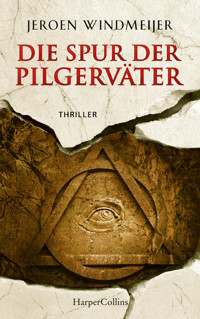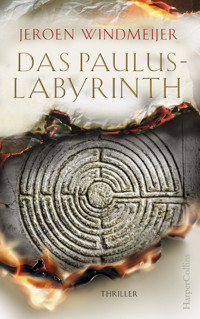
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Peter-de-Haan-Thriller
- Sprache: Deutsch
Archäologische Sensation und grausiger Fund zugleich: Durch einen Unfall bei einer feierlichen Ausgrabungszeremonie in Leiden wird ein unbekannter Tunnel freigelegt. Der Archäologe Peter de Haan wittert eine einmalige Entdeckung, schließlich blickt die Universitätsstadt auf eine jahrtausendealte Geschichte zurück. Doch als de Haan als erster die Einsturzstelle in Augenschein nimmt, findet er den blutverschmierten Körper eines Mannes. Wer wusste von dem Tunnelsystem und hat ihn dorthin gebracht? Für Peter de Haan ist dies nur das erste Rätsel von vielen, die ihm den Weg zu einem mysteriösen vorchristlichen Geheimbund weisen.
»Ein gut geschriebener Actionthriller mit Tiefgang.« Nederlands Dagblad
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
HarperCollins®
Copyright © 2019 by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Titel der niederländischen Originalausgabe: Het Pauluslabyrint Copyright © 2017 by Jeroen Windmeijer erschienen bei: HarperCollins Holland
Published by arrangement with HarperCollins Holland
Covergestaltung: HarperCollins Germany / Deborah Kuschel, Artwork Wil Immink Design Coverabbildung: Wil Immink Design E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959678742
www.harpercollins.de
ZITAT
»Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise, und mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.«
Johannes 6,54-56
PROLOG
Mérida (Hispania), 72 A. D.
Mit einem Schnitt seines scharfen Dolchs schlitzt der Henker den Bauch des Gefangenen auf. Blut strömt heraus, sprudelnd wie Wasser, das einen Deich durchbricht. Der Mann schreit vor Qual, als seine Eingeweide wie enthäutete Schlangen bis kurz oberhalb seiner Knie quellen. Dann kommen die Vogelmänner; Adler balancieren auf ihren geschützten Unterarmen. Mit ihren spitzen Schnäbeln hacken die Greife gierig große Stücke aus der frei liegenden Leber. Die drei anderen Männer, die an Holzpfählen festgezurrt und zum gleichen Schicksal verdammt sind wie der Gequälte, versuchen verzweifelt, sich loszureißen.
Das Publikum tobt. Die drei Ränge des Amphitheaters, das unter Kaiser Augustus erbaut wurde und sechzehntausend Menschen fasst, sind heute bis auf den letzten Platz gefüllt.
Nach der venatio, der Hetze auf Raubtiere, werden die Zuschauer mit Hinrichtungen unterhalten. Während der nicht gerade überwältigenden Eröffnungsnummer, bei der nur ein paar Kriminelle unspektakulär enthauptet wurden, nutzten viele die Gelegenheit, sich auf den öffentlichen Latrinen in den Katakomben zu erleichtern.
Das Publikum schätzt die Kreativität, mit der die Exekutionen inszeniert werden, oft inspiriert von Geschichten aus dem antiken Griechenland. Nachdem die Adler die Lebern der vier Männer gefressen haben – wie in der Sage von Prometheus – und sie gestorben sind, werden vier Holzrampen in die Arena geschoben. Auf jeder Rampe befindet sich ein riesiger Felsbrocken, und Sträflinge müssen versuchen, diesen wie Sisyphus das Gefälle hinaufzurollen. Natürlich gelingt es keinem von ihnen, und das Knacken ihrer brechenden Knochen ist bis hinauf in den dritten Rang zu hören.
Dann werden wieder andere Männer in die glühend heiße Arena geschickt. Seit Tagen haben sie nichts zu essen und zu trinken bekommen, und nun werden ihnen Brot und Krüge mit Wasser an langen Stangen von den Tribünen hinunter dargeboten. Kurz bevor die Schmachtenden sie erreichen, werden die Stangen zum großen Vergnügen der Menge hoch über ihre Köpfe gehoben, was das Brot und Wasser für sie so unerreichbar macht wie für Tantalus. Wenn die Aufmerksamkeit des Publikums erlahmt, werden ausgehungerte Hunde freigelassen, um die Männer in Stücke zu reißen.
Zum Schluss werden noch acht mit Pech und Öl beschmierte Männer in den Ring gebracht und an Pfähle gebunden. Römische Jungen, noch keine zwölf Jahre alt, schießen mit brennenden Pfeilen auf die Gefangenen, bis sie schließlich Feuer fangen. Während die Männer schreiend ihr Ende finden, geht ein anerkennendes Raunen durch das Amphitheater. Zwar scheint es hierfür keine mythische Vorlage zu geben, aber so etwas wurde bisher noch nie gezeigt.
Ein verspäteter Besucher erklimmt die Tribüne und sucht sich einen Platz am Ende einer der Bänke. Zwar ist er klein und hat krumme Beine, aber er ist ansonsten gut gebaut. Seine Augenbrauen treffen sich über der langen Nase. Er ist ein charismatischer Mann und strahlt die erhabene Gelassenheit eines Engels aus. Ein kurzer Blick auf den jüngeren Mann, der bereits am Ende der Bank sitzt, genügt, damit dieser ihm Platz macht. Der Mann setzt sich hin und stellt einen kleinen irdenen Krug auf den Boden zu seinen Füßen.
Während die toten Verbrecher aus der Arena geschleift und die Blutflecken mit frischem Sand bedeckt werden, unterhalten Musiker und Narren nach Kräften das Publikum mit akrobatischen Possen. Die Menge jubelt, als Dutzende von Jungen und Mädchen mit großen Brotkörben zwischen sich die Tribünen hinauflaufen. Vor zwei Jahren hat man begonnen, bei den Spielen Brot zu verteilen, und die Praxis wurde bei den Bürgern so beliebt, dass sie sich rasch bis in alle Ecken des Reiches verbreitet hat. Während sie die Treppe hinaufgehen, werfen die Jungen und Mädchen Brote in die Menge. Ein Wald von Armen reckt sich dort in die Luft, wo die Laibe hinfallen. Einmal erwischt, werden sie schnell unter den Gewändern verstaut, sodass die Hände frei bleiben, um sich noch mehr zu schnappen.
»Panem et tauros«, sagt der junge Mann spöttisch zu dem älteren neben ihm. Brot und Stiere. Er nimmt den Laib, der ihm buchstäblich in den Schoß gefallen ist, und schleudert ihn achtlos im hohen Bogen hinter sich.
Die meisten Leute sind aus diesem Grund heute gekommen, wegen des Brotes, aber nicht zuletzt auch, um den Stierkampf zu sehen.
Der editor muneris, der Sponsor der heutigen Spiele, gibt mit einem markigen Ave-Gruß den Befehl zur Freilassung des Bullen. Ein ohrenbetäubender Jubel erfüllt die Arena. Der editor blickt sich zufrieden um und kehrt zurück auf sein Lager. Er nimmt ein kleine Traube Weinbeeren vom üppig gedeckten Tisch neben sich und beobachtet, wie der riesige, wild buckelnde Stier ins Amphitheater stürmt. Das Tier wurde vorher vierundzwanzig Stunden lang in einem kleinen Verschlag eingesperrt und zwangsweise mit Salz gefüttert, ohne einen Tropfen Wasser. Mit Sandsäcken haben sie ihm gegen den Bauch geschlagen, um innere Blutungen zu verursachen. Das Spiel wurde manipuliert, bevor es überhaupt begonnen hat. Er kann heute nicht gewinnen.
Jetzt betreten die ministri die Arena, die Diener, die versuchen, den Stier mit großen Capes abzulenken. Dadurch verschaffen sie sich einen Eindruck von seiner Stärke, seiner Intelligenz und seinem Kampfgeist. Mutig und unerschrocken schwenken sie die bunten Umhänge und weichen geschickt den Angriffen des Bullen aus. Der Jubel des Publikums rauscht von den Tribünen in die Arena wie das Wasser eines Flusses, der einen Berg hinunterstürzt.
Der Stier wird für kampfwürdig befunden. Vier als Götter verkleidete venatores, Jäger, die nur mit einem Lendenschurz gegürtet und mit einem ins Haar geflochtenen Ährenkranz geschmückt sind, kommen zu Pferd durch die vier Tore des Schlachtfeldes. Jeder trägt ein verutum, einen Jagdspeer, in der rechten Hand. Ihre Pferde werden von schweren Rüstungen geschützt und sind sichtlich verängstigt, aber ihre Stimmbänder wurden durchtrennt, sodass sie nicht wiehern können.
Sie nähern sich dem Stier aus vier Richtungen, und er weiß nicht, welches Pferd er zuerst angreifen soll, doch der Kreis schließt sich immer enger um ihn, bis er gezwungen ist, sich auf den nächsten Reiter zu stürzen. Sobald er sich einem der Pferde nähert, steht der Reiter in den Steigbügeln auf, um ihm das verutum in den Hals zu bohren und sich mit seinem ganzen Gewicht darauf zu stützen. Nach mehreren Angriffen, bei denen jeder venator mindestens einmal seinen Speer in den Hals des Stieres gebohrt hat, ziehen sich die Reiter unter lautem Applaus zurück. Der Stier ist benommen und steht mit gesenktem Kopf da. Blut tropft aus seinen Wunden auf den Boden.
Dann kommt der mactator, der Star der Show, der Stiertöter, der Mann, der der Sache ein Ende bereiten wird. Er ist ein Hüne, bekleidet nur mit einer einfachen, kurzen Tunika. Seine Arme sind nackt, und an den Unterschenkeln trägt er Beinschützer. In den Händen hält er mit Bändern verzierte, armlange Stöcke mit Widerhaken an den Enden. Er geht geradewegs auf den Stier zu. Je entschlossener er seinem imaginären Weg folgt, desto mehr bewundert die Menge seinen Mut. Die meisten Leute sitzen jetzt wieder auf ihren Plätzen, und statt der Jubelrufe und Schreie, die eben noch jedes Gespräch unmöglich gemacht haben, herrscht Stille, als hielte das Publikum kollektiv den Atem an. Der Stier reagiert auf die neue Bedrohung, indem er mit einem Vorderhuf im Sand scharrt. Mit unartikuliertem Gebrüll zieht der mactator endgültig die Aufmerksamkeit des gesamten Amphitheaters auf sich. Als er nur noch wenige Schritte vom Stier entfernt ist, stürmt dieser auf ihn los. Der taurarius, der Stierkämpfer, wirbelt um die eigene Achse, um ihm auszuweichen, und noch bevor er seine Pirouette beendet hat, sticht er dem Bullen einen der beiden Spieße mit den Widerhaken zwischen die Schulterblätter. Die Arena tobt vor Begeisterung, so elegant war die Parade, so perfekt platziert die Lanze. Jetzt rennt der mactator vor dem Stier davon. Dann schlägt er einen Haken und sticht mit einem mächtigen Sprung den zweiten Speer in gleicher Höhe neben den ersten.
Wer glaubt, der Bulle hätte aufgegeben, hat sich getäuscht. Es ist, als wüsste das Tier, dass dies seine letzte Chance ist, seinen Angreifer zu verwunden. Es sammelt noch einmal seine ganze Kraft und hebt den Kopf, wobei Blut aus seinen Wunden sprudelt und ihm lange, blutige Schleimfäden aus dem Mund hängen.
Der taurarius nähert sich der Loge des editors, kniet sich mit einem Bein in den Sand und senkt das Haupt. Der editor reagiert mit einem kurzen, anerkennenden Nicken, woraufhin der venator am Osttor nach vorne kommt, um dem mactator eine besondere Kopfbedeckung aufzusetzen – eine weiche, rote konische Mütze mit nach vorn fallender Spitze – und ihm das linteum zu überreichen, ein halbkreisförmiges Tuch aus rotem Flanell, das über eine Holzstange drapiert ist.
Der taurarius kehrt zurück zum Stier, der mit erneuter Energie einige verzweifelte Angriffe auf das flatternde Tuch unternimmt, mit dem er gereizt wird. Die Zuschauer reagieren begeistert und spornen den Stierkämpfer an, noch größere Risiken einzugehen. Dies ist die gefährlichste Phase des Kampfes, denn jede noch so kleine Unaufmerksamkeit könnte fatal sein. Der vor Angst und Schmerz halb wahnsinnige Stier könnte in einem letzten Versuch, den Tod abzuwenden, den mactator tödlich verwunden, indem er ihn auf die Hörner nimmt und seinen ungeschützten Bauch durchbohrt.
Aber da ertönt schon das befreiende Trompetensignal, und der venator, der sich am westlichen Tor aufgestellt hat, kommt herbeigeeilt. In einer Hand trägt er ein leichtes Krummschwert mit einem Griff in Form einer Schlange, die falcata, in der anderen eine brennende Fackel. Er übergibt die falcata dem mactator und nimmt seinen Platz hinter der linken Flanke des Bullen ein. Dies ist die hora veritatis, die Stunde der Wahrheit, in der der mactator das Tier von seinen Leiden erlöst, indem er ihm das Schwert zwischen die Schulterblätter stößt und sein Herz durchbohrt.
Er stellt sich vor das erschöpfte Tier, das jetzt zu müde ist, um noch den Kopf zu heben. Mit der linken Hand auf seiner Stirn zwingt er es zu Boden, eine Geste, die dem Publikum einen Seufzer der Bewunderung entlockt.
Ein minister stürmt von der Ostseite der Arena herüber, in der einen Hand einen silbernen Kelch und in der anderen eine lodernde Fackel, die zu Boden zeigt.
Der Stier liegt jetzt im Sand. Der mactator setzt sich rittlings auf ihn, ein Knie in seiner rechten Flanke, das andere Bein auf dem Boden. Mit der linken Hand zieht er den Kopf des Stieres am Horn zurück und reckt den rechten Arm in die Luft. Die Klinge seiner falcata blinkt in der Sonne. Und dann, mit einer schnellen, treffsicheren Bewegung, schneidet er dem Tier die Halsschlagader durch. Blut spritzt heraus, und nachdem mehrere pulsierende Fontänen den Sand durchtränkt und rot gefärbt haben, haucht der Stier schließlich sein Leben aus. Das Krummschwert steckt ihm bis zum Heft im Hals, sodass die Schlange am Griff die Wunde des Bullen zu lecken scheint.
»Sanguis eius super nos et super filios nostros«, murmelt der alte Mann auf der Tribüne wie in einem hoffnungsvollen Gebet. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.
Der mactator fährt sich mit den blutbefleckten Händen über sein Gesicht, als würde er sich mit dem Blut waschen. Er bietet jetzt einen Furcht einflößenden Anblick; das Blut hat sich mit Sand und Schweiß vermischt, aber er wirkt ungerührt und starrt auf einen imaginären Punkt in der Ferne.
»Et nos servasti eternali sanguine fuso«, flüstert der alte Mann. Auch uns hast du gerettet, indem du ewig machendes Blut vergossen hast. Der Mann zieht ein Stück Brot aus dem Ärmel und reißt ein Stück davon ab, während er starr das Spektakel in der Arena verfolgt.
Der taurarius zieht die Klinge noch einmal heraus, diesmal, um ein Stück Fleisch vom Stier zu schneiden. Er zeigt es dem Publikum, steckt es in den Mund und schluckt es, ohne zu kauen, herunter.
»Accipite et comedite, hoc est corpus meum quod pro vobis datur.«Nehmt dies und esst; das ist mein Leib, der für euch gegeben wurde.
Der alte Mann schließt die Augen, steckt sich das Stück Brot in den Mund und kaut sorgfältig, als schmecke er zum ersten Mal in seinem Leben Brot.
Der mactator nimmt den Kelch von dem venator hinter ihm und füllt ihn mit Blut aus dem Hals des Bullen. Auch ihn zeigt er dem Publikum, bevor er ihn mit einem langen Schluck leert.
»Bibite, hic est sanguis meus qui pro multis effunditur.« Trinkt, das ist mein Blut, das für viele vergossen wurde. Der alte Mann hebt den kleinen Tonkrug zu seinen Füßen auf, zieht den Korken heraus, nimmt einen Schluck, spült den Wein im Mund herum und schluckt ihn dann herunter.
Die ekstatische Menge skandiert den Namen des taurarius, und er steht auf, um seine Ehrenrunde zu drehen. In der Zwischenzeit schneidet ein venator mit einer Schere in Form eines Skorpions die Hoden des Bullen ab. Diese gelten als starkes Aphrodisiakum und werden später dem editor dargereicht.
»Iste, qui nec de corpore meo ederit nec de mea sanguine biberit ut mecum misceatur et ego cum eo miscear, salutem non habebit«, beendet der alte Mann sein Ritual. Wer nicht von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, damit er in mir bleibt und ich in ihm, der wird das Heil nicht erlangen.
Ein Hund, der aus den Katakomben entwischt ist, nutzt seine Chance, sich dem Stier zu nähern und an dem Blut zu lecken, das noch aus seinem Hals fließt. Ein minister versetzt ihm einen gezielten Tritt in den Bauch, und er macht sich davon, mit roten Zähnen und Lefzen.
Die Leute klettern auf die Bänke und winken mit weißen Tüchern, um ihre Anerkennung für den Mut des taurarius und die Eleganz zu zeigen, mit der er gekämpft hat. Ein paar Männer springen in die Arena und nehmen den Stierkämpfer auf die Schultern. In einem Regen von Blumen und geflochtenen Ährenkränzen tragen sie ihn in die Runde. An den Hinterbeinen des leblosen Stieres werden zwei Seile befestigt. Ein Teil des Applauses gilt sicherlich auch ihm, als er, eine blutige Spur im Sand hinterlassend, aus der Arena geschleift wird. Sein Fleisch kommt heute Abend bei den wohlhabenden Familien der Stadt auf den Tisch. Ein kleines Vermögen wird für den Schwanz bezahlt werden, der, mit viel Zwiebeln und Wein geschmort, als Delikatesse gilt.
Der alte Mann steht auf und wirft noch einen letzten Blick auf die Arena hinter ihm, wo nur die Blutspur im Sand in Richtung des östlichen Eingangs noch an den ungleichen Kampf erinnert, der hier stattgefunden hat.
»Consummatum est«, sagt er zufrieden. Es ist vollbracht.
CORAX
RAVEN
1
Leiden, 20. März 2015, 13:00 Uhr
Theoretisch war das Seminar von Peter de Haan bereits vorüber. In seiner Einführung in die Geschichte von Leiden für Masterstudierende hatte er einen Überblick über die wichtigsten Kirchen Leidens gegeben. Die Veranstaltung war Teil eines Wahlmoduls, aber er füllte damit jedes Jahr den kleinen Hörsaal. Das tat ihm natürlich gut, und er hatte aufgehört, sich darüber zu wundern.
Einige Studierende waren schon dabei, ihre Sachen wegzupacken, hatten es aber noch nicht gewagt, ihre Plätze zu verlassen. Ein junger Mann beobachtete ihn wie ein Hund, der auf den Befehl seines Herrchens wartete.
Auf die Leinwand hinter ihm wurde eine Luftaufnahme der Hooglandse Kerk projiziert. Was Anfang des vierzehnten Jahrhunderts nichts weiter als eine kleine Holzkapelle gewesen war, war im 16. Jahrhundert zu einer Kathedrale herangewachsen, die in ihren Ausmaßen nicht mehr recht in ihre Umgebung passte, so wie ein überdimensionales Sofa in einem Wohnzimmer. Auf dem Foto war auch die Burg von Leiden gut zu sehen, das prägende Bauwerk der Stadt, im Grunde eine kreisförmige, sechs Meter hohe, zinnenbewehrte Steinmauer, die auf einer Motte stand, einem zwölf Meter hohen künstlichen Hügel aus dem elften Jahrhundert.
Peter hob die Hand, und das leise Gemurmel im Raum verstummte sofort. »Ich weiß, dass ihr alle zum Mittagessen gehen wollt«, sagte er mit einem Hauch von Zögern in seiner Stimme, »aber wer von euch will heute Nachmittag zusehen, wie der erste unterirdische Abfallbehälter vor der Stadtbibliothek versenkt wird?«
Die meisten Studierenden sahen ihn freundlich an, aber niemand antwortete.
»Ihr wisst doch, dass heute um vierzehn Uhr in der Stadt das Großprojekt startet, bei dem diese unterirdischen Container aufgestellt werden?«
»Nein, das wusste ich nicht, Meneer«, sagte ein junger Mann höflich und hielt beim Sprechen die ganze Zeit die Hand in der Luft. »Aber warum sollten wir uns dafür interessieren?«
»Wie nett von dir, wenigstens zu fragen«, antwortete Peter.
Ein paar Leute lachten leise. Die Studierenden hielten mit ihrem Rumoren inne und fanden sich damit ab, dass sie noch einen Moment festsaßen.
Peter zog mit seinem Laserpointer einen Kreis um die Kirche auf der Leinwand.
»Vielleicht überrascht es euch, aber es ist nicht viel über Leidens Ursprünge und seine Entwicklung bekannt. Im Zentrum einer Stadt archäologische Grabungen durchzuführen, ist immer schwierig, ganz einfach deswegen, weil alle Flächen, auf denen man gerne graben würde, bebaut sind. Diejenigen von euch, die sich später mit Stadtarchäologie befassen, werden dies ganz sicher noch feststellen. Ganz selten bietet sich Archäologen die Gelegenheit zu kurzen Bodenuntersuchungen, wenn zum Beispiel ein Gebäude abgerissen wird, aber das kommt, wie gesagt, nicht oft vor. Dieses Projekt bringt es mit sich, dass wir an buchstäblich Hunderten von Stellen in der ganzen Stadt bis zu drei Meter tief in die Erde gehen können. Wer weiß, was sich unter unseren Füßen alles verbirgt?«
»Oder welche Leichen wir im Keller finden«, bemerkte der junge Mann.
»Genau!«, antwortete Peter begeistert. »Es sieht jetzt so aus, als hätte ich das für heute geplant, aber es sollte eigentlich mein nächstes Thema sein. Schaut mal …«
Mit dem roten Lichtstrahl folgte er der Nieuwstraat. »Diese Straße war früher eine Gracht, aber wie viele der anderen Grachten in Leiden wurde sie zugeschüttet. Manche Grachten wurden überbaut, was bedeutet, dass sie nicht mit Sand und Schutt gefüllt wurden, sondern nur eine Abdeckung erhielten, über der dann die Straße angelegt wurde. In manchen kann man noch ein Stück unterirdisch gehen, wie durch einen Tunnel, aber diese Gracht wurde zugeschüttet. Der Friedhof war hier, auf der anderen Seite der Kirche, aber auf dieser Seite, also rings um die ehemalige Gracht und neben der Kirche, wurden früher manchmal heimlich Leute begraben. Es waren solche, die es sich nicht leisten konnten, in der Kirche bestattet zu werden, die aber so nah wie möglich bei der Kirche ruhen wollten.«
Das Handy in der Innentasche seiner Jacke begann zu vibrieren.
Er sah sich im Hörsaal um. Wenn er so weitermachte, würde er zu einem Onkel werden, der auf Partys endlos über die Vergangenheit schwadronierte. »Ihr könnt jetzt gehen«, sagte er stattdessen. »Ich sehe euch dann alle heute Nachmittag!«
Sofort erwachte der Raum zum Leben, als hätte man ein angehaltenes Video wieder eingeschaltet. Auf dem Weg zur Tür gingen die Studierenden alle an seinem Pult vorbei, um ihre Arbeiten abzugeben. Für das Seminar mussten sie alle vierzehn Tage einen kurzen Essay über eines der behandelten Themen einreichen.
Der Raum war leer. Peter schaltete den Beamer aus und packte seine Sachen zusammen. Als er den Stapel Papiere aufhob, fiel zwischen ihnen ein unbeschriebener Umschlag heraus. Er nahm ihn in die Hand und sah ihn sich an. Wahrscheinlich eine Nachricht von einem Studierenden, der sich dafür entschuldigte, dass er durch verschiedene Umstände die Aufgabe für diese Woche nicht erledigen konnte.
Peter wollte den Umschlag gerade öffnen, als Judith zur Tür hereinschaute.
Sie lächelte. »Du hast mich doch nicht vergessen, oder?«
»Wie könnte ich je eine Verabredung mit dir vergessen?«, erwiderte Peter, während er den Umschlag zu den übrigen Papieren in seine Tasche steckte.
Er hatte Judith Cherev, eine Frau Anfang vierzig, vor zwanzig Jahren kennengelernt, als er ihre Abschlussarbeit betreut hatte. In den Jahren darauf waren sie enge Freunde geworden. Sie hatte für ihre Doktorarbeit die Geschichte des Judentums in Leiden untersucht. Heute war sie Dozentin im Fachbereich Geschichte und freiberuflich als Forscherin für das Jewish Historical Museum in Amsterdam tätig.
Ihre dunklen Locken, hier und da von einer charmanten grauen Strähne durchzogen, hatte sie lässig mit einem dicken Zopfgummi im Nacken zusammengebunden. Sie war immer noch eine schöne Frau, schlank und wie immer in eine Bluse und einen langen Rock gekleidet. Der Davidstern-Anhänger, den sie um den Hals trug, schimmerte im Licht der Leuchtstoffröhren.
»Hast du mir gerade eine Nachricht geschickt?«
Judith schüttelte den Kopf.
Peter nahm das Handy aus der Jacke und öffnete die Nachricht.
Hora est.
Er lächelte.
»Was ist denn?«
»Ich glaube, einer meiner Studis wollte mich wissen lassen, dass es Zeit war, mit dem Reden aufzuhören.«
Er ging mit der Tasche unter dem Arm zur Tür und schaltete das Licht aus. Unterwegs zeigte er Judith die Nachricht.
Hora est – es ist Zeit – war der Satz, mit dem der Universitätsdiener nach exakt einer Dreiviertelstunde hereinkam, wenn Doktorandinnen oder Doktoranden ihre Doktorarbeit vor dem Promotionsausschuss verteidigten. Ab dann durften die Kandidaten nicht mehr sprechen, selbst wenn sie mitten in einem Satz waren. Für die meisten bedeuteten die Worte eine große Erleichterung.
»Ziemlich witzig«, meinte Judith und gab ihm das Handy zurück. »Aber komisch, dass die Nachricht anonym verschickt wurde.«
»Wahrscheinlich aus Angst, der Witz würde ihn oder sie Punkte kosten.« Peter löschte die Nachricht. Als er den Hörsaal abschließen wollte, bemerkte er, dass jemand ein Handy auf einem der Tische liegen gelassen hatte, ein iPhone, das brandneu aussah. Er ging wieder hinein und steckte es in die Jackentasche. Derjenige, dem es gehörte, würde sicher bald bei ihm im Büro vorbeischauen, schließlich waren die Studierenden praktisch mit ihren Handys verwachsen.
Sie gingen zusammen hinaus und machten sich auf den Weg zur Mensa im Lipsiusgebäude. Es hieß schon seit Jahren so, aber Peter nannte es immer noch LAK, nach dem ehemaligen Theater- und Kulturzentrum, das sich früher darin befunden hatte.
»Mark ist wahrscheinlich schon da«, sagte Judith fast zärtlich. »Du kennst ihn ja. Ein Uhr bedeutet für ihn ein Uhr.«
Mark war Professor an der theologischen Fakultät, ein brillanter Mann, der lange Zeit unter psychischen Problemen gelitten hatte. Judith und er führten eine LAT-Beziehung, living apart together. Im Grund lebten sie zusammen, nur hatten sie eben beide ihre bescheidenen Wohnungen im Sionshofje behalten. Zusammenzuziehen hätte für sie bedeutet, eine neue Bleibe suchen zu müssen, und keiner von beiden wollte die idyllische alte Anlage rings um den malerischen Innenhof verlassen.
In der Mensa saßen Studierende, Dozentinnen und Dozenten an langen Tischen und aßen zu Mittag. Ein monotones Stimmengewirr, Klirren von Geschirr und Besteckklappern erfüllten den Raum. Die Wärme und die Küchendünste erzeugten eine etwas stickige Atmosphäre.
Wie Judith vorhergesagt hatte, saß Mark bereits an einem Tisch und hielt zwei Plätze für sie frei. Er winkte.
Auf dem Weg zu ihm gingen sie am Buffet vorbei. Peter nahm einen extra großen Salat und ein Glas frisch gepressten Orangensaft, Judith holte sich eine Suppe mit einer Scheibe Brot und Käse.
»Gut so«, sagte Judith und klopfte Peter scherzhaft auf den Bauch.
Mark war bereits halb fertig mit dem Essen, als sie sich setzten. Judith hauchte ihm einen Kuss auf die Wange, was Peter selbst nach den vielen Jahren noch einen Stich der Eifersucht versetzte.
»Was habt ihr denn heute Nachmittag vor?«, fragte Peter.
»Ich habe um zwei Uhr einen Termin mit einem älteren Herrn, der einige Stücke von seiner jüdischen Großtante geerbt hat«, sagte Judith. »Er hat mich über das Museum ausfindig gemacht. Ich gehe mal bei ihm vorbei und sehe mir an, ob etwas für unsere Sammlung dabei ist.«
»Klingt interessant«, meinte Peter.
»Ach, ehrlich gesagt lohnt es sich nur selten. Aber ab und zu taucht doch mal etwas Besonderes auf. Es ist ein bisschen wie in ›Bares für Rares‹. Tagebücher oder Briefe aus einem Konzentrationslager oder einfach nur interessante Alltagsgegenstände wie Küchenutensilien, Werkzeuge und so weiter. Man kann nie wissen. Ich habe trotzdem meistens meinen Spaß daran. Die Leute suchen oft nur jemanden, mit dem sie reden können.«
»Langeweile ist dir fremd, was?«
»Stimmt, so etwas kenne ich nicht«, bestätigte sie. »Heute Abend möchte ich dann ein Seminar für Montag vorbereiten, also nichts Besonderes im Grunde. Ich bin die nächsten Tage allein.« Sie legte Mark die Hand auf den Arm.
»Ja«, sagte Mark. »Ich fahre mal wieder nach Deutschland. Eine Woche ohne Telefon, ohne Internet, für kurze Zeit ganz und gar abgeschnitten vom Rest der Welt. Einfach herrlich!«
Ein- bis zweimal im Jahr zog sich Mark irgendwo tief in die deutschen Wälder zurück, um »nachzudenken«, wie er sagte. Er hatte dort nicht mal Handyempfang. Judith neckte ihn mit seiner heimlichen Geliebten, aber sie wusste, dass er so ein Retreat ab und zu brauchte, um aufzutanken. Er kam jedes Mal belebt und voller Energie zurück. Der einzige Kompromiss bestand darin, dass er sich hin und wieder in die Zivilisation begab, um Judith anzurufen und ihr Bescheid zu sagen, wie es ihm ging.
»Und heute Nachmittag«, fuhr Mark fort, »möchte ich noch ein paar Stunden an einem Artikel arbeiten, den ich mit Fay Spežamor zusammen schreibe, du weißt schon, der tschechischen Geschichtsexpertin, Kuratorin für römische und etruskische Kunst im Museum für Völkerkunde.«
»Ja, ich habe sie ein paarmal getroffen«, sagte Peter. »Und seltsamerweise ist ihre Handynummer die einzige, die ich auswendig kenne. Wenn man sich die ersten beiden Zahlen merkt …«
»… muss man immer nur zwei addieren«, beendete Mark seinen Satz.
Eine Weile lang schwiegen sie.
»Und, was hast du heute Nachmittag vor?«, fragte Mark.
»Ich gehe in die Stadt, da findet in der Nieuwstraat eine kleine Feier zum Start des neuen Projekts mit den unterirdischen Containern statt. Die Grube interessiert mich, und ich habe das Projekt von Anfang an mitverfolgt. Die Behörde für Kulturerbe hat mich eingeladen. Daniel Veerman und Janna Frederiks sind auch da. Sie haben versprochen, mich zu informieren, falls sie in der Baugrube auf etwas Interessantes stoßen.«
»Ach, übrigens, ich wollte euch auch etwas zeigen«, sagte Mark völlig aus dem Zusammenhang, als hätte er Peter gar nicht zugehört. Er schob sein Tablett zur Seite. Darunter befand sich ein großer Umschlag, der mit einer sauberen, unverkennbar altmodischen Handschrift versehen war.
»An den hochwohlgeborenen, gelehrten Professor Doktor M. Labuschagne«, las er amüsiert vor. »Ich muss dem Absender heute Nachmittag eine kurze Antwort schicken.« Er zog einen dicken Stapel mit Schreibmaschine beschriebener Seiten aus dem Umschlag. »Das ist wieder mal so etwas …«, murmelte er und blätterte sie durch, als suche er nach etwas Bestimmtem. »Seitdem ich promoviert habe, schicken mir die Leute andauernd solche Sachen. Amateure, die mir unbedingt mitteilen wollen, dass sie den Code des Buchs der Offenbarung geknackt oder den ultimativen Beweis dafür gefunden haben, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist.«
»Oder dass der Apostel Petrus in Leiden begraben ist«, scherzte Judith.
Sie lachten.
»Aber das hier … Wisst ihr, normalerweise ist es Unsinn, und man könnte es genauso gut gleich in den Papierkorb werfen, aber ich hebe alles auf. Eines Tages will ich vielleicht etwas damit anfangen. Manchmal erscheinen einem bestimmte Ideen verrückt, und alle Welt hält den Urheber für vollkommen übergeschnappt, dabei sind diese Leute teilweise einfach ihrer Zeit weit voraus. Dies hier habe ich heute erhalten, von einem Meneer …« Er sah sich das Titelblatt an. »Meneer Goekoop aus Zierikzee. Es geht um die Burg. Er behauptet, sie habe ursprünglich eine astrologische Funktion gehabt. Schau, er hat sogar ein paar Zeichnungen beigelegt.«
Mark hielt ein Blatt Papier mit einer überraschend genauen Federzeichnung der Burg von Leiden hoch, auf der der Raum zwischen den Zinnen frei gelassen worden war, sodass das Ganze einem Steinkreis ähnlich wie Stonehenge glich.
»Er hat eine vollständige Theorie aufgestellt, darüber dass bei der Sonnenwende am 21. März die ersten Sonnenstrahlen genau durch das Haupttor der Burg fallen, unter Berücksichtigung der Präzession der Erde, also der Richtungsänderung der Erdachse. Man kann die Erde mit einem Kreisel vergleichen, der nicht genau senkrecht steht, es ist etwas kompliziert … Durch verschiedenste Berechnungen versucht er zu beweisen, dass die ursprüngliche Burg vor mehr als zweitausend Jahren erbaut worden sein muss. Ihm zufolge leitet sich das Wort Megalith vom griechischen mega-leithos oder Groß-Leiden ab.«
»Das lässt sich leicht überprüfen. Morgen ist der 21. März.«
»So einfach ist es leider nicht. Die Erdachse hat sich seit damals verschoben. Wie auch immer, diese Geschichte mit Megalith ist natürlich Unsinn und der Rest wahrscheinlich auch. Schaut mal, er glaubt, einen weiteren Beweis für seine Theorie in den drei Bäumen in der Mitte der Burg gefunden zu haben. Weil sie genau so angeordnet sind wie die drei Sterne an Orions Gürtel. Du weißt schon, wie die Pyramiden in Ägypten.«
»Und der Rhein soll wohl der Nil sein?«
»Nein, er sagt, dass der Rhein die Lethe oder Leythe ist, einer der fünf Flüsse der Unterwelt in der griechischen Mythologie, genau wie der Styx. Ihm zufolge hat der Name Leythe natürlich auch etwas mit Leiden zu tun.«
»Dass du damit deine Zeit verschwendest!«, bemerkte Peter.
»Es amüsiert mich. Man weiß nie, was sich die Leute alles ausdenken. Manchmal machen Amateure überraschende Entdeckungen. Aber was mich an dieser Geschichte fasziniert, ist seine Theorie von der Burg als Mittelpunkt eines Sonnenkults. Und was den Namen Lugdunum angeht, hat er gar nicht so unrecht.«
»Der römische Name für Katwijk.«
»Genau. Er vermutet allerdings, dass es ursprünglich der Name des Hügels war, auf dem die Burg steht. Lug ist der Name des keltischen Sonnengottes, und dunum bedeutet so viel wie ›Hügel‹ oder ›Berg‹. ›Lug-Hügel‹ oder, etwas freier übersetzt, ›der Hügel, auf dem Lug verehrt wird‹.«
»Mit dieser Art von Argumentation«, konterte Peter, »könnte man glatt beweisen, dass der Name von Goekoops Heimatstadt Zierikzee auf die griechische Göttin Circe zurückgeführt werden kann und dass Troja daher irgendwo in Zeeland gelegen haben muss.«
Mark schob die Seiten wieder in den Umschlag. »Trotzdem schicke ich diesen Leuten immer eine höfliche Antwort. Das reicht normalerweise, um sie zufriedenzustellen.«
Judith nahm ihr Tablett. Sie hatte ihre Suppe und ihr Brot bereits aufgegessen.
»Gehst du schon?«, fragte Peter, ein wenig enttäuscht.
»Ja, ich habe doch um zwei den Termin und muss noch zurück ins Büro, um meine Sachen zu holen. Wenn du Lust hast, könnten wir ja heute Abend ein Glas zusammen trinken.«
Peter nickte.
Judith legte kurz die Hand auf Marks Schulter, und er neigte den Kopf zur Seite und schmiegte sich daran wie eine Katze. Judith zwinkerte Peter zu und brachte ihr Tablett zur Spülküche.
»Lug also«, sagte Peter und brachte sie damit wieder zurück zu ihrem Gespräch.
»Ja, Lug, aber es hat natürlich im Laufe der Jahrhunderte viele andere Sonnengötter gegeben. Ein faszinierendes Thema, und genau davon handelt auch der Artikel, an dem ich heute Nachmittag arbeiten will. Er ist ein bisschen populärwissenschaftlich. Es geht darum, dass diese Sonnengötter immer am dritten Tag nach der Wintersonnenwende geboren wurden, am Abend des 24. Dezember, um so symbolisch die Ankunft des Lichts in einer dunklen Welt zu feiern. Die Mutter ist Jungfrau, sie werden in der Regel in einer Höhle geboren, es erscheint ein Stern, sie werden von Hirten verehrt, Könige kommen mit Geschenken, ein weiser Mann sagt voraus, dass dies der Retter ist, auf den die Welt gewartet hat, und so weiter.«
»Ja, ich kenne diese Geschichten. Übrigens, hast du heute Morgen noch etwas von der Sonnenfinsternis mitbekommen?«
»Nein, ehrlich gesagt habe ich nicht darauf geachtet.«
»Es war sowieso bewölkt, wahrscheinlich war kaum etwas zu sehen.«
»Stimmt, aber … wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die Sonnengötter. Sie sterben immer um die Zeit der Frühlingssonnenwende herum und erstehen drei Tage später wieder auf. Attis, Osiris, Dionysos, du kannst es dir aussuchen. Der Gott oder der Gottessohn stirbt, einen Tag lang wird getrauert, und am dritten Tag herrscht dann eine Riesenfreude, wenn der Gott von den Toten wiederaufersteht. Genau wie die Natur, die im Winter gestorben zu sein scheint, aber dann wieder zum Leben erwacht.«
Peter hatte natürlich darüber gelesen, wie verwirrt die frühen Kirchenväter gewesen waren, als sie die Ähnlichkeiten zwischen den Evangelien und diesen anderen Geschichten entdeckten, die offensichtlich viel älter waren. Sie fanden keine andere Erklärung, als dass die älteren Geschichten Teufelswerk sein mussten. Satan musste von den Umständen gewusst haben, unter denen Jesus geboren werden würde, und hatte deshalb schon Jahrhunderte im Voraus die Riten der Sonnengötter eingeführt, um die Menschen zu verblenden.
»In meinem Artikel will ich die Parallelen zwischen verschiedenen grundlegenden christlichen Konzepten und den heidnischen Kulten hier in der Gegend aufzeigen. Sehr spannend! Etwa Orpheus und Eurydike, Demeter und Persephone … alles Varianten des gleichen Themas. Die Anhänger des Dionysos-Kults schlachteten jedes Jahr einen Stier. Sie aßen das Fleisch und tranken das Blut, damit sie eins mit Dionysos wurden und damit auferstanden so wie er.«
»Das ist wirklich … Entschuldige«, unterbrach ihn Peter. Mark war normalerweise eher introvertiert, aber wenn er sich mal öffnete, konnte er endlos lange reden. »Ich muss meine Tasche noch in mein Büro zurückbringen, und der Bürgermeister kommt um zwei zur Eröffnung.«
Mark lächelte und hob entschuldigend die Hände. »Kein Problem.«
Peter aß die letzten Bissen von seinem Salat und leerte sein Glas. Dann zog er die Lippen hoch und zeigte die Zähne wie ein lachender Schimpanse. »Nichts zwischen den Zähnen?«, fragte er. Mark versicherte ihm, dass alles in Ordnung war.
Sie verabschiedeten sich, und Peter ging zu seinem Büro in der archäologischen Fakultät neben der LAK.
Sein Zimmer war seit über zwanzig Jahren unverändert. Für ihn war es fast wie sein Wohnzimmer. An den Wänden hingen schon ewig dieselben drei Bilder: das Letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci, ein Poster von dem berühmten Gustav-Wappers-Gemälde von Bürgermeister Van der Werff und ein großes Foto von Papst Johannes Paul II. in seinem Papamobil.
Es gab Wochen, in denen er mehr Zeit in seinem Büro verbrachte als in seiner Vierzimmerwohnung an der Boerhavelaan. Er hatte sogar Wechselkleidung im Schrank für den seltenen Fall, wenn er die Nacht auf dem Dreisitzersofa verbrachte.
Als er den Papierstapel aus seiner Tasche zog, fiel der Umschlag auf den Boden. Fasziniert hob er ihn auf und öffnete ihn. Die Notiz im Inneren enthielt keine Ausreden für eine nicht erledigte Aufgabe. Stattdessen stand akkurat in der Mitte des Blattes:
Röm. 13,11
Aber es waren vor allem die Worte darunter, durch die ihm plötzlich der Mund trocken wurde. Er ließ den Zettel fallen wie ein benutztes Taschentuch, das man in den Müll wirft.
Hora est.
2
Freitag, 20. März, 13:45 Uhr
Peter sah auf die Uhr. Viertel vor zwei. Er musste sich beeilen, wenn er es rechtzeitig zur Nieuwstraat schaffen wollte. Die anonyme Nachricht hatte ihn mehr verstört, als er sich eingestehen wollte. Vor allem, dass es dieselbe Nachricht war, die er auf dem Handy erhalten hatte, machte ihn nervös. Er ging an den Bücherschrank, um eine Bibel zu holen, aber dann wurde ihm klar, dass er keine Zeit hatte. Er wusste, dass mit Röm. 13,11 die Paulusbriefe an die Römer im Neuen Testament gemeint waren, aber er war nicht bibelfest genug, um sich an die betreffende Passage erinnern zu können.
Er ließ die Bibel widerstrebend auf seinem Schreibtisch zurück, schloss die Bürotür und machte sich auf den Weg.
Obwohl es gegen seine Prinzipien verstieß, im Gehen auf sein Handy zu schauen – er zog immer über die Leute her, die wie Zombies herumtappten, die Augen an das Display geheftet –, öffnete er jetzt die Website Biblehub.com, um nachzusehen, was das Zitat besagte.
Die Verbindung war langsam. Als einmal in einem seiner Seminare die Rede auf Bilder von der Hölle gekommen war, hatte er seine Studierenden nach ihren Vorstellungen von der Unterwelt gefragt. Spontan hatte ein junger Mann geantwortet: »Die Hölle ist ein Ort, an dem das Internet extrem langsam ist.«
Peter hoffte jetzt vor allem, dass ihm keine Bekannten begegneten. Die Seite baute sich träge auf, als er durch den Doelensteeg und entlang der Rapenburg zum Platz mit dem Namen »Het Gerecht« ging. Er klickte »Römer« und dann »13« an. Erst als er die Pieterskerk erreicht hatte, erschien der Text auf seinem Bildschirm.
Es war inzwischen kurz vor zwei. Er konnte es sich nicht leisten, zu spät zu kommen. Unzufrieden klappte er die Handyhülle zu, immerhin in dem Wissen, dass der Text noch da sein würde, wenn er sie wieder öffnete.
Er setzte seinen Weg zügig fort und ging durch die engen Gassen, die zur Breestraat führten, vorbei am Rathaus und dann nach links. Als er den Fluss durch die Kolonnaden der Pilarenbrug überquerte, war die Bibliothek schon in Sichtweite.
Die Entscheidung der Stadt Leiden, die Abfallbehälter der Stadt unter die Erde zu verbannen, war aufgrund einer Möwenplage zustande gekommen. Die kleine Universitätsstadt lag nur zehn Kilometer Luftlinie von der Küste entfernt. Seitdem man in den Dünen wieder Füchse angesiedelt hatte, für die Nester voller Möweneier eine leichte Beute waren, waren viele Vögel in die Stadt geflohen. Sie pickten zu früh rausgestellte Müllsäcke auf, fraßen aus Abfalleimern und waren im Laufe der Zeit immer aggressiver geworden. Man hatte alle möglichen Gegenmaßnahmen ausprobiert: Möweneier durch Styroporeier ersetzt, Greifvögel eingesetzt, Taubengitter auf Dächern angebracht, alles ohne Erfolg. Nun hoffte man, dass die Stadt durch unterirdische Container unattraktiver für die Vögel werden würde.
Ein wenig außer Atem hielt Peter kurz inne, bevor er um die Ecke bog. Er betrachtete sich in einem Schaufenster. Ein bisschen zu dick, Dreitagebart und volles, etwas zu langes Haar. Sein Spiegelbild war sogar noch schmeichelhaft; die Reflexion zeigte nicht die tiefen Falten auf der Stirn und die dunklen Ringe unter den Augen.
»Wir sehen jetzt durch einen Spiegel wie im Rätsel …«, sagte er leise zu sich selbst.
Er steckte das Hemd ordentlich in die Hose und spürte das vergessene Handy aus dem Hörsaal in der Jackentasche. Er nahm sich vor, nachher die erstbeste Nummer auf der Teilnehmerliste anzurufen. Wer auch immer den Anruf annahm, würde ihm sicher sagen können, wem das Handy gehörte.
Eine große Menschenmenge hatte sich um die Ausgrabungsstelle versammelt. Die Leidener Presse natürlich, die Anwohner, alle möglichen Würdenträger und dazu die Arbeiter, erkennbar an ihren gelben Helmen und orangefarbenen Westen. Ein Teil des Geländes um die ausgehobene Grube war mit Drängelgittern und rot-weißem Flatterband abgesperrt.
»Hi, Peter!«, hörte er Arnold van Tiegem rufen. Peter erkannte selbst aus dieser Entfernung an der übertriebenen Fröhlichkeit von Arnolds Winken, dass dieser nicht auf den später stattfindenden Sektempfang hatte warten können.
Vor zwanzig Jahren war Peters damaliger Professor, Pieter Hoogers, in den Ruhestand gegangen und gleich nach seiner Abschiedsrede weggezogen. Alle hatten erwartet, dass Peter seine Professorenstelle erhalten würde, aber nach ein paar Monaten mit den typischen akademischen Kungeleien hatte die Universität einen Überraschungskandidaten aus dem Hut gezogen: Arnold van Tiegem, einen hohen Beamten aus dem Ministerium für Wohnungswesen, Stadtplanung und Umwelt, der dort auf ein Nebengleis geraten war. Irgendwann in ferner Vergangenheit hatte er an der Universität Wageningen Geologie studiert, was als ausreichende Qualifikation für die Leitung der Fakultät bewertet wurde. Der einmalige Zuschuss von fünf Millionen Gulden, den er mitbringen würde, überzeugte den Vorstand letztlich von seiner Eignung für den Posten.
Seit seiner Ernennung war Arnold mehrmals ein paar Tage lang verschwunden. Anfangs hatte man noch Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet, aber weil er immer wieder auftauchte, akzeptierte man es als ihm eigene Macke, dass er hin und wieder einfach für eine Weile auskniff. Er selbst verglich diese Episoden gerne mit John Lennons »lost weekend« und betrachtete sie als Bestandteil eines großartigen und aufregenden Lebens.
Peter hatte die hohen Stehtische erreicht, wo seine Vermutung durch eine Reihe von leeren Bierflaschen und zwei halb leeren Flaschen Wein bestätigt wurde.
Daniel Veerman, der bereits an einem der Tische stand, verdrehte verstohlen die Augen, als er seinen Blick von Arnold auf Peter verlagerte. Daniel war Anfang dreißig und das wandelnde Klischee eines Archäologen: langes, dunkles, welliges Haar bis in den Nacken, eine kleine Brille mit runden Gläsern auf der Nase, intelligente Augen dahinter und dazu einen trendigen Bart, der lässig aussah, aber gepflegt war. Er hatte Peter einmal erzählt, dass er schon als Kind nichts anderes getan habe, als nach verborgenen Schätzen zu suchen. Während andere Kinder im Sandkasten brav Berge angehäuft und mit Eimerchen und Schippchen gespielt hatten, hatte er meist draußen vor dem Sandkasten gebuddelt.
Peter schüttelte Daniel die Hand und begrüßte dann Janna Frederiks, die zusammen mit Daniel das Projekt für die Abteilung Kulturerbe leitete. Peter kannte Janna nicht besonders gut. Sie war eine ernste, bemerkenswert große Frau – fast zwei Meter –, die ihren Kopf stets leicht gesenkt hielt, als suche sie den Boden ab, in der Hoffnung, dort etwas Interessantes zu finden.
Arnold öffnete eine weitere Flasche Bier und leerte sie in wenigen Schlucken. Anschließend kämmte er sein langes graues Haar mit einem kleinen Kamm nach hinten, etwas, was er wie einen nervösen Tick viele Male am Tag wiederholte. Den Entenschwanz, der dadurch in seinem Nacken entstand, hielt er vermutlich für künstlerisch. In Kombination mit seinem dicken Bauch und seinen spindeldürren Beinen erinnerte er Peter an einen Zirkusdirektor. Setzte man ihm einen Zylinder auf den aufgedunsenen Kopf, wäre die Ähnlichkeit perfekt.
»Er lebt für diese Momente, oder?«, flüsterte Peter Daniel zu.
»Das Foto von ihm mit dem Bürgermeister postet er gleich anschließend auf Facebook«, bestätigte Daniel lachend. Dann sah er Peter von der Seite an und sagte: »Nett, dass du gekommen bist, Peter. Ich weiß das wirklich zu schätzen.«
»Keine Ursache. Ich wollte dir viel Erfolg wünschen. Ich bin wegen dir und Janna da, nicht meinetwegen, wie van Tiegem.«
»Aber er ist ein guter Networker, das muss man ihm lassen. Und so was braucht ihr doch, oder?«
Peter wollte ihm gerade eine passende Antwort geben, als plötzlich Applaus aufbrandete. Bürgermeister Freylink war eingetroffen, in vollem Ornat, mit der Amtskette um den Hals.
»Was genau passiert jetzt eigentlich?«, fragte Peter.
Daniel antwortete, ohne ihn anzusehen, während er weiterhin dem Bürgermeister applaudierte, der dicht an ihm vorbeiging. »Ich habe einen kleinen Haufen Sand in das Loch geworfen«, antwortete er, »und er holt ihn mit dem Bagger wieder raus. Das ist der symbolische Start des Projekts.«
»Ein bisschen umständlich, meinst du nicht?«
»Tja, wir hätten ihn auch mit einem Eimer in das Loch schicken können, aber ich dachte, so wäre es etwas schicker. Freylink war begeistert. Und er war früher selbst Historiker, wie du weißt, deswegen freut er sich, dass er eng eingebunden wird. Er war sogar auf einer Baustelle zum Üben.«
Der Applaus erstarb.
Ein kleiner Bagger kam auf sie zu. Aus dem langen, dünnen Abgasrohr auf dem Dach entwichen schwarze Rauchwölkchen.
»Ich gehe mal kurz rüber«, sagte Daniel. Janna folgte ihm. Er drehte sich um und sah Peter an. »Wir gehen heute Abend mit dem Team im El Gaucho essen. Du bist herzlich eingeladen, dich uns anzuschließen, wenn du mitkommen möchtest.«
Peter hob den Daumen. Vielleicht könnte ich Judith bitten, mich zu begleiten, dachte er.
Er nutzte die Gelegenheit, einen kurzen Blick auf sein Handy zu werfen. Er überflog Kapitel dreizehn des Paulusbriefes an die Römer und erkannte den Inhalt sofort wieder. Es ging um den Gehorsam gegenüber der staatlichen Gewalt. Ein Text, der im Laufe der Geschichte oft missbraucht worden war und für den man Paulus heftig kritisiert hatte. Zahlt eure Steuern, tut, was euch gesagt wird, seid nicht rebellisch, denn es gibt keine Autorität, die nicht von Gott stammt. Wer sich dem Staat widersetzt, widersetzt sich der Ordnung Gottes und damit Gott.
Kein Wunder also, dass sich die Leidener plötzlich zu Calvin hingezogen fühlten, als die Spanier vor den Toren der Stadt standen. Er erlaubte durchaus, sich gegen seine Herrscher aufzulehnen. Die Leute neigten eben dazu, sich einen Glauben auszusuchen, der ihren eigenen Interessen am meisten entgegenkam.
Plötzlich begann das Handy aus dem Hörsaal zu vibrieren. Peter hätte eigentlich damit gerechnet, dass das schon viel früher passieren würde; die jungen Leute kommunizierten mehr mit denen, die sie nicht sehen konnten, als mit denen in ihrem direkten Umfeld. Aber zuerst wollte er den genauen Vers lesen, der auf dem Zettel angegeben war. »Bleibt niemand etwas schuldig«, las er, »nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt.« Da, jetzt hatte er es gefunden, Vers 11:
Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, wo wir vom Schlafe aufwachen sollten; denn jetzt ist unser Heil näher, als da wir gläubig wurden.
Dass nämlich die Stunde schon da ist …
»Hora est«, wiederholte Peter langsam, als wolle er die Worte auf der Zunge schmecken.
Das letzte Stück des Kapitels las er murmelnd, fast im Stakkato, als ob er dem Text dadurch eine verborgene Botschaft entlocken könnte.
Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe. So lasset uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts.
Jemand schlug ihm übertrieben jovial auf die Schulter. Van Tiegem.
»Komm, jetzt steck mal das Handy weg«, sagte er und versuchte spielerisch, Peter den Apparat aus der Hand zu nehmen.
Verärgert wehrte Peter ihn ab. »Okay, okay«, sagte er und steckte das Handy ein.
»Willst du kein Bier?«
»Nein, danke, Arnold, ich muss noch arbeiten.«
»Sehr löblich«, sagte Arnold ohne große Überzeugung, »sehr löblich. Ich sollte mir ein Beispiel an dir nehmen.«
Der Bürgermeister stand jetzt neben dem Bagger. Mehr der Form halber, so schien es, setzte ihm jemand einen gelben Schutzhelm auf. Er nahm sich Zeit zu posieren, während Fotos gemacht wurden.
»Solltest du nicht zu ihm gehen und dich neben ihn stellen?«, schlug Peter vor.
»Gute Idee!«, erwiderte Arnold aufrichtig erfreut. Auf dem Weg zum Bürgermeister schnappte er scherzhaft den Helm eines Bauarbeiters und setzte ihn sich in einem kessen Winkel auf den Kopf. Er stand neben Freylink und hob beide Daumen, als die Kameras klickten.
Peter nahm das andere Handy aus seiner Tasche. Es hatte eine Nachricht erhalten, nicht über WhatsApp, sondern eine andere App, von der er noch nie zuvor gehört hatte, Wickr. Er öffnete die Nachricht. Es waren nur drei Worte:
iuxta est salus
Gleich darauf traf eine weitere Nachricht ein.
Die Erlösung ist nah.
Erst dann sah er den Namen des Absenders. Paulus.
Das war …
Peter wollte antworten, sah aber dann, dass die Nachrichten bereits verschwunden waren. Sie waren offenbar nur für wenige Sekunden verfügbar gewesen, gerade lange genug, um sie lesen zu können.
Er öffnete die Kontaktliste des Handys. Er musste zweimal hinsehen, um sicherzustellen, dass er sich nicht irrte.
Sie war vollkommen leer.
3
Freitag, 20. März, 14:15 Uhr
Peter blickte vom Handy auf und sah sich überall um, zuerst nach links und dann wieder nach rechts, wie eine Überwachungskamera, die ein bestimmtes Gebiet abdeckt, aber es gab nichts zu sehen. Niemand duckte sich plötzlich weg, kein Mann mit Hut schaute ihn halb verborgen hinter einer Zeitung durch zwei Gucklöcher an.
Am liebsten wäre Peter sofort zurück in sein Büro geeilt. Vielleicht konnte er den Scherzkeks ausfindig machen, indem er die Liste der Studierenden seines Seminars durchging? Andererseits war ihm klar, dass es gut für ihn war, sich hier sehen zu lassen. In seinem Umfeld kam es letztendlich darauf an, wen man kannte, kurze Kommunikationswege, Vetternwirtschaft, ein gutes Netzwerk. In diesen Zeiten der Einsparungen an allen Ecken und Enden konnte es nicht schaden, die richtigen Leute zu kennen, da hatte Daniel schon recht. Man konnte gegen van Tiegem sagen, was man wollte, aber der Mann war ein geborener Netzwerker, der immer wieder erfolgreich Mittel für die Fakultät rausholte.
Peter hatte plötzlich großen Durst. Er nahm eine Flasche Bier vom Tisch und drehte den Kronkorken ab. Mit dem ersten Schluck spülte er den Mund, bevor er ihn herunterschluckte. Das Bier war lauwarm.
Freylink saß jetzt in der Kabine des Baggers und hatte die Tür geschlossen. Der Motor brummte gleichmäßig, während der Bürgermeister vorsichtig auf das Loch zufuhr, rechts und links begleitet von einer Gruppe Männer mit ernster Miene und gemessenen Schritten, wie Sargträger bei einer Beerdigung. Am Rand der Grube angekommen, traten alle ein paar Schritte zurück.
Daniel hob beide Daumen in Richtung Freylink, der einen Hebel zog, um den Greifer zu bewegen. Alles lief nach Plan, ruhig und kontrolliert, was darauf hindeutete, dass Freylink tatsächlich für diesen Moment geprobt hatte.
Janna kehrte zurück.
»Ich habe mich heute Morgen schon um halb zehn bereit gemacht«, sagte sie ohne Einleitung.
»Bereit für was?«, fragte Peter, aber er kannte die Antwort schon, bevor er die Frage ganz ausgesprochen hatte. »Ah, die Sonnenfinsternis.«
»Genau, aber man konnte nicht viel erkennen«, sagte Janna enttäuscht. »Es war einfach zu bewölkt. Sie hat bis Viertel vor zwölf gedauert, aber das meiste habe ich verpasst.«
»Schade.«
Inzwischen war der Arm des Baggers fast vollständig im Loch verschwunden. Die nächste Aufgabe bestand darin, mit der großen Schaufel etwas Sand aufzunehmen und vorsichtig an die Oberfläche zu bringen. Das Manöver erforderte höchste Präzision, da nicht viel Spielraum war. Nach dem reibungslosen Start schien der Bürgermeister jetzt zu zögern. Das Motorengeräusch wurde etwas lauter, und es kamen dickere Qualmwolken aus dem Auspuff. Die Schaufel schien festzustecken. Der Bagger neigte sich ein wenig vornüber. Jemand aus der Menge stieß einen kurzen Schrei aus, und ein paar Zuschauer lachten nervös.
Ein Bauarbeiter klopfte an das Kabinenfenster, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Freylink lächelte und hob den Daumen, wischte sich dann aber mit einem Taschentuch über die Stirn.
Der hydraulische Arm begann sich wieder zu bewegen. Plötzlich ertönte ohrenbetäubender Lärm. Das Brechen von Steinen vermischte sich mit dem Röhren des hochtourig laufenden Motors. Die kleinen Qualmwolken ballten sich zu dickem, pechschwarzem Rauch zusammen, der Geruch von Diesel stieg auf, und der Bagger kippte nach vorn. Zwei Männer versuchten, ihn in seine ursprüngliche Position zurückzuziehen, indem sie sich an ihn hängten, aber vergeblich.
Peter konnte erkennen, dass das normalerweise so ruhige Gesicht des Bürgermeisters angstverzerrt war. Freylink versuchte, die Tür aufzustoßen, aber da stürzte der Bagger schon vornüber in die Grube.
Das Publikum schrie und wich zurück, als der Bagger eingeklemmt wurde, halb unter- und halb oberhalb der Erde, wodurch die gefährliche Position, in der sich der Bürgermeister jetzt befand, deutlich sichtbar wurde. Es brach ein totales Chaos aus. Ein paar Leute zerrten an der Laufkette des Baggers, gaben aber bald auf. Die Tür ließ sich nicht mehr öffnen, da der untere Teil durch die Wand der Grube blockiert wurde.
Instinktiv war Peter sofort hinübergerannt, um zu sehen, ob er helfen konnte. Er hockte sich neben Daniel, der gegen das Fenster klopfte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blickte Freylink sie an, wobei ihm das Blut aus einer Augenbraue und der Nase über das Gesicht lief. Dennoch rang er sich ein Lächeln ab.
»Wir holen Sie da so schnell wie möglich raus!«, rief Daniel. Sein Gesicht war gerötet, vielleicht aufgrund der Anstrengung, vielleicht wegen der peinlichen Situation, in die der Bürgermeister geraten war.
Peter blickte auf und sah, dass sich eine Gruppe von Menschen in einem Halbkreis um das Loch im Boden versammelt hatte. Viele von ihnen fotografierten und filmten mit ihren Handys. »Hören Sie auf damit!«, rief er und sprang auf die Beine.
Die meisten steckten ein wenig beschämt ihre Handys weg. Peter wurde von Schwindel nach dem schnellen Aufstehen erfasst und musste sich an Daniel festhalten, um nicht umzukippen.
In dem Moment kam Janna Frederiks rübergerannt. »Ein Stück die Straße runter steht noch ein anderer Bagger«, keuchte sie. »Sie holen ihn und wollen versuchen, diesen hier mit einem Stahlseil rauszuziehen.«
»Aber wir können ihn doch nicht die ganze Zeit in der engen Kabine sitzen lassen?«
»Was schlägst du stattdessen vor?«, fragte sie. »Willst du die Scheibe einschlagen?«
»Genau, wir schlagen die Scheibe ein! Sie ist aus Kunststoff, nicht aus Glas, splittert also nicht. Wenn er sich die Jacke über den Kopf zieht, kann er sich vor eventuellen scharfen Stücken schützen. Seht ihr, wie unangenehm dem Mann das ist? Das da drin ist der Bürgermeister!«
Nach kurzem Nachdenken erklärte sich Janna einverstanden. Den Bagger rauszuschleppen würde mindestens eine halbe Stunde dauern, selbst wenn alles reibungslos verlief.
Daniel kniete sich wieder auf den Boden und klopfte gegen das Fenster. Freylink hatte sich so gut es ging auf das Bedienfeld gesetzt. Obwohl er sich ein wenig beruhigt zu haben schien, sah er mit seinem blutbefleckten Gesicht gruselig aus.
»Ziehen Sie Ihre Jacke aus!«, rief Daniel ihm zu, die Hände trichterförmig an den Mund gelegt. Dann zog er selbst die Jacke aus, um Freylink zu demonstrieren, was er tun sollte. »Wir werden jetzt die Scheibe einschlagen«, schrie er, jedes Wort betonend, wobei er die Handlungen übertrieben mimte, »sodass Sie rausklettern können. Der Bagger wird gleich rausgeschleppt, aber wir wollen Sie nicht so lange da drinlassen! Ziehen Sie sich die Jacke über den Kopf!«
Freylink hatte verstanden. Er zog seine Jacke aus und drapierte sie sich über Kopf und Schultern.
Janna kam mit einem großen Hammer, einem Stechbeitel und einem Paar Arbeitshandschuhen zurück, die sie Daniel gab.
Nach einigen gezielten Hammerschlägen bildeten sich Risse im Kunststoff. Ohne viele Splitter zu verursachen, schlug Daniel die Scheibe heraus. »Keine Sorge. Wir holen Sie im Handumdrehen raus. Ich bin fast fertig. Wie geht es Ihnen?«
»Es ist hauptsächlich der Schreck«, ertönte Freylinks gedämpfte Stimme. »Schmerzen habe ich keine.«
Daniel überprüfte den Fensterrahmen auf scharfe und spitze Kunststoffscherben. Als Freylink seine Jacke herunternahm, erschrak Peter erneut wegen seines blutigen Gesichts und dem Haar, das ihm an der feuchten Stirn klebte. Kaum steckte der Bürgermeister den Kopf nach draußen, begann die Menge erleichtert zu applaudieren.
Er kletterte auf das Lenkrad und richtete sich etwas gerader auf. Peter und Daniel packten ihn unter den Achseln und zogen ihn vorsichtig nach oben. Seine Hose blieb an einem Haken hängen, wodurch ein langer Riss entstand.
Als der Bürgermeister schließlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, erhielt er noch mehr Applaus. Er lächelte schwach und winkte. Daniel und Peter brachten ihn zum wartenden Krankenwagen. Die Besatzung wollte die Trage ausladen, aber der Bürgermeister winkte ab. Allerdings stieg er ein, um sich behandeln zu lassen.
Der zweite Bagger traf ein, angeführt von einer Gruppe von Männern, die dicke Kabel trugen. Daniel ging noch einmal zum Bürgermeister, dessen Gesicht bereits gereinigt worden war. Er saß da und hielt sich ein Taschentuch an die Nase, während ein Sanitäter ihm einen Verband um den Kopf wickelte. Er erinnerte Daniel an einen Fußballspieler mit einer Kopfverletzung, der vor der Rückkehr auf das Spielfeld zusammengeflickt wurde.
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid es mir tut, Meneer«, begann Daniel.
»Es war nicht Ihre Schuld. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Ich muss den falschen Knopf gedrückt haben. Es fühlte sich an, als träfe ich auf Widerstand, und dann durchbrach ich etwas.«
»Wir werden das untersuchen, Herr Bürgermeister. Und ich bitte Sie nochmals aufrichtig um Entschuldigung.«
Der Sanitäter war fertig mit dem Verbinden von Freylinks Kopf und teilte ihm mit, dass er ihn gerne für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus bringen wolle. Der Bürgermeister stimmte zu. Bevor er in den Krankenwagen stieg, winkte er noch einmal jovial dem Publikum zu, das aus der Distanz zugesehen hatte. Die Türen des RTWs wurden geschlossen, und er fuhr weg, ohne Blaulicht und Sirene.
Inzwischen hatte man die Kabel am Bagger befestigt, und dröhnend und qualmend fuhr der andere Bagger rückwärts, während vier Männer um die Grube herumstanden, um den Vorgang zu überwachen. Die eingeklemmte Baumaschine geriet schon bald in Bewegung, und nach zwanzig Minuten stand sie wieder aufrecht.
Daniel stand ungeduldig daneben, eine Strickleiter in der Hand.
»Willst du da runter?«, fragte Peter.
»Ja, natürlich! Ich will sehen, was zum Teufel schiefgelaufen ist. Wir haben beim Graben nichts Ungewöhnliches gefunden. Ich habe noch vor einer Stunde alles selbst inspiziert!«
Sie starrten beide in die Grube hinunter. Es sah so aus, als wäre ein Teil des Bodens eingestürzt. Als das Signal kam, dass alles klar war, ließ Daniel die Strickleiter vorsichtig hinunter. Er stellte sicher, dass sie mit zwei Heringen fest im Boden verankert war, bevor er seinen Fuß auf die erste Sprosse setzte. Dann schaltete er die Lampe an seinem Helm an und begann herunterzuklettern.
»Und?«, rief Peter ihm nach.
»Es riecht irgendwie anders … als wäre die Luft feuchter geworden, schwerer. Und …« Er war jetzt ganz unten. »Der Boden ist tatsächlich teilweise eingebrochen!«, rief er. »Als wäre darunter ein Hohlraum!«
»Ist Platz für noch einen da unten?«, rief Peter. Er war erpicht darauf, auch mal vor Ort nachzusehen, in der Hoffnung, dass ihn das von den seltsamen Textnachrichten ablenken würde.
»Ich wusste, dass du das fragen würdest! Komm schon!«
Peter stieg vorsichtig hinunter, beobachtet von Janna, die ein besorgtes Gesicht machte und ein wenig gereizt den Kopf schüttelte.
Daniel streifte seinen Schutzhelm ab und richtete den Strahl der Taschenlampe auf den Boden unter sich. »Das ist doch wirklich bizarr! Schau mal!«
Jetzt konnte Peter es auch sehen. Die Wände der Grube waren eindeutig aus Ziegeln und Mörtel gefertigt. Was um alles in der Welt war das? Ein gemauerter Boden? Drei Meter unter der Erde?
Peter kniete sich hin und lehnte sich nach vorn, um nachzusehen, wie tief das Loch am Boden der Grube hinunterging. Er nahm Daniels Helm und richtete die Lampe nach unten.
Plötzlich hörte er ein Stöhnen. Ein leises, aber unverkennbares Stöhnen.
Er schrie vor Überraschung auf und zog den Kopf zurück, wodurch der Helm in das Loch fiel.
»Hast du einen Geist gesehen?«, fragte Daniel und lachte nervös.
»I … Ich glaube, da ist jemand …«, stotterte Peter.
Das Stöhnen ertönte wieder, jetzt noch lauter. Es war nicht zu überhören; auch Daniel hatte es jetzt wahrgenommen.
Peter atmete tief durch. Er steckte den Kopf wieder in das Loch und suchte nach der Quelle des Stöhnens. Nichts hätte ihn auf das vorbereiten können, was er sah.
Zwei nackte Beine ragten unter einem Haufen Ziegelsteine hervor. Am anderen Ende des Haufens lag der nackte Oberkörper eines jungen Mannes.
Die Helmlampe beleuchtete die Szene vor ihm nur schwach, aber sobald sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, keuchte Peter auf, als hätte man ihm in den Magen geboxt. Ihm bot sich ein Anblick, der ihn an die mittelalterlichen Gemälde über die Qualen der Hölle erinnerte.
Der Mann war von Kopf bis Fuß voller Blut.
4
Freitag, 20. März, 17:22 Uhr
Anja Vermeulens Schicht war fast zu Ende, es lagen nur noch knapp zwei Stunden vor ihr. Das Küchenpersonal servierte gerade das Essen, und danach war Besuchszeit.
Sie bereitete schon einmal ihren Wagen mit den Medikamenten für die Patienten vor. Die allgemeine Abteilung des LUMC, des Leiden University Medical Centre, wo die Patienten durchschnittlich zehn Tage verbrachten, war bekannt dafür, ziemlich ruhig zu sein. Die Patienten erholten sich hier von kleineren Operationen wie einer Blinddarmentfernung oder wurden nach einem längeren Aufenthalt auf die Rückkehr nach Hause vorbereitet.
Normalerweise geschah hier nie etwas Spektakuläres, aber der heutige Tag war ungewöhnlich. Am Nachmittag war ein junger Mann eingeliefert worden; ein mysteriöser Fall. Er war entdeckt worden, als ein Bagger bei Ausgrabungsarbeiten im Stadtzentrum in eine Grube gefallen war. Der Mann, der etwa Mitte zwanzig war, hatte über und über mit Blut bedeckt in einem Hohlraum unterhalb des Lochs gelegen, das für einen unterirdischen Abfallbehälter ausgehoben worden war. Bis auf einen Lendenschurz war er völlig nackt gewesen. Niemand wusste, wie er unter die Erde geraten war. Anja hatte die Nachricht vom Unfall, bei dem Bürgermeister Freylink leicht verletzt worden war, im Lokalradio gehört, aber dieses namenlose Opfer war dabei noch nicht erwähnt worden.
Nachdem er bewusstlos, aber in einem stabilen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden war, war der junge Mann von Kopf bis Fuß gewaschen worden. Man hatte keine einzige Verletzung an seinem ganzen Körper festgestellt, und wie durch ein Wunder hatte er sich auch nichts gebrochen. Das Blut, mit dem er bedeckt gewesen war, musste von jemand anderem stammen. Eine Probe dieses Blutes war inzwischen ins Labor gebracht wurden, um es auf eventuelle Krankheiten oder dergleichen zu untersuchen. Die Polizei wollte am nächsten Tag kommen, um Fotos von dem jungen Mann zu machen und ihn zu befragen, falls er bis dahin das Bewusstsein wiedererlangt hatte.
Der anonyme Patient wurde versorgt und mit sauberer Krankenhauswäsche in ein leeres Zimmer gebracht.
Gegen Viertel nach fünf schaute Anja bei »Anonymus« vorbei, wie auf dem Namensschild draußen stand. Sie öffnete die Tür und sah, dass alles in Ordnung war. Der junge Mann, gut gebaut, eindeutig ein sportlicher Typ, atmete ruhig. Alles schien unter Kontrolle zu sein.