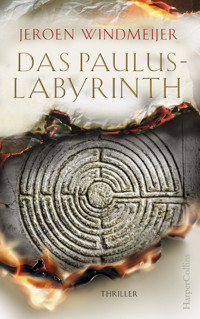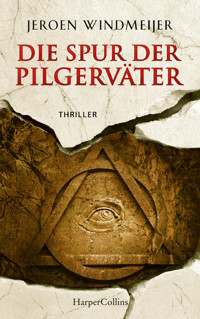
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Peter-de-Haan-Thriller
- Sprache: Deutsch
Das jahrhundertealteGeheimnis derPilgerväter
Der Großmeister der Leidener Freimaurer liegt in einem Kegel aus Licht und einer Lache aus Blut: erschlagen, seine Ritualinsignien Winkelmaß und Zirkel wurden ihm durch Hände und Brust getrieben. Anthropologe Peter de Haan ist entsetzt, hatte er doch kurz zuvor noch mit dem Großmeister der Ishtar-Loge gesprochen. Für die Polizei ist Peter daher der Hauptverdächtige. Um sich von dem Verdacht freizusprechen, macht er sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Und kommt dabei einem Geheimnis auf die Spur, das bis zu den Pilgervätern von der Mayflower und ihrer Zeit in Leiden zurückreicht.
Packender Verschwörungsthriller für alleDan-Brown-Fans
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 777
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HarperCollins®
Copyright © 2020 by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
© 2018 Jeroen Windmeijer Originaltitel: »Het Pilgrim Fathers complot« Erschienen bei: Uitgeverij HarperCollins Holland, Amsterdam
Covergestaltung von Hauptmann & Kompanie, Zürich Coverabbildung von Kanea, Chris Foto / Shutterstock E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749950324
www.harpercollins.de
Werden Sie Fan von HarperCollins Germany auf Facebook!
Widmung
Für Dünya
Zitat
Danach gingen Moses und Aaron zum Pharao und sagten: »So spricht Jahwe, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern können.«
EXODUS 5,1
Vorwort des Autors
Im Frühjahr 2017 entdeckte Sprachwissenschaftler Piet van Vliet im kulturhistorischen Zentrum »Erfgoed Leiden en Omstreken« ein Manuskript, das einen einzigartigen Einblick in das Leben und Denken der Pilgerväter bietet.
Die ursprünglich aus England stammenden Puritaner ließen sich 1609 in Leiden nieder, auf der Suche nach einem Ort, an dem sie ihren Glauben ungehindert ausüben konnten. Elf Jahre lang blieben sie in den relativ toleranten Niederlanden, weil für sie unter König Jakob I. in England kein Platz war. Knapp die Hälfte der Gruppe schiffte sich 1620 mit der Mayflower nach Amerika aus, wo sie zu den Gründervätern der Vereinigten Staaten wurden. Viele moderne Konzepte, etwa die Trennung von Kirche und Staat, die standesamtliche Ehe, Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit nahmen sie aus Leiden mit in die neue Welt.
Obwohl das Dokument in groben Zügen die hinlänglich bekannte Geschichte dieser in England verfolgten religiösen Gruppe erzählt, wird der Fund dennoch für großes Aufsehen unter den Historikern sorgen – und weit darüber hinaus. Nun ist ein Manuskript, in dem ein normaler Bürger in persönlichen Worten von historischen Geschehnissen berichtet, schon an sich sehr wertvoll. Historiker erhalten dadurch einen Einblick in die Art und Weise, in der die Historie das Leben der kleinen Leute berührt hat. Häufig ergeben solche Dokumente ein Bild, das ein klein wenig anders aussieht als das, welches wir uns auf der Grundlage der offiziellen Geschichtsschreibung erschaffen haben. Doch dieses persönliche Dokument – Aufzeichnungen eines anonym gebliebenen Chronisten der Leidener Pilgerväter – ist viel mehr als das. Es verschafft Historikern nicht nur entscheidende Informationen, mithilfe derer sie gewisse ältere Theorien über die Pilgerväter in Leiden differenzierter formulieren können, sondern es wirft vor allem ein ganz neues Licht auf die Gründe, die einen Teil der Gruppe dazu bewog, nach Amerika zu gehen, während der weitaus größere Teil dortblieb. In dieser Hinsicht wird das Kapitel über die Pilgerväter wohl stellenweise neu geschrieben werden müssen.
Für wen das Dokument bestimmt war, ist nicht ganz klar. Offenbar handelt es sich jedoch nicht um ein Tagebuch. Wollte der Autor die Schwierigkeiten, mit denen die Pilger zu kämpfen hatten, für deren Nachfahren festhalten? Dienten die Aufzeichnungen dem persönlichen Gebrauch? War der Chronist der »Historiker« der Gruppe? Zwischen den einzelnen Abschnitten liegen manchmal große Zeitsprünge, oftmals von mehreren Jahren; etwaige dazwischenliegende Episoden sind vermutlich verloren gegangen.
Doch schon allein der Fund eines fast vier Jahrhunderte lang verborgen gebliebenen Manuskripts bietet Stoff für ein spannendes Buch; jeder Wissenschaftler träumt davon, wenigstens einmal im Leben eine solche Entdeckung zu machen. Lisette Schouten und Guido Marsman von Leiden TV haben in ihrer faszinierenden Dokumentation Nieuw Licht op de Pilgrim Fathers (Neues Licht auf die Pilgerväter) diese außergewöhnliche Geschichte rekonstruiert. Ich werde weiter unten in meinem Buch noch ausführlich darauf zurückkommen.
Sind hiermit alle Rätsel gelöst? Kann jetzt die endgültige Geschichte der Pilgrims geschrieben werden?
Die Antwort lautet … nein.
Es wird jeden frustrieren, der sich mit den Pilgervätern beschäftigt, von den Fachleuten im In- und Ausland bis hin zu den interessierten Laien, doch leider fehlen die letzten Seiten des Manuskripts. Hat der Autor sie bewusst weggelassen? Oder hat ein anderer befunden: Bis hierher dürft ihr lesen, aber nicht weiter?
Das Versprechen des Autors auf den letzten erhaltenen Seiten, im Folgenden gewisse Geheimnisse zu enthüllen, bietet Raum für so viele Spekulationen, dass man getrost davon ausgehen kann, dass sich der Staub, der buchstäblich von diesem jahrhundertealten Manuskript aufgewirbelt wurde, bis auf Weiteres nicht legen wird.
Die Übersetzung aus dem Altenglischen stammt von dem über jedes Lob erhabenen Piet van Vliet persönlich. Durch seine fließende Übertragung ins moderne Niederländisch hat man als Leser das Gefühl, als spräche aus einer fernen Vergangenheit ein Mensch zu einem, der einem in all seinen täglichen Sorgen und Überlegungen letztendlich mehr ähnelt, als man je für möglich gehalten hätte.
Das Manuskript bildet die Grundlage dieses Romans, in dem ich versucht habe, die »weißen Flecke« dieser Geschichte auf plausible Weise einzufärben. Ich bin Piet van Vliet außerordentlich dankbar dafür, dass er diesen Roman als Podium für sein Dokument gewählt hat. Ein Artikel in einer historischen Zeitschrift würde schließlich nur von wenigen Spezialisten gelesen werden, während auf diese Weise ein viel breiteres Publikum von diesem einzigartigen Manuskript erfahren kann.
Jeroen Windmeijer
Teil 1: Die alte Welt
TEIL I
DIE ALTE WELT
LEIDEN
1
Peter de Haan legte die Hand auf die Klinke der Tür, die zum Versammlungsraum führte, den die Freimaurer als Werkstatt oder Tempel bezeichneten. Nach dem Gästeabend, an dem der »Meister vom Stuhl«, der Vorsitzende Coen Zoutman, den Gästen von seiner Loge Ishtar erzählt hatte, hatte es unten im Foyer noch einen Umtrunk gegeben. Der Meister selbst war oben im Tempel zurückgeblieben, um Fragen von Interessierten zu beantworten. Schließlich war es für Außenstehende eine einzigartige Chance gewesen, einmal einen Einblick in das Gebäude an der Steenschuur zu erhalten, das auf viele einen geheimnisvollen Eindruck machte.
Peter und seine Freundin Fay Spežamor wollten allmählich nach Hause, doch nicht ohne sich vorher noch von Coen zu verabschieden. Seit der Gründung 2014 war Fay Mitglied der Ishtar-Loge, die auch Frauen aufnahm, was insofern etwas ganz Besonderes war, weil bis vor Kurzem die Freimaurerlogen ausschließlich Männern vorbehalten gewesen waren.
Auf einmal überkam Peter eine unheilvolle Vorahnung, und er ließ die Hand unschlüssig auf der Klinke liegen.
Fay hatte nicht damit gerechnet, dass er stehen blieb, und stieß von hinten gegen ihn. »Was ist?«, fragte sie erstaunt.
»Ich weiß nicht«, antwortete Peter, bevor er langsam die Klinke herunterdrückte und die Tür öffnete.
Die Lampen im Tempel waren ausgeschaltet. Nur ein Spot brannte.
Peter und Fay folgten mit ihren Blicken dem immer breiter werdenden Lichtstrahl.
Ihnen stockte im selben Augenblick der Atem, als wären sie zusammen in das Wasser eines eiskalten Flusses gesprungen.
Auf den schwarz-weißen Bodenfliesen lag, perfekt ausgeleuchtet, der Meister vom Stuhl, wie ein geschlagener König auf einem Schachbrett.
Fay stieß einen Schrei aus und schlug die Hand vor den Mund.
Mit wenigen großen Schritten war Peter bei dem Opfer, dessen Kopf von einer Blutlache umgeben war. Auf dem Boden lag ein Hammer, an dem Haare und Blut klebten. Aus der Brust des Meisters ragte ein Winkelmaß hervor, das offenbar mit großer Kraft dort hineingetrieben worden war. Das Bizarrste war jedoch der Zirkel, der die beiden gefalteten Hände durchbohrte.
Obwohl Peter wusste, dass es eigentlich keinen Sinn hatte, legte er Zeige- und Mittelfinger seiner rechten Hand an den Hals des Meisters, aber wie befürchtet spürte er kein Lebenszeichen mehr.
Peter drehte sich zu Fay um, die reglos in der Tür stand und zusah, die Augen weit aufgerissen und die Hand noch immer vor dem Mund. Fassungslos schüttelte er den Kopf; dann stand er auf, zog sein Handy aus der Tasche und wählte die 112.
Sollte er die Polizei oder einen Krankenwagen rufen?
Das Display leuchtete auf, während er die Notrufnummer eingab. Praktisch unverzüglich meldete sich eine freundliche, aber energische Stimme: »Notruf Leiden, wollen Sie die Polizei, die Feuerwehr oder einen Rettungswagen anfordern?«
»Die Polizei«, antwortete Peter.
Er wurde sofort verbunden.
»Polizei Leiden«, meldete sich nach wenigen Sekunden eine Frau. »Was ist passiert?«
»Hallo, hier spricht Peter de Haan«, sagte er nach kurzem Zögern. »Ich, äh … Es ist jemand ermordet worden … Ich …«
»Wie bitte?«
Peter riss sich zusammen. »Wir brauchen die Polizei und einen Krankenwagen, glaube ich, obwohl das Opfer bereits tot ist.«
»Bitte nennen Sie mir Ihren Standort.«
»Ich bin … Wir sind in Leiden, an der Steenschuur. Steenschuur Nummer sechs.«
»Einen Augenblick, ich gebe das sofort weiter. In spätestens zehn Minuten sind die Kollegen bei Ihnen.«
Eine kurze Stille trat ein.
»Was ist passiert?«, wiederholte die Frau.
»Wir sind hier im Gebäude der Freimaurer. Heute hat ein offener Gästeabend stattgefunden. Meine Freundin und ich befinden uns im sogenannten Tempel; der Meister der Loge liegt reglos auf dem Boden; es sieht so aus, als wäre er mit einem Hammer niedergeschlagen worden.«
»Sind Sie sicher, dass er nicht mehr lebt?«
»Ja, ich habe an seiner Halsschlagader gefühlt und keinen Puls mehr gespürt.«
Peter blickte hinunter auf den Mann, der sich gerade eben noch mit liebenswürdigem Blick im Saal umgesehen hatte. Er zog sich langsam zurück zu Fay, den Blick starr auf den Toten geheftet.
»Können Sie mir den Namen des Opfers nennen?«
Inzwischen hatte Peter Fay erreicht, die ihre Hand auf seinen Rücken legte.
»Coen …« Fragend schaute er Fay an.
»Zoutman«, ergänzte sie.
»Zoutman«, sagte Peter. »Coen Zoutman. Coen mit ›C‹.«
Man hörte eine Tastatur klappern.
»Die Kollegen sind gleich bei Ihnen, Meneer de Haan«, sagte die Frau. »Bitte fassen Sie nichts an, und sorgen Sie dafür, dass niemand den Raum betritt. Haben Sie mich verstanden?«
»Ja, ja«, antwortete Peter wie betäubt.
»Es ist auch ein Krankenwagen unterwegs«, sagte die Frau am Telefon. »Nochmals: Fassen Sie nichts an, und lassen Sie niemanden in den Raum. Haben Sie das verstanden?«
»Ja, habe ich.«
»Sobald Hilfe eingetroffen ist, lege ich auf. Haben Sie das auch verstanden?«
»Ja.«
»Ist die Nummer, die ich auf dem Display sehe, die Ihres Handys?«
»Ja.«
Sie fragte ihn nach seiner Adresse, und er nannte sie ihr.
»Könnten Sie auch dafür sorgen, dass niemand das Gebäude verlässt?«, fügte sie noch rasch hinzu.
»Es sind schon viele Leute gegangen«, erwiderte Peter. »Aber ich kümmere mich darum.«
Es blieb so lange still in der Leitung, dass Peter sich fragte, ob die Frau noch da war.
»Ich habe gerade die Meldung erhalten, dass die Kollegen vor dem Gebäude Steenschuur Nummer sechs stehen«, sagte sie dann. »Sie werden von jetzt an übernehmen.« Sie verabschiedete sich und legte auf.
Peter stand mit dem Handy in der Hand da und starrte es ausdruckslos an, als erwarte er, dass der Apparat all seine Fragen beantworten würde. »Komm«, sagte er zu Fay, die noch immer kein Wort gesagt hatte.
Sie suchte mit einer Hand Halt an Peters Rücken, auch nachdem sie den Tempel verlassen hatten, als würde sie umkippen, sobald sie losließe.
Genau in dem Moment, als Peter die Tür hinter sich schloss, klingelte es an der Eingangstür.
»Komm, lass uns runtergehen«, sagte Peter.
Fay nickte und ließ ihn los.
Die warme Stelle, auf der ihre Hand gelegen hatte, kühlte augenblicklich ab.
»Peter?«, sagte sie.
Als er sich umdrehte, umarmte sie ihn kurz. »Das ist doch Wahnsinn«, brachte sie mühsam hervor.
Sie lösten sich voneinander und gingen die Treppe hinunter.
Es klingelte noch einmal, hartnäckiger als zuvor.
Peter öffnete.
Zwei junge Uniformierte, ein Mann und eine Frau, standen vor der Tür. Die Anspannung war ihnen deutlich anzusehen.
»Guten Abend«, sagte die Frau. »Dijkstra, Polizei Leiden. Meneer de Haan?«
»Ja.«
»Sie haben gemeldet, dass Sie das Opfer eines Überfalls gefunden hätten. Wo ist es?«
»Oben im Tempel.«
Die Beamten traten ein.
»Van Hal«, stellte sich der Mann vor und reichte Peter höflich die Hand.
Sie gingen die Treppe hinauf.
»Ich komme gleich!«, rief Peter ihnen nach. »Ich bringe nur schnell meine Freundin in den großen Saal.«
Die Beamten reagierten nicht.
Fay war stocksteif stehen geblieben. Sie regte sich erst wieder, als Peter sie sanft berührte. Geistesabwesend lächelte sie ihm zu, als müsse sie sich erst wieder daran erinnern, wer er war.
Gemeinsam betraten sie den Saal, wobei Peter seinen Arm fest um Fay geschlungen hielt. Die Anwesenden drehten sich alle wie auf Kommando zu ihnen um, als spürten sie, dass etwas passiert war. Es war, als hätte jemand mit einer Fernbedienung den Ton ausgeschaltet, so abrupt rissen die Gespräche ab.
Nachdem Peter Fay behutsam auf einen Stuhl gesetzt hatte, holte er ihr ein Glas Wasser, das sie in kleinen Schlucken austrank. Dann wandte er sich zu der Gruppe, die sich in einem Halbkreis um sie geschart hatte. »Meine Damen und Herren«, sagte er, »ich bin Peter de Haan, der Partner von Fay. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Fay und ich sind nach oben gegangen, um uns vom Meister zu verabschieden, und als wir ankamen, lag er auf dem Boden. Er ist tot.«
Entsetzte Schreie gellten durch den Raum; einige Leute fingen an zu weinen.
»Ich habe den Notruf gewählt. Inzwischen sind zwei Polizisten oben. Ich gehe jetzt zu ihnen, aber Sie müssen bitte vorerst alle hierbleiben.«
Peter drehte sich noch einmal zu Fay um, aber sie schien in guten Händen zu sein. Ein paar ihrer Brüder und Schwestern umringten sie wie ein Schutzschild.
Oben im Tempel blieb er zögernd an der Türschwelle stehen.
Die Polizistin hockte neben der Leiche von Coen Zoutman und stand auf, als sie Peter sah. Ihr Kollege sprach in ein Funkgerät.
»Sie haben also das Opfer gefunden?«, fragte die Frau, während sie auf ihn zuging.
Ihre blauen Schuhüberzieher raschelten.
»Richtig«, sagte Peter. »Zusammen mit meiner Partnerin, der Frau, die eben bei mir war. Ihr Name ist Fay Spežamor. Ich habe sie begleitet; heute fand ein offener Gästeabend statt. Der Meister der Loge hat einen Vortrag gehalten, eine Einführung in die Freimaurerei. Danach sind wir hinuntergegangen. Das muss so gegen zehn gewesen sein. Es gab noch einen Umtrunk; nur der Meister ist hiergeblieben, um weitere Fragen zu beantworten. Bevor wir nach Hause gingen, wollten Fay und ich uns von ihm verabschieden. Deswegen sind wir noch einmal nach oben gegangen.«
»Sie wissen nicht zufällig, wer ihn zuletzt lebend gesehen hat?«
»Nein. Als wir nach unten gingen, sind noch mehrere Leute hier oben im Tempel zurückgeblieben, um mit dem Meister vom Stuhl zu reden.«
»›Meister vom Stuhl‹?«
»Entschuldigen Sie, ›Meister vom Stuhl‹ oder ›Stuhlmeister‹ nennt man den Vorsitzenden der Loge. Sein Name ist Coen Zoutman. Jedenfalls herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, auch unten im Foyer. Es war wie gesagt ein offener Gästeabend. Meiner Meinung nach wird es schwierig sein …«
»Der Staatsanwalt ist bereits informiert«, unterbrach der Polizist Peter. »Er leitet das kriminalpolizeiliche Ermittlungsverfahren ein und hat die Kriminaltechnik benachrichtigt. Die Kollegen sind in einer Viertelstunde hier.«
»Gut«, sagte die Beamtin, die sich als Dijkstra vorgestellt hatte. »Dann werden wir jetzt mal alles absperren, hier und unten auf der Straße. Niemand darf das Gebäude verlassen, bis wir von allen Anwesenden Namen und Adressen notiert haben.«
Unwillkürlich blickte Peter kurz zu dem Allsehenden Auge über dem Stuhl, auf dem Coen Zoutman früher am Abend noch so ruhig gesessen hatte und wo er ganz in seiner Rolle aufgegangen war.
Das Allsehende Auge als einziger Zeuge … Welche Ironie!
»Videokameras?«, fragte Dijkstra.
Es war eher eine Feststellung als eine Frage.
»Unwahrscheinlich«, erwiderte Peter. »Hier finden Rituale statt, zu denen nur Eingeweihte Zutritt haben.«
»Klingt ja richtig unheimlich«, sagte van Hal. »Geheime Rituale … und das in Leiden!«
»Hier können wir im Moment nichts mehr tun«, sagte Dijkstra. »Komm, wir gehen runter und sperren alles ab.«
Da Peter das Bedürfnis nach frischer Luft hatte, folgte er den beiden nach unten. Bis weitere zwei Einsatzwagen, ein Krankenwagen und ein Fahrzeug der Spurensicherung eingetroffen waren, hatten sie die Steenschuur in beide Richtungen mit rotweißem Flatterband abgesperrt.
Zuletzt kam noch ein SUV, den der Fahrer halb auf dem Bürgersteig parkte. Zwei Männer in Zivil stiegen aus, ein älterer mit kurzem grauem Haar und akkurat getrimmtem Schnurrbart, und ein jüngerer Mann mit Glatze.
Dijkstra ging zu den beiden Männern hinüber, um ihnen Bericht zu erstatten. Sie blickte kurz über die Schulter zu Peter, der hörte, wie sie seinen Namen nannte.
Zu dritt kamen sie auf ihn zu.
»Rijsbergen, Kripo Leiden«, sagte der Mann mit dem Schnäuzer und schüttelte Peter die Hand. »Willem Rijsbergen. Der junge Mann hier ist mein Partner, wie man so schön sagt.«
»Van de Kooij«, stellte sich dieser vor. »Ich heiße tatsächlich so, obwohl ich nicht von hier stamme«, fügte er lächelnd hinzu, in Anspielung auf das Viertel De Kooij im Norden von Leiden, das für seinen volkstümlichen Charakter und seine buntgemischten Bewohner bekannt war.
»Na schön«, sagte Rijsbergen, der kurz die Augen verdrehte, weil er diesen Witz offenbar nicht zum ersten Mal hörte.
»Willem!«, rief ein Mann, ein schlanker Fünfziger mit dunklen Locken und einem schmalen, modernen Brillengestell.
»Das muss Anton sein«, sagte Rijsbergen zu niemand bestimmtem. »Anton Dalhuizen.« An Peter gewandt fuhr er fort: »Dalhuizen ist der forensische Mediziner vom Gesundheitsamt. Wenn wir von einer unnatürlichen Todesursache ausgehen, wie in diesem Fall, übernimmt er oder einer seiner Kollegen die Leichenschau.«
Dalhuizen, der einen klassischen schwarzen Arztkoffer in der Hand trug, gesellte sich zu ihnen.
»Wie ich gehört habe, befinden sich noch Leute im Gebäude?«, sagte Rijsbergen.
»Im Foyer sind noch Gäste«, antwortete Peter. »Heute hat ein offener Abend stattgefunden, und viele Leute haben sich den Vortrag angehört. Ein großer Teil von ihnen ist allerdings schon gegangen.«
»Gibt es eine Gästeliste?«
»Meiner Meinung nach nicht. Es müssen ungefähr sechzig bis siebzig Besucher gewesen sein. Genau weiß ich es nicht. Etwa zwanzig von ihnen gehören der Loge an, daher müssen es vierzig bis fünfzig Nichtmitglieder gewesen sein.«
»Sie sind also Mitglied?«
»Nein, ich nicht. Aber meine Freundin, und ich habe sie begleitet.«
»Schön, schön«, murmelte Rijsbergen, und Peter fragte sich, ob das ironisch gemeint war, denn schließlich war nichts Schönes an der Situation.
Sie betraten das Foyer.
»Gut«, sagte Rijsbergen zu Dijkstra. »Wenn Sie und van Hal schon einmal damit anfangen könnten, die Namen der Anwesenden zu notieren? Dann sehen wir uns solange oben um.«
Peter ging mit ihnen die Treppe hinauf, aber oben angekommen fragte er sich, warum er das eigentlich getan hatte. Am liebsten hätte er diesen Ort so schnell wie möglich verlassen, wäre mit Fay nach Hause gegangen und hätte sich im Bett eng an sie gekuschelt.
Rijsbergen und Van de Kooij schlüpften in blaue Schuhüberzieher, ebenso wie Dalhuizen, der ein Paar aus seinem Koffer geholt hatte.
»Mein Gott!«, stieß Rijsbergen hervor, nachdem sie die Tempeltür geöffnet hatten und Coen Zoutman dort liegen sahen.
»Sieht ja fast aus wie an einem Filmset«, bemerkte Dalhuizen.
Einen kurzen Moment lang schienen sie zu zögern, als befürchteten sie tatsächlich, die Aufnahmen für einen Spielfilm zu stören.
»Schalte mal das Licht ein, Lockenkopf«, sagte Rijsbergen zu Van de Kooij, der als Erster hineinging und die Wand auf der Suche nach einem Lichtschalter abtastete. Schon bald hatte er ihn gefunden, und der Tempel wurde hell erleuchtet.
Der unheimliche Zauber, der durch die ausgeklügelte Beleuchtung über dem Saal gelegen hatte, war mit einem Schlag verschwunden.
Dalhuizen kniete bereits neben dem reglosen Coen Zoutman und legte ihm den Zeige- und Mittelfinger an den Hals, genau wie Peter es eben getan hatte.
»Die Todesursache scheint völlig klar zu sein«, sagte er so laut, dass Peter ihn deutlich verstehen konnte. »Ihm wurde von hinten mit einem schweren Gegenstand der Schädel eingeschlagen – ich nehme an, mit diesem Hammer hier. Meiner Einschätzung nach muss das Opfer sofort tot gewesen sein. Um dieses Winkelmaß durch das Herz zu treiben …« Rijsbergen und Van de Kooij waren näher herangegangen. »… muss wahrscheinlich erst eine Stichwunde mit einem Messer gemacht worden sein, sonst kann man nicht so einfach das Muskelgewebe und die Knochen durchdringen. Dasselbe gilt für den Zirkel durch die Hände … Trotzdem hat es große Kraft erfordert. Na schön …« Dalhuizen stand auf. »Das ist mein erster Eindruck. Alles andere überlasse ich natürlich meinem Kollegen, der die Autopsie durchführt. Meine Aufgabe hier ist beendet. Ich habe den Tod des Opfers festgestellt. Mehr gibt es für mich nicht zu tun.«
Sie kehrten auf den Treppenabsatz zurück, wo Peter noch immer stand.
»Danke, Anton«, sagte Rijsbergen.
Dalhuizen streifte die blauen Schuhschützer ab, knüllte sie zusammen und steckte sie in seinen Koffer.
»Wenn du runtergehst, kannst du den Rettungssanitätern Bescheid sagen, dass sie nicht gebraucht werden. Und bitte schicke jemanden rein, um die Treppe abzusperren.«
Dalhuizen hob den Daumen. »Meine Herren«, sagte er zum Abschied und ging.
»Das wird sicher nicht einfach werden«, bemerkte Peter. »So viele Leute in einem Raum! Das ist …«
»It is the brain«, unterbrach ihn Rijsbergen plötzlich auf Englisch mit einem kuriosen französischen Akzent, »the little gray cells on which one must rely.« Er tippte sich mit dem rechten Zeigefinger an den Kopf. »One must seek the truth within – not without.«
Peter blickte ihn verständnislos an.
Man muss die Wahrheit in sich selbst suchen, nicht außerhalb davon … Klang wie ein Motto der Freimaurer. Erkenne dich selbst, die Wahrheit liegt in dir verborgen …
»Hercule Poirot!«, sagte der Ermittler und machte damit Peters Verwirrung ein Ende. »Den kennen Sie doch bestimmt? Agatha Christie.« Er lachte herzhaft.
Peter lächelte. »Natürlich«, bestätigte er.
»Gut«, sagte Rijsbergen. »Wir warten auf das Team der Kriminaltechnik. Sie müssen gleich hier sein. Van de Kooij, rufen Sie bitte beim Staatsanwalt an?«
Peter hatte genügend niederländische Polizeiserien im Fernsehen gesehen, um zu wissen, dass der Staatsanwalt formal der Leiter der kriminalpolizeilichen Vorermittlungen war. Die Polizei musste ständig mit ihm im Kontakt stehen, unter anderem, um die Erlaubnis für besondere Ermittlungstechniken wie etwa das Abhören eines Telefons zu erhalten.
Peter machte Anstalten, zu Fay zu gehen.
»Gibt es jemanden, der bezeugen kann, dass Sie die ganze Zeit unten waren?«, fragte Rijsbergen unvermittelt. »Und dass Sie und Ihre Freundin erst nach oben gegangen sind, als der Herr dort offenbar schon tot war?«
Peter zögerte einen Moment. Er erschrak bei dem Gedanken daran, dass er natürlich auch als Verdächtiger betrachtet werden könnte. »Selbstverständlich. Viele Leute haben mich gesehen, haben uns gesehen, Mevrouw Spežamor und mich. Als wir hinaufkamen, war er schon …«
»Wie viel Zeit lag zwischen der Entdeckung der Leiche und Ihrem Anruf bei der 112?«
»Ich weiß nicht genau … Nicht mehr als eine Minute.«
»Aha«, sagte Rijsbergen. »Natürlich wurde die Anrufzeit protokolliert und das gesamte Telefongespräch aufgezeichnet. Das Problem, Meneer de Haan, besteht darin, dass der Rechtsmediziner einen Todeszeitpunkt feststellen wird. Dabei gibt es immer einen gewissen Spielraum; bis auf die Minute genau werden wir ihn nie erfahren. Aber klar ist, dass er zwischen zweiundzwanzig Uhr heute Abend – als der Vortrag zu Ende war – und Ihrem Anruf liegen muss, der gegen dreiundzwanzig Uhr erfolgte.«
»Ja, aber …«, sträubte sich Peter, der sich nicht nur allmählich aufregte, sondern auch nervös wurde, weil er genau wusste, worauf der Ermittler hinauswollte. »Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass Sie mich und meine Freundin verdächtigen, wir hätten …«
Auf Rijsbergens Gesicht erschien ein Lächeln, das anscheinend sowohl väterlich-beruhigend wirken sollte als auch Verwunderung über Peters Naivität verriet. »Nehmen Sie es nicht persönlich, Meneer de Haan«, sagte er. »In diesem Stadium können wir nichts ausschließen, das verstehen Sie doch sicherlich.«
»Soll ich die beiden aufs Präsidium bringen lassen?«, fragte Van de Kooij eilfertig.
»Einen Moment noch, Kollege. Immer mit der Ruhe.«
»Ich gelte doch nicht etwa als Verdächtiger?«, vergewisserte sich Peter.
»Es wäre natürlich ein besonders schlauer Schachzug des Mörders, höchstpersönlich die Polizei zu rufen«, erwiderte Rijsbergen, »aber ich habe schon Verrückteres erlebt.«
Diese Antwort war ganz und gar nicht dazu geeignet, Peter zu beruhigen.
»Sie und Ihre Freundin haben das Opfer gefunden, also …« Der Ermittler beendete seinen Satz nicht. »Wir sollten nicht zu voreilig sein, Meneer de Haan«, sagte er, ein wenig matt. »Wie gesagt, in diesem Stadium müssen wir alles ins Kalkül ziehen.«
Verdächtige? Wir? Beunruhigt schüttelte Peter den Kopf. Vom Standpunkt eines Polizisten aus konnte er sich das zwar vorstellen, aber er selbst fand den Gedanken zu absurd, um ihn in Worte zu fassen.
Nicht mal ich habe Fay den ganzen Abend im Auge gehabt.
Man hörte polternde Schritte auf der Treppe.
Zwei Männer und zwei Frauen, gekleidet in weite weiße Overalls aus dünnem Stoff, kamen herauf, jeweils mit einem mittelgroßen Koffer in der Hand. Die Kapuzen der Overalls hatten sie über die Köpfe gestreift, und alle trugen einen Mundschutz.
»Wir gehen jetzt rein«, sagte die Frau an der Spitze kurz angebunden und marschierte ohne ein weiteres Wort an ihnen vorbei.
»Hallo, Dexter«, begrüßte Van de Kooij den letzten in der Reihe, der mit der freien Hand locker grüßte.
Rijsbergen seufzte und sagte: »Der Vorschlag meines Kollegen ist eigentlich gar nicht so schlecht.«
Van de Kooij sah Peter so triumphierend an, als hätte er ihm am liebsten auf der Stelle Handschellen angelegt.
»Was soll das heißen?«, stotterte Peter.
»Dass Sie und Ihre Freundin gleich getrennt voneinander ins Präsidium gebracht werden.«
Peter war sprachlos.
»Bis dahin dürfen Sie nicht miteinander reden.«
2
Früher am selben Tag
Das Heizöfchen lief auf vollen Touren, spendete aber nicht besonders viel Wärme. Sobald sich eine Seite seines Körpers ein wenig aufgeheizt hatte, drehte Peter sich um, und die andere Seite war dran. So wendete er sich hin und her, immer mit dem Buch Mayflower von Christopher Hilton in den Händen, das ausführlich die Geschichte der Pilgerväter erzählte. Es war keine besonders bequeme Art zu lesen, aber an diesem Nachmittag war es ruhig im Leidener Pilgermuseum, und Peter hatte ansonsten nichts weiter zu tun.
Er hatte vor einiger Zeit Jeffrey Banks persönlich kennengelernt, einen aus den USA stammenden Kunsthistoriker, der das Museum leitete. Er war eine wandelnde Enzyklopädie, besaß einen trockenen Humor und trug stets ein leicht ironisches Lächeln auf den Lippen, wenn er die Besucher durch das kleine Museum führte, in dem es nur zwei Räume gab: das »Wohnzimmer« und die »Küche«.
Im Hinblick auf das bevorstehende vierhundertjährige Jubiläum des Aufbruchs der Pilgerväter aus Leiden war Jeffrey bestrebt gewesen, das Museum häufiger zu öffnen als bisher nur mittwoch- und samstagnachmittags von dreizehn bis siebzehn Uhr. Peter hatte sich für die beiden festen Nachmittage freiwillig gemeldet, und aus diesem Grund saß er nun hier im Wohnzimmer, das mit Originalmöbeln aus der damaligen Zeit eingerichtet war. Besucher des bescheidenen Museums traten buchstäblich in das frühe 17. Jahrhundert ein – nur das Heizöfchen störte.
Man gelangte durch eine zweigeteilte Hoftür hinein, deren obere Hälfte man separat öffnen konnte, wenn jemand schellte oder ans Fenster klopfte.
Der Boden des Wohnzimmers bestand aus terrakottafarbenen Fliesen, und der Raum wurde von einem großen Tisch dominiert, auf dem Geschichtsbücher über die Pilgerväter ausgelegt waren. Darum herum standen Korbstühle, die ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert stammten. Vor ein Fenster hatte man einen kleinen Tisch gestellt, auf dem weitere Bücher lagen, von denen eines aufgeschlagen war. Der Stuhl vor dem Tisch war schräg beiseitegeschoben worden, als mache der Leser des Buches nur rasch eine Besorgung und könne jeden Moment zurückkehren.
Die dicken, offen liegenden Stützbalken trugen ebenso zu der rustikalen Atmosphäre bei wie die kleinen originalen Kacheln an der Wand und am Bett.
In manchen Momenten wähnte sich Peter tatsächlich in einer anderen Zeit, vor allem wenn er am späten Nachmittag auf seinem Stuhl saß, von vollkommener Stille umgeben, und seine Augen durch das Zimmer wandern ließ, das nur von drei großen Kerzen erleuchtet wurde.
In letzter Zeit hatte sich die Zahl der Besucher beträchtlich erhöht. Fast die Hälfte der Touristen kam aus den USA, der neuen Welt, zu der die Pilger nach gut elf Jahren in Leiden 1620 aufgebrochen waren. Aber an diesem Tag war es ruhig.
Peter de Haan, achtundfünfzig Jahre alt, Dozent für Archäologie und Geschichte, war mittlerweile – seine Studienzeit mitgerechnet – seit genau vierzig Jahren an der Universität Leiden. Zwei Jahre zuvor war er bei der Nachbesetzung einer Professorenstelle nicht zum Zuge gekommen, nachdem sein Chef Arnold von Tiegem plötzlich verstorben war. Ebenso wie nach der Emeritierung seines ehemaligen Professors Peter Lucas vor über zwanzig Jahren hatte die Verwaltung auch diesmal einen anderen Kandidaten ihm vorgezogen. Er wusste, dass manche Leute aus diesem Grund ein wenig mitleidig auf ihn herabsahen, aber ihn selbst hatte die Professur ohnehin nie übermäßig interessiert.
Allerdings arbeitete Peter seit dieser Zeit einen Tag weniger pro Woche, wodurch er mehr Zeit für Ehrenamtliches wie dieses hatte, aber vor allem auch für seine Freundin.
Fay Spežamor.
Nachdem sie sich im Rijksmuseum van Oudheden begegnet waren, wo Fay neben ihrer Tätigkeit als Dozentin für Griechisch und Latein als Konservatorin für römische und etruskische Kunst arbeitete, war zunächst eine Freundschaft zwischen ihnen entstanden, die mit der Zeit – für sie beide vollkommen unerwartet – zu einer Liebesbeziehung geworden war.
Fay, deren Mann kurz nach der Geburt ihrer Tochter Agapé an Krebs gestorben war, war eine außergewöhnlich lebendige Frau Anfang fünfzig mit einer unerschöpflichen Faszination für alles, was mit der klassischen Antike zu tun hatte. Sie hatte schulterlanges Haar, das mehr grau als schwarz war, unverkennbar slawische Züge, eine schmale Gestalt und ein etwas mageres Gesicht, aber Augen, die wütend aufleuchten konnten, wenn sie für ihre Überzeugungen eintrat, und mit denen sie Peter voller Liebe ansah, einer Liebe, mit der sie beide nach ihrer langen Zeit als Singles gar nicht mehr gerechnet hatten.
Peter erschauderte kurz.
Obwohl der astronomische Frühling vor fast einem Monat begonnen hatte, war es immer noch kalt, vor allem in diesem alten Gebäude mit Einfachverglasung, in das nie direktes Sonnenlicht einfiel.
Jemand klopfte ans Fenster.
Peter drehte den Heizofen runter und legte das Buch beiseite, ein Lesezeichen zwischen die Seiten geklemmt. Als er aufstand, erinnerten ihn seine schmerzenden Schultern daran, wie verkrampft er in den letzten Stunden auf dem Stuhl gesessen hatte. Ein wenig steif ging er an die Tür und öffnete die obere Hälfte.
Das fröhliche Gesicht von Willem Hogendoorn strahlte ihm entgegen. »Einen wunderschönen guten Tag, Peter!«, begrüßte er ihn.
Hinter ihm wartete eine kleine Gruppe von Leuten.
Peter kannte Willem inzwischen schon ganz gut. Er war ein großer Mann, nicht ganz glatzköpfig, aber nur noch mit einem Kranz von schütterem Haar rings um den Schädel und einem offenen Gesicht, dessen gesunde Farbe verriet, dass er sich viel an der frischen Luft aufhielt. Regelmäßig besuchte der ehemalige Kriminalkommissar, der sich nach seiner Pensionierung mit selbst ausgetüftelten Stadtführungen etwas dazuverdiente, mit einer seiner Gruppen das Museum. Seine Spaziergänge hatten verschiedene Themen, darunter auch die »Pilgerfahrt«, die im Museum begann und sich wachsender Popularität erfreute.
»Kommen Sie rein!«, sagte Peter und öffnete auch die untere Hälfte der Tür.
Die Touristen entrichteten jeder ein Eintrittsgeld von fünf Euro, das Peter in eine Blechdose auf dem Tisch steckte. Mit acht Leuten, einschließlich Peter und Willem, war tatsächlich auch schon die Höchstzahl von Besuchern erreicht, die das Museum betreten durften, weil es in den kleinen Räumen sonst einfach zu eng wurde.
»Dieses Haus, meine Damen und Herren«, begann Willem sogleich, »ist genauso eingerichtet, wie es die Häuser zu Zeiten der Pilgerväter in Leiden waren. Das Gebäude selbst stammt aus dem 14. Jahrhundert; erbaut wurde es zwischen 1330 und 1365. Es wurde mehrmals umgebaut, zerstört und wieder aufgebaut, aber bei allem, was Sie hier sehen, handelt es sich um Originale; jeder Stuhl, jeder Tisch, jeder Schrank stammt aus dem 17. Jahrhundert.«
Willem entfernte sich ein paar Schritte von der Gruppe und trat vor die historische Karte von Leiden, die über dem Schreibtisch an der Wand hing.
»Die Pilgerväter waren sogenannte Separatisten. Sie gehörten damit einer besonders radikalen Strömung des englischen Puritanismus an, die der Meinung war, dass die Church of England die Reformation nicht in letzter Konsequenz zu Ende geführt habe. So hatte man beispielsweise Hierarchien und Rituale beibehalten, Bischöfe und Erzbischöfe, Weihrauch, Gewänder und so weiter. Die Separatisten forderten deswegen absolute Gemeindeautonomie.«
»Das war zu der Zeit von King James, nicht wahr?«, fragte eine Touristin, eine unscheinbare Frau, die zwar Niederländisch sprach, aber mit einem englisch angehauchten Akzent.
Ein Mann nickte beflissen; er schien zu ihr zu gehören. Er trug einen grauen Vollbart und eine teure Kamera über dem imposanten Bauch.
»Richtig«, bestätigte Willem. »Es war Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, während der Regierung von King James beziehungsweise König Jakob I., wie er hier genannt wird. Nach seiner Thronbesteigung 1603 verschlimmerte sich die Lage der Separatisten zusehends. Jakob wollte nichts von einer Trennung wissen und eröffnete die Jagd auf diese puritanische Gruppe.«
»Puritanisch«, wiederholte der dicke Mann lächelnd und fügte mit deutlich afrikaanssprachigem Einschlag hinzu: »Das Wort höre ich gerne.«
Peter zog die Augenbrauen hoch, aber Willem ignorierte die Bemerkung des Mannes und fuhr ungestört fort.
»Die Menschen fanden kaum noch Arbeit«, erzählte er. »Sie durften nicht ohne Erlaubnis reisen und wurden häufig zu Sündenböcken gemacht und zu Unrecht der verschiedensten Übertretungen und Verbrechen beschuldigt. 1608 beschloss eine Gruppe von Puritanern aus Scrooby in Nottinghamshire zu flüchten. Diese Leute, die später als Pilgerväter bezeichnet wurden, brachen heimlich nach Amsterdam auf. In den Niederlanden herrschte größere religiöse Toleranz, und das Land erlebte einen wirtschaftlichen Aufschwung. Es war auch recht friedlich, da es sich in einem zwölfjährigen Waffenstillstand mit Spanien befand. Schon nach relativ kurzer Zeit«, sagte Willem und berührte mit der rechten Hand die alte Karte, »beschloss der religiöse Führer dieser puritanischen Gruppe, John Robinson, von Amsterdam aus weiter nach Leiden zu ziehen. Hier gab es viel Arbeit in der Leinenindustrie, für die man kein Vorwissen brauchte, nur Muskelkraft. Sie ließen sich hier«, er deutete es mit kreisförmigen Bewegungen auf der Karte an, »nieder, rings um die Pieterskerk, unter anderem dort, wo sich jetzt das Pesijnhofje befindet, das wir anschließend besichtigen werden.«
Die Touristen, die sich in einem Halbkreis rings um den großen Tisch geschart hatten, hörten aufmerksam zu.
»Die Pilger haben insgesamt gut elf Jahre hier in Leiden gelebt und während dieser Zeit hart gearbeitet und Geld gespart. Dann beschloss ein Teil der Gruppe, nach Amerika aufzubrechen. Die meisten blieben jedoch hier, daher gibt es in Leiden bis heute noch viele Nachfahren der damaligen Pilger. Man erkennt sie an Nachnamen wie Cooke, Cooper oder Turner.«
»Dürfen wir hier fotografieren?«, wurde Peter gefragt, der zustimmend nickte.
Es war, als hätten die Besucher nur auf diese Gelegenheit gewartet, denn sofort begannen sie eifrig, mit Kameras und Handys zu fotografieren. Es war gar nicht so leicht, in dem kleinen Museum Fotos zu machen, auf denen keine anderen Leute zu sehen waren, daher entstand eine komplizierte Choreografie von Ausweichbewegungen, Drängen und Nachgeben, um einander Platz zu machen.
»Nebenan befindet sich noch die Küche«, erklärte Willem. »Um sie zu besichtigen, müssen wir außen herum gehen, da die beiden Räume nicht miteinander verbunden sind.«
Er nickte Peter kurz zu, der den Schlüssel aus einer Schublade holte und ihn Willem reichte.
»Bitte folgen Sie mir«, sagte Willem.
»Warum sind die Leute damals eigentlich nach Amerika ausgewandert?«, hörte Peter eine Touristin fragen, als die Gruppe hinausgegangen war.
Er lächelte.
Es wurden immer wieder dieselben Fragen gestellt, aber das war ja auch nicht weiter verwunderlich. Nach dem, was er inzwischen von Willems Erklärungen aufgeschnappt hatte, wäre er inzwischen selbst in der Lage gewesen, eine Führung zu geben.
»Das ist eine sehr gute Frage«, antwortete Willem der Frau, die sich über das Kompliment sichtlich freute. »Es gab eine ganze Reihe von Gründen dafür. Einer davon war, dass die Separatisten den englischen König noch immer provozierten und sie auch in den Niederlanden Angst vor Repressionen hatten. Außerdem war der vereinbarte Waffenstillstand mit den Spaniern beinahe verstrichen, und es wurde allmählich unruhiger in den Niederlanden. Hinzu kam, dass viele der Puritaner die niederländische Gesellschaft als zu freizügig empfanden und sich nicht integrieren wollten. Sie wollten unter sich bleiben und sich nicht mit den Niederländern vermischen. Es kam zu religiösen Differenzen, zu kompliziert, um sie an dieser Stelle zu erklären, in die sie nicht hineingezogen werden wollten. Wie Sie sehen, gab es diverse Gründe. Viele Pilger hegten einfach den Wunsch, in einem neuen Land einen Neuanfang zu machen, ohne dass sich andere einmischten, und ihren Glauben so ausleben zu können, wie sie es wollten.«
»Verständlich«, mischte sich der Südafrikaner nun wieder ein. »Deswegen hatten wir bei uns die Apartheid, und damals war Zucht und Ordnung in Südafrika. Jetzt ist alles Chaos.«
Daraufhin trat ein unbehagliches Schweigen ein.
Seine Frau blickte sich in der Gruppe um, einen verbissenen Zug um den Mund, als bereite sie sich auf eine Diskussion vor, die sie bereits öfter geführt hatte.
»Wenn Sie mir bitte folgen wollen«, sagte Willem und lockerte damit die angespannte Atmosphäre.
Erleichtert folgte ihm die Gruppe zu der Straßenecke, an der sich der zweite Eingang befand.
»Sie kommen also aus Südafrika?«, fragte Peter das Ehepaar, das ein wenig zurückgeblieben war, als überlege es, ob es noch weiter an der Führung teilnehmen sollte.
»Ja, van Suidafrika. Zu Hause sprechen wir Afrikaans, aber wir habe immer auch Hollands gesprochen. Das war wichtig für mir.«
»Ihre Vorfahren …«, setzte Peter zu einer Frage an, aber der Mann ließ ihn nicht ausreden.
»Meine Vorfahrens sind vor über hundertfünfzig Jahren nach Suidafrika ausgewandert, sie kamen aus Leiden, sie waren Hugenotten. Deshalb sind wir hiergekommen, auf der Suche nach unsere Wurzels. Unsere Vorfahrens waren Voortrekker, Pioniere. Die Oupa von meine Oupa war einer von die Gründer von die Oranje Vrystaat. Sie sind mit den Buren aus der Kapkolonie weggezogen, als die Engländer kamen. Nach Norden sind sie gezogen, das war der Groot Trek. Sie waren auch eine Art Pilger.«
Peter nickte. Obwohl ihm die vorherigen Äußerungen des Mannes unangenehm gewesen waren, fand er es als Historiker wie immer interessant, sich mit Leuten zu unterhalten, die radikal anders dachten als er.
»Deshalb wohnen wir jetzt in Orania, einem Gebiet nur für Weiße, das ganz und gar autark ist«, legte der Mann noch eine Schippe obendrauf. »Wir haben unseren eigenen Freistaat gegründet, wie der Oupa von meine Oupa. Wir haben unser eigenes Geld, eigene Schulen, eigene Richter. Niemand macht uns Vorschriften. Wir wollen auch unter uns bleiben und uns nicht vermischen, wie die Puritaner.«
»Das ist …«, sagte Peter, der nicht recht wusste, wie er auf diese Offenheit reagieren sollte.
»Genau wie die Pilger«, fuhr der Mann fort. »Sie wollten auch unter sich bleiben. Und sie sind auch in ein anderes Land gezogen, in dem es nur primitive Völker gab, um einen Neuanfang zu machen, als gläubige Christenmenschen. Aber sie haben es besser gemacht als wir, sie haben die Ureinwohner ausgerottet, wie Josua im gelobten Land.«
»Ich glaube nicht, dass das …«, begann Peter zögernd. »Wir in den Niederlanden betrachten das aus einer anderen Perspektive. Wir halten es für …«
Der Mann sah ihn an, den Kopf schräg geneigt, das Kinn erhoben, die Unterlippe geschürzt, als hätte er bereits eine Antwort parat, egal, was Peter sagen würde.
»Kommen Sie, wir gehen zu den anderen«, brach Peter die Unterhaltung kurzerhand ab.
Sie würden sich bloß in eine fruchtlose Diskussion verstricken, wenn er auf die letzten Äußerungen des Mannes näher einginge – auch wenn er spürte, dass er auf diese Art und Weise den Weg des geringsten Widerstands wählte.
»In Ordnung«, sagte die Frau.
Dem Mann schien es jetzt erst zu dämmern, dass das Gesprächsthema abgeschlossen war.
Peter und die beiden südafrikanischen Touristen gesellten sich zu den anderen, die den zweiten Raum des Museums bereits betreten hatten. Sie gelangten zunächst in einen kleinen Flur. Eine Steintreppe führte hinunter zur Küche, die etwa anderthalb Meter unter dem Straßenniveau lag. Auf einem langen unlackierten Holztisch lagen verschiedene Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge und Küchenutensilien, aber auch eine dicke, jahrhundertealte Bibel mit Eisenbeschlag.
Im offenen Kamin und in einer Ecke der Küche lagen Holzscheite und große Stücke Torf. Über dem glimmenden Feuer hing ein Kochtopf, leer, aber im Prinzip bereit für den Gebrauch.
»In den englischen Kolonien«, erklärte Willem soeben der Gruppe, »gab es aufgrund von Mangelernährung und zahlreichen Krankheiten sehr hohe Sterberaten, während andererseits nicht genug neue Leute hinzukamen. Die Pilger waren daher mehr als willkommen in Amerika. Wobei nicht alle Pilger ausgewandert sind, wie ich bereits sagte, sondern nur diejenigen, die den Mut hatten, die gesund waren und genug Geld für die Überfahrt besaßen. Sie nahmen noch eine letzte gemeinsame Mahlzeit im Haus ihres Anführers ein, Pfarrer John Robinson, und brachen am 21. Juli 1620 nach Delfshaven auf, wo die Speedway, ein kleines Schiff, auf sie wartete. Damit fuhren die Männer, Frauen und Kinder nach Plymouth in England, von wo aus sie mit der Mayflower in See stachen.«
Peter ging hinüber zum offenen Kamin.
»Das hier ist interessant«, sagte er und legte die Hand auf die eiserne Hängevorrichtung, an der der Topf befestigt war. »An diesem Gestell kann man den Topf höher oder niedriger über die Feuerstelle hängen, mithilfe dieser hervorstehenden Haken. Man kann sich vorstellen, dass das Eisen glühend heiß wurde, wenn es über dem offenen Feuer hing, sodass man es nicht berühren konnte. Daher stammt der Ausdruck ›ein heißes Eisen‹, wenn ein bestimmtes Thema zu heikel ist, um darüber zu reden, etwa die Sklavereivergangenheit der Niederlande, die Kriegsverbrechen in Indonesien oder die Apartheid in Südafrika.«
Das südafrikanische Ehepaar blickte starr geradeaus, während die anderen in der Gruppe bei dem Seitenhieb grinsten.
»Wie dem auch sei«, übernahm jetzt wieder Willem. »Um meine Geschichte zu beenden: Am 6. September 1620 verließ die Mayflower England mit siebenundfünfzig Leidener Bürgern an Bord. Auf der Reise gab es viele Probleme, und erst nach gut zwei Monaten, am 9. November, sahen die Reisenden zum ersten Mal Land. Nach einigen Erkundungsausflügen fanden die Pilger am 11. November ein geeignetes Fleckchen in Neuengland. Ihre Niederlassung nannten sie Plymouth Colony. Sie sollte die erste Ansiedlung in den USA werden, die permanent bewohnt bleiben würde.«
»Echte Pioniere«, bemerkte der Südafrikaner.
»In der Tat«, bestätigte Peter, »aber ohne die Hilfe der ›Eingeborenen‹ wären in den ersten Wochen alle Pilger umgekommen. Dadurch, dass sie im Winter angekommen waren, fanden sie kaum etwas zu essen. Strenger Frost und Schneefälle machten es unmöglich, Häuser zu bauen. Vor allem den schwachen und jungen Auswanderern machten diese Umständen zu schaffen, sodass die Hälfte der Passagiere und der Besatzung starb. Die anderen überlebten nur durch die Hilfe der Wampanoag-Indianer. Sie brachten den Siedlern Nahrung und Gebrauchsgegenstände und zeigten ihnen, welche Gewächse sie anbauen konnten und wo es Fische gab. Doch wir alle wissen, wie die Hilfsbereitschaft der ersten Indianer von den Siedlern belohnt wurde, denn …«
»Vielen Dank«, unterbrach ihn der Südafrikaner, dem es jetzt reichte. »Wir machen uns auf den Weg, danke, das war sehr interessant.« Er streckte seine Hand aus, die groß wie eine Kohlenschaufel war, und schüttelte erst Willem und danach Peter die Hand, wobei er viel fester und länger zudrückte als nötig.
Peter versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, ärgerte sich aber über diese kleine Racheaktion.
»Baie dankie«, sagte der Mann lächelnd.
Auch seine Frau bedankte sich, allerdings nicht mit Handschlag.
Ohne eine Antwort abzuwarten oder sich noch weiter zu verabschieden, stieg das Paar die Treppe hinauf und verließ das Gebäude.
Sobald die Tür hinter ihnen zugeklappt war, ging ein kollektives Aufatmen durch die Gruppe.
»Was für unangenehme Leute! Ich bin froh, dass sie weg sind«, sagte die Frau, die eben nach den Gründen für die Auswanderung gefragt hatte, und die anderen nickten bestätigend.
Willem bot ihnen noch kurz die Gelegenheit, Fotos zu machen, und erneut nutzten alle sie dankbar.
Nachdem sie sich verabschiedet hatten, kehrte Peter zurück ins Wohnzimmer, wo er sich wieder auf seinem Stuhl neben dem Heizöfchen niederließ, dessen Thermostat er wieder weit aufdrehte.
Mit der linken Hand rieb er sich die schmerzende Rechte.
Noch einmal dachte er an die Worte des Mannes aus Südafrika: Sie wollten auch unter sich bleiben. Aber sie haben es besser gemacht als wir …
Fragment eins – Flucht aus England(Januar1609)
Wir haben es geschafft. Wir sind in Sicherheit.
Vorläufig.
William (Brewer – PvV) hat uns in die Fremde geführt, gemeinsam mit John (Robinson –PvV), im Jahre des Herrn1608. Die Bitte »Lass mein Volk ziehen!« vermochte das harte Herz des Königs nicht zu erweichen, und so mussten wir heimlich, wie Diebe in der Nacht, unser geliebtes England verlassen. Nein, das Meer teilte sich nicht, und die Soldaten des Königs ertranken nicht, aber auf einem von Gott gesandten Schiff gelang es uns zu entkommen, anfangs nur die Männer.
Ein Jahr zuvor hatten wir es schon einmal versucht und waren verraten worden. Wir hatten dem englischen Kapitän einen hohen Preis gezahlt, der uns in die Niederlande bringen sollte, wo Religionsfreiheit herrschte. In kleinen Gruppen, weil es sonst zu auffällig gewesen wäre, waren wir von Scrooby aus zu Fuß nach Boston an der Ostküste gelaufen. Nachdem wir uns eingeschifft hatten, zeigte sich, mit was für einem schlechten Menschen wir in See gestochen waren. Der Teufel soll ihn holen! Kaum waren wir an Bord, da erschien schon ein Schiff aus der Flotte des Königs. Der Kapitän hatte unser Vorhaben verraten. Wir wurden alle sechzig verhaftet, Männer, Frauen und sogar kleine Kinder. Zur Belustigung des Volkes – und zur Abschreckung natürlich – mussten wir in einem Umzug durch das Stadtzentrum ziehen. Die Leute bewarfen uns mit faulem Obst und Eiern … Ins Gefängnis haben sie uns gesteckt, ein dreckiges, finsteres Rattenloch. Schimmeliges Brot gaben sie uns zu essen, und das Wasser stank, aber sogar dort sprachen wir uns noch Mut zu, auch dort fanden wir Trost in Gesang und Gebet.
John sprach ganz wundervoll, und er zitierte die berühmten Worte des Paulus: »Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist.«
Einen Monat Gefängnis hielt man wohl für Strafe genug, dann wurden wir nach Hause geschickt, in Schmach und Schande, aber vor allem mittellos.
Doch wenn sie glaubten, dass dieser Rückzug uns den Wunsch zu gehen ausgetrieben hätte, irrten sie sich.
Ein Jahr später, im Jahre des Herrn1608, wagten wir daher einen zweiten Versuch. Inzwischen waren wir noch mehr geworden, mindestens hundert Seelen. Der Segen des Herrn ruhte auf unserem Werk.
So schien es jedenfalls.
Wir Männer gingen zu Fuß von Scrooby in Nottinghamshire zur Nachbargemeinde Lincolnshire, zu dem Strandabschnitt zwischen Grimsby und Hull, den wir wegen seiner Einsamkeit ausgewählt hatten. Die nächstgelegenen Dörfer, Immingham und Killingshire, bestanden nur aus wenigen kleinen Bauernhöfen. Unser Unterfangen war gefährlich, weil wir keinerlei Deckung hatten. Ein aufmerksamer Hirtenjunge oder ein Landarbeiter, der gerade eine Pause einlegte, hätte schon gereicht, um unseren zweiten Versuch, das Land unerlaubt zu verlassen, wiederum scheitern zu lassen. Unterwegs tranken wir mit den hohlen Händen aus Bächen und aßen von dem kargen Proviant, den wir von zu Hause mitgenommen hatten.
Für die Frauen und Kinder hatten wir die Überfahrt geregelt. Ihr Boot mit unserem ganzen Besitz war schneller als wir, aber auf eine der vielen Sandbänke aufgelaufen, sodass die Passagiere gezwungenermaßen die Nacht dort draußen verbringen mussten.
Als wir im Laufe des frühen Morgens wieder mit unseren Frauen und Kindern vereint waren, sahen wir, dass das Schiff des niederländischen Kapitäns in die breite Flussmündung einfuhr. Doch weil noch Niedrigwasser war, konnte es nicht näher kommen, obwohl die Zeit drängte. Mit der Schaluppe wurden so viele von uns wie möglich an Bord gebracht, zuerst die Männer, eine Entscheidung, die wir im Nachhinein bereuten, denn kaum waren wir auf dem Schiff, schon sahen wir, wie ein Trupp Soldaten den Strand stürmte. Wie verzweifelt wir uns fühlten, wir Männer, als wir mit ansehen mussten, wie unsere Frauen und Kinder von den erbarmungslosen Soldaten aus dem Heer König Jakobs vom Strand abgeführt wurden! Wir konnten nur hilflos zusehen, vom Deck des heftig in der Brandung schaukelnden Schiffes aus. Einer von uns wollte über Bord springen, um seiner Frau und seinen Kindern zu helfen, aber er wäre gewiss in den brausenden Wogen ertrunken. Und was hätte er ausrichten können, falls er den Strand erreicht hätte, ein einzelner gegen die Übermacht der bis an die Zähne bewaffneten Soldaten?
Ich habe »Männer«geschrieben, aber unter uns befand sich auch ein Knabe, der unter dem besonderen Schutz von Josh stand, einem unserer Anführer. Der Kleine wich ihm nicht von der Seite und umklammerte oft seine Hand – oder, wenn das nicht möglich war, seinen Rockzipfel.
Der Kapitän erhörte unser Flehen nicht und lichtete den Anker. So sahen wir Feiglinge, wie unsere Frauen und Kinder rücksichtslos fortgebracht wurden, während unser Schiff immer weiter in Richtung der offenen See trieb.
Nicht lange darauf gerieten wir in einen unvorstellbar heftigen Sturm. Viele von uns glaubten fest, dass unsere Geschichte hier schon enden würde. Bis nach Norwegen trieben wir ab, wodurch unsere Reise zwei Wochen anstatt der zwei Tage dauerte, die normalerweise für die Überfahrt benötigt wurden.
Verzweifelt hockten wir an Bord, betend, todkrank und von Übelkeit geschüttelt. Wir mussten ständig erbrechen und wurden zusehends schwächer. Wie Gespenster irrten wir über das Deck und durch die Räume, während unser Schiffchen den Elementen ausgeliefert war. Die Vorräte waren für eine so lange Überfahrt nicht berechnet – unsere Rettung war, dass wir weniger Leute waren als geplant.
Josh teilte die karge Ration, die ihm genau wie den übrigen zugeteilt wurde, sogar noch mit dem kleinen Jungen, der dadurch der am besten genährte Passagier des ganzen Schiffs war. Niemand kannte den Jungen, aber es wagte auch niemand, nach seiner Herkunft zu fragen. Wir wussten, dass er eine Waise war – ebenso wie Josh hatte er keine Menschenseele auf dieser Welt –, aber mehr als das war nicht bekannt.
Häufig zogen sie sich an ein ruhiges Plätzchen unter Deck zurück, wo Josh unaufhörlich auf den Jungen einredete, wie ein Verkäufer, der auf dem Markt einem Kunden seine Ware aufschwatzen will. Der Junge schien dann seine Worte zu wiederholen und nickte dabei hin und wieder ernsthaft.
Nach dieser schrecklichen Reise kamen wir endlich in Amsterdam an. Über viele Umwege erfuhren wir vom Schicksal unserer Frauen und Kinder: Man hatte sie ins Gefängnis geschleift, weil niemand wusste, was man mit ihnen anfangen sollte. Aber war nicht ihr einziges Verbrechen gewesen, dass sie ihren Männern und Vätern hatten folgen wollen? Daher erhielten sie schließlich die Erlaubnis, England zu verlassen.
Im August1608waren wir wieder vollzählig, etwa hundertfünfzig Männer, Frauen und Kinder. In Amsterdam schlossen wir uns John Smyth an, einem guten Freund von John. Schließlich waren wir nicht die ersten Separatisten, die wegen der Verfolgung durch Jakob I. aus England geflüchtet waren. Doch unsere Ruhe war nur von kurzer Dauer, denn auch hier entstand Zwietracht. John Smyth fühlte sich mehr und mehr von den Vorstellungen der Mennoniten angezogen, die keine Kinder, sondern nur Erwachsene tauften, und er wollte sie uns aufdrängen.
»Unser« John beschloss, dass es Zeit war zu gehen und Amsterdam hinter uns zu lassen. Er schrieb an den Gemeinderat der Stadt Leiden.
Das Jahr des Herrn1609hatte gerade erst begonnen.
3
Peter schloss das Museum ab und ging hinüber zum Lipsiusgebäude, um in der Unimensa eine Kleinigkeit zu essen und Kaffee zu trinken. Danach radelte er gemütlich zum Jean Pesijnhofje in der Nähe der Pieterskerk, wo Fay ihm schon durch das große Tor entgegenkam.
»Hallo, Schatz«, begrüßte sie ihn, liebevoll wie immer. Sie küsste ihn sanft auf die Wange, zart wie ein Schmetterling, und umarmte ihn. »Wie schön, dass du heute Abend mitkommst!«
Nachdem er sein Fahrrad abgeschlossen hatte, gingen sie Arm in Arm in Richtung der Rapenburg.
Vor drei Jahren war Fay Ishtar beigetreten, einer Loge innerhalb der Gilde der Freimaurer. Diese Loge, die sowohl Männer als auch Frauen aufnahm, hielt heute einen offenen Gästeabend ab. Alle zwei Wochen trafen sich die Mitglieder im Leidener Freimaurerzentrum an der Steenschuur, nicht nur, um sich selbst besser kennenzulernen, sondern auch, um einander auf diesem Weg der Einkehr, Besinnung und Selbstverbesserung zu begleiten, so hatte Fay es Peter erklärt. Gemeinsam dachten sie über ihr Verhältnis zu ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt nach.
Peter wusste, dass Fay sich von Anfang an von der Gemeinschaft aufgenommen gefühlt hatte. Sie sagte, dort bestehe ein aufrichtiges Interesse füreinander, und es verbinde sie der gemeinsame Wunsch, an sich selbst zu arbeiten und auf dieser Basis eine bessere und schönere Welt aufzubauen.
»Heute Nachmittag hatte ich einen ziemlich bizarren Besucher im Museum«, erzählte Peter.
»Wieder einen direkten Abkömmling der Pilgerväter?«, fragte Fay mit leicht ironischem Unterton.
»Das nicht«, antwortete Peter lachend. »Dieser war ein ferner Nachkomme eines Hugenotten, der im 19. Jahrhundert von Leiden aus nach Südafrika ausgewandert war.«
Die Hugenotten waren Calvinisten, protestantische Anhänger des schweizerischen Kirchenreformers Calvin, die im Frankreich des 16. Jahrhunderts unbarmherzig verfolgt wurden. Nach den abscheulichen Morden in der Bartholomäusnacht vom 23. auf den 24. August 1572, in der Tausende Hugenotten ermordet wurden, flüchteten viele aus Frankreich. Zahlreiche von ihnen gelangten in die Niederlande. In Leiden erinnerten bis heute Nachnamen wie Labruyere, Montanje, Parmentier und Labuschagne an jene Zeit.
»Erzähl!«, ermunterte ihn Fay.
»Es war ziemlich bizarr, wie gesagt«, fuhr Peter fort. »Willem Hogendoorn kam mit einer Gruppe Touristen vorbei, darunter einem südafrikanischen Ehepaar, das in Orania wohnt. Als sie weg waren, habe ich es noch einmal gegoogelt. Es ist eine Art Freistaat, den Weiße nach dem Ende der Apartheid gegründet haben. Nichtweiße sind dort nicht willkommen. Sie haben ihre eigene Währung, eigene Schulen, eigene Zeitungen, ein eigenes Rechtssystem, eine eigene Verwaltung usw. Der ›Oupa von seinem Oupa‹, wie sich der Mann ausgedrückt hat, ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Leiden aus nach Südafrika gegangen und gehörte zu den Gründern des Oranje-Freistaats, vergleichbar mit dem heutigen Orania. In den Pilgervätern erkannte er viel von dem damaligen Pioniergeist wieder – Menschen, die an einen anderen Ort ziehen, um dort einen Neubeginn zu wagen, eine eigene Gesellschaft aufzubauen an einem Ort, von dem sie glauben, dass er ihnen von Gott vorherbestimmt ist.«
»Das ist doch nichts Besonderes?«
Sie gingen an der Rapenburg vorbei. Es war noch hell und ziemlich kühl. Auf der glatten Wasseroberfläche der breiten Gracht spiegelten sich die Bäume und die Fassaden der vornehmen Herrenhäuser wider.
»Nein, das war an sich nichts Besonderes«, stimmte Peter ihr zu, »aber der unverhohlene Rassismus dieses Mannes … Er hat ganz offen bedauert, dass die Apartheid abgeschafft worden ist, und behauptet, Südafrika versinke seitdem im Chaos. Und er sagte, die Pilgerväter und andere Siedler in Afrika hätten es besser gemacht als sie, indem sie die ursprüngliche Bevölkerung so gut wie ausgerottet hätten.«
»So offen hört man das tatsächlich selten.«
»Und das hat mich eben so erstaunt«, sagte Peter. »Natürlich weiß ich, dass es Leute gibt, die so denken, aber so dreist zu sein, das unverblümt auszusprechen, und dann noch jemandem gegenüber, den man gerade erst kennengelernt hat … Das fand ich ziemlich schockierend, um ehrlich zu sein.«
»Trotzdem sollte man Leuten, die so denken, ganz entschieden entgegentreten«, meinte Fay.
»Kann schon sein … Ich bin diesmal nicht näher darauf eingegangen, das war vielleicht ein bisschen feige, aber ich habe einfach befürchtet, dass wir uns in eine fruchtlose Diskussion verstricken würden.«
»Sehr vernünftig, Schatz«, sagte Fay und drückte seinen Arm.
Inzwischen hatten sie den Van der Werfpark passiert, überquerten die Groenebrug und bogen links in die Steenschuur ein, wo die Tür zum Gebäude der Freimaurer bereits einladend offen stand.
Im selben Haus hatte noch eine zweite Freimaurerloge ihre Räumlichkeiten, La Vertu, »Die Tugend«, die ausschließlich Männern vorbehalten und 1757 gegründet worden war, was sie zu einer der ältesten Logen der Niederlande machte. Sie stand landesweit auf Rang sieben. Die älteste Loge der Niederlande befand sich in Den Haag, L’Union Royale, gegründet 1734 und damit die Nummer eins.
In der offenen Tür wartete ein älterer Mann, um die Gäste willkommen zu heißen. Er war in einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Fliege gekleidet und trug einen gepflegten grauen Ringbart – ein richtiger feiner Herr; es fehlte nur das Monokel.
Fay umarmte ihn kurz, was Peter übertrieben fand, aber nachdem sie hineingegangen waren, stellte er fest, dass Umarmungen unter den Brüdern und Schwestern der Loge eine allgemein übliche Art der Begrüßung waren.
Nachdem sie im Foyer ihre Mäntel aufgehängt hatten, gelangten sie in den Logensaal. Die Wände waren mintgrün, wie in einem Krankenhaus, und es hingen Schaukästen mit Urkunden, Insignien und Gebrauchsgegenständen daran, deren Funktion Peter nicht auf den ersten Blick erkennen konnte. Ein großes Staatsporträt von König Willem-Alexander nahm einen zentralen Platz ein.
Der Raum wirkte altmodisch und ein bisschen wie aus den Achtzigerjahren. Einfache Tische mit Deckchen und Minivasen mit zwei Nelken darin waren zu kleinen Inseln gruppiert, umgeben von funktionalen Stühlen, als könne jeden Moment der Skatabend beginnen.
An der kleinen Bar in der Ecke holte Peter zwei Tassen Kaffee. Vorsichtig trug er sie zurück zu Fay, den Blick starr auf das Tablett gerichtet, wie ein Kind beim Eierlaufen.
Eine Tasse reichte er Fay, die eine Unterhaltung mit einigen anderen Besuchern angefangen hatte. Peter beschloss, die Gelegenheit zu nutzen, um kurz hinauszugehen, da er noch keine Zeit gehabt hatte, seinen täglichen Zigarillo zu rauchen.
Die Flügeltüren zum Garten waren geöffnet. Draußen standen weitere Raucher unter einem großen gläsernen Vordach, das einem Wintergarten ähnelte, bei dem die Wände fehlten.
Unter den Gästen draußen war auch Sven, einer von Peters Studenten. Er trug ein T-Shirt, auf dem in blassen Lettern stand: WE WILL NOT DANCE ON THE GRAVES OF OUR FATHERS, vor dem Hintergrund eines grimmig aussehenden Indianers. Auf der Nase trug er eine kleine Brille mit runden Gläsern, die er ab und zu hochschob. Er befand sich in Gesellschaft eines größeren jungen Mannes, dessen Hemd eng um seinen muskulösen Brustkorb spannte.
Zu zweit kamen sie auf Peter zu. Sven schien sich nicht ganz wohlzufühlen, so als hätte er keine rechte Lust auf ein Gespräch, aber dennoch beschlossen, dass er seinen Dozenten nicht einfach ignorieren konnte.
»Guten Tag, Meneer de Haan«, grüßte er. »Sind Sie hier Mitglied?«
»Nein, ich nicht, aber meine Freundin. Ich bin heute Abend nur aus Interesse mitgekommen. Und Sie?«
»Wir sind auch aus Interesse hier«, antwortete Sven und stellte Peter in einem Atemzug seinen Freund vor. »Das ist Erik. Wir sind beide Mitglied bei der Studentenverbindung Catena.«
Sven nahm Peter ungefragt Tasse und Untertasse ab, sodass er sich den Zigarillo anzünden konnte.
Neben ihnen stand ein Mann, der tief in Gedanken versunken zu sein schien, als bereite er sich mental auf die kommenden Ereignisse vor. Als sich der erste Rauch aus Peters Zigarillo an seinem Gesicht vorbeikringelte, warf er Peter einen raschen Seitenblick zu.
»Stört Sie der Rauch?«, fragte Peter und trat sofort zwei Schritte zurück.
Der Mann sah ihn verständnislos, aber freundlich an. Er war hochgewachsen und um die fünfzig, mit für sein Alter auffällig langem Haar, das lockig unter einer Baseballkappe der Boston Red Sox hervorhing. Seine Gesichtshaut war so glatt, dass es aussah, als hätte er sich vor noch nicht mal einer Minute rasiert.
»Hallo«, sagte er auf Englisch mit unverkennbar amerikanischem Akzent. Er schüttelte sowohl Peter als auch Sven und Erik die Hand, mit einer Begeisterung, als seien sie ehemalige Schulkameraden, die sich nach einem halben Leben bei einem Klassentreffen wiedersahen. »Mein Name ist Tony. Anthony Vanderhoop, um genau zu sein.«
Seinen Nachnamen sprach er wie »Vänderhup« aus.
»Aber bitte nennen Sie mich Tony. Und wer sind Sie?«
»Ich bin Peter de Haan, und das sind Sven und Erik.«
Es muss fantastisch sein, überall auf der Welt seine Muttersprache sprechen zu können, dachte Peter.
»Sprechen Sie kein Niederländisch?«, fragte Sven. »Denn heute Abend findet alles auf Niederländisch statt, oder?«
»Nein, leider spreche ich kein Niederländisch. Allerdings stammt meine Familie von den ersten Siedlern ab, die aus den Niederlanden nach Amerika kamen – ein Onkel von mir hat gründlich Ahnenforschung betrieben. Wobei sich die Aussprache unseres Nachnamens im Laufe der Zeit verändert hat.«
»Wir sagen ›Van der Hoop‹«, erklärte Erik mit übertrieben deutlicher Aussprache.
»Ja, richtig«, sagte Tony, aber als er versuchte, Erik nachzuahmen, klang es doch wieder nach »Vänderhup«.
»Ich komme aus Boston«, fuhr Tony fort. »Dort bin ich Mitglied einer Freimaurerloge. Und wie Sie vielleicht wissen, sind wir eine weltweit verbreitete Bruderschaft, deswegen besuche ich, wenn ich im Ausland bin, immer gerne meine Brüder und inzwischen auch Schwestern.«
Bei dem Wort »Schwestern« verzog er ein wenig spöttisch den Mund, als sei er nicht ganz einverstanden damit, dass heutzutage auch Frauen Mitglied werden konnten.
»Aber dann verstehen Sie nachher doch gar nichts«, sagte Peter.