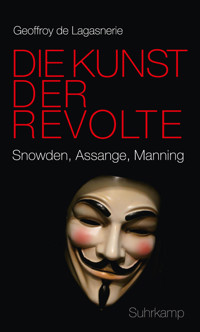23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Passagen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn wir über Politik nachdenken, verwenden wir meist totalisierende Kategorien (Volk, Gemeinwille, Volkssouveränität), mystifizierende Narrative (Gesellschaftsvertrag,deliberative Demokratie) oder abstrakte Begriffe (der Gesetzgeber, der politische Körper, der Bürger). Obwohl wir ihre fiktive Natur erkennen, halten wir sie für notwendig. Aber warum sollte politisches Denken auf Fiktionen beruhen? Und was passiert, sobald wir mit diesen Denkweisen brechen und die Realität so betrachten, wie sie ist? Lagasnerie plädiert dafür, eine realistische Konzeption des Staates, des Rechts und unserer Erfahrung als Subjekte zu entwickeln. Dabei skizziert er eine "reduktionistische" Theorie, die zur Aufhebung der Gegensätze führt, die die ganze Geschichte der politischen Philosophie strukturieren: zwischen Demokratie und Kolonie, legitimer und illegitimer Gewalt, Rechtsstaatlichkeit und Willkür oder politischem Verbrechen und gewöhnlicher Kriminalität. Ein Werk, das den Rahmen der politischen Theorie tiefgreifend erneuert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wenn wir über Politik nachdenken, verwenden wir meist totalisierende Kategorien (Volk, Gemeinwille, Volkssouveränität), mystifizierende Narrative (Gesellschaftsvertrag, deliberative Demokratie) oder abstrakte Begriffe (der Gesetzgeber, der politische Körper, der Bürger). Obwohl wir ihre fiktive Natur erkennen, halten wir sie für notwendig. Aber warum sollte politisches Denken auf Fiktionen beruhen? Und was passiert, sobald wir mit diesen Denkweisen brechen und die Realität so betrachten, wie sie ist?
Lagasnerie plädiert dafür, eine realistische Konzeption des Staates, des Rechts und unserer Erfahrung als Subjekte zu entwickeln. Dabei skizziert er eine „reduktionistische“ Theorie, die zur Aufhebung der Gegensätze führt, die die ganze Geschichte der politischen Philosophie strukturieren: Demokratie und Kolonie, legitime und illegitime Gewalt, Rechtsstaatlichkeit und Willkür, politisches Verbrechen und gewöhnliche Kriminalität. Ein Werk, das den Rahmen der politischen Theorie tiefgreifend erneuert.
Geoffroy de Lagasnerie ist Philosoph und Soziologe. Er unterrichtet am Pariser Institut für politische Studien.
Geoffroy de LagasnerieDas politische Bewusstsein
Aus dem Französischen vonRichard Steurer-Boulard
Passagen forumherausgegeben vonPeter Engelmann
Deutsche Erstausgabe
Titel der Originalausgabe: La conscience politique
Aus dem Französischen von Richard Steurer-Boulard
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Außenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-7092-5048-8
ISBN 978-3-7092-0473-3
© 2019 by Fayard
© der dt. Ausgabe 2021 by Passagen Verlag Ges. m. b. H., Wien
http://www.passagen.at
Grafisches Konzept: Gregor Eichinger
Satz: Passagen Verlag Ges. m. b. H., Wien
Inhalt
Vorwort
I. Der politische Diskurs
1. Eine Verzerrungslogik
2. Hobbes, die Wissenschaft, der Mythos
3. Dem entkommen, was ist
4. Eine Kritik des Bewusstseins
II. Die Reduktion der Politik auf das, was sie ist
1. Die Autonomie der Politik
2. Vom Monismus zum Reduktionismus
3. Die Politik als leerer Signifikant
4. Wenn eine Gruppe „Wir, das Volk“ sagt
5. Von der Performativität zur Fiktion
III. Der Staat und das Recht als Wille
1. Entscheiden
2. Gezieltes Auswählen
IV. Die politische Szene
1. Konfrontation
2. Vor dem Gesetz
3. Eine Theorie der kolonialen Macht
4. Der Konflikt der Souveränitäten
5. Besetzte Gebiete
V. Die Frage der Demokratie und des Rechts
1. Jenseits der Demokratie
2. Das Recht konkret denken
VI. Bis wohin? Die Frage der Gewalt
1. Die Stirn bieten
2. Politik ohne Legitimität
3. Die Nicht-Stichhaltigkeit der Gewaltlosigkeit
4. Mittel
Anmerkungen
Für D., natürlich
Vorwort
Dieses Buch ist in zwei Abschnitte geteilt, die relativ unabhängig voneinander gelesen werden können. In den methodologischen Teilen I und II wird versucht, die Grundlagen für eine realistische (reduktionistische) Theorie der Politik zu legen, die die mythologischen Formen des traditionellen politischen Denkens in Frage stellt und mit ihnen bricht. Im zweiten Abschnitt wird versucht, eine Beschreibung unserer politischen Lage zu liefern, und zwar durch eine Theorie des Gesetzes und des Staats (Teil III), unserer Erfahrung als Subjekt (Teil IV), des Rechts, der Demokratie und der Gewalt (Teile V und VI).
I. Der politische Diskurs
1. Eine Verzerrungslogik
In gewisser Weise hat alles, was ich hier schreibe oder gerne schreiben würde, seinen Ursprung in dem Unbehagen, das ich immer dann verspüre, wenn wir von Politik sprechen. Ich habe ständig den Eindruck, dass etwas nicht stimmt an unseren Diskursen über den Staat, das Gesetz oder über uns selbst als Subjekt. Ob es sich nun um die Texte klassischer oder zeitgenössischer Autoren handelt, um deutsche, französische oder angelsächsische Theoretiker, um Stellungnahmen von Aktivisten oder Berufspolitikern, um konservative Sprecher, um solche, die radikaler eingestellt sind – die verwendeten Wörter, die gebrauchten Begriffe, die vorgeschlagenen Erzählungen erscheinen mir falsch zu sein, und mehr noch als das: offensichtlich falsch, so als ob wir die Politik nur zum Gegenstand machen könnten, indem wir uns Geschichten erzählen, im Grunde unseres Herzens wissend, dass wir dabei sind, uns selbst zu belügen.
Es ist schwierig, die Gründe für ein undeutliches Gefühl ohne Weiteres auf nicht restriktive und nicht einschränkende Weise darzulegen. Denn obwohl die Politik der Ort des Protests, des Einfallsreichtums und des Experimentierens sein soll, lässt sich kaum die Homogenität unserer politischen Sprache übersehen! Sobald wir uns über die Polizei oder die Justiz, über Wahlen oder Demonstrationen, über den Staat oder das Gesetz äußern oder uns darüber Gedanken machen, drängen sich uns die immer gleichen Rede- und Wahrnehmungsweisen auf. Eine geringe Anzahl von Begriffen kehrt ständig wieder – so als ob (was bereits ein beunruhigendes Phänomen darstellt) ein Dutzend Begriffe ausreichen würde, um das Wesentliche unseres Lebens zu erfassen: Volk, Gemeinwille, Gesellschaftsvertrag, Souveränität, Legitimität, Staatsbürgerschaft, Konstitution und Destitution, wir, öffentlicher Raum, Repräsentation, Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaft, Gesetzgeber, Debatte, Demokratie …
Mit diesen Begriffen lassen sich durchaus sehr unterschiedliche Dinge sagen. Wir können mit ihrer Hilfe Diskurse artikulieren, die entgegengesetzten politischen Lagern zuzuordnen sind, Diskurse, die die Form einer Legitimierung der Institutionen der liberalen Demokratie ebenso gut annehmen können, wie die Form einer Kritik am antidemokratischen Charakter dieser Institutionen oder eines Aufrufs zum Volksaufstand gegen unrechtmäßig agierende Institutionen. Doch diese Veränderlichkeit und Vielfalt der Stellungnahmen verhindert nicht, dass die Autoren, die sie aussprechen, ein und dieselbe Sprache teilen, sodass man sich in einer sonderbaren Situation befindet, in der jeder – von der Regierung bis zu oppositionellen Aktivisten, von konservativen Philosophen bis zu kritischen Theoretikern – mit denselben Wörtern spricht.
Wenn wir auf die Welt kommen, ist der Raum der Sprache bereits da. Die Intuition, die ich ausarbeiten möchte, lautet, dass die Sprache, die unser Verhältnis zur Politik vorformt und mit der wir uns als Subjekte konstruieren, von der Wirklichkeit losgelöst ist. Von dem Augenblick an, da man zu sprechen beginnt, scheint die Politik ein Bereich zu sein, in dem Verzerrungs- und Mystifizierungsoperationen ablaufen. Überall – bei den unterschiedlichsten Autoren, auf der Straße und in Büchern – treten leere Wörter und Abstraktionen an die Stelle der Wirklichkeit, gibt man vor, durch mythologische Erzählungen getreu Rechenschaft davon, was wir sind, ablegen zu können, werden sinnlose Formeln wie Offensichtlichkeiten verwendet, werden rechtliche oder politische Fiktionen, deren Fiktionalität eingestanden wird, als notwendige Grundlagen für die Reflexion gesetzt. Wie kann man zum Beispiel von „Volkswille“ oder „Volkssouveränität“ oder „Volk“ in Gesellschaften sprechen, die geprägt sind von einer Vielfalt an Meinungen und oppositionellen Stimmen, von sozialen Konflikten, von der Weigerung, sich zu beteiligen, von Auseinandersetzungen zwischen Mehrheit und Minderheit, zwischen denen, die sprechen, und denen, die schweigen oder zum Schweigen gebracht werden? Wie kann man den Ausdruck „Bürger“ dort verwenden, wo es eine Vielfalt von Identitäten, Abhängigkeiten und Spaltungen gibt? Es ist auch nicht selten, dass Regierungen, die von einer Minderheit der Wähler gewählt wurden, vorgeben, dass die Demokratie auf dem Prinzip der Übertragung der „Volkssouveränität“ mittels Wahlen „gegründet“ ist, worauf ihre Gegner, anstatt diese Kategorien zu verwerfen, erwidern, sie verkörperten den eigentlichen „Volkswillen“ … Hat man vergessen, dass es vor ein paar Jahren in Paris, als im Zuge der Nuit debout genannten Bewegung Aktivisten und Intellektuelle behaupteten, sie seien „das Volk“ und würden „eine Verfassung formulieren“, obwohl da nur ein paar Hundert Personen versammelt waren, genügte, sich umzuschauen, um festzustellen, dass die Taxifahrer, Café-Kellner, Händler und Apotheker ihr Leben weiterführten wie eh und je, dass man nur 100 Meter weiter in die umliegenden Straßen gehen musste, um zu sehen, dass sich nichts änderte? Sogar die politische Philosophie und die Rechtstheorie entkommen diesem sonderbaren Dispositiv nicht. Es gibt hier keinen Bruch zwischen den alltäglichen Formen des Verhältnisses zur Politik und den Ausführungen der Gelehrten. Wenn Jürgen Habermas vom öffentlichen Raum der Debatte und von intersubjektiver Konstruktion des Rechts spricht, wenn Hannah Arendt von der Politik als einem „gemeinsamen Handeln“, John Rawls von der Demokratie als einem Regime spricht, in dem die Macht „freier und gleicher Bürger herrscht, die in einem Gemeinschaftskörper konstituiert sind“, wenn Juristen die Begriffe „konstituierend“, „Gesetzgeber“, „öffentliche Ordnung“ verwenden usw., wie sollte man – selbst wenn man kruden empiristischen Argumenten misstrauen muss – sich nicht fragen: Wovon reden sie bloß? Worauf verweist das, was sie sagen? Warum verwenden sie derlei fiktive Ausdrücke? Haben sie schon einmal eine Parlamentsdebatte im Fernsehen gesehen? Haben sie schon einmal einen Politiker in Aktion gesehen, einen Richter mit einem Angeklagten sprechen gehört oder einen Präfekten eine Entscheidung über Einwanderer treffen gesehen? Sind sie schon einmal in ein Gefängnis gegangen? Haben sie schon einmal gesehen, wie Wahlkämpfe ablaufen? Wie kommen sie dazu, die Politik ausgehend von einem Weltbild zu denken, das durch jeden – auch noch so flüchtigen – soziologischen Blick auf die Wirklichkeit widerlegt wird?
Wenngleich der Raum der Politik oft als der Bereich der Ausübung der Rationalität dargestellt wird, im Gegensatz zur Privatsphäre, in der der Affekt und das Interesse herrschten, ist es gut möglich, dass er einer der Hauptorte der Verblendung und des Automatismus ist. Wenn wir eine Eigenschaft unseres politischen Diskurses hervorheben sollten, dann wäre das die Tatsache, dass seine Sprecher – gleichsam systematisch – dadurch Positionen beziehen, dass sie Verzerrungs- und Mystifizierungsprozesse bedienen. Es ist, als ob der Wortschatz und die Sprache dieses Bereichs eine Funktion ausübten, die im Gegensatz zu ihrer eigentlichen Aufgabe steht, und nicht dazu dienten, etwas zu benennen, sondern zu verbergen. Sich selbst zu belügen, sich selbst gerade in dem Moment zu verfehlen, in dem man behauptet, über sich zu sprechen, wäre das Kennzeichen unserer Position als politisches Subjekt. Es ließe sich nicht einmal behaupten, dass in unserem politischen Diskurs eine Verzerrungslogik am Werk ist, vielmehr müsste man sagen, dass unser politischer Diskurs gänzlich auf der Grundlage von Verzerrungen erzeugt wird. Politisch zu denken, scheint zu implizieren: in Fiktionen zu denken.
2. Hobbes, die Wissenschaft, der Mythos
Die Logik der Mystifizierung, die den Kern unserer politischen Moderne ausmacht, lässt sich aufzeigen, indem wir uns Thomas Hobbes’ Leviathan zuwenden. Es ist offensichtlich kein Zufall, dass es mir zweckmäßig erscheint, dieses Werk zum Ausgangspunkt zu nehmen. Der Leviathan ist – geschichtlich betrachtet – eines der Gründungswerke der politischen Theorie und folglich hat die Geste, die es vollzieht, einen Modus der Problematisierung initiiert, den viele Autoren danach bewusst oder unbewusst übernommen haben. Hobbes hat Gewohnheiten und Reflexe geschaffen, die unseren Diskurs, so wie er uns umgibt und als sprechende und fühlende Subjekte hervorbringt, bis heute prägen.
Es gibt noch einen anderen Grund dafür, dass Hobbes’ Analyse ein nützliches Werkzeug bildet, mit dem wir die Natur unserer politischen Denkweisen aufzeigen können: Hobbes bezeichnet sein Projekt nämlich als rationalistisch und wissenschaftlich. Er beansprucht, mit allen Leidenschaften, mit oberflächlichen und parteiischen Beobachtungen zu brechen und zum ersten Mal eine „echte Wissenschaft“ von der Politik zu konstruieren, die sich – wie die Mathematik – von den Regeln der Vernunft und der Beobachtung leiten lässt.1 Hobbes’ Projekt besteht nicht darin, politische „Philosophie“ zu betreiben, sondern darin, eine autonome, illusions- und vorurteilsfreie Wissenschaft zu begründen.2 Sein Unterfangen eröffnet demnach ein Terrain, auf dem es möglich wird, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass man in unserem politischen Diskurs gerade in dem Moment, da man das Wahre zu sagen behauptet, ohne Unterlass das Falsche sagt.
Deduzieren
Hobbes will seine Wissenschaft von der Politik begründen, indem er die Souveränität aus den Eigenschaften des Menschen und aus den Beziehungen zwischen den Menschen deduziert. Er arbeitet daher im ersten Teil seines Werks eine Theorie der Affekte, der Leidenschaften, der Vernunft und der Erfindung aus. Er möchte auf diese Weise eine materialistische und objektive Beschreibung der menschlichen Natur liefern, um daraus in einem zweiten Schritt ein Wissen über die Politik abzuleiten.
Doch sobald Hobbes „das Gemeinwesen“ zum Gegenstand nimmt, sobald er anfängt, über die Geburt des politischen Subjekts nachzudenken, gibt er plötzlich die Vernunftlogik, die Logik der Feststellung und der Argumentation auf.
Hobbes führt zwei mögliche Arten der Verfassung des Gemeinwesens an, oder genauer zwei mögliche Weisen für das Subjekt, in ein Verhältnis zu einem Souverän zu treten. Es gebe zwei Formen des Eintretens in die politische Abhängigkeit (sujétion)3 und folglich zwei Arten von Gemeinwesen. Es gebe einerseits das Gemeinwesen durch Einsetzung oder Institution: Ein Gemeinwesen ist durch Einsetzung gegründet, wenn Individuen sich versammeln und eine Abmachung oder eine Vereinbarung treffen, um eine Person einzusetzen, die das Recht hat, sie zu vertreten. „Ein Gemeinwesen gilt als durch Einsetzung gegründet, wenn eine Menge von Menschen sich einigt und einen Vertrag schließt, jeder mit jedem, daß jeder beliebige Mensch oder jede Versammlung von Menschen, dem die Mehrheit das Recht gibt, ihrer aller Person zu vertreten (das heißt ihr Repräsentant zu sein), von jedem einzelnen, ob er dafür oder dagegen stimmt, für seine Handlungen und Entscheidungen in gleicher Weise Ermächtigung erhält.“4
Die zweite mögliche Form der Einrichtung einer politischen Bindung nimmt nicht die Form des gegenseitigen Vertrags an. Sie entstammt dem Krieg, der Invasion und der Eroberung. Sie ist eine durch Gewalt erlangte Herrschaft: Ein Souverän taucht auf, er erobert ein Gebiet, er erringt den Sieg. Das Subjekt wird zum politischen Subjekt, wenn es – angesichts der Aufforderung des Kriegsgewinners, sich zu unterwerfen oder zu sterben – nachgibt und die neu eingerichtete Macht akzeptiert. Das ist das Gemeinwesen durch Aneignung. „Ein Gemeinwesen durch Aneignung besteht dort, wo die souveräne Macht durch Gewalt erworben wird. Und sie wird durch Gewalt erworben, wenn Menschen, einzeln oder viele zusammen durch Stimmenmehrheit aus Furcht vor Tod oder Knechtschaft dem Mann oder der Versammlung, die ihr Leben und ihre Freiheit in der Gewalt haben, Ermächtigung für ihre Handlungen geben.“5
Diese Unterscheidung ist von Historikern und Philosophen lang und breit diskutiert worden. Was dabei aber als das wesentliche Element angesehen wurde, ist die Tatsache, dass Hobbes die Unterscheidung zwischen diesen zwei Formen der Souveränität einführt, um ihren Unterschied aufzuheben. Man könnte glauben, dass die Form „Gesellschaftsvertrag“ und die Form „Aneignung“ einander widersprechen, dass sie zwei gegensätzliche Modalitäten des Verhältnisses ausdrücken, in dem das Subjekt in der Unterwerfung unter den Souverän steht, und dass folglich diese zwei Typen des Gemeinwesens durch unterschiedliche Arten von Legitimität gekennzeichnet sind. Hobbes’ Konstruktion hat nun aber die Funktion aufzuzeigen, dass der Akt der Subjektivierung, durch den ein Individuum zum politischen Subjekt wird, in beiden Fällen auf ein und derselben Leidenschaft beruht, nämlich auf der Angst.
Die Errichtung eines Gemeinwesens durch Einsetzung gründet nach Hobbes auf der Furcht, die jeder vor dem anderen empfindet, und auf dem Wunsch, diese Situation der Unsicherheit zu beenden, während das Gemeinwesen durch Aneignung auf der Angst vor dem aneignenden Souverän gründet: zwei Ängste also, die aus unterschiedlichen Quellen stammen, Ängste nichtsdestoweniger, und weil es daher letztlich ein und dieselbe Logik ist, die in beiden Formen der Konstitution der Souveränität am Werk ist, kommt auch beiden Formen dieselbe Legitimität zu.
Die kontra-intuitive Behauptung, dass der Souverän durch Einsetzung die gleiche rechtliche Legitimität besitze wie der Souverän durch Aneignung, ist das, was die politische Theorie, einschließlich Foucault6, aus Hobbes’ Werk lernt. Diesen Nachweis hält man für sein Bravourstück.
Naivität
Und doch liegt etwas viel Sonderbareres in dieser Überlegung, die nicht hinreichend kommentiert wurde, wahrscheinlich, weil diesen Punkt aufzugreifen bedeutet, für einen naiven Autor gehalten zu werden. Die Gefahr, sich der Anschuldigung der Naivität auszusetzen, hat übrigens große Implikationen. Sie zeigt das Vorhandensein einer Art von autoimmunisierenden Vorrichtung in der politischen Philosophie, die mit besonderer Intensität hinsichtlich der Theorien des Gesellschaftsvertrags, des Konstruktivismus und der deliberativen Demokratie zum Einsatz kommt: Wenn man die konstitutiven Hypothesen des Feldes nicht akzeptiert, riskiert man, der Naivität bezichtigt zu werden und somit die Pertinenz seiner Aussagen entkräftet zu sehen, was bewirkt, dass die grundlegenden Hypothesen des Feldes von einem legitimen Diskurs letztlich niemals in Frage gestellt werden können, weil die Legitimität die Anerkennung der konstitutiven Hypothesen voraussetzt … Dieses System der Einschüchterung und Selbstbestätigung ist im Grunde demjenigen sehr ähnlich, das im Feld der Gegenwartskunst am Werk ist. Und es erklärt die automatische Fortführung einer Denkweise, deren Existenz niemand in Frage zu stellen wagt.
Falsch
Worüber man beim Lesen von Hobbes’ Text erstaunt sein sollte, ist die Tatsache, dass die Wirklichkeit unserer Beziehung zur Politik an den zwei Modalitäten des Souveränität, von denen er spricht, völlig vorbeigeht.
Hobbes unterscheidet zwei Weisen des Eintretens in den Staat und der Hervorbringung des Subjekts als Untertan des Souveräns. Diese zwei Möglichkeiten haben jedoch keinen Bezug zur Wahrheit unserer Erfahrungen. Sie sind keine Modelle, sondern Fiktionen. Letztlich könnte man behaupten, dass nur das Gemeinwesen aus Aneignung eine Form darstellt, die manchmal – und eigentlich sehr selten – geschichtliche Wirklichkeit aufweist, nämlich für die Kämpfer in einem Krieg im Moment der Niederlage, für die Mitglieder eines kolonisierten Gebiets im Moment der Eroberung … Aber darüber hinaus? Ob es nun im Rahmen „kolonialer“ Systeme, „monarchistischer“ oder „demokratischer“ Regime ist – ich setze diese Ausdrücke hier in Anführungszeichen, denn wir werden über diese Unterscheidungen und Bezeichnungen nachdenken müssen –, wer kann seine Beziehung zum Staat in einer der zwei Formen beschreiben, von denen Hobbes spricht? Die Einrichtung des Staats und der Eintritt des Subjekts in den Staat nehmen praktisch niemals die Form eines freiwilligen und ausdrücklichen Vertrags an.
Der Souverän, so wie Hobbes ihn in der Theorie vom Aneignungsstaat beschreibt, würde sagen: Du unterwirfst dich, du wirst mein Untertan, mein politisches Subjekt, oder ich lasse dich hinrichten. Deshalb behauptet Hobbes, dass der Aneignungsstaat ebenso legitim wie der Einrichtungsstaat ist, denn beide beruhen auf der Zustimmung der Subjekte und auf einem Akt der Anerkennung.
Wenn man die reale Erfahrung des politischen Subjekt-Werdens beschreibt, dann gibt es die Wahl, von der Hobbes spricht, nicht. Wir haben niemals die Wahl. Es stimmt nicht, dass es eine Alternative zur politischen Zugehörigkeit gibt. Die Tatsache, unter der Herrschaft einer Macht zu stehen, die sich das Recht nimmt, über uns zu verfügen, wird uns mit der Geburt auferlegt. Es gibt keinen Vertrag, es gibt keine Unterwerfung, weil es niemals die Möglichkeit gibt, sich nicht zu unterwerfen und nicht Teil der Rechtsordnung zu sein. Wenn wir geboren werden, gibt es bereits eine Rechtsordnung, sie ergreift Besitz von uns und wir müssen sie dulden. Das Subjekt steht in keinem Konstitutionszusammenhang mit der Ordnung, in der es sich befindet. Eher könnte man von einer Gefangennahme sprechen.
Hobbes stellt die Wahl an den Ursprung des politischen Subjekts, obwohl in Wirklichkeit die Frage des Staats die Frage einer erzwungenen Zugehörigkeit ist: Ohne dass man mich um meine Meinung gefragt hat, ohne dass ich meinen Willen formell oder vertraglich ausgedrückt habe, bin ich de facto Teil des Staats als Untertan oder Bürger. Thomas Bernard sagte, in einer Formulierung, die Pierre Bourdieu gerne zitiert: „Der Staat hat mich, wie alle andern auch, in sich hineingezwungen“7. Wir werden im Staat geboren, vom Staat erfasst, von ihm definiert. Wir sind Objekte des Staats, dem Staat unterworfen. Wir sind in ihm eingeschlossen – ich werde darauf zurückkommen.
Anstatt zu sagen: Wenn wir geboren werden, sind der Staat, das Recht und auch die Polizei schon da, und unsere Geburt als politisches Subjekt ist das Ergebnis eines Zwangs und nicht das Ergebnis einer Unterschrift, schreibt Hobbes: Das politische Subjekt ist dem Recht unterworfen, weil es einen Vertrag unterschrieben hat, und es hat diesen Vertrag entweder aus Angst vor den anderen oder aus Angst vor dem Souverän unterschrieben.
Realismus und Gesellschaftsvertrag
Man könnte darauf natürlich antworten, dass Hobbes’ Projekt der Tradition des Gesellschaftsvertrags angehört und dieser Bereich des Denkens schließlich mit einer hypothetischen Vorstellung vom Menschen und der Gesellschaft arbeitet, um eine Theorie der Souveränität und der Rechtmäßigkeit zu konstruieren. Doch dieser Einwand ist nicht gültig. Hobbes’ Vorgehen lässt sich nicht in die Tradition des Gesellschaftsvertrags einordnen, so wie sie sich von Jean-Jacques Rousseau bis John Rawls entwickelt.