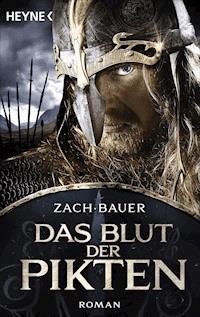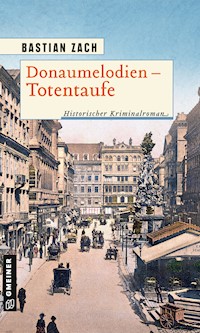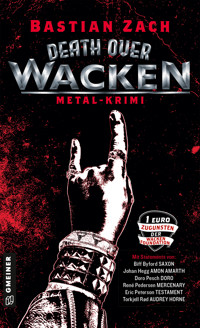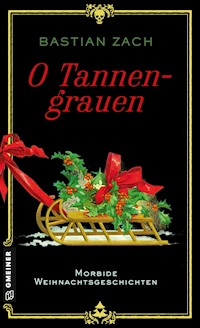9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tränen-der-Erde-Saga
- Sprache: Deutsch
Anno 1618: Der Dreißigjährige Krieg hat begonnen. Der Katholik Johannes Heidfeldt und der Protestant Christoph Ackermann waren einst gute Freunde, doch der Religionsstreit hat sie und ihre Familien auseinandergerissen. Während es die Ackermanns nach Prag verschlägt, erschließen die Heidfeldts im heimischen Schwaben ein neues Geschäft: Handel mit Waffen für den Krieg. In diesen unruhigen Zeiten kreuzen sich die Wege der beiden Familien erneut auf schicksalhafte Weise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DAS BUCH
»Christophs Frau Helene war die Erste gewesen, die im Jahr zuvor, an jenem eiskalten Tag im Mai, geahnt hatte, was auf sie alle zukommen würde. Zitternd und mit dünner Stimme, hatte sie ihrem Gemahl berichtet, wessen sie gerade Zeuge geworden war, wie die drei kaiserlich-katholischen Räte aus dem Fenster der Hofkanzlei der Burg geworfen worden waren, wie die lutherischen Adligen ihnen nachgeschrien und nachgeschossen hatten, und wie sie damit den Kaiser brüskierten.
Das wird Folgen haben, Christoph. Für uns, unsere Familie, das ganze Reich – dies ist erst der Beginn von etwas, dessen Ausmaß noch niemand erahnen kann.
Wie recht Helene behalten hatte. Denn nun herrschte Krieg.«
DIE AUTOREN
Bastian Zach, geboren 1973, lebt und arbeitet als selbstständiger Schriftsteller in Wien.
Matthias Bauer, geboren 1973, lebt und arbeitet als selbstständiger Schriftsteller in Tirol.
Zusammen schreiben sie als Zach/Bauer Romane (unter anderem die »Morbus-Dei«-Trilogie) und Drehbücher, zuletzt zum internationalen Blockbuster »Northmen – A Viking Saga«. Mit den großen Romanepen »Das Blut der Pikten« und »Feuersturm« erweckten sie die Welt der Wikinger zum Leben. Nun legen sie mit »Tränen der Erde« und »Das Reich der zwei Kreuze« eine mehrbändige historische Familiensaga zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs vor.
BASTIAN ZACH ~ MATTHIAS BAUER
Das
REICH
der zwei
KREUZE
HISTORISCHER ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 12/2020
Copyright © 2020 by Bastian Zach und Matthias Bauer
Copyright © 2020 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Barbara Häusler
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer
unter Verwendung von Motiven von akg-images/
Science Source; Shutterstock.com
(Nickita Vanat, kilukilu, Leigh Prather, alexandre17,
Romanova Ekaterina, ULKASTUDIO)
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-26271-6V001
www.heyne.de
Für alle, die der Verblendung widerstehen und auch in Zeiten größten Unheils Mensch bleiben.
Die Hauptcharaktere
Familie Heidfeldt, Katholiken
Johannes Heidfeldt, Kaufmann
Agnes Heidfeldt, seine Ehefrau
Balthasar, ihr Sohn
Magdalena, ihre Tochter
Sieglinde, ihre jüngste Tochter
Familie Ackermann, Lutheraner
Christoph Ackermann, Transporteur
Helene Ackermann, seine Ehefrau
Lorenz, ihr ältester Sohn
Lucas und Philipp, ihre Zwillingssöhne
Sonstige
Hans Albrecht von Dandorf, bayerischer Statthalter von Donauwörth
Sibylla, seine Frau
Piero Contarini, Kaufmann in Augsburg
Martin Peller, Kaufmann in Nürnberg
Joachim Sailer, Agent aufseiten der Lutheraner
Hans de Witte, calvinistischer Finanzier und Hofbankier des Kaisers
Jana Bittová, Freundin von Lucas und Dienstmagd in Prag
Ulrich und Catharina, Freunde von Philipp und Künstler in Prag
Casper von Chotemice, Mäzen und Adliger in Prag
Agathe, seine Tochter
Die Kriegsparteien
Die Katholiken
Ferdinand II., habsburgischer Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
Maximilian I., Herzog von Bayern
»Wallenstein«, geb. Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, böhmischer Feldherr
Johann T’Serclaes von Tilly, oberster Heerführer der Katholischen Liga
Comte de Bucquoy, Heerführer der Katholischen Liga
Die Lutheraner
Friedrich V. von der Pfalz, König von Böhmen, geschmäht als »Winterkönig«
Christian von Anhalt, Heerführer
Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, Heerführer und aufgrund seiner tollkühnen Kampfesweise auch der »tolle Halberstädter« genannt
Peter Ernst II. von Mansfeld, Heerführer
Prolog
Donauwörth, Herbst 1618
Johannes Heidfeldt sah aus dem Stubenfenster seines Hauses. Die Butzenscheiben erzitterten im kalten Wind, der durch die Stadt rauschte. Friedhofswind, dachte Johannes, so haben wir ihn als Jungen genannt und den alten Vers gesungen.
Friedhofswind, Grabeswind, macht die Augen aller blind. Lässt grimmig klappern das Gebein, lässt Kälte über allem sein.
Einige abgestorbene Blätter wirbelten vor dem Fenster durch die Luft und vollführten einen einsamen Tanz. Dann waren sie auch schon wieder verschwunden.
Johannes’ Blick glitt über den Abendhimmel. Der Wind hatte ihn von Wolken leer gefegt, Mond und Sterne sahen auf Donauwörth herab.
Aber heute waren sie nicht allein.
Denn am Himmel stand, mächtig und Unheil verkündend, ein Komet, der alles andere überstrahlte und dessen Schweif sich über einen großen Teil des Horizonts zog.
Johannes dachte daran, wie ihm zugetragen worden war, dass mit Auftauchen des Irrsterns die Menschen im ganzen Reich in Angst und Schrecken verfallen waren. Man glaubte zu wissen, die himmlische Ordnung des Firmaments wäre gestört und das Ende nahe. Donauwörths katholischer Stadtpfarrer Michael Weinmann hatte sich dieser Meinung angeschlossen und predigte seitdem ohne Unterlass vom Ende der Zeit und dem Nahen des Jüngsten Gerichts. Das Licht am Himmel sei der Vorbote der vier apokalyptischen Reiter, die Krieg, Hunger und Pest brächten und schließlich den Tod aller Menschen.
Johannes, ganz der nüchterne Kaufmann, hatte während Weinmanns letzter Predigt gedacht, dass der alte Schwätzer zumindest mit Krieg richtiglag. Seit vor einigen Monaten drei kaiserlich-katholische Räte von böhmischen lutherischen Adeligen aus dem Fenster der Prager Burg gestürzt worden waren, standen die Zeichen auf Sturm. Der Kaiser hatte auf den infamen Vorfall umgehend reagiert, und so war schon im Sommer eine katholische Armee unter Graf von Bucquoy gen Prag gezogen. Die Kaiserlichen scheiterten jedoch am Heer des Söldnerführers Graf Ernst von Mansfeld, der sich im Auftrag der Böhmen den Eindringlingen entgegenwarf. Bucquoy hatte sich zurückziehen müssen, mittlerweile munkelte man gar, dass das kaisertreue Pilsen bald fallen würde.
Johannes hoffte, es würde sich trotz allem eine friedliche Lösung für die beiden Konfessionen ergeben. Er hatte den Krieg als junger Mann in einer belagerten Stadt erlebt, und er wusste, dass es am Ende nur Verlierer gab. Aber Piero Contarini, Johannes’ wie immer bestens informierter Handelspartner in Augsburg, hatte bei ihrem letzten Treffen gemeint, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis sich das ganze Reich zerfleischen würde. Johannes hatte entgegnet, dass es seit siebzig Jahren keinen großen Krieg mehr im Reich gegeben habe, und das würde auch so bleiben. Die Union1 und die Liga2 würden sich ein wenig die Köpfe blutig schlagen, dann an den Verhandlungstisch setzen und einen Kompromiss finden.
Doch der kleine Venezianer hatte auf seiner Meinung beharrt. Was in Prag begonnen, wird sich über das Reich ausdehnen, Signore Heidfeldt, und dieses Reich wird im Blut ertrinken.
Was in Prag begonnen …
Geisterhaft schienen die Worte durch die dunkle Stube zu wabern, die so kalt war, dass Johannes seinen Atem sehen konnte. Er rieb sich die Hände und blies hinein. Holz war knapp in Donauwörth, seit die Stadt durch die im Jahre 1607 vollzogene kaiserliche Reichsacht ihren alten Namen Schwäbischwerd, ihren Status als Reichsstadt und alle damit verbundenen Rechte verloren hatte. Eines dieser Rechte war die Nutzung der umliegenden Wälder. Seither wurden in den Häusern nur noch die Räume geheizt, in denen es unbedingt nötig war.
Auf einmal sah Johannes Licht in der dunklen Straße, die unter ihm lag. Zwei Stadtwachen schritten gemessenen Schrittes vorbei. Ihre Laternen erhellten für einen Augenblick das schmiedeeiserne Tor eines Hauses, das dem von Johannes genau gegenüberlag. Dann waren die Wachen auch schon vorbei, und die Straße war wieder in Dunkelheit versunken.
Johannes kannte das Haus auf der anderen Seite wie sein eigenes. Nichts ließ erahnen, dass es einmal das prächtigste Gebäude in der Reichsstraße gewesen war. Diese hatte damals an sich schon einen höchst beeindruckenden Anblick geboten, mit ihren Gaststätten, den Unterkünften der Zünfte und den Fachwerkbauten mit ihren wundervoll bemalten Giebeln und Erkern. Die schönsten Bürgerhäuser waren jedoch das von Johannes und das gegenüberliegende gewesen.
Das Haus mit dem ehemals leuchtend gelben Tor, welches mittlerweile in fahlen, abblätternden Farben aus den Angeln hing, die Mauern schäbig, die Fenster wie aufgerissene Augen ins Leere starrend.
Das Haus seines Freundes Christoph Ackermann, der mit den Seinen nach der Reichsacht nach Prag hatte fliehen müssen.
Was war das für ein Leben, als Christoph noch dort drüben gewohnt hat, erinnerte sich Johannes. Zäh und skrupellos waren sie beide gewesen und hatten sich deshalb sehr gut ergänzt. Und wo der katholische Kaufmann Heidfeldt sich durch kaufmännischen Instinkt und eine gewisse Bodenständigkeit auszeichnete, war der lutherische Transporteur Ackermann der redegewandte, charmante Teil der beiden, der mit Energie und Witz jeden zögernden Kunden umzustimmen wusste. Ihre verschiedenen Konfessionen hatten sie nicht trennen können, vereint waren sie stärker, vereint hatten sie die beiden erfolgreichsten Unternehmen der Stadt aufgebaut. Und in tiefer Freundschaft vereint waren auch ihre beiden Familien gewesen.
Der Kaufmann drehte sich vom Fenster weg. Genau hier, in dieser Stube, hatten sich Ackermanns und Heidfeldts unzählige Male getroffen, hatten Spezereien geschmaust und Agnes Heidfeldt gelauscht, während diese Geschichten aus längst vergangener Zeit erzählte.
Mit einem Mal erschien es Johannes, als ob er Stimmen hörte. Mit den Stimmen kam warmes Kerzenlicht, das den Eichenboden und die Stühle und Bänke der Finsternis entriss und die lustigen blau-weißen Kacheln des mannshohen Ofens erhellte. Johannes konnte Agnes vor sich sehen, wie sie an dem wundervoll gefertigten Tisch aus rötlich glänzendem Kirschholz saß, wie die Kinder beider Familien ihr lauschten: Balthasar Heidfeldt und seine Schwestern Magdalena und Sieglinde, neben ihnen die Zwillinge Lucas und Philipp Ackermann. Und sogar Lorenz, der älteste Sohn der Ackermanns, hatte zugehört, obwohl er doch nur Augen für seine schöne Braut hatte, die bei ihm saß.
Für Anna Heidfeldt.
Der Kaufmann schluckte. Die Bilder verschwanden, die Stube fiel wieder der Dunkelheit anheim.
Obwohl es so viele Jahre her war, verspürte Johannes immer noch tiefen Schmerz, wenn er daran dachte, was mit Anna geschehen war. Wie der Tod ihm eine Tochter und Lorenz ein Eheweib und ein ungeborenes Kind geraubt hatte.
Ein Seufzen entrang sich dem Kaufmann, dann verdrängte er die Erinnerung. Was geschehen war, war vorbei, was kam, musste man hinnehmen. In jungen Jahren hatte er noch gedacht, der Herr seines Schicksals zu sein. Mittlerweile wusste er, dass es Dinge gab, die niemand, nicht er und wahrscheinlich nicht einmal die Mächtigen, beeinflussen konnte. Gleichgültig wie mutig, fleißig, stark und gottesfürchtig man war – manche Ereignisse kamen über einen wie ein Sturm, und man konnte sich glücklich schätzen, wenn man ihn lebend überstand.
Johannes fuhr sich mit der Hand durch das mit den Jahren dünn gewordene weiße Haar, über die stoppeligen Wangen und das Kinn. Dann ging er langsamen Schrittes durch die Stube.
Ich habe schon so manchen Sturm überlebt, und ich werde mich auch denen, die noch auf mich warten, entgegenstemmen. Das bin ich meiner Familie schuldig.
Der Kaufmann öffnete die Tür und verließ den Raum.
Die Schritte entfernten sich. Die Stube blieb für sich, kaum merklich erhellt vom Licht des Kometen, der so unheilvoll über Donauwörth stand …
Prag, Herbst 1618
Wortlos starrte Christoph Ackermann auf den Irrstern, der selbst am helllichten Tag sichtbar am Himmel stand und von dem man rätselte, welche Vorboten er wohl schicken mochte. War er ein Zeichen für die Erleuchtung der Menschheit oder ihren Untergang? Ein Segen oder eine Warnung? Niemand in der Stadt an der Moldau wusste es, und so deutete jedermann das in ihn, was ihm gerade widerfuhr.
Für Christoph war der Komet ein schlechtes Zeichen. Das einzige Fuhrwerk in seinem Lager ächzte selbst unter der kleinsten Last dermaßen, als würde es jeden Augenblick zusammenbrechen. Auch das Lager, wenngleich es nicht sonderlich geräumig war, war zum Gähnen leer. Kaum Fässer, kaum Kisten.
Nichts …
Die letzten Wochen waren mit Aufträgen karg gesät gewesen, karger noch als die Monate davor. Und so fraß das einzige Zugpferd, das Christoph noch besaß, jenen Hafer, für den er keine Gegengeschäfte hatte und der eigentlich als Brot auf den Tisch der Familie gehörte. Aber er wusste auch, dass er ohne das Pferd nahezu mittellos wäre. Gut, sein Sohn Lucas half ihm, wo er nur konnte. Dennoch hatte Christoph ihn in den letzten Wochen immer öfter zu anderen Transporteuren schicken müssen, auf dass er sich dort als Tagelöhner ein Zubrot verdiente. Und er wusste, dass er mit nur einem Handkarren allein seine Familie nicht würde erhalten können.
Der Transporteur seufzte schwer. Ein gutes Dutzend Fuhrwerke konnte er einst sein Eigen nennen, dazu eine Handvoll Zillen3. Zwei Dutzend Knechte hatte er unter Lohn gehabt, ein ansehnlich großes Lager besessen und in einem der beiden vornehmsten Häuser der Reichsstadt Schwäbischwerd gewohnt. Ja, das Leben war gut zu ihm und Helene gewesen … bevor sich manch wichtiger Herr dazu entschieden hatte, dass er selbst ein Verfechter des wahren Glaubens war, er jedoch nun auch jene, die dies seiner Meinung nach nicht waren, dazu bekehren müsste. Notfalls oder sogar bevorzugt mit Waffengewalt. Viele hatten in den letzten zehn Jahren dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen, er und seine Familie zunächst mit dem Verlust ihres Hab und Guts, dann mit dem Verlust ihrer Heimat.
Christoph hatte derlei Anmaßungen noch nie verstehen können – nach ihrem Tod hätten die verschwenderischen Papstküsser schon erkannt, welchen Fehler sie begangen hatten. Wozu sie also im Diesseits darauf hinweisen?
Aber natürlich wusste er auch, dass vermeintlich hehre Ziele oftmals nur vorgeschützt waren. Es ging um Grund und Boden, um Macht und Einfluss. Die Mär eines Kampfes für den Glauben war für die einfältigen Seelen bestimmt.
Christophs Frau Helene war die Erste gewesen, die im Jahr zuvor, an jenem eiskalten Tag im Mai, geahnt hatte, was auf sie alle zukommen würde. Zitternd und mit dünner Stimme hatte sie ihrem Gemahl berichtet, wessen sie gerade Zeuge geworden war, wie die drei kaiserlich-katholischen Räte aus dem Fenster der Hofkanzlei der Burg geworfen worden waren, wie die lutherischen Adligen ihnen nachgeschrien und nachgeschossen hatten, und wie sie damit den Kaiser brüskierten.
Das wird Folgen haben, Christoph. Für uns, unsere Familie, das ganze Reich – dies ist erst der Beginn von etwas, dessen Ausmaß noch niemand erahnen kann.
Wie recht Helene behalten hatte. Denn nun herrschte Krieg.
Christoph schüttelte die dunklen Gedanken ab, denn sie würden ihm kein Brot auf den Tisch bringen. Also lud er zwei Säcke voll Mehl, die neben ihm lagen, auf einen Handkarren und machte sich auf, sie dem Bäcker zu bringen, der danach verlangt hatte.
Die Knochen des Transporteurs schmerzten schon seit geraumer Zeit immer stärker. Einerseits lag dies bestimmt am kalten Wetter. Andererseits war er derlei Anstrengungen einfach nicht mehr gewohnt, hatte er doch so lange Zeit Knechte gehabt, die ihm die harte Arbeit abgenommen hatten.
Nachdenklich kratzte er sich den kurz geschnittenen Vollbart, der mittlerweile so grau war wie sein schütter gewordenes Haupthaar. Wenn doch nur bald die Fässer aus der Lombardei einträfen, wünschte sich Christoph, dann könnte er mit dem dafür versprochenen Salär zumindest die nächste kurze Durststrecke überdauern.
Einstweilen musste jedoch genügen, was man hatte. Und so zog Christoph Ackermann den Karren weiter durch die engen Gassen von Prag, während der Komet unerbittlich am Firmament verharrte …
Donauwörth, März A.D. 1619
Ruhelos ging Agnes Heidfeldt in der Küche auf und ab.
Der Kessel mit der frisch zubereiteten Fleischsuppe hing über der offenen Feuerstelle. Gemüse und Brot standen in hölzernen Schüsseln bereit auf dem Tisch. So gab es im Augenblick nichts zu tun, und genau das machte Agnes unruhig.
Sie nahm eine Schöpfkelle, tauchte sie in den Kessel und kostete vorsichtig. Dann lächelte sie zufrieden. Eine einfache, aber deftige Fleischsuppe war eines von Johannes’ Lieblingsgerichten, und wie immer würde sie ihm auch heute munden, und er würde essen, bis er nicht mehr konnte.
Agnes legte die Kelle weg und sah sich in der Küche um.
Verharrte.
Ihre Finger fuhren in die Tasche der Schürze, die sie über dem Rock trug, berührten, was sich darin befand. Fühlten zusammengerolltes Papier, das raschelte –
Irmel, die ältliche Küchenmagd, kam herein. Ihr rosiges, etwas einfältiges Gesicht verzog sich erstaunt, als sie Agnes erblickte. Offenbar hatte sie nicht damit gerechnet, dass sich jemand in der Küche aufhielt. »Habt Ihr besondere Wünsche für das Abendessen, Herrin?«
Wie ertappt, zog Agnes die Hand aus der Tasche. »Nein, nein … sag mir, wie ist es um unseren Vorrat an Kohl und Rüben bestellt?«
»Haben wir noch für einige Zeit, Herrin.«
»Birnen und Äpfel?«
»Sind noch genug Kletzen4 da.«
Agnes fuhr sich fahrig über die Haube, die ihr volles Haar verbarg. »Und der gedörrte Salm für morgen?«
»Den wollte ich morgen holen, Herrin«, antwortete Irmel.
»Hol ihn lieber gleich.«
»Aber –«
»Gleich!« Agnes’ Ton war unmissverständlich.
»Wie Ihr befehlt, Herrin.« Etwas gekränkt, verließ Irmel die Küche.
Agnes tat es augenblicklich leid, dass sie so schroff gewesen war. Aber sie wollte allein sein, und am allerwenigsten brauchte sie im Augenblick die treue, jedoch etwas anstrengende Irmel um sich.
Unten fiel das Eingangstor ins Schloss.
Agnes atmete auf. Nun war niemand außer ihr im Haus, denn Johannes und Balthasar arbeiteten im Kontor. Die Handelsgehilfen, die sich sonst im Geschäft im Erdgeschoss des Hauses Heidfeldt aufhielten, waren ebenfalls im Kontor und halfen Vater und Sohn. Conrad, der Hausknecht, war in Zirgesheim, und Magdalena und Sieglinde wohnten im Kloster Heilig-Kreuz der Abendmesse bei, die der greise Abt Leonhard Hörmann abhielt. Da Pfarrer Weinmann andauernd den Untergang der Welt predigte, schickte Agnes ihre Töchter mittlerweile lieber zum Abt. Der war immer schon ein Mann des gemäßigten Wortes gewesen.
Sie war also allein.
Und doch stimmte das nicht ganz. Jemand war bei ihr, wenn auch nicht körperlich.
Ihre Finger fuhren wieder in die Tasche der Schürze, fuhren über den zusammengerollten Brief und über das Band aus Samt, das ihn zusammenhielt. Berührten ihn, wollten ihn herausziehen. Zögerten.
Denn Agnes wusste, was auch in diesem neuen Brief stehen würde, und sie wollte es nicht lesen. Es stand einer verheirateten Frau nicht zu, an solche Worte auch nur zu denken.
Wer bist du?
Das war die Frage, die sie beschäftigte. Einmal in der Woche ging sie zur Beichte, immer zur gleichen Zeit. Gestern hatte nun schon zum dritten Mal ein Brief im Beichtstuhl gelegen. Jemand wusste also genau über ihre Angewohnheiten Bescheid, und auch, dass er sich auf diese Weise mit ihr in Verbindung setzen konnte.
Agnes war sich bewusst, dass sie trotz ihrer bald fünfzig Lenze immer noch eine schöne Frau war. Ihr Busen war üppig und fest, das Haar lang und blond, das Gesicht nur von wenigen, feinen Falten heimgesucht. Und bei der richtigen Gelegenheit vermochten die klaren blauen Augen immer noch so zu strahlen wie früher. So war es nur natürlich, dass die Frau des Stadtrats und Kaufmanns Johannes Heidfeldt Begehrlichkeiten bei den Männern der Stadt weckte, auch wenn diese sie sorgsam verbargen.
Einer dieser Männer hatte jedoch jede Vorsicht über Bord geworfen und schrieb ihr. Mehr noch, er offenbarte sich, sprach von einer Zukunft für sie beide. Doch wer?
War es Sebastian Werlin, der Goldschmied, der ihr immer so freundlich begegnete? Rainwailer, der Uhrmacher? Oder gar Anton Wanger, der Bildhauer, dessen dunkle, fast schwarze Augen aufzublitzen schienen, wann immer er Agnes grüßte? Und was war mit einer »Zukunft, die uns Verheißungsvolles bringen wird« gemeint? Gar eine verbotene und daher umso leidenschaftlichere Liaison?
Agnes erschrak innerlich. Sie war mit Johannes seit bald dreißig Jahren verheiratet und liebte ihn innig. Sie waren zusammen durchs Leben gegangen und hatten ein Alter erreicht, mit dem sie zufrieden sein konnten. Johannes und sie waren gesund, auch wenn die Korpulenz ihres Gemahls mittlerweile ein Ausmaß erreicht hatte, dass ihm das Atmen teils schwerfiel. Sie betete tagtäglich, der Erlöser möge seine schützende Hand über Johannes und die Familie halten.
Ich liebe meinen Gemahl. Und niemand wird dieses Glück gefährden.
Trotzdem waren beim Nachdenken drei Männer vor ihrem inneren Auge aufgestiegen. Konnte es sein, dass sie an diese drei dachte, weil sie ihr –
Weil sie dir insgeheim gefallen? Hoffst du sogar, dass es einer der drei ist?
Immer noch lagen Agnes’ Finger auf dem Brief in ihrer Tasche. Dann, nach einer schieren Ewigkeit, zog sie ihn heraus.
Hielt ihn in der Hand, zögerte kurz – und warf ihn in das Feuer unter dem Kessel.
In der stillen Küche kam Agnes das leise Auflodern des Papiers ohrenbetäubend vor. Sie setzte sich an den Tisch, barg den Kopf in ihren Händen und wartete darauf, dass der Brief verbrannte, sich auflöste, dass wieder Ruhe in ihrem Herzen einkehren würde.
Und doch: Als das Feuer die letzten Reste des Papiers und die darauf so kunstvoll mit Eisengallustinte geschriebenen Worte verzehrt hatte, stand die Frage wieder im Raum, drängender denn je.
Wer bist du?
Die Frühlingssonne, die sich eben noch zum ersten Mal seit Tagen gezeigt hatte, verschwand wieder hinter grauen Wolken. Grau war auch das Wasser der Donau, die am Hafen Donauwörths vorbeifloss. Die wenigen Einmaster und Zillen, die am hölzernen Steg vertäut waren, schaukelten ächzend in der Strömung.
Grimmig beugte sich Balthasar Heidfeldt zu dem Mann, der vor ihm stand. Die vierschrötige Gestalt des Kaufmannsohns schien den dicken Wollmantel, der sie umhüllte, sprengen zu wollen, die Wangen waren weniger von der Kälte gerötet, sondern vielmehr vom Zorn. Sogar das kurz geschnittene Haar schien sich aufzustellen. Kurz: Balthasar wirkte wie ein Bulle, der bereit war, auf sein schmächtiges Gegenüber loszugehen. Dieser reckte sich trotzdem tapfer in die Höhe, auch wenn seine Augen im blassen Gesicht unruhig hin und her zuckten und er sich mit der linken Hand immer wieder fahrig über die rote, laufende Nase wischte.
»Du bestehst also wirklich darauf, dass du und deine verdammten Schifffahrtsknechte mehr Entlohnung bekommen?« Balthasars Stimme klang gefährlich ruhig.
Der Mann schnäuzte sich in den Ärmel seiner Joppe. »Ganz recht, Herr Heidfeldt. Es steht uns zu.«
Balthasar ging unvermittelt ganz nah an den anderen heran. »Ich sage dir eines, du gierige Ratte – wenn du nicht sofort verschwindest –«
»Balthasar.« Eine Stimme hinter seinem Rücken. »Zügle dich.«
Der Mann atmete erleichtert aus. Balthasar knirschte mit den Zähnen, trat aber einen Schritt zurück.
Johannes Heidfeldt ging mit ruhigen Schritten zu den beiden Männern. Wie sein Sohn trug er den Wollmantel fest um sich geschlungen. Doch im Gegensatz zum Sohn waren die Wangen des Vaters von einer auffallenden Blässe, und das dünne Haar lag wie erschlafft auf der Kopfhaut. Alt ist er, dachte Balthasar, und auch sein Umgang mit seinen Leuten ist der eines alten Mannes. Aber nicht mehr lange, da sei der Herr mein Zeuge.
»Du bist Jos Pecherer, hab ich recht? Und du stehst seit Kurzem den Schifffahrtsleuten vor?« Johannes blickte den Schmächtigen nicht unfreundlich an.
Der Angesprochene nickte.
»Ich kannte deinen Vater«, fuhr Johannes fort. »Er hat meinem besten Freund immer wieder Ärger bereitet.«
Auch Balthasar konnte sich noch gut an Veit Pecherer erinnern, der einst die Fuhr- und Schifffahrtsleute angeführt hatte wie jetzt sein Sohn. Veit war immer etwas zu gierig gewesen und hatte es weidlich ausgenutzt, dass keiner die Gewässer besser kannte als er. Und doch hatten diese Gewässer ihn vor einigen Jahren das Leben gekostet, als er von den tückischen Stromschnellen der Frühlingsschmelze verschlungen worden war.
»Aber letzten Endes konnte man sich auf das Wort deines Vaters verlassen, junger Pecherer«, meine Johannes jetzt. »Wie steht es mit deinem Wort?«
Jos zögerte, sein Blick glitt zwischen dem Kaufmann und seinem Sohn hin und her. Schließlich räusperte er sich. »Was für meinen Vater galt, gilt auch für mich.«
»Dann sei es so. Hol meine Waren sicher aus Augsburg, dann erhöhe ich um fünfzehn Kreuzer pro Mann.«
»Damit werden meine Männer nicht einverstanden sein.«
»Dann sollen sie kommen und es uns selbst ins Gesicht sagen, wenn sie Muts genug sind«, fiel Balthasar harsch ein. Aber er verstummte, als er den Gesichtsausdruck seines Vaters sah. Dieser konnte trotz seiner Lenze äußerst unangenehm werden, wenn er wollte. Mochte die Gestalt fassartig, der Atem schwer und das Haar weiß geworden sein – die Fäuste von Johannes Heidfeldt waren immer noch schnell und kräftig.
»Du musst meinem Sohn verzeihen, er hat etwas zu viel Temperament. Zwar ist dies ein Anrecht der Jugend, doch sollte es nicht im Übermaß beansprucht werden.« Johannes machte eine kurze Pause. »Und das gilt auch für dich, junger Herr. Zwanzig Kreuzer. Mein letztes Wort.«
Der Fluss rauschte. Die vertäuten Boote knarrten, vor dem grauen Himmel krächzte ein Vogel.
Schließlich neigte Jos Pecherer den Kopf. »Ich bin einverstanden, Herr Heidfeldt.«
»Und ich bin erfreut, dies zu hören.« Der Kaufmann streckte ihm die Hand hin.
Die beiden Männer schlugen ein, dann entfernte sich Pecherer mit schnellem Schritt.
Johannes blickte dem Mann nach. Als der außer Sicht war, wandte er sich seinem Sohn zu. »Balthasar …«
»Ja, Vater?«
Wieder einmal fiel Johannes auf, dass Balthasars Augen zwar so blau wie die von Agnes waren, aber anders, irgendwie blasser. Man konnte sie schwer einschätzen, wie den ganzen Jungen.
Balthasar sah ihn jetzt geradewegs an, das Kinn trotzig erhoben, den Mund zusammengepresst, in Erwartung einer Rüge. Aber für die war Johannes Heidfeldt auf einmal zu müde. Es war diese Müdigkeit, die ihn in letzter Zeit öfter plagte, die sich schlagartig über Körper und Geist legte und ihn kraft- und mutlos machte. So auch jetzt; jedes Wort, jede Zurechtweisung erstarb ihm auf der Zunge. »Lass uns ins Kontor zurückgehen.«
»Ja, Vater. Wie du befiehlst.«
Balthasar war sichtlich erstaunt, aber da schwang noch etwas anderes in seinem Gesicht, in seiner Stimme mit: eine Art von Lauern, von stillem Triumph. Als ob die Beute die Schwäche des Jägers wittert, kam es Johannes in den Sinn, und es war kein angenehmer Gedanke.
Wortlos ging er voran, Balthasar folgte ihm.
Nach kurzer Zeit erreichten sie das Kontor des Hauses Heidfeldt, einen großen Bau mit Steinmauern und schwerem Holzdach.
Drinnen stapelten sich die Waren in die Höhe, wenn auch nicht mehr wie in früheren Zeiten. Johannes hatte noch deutlich vor Augen, wie es damals gewesen war, als sich die Waren bis unters Dach getürmt hatten. Doch nicht nur die Menge hatte sich verändert, auch die Art der Waren, mit denen das Haus Heidfeldt handelte. Hatte es früher kunstvolles Glas aus Venedig, Seide, Gewürze und andere erlesene Waren angeboten, war es in den Jahren seit der Reichsacht zu schnöden Gebrauchsgütern übergegangen. Einfache Stoffe, Korn, Fässer mit Salz, Holz für Kommoden und andere Einrichtungsgegenstände füllten nun das Kontor, nur mehr ein Abklatsch vergangenen Reichtums.
Wie so vieles war auch das eine Folge der Reichsacht. Obwohl Katholik, war Johannes durch seine Freundschaft zu den Ackermanns den Makel des »Lutheraner-Freunds« nie ganz losgeworden. Zudem hatte die Flucht von Christoph und Helene Ackermann aus Donauwörth sowie der Tod des Spaniers Emanuel Suárez und seiner Schwester einigen Staub aufgewirbelt. Zwar wussten nur die Eheleute Heidfeldt und Ackermann, dass es sich bei Suárez’ Schwester in Wahrheit um seine Gemahlin – und Helenes tot geglaubte Schwester Teresa – gehandelt hatte, die bayerischen Besatzer waren jedoch misstrauisch geblieben. Sie konnten nicht beweisen, dass Johannes seine Hand beim Tod des Spaniers und der Flucht seiner Freunde im Spiel gehabt hatte, hielten den Kaufmann aber auf Abstand.
Erst langsam, über die Jahre, hatte Johannes durch seinen Fleiß und seine Beharrlichkeit den Verdacht zerstreuen können und war in den Inneren Rat der Stadt aufgenommen worden. Das, da machte er sich nichts vor, war nur geschehen, weil kaum noch fähige Männer für dieses Amt in der Stadt waren. In den Jahren nach der Acht waren größtenteils Katholiken in den Rat aufgenommen worden, die lutherischen Patrizier waren in der Unterzahl oder später gar nicht mehr vertreten. Viele der alten lutherischen Familien hatten die Stadt verlassen, ihre Häuser standen leer und verfielen, weil den anderen Stadtbewohnern die Mittel fehlten, die Besitze zu erwerben. Der Handel war immer mehr zurückgegangen, auch das gesamte Leben, von Hochzeiten bis zum Bau neuer Häuser, war im Schwinden.
Das Kontor des Hauses Heidfeldt, durch den sein Besitzer nun mit seinem Sohn schritt, legte davon beredtes Zeugnis ab.
Die Handelsgehilfen waren eifrig damit beschäftigt, Platz für die zu erwartenden Güter aus Augsburg zu schaffen. Sie erwiderten Johannes’ Gruß freundlich, den seines Sohnes schon weniger freundlich.
Johannes riss sich aus seinen Gedanken und blieb stehen. »Vergesst mir die Weinfässer nicht«, rief er den Männern zu. »Lasst genügend Platz, denn ein paar davon werden wir sogar in dieser Stadt benötigen.«
Das Weingeschäft war früher ein sicherer Rettungsanker für den Handel gewesen, hatte sich aber zu einem beständigen Streitpunkt zwischen den bayerischen Besatzern und den Bewohnern entwickelt. Die Bayern wollten keinen Wein, sondern Bier, die Bewohner Donauwörths hielten jedoch an ihrem geliebten Wein fest. Nur einige wenige brauten den Gerstensaft, darunter der wie immer sehr geschäftstüchtige Francesco Santorio, der Wirt des Gasthauses Der Rote Hund. Manche Bewohner von Donauwörth nahmen ihm das übel. Johannes nicht. Man musste sehen, wo man blieb.
»Komm mit«, wandte sich der Kaufmann nun an Balthasar. »Wir werden die letzten Eintragungen vornehmen, dann haben wir das Tagwerk für heute erledigt.«
»Wie du wünschst, Vater.«
Johannes öffnete die hintere Kammer, zu der nur er und Balthasar Zutritt hatten und von wo aus die Geschicke des Unternehmens geleitet wurden. In der Mitte des Raums thronte schwer der wuchtige Tisch, an dem geschrieben und gerechnet wurde. Wie alles in der Kammer war auch der Schreibtisch abgenutzt, wirkte gleich seinem Besitzer von der Last des Alters gebeugt. Nichts wurde mehr erneuert, das Bestehende blieb.
Johannes durchquerte den Raum und ließ sich hinter dem Schreibtisch auf den Stuhl fallen. Er zog ein leinenes Tuch aus der Manteltasche und wischte sich damit über die Stirn. Der Stoff blieb trocken, obwohl dem Kaufmann heiß war und ihm das Blut in den Ohren rauschte.
Balthasar musterte ihn aufmerksam. »Ist dir nicht wohl?«
»Es ist alles in Ordnung. Ein langer Tag, weiter nichts.« Johannes steckte das Tuch wieder weg und schlug das große Buch auf, in dem der Bestand seiner Waren verzeichnet war. »Gib mir die Liste für Augsburg.«
Balthasar tat, wie ihm geheißen. Johannes besah sich erst den Bestand im Buch, dann tauchte er die Schreibfeder in das kleine Tintenfässchen und begann, die noch leere Liste mit den zu bestellenden Waren zu füllen. Doch schon nach kurzer Zeit hielt er inne, legte die Feder beiseite. Er konnte sich einfach nicht konzentrieren.
»Soll ich das übernehmen?« Balthasar war neben ihn getreten.
Johannes zögerte, dann übergab er seinem Sohn die Feder und stand auf. Balthasar setzte sich und begann unverzüglich zu schreiben.
Von außen drangen Gesprächsfetzen und die üblichen Geräusche herein: das Rumpeln, wenn Warengegenstände gestapelt wurden, leises Fluchen, wenn etwas nicht wie vorgesehen klappte.
In der Kammer wurde es dunkler. Die Dämmerung hatte eingesetzt. Johannes entzündete eine Talglampe und stellte sie auf den Schreibtisch, damit sein Sohn genug Licht für seine Arbeit hatte.
Während er Balthasar zusah, dachte Johannes an den Vorfall im Hafen zurück. Balthasar wäre beinahe auf den jungen Pecherer losgegangen, und jetzt saß er hier und erfüllte gehorsam seine Arbeit. Das waren die zwei Seiten seines Sohnes: Mal war er ungestüm und roh, drangsalierte die Untergebenen. Dann wieder vermied er Auseinandersetzungen, bei denen offenkundig war, dass er den Kürzeren ziehen würde. Und eine gewisse Bauernschläue fürs Geschäft war ohne Zweifel vorhanden – aber auch nicht mehr. Das bereitete Johannes Sorgen, und in diesem Augenblick, als das Kratzen der Feder das einzige Geräusch im Raum war, verspürte der Kaufmann das Bedürfnis, über seine Sorgen zu sprechen.
»Balthasar?«
»Ja, Vater?«, antwortete der, ohne aufzusehen.
»Ich möchte mit dir über Jos Pecherer reden.«
»Ich wusste doch, dass du mich nicht so einfach davonkommen lässt.« Balthasar legte die Feder weg, verschränkte die Hände vor dem Bauch und starrte seinen Vater an.
»Es geht nicht ums Davonkommen.« Johannes nahm den Krug mit Wein, der am Rand des Schreibtischs stand, und schenkte die beiden kunstvoll verzierten Zinnbecher voll, die ebenfalls immer auf dem Tisch standen. Er nahm einen Becher, Balthasar den anderen.
»Es geht darum«, fuhr Johannes fort, »dass du mein Nachfolger bist, und zwar mein einziger. Du sollst eines Tages unser Unternehmen führen, aber dazu muss man wissen, wie man mit seinen Untergebenen umgeht. Gerade wenn die Zeiten schlecht sind.« Er nahm einen großen Schluck, sein Sohn tat es ihm gleich.
»Und was rätst du mir, Vater?«
»Natürlich musst du streng sein, musst die Leute führen. Aber es gibt Situationen, in denen man mit Geschick mehr erreicht als mit Strenge.«
Er trank den Becher leer und schenkte sich nach. »Ich erinnere mich, als Lorenz Ackermann einmal –«
»Natürlich. Der heilige Lorenz.« Balthasars Stimme klang ironisch.
»Sprich nicht so respektlos«, erwiderte Johannes scharf. »Niemand ist heilig, vor allem nicht in unserem Gewerbe. Aber vor vielen Jahren stand Christoph dem Vater des Mannes gegenüber, den du heute bedroht hast, fast an der gleichen Stelle im Hafen. Auch der Vater wollte damals, dass Christoph ihm und seinen Leuten mehr bezahlt. Christoph hatte zuweilen ein etwas überschäumendes Temperament, und so wie du wäre er fast auf den Mann losgegangen.«
»Und was hat ihn bewogen, es nicht zu tun?«
»Lorenz. Der ist dazwischengegangen und hat eine für beide Seiten vertretbare Lösung ausgehandelt. So wie es ein Transporteur und natürlich auch ein Kaufmann tun sollte.«
»Du erwähnst oft, wie geschickt Lorenz sich im Unternehmen seines Vaters angestellt hat. Dann erklär mir doch eines.« Balthasar stellte den Becher ab. »Warum treibt sich dieser so musterhafte Sohn jetzt in Frankreich herum? Warum sucht er diese – diese Frau und besudelt damit Annas Andenken?«
Der letzte Satz war nur eine Finte, um Johannes für sich zu gewinnen. Der Kaufmann war sich sicher, dass Balthasar nicht viele Gedanken an seine tote Schwester verschwendete. Aber der Junge wusste, dass Johannes und Agnes auch jetzt noch, nach so vielen Jahren, schwer an dem Verlust ihrer Tochter trugen, und mit dem Bezug auf Louise, die Frau aus Frankreich, konnte er Lorenz’ Ansehen gezielt beschädigen.
»Darum geht es jetzt nicht, mein Sohn. Es geht darum, dass ich dir noch einmal dringend rate, dass du Menschen, auch Untergebene, mit Respekt behandelst, so sie ihn verdienen. Denn nur auf diese Weise erhältst du die Leistung, die du brauchst, um dein Unternehmen gewinnträchtig zu führen.«
Von draußen war jetzt ein Krachen zu hören, gefolgt von einem lauten Fluch. Wahrscheinlich war eines der Warenregale zusammengebrochen. Wieder einmal.
»Bist du fertig, Vater? Dann werde ich draußen besser nach dem Rechten sehen, wenn du gestattest.« Balthasar stand auf und blickte den Vater abwartend an. Der öffnete den Mund, um etwas zu sagen, überlegte es sich dann anders und nickte nur.
Balthasar verließ den Raum. Die Tür fiel zu, dann war der Kaufmann allein. Mit düsterer Miene trank er den Becher leer und füllte ihn ohne zu zögern nach.
Sieglinde Heidfeldt fror. Die feuchte Kälte drang durch den Boden, auf dem die Kirchenbänke standen, und von dort in die Füße der sitzenden Gläubigen. Bei jedem »Ave Maria« waren die Atemwolken der Betenden in der von Weihrauch geschwängerten Luft der Klosterkirche Heilig-Kreuz deutlich zu sehen.
Aber die Kälte war nicht das Schlimmste. Schlimmer war die tödliche Langeweile, die Sieglinde bei jeder Messe von Abt Hörmann befiel.
Sie blickte zwar, wie es sich schickte, zur Kanzel hinauf, von welcher der alte Abt predigte, nahm den Mann Gottes allerdings nicht wahr, weder ihn noch seine Predigt. Es war ihr unmöglich, Hörmanns schier endlosen Ausführungen zu folgen. Lieber wäre sie bei Pfarrer Weinmann in der Stadtpfarrkirche gewesen, der predigte immerhin über Tod und Apokalypse und forderte inbrünstig Gebete für den Kaiser und seine Truppen, damit sie endlich die ketzerischen Lutheraner in Böhmen besiegten. Doch Sieglindes Mutter bestand auf regelmäßige Messen in Heilig-Kreuz, aus welchem Grund auch immer.
»Ich wundere mich stets, wie der alte Hörmann überhaupt noch die Kraft hat, Chorrock und Talar zu tragen«, flüsterte ihr Klara, die kapriziöse Bäckerstochter, von der Seite her zu.
Sieglinde grinste. »Vielleicht sitzt ja der Diakon über ihm und führt ihn wie eine Marionette.«
Sie hörte ein vorwurfsvolles Räuspern von der anderen Seite. Magdalena, wer sonst. Sieglinde musste gar nicht hinsehen, um zu wissen, dass ihre Schwester missbilligend das Gesicht verzogen hatte.
Daher rollte sie gegenüber Klara übertrieben mit den Augen und sah dann wieder zu dem Abt hinauf. Sie versuchte gar nicht erst, seiner Predigt zu folgen, sondern dachte stattdessen an Erfreulicheres, etwa an die jungen Männer der Stadt. Sogar hier in der Kirche warfen sie der jüngsten Tochter des Kaufmanns Heidfeldt verstohlene Blicke zu, Sieglinde konnte es fast körperlich spüren. Am ersten Mai würde sie so viele Maizweige bekommen, dass man die Reichsstraße damit bepflastern konnte, scherzten nicht wenige Stadtbewohner. Und sie hatten nicht unrecht, denn mit ihren erst achtzehn Lenzen war Sieglinde Heidfeldt eine wunderschöne junge Frau, deren schlanker, dennoch sehr weiblicher Körper mit den üppigen blonden Haaren und den tiefblauen Augen die Träume gar mancher braver Bürger von Donauwörth heimsuchte. Es waren schon Wetten abgeschlossen worden, wer ihr Herz erobern würde, denn Anwärter gab es viele.
Aber Sieglinde hatte sich noch nicht festgelegt, obwohl ihre Eltern in regelmäßigen Abständen Fragen stellten. Im Augenblick genoss sie es einfach zu sehr, im Mittelpunkt der allgemeinen Bewunderung zu stehen.
Eine Weile wollte sie noch mit den Herzen der in Liebe Entflammten spielen, und dann – dann würde sie eine Wahl treffen. Und anschließend ein Leben voller Wonne führen.
Bei dem Gedanken daran erblühte ein liebliches Lächeln auf Sieglinde Heidfeldts Gesicht.
Aus den Augenwinkeln sah Magdalena, wie ihre Schwester selig lächelte. Sie war sich jedoch sicher, dass Sieglinde nicht den Worten des Abtes lauschte, sondern an etwas ganz anderes dachte.
Wieder einmal wurde ihr bewusst, wie wenig sie von ihrer Schwester hielt. Das ging schon seit der Zeit, als sie noch Kinder gewesen waren. Immer hatte sich Sieglinde mit Balthasar verbündet und gegen sie Partei ergriffen, sie bis aufs Blut gereizt. Als ihre ältere Schwester Anna noch lebte, hatte diese die beiden wenigstens ab und an in ihre Schranken gewiesen. Nach ihrem Tod war dieser Schutz weggefallen, und Balthasar und Sieglinde fuhren fort, Magdalena zu piesacken.
Wie verschieden wir Geschwister doch immer waren, dachte Magdalena, und das bis zum heutigen Tag. Balthasar war ein grober Klotz, während Sieglinde sich wie eine Kaiserin aufführte, weil ihr die jungen Männer der Stadt wie hechelnde Hunde nachliefen. Magdalena war zwar ebenfalls eine schöne junge Frau, mit langen braunen Haaren und durchdringenden, immer etwas misstrauisch wirkenden grünen Augen. Im Wesen jedoch glich sie ihrer Mutter. Auf jeden Fall war sie gottgefälliger und keinesfalls so verzogen wie Sieglinde, welcher der Vater immer schon viel zu viel nachgesehen hatte.
Die Predigt war zu Ende, und Abt Hörmann stimmte das Credo5 an. Magdalena betete mit energischer Stimme, denn im Gegensatz zu Sieglinde lag ihr etwas an der Messe – wieder etwas, das sie mit ihrer Mutter verband. Sie liebte die alte Klosterkirche, besonders jetzt am Abend, wenn sie von Kerzen erhellt war. Das flackernde Licht fiel dann immer geheimnisvoll auf die reich verzierten Kapellen und Altäre und ließ das Gold geheimnisvoll glänzen. Die Fresken auf den dicken Säulen, welche das Kirchenschiff stützten, schienen zu tanzen, und über allem lag der wunderbare Duft nach Weihrauch.
Auch Anna hatte es hier immer sehr gut gefallen. An einem kalten Winterabend war sie einst mit Magdalena hierhergekommen, weil sie etwas mit dem damaligen Prior Beck besprechen wollte, aber der Prior war zu einem Kranken gerufen worden. Also hatten Anna und Magdalena vor dem Hochaltar ein kurzes Gebet gesprochen, und dann hatte Anna ihrer kleinen Schwester die Geschichte der Kaisermonstranz erzählt, die beim Hochaltar stand und Heilig-Kreuz erst berühmt gemacht hatte.
Zwar kannte Magdalena die Geschichte, aber es war etwas anderes, sie in der stillen abendlichen Kirche zu hören. So viele Kaiser hatten andächtig vor der Monstranz gekniet, die Lukas von Antwerpen angefertigt hatte und die in ihrer Mitte, von Gold, Silber und anderen Edelsteinen verziert, einige Splitter vom Kreuz des Erlösers hielt. An diesem Abend hatte Magdalena, auf den Knien wie unzählige Mächtige vor ihr, sich wie einer dieser Herrscher gefühlt, verbunden im tiefen Glauben an den Erlöser.
Es war ein schöner Moment gewesen, der nur den beiden Schwestern gehört hatte.
Jetzt war Magdalena wieder hier, aber mit einer anderen Schwester, die empörenderweise so aussah, als ob sie nur mit Mühe ein Gähnen unterdrücken könnte.
Eingebildetes Biest. Man sollte dir –
Das beginnende Offertorium6 riss Magdalena Heidfeldt aus ihren unchristlichen Gedanken und band sie wieder in den Ablauf der Messe ein.
Balthasar schloss das Eingangstor des Hauses Heidfeldt mit aller Behutsamkeit, die ihm möglich war. Trotzdem knirschte das Tor. Der junge Mann erstarrte, blickte die Fassade des Hauses hinauf, dann nach links, dann nach rechts über die nächtliche Straße.
Alles war ruhig. Niemand schien etwas gehört zu haben.
Gut.
Der Sohn des Kaufmanns Heidfeldt zog sich die Kapuze des Mantels über den Kopf und ging mit schnellen Schritten die Straße zum Unteren Markt entlang. Er wusste, dass er sich nicht von den Stadtwachen erwischen lassen durfte, denn sie nahmen jeden ausnahmslos mit, der sich hier ohne Laterne nach Einbruch der Dunkelheit herumtrieb. Auch den Sohn eines Ratsherrn.
Genüsslich sog Balthasar die kalte Luft ein. Er war froh, der tristen Stimmung des Elternhauses entronnen zu sein. Das Abendessen war fast schweigend eingenommen worden. Der Vater hatte erschöpft gewirkt und seiner geliebten Fleischsuppe weniger als sonst zugesprochen. Die Mutter war blass und abwesend gewesen, die beiden Schwestern hatten sich ihren üblichen Sticheleien hingegeben, allerdings ebenfalls nicht in dem Ausmaß wie sonst.
Er selbst hatte ebenfalls nicht viel zum Gespräch beigetragen, drei Teller Suppe gelöffelt – er brauchte Kraft für den Abend – und dann die Stube verlassen, mit der Bemerkung, er müsse unten im Geschäft noch etwas vorbereiten. Der Vater hatte nur genickt, Balthasar war sich nicht sicher, ob er ihn überhaupt gehört hatte.
Die Dunkelheit und jeden Schatten ausnutzend, schlich Balthasar nun den Unteren Markt entlang. Bei dem Gedanken an das, was ihn erwartete, durchfuhr ihn prickelnde Erregung.
Er näherte sich dem Ende des Marktes, das Stadtzollhaus und das Rathaus kamen in Sicht. Bisher war alles gut gegangen, und so –
Schritte. Sie kamen von vorne, von der Ecke, wo die Reichsstraße eine Biegung machte.
Balthasar durchfuhr es eiskalt. Natürlich konnte er nicht mit Sicherheit wissen, ob es die Wachen waren, aber er durfte kein Risiko eingehen. Mit einer für einen so bulligen Mann erstaunlichen Behändigkeit bewegte er sich schnell und fast lautlos voran.
Die Schritte kamen näher und näher, da bog Balthasar nach rechts ab und glitt in die enge, nur mannsbreite Gasse, die den Unteren Markt mit der Kronengasse verband.
Er presste sich an die Wand und wagte kaum zu atmen.
Eine Stimme, unverkennbar bayrisch.
»Ein Rundgang noch, Hans, dann soll uns der verdammte Joachim ein Bier ausgeben. Der sitzt gemütlich beim Tor und säuft im Warmen, und wir frieren uns unsere verdammten –«
»Bist du von Sinnen? Weißt du noch, was der Alte mit dem Samuel gemacht hat, als er ihn erwischt hat?«
»Hast ja recht.«
Die Schritte wurden langsamer und verstummten. Balthasar sah den Lichtschein einer Lampe hin und her pendeln, genau am Eingang der Gasse. Nur mit Mühe konnte er ein Zähneknirschen unterdrücken. Mussten die beiden ausgerechnet hier stehen bleiben?
»Wir sollten unseren Wachdienst auf dem Turm der Stadtpfarrkirche versehen. Dann könnten wir mit dem alten Virgil saufen.« Ein geräuschvolles Hochziehen der Nase, ein Spucken.
»Da sei Gott vor. Seitdem ihm Frau und Kinder an den Blattern weggestorben sind, jammert der jedem, der in der Nähe ist, die Ohren voll.«
»Das tät ich glatt in Kauf nehmen.«
Balthasar fluchte innerlich. Er war nur ein paar Schritte von den Männern entfernt, und wenn einer der beiden herleuchtete, war er verloren. Es nützte nichts, er musste weiter.
Vorsichtig, Schritt für Schritt, zog er sich noch tiefer in die Gasse zurück – und stieß dabei mit dem Fuß an einen zerbrochenen Krug, den jemand liegen gelassen hatte.
Das Geräusch schien in Balthasars Ohren zu explodieren.
Dann Stille –
»Was war das, Hans?«
»Was denn?«
»Na das eben. Kam aus der Gasse.«
Balthasar handelte instinktiv. Es galt, nur weiter weg vom Licht und von den Wachen zu kommen. So leise er konnte, schlurfte er, an die Hauswände gedrückt, den Durchlass entlang, auf Gegenstände, die am Boden lagen, nahm er dabei keine Rücksicht mehr. Weiter, immer weiter …
Der Schein der Laterne fiel in die Gasse.
Auf einmal fühlte Balthasar am Rücken etwas Platz. Es musste eine Nische sein. Ohne zu zögern drückte er sich hinein, im gleichen Augenblick, da die Laterne höher geschwenkt wurde und ihr Lichtkegel die Gasse ausleuchtete.
Der Kaufmannssohn erstarrte, atmete nicht einmal.
Dann verschwand das Licht wieder.
»Da ist nichts. War sicher nur irgendein Hunds- oder Katzenvieh.«
»Als ob’s die noch gäb in der Stadt. Haben die Lutheraner doch alle gefressen, wie letzten Frühling die Waren nicht durchgekommen sind.«
Ein leises, gemeines Lachen. Dann waren Schritte zu hören, die sich entfernten.
Balthasar konnte sein Glück kaum fassen. Zitternd atmete er tief durch und spürte den Schweiß, der ihm trotz der Kälte über Stirn und Rücken geflossen war.
Er verharrte noch einige Augenblicke, dann wagte er sich wieder aus seinem Versteck. Weiter vorne, in Richtung Oberer Markt, waren die beiden Gestalten mit ihrer Laterne zu sehen. Damit war Balthasar für kurze Zeit sicher, und mehr brauchte er nicht. Er verließ den Unteren Markt und huschte zielstrebig durch die Seitenstraße.
Kurze Zeit später erreichte Balthasar sein Ziel – das Manasser-Haus. Seitdem der Spanier Suárez und seine Schwester dort gestorben waren, war das Haus verlassen.
Der junge Mann betrat das Erdgeschoss, zog die Tür, die in den Angeln hing, beiseite und bemühte sich, die Stufen in das obere Geschoss nicht über Gebühr knarren zu lassen.
Dann schritt er durch den Gang. Er war schon öfter hier gewesen, kannte jede Handbreit.
Er betrat die Stube. Nachdem sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte er Schemen wahrnehmen, Bilder an den Wänden, die Vertäfelung, Stühle und Tisch. Er wusste, dass sich am Boden ein Blutfleck befand, bräunlich und verblasst, eine unheilvolle Erinnerung an das, was vor vielen Jahren hier geschehen war.
Es war das Blut des Spaniers, der erstochen worden war. Seine Mörderin hatte sich daraufhin selbst vergiftet.
Balthasar grinste im Dunkeln. Das hier war ein gemiedener Ort und damit der am besten geeignete, um Unzucht zu treiben.
»Da bist du ja endlich.« Die weibliche Stimme klang unwillig.
»Ich bin beinahe den Stadtwachen in die Arme gelaufen. Zum Glück konnte ich ihnen entkommen, sonst müsstest du heute Nacht auf das Vergnügen meiner Gesellschaft verzichten.«
Sie trat aus den Schatten. Klein, fast zierlich, die Haare offen und schwarz, die Augen glänzend im spärlichen Mondschein, der von außen hereindrang.
»Ob es ein Vergnügen ist, werden wir ja sehen, Balthasar Heidfeldt«, meinte Mechthild Meyer und zwinkerte ihm zu.
»Du hast wahrlich ein loses Mundwerk für eine Magd.« Er zog sie an sich, küsste sie gierig und fühlte die Lust in seinen Lenden. Es war ein gefährliches Spiel, das er da trieb, denn auf Unzucht standen hohe Strafen. Bisher hatte er sich immer an Frauen gehalten, die er für ihre Liebesdienste bezahlt hatte, und das ausschließlich, wenn er mit seinem Vater auf Handelsreisen unterwegs war. In Donauwörth selbst hatte er sich immer unnahbar gegeben.
Für Mechthild jedoch war er seinen Vorsätzen untreu geworden. Er hatte die Magd im Hause des Statthalters kennengelernt, als er mit seinem Vater dort war. Ein heimliches Wort gab das andere, am Markt und nach dem Kirchgang, und schließlich hatten sie sich für heute im Manasser-Haus verabredet. Wie es die Magd geschafft hatte, allein und unbemerkt hierherzukommen, war Balthasar ein Rätsel, aber es zeugte von ihrer Entschlusskraft.
Mechthild löste sich wieder von ihm. »Wir müssen uns beeilen. Meine Herrin wird bald nach Hause kommen.«
»Ein wenig wird sie dich noch entbehren müssen.« Balthasar nahm seinen Mantel ab und breitete ihn auf dem Boden aus. Dann umarmte er Mechthild und zog sie auf den Mantel hinab. Sie küsste ihn, ihre Hand glitt in seinen Schritt, streichelte kundig auf und ab. Balthasar fühlte, wie sein Glied in seiner Hose steif wurde. Er keuchte und streifte die Hose ab. Mechthild raffte ihren Rock hoch, und er drang in sie ein. Die Magd begann zu stöhnen wie ein brünstiges Tier. Balthasar spürte die Hitze ihres Schoßes und dachte, dass er noch nie so erregt gewesen war. Dieser kleine schwarzhaarige Teufel vermochte ungeahnte Gelüste in ihm zu wecken.
Dann waren alle Gedanken verschwunden, und Balthasar gab sich nur noch seiner Lust hin.
Agnes betrachtete ihren Gemahl, der in der Bettstatt lag und schnarchte. Das hatte er schon immer, aber jetzt war ein rasselndes Geräusch dazugekommen, das sie sehr beunruhigte.
Sie sprach ein kurzes Gebet, in dem sie den Schutz Gottes für ihre Familie erflehte. Dann bekreuzigte sie sich, löste den Haarknoten und schüttelte ihren Kopf. Das blonde Haar legte sich wie ein tröstender Fächer über ihre Schultern.
Sie blies das Kerzenlicht aus und legte sich neben Johannes.
Schloss die Augen und war bald darauf in einen unruhigen Schlaf gefallen.
Magdalena lauschte den Atemzügen ihrer Schwester, die im gegenüberliegenden Bett der Schlafkammer lag. Deren Atem ging schnell, fast hechelnd. Magdalena wusste genau, was Sieglinde da drüben machte, welche Sünde sie trieb.
Aber war sie selbst besser?
Wurde sie nicht immer wieder von unzüchtigen Gedanken heimgesucht? Von Wünschen nach Liebe und einem Mann, einem ganz bestimmten?
Nach Lucas?
Es war vor einigen Jahren geschehen, als sie mit ihrer Familie nach Prag gereist war. Lucas hatte im Werkraum des Vaters einen kleinen Transportkarren ausgebessert. Es war heiß gewesen, und er hatte sein Hemd ausgezogen. Sein muskulöser Oberkörper hatte von Schweiß geglänzt, als sich seine Arme mit dem Hammer im Schwung rhythmisch hoben und senkten.
Die Gedanken, die sie bei diesem Anblick so unerwartet durchströmten, hatten Magdalena Heidfeldt erröten lassen.
Mit einem Mal hatte er sich umgedreht und sie bemerkt. Zunächst hatte er gestutzt, dann hatte sich ein Lächeln auf seinem Gesicht ausgebreitet. Er hatte sie umarmt, bevor sie auch nur reagieren konnte, und sie spürte seine Kraft und Muskeln mit einer Intensität, die sie selbst erstaunte. Danach hatten sie lange miteinander gesprochen, so vertraut, als wären sie nie getrennt gewesen. Und doch hatte sich etwas verändert, zumindest für Magdalena. Aus einer Kinderfreundschaft war etwas anderes geworden.
In dieser Nacht in Prag, als jedermann im Haus schlief, hatte Magdalena sich zum ersten Mal selbst berührt, wie es ihr Kathrein, die feiste Tochter des Lederers, gezeigt hatte. Sie war schamerfüllt über die Wonne gewesen, die sie durchströmte. Und hatte doch weitergemacht und dabei leise »Lucas« gestöhnt …
In den Jahren darauf hatte sich an ihren Gefühlen nichts verändert. Und auch jetzt, in diesem Augenblick, in ihrer Bettstatt, sah sie Lucas so deutlich vor sich, als ob er wahrhaft vor ihr stünde – beinahe schmerzhaft spürte sie ihr Begehren nach ihm.
Begehren und die Hoffnung, ihn wiederzusehen.
Mit ihm vereint zu sein, für immer.
Donauwörth, Juni A.D. 1619
Der Regen, der noch in der Frühe auf Donauwörth heruntergeprasselt war, hatte aufgehört. Nach der Schwüle der letzten Tage lag nun eine willkommene Frische über der Stadt.
Auf dem Oberen und Unteren Markt herrschte gemäßigtes Treiben. Die Handwerksbetriebe öffneten ihre Tore, Meister und Gesellen gingen für alle sichtbar ihrem Gewerbe nach, teils sogar auf der Straße. Es wurde gehämmert, gehobelt, gewebt, geschmiedet, und so manches unflätige Wort fiel, wenn einer der Meister wieder einmal nicht mit dem Werk seiner Gehilfen zufrieden war.
Die Bürger der Stadt waren ebenfalls unterwegs, allein oder mit ihren Gemahlinnen, alle bemüht, den Eimern mit der Notdurft auszuweichen, die aus den Fenstern der Häuser gekippt wurden.
Von allem unberührt, erhob sich das Rathaus von Donauwörth am Ende des Unteren Markts in die Höhe, steinern und streng.
Johannes Heidfeldt saß zwischen den anderen Mitgliedern des Zwölferrates, der die Geschicke der Stadt leitete. Zumindest nominell, denn in Wahrheit herrschten einzig und allein die Bayern.
Obwohl die Reichsacht 1609 aufgehoben worden war, hatte der bayerische Herzog Maximilian die Oberhoheit über Donauwörth erhalten. Der Kaiser hatte Maximilian zugesichert, dass diesem seine für die Einnahme der Stadt aufgewendeten Kosten von den Stadtbewohnern erstattet werden würden. Zähneknirschend hatten die Bewohner dem Bayern-Herzog das Handgelübde leisten müssen und sich darangemacht, die Schuld loszuwerden. Doch schon im Jahr 1613 war diese Schuld auf annähernd eine halbe Million Gulden angestiegen. Ab da war auch dem letzten Gerbergesellen klar, dass Donauwörth seine Schulden niemals würde zurückzahlen können.
Die Stadt blieb also im bayrischen Würgegriff, mit einem bayrischen Statthalter und drei Bürgermeistern, die ihm unterstanden. Dass es seit dem lutherischen Aderlass, den die Stadt erlitten hatte, fast ausschließlich unfähige, aus katholischen Reihen stammende Ratsherren gab, war aufgrund der Herrschaft der Bayern nicht wirklich von Bedeutung. Johannes tat, was er konnte, aber er war machtlos gegen seine Ratsgenossen, die ihre Untauglichkeit mit einer geradezu hündischen Ergebenheit gegenüber den Bayern wettzumachen trachteten.
So lag das Los von Donauwörth in den Händen des Mannes, der sich jetzt erhob und mit gemessenem Schritt vor dem Rat auf und ab zu gehen begann.
Die Ratsmitglieder blieben still auf der großen, halbrunden Holzbank sitzen, die den Raum beherrschte. Manch einer drehte unruhig den steifen Hut in den Händen, schwitzte ob der Schwüle, die sich noch im Raum hielt, und kratzte sich am Wams oder an der Strumpfhose.
Hans Albrecht von Dandorf, Statthalter Herzog Maximilians, strich sich über die glatt rasierten Wangen und wandte sein schmales, scharf geschnittenes Gesicht dem Rat zu. Alles an ihm wirkte kalt, vom grauen kurzen Haar über die bohrenden Augen bis zum dunklen Mantel, den er trotz der Wärme im Raum um die Schultern trug. Kein Schweißtropfen zierte seine hohe Stirn, keine Unsicherheit war zu erkennen. Von Dandorf befahl, und wer nicht gehorchte, lernte ihn schneller kennen, als ihm lieb war.
»Werte Herren des Rates, die Nachrichten werden immer schlechter.«
Ein unruhiges Murmeln machte sich breit.
»Von Thurns böhmisches Heer«, fuhr der Statthalter fort, »steht vor den Toren Wiens. Niemand weiß, wie lange die Stadt sich halten kann.«
»Und von Bucquoy?« Stadtpfleger Georg Fugger, der bei jeder Ratssitzung dabei war und jeden Beschluss genehmigen musste, fuhr sich unruhig über sein dünnes Haar.
»Wird sich Mansfeld bei Sablat7 stellen. Auch hier wissen wir nicht, wessen Fahne den Sieg davontragen wird.«
Johannes hatte seine Zweifel, ob es dem kaiserlichen Befehlshaber von Bucquoy, der seit Ausbruch des Krieges nur Niederlagen zu verzeichnen hatte, gelingen würde, den unerschrockenen Söldnerführer Ernst von Mansfeld zu schlagen. Er behielt seine Zweifel jedoch für sich, denn es war nicht ratsam, offen am Kaiser zu zweifeln.
Von Dandorf hob die Hände. »Es gibt jedoch auch gute Neuigkeiten. Ich darf verkünden, dass unser Herzog Maximilian in Gesprächen mit Kaiser Ferdinand steht. Er verhandelt mit dem Kaiser über ein Heer, das er im Namen der Liga gegen die Lutheraner führen wird.«
»Und dann wird sich das Blatt wenden, beim Allmächtigen«, warf Bürgermeister Franz Widemann eifrig ein. Johannes empfand Widerwillen gegen den dicken, immer schwitzenden »Dreier-Franz«, so genannt, weil er im Laufe seines Lebens schon dreimal die Konfession gewechselt hatte. »Fähnlein im Wind« war eine noch viel zu harmlose Umschreibung für den amtierenden Bürgermeister, dessen Unterwürfigkeit sogar im Rat von Donauwörth ihresgleichen suchte.
»Darauf könnt Ihr Gift nehmen«, erwiderte von Dandorf trocken. »Wenn die Liga erst einmal marschiert, werden sich die Böhmen schneller in der Hölle einfinden, als Ihr einen Kapaun fresst, Herr Bürgermeister.«
Einige der Ratsherren lachten, Widemann stimmte mit unbehaglichem Gesicht ein.
Johannes blickte den Statthalter nachdenklich an. Der Mann wirkte wie aus Eisen, hart und unnachgiebig. Aber von den drei bayrischen Statthaltern, die Donauwörth seit der Reichsacht ertragen musste, war von Dandorf noch der gemäßigtste. Am schlimmsten war der berüchtigte Freiherr von Bemelberg gewesen, unter dem ab dem Jahr 1608 die Scheiterhaufen zu lodern begannen. Viele von Johannes’ Glaubensgenossen hatten das Vorgehen gegen die »Hexen« begrüßt, der Kaufmann selbst war jedoch mit jeder Faser seines Herzens dagegen gewesen, auch wenn er es natürlich nicht zeigte.
Für Johannes versinnbildlichte vor allem der Tod der Witwe Anna Buecher den Wahnsinn der Verbrennungen. Die Witwe war eine herzensgute Frau gewesen, die niemals irgendwem ein Leid zugefügt hatte. Aber sie war die Tochter des ehemaligen Bürgermeisters Hans Buecher und bewohnte eines der schönsten Bürgerhäuser der Stadt, und das hatte genügt, um Neid aufkommen zu lassen. Unter glühenden Zangen hatte das arme Weib schließlich gestanden, mit dem Teufel Unzucht getrieben und Kinderfleisch gegessen zu haben. Ihre Schreie auf dem Scheiterhaufen waren geradezu unmenschlich gewesen und hatten Johannes und vielen anderen in der Seele wehgetan. Nur von Bemelberg hatte sich völlig ungerührt über seinen korrekt gestutzten Schnurrbart gestrichen und unverzüglich seinen Umzug in das Haus der toten Witwe veranlasst. Denn einem Statthalter stand eine schöne Unterkunft zu.
Unter dem jetzigen Befehlshaber waren zumindest keine neuen Scheiterhaufen angezündet worden. Aber Johannes wollte nicht daran denken, wozu der Mann fähig wäre, sollten Situationen eintreten, die ein Höchstmaß an Härte verlangten.
»Nun aber, meine Herren, zu der Lage in der Stadt«, fuhr von Dandorf fort …
Johannes stand vor dem Rathaus. Die Sitzung war schnell verlaufen, denn es gab nicht viel zu besprechen. Keine Trauung, die anstand, keine leer stehenden Häuser, die gekauft wurden. Nur das stete Sinken der Einwohnerzahl und das stete Kämpfen des Handels und Handwerks um Abnehmer und Aufträge.
Der Kaufmann blickte von Dandorf und seinem Gefolge nach, die sich vom Rathaus entfernten. Mit Sicherheit ging es wieder zum Goldenen Löwen. Der Löwe war das einzige der großen Gasthäuser, das noch betrieben wurde, und das nur, weil es sich seit dem ehemaligen Bürgermeister Wurm so eingebürgert hatte, dass die hohen Herren der Stadt dort speisten.
Die kleine Gruppe passierte das Stadtzollhaus. Am Erkertürmchen des Hauses ragte die Statue des Ritters von Zusum in die Höhe. Der Ritter war einst einer der hervorragendsten Streiter für Kaiser Maximilian im Krieg gegen die Schweizer gewesen und hatte vom Kaiser als Dank die Fahne des Reiches geschenkt bekommen. Die Statue des Ritters trug diese Fahne bis heute in ihren steinernen Händen.
Johannes huschte ein grimmiges Lächeln übers Gesicht.
Oben am Erker stand der tapfere Ritter, um für immer über die Stadt zu wachen, wie er dereinst geschworen hatte.
Unter ihm ging mit Albrecht von Dandorf das Sinnbild seines Versagens vorbei.
Der Kaufmann setzte sich seinen Hut auf. Gemächlich schritt er in die entgegengesetzte Richtung, die von Dandorf und seine Untergebenen eingeschlagen hatten. Gleich darauf bog er in die Kapellgasse ein und freute sich, als er schon von Weitem den wohlbekannten Fachwerkbau sah und die aus Blech getriebene Figur des flammend roten Hundes über dem Tor.
Agnes, Balthasar, Magdalena und Sieglinde gingen schnellen Schrittes durch die Kapellgasse.
»Ich hoffe der alte Sodomit tischt gut auf. Ich bin hungrig wie ein Wolf.« Balthasar strich sich über seinen Bauch, der unter der Joppe gut sichtbar hervorstand.
»Wie kannst du Santorio nur so nennen?«, empörte sich Magdalena. »Nach allem, was er für uns getan hat?«
»Für die Ackermanns hat er sich hervorgetan. Und das mit Sicherheit auch nur, weil er sich davon einen Vorteil versprochen hat«, erwiderte Sieglinde verächtlich.
»Sprecht nicht so respektlos, ihr alle zusammen! Und nun beeilt euch, euer Vater wartet mit Sicherheit schon auf uns.« Agnes fühlte Traurigkeit über Balthasars und Sieglindes verletzende Worte. Sie wusste, dass Francesco Santorio die Gerüchte nie loswerden würde, obwohl sie völlig haltlos waren. Aber es tat ihrem Herz besonders weh, wenn ihre eigenen Kinder so gedankenlos über den Mann sprachen, der den Familien Ackermann und Heidfeldt immer beigestanden hatte. Vor allem am Anfang, als sich Johannes und Christoph als junge Männer ihren Weg nach oben hatten erkämpfen müssen, hatte der Wirt sie unterstützt. Und war nicht er es gewesen, der in einer kalten Winternacht Christoph und Helene Ackermann auf einem seiner Wagen aus der Stadt hatte transportieren lassen, unter den Augen der bayrischen Besatzer? War nicht er es gewesen, der damit sein Leben riskiert hatte?
Aber ihr Sohn und ihre junge Tochter schmähten diesen Mann seit jeher. Jugend vergaß so schnell, dass es wehtat.
Sie erreichten das Gasthaus, öffneten das schwere Eingangstor und schlüpften hindurch.
Francesco Santorio trat ihnen gebeugt entgegen, das weiße Haar nur mehr ein Flaum auf dem faltigen, mit Altersflecken übersäten Schädel. Aber seine dunklen Augen strahlten immer noch Kraft und Wärme aus.
»Seid willkommen, Agnes Heidfeldt. Euer Gemahl erwartet Euch bereits.«
Er führte sie umgehend zur besten Stube. Drinnen saß Johannes an einem Ecktisch, und sie setzten sich zu ihm.
Die rauchgeschwängerte Luft war zum Schneiden dick, obwohl die Stube nicht sehr gut besucht war. An einem Tisch saßen einige Bildermacher und Schmiede, an einer Tafel ein Trupp Bayern. Die Soldaten hatten alle einen Krug Bier vor sich, dazu eine riesige Platte mit Sauerkraut und Speckschwarten. Ihre Gesichter waren gerötet, die Augen glasig. Ihre Pfeifen glommen in der dämmrigen Stube, deren kleine Fenster nicht viel Tageslicht hereinließen.
Agnes fühlte sofort Unruhe in sich aufsteigen. »Wie lange sind die schon da?«, flüsterte sie Johannes zu.
»Augenscheinlich schon länger«, antwortete der. »Aber sorge dich nicht über Gebühr – von Dandorf bestraft Übergriffe seiner Männer streng.«