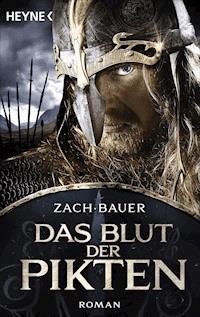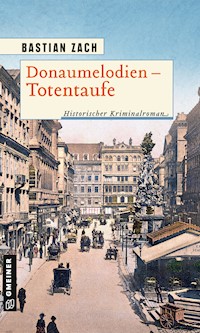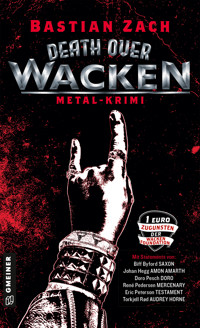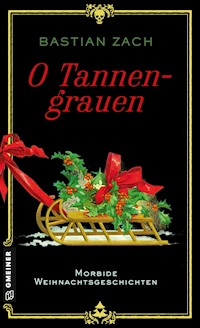9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tränen-der-Erde-Saga
- Sprache: Deutsch
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, Anno Domini 1606. Der Schatten des drohenden Dreißigjährigen Krieges legt sich wie ein Leichentuch über das Reich. In der Reichsstadt Schwäbischwerd leben zwei angesehene Familien, die eng miteinander befreundet sind. Die katholischen Heidfeldts und die protestantischen Ackermanns scheinen alles zu teilen: Geschäft, Wohlstand und Liebe. Sie haben Macht und Einfluss, doch gleichzeitig werden sie bedroht von Neidern, die sie im aufkommenden Religionsstreit zu Fall bringen wollen. Niemand ahnt, dass sie mit einem niederträchtigen Verrat den Grundstein für ihr Vermögen gelegt haben. Während der Sturm des Krieges sich ankündigt, geraten die beiden Familien in einen Strudel aus Intrigen, Macht und Leidenschaft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
DAS BUCH
»Macht auf, ich flehe euch an!« Eine belagerte Stadt, ein verzweifeltes Pochen an das Tor der einzigen sicheren Zuflucht – vergeblich. Doch Helene Ackermann und ihr Mann Christoph haben Glück, sie entgehen mit ihren Freunden, den Heidfeldts, dem Untergang. In einer anderen Stadt bauen sie sich ein neues Leben auf, gründen Unternehmen und Familien. Jahre später stehen sie am Zenit ihres Erfolgs, nichts kann ihre Freundschaft trüben – bis auf ihre gegensätzlichen Konfessionen, welche zusehends einen Keil zwischen die protestantischen Ackermanns und die katholischen Heidfeldts treiben. Es ist ein Keil zwischen Freunden, zwischen Familien, und schon bald zwischen der gesamten Bevölkerung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nationen ...
DIE AUTOREN
Bastian Zach, geboren 1973, lebt und arbeitet als selbstständiger Schriftsteller in Wien.
Matthias Bauer, geboren 1973, lebt und arbeitet als selbstständiger Schriftsteller in Tirol.
Zusammen schreiben sie als Zach/Bauer Romane (unter anderem die »Morbus Dei«-Trilogie) und Drehbücher, zuletzt zum internationalen Blockbuster »Northmen – A Viking Saga«. Mit den großen Epen »Das Blut der Pikten« und »Feuersturm« (ebenfalls bei Heyne erschienen) erweckten sie die Welt der Wikinger zum Leben.
BASTIAN ZACH ~ MATTHIAS BAUER
Tränen derErde
HISTORISCHER ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Bastian Zach und Matthias Bauer
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Barbara Häusler
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München,
unter Verwendung von © Richard Jenkins Photography (Frau)/
© Shutterstock.com (Slava Gerj, Venus Angel, Matt Gibson,
after6pm, Bernatskaya Oxana, Everett Historical) (Hintergrund)
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-24038-7V001
www.heyne.de
Für Sabine
Peragravit tunc super sidus
Die Hauptcharaktere
Familie Heidfeldt, Katholiken
Johannes Heidfeldt, Kaufmann
Dorothea Heidfeldt, seine erste Ehefrau
Agnes Heidfeldt, seine zweite Ehefrau
Anna, ihre älteste Tochter
Balthasar, ihr Sohn
Magdalena, ihre Tochter
Sieglinde, ihre jüngste Tochter
Gebhard Baumgart, Bruder von Agnes Heidfeldt
Familie Ackermann, Lutheraner
Christoph Ackermann, Transporteur
Helene Ackermann, seine Ehefrau
Lorenz, ihr ältester Sohn
Lucas und Philipp, ihre Zwillingssöhne
Teresa Dirr, Schwester von Helene
Sonstige
Emanuel Suárez, spanischer Edelmann
Sibylla Amling, Ehefrau des lutherischen Ratsherrn Erasmus Amling
Louise Croÿ, Witwe aus Frankreich
Georg Wurm, genannt »Der Sattler«,Bürgermeister von Schwäbischwerd
Georg Kuno, von Augsburg, Stadtschreiber
Diakon Johannes Delzer, lutherischer Geistlicher
Prior Georg Beck, katholischer Geistlicher
Francesco Santorio, Wirt des Gasthauses ›Der Rote Hund‹
Alexander von Haslang, Befehlshaber des Herzogs Maximilian von Bayern
Im Jahre 1618 entbrannte zwischen Katholiken und Lutheranern ein Krieg, der dreißig Jahre dauern sollte und große Teile Europas in einen Strudel des Verderbens riss.
Der Krieg kostete beinahe zwei Drittel der deutschen Bevölkerung das Leben.
Doch schon lange vor 1618 nahmen Geschehnisse ihren schicksalhaften Lauf, die letztendlich zum Ausbruch des Krieges führten …
Deutz, 10. August A.D. 1583
Mit einem spitzen Schrei rutschte Helene auf den regennassen Steinen der Gasse aus und schlug mit dem Kopf hart gegen den Holzstreb eines Fachwerkhauses. Für einen Moment war sie benommen, nahm ihren rasenden Herzschlag wie durch einen roten, pulsierenden Schleier vor den Augen wahr.
Die junge Frau, beinahe noch ein Mädchen, rieb sich die angeschlagene Stelle und spürte ein dumpfes Pochen im Kopf. Dann wurde ihr Blick wieder klar.
Verängstigt sah sie um sich: Regen prasselte aus schweren Gewitterwolken, die langsam von der Dämmerung verschluckt wurden. Die enge Gasse war menschenleer, die Fenster der Häuser finster. Ein brandiger Geruch war allgegenwärtig. Vor wenigen Tagen hatte ein Feuer in Teilen der Stadt gewütet, erst der Regen hatte ihm Einhalt geboten. Trotzdem war die Furcht der Bewohner ob eines alles verschlingenden Feuers nicht so groß wie die Furcht vor dem, was vor der Stadt lauerte.
Helene blickte auf ihr Kleid hinab. Der bräunliche Stoff war oberhalb des linken Knies aufgerissen. Ihre Beine schmerzten, ihr Kopf tat ihr weh, aber im Augenblick konnte sie auf sich keine Rücksicht nehmen – durfte keine Rücksicht nehmen. Zu viel stand auf dem Spiel.
Sie rappelte sich auf, raffte ihren Rock und lief wieder los, als wäre der Leibhaftige persönlich hinter ihr her.
Hätte Helene Ackermann auch nur im Entferntesten geahnt, was sie alsbald anrichten würde, so wäre sie wohl sitzen geblieben und hätte das Grauen, das die Stadt zu verschlingen drohte, einfach über sich ergehen lassen.
Am Ende der Gasse zeichnete sich der wuchtige Umriss der Klosterkirche von Deutz immer deutlicher gegen den Gewitterhimmel ab, gleich einem gesichtslosen Monstrum, das immer größer wuchs, je näher man ihm kam.
Helenes Lungen schmerzten, das Atmen fiel ihr mit jedem Zug schwerer. Nur noch ein wenig durchhalten, dann habe ich es geschafft, dachte sie, gleich bin ich bei ihr –
In diesem Augenblick hüllte sie eine dichte Staubwolke ein. Holzsplitter, Fassadentrümmer und Glasscherben schnitten durch die Luft und ließen Helene doch scheinbar unberührt. Sie taumelte, dann hörte sie einen dumpfen Knall – die Belagerer begannen wieder mit der Beschießung der Stadt.
Eine warme Flüssigkeit trat aus ihrer Schläfe, wurde vom herabpeitschenden Regen über ihre Wange gespült und vom Saum ihrer Haube aufgesogen. Achtlos strich Helene über die Wunde, während sie versuchte, durch den Staub, der sie immer noch umgab, etwas zu erkennen. War die Gasse noch passierbar?
Nur Augenblicke später hatte der Regen die Sicht geklärt: Ein Stück Fassade, groß wie ein Scheunentor, war aus dem oberen Geschoss des Fachwerkhauses vor ihr gerissen worden und lag versprengt in der Gasse. Die Häuserzeile erschien Helene wie ein Wurm, dem man ein Stück aus dem Leib gebissen hatte. Dann drangen die Schreie eines Mannes aus der Bisswunde.
Helene wischte sich die Haare aus dem Gesicht und schob sie unter die blutgetränkte Haube. Ohne die Schreie zu beachten, lief sie über die Trümmer hinweg, der Klosterkirche entgegen.
»Macht auf, ich flehe euch an!«
Immer wieder pochte Helene an das schwere, mit einem eisernen Gitter verstärkte Eingangstor des Marienklosters. Ihre geballte Faust schmerzte, ihre Kräfte schwanden.
Sie hielt inne, lauschte – nichts, nur das Rauschen des Regens. Niemand schien sie zu hören. Stumm blickte die Mauer, die das Wehrkloster umgab, auf Helene herab.
Plötzlich begannen die schweren Glocken der Klosterkirche zu läuten, kündeten vom Anbruch des Abends. Normalerweise konnte man nun das Tagwerk ruhen und im Kreise seiner Lieben oder in der nächsten Branntweinstube den Tag ausklingen lassen. Normalerweise …
Wie schnell sich doch alles ändert, dachte Helene, und wie schnell man sich an solch eine Veränderung anzupassen vermag. Was gestern noch undenkbar, war heute schon Gewohnheit. Und doch war es ihr, als würde ihr mit jedem Glockenschlag die Kehle ein wenig enger zugeschnürt.
Verzweiflung machte sich in ihr breit. Sie wusste, dass die Zeit gnadenlos verrann.
Zeit, ihre Schwester aus dem Konvent zu holen.
Zeit, um mit ihr die Stadt zu verlassen.
Zeit, dem sicheren Untergang zu entkommen.
Aber was war mit den anderen, mit den Bürgern und ihren Weibern, den Kindern, Alten und Kranken? All jenen, die trotz des großen Feuers entschlossen waren zu bleiben und in den Klostergärten Zuflucht gefunden hatten? Wer würde ihnen die Zeit zugestehen?
Das Glockengeläut verstummte und machte einer erdrückenden Stille Platz.
Verzweifelt schrie Helene auf und hämmerte erneut mit aller Kraft gegen das Tor. Noch wollte sie nicht aufgeben. Und wenn sie alles in Grund und Boden schlagen müsste, sie würde ihre Schwester –
Mit einem heftigen Ruck wurde eine schmale Luke, die zwischen die Eisenstreben in das Tor eingelassen war, aufgeschoben. Dahinter war schemenhaft ein Soldat zu erkennen.
»Passierwort?«, hieß es mit bayerischem Dialekt von der anderen Seite.
Helene brachte kein Wort heraus, so sehr war sie außer Atem.
»Dann nicht.« Der Soldat war im Begriff die Luke zu schließen, als Helene sich endlich wieder in der Gewalt hatte.
»Bitte …«, keuchte sie.
»Was in Herrgotts Namen willst du zu so später Stunde, Weib?«, schnauzte er sie an.
»Meine Schwester«, flehte Helene. »Ich muss zu ihr!«
Stille auf der anderen Seite.
»Teresa Dirr ist ihr Name«, fuhr Helene nun mit fester Stimme fort. »Sie ist als Novizin aus freien Stücken zur barmherzigen Pflege der Verwundeten geblieben. Und ich will sie augenblicklich sehen!«
»Die Verwundeten sind in den Wirtschaftsgebäuden in den Klostergärten untergebracht, nicht hier«, blaffte der Soldat. »Und dort sind sie sicher, im Gegensatz zu dir. Denn die verfluchten Lutheraner sind zurückgekehrt, mit Reiterei und schwerem Geschütz, falls dir das entgangen ist. Du solltest fliehen, Weib, solange du noch kannst.«
»Ihr versteht nicht, Herr Hauptmann! Das Kloster wird nicht standhalten, und wenn die Truppen es stürmen, dann –«
»Ach was«, wiegelte er ab. »Wir haben die Hundesöhne vor sechs Tagen vertrieben, und wir vertreiben sie auch diesmal. Diese Mauern werden standhalten.« Der Soldat machte eine Pause. »Und ich bin kein Hauptmann!«
Dann schloss er die Luke mit der gleichen Heftigkeit, mit der er sie geöffnet hatte.
Helene stand da. Fassungslos. Ungläubig. Machtlos.
Sie blickte die schweren Außenmauern empor, die das Konvent umringten und Schutzwall und Käfig in einem bildeten, schier unüberwindlich von beiden Seiten.
Sie neigte ihr Gesicht gen Himmel, die Augen geschlossen, und ließ sich ihre Tränen vom Regen wegwaschen.
Die Todesangst um ihre Schwester ergriff immer mehr Besitz von ihr. Aber vielleicht hatte der Soldat auf der anderen Seite des Tores recht? Vielleicht würden die Mauern tatsächlich halten? Immerhin stand das Bollwerk bereits seit mehreren hundert Jahren.
Es war nur ein kleiner Strohhalm, doch Helene wusste, dass sie ihn ergreifen musste. Nicht nur um ihretwillen, sondern auch um ihres Gemahls willen.
Drei Mal atmete sie durch, sog die nasse Abendluft so tief ein, wie sie nur konnte. Dann lief sie denselben Weg zurück, auf dem sie gekommen war.
Unablässig ergoss sich der Regen auf die verwinkelten Gassen und die Häuser, die sie säumten. Die meisten waren ausgebrannt, Schutt und Holzstreben lagen verstreut, hie und da quoll noch Rauch hervor. In der Toreinfahrt der Münzpräge, einem der wenigen Häuser, die unversehrt geblieben waren, versteckten sich drei Gestalten – zwei Männer und eine Frau. Keiner von ihnen hatte zwanzig Lenze erreicht, sie trugen die farblose und geschundene Kleidung des niederen Standes und nichts außer einem Leinenbündel bei sich.
Dorothea Heidfeldt prüfte, ob ihr langes, schwarzgelocktes Haar ordentlich unter der Leinenhaube versteckt war. Johannes, ihr Mann, beobachtete sie aus dem Augenwinkel. Er wusste, dass sich Dorothea mit dieser vertrauten Geste nur beruhigen wollte. Trotz ihrer kräftigen Statur und des dicken Bauches, in dem sie sein Kind trug, wirkte sie zerbrechlich. Nun würde es nicht mehr lange dauern, bis sie –
Von jenseits der Stadt rollte das gedämpfte Grollen des Kanonendonners durch den Regen.
Dorothea presste die Augen zusammen, sodass ihr blasses Gesicht noch mehr dem einer Porzellanpuppe glich. »Sie werden uns alle zusammenschießen«, sagte sie mit zitternder Stimme und bekreuzigte sich mehrmals.
Christoph Ackermann drehte sich zu der schwangeren Frau und ihrem Gemahl um, lächelte zuversichtlich. »Ach was, denen ist die Zeit zu lang. Das ist kein gezielter Beschuss, die wollen uns nur einschüchtern.«
»Bei mir ist ihnen das gelungen«, flüsterte Dorothea und wischte sich die feuchten Handflächen, die vom jahrelangen Geflügelrupfen rau und schwielig waren, an ihrem Kittel ab.
Johannes strich ihr über den dicken Bauch. »Geht es dir gut?«
Sie nickte knapp und wenig überzeugend. Ihr Blick folgte ihrem Gemahl, der nun aufstand und gemeinsam mit Christoph in die Gasse lugte. Zwei Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten: Christoph, groß und breitschultrig, und Johannes, kleiner und trotz des kargen Tagelöhnerdaseins bereits mit dem Ansatz eines Wanstes. Der eine nie um ein Wort verlegen, der andere bedächtig, überlegt. Doch trotz ihrer Wesensunterschiede und obwohl Christoph Lutheraner und Johannes Katholik war, hatte ihre Freundschaft seit Kindestagen gehalten und sich im Laufe der Zeit auf ihre Frauen übertragen. Auch wenn Dorothea sich mit der schönen, aber manchmal etwas reservierten Helene nie so richtig verbunden gefühlt hatte.
Andererseits – was machte das schon? Wenn sich an ihrem Dasein nichts änderte, wenn sie und Johannes Tagelöhner blieben, würden sie nicht alt werden. Bei Christoph war es anders, der war als Geselle untergekommen. Aber sie?
Dorothea schüttelte ihre düsteren Gedanken ab. Im Augenblick gab es nur eines, was wichtig war, und das war in ihrem Bauch. Und so wie es zuweilen strampelte, würde es nicht mehr lange darin bleiben.
»Könnt ihr sie schon erspähen?«, fragte sie.
Johannes fuhr sich durch die kurzen braunen Haare. »Nein. Und wenn sie nicht bald kommt, dann –«
»Helene wird kommen.« Christophs Stimme klang so überzeugt, dass es ihm die anderen beinahe glaubten.
Und wie aufs Stichwort waren Schritte zu hören. Dann kam eine Frau mit gerafftem Rock hastig über die Trümmer in der Gasse gestiegen.
Helene.
Christophs Augen strahlten. »Mein Weib. Was hab ich euch gesagt?«
»Aber sie ist allein«, bemerkte Johannes zögernd. »Ändert das etwas an unserem Vorhaben?«
Helene hatte die Gruppe erreicht und drängte sich in die Toreinfahrt. Vor lauter Anstrengung atmete sie so stark, dass sie sich beinahe übergeben musste.
Wortlos nahm Christoph sie in die Arme und bettete ihren Kopf an seiner Schulter. Jetzt erst bemerkte er das zerrissene Kleid und die blutige Haube. Helene zuckte zusammen, als er den Stoff berührte und vorsichtig anhob. Ihr dunkelbraunes Haar war vom Blut schwarz gefärbt.
»Was ist passiert, um Himmels willen?« Christoph löste sich von ihr.
»Mir fehlt nichts«, keuchte sie. »Aber Teresa. Ich konnte nicht zu ihr. Wir müssen warten –«
»Warten?«, platzte es entsetzt aus Dorothea heraus. »Hörst du nicht die Kanonen? Keine zwei Tage wird ihnen das Kloster standhalten. Und wenn mein Kind erst das Licht der Welt erblickt hat, dann müssen wir ohnehin hierbleiben! Dann sind wir ihnen ausgeliefert!«
Johannes legte den Zeigefinger auf die Lippen seiner Frau und blickte sie warnend an. Dorothea wurde bewusst, dass sie zu laut geworden war, und nickte reuig. Auch wenn viele Bewohner von Deutz entweder aus der Stadt oder hinter die Klostermauern geflohen waren, gab es nicht wenige, die sich in den Häusern versteckten, auf Gott vertrauten und hofften, dass sie verschont würden.
Dass vielleicht ein Wunder geschah.
Deshalb durften Dorothea und die anderen bei dem, was sie vorhatten, keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
»Mein Weib hat recht«, fuhr Johannes fort. »Wir müssen hier weg.«
»Aber meine Schwester?« Helene klang verzweifelt.
»Teresa betreut die Verwundeten und Kranken«, sagte Christoph. »Sie wird von uns Lutheranern genauso gebraucht werden wie von euch Katholiken. Damit ist sie sicherer als jeder andere in der Stadt.«
Helene sah in die Runde. Sah den zuversichtlichen Ausdruck im Gesicht ihres Mannes, sah Johannes und Dorothea, die die Hand auf ihren Bauch gepresst hatte und der die Zeit davonlief.
Und mit einem Male wusste sie, was zu tun war.
»Wir flüchten heut Nacht, so wie geplant«, sagte Helene. »Die Mauern des Klosters werden halten, Teresa ist sicher.« Sie blickte die Gasse entlang, in Richtung des Klosters, das sie von hier aus nur erahnen konnte.
Halte stand, Teresa. Wir werden uns wiedersehen. Möge der Herr dich beschützen.
Sie bekreuzigte sich hastig. Dann ging sie durch die Toreinfahrt auf die Münzpräge zu. Die anderen folgten ihr.
Die beiden Fackeln, die sie mitgebracht hatten, warfen zuckende Schatten auf die feuchten Wände des Kellers. Es roch modrig. Schmale Rinnsale aus Regenwasser suchten sich den Weg über die groben Mauersteine und bildeten kleine Pfützen auf dem gestampften Lehmboden.
In einem verrottenden Holzregal stapelte sich schwarz verfärbtes Papier, auf dem sich Maden wanden. In den Winkeln türmte sich faulige Erde empor. Wie in einem Grab riecht es hier, dachte Helene schaudernd.
Johannes schob einige Bretter am Boden beiseite und legte so ein schmales Loch in der Erde frei.
Entgeistert starrte Dorothea in die schwarze Öffnung. »Da sollen wir hinein?«
Johannes nickte. »Von hier führt ein Tunnel unter der Kellermauer hindurch und mündet in einen alten unterirdischen Gang, der aus der Stadt führt. Den Tunnel haben wir als Kinder gegraben und gespielt, wir wären Mineure bei einer großen Belagerung.«
»Ja, bis uns der alte Münzer erwischte und nach einer ordentlichen Tracht Prügel auf die Straße gescheucht hat«, gab Christoph zum Besten. Johannes schmunzelte bei der Erinnerung.
Dorothea streckte demonstrativ ihren Bauch vor. »Und wie soll ich da durch? Wenn hinter der Kellermauer ein Gang ist, warum können wir nicht einfach die Mauer zu ihm einschlagen?«
»Damit das ganze Haus über uns zusammenstürzt, mein kluges Weiblein?«
Helene starrte auf das Loch. »Mit diesem Fluchtweg könnten wir doch die anderen Bürger, die noch in der Stadt sind, retten.«
Johannes blickte sie zweifelnd an. »Und wie viele willst du retten? Zwei? Vier? Vierhundert? Die Menschen würden in Panik versuchen, durch den Gang zu stürmen. Sie würden stecken bleiben und schließlich alle umkommen.«
»Johannes hat recht«, sagte Christoph. »Versuch eine Handvoll Kiesel in eine Flasche zu füllen. Eine Leichtigkeit. Fülle die Flasche bis zur Hälfte und drehe sie um, und die Kiesel verkeilen sich und verstopfen den Flaschenhals. Also entweder wir oder gar keiner.«
Helene seufzte. Sie wusste, dass dies die Wahrheit war, fühlte sich jedoch trotzdem innerlich zerrissen, vor allem weil sie Teresa zurücklassen musste. Und sie wusste auch, dass es ihren Gefährten nicht anders erging. Trotzdem verbargen sie ihre Gefühle, denn die konnten sie sich im Augenblick nicht leisten.
Helene kniete sich neben das Loch, steckte den Kopf hinein und zog ihn schnell wieder heraus. »Wie lange dauert es, bis man den Gang erreicht hat?«
»Nicht lang«, antwortete Johannes vage und stieg mit der Fackel in der Hand in das Loch. Er drehte sich noch einmal zu Dorothea um. »Du kannst das. Für uns und unser Kind.« Er ging in die Knie, kroch auf allen vieren los. Kurz darauf war er samt dem Schein seiner Fackel verschwunden, die anderen hörten nur noch scharrende Geräusche.
Dann war es still.
Christoph räusperte sich. »Johannes?«, rief er in die Öffnung.
»Nun kommt doch!«, hallte es von der anderen Seite.
Dorothea warf Helene einen furchtsamen Blick zu. »Du wirst es schaffen«, versuchte diese sie zu beruhigen und nahm ihren Arm. »Ich warte hier, bis du durch bist.«
»Nein!«, entgegnete Dorothea patzig und begann immer schwerer zu atmen. »Ihr geht zuerst. Ich will nicht, dass ihr auf mich warten müsst.«
Helene gab Christoph mit einem Blick zu verstehen, dass Widerspruch zwecklos sei. Der überreichte seinem Weib die Fackel, griff das Leinenbündel mit den Habseligkeiten und gab ihr einen Klaps auf den Hintern. Dann verschwand er im Loch.
Helene blickte ihm kurz nach, dann wandte sie sich an Dorothea. »So, nun mit aller gebotenen Ruhe. Ich kriech mit der Fackel voraus und lasse sie am Ende des Tunnels liegen. Dann musst du nur noch auf das Licht zusteuern, ja?«
»Du lässt mich hier im Dunkel zurück?«
»Einfach auf den Schein zu«, bekräftigte Helene.
Dorothea biss sich auf die Unterlippe, die eine weiße Farbe annahm, und nickte kaum merklich.
»Du schaffst das.« Helene gab ihr einen Kuss auf die Wange und stieg mit der Fackel in der Hand hinab.
Das Loch im Boden, erst noch vom Feuerschein erhellt, wurde langsam so dunkel wie der Keller selbst und ließ Dorothea in absoluter Finsternis zurück. Mit einem Schlag fühlte sie sich von der ganzen Welt verlassen, ihr war, als wäre mit dem Licht auch die Hoffnung auf ein neues Leben endgültig erloschen.
Helenes Worte, die hallend aus dem Loch drangen, rissen Dorothea aus ihrer Schwermut. »Bin schon durch, ist ein Kinderspiel! Wohlan!«
Dorothea wischte sich ihre schweißnassen Hände am Kleid ab und zog ihre Haube artig zurecht, als wollte sie in die Sonntagsmette gehen. Dann machte sie kleine Schritte auf das Loch zu und stieg hinein. Vorsichtig kniete sie sich auf die feuchte Erde und blickte nach vorn.
Der Schein der Fackel am Ende des Tunnels war deutlich zu erkennen, genau wie Helene es versprochen hatte. Dorothea musste nur ihre Angst überwinden – denn wenn die drei es geschafft hatten, warum sollte sie hier scheitern? Langsam senkte sie den Kopf, begann vorwärtszukrabbeln. Als ihr Bauch schon nach wenigen Augenblicken am Boden schleifte, versuchte sie instinktiv ihren Rücken aufzurichten, stieß jedoch gegen die Decke aus Lehm. Ein stechender Schmerz fuhr ihr ins Kreuz, Erde bröckelte von oben herab.
Dorothea hustete und fühlte sich, als wäre sie in einen Schraubstock gespannt. Sie würde mit Sicherheit stecken bleiben, das wusste sie mit einem Male, denn ihr geliebter Mann hatte offenbar nicht bedacht, dass sie und ihr ungeborenes Kind beinahe den Umfang zweier Männer maßen. Und über ihr stand ein gesamtes Haus.
Gnadenlos machte sich Panik in ihr breit. Ihr Herz schlug immer schneller, ihre Kehle schnürte sich zu. Sie kroch rückwärts, bis sie wieder bei der Öffnung war, richtete sich auf und rang gierig nach Luft. Ihr war, als wäre sie aus einer Höhle, die mit Wasser geflutet war, aufgetaucht.
»Wo bleibst du?« Die verärgerte Stimme ihres Mannes von jenseits des Tunnels.
»Ich kann nicht –« In diesem Moment erschütterte etwas das Gebäude über ihr. Gleich darauf schlugen neben ihr mehrere Ziegelsteine auf den Lehmboden, die sich aus dem Gewölbe gelöst haben mussten. Vermutlich war die Münze oder das Gebäude daneben von einer Kanonenkugel getroffen worden.
Schlagartig wurde Dorothea bewusst, wie brandgefährlich ihre Lage tatsächlich war. Der Tod lauerte dort oben wie hier unten, also sei’s drum. Sie zog das kleine Holzkreuz, das an einer Kette um ihren Hals hing, aus ihrem Dekolleté, küsste es innig und hielt die Luft an. Dann presste sie die Augen zusammen und kroch so schnell sie konnte durch den Gang.
Sie kam sich vor wie eine Schabe, die um ihr Leben floh, da sie jeden Moment zertreten werden konnte. Der Tunnel vor ihr erstreckte sich ins schier Unendliche. Hatte sie sich verirrt? Vielleicht –
»Gott zum Gruße, schöne Maid!«
Johannes’ Stimme riss Dorothea aus ihrer Verzweiflung, verdutzt blickte sie um sich: Sie hatte das Ende des Tunnels bereits erreicht.
Dorothea räusperte sich unbehaglich und stand auf. Dann versetzte sie ihrem Mann einen Hieb auf die Schulter. »Das nächste Mal denk dran, dass ich den Umfang eines Bierkutschers habe!«
Johannes küsste sie auf die schweißnasse Stirn. »Und was für ein hübscher Bierkutscher du doch bist.«
»Wann immer es euch beliebt …«, rief Christoph, der mit Helene bereits einige Schritte in den schmalen Gang hineingegangen war.
»Passt auf eure Köpfe auf«, sagte Johannes und deutete auf das niedrig gemauerte Tonnengewölbe.
Dann marschierten sie schnellen Schrittes hinein in die Dunkelheit.
Sie waren nun schon eine geraume Weile in dem unterirdischen Gang unterwegs, und die Luft war immer wärmer und trockener geworden.
»Wo werden wir herauskommen?«, fragte Helene und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »In der Hölle?«
»Du vielleicht«, entgegnete Christoph und grinste. »Wir gottesfürchtigen Leut werden am Südufer des Rheins wieder das Licht der Welt erblicken.« Er sah zu Johannes, der vorausgeeilt und nur mehr am Schein seiner Fackel zu erkennen war. »Der läuft wieder, als hätte er was gestohlen. Johannes! Mach langsamer! Dorothea kann nicht –«
Die Erde erzitterte. Ohne nachzudenken, stieß Christoph die beiden Frauen zu Boden und warf sich auf sie.
Einem ohrenbetäubenden Krachen folgte sirrende Stille.
Dann das dumpfe Aufeinanderprallen von Steinen.
»Was war das?« Helene wischte sich den Schmutz aus dem Gesicht, blickte sich unsicher um. Die Luft war schwer vom Staub. Außer dem dunstigen Schein von Christophs Fackel, die auf der Erde lag, konnte sie nichts erkennen.
Christoph rappelte sich auf, dann zog er die beiden Frauen nacheinander auf die Beine. Dorothea weinte vor Schreck, er nahm sie schweigend in die Arme.
Wütend klopfte sich Helene den Staub vom Kleid. Für heute hatte sie wahrlich genug durchgemacht. Ihr war, als würde ihr der Herrgott vorsätzlich nach dem Leben trachten. Sie hob die Fackel auf und schwenkte sie hin und her, als wollte sie die Luft zerteilen.
Die Finsternis vor ihnen schwand und machte einer Wand aus Steinen und Erde Platz.
Der Tunnel war über Johannes eingestürzt.
Dorothea löste sich von Christoph. Ungläubig kletterte sie auf den Steinhaufen und begann mit bloßen Händen den Schutt beiseitezuräumen.
»Johannes!« Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein! Eben noch waren sie auf dem Weg in die Freiheit, um diesen verdammten Krieg hinter sich zu lassen, und nun sollte alles umsonst gewesen sein?
Tränen liefen Dorothea über das Gesicht und schnitten breite Schneisen durch den Schmutz, der ihre Wangen bedeckte.
»Johannes! Bitte!« Ihre Fingerkuppen begannen zu bluten, aber das spürte sie nicht, sie wollte nur zu ihrem Mann.
»Dorothea, beruhige dich.«
Helene und Christoph versuchten sie wegzuziehen, aber Dorothea schüttelte die beiden ab und grub weiter.
»Johannes –« Plötzlich verharrte sie. Dann presste sie ihr Ohr an die Erde. »Hört ihr das?«
Helene und Christoph warfen sich einen ungläubigen Blick zu, doch dann vernahmen sie es auch: ein rhythmisches Klopfen, von der anderen Seite her.
Johannes!
»Kannst du mich hören?«, brüllte Dorothea so laut sie konnte.
»Nein. Und du mich?«, kam es gedämpft zurück.
»Der Hund feixt noch auf dem Weg ins Fegefeuer«, knurrte Christoph erleichtert. »Bist du verletzt?«
»Nein.«
»Wir auch nicht!« Dorothea überlegte kurz. »Und nun?«
Johannes schwieg.
»Der Einsturz ist wohl zu dick, da kommen wir niemals durch!«, rief Christoph.
Sie hörten ein kurzes Schaben, dann einige Steine herunterpoltern und Johannes fluchen. »Könntest recht haben!«
»Wir kehren um«, sagte Helene. »Wir kümmern uns um Dorothea und ihr Ungeborenes!«
»Und wenn Deutz gestürmt wird?« Johannes’ Stimme wurde schwächer.
»Sie wollen die bayerischen Soldaten im Wehrkloster, nicht unser Leben.« Christoph bemühte sich unüberhörbar, seinen eigenen Worten Glauben zu schenken. »Wir verstecken uns und sitzen es aus. Das ist unsere einzige Chance!«
Stille.
»Nein, ist es nicht«, rief Johannes, nun wieder kräftiger. »Es gibt noch eine andere!«
Die anderen wurden hellhörig. »Ach ja?«
»Ja!«, kam es als knappe Antwort, und nach einer erneuten Pause: »Ich kenne das heutige Passierwort.«
»Welches Passierwort?«
»Vom kleinen Nordtor.«
Helene, Christoph und Dorothea sahen sich verständnislos an.
»Ich werde die Belagerer ins Kloster leiten«, fuhr Johannes fort, »allerdings unter der Bedingung, dass ihr unversehrt aus Deutz hinauskönnt. Und nur unter der Zusicherung, dass das Kloster nicht gestürmt, sondern lediglich besetzt wird, mit freiem Abzug für alle Bürger.«
»Wer soll dir das garantieren?« Christoph kratzte sich zweifelnd den kurzrasierten Schädel.
»Der Oberbefehlshaber der Belagerungstruppen«, erklärte Johannes bestimmt und fügte kaum hörbar hinzu: »Wer auch immer das sein mag.«
»Das wird nicht klappen. Die werden dich aufspießen, ehe du ›Deutz‹ sagen kannst«, entgegnete Christoph.
»Was?« Dorothea war entsetzt.
»Hör nicht auf den Münzknecht, meine Kleine!«, beschwichtigte Johannes. »Wenn ihr einen brennenden Pfeil über die Klostermauer fliegen seht, dann haltet euch am kleinen Nordtor bereit!«
»Und wenn wir keinen Pfeil sehen?« Der Zweifel in Helenes Stimme war unüberhörbar.
Keine Antwort.
»Johannes?«
Nichts.
»Er ist weg. Kommt.« Christoph nahm die Fackel und stapfte los.
»Johannes wird es doch schaffen, oder?« Dorothea sah Helene hoffnungsvoll an.
»Das wird er«, entgegnete diese, und die Lüge kam ihr leicht und flüssig über die Lippen. »Das wird er ganz bestimmt.«
Der Regen hatte aufgehört. Immer wieder schnitt die Sichel des Mondes durch die vorbeiziehenden Wolken.
Darunter wand sich der breite Strom des Rheins durch die mitternächtliche Landschaft, rau und ungezähmt, und trennte das friedlich schlafende Köln und seine zahlreichen Fährschiffe am Westufer vom belagerten Deutz am Ostufer. Doch trotz der zahlreichen Soldaten und Gerätschaften, die rund um Deutz lauerten, herrschte eine täuschend friedliche Stimmung.
Johannes kniete hinter der Ruine eines einst prächtigen Anwesens, das auf einem Hügel außerhalb der Stadt lag. Den Besitzer hatte er vor wenigen Wochen kennengelernt, als er ihm Weinfässer lieferte. Hermann Adolph von Solms war ein dicker, rotbackiger Adeliger gewesen, der sogar für gemeine Knechte und Mägde ein freundliches Wort übrig hatte. Bayerische Soldaten hatten vor drei Tagen das Gut mitsamt dem Adeligen, seiner Familie und der Dienerschaft in Brand gesteckt, einzig, weil es nah am Kloster lag und eine ideale Kanonenstellung hergab.
Und warum das alles?, dachte Johannes verbittert. Nur weil der Kölner Erzbischof sich eingebildet hatte, lutherisch zu werden, und das Kölner Domkapitel sofort katholische Truppen zu Hilfe gerufen hatte. Diese besetzten nun das Kloster von Deutz und kontrollierten somit auch die Waren, die auf dem Rhein transportiert wurden. Das wiederum nahm das lutherische Bonn nicht hin und schickte Truppen zur Rückereroberung von Deutz.
Nur wegen eines verdammten Bischofs verliere ich vielleicht bald alle, die mir lieb und teuer sind.
Vorsichtig streckte er den Kopf hinter einer Mauer hervor und blickte auf Deutz hinab. Aus der Stadtmitte ragte der massige Turm der Stiftskirche wie ein steinerner Fingerzeig Gottes empor. Rund um ihn reihten sich die Mauern des ehemaligen Kastells und umschlossen die Klostergärten und die dazugehörigen Dienst- und Wirtschaftsgebäude. Davor standen die teils noch immer rauchenden Ruinen der Fachwerkhäuser.
Südlich und östlich der Mauer lag ein Meer aus dreieckigen Zelten, in denen die Belagerer schliefen. Zu Johannes Linken rauschte der Rhein, zu seiner Rechten erstreckte sich ein Wall aus zugespitzten Holzstämmen, der das Lager sicherte. Wenn er ihn umrundete, so war sich Johannes sicher, würde er früher oder später an einen Kontrollposten kommen, von dem aus man ihn zum Befehlshaber bringen würde. Er musste nur selbstsicher genug auftreten, durfte sich die Angst nicht anmerken lassen. Denn obwohl er gerade einmal siebzehn Lenze zählte, fühlte er sich nicht als Bittsteller.
Er hatte etwas feilzubieten.
Johannes richtete sich auf und atmete mehrmals tief durch.
»He du da!«, erschallte es auf einmal hinter ihm. Johannes fuhr herum. Zwei Männer kamen schnellen Schrittes auf ihn zu, sahen mehr wie Halunken denn Soldaten aus.
Reflexartig hob Johannes die Hände, als ihn ein brutaler Faustschlag zu Boden streckte.
»Was suchst du vor dem Lager, du Hund?«, knurrte der kleine Gedrungene, der ihm den Schlag verpasst hatte. Sein Dialekt verriet, dass er aus einem der nördlichen Fürstentümer des Reiches kam.
Der andere, ein hagerer Kerl, gut zwei Kopf größer als Johannes, kniete sich auf dessen Arm und zückte einen Dolch. »Was du suchst, du Hund?«, wiederholte er, ebenfalls mit starkem Dialekt, und drückte Johannes den Dolch so fest gegen die Kehle, dass er die Haut bereits aufritzte.
Johannes dröhnte der Kopf, sein Kiefer schmerzte. Sein Arm, auf dem der Hagere kniete, wurde taub. »Ich will … bringt mich zu eurem Kommandanten«, sagte er mit unsicherer Stimme.
»Was willst du von ihm, Jüngelchen?«, fragte der Dicke.
»Ja, was willst von ihm?«, wiederholte der Dürre und verlagerte sein gesamtes Körpergewicht auf Johannes’ Arm.
»Ich habe … wichtige Kunde für ihn«, krächzte Johannes mit schmerzverzerrtem Gesicht und schluckte das Blut, das sich in seiner Mundhöhle angesammelt hatte. »Und wenn ihr mich nicht zu ihm bringt … wird euch das noch … leidtun.«
»Wird’s das, Jaspar?« Der Gedrungene schien zu überlegen, was er mit dem Gefangenen tun sollte.
»Ich glaube nicht, Daniel«, raunte der Hagere und blickte grienend zu seinem Kameraden. »Ich schlitz das Jüngelchen jetzt auf, ja?«
Daniel wurde ernst. »Nein! Wir bringen ihn zu Doctor Peutherich. Wenn der mit ihm fertig ist, kannst du mit ihm immer noch tun, wonach dir ist.«
Schlagartig erlosch Jaspars Lächeln. »Ich will’s aber gleich tun.« Er holte mit dem Dolch aus.
So endet es also, dachte Johannes und sah blitzartig das Bild von Dorothea vor sich. Er schloss die Augen und erwartete den Stich.
Verzeih mir Dorothea, o verzeih mir, dass ich –
Ein dumpfer Stoß, dann war das Gewicht des Mannes auf ihm plötzlich verschwunden. Erstaunt öffnete Johannes die Augen.
Neben ihm lag der Dürre am Boden. Sein Kumpan beugte sich gerade über ihn. »Wenn ich ›nein‹ sag, heißt das auch ›nein‹, verstanden? Bin ja kein Weib.«
Jaspar brummte missmutig.
Johannes sah den Gedrungenen mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Furcht an. Der erwiderte den Blick, einen seltsamen Ausdruck in den Augen. »Freu dich nicht zu früh, Jüngelchen. Wenn das eine List von dir ist, wird dir mein Freund ein Grinsen ins Gesicht schneiden, das von einem Ohr zum anderen reicht. Und dann wird’s richtig schmerzhaft, verstanden?«
»Verstanden.« Johannes rappelte sich auf.
Daniel gab ihm einen Stoß. »Und jetzt vorwärts!«
Die Nacht lag wie ein Leichentuch über Deutz. Kein Feuer, das wärmte, keine Fackel, die leuchtete, keine Kerze, die Hoffnung spendete. Niemand wollte den Kanonen vor der Stadt ein Ziel bieten.
Christoph, Dorothea und Helene saßen auf leeren Holzkisten vor einer abgebrannten Bäckerei. Die schmale gepflasterte Gasse vor ihnen führte leicht bergab und stieß an die Klostermauer, die über zwei Mann hoch war und somit die Sicht auf alles Dahinterliegende verwehrte, nicht nur bei Nacht.
»Wie will Johannes da hineinkommen?« Dorothea machte sich nicht nur größte Sorgen um ihren Gemahl, sie zweifelte auch an seinem Vorhaben.
»Angenommen das Passierwort stimmt, dann könnte er mit ein paar Mann in die Stadt gelangen. Diese könnten die Wachmannschaft gefangen nehmen und danach die äußeren Pforten öffnen.«
»Und somit Tür und Tor für alle Plünderer, Halsabschneider und Vergewaltiger«, fügte Helene hinzu.
»Die wollen nur das Kloster einnehmen, um den Fluss wieder kontrollieren zu können. Was interessieren die ein paar verängstigte Bürger und Nonnen? Wenn sie sich vergnügen wollen, gehen sie hinüber nach Köln.«
»Wenn’s denn nur wahr wär. Möge der Herr Sein Kloster schützen.« Helene bekreuzigte sich.
»Weiß deine Schwester, wo wir hinwollen?«, fragte Dorothea.
Helene schüttelte den Kopf, der ihr ob der Verletzung immer noch dröhnte. »Aber ich weiß, wo ich sie finde. Und sobald dieser Irrsinn vorbei ist, werde ich sie in ihrem Konvent in Köln besuchen.«
Dorothea ergriff Helenes Hand und drückte sie. »Wir gehen alle zusammen. Vielleicht schon zu fünft.« Sie strich sich über den Bauch.
»Sehr ergreifend. Aber vielleicht sollten wir weniger wie die Waschweiber schwatzen und mehr darauf achten, ob wir einen brennenden Pfeil sehen«, raunte Christoph und blickte demonstrativ in den Nachthimmel.
Die beiden Frauen warfen sich einen beredten Blick zu, taten es ihm dann aber gleich.
Auf einmal durchfuhr ein stechender Schmerz Dorotheas Unterleib. Sie verzog das Gesicht und drückte sich den Bauch.
Helene sprang auf und kniete sich neben ihre Freundin. »Was ist? Beginnt es?«
Dorothea schüttelte den Kopf, die Augen zusammengekniffen. Ihr Atem ging stoßweise.
»Bleib noch ein bisschen da drin«, flüsterte Helene, die Lippen an Dorotheas Bauch gepresst. »Noch ein paar Tage, dann kannst du in Sicherheit das Licht der Welt erblicken.«
»In Sicherheit?«, presste Dorothea hervor. »Wir sind arm wie Kirchenmäuse und haben niemand, der uns Arbeit gibt, niemand, der über uns wacht …«
»Ganz ruhig, das wird schon.« Helene wischte der Schwangeren über die schweißnasse Stirn. »Der Herr wird für uns sorgen.«
»Ja, vielleicht wird er das«, murmelte Christoph wie zu sich selbst. Er überlegte, dann gab er sich einen Ruck. »Vielleicht aber auch nicht. Achtet auf den Pfeil.« Unvermittelt sprang er auf, küsste Helene auf die Schläfe und rannte so schnell er konnte in jene Richtung zurück, aus der sie gekommen waren.
Verdutzt blickten ihm die beiden Frauen nach. »Wenn man sich auf die Mannsbilder verlässt, ist man verlassen«, meinte Helene trocken und blickte ihre Freundin an.
Dorothea zog eine Schnute. »Amen.«
Im Lager herrschte angespannte Stille. Manche Soldaten schliefen nahe einem der zahlreichen Lagerfeuer, andere putzten Stiefel und Gerät. Kaum einer würdigte Johannes oder seine beiden Begleiter eines Blickes. Die einzigen Wortfetzen, die zu hören waren, klangen Französisch.
Der ausgetretene Pfad, dem die drei folgten, war dick mit Stroh bedeckt. Es sog das Regenwasser auf und verhinderte so, dass man bis zu den Knöcheln im Schlamm stapfen musste. Dafür stank es erbärmlich nach Gülle. Am Ende des Pfades lag eine Ansammlung mannshoher Zelte, die heller beleuchtet waren als der Rest und auch größer.
Johannes versuchte sich einen Eindruck über das Lager zu verschaffen, das sich vor Deutz seit gestern immer weiter ausbreitete, gleich Ameisen rund um einen toten Käfer. Trotz des offensichtlichen Chaos aus Mensch und Material schien doch eine tiefer liegende Ordnung zu herrschen: Fässer waren aneinander vertäut, Sturmleitern lagen griffbereit gestapelt, ein- und zweiachsige Wagen und Karren standen in Reih und Glied vor einer Koppel, auf der Pferde grasten oder schliefen.
Je näher die drei dem großen Zeltlager kamen, desto misstrauischer wurden die Blicke der Soldaten am Wegesrand und umso mulmiger wurde Johannes zumute.
Nachdem der Fluchttunnel eingestürzt war, hatte er einfach nur gehandelt. Und dieses Passierwort, das er heute Mittag beim Kartenspielen mit ein paar anderen Tagelöhnern zufällig aufgeschnappt hatte, war sein einziger Trumpf. Denn in Deutz auszuharren und darauf zu hoffen, dass er und seine Lieben nach der Erstürmung der Stadt unbeschadet, und vor allen Dingen Dorothea und Helene ungeschändet, davonkommen würden, kam Irrsinn gleich.
Johannes atmete tief durch. Ausharren oder verhandeln, seine Entscheidung stand fest. Allerdings fühlte es sich im Augenblick so an, als hätte er sich seinen Henker einfach nur selbst ausgesucht.
Die drei passierten mehrere Wachposten, dann blieben sie auf einem kleinen Platz stehen, um den sich mehrere erhellte Zelte drängten. Vermutlich die Behausung der Offiziere und Kommandanten, kam Johannes in den Sinn.
Der Gedrungene schlug Johannes auf die Brust, damit dieser stehen blieb. Dann ging er in eins der Zelte.
»Versuch zu fliehen«, raunte Jaspar hinter ihm. »Bitte.«
Johannes drehte sich um, sah, wie der Mann mit dem Daumen über die Klinge seines Dolches strich und grinste. »Tu mir den einen Gefallen.«
»Und dann?« Johannes hielt dem Blick seines Bewachers stand. »Lässt du dich wieder von deinem Kumpan verprügeln?«
Jaspars Grinsen erlosch. »Hier und jetzt. Ist mir alles einerlei, ich werd dich hier und jetzt wie einen stinkenden Fisch –«
»Stillgestanden!«
Der Dolch verschwand, Jaspar nahm Haltung an.
Daniel näherte sich, gefolgt von einem schlanken, gepflegt wirkenden Mann mittleren Alters, der leicht humpelte. Dieser trug sein langes braunes Haar streng nach hinten gebunden, über das bestickte Wams hatte er einen eng anliegenden Überrock gezogen, der durch seine weiten Ärmel und seinen auffälligen Kragen imposant und höfisch wirkte. Er blieb schließlich knappe drei Fuß vor Johannes stehen und betrachtete diesen, während er sich über seinen gestutzten Vollbart strich.
»Mein Name ist Doctor Peutherich. Mir unterstehen die Truppen aus der Gascogne sowie die Verstärkung aus Westfalen«, sagte der Mann mit ruhiger Stimme und verschränkte dann die Arme gelassen hinter dem Rücken. Er gehörte augenscheinlich zu jenen, die ihre Stimme nicht erheben mussten, um Befehle durchzusetzen. Mit jeder Nuance strahlte er Autorität aus. »Mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Johannes Heidfeldt, Herr«, antwortete der Gefragte, ohne den Blick zu heben.
»Du kannst mir ruhig in die Augen sehen. Das hat noch niemanden umgebracht«, sprach Peutherich.
»Ja, Herr.« Zögerlich hob Johannes den Kopf. Zu oft hatte er in seinem bisherigen Leben erfahren müssen, dass es Prügel immer dann setzte, wenn jemand diese zuvor ausdrücklich ausgeschlossen hatte.
Aber es passierte nichts, außer dass es Johannes vorkam, als würden ihn die bernsteinfarbenen Augen dieses sogenannten Doctors durchbohren und tief in seinem Inneren nach Wahrheit suchen.
»Wie ein Bauernbursch siehst du nicht aus«, fuhr Peutherich fort. »Wohl eher wie ein Geselle.«
Johannes nickte. »Bäckersgeselle war ich. Bis … bis mein Meister bei einer Mehlexplosion den Tod fand. Seitdem helfe ich, wo ich kann.«
»Ein Tagelöhner also. Das heißt, du hast nichts zu verlieren. Außer deinem Leben, selbstverständlich.« Peutherich überlegte einen Moment, dann drehte er sich um und ging auf sein Zelt zu. »In Ketten zu mir!«
Daniel und Jaspar schnappten Johannes’ Arme schneller, als dieser reagieren konnte, zwangen sie auf seinen Rücken und legten ihm Eisen an. Johannes wehrte sich nicht, er wusste, dass es zwecklos war.
»Jetzt geht’s los, Jüngelchen!«
Das Zelt war schlichter, als Johannes von draußen angenommen hatte. Nur ein einfaches Bett mit einer strohgefüllten Matratze, auf der penibel zusammengefaltet eine Decke aus Filz lag, drei einfache Sessel und ein Kartentisch fanden darin Platz. Das einzig Überraschende war eine Staffelei am Fußende des Bettes, mit dem Gemälde einer hübschen Frau darauf. Die Frau lächelte wehmütig, die Hände auf das Korsett ihres leicht gerundeten Bauchs gelegt.
»Auf die Knie, Herr Heidfeldt, wenn ich bitten darf«, sagte Peutherich in einem Tonfall, der keine Bitte war. Johannes tat, wie ihm geheißen. Er ahnte, dass dieser Mann weder selbstherrlich noch überheblich war, sondern ihn als das betrachtete, was jeder Gefangene für ihn darstellte: eine potenzielle Gefahr.
»Die Frage, die ich mir stellen sollte, lautet: Was in Gottes Namen kann wohl ein Tagelöhner kundtun, das von Interesse für mich ist?« Wieder sah der Kommandant seinen Gefangenen mit einem alles durchdringenden Blick an.
Johannes wollte gerade antworten, als ihn der erhobene Zeigefinder Peutherichs verstummen ließ. »Jedoch die wahre Frage lautet: Was will der Tagelöhner dafür im Gegenzug?«
Johannes durchlief es siedend heiß. Er war gerade vom Händler zum Bittsteller degradiert worden. Aber hatte er eine Wahl? Er dachte an Dorothea, an sein ungeborenes Kind, an eine mögliche gemeinsame Zukunft – und fasste sich ein Herz. »Ich möchte freien Abzug aus der Stadt für mich und drei weitere, Herr.«
Peutherich schmunzelte. »Nichts als die nackte Haut retten. Das ist wohl die Ironie des Lebens – ungeachtet dessen, woher wir kommen, welchen Rang oder Stand wir bekleiden, ob Bettler oder König – zu guter Letzt wollen wir doch alle nur das Eine.« Er machte eine kurze Pause. »Und was sollen mir diese vier Leben wert sein?«
Johannes zögerte.
Der Kommandant hob die Augenbrauen. Nun schien er ungeduldig zu werden.
Johannes gab sich einen Ruck. »Ich … weiß das Passierwort des Nordtores.«
Peutherich stutzte.
Johannes fühlte den Anflug eines Triumphs in sich aufkeimen, doch er unterdrückte jede Regung, seine Miene blieb ungerührt. Er wusste, dass er ein gefährliches Spiel spielte.
Peutherich humpelte einige Schritte auf und ab, wobei er sich immer wieder über seinen Bart strich. Die Möglichkeit, die sich durch den Tagelöhner auftat, war verlockend, denn Peutherich musste seinen Kommandanten und vor allem seinen Männern gegenüber einen Erfolg vorweisen. Das letzte Gefecht war in einer schweren Niederlage gemündet, die Bürger von Unkel hatten ihre Stadt wider Erwarten nicht nur wehrhaft verteidigt, sondern seine Truppen auch noch auf dem Rückzug verfolgt. Viele der Schwerverwundeten hatten sie zurücklassen müssen, um das sichere Bonn erreichen zu können. Die Schussverletzung im Bein erinnerte ihn schmerzhaft an sein Versagen.
Trotzdem wusste Peutherich, was er zu tun hatte. Mit dem Rücken zu Johannes blieb er schließlich vor dem Gemälde stehen und betrachtete die Frau darauf.
Es war nun still im Zelt. Unwillkürlich hielt Johannes den Atem an.
Der Kommandant drehte sich zu ihm und fixierte ihn. »Ein Verräter. Das bist du also, ein einfacher Verräter. Ich nehme an, du hast nicht viel in deinem Leben gelernt. Aber sogar du müsstest wissen, dass man Verrätern niemals trauen darf. Schon gar nicht, wenn sie versuchen, eine ganze Stadt feil zu bieten, nur um ein paar anderen Halunken den Galgen zu ersparen.« Er wandte sich zum Eingang des Zeltes. »Wache!«
Johannes wurde bleich.
Daniel kam herein, ein schmieriges Grinsen im Gesicht. Er packte den Gefangenen am Kragen und zerrte ihn hoch.
»Ich stehe nicht für Halunken ein!«, schrie Johannes und sah sich hektisch im Zelt um. Der Kommandant blickte immer noch auf das Gemälde. Auf die Frau darauf.
»Es geht um mein Weib!«, rief Johannes. »Um mein Weib und unser ungeborenes Kind!«
Peutherich erstarrte. Dann berührte er sanft das Bild der Frau – seiner geliebten Ebba, und in ihr die kleine Marie. Wie lange war es schon her? Und doch tat es so weh wie an jenem gottverdammten Tag, als –
Der Kommandant schritt auf seinen Gefangenen zu. »Dein Weib?«
Johannes nickte hektisch, riss sich aus dem Griff des Gedrungenen und kniete sich vor Peutherich. »Sie heißt Dorothea! Ich bitte für sie!«
»Und die anderen zwei?«
»Unsere Freunde, Christoph und Helene. Wir sind gottesfürchtig und redlich, sind gemeinsam aufgewachsen, haben Unsägliches zusammen gemeistert. So denn, ich bitte Euch, nehmt mich, und verschont nur die drei.«
Der Kommandant ging langsam zu einem der Sessel und setzte sich. Dann nickte er Daniel zu, der das Zelt wieder verließ.
»Nun gibst du also dein Leben für das deines Weibes und deiner Freunde?«
Johannes nickte, Tränen rannen ihm über das Gesicht.
»Und doch opferst du den Rest der Stadt für diese drei Seelen.«
»Nein, Herr. Ihr müsst mir Euer Wort geben, dass das Kloster nicht gestürmt wird und dass die Bürger freien Abzug erhalten.«
»Ich muss?« Die Miene des Kommandanten verfinsterte sich. »Ich könnte das angebliche Passierwort auch einfach aus dir herausfoltern lassen.«
»Es geht um mein Weib und mein ungeborenes Kind«, sagte Johannes, und aus seiner Stimme klang eine Überzeugung, die keine Zweifel aufkommen ließ. »Eher durchleide ich das ewige Fegefeuer, als sie zu verraten.«
Peutherich wog Für und Wider ab, er wusste jedoch, dass er nur gewinnen konnte. Und er wollte seine Männer schonen.
»Wohlan, ich gebe dir hiermit mein Ehrenwort als Doctor, dass –«
»Und als Christ«, unterbrach ihn Johannes.
Der Kommandant zögerte einen Moment »– als Doctor und als Christ, dass ich meinen Männern nur den Befehl zur Besetzung geben werde. Und dass ich den Bürgern freien Abzug gewähre.«
Nun war es Johannes, der den Kommandanten prüfend ansah.
Und er glaubte ihm. Er wollte ihm einfach glauben. Und mit diesem Glauben war Johannes, als wäre ihm ein Stein von der Größe jener Stadt vom Herzen gefallen, die er gerade verraten hatte.
Ich habe es geschafft, Dorothea, wir werden –
Die Stimme Peutherichs, ruhig und amüsiert, riss ihn aus seinem innerlichen Jubel. »Also, Johannes Heidfeldt, wie hast du dir deine List vorgestellt?«
Johannes stapfte über die durch den Regen aufgeweichte Straße. Zielstrebig näherte er sich dem Nordtor, das wie ein pechschwarzes Loch in der Mauer des alten Kastells klaffte. Bis heute hatte er den Anblick des Klosters geliebt, denn es versprach Sicherheit, Zugehörigkeit und Geborgenheit. Nun wirkte es jedoch wie ein versteinertes Ungetüm, das seiner Erweckung harrte.
Hinter Johannes folgten zehn Männer in zerschlissenen Kutten, die die Waffen verbargen, die sie darunter trugen. Daniel und Jaspar waren auch unter ihnen, und am Ausdruck ihrer Gesichter konnte Johannes unschwer ablesen, dass sie es verfluchten, ihn nicht einfach abgestochen zu haben, als sich ihnen die Möglichkeit dazu geboten hatte. Denn jetzt mussten sie dem Jüngelchen auf einem Himmelfahrtskommando folgen, wie einer der anderen Mitstreiter es vortrefflich genannt hatte.
Johannes aber blendete die Männer aus, blendete aus, was mit ihm passieren würde, schlüge sein Plan fehl. Und noch viel schlimmer – was dann mit Dorothea geschehen würde. Er konzentrierte sich nur auf eins: das heutige Passierwort wiederzugeben.
Wasserschanz.
Kräftig, selbstsicher und furchtlos musste er klingen. Also genau gegengleich dazu, wie er sich fühlte.
Kräftig?
Johannes’ Glieder schmerzten. Seine Schulter, weil ihm die beiden Kerle die Arme auf den Rücken verrenkt hatten. Seine Handgelenke von den Eisen, die man ihm angelegt hatte. Und sein Kopf von dem Willkommens-Faustschlag des Gedrungenen.
Sie waren noch gut einhundert Schritte vom Tor entfernt.
Wasserschanz.
Selbstsicher? So zeigte er sich in Gegenwart von Freunden und Weibern. Zwar nicht in dem Maß wie Christoph, der immer einen Spruch parat und einen Scherz auf den Lippen hatte, und, wie er es zu nennen pflegte, »lieber einen guten Freund verlieren als einen schlechten Witz auslassen« würde. Dennoch – Johannes Heidfeldt wirkte in vielem wie ein Fels in der Brandung. Nur seine Frau kannte die andere Seite an ihm, die unsichere, die verletzliche, die schutzsuchende. Und genau so war ihm gerade zumute.
Noch gut sechzig Schritte bis zum Tor.
Wasserschanz.
Furchtlos? Dieses Gefühl war abrupt geschwunden, als sich vor wenigen Stunden der Hagere mit gezücktem Dolch auf ihn gekniet hatte und im Begriff war, ihn aufzuschlitzen. Und seitdem wollte die Furcht nicht mehr verfliegen. Seine Hände zitterten, seine Beine fühlten sich an, als wollten sie das Fliegengewicht, das auf ihnen lastete, nicht mehr tragen. Und sein Mund war so trocken, als hätte man ihn tagelang in einen Menschenkäfig gesperrt und der Sonne ausgesetzt. Wie sollte er auch nur ein Wort herausbringen?
Nur noch zwanzig Schritte. Johannes blickte sich um. Keiner der Männer hinter ihm zeigte eine Regung. Sie gehorchten einfach ihrem Befehl.
Noch zehn Schritte.
Wasserschanz.
Noch fünf.
In die Mauer war eine mannshohe Tür eingelassen, in der nun eine Luke geöffnet wurde. Ein Mann mit einem Helm blickte Johannes entgegen. »Was wollt’s denn, ihr Bauerngsindel, zu solch unchristlicher Stund?«, blaffte er mit bayerischem Dialekt heraus.
Johannes räusperte sich.
Er setzte an, brachte aber keinen Ton heraus. Seine Zunge war eine trockene, pelzige Masse, die ihm am Gaumen klebte.
»Nun denn?«
Johannes bückte sich blitzschnell, tauchte seine Hand in eine Pfütze und leckte das schmutzige Wasser auf. Die Trockenheit war verflogen.
»Wasserschanz«, sagte er entschlossen.
»Was?«, tönte es von jenseits des Tores.
»Wasserschanz!«, wiederholte Johannes mit Nachdruck.
Einen Augenblick später wurde die Luke wieder geschlossen. Nichts geschah.
Johannes spürte, wie die Männer hinter ihm unruhig wurden. Er sah die Turmmauer hinauf nach oben, betrachtete die Unterseite der Hurde, den hölzernen Wehrgang, der aus der Mauer kragte, und stellte sich vor, wie eines der Falllöcher geöffnet und Pisse, Steine oder Schlimmeres auf sie herabregnen würde.
Erneut ging die Luke auf. »Wer seid Ihr überhaupt?«
Geschafft!
Vor Erleichterung sackte Johannes beinahe zusammen. Aber er riss sich am Riemen und versuchte seiner Stimme einen festen Klang zu geben. »Gern erzähl ich Euch meine Geschichte, von Geburt an, wenn Ihr wollt, aber gewährt uns Einlass, um Himmels willen, bevor noch irgendeiner dieser Teufel vor der Stadt Schießübungen auf uns veranstaltet!«
Die Wache zögerte.
»Oder soll ich Kommandant Ranucino berichten, wie Ihr Deutzer Bürgern den Zutritt verwehrt, anstatt sie zu beschützen?«, setzte Johannes nach.
Metallisches Klacken und hölzernes Knirschen war die Antwort. Dann öffnete sich ächzend das Tor.
Johannes schritt voran, die zehn Männer folgten ihm.
Das Tor schlug hinter ihnen zu.
Das Kloster lag still.
Augenblicke später sirrte ein brennender Pfeil durch die Luft.
Vier Gestalten hasteten durch den nächtlichen Wald. Erst als sie eine kleine Anhöhe erklommen hatten, machten sie Rast. Vor ihnen glitzerte im Mondlicht der Rhein.
Dorothea sank auf die Knie, völlig außer Atem. Die junge Frau hielt sich ihren Bauch und atmete so schwer, als würde sie jeden Augenblick niederkommen.
Helene setzte sich zu ihrer Freundin ins feuchte Moos. Johannes und Christoph blickten zurück auf die Stadt, die sie hinter sich gelassen hatten.
Die sie verraten hatten.
Neben Köln erschien Deutz wie ein Brotende, das abgetrennt neben dem großen Laib lag. Allerdings brannte nirgends ein Feuer, und auf dem Weg hierher hatten die vier weder Kampfeslärm noch Geschrei gehört.
Johannes atmete auf. Dieser seltsame Doctor schien sein Wort gehalten zu haben.
Christoph klopfte Johannes auf die Schulter. »Es hat funktioniert! Ich kann es noch immer nicht glauben.«
Johannes nickte, ohne den Blick von der Stadt zu wenden. Hatte er nicht gerade etwas aufflammen sehen? Er wartete, aber nichts geschah. Er musste sich getäuscht haben.
»Wirst du es schaffen?«, fragte Johannes Dorothea, die noch immer nach Atem rang.
»Ja«, antwortete Helene an ihrer statt. »Aber rasten wir noch ein Weilchen. Es ist uns ja doch keiner auf den Fersen.«
»Wo soll’s nun hingehen?« Christoph sah Johannes herausfordernd an.
Der zuckte mit den Schultern. »Was weiß ich, Richtung Süden erstmal. Da sollten wir vor Soldaten sicher sein. Irgendeine kleine Stadt, wo sie genug Arbeit haben. Du könntest dich wieder als Münzknecht anwerben lassen, ich könnte mich am Markt oder am Hafen verdingen. Von Luft und Liebe allein lebt sich’s schlecht.«
»So ist es«, bekräftigte Christoph. »Deshalb habe ich, während du mit den Soldaten geplänkelt hast, unsere Zukunft geschmiedet.«
Fragend zog Johannes die Augenbrauen hoch. Auch die Frauen wurden hellhörig. Christoph nahm das Leinenbündel von der Schulter und legte es theatralisch auf die Wiese.
»Du hast unsere Zukunft geschmiedet, indem du unsere wenigen Habseligkeiten mitgeschleppt hast?«, fragte Helene und seufzte gespielt. »Weiß der Herr, warum ich dich zum Manne genommen hab.«
»Schweig, o Weib, und staune.« Langsam öffnete Christoph das Bündel und betrachtete, was darin eingewickelt war, als wäre es das Schönste auf der Welt. Seine drei Begleiter kamen näher und beugten sich über ihn.
Aber sie verstanden nicht.
»Was … ist das?«, fragte Dorothea.
»Das, meine Lieben«, sagte Christoph voll Stolz, »das ist unsere Zukunft.«
Schwäbischwerd, Januar A.D. 1606
Langsam versank die Sonne am Horizont. Ein Turmfalkeflog über die Stadt, hob sich wie ein Scherenschnitt vom blutroten Himmel ab.
Wind kam auf und schleuderte vereinzelte Schneeflocken wie eisige Geschosse gegen den Falken. Der Raubvogel kreiste noch einige Augenblicke, dann stieß er einen schrillen Schrei aus und schoss auf die große Kirche zu, die stolz zwischen den Bürgerhäusern emporragte. Sicher landete er in einer schützenden Nische des Turmes und legte die Flügel an.
Der Turm gehörte zur Stadtpfarrkirche Zu Unserer Lieben Frau. Die ehemals größte katholische Kirche in der Stadt, die seit über fünfzig Jahren in der Hand der Lutheraner war, stand ungerührt in der Dämmerung, und ihr langer Schatten fiel auf die Straße, genau zwischen die beiden prächtigen Häuser, die sich gegenüberstanden.
Zwischen das Haus Heidfeldt und das Haus Ackermann.
Die Holzscheite im Ofen knackten. Wegen der Dämmerung war es dunkel in der Stube, denn die kleinen Butzenscheiben ließen schon bei Tag nur wenig Licht in den Raum herein.
Der Gestalt, die einsam an einem der Stubenfenster stand, war das nur recht. So konnte sie ungestört ihren Gedanken nachgehen. Die Knaben waren in der Küche und ärgerten mit Sicherheit das Gesinde, bis Bartholomäus, der alte Küchenknecht, sie mit der Schöpfkelle verjagen würde. Dann würden sie ihre Mutter suchen, sie mit der untrüglichen Sicherheit eines Jagdhundes finden und sich bei ihr verstecken.
Helene Ackermann lächelte und strich sich eine Strähne ihres Haares aus dem Gesicht.
Ihre Söhne. Ihr Leben.
Ein Holzscheit barst im Kamin.
Das Lächeln verschwand. Flammen stiegen in ihren Gedanken auf, verdrängten die Bilder ihrer Söhne, und in den Flammen war ihr Gesicht, das sie ab und an in ihren Träumen sah, seit jener schrecklichen Nacht, als sie –
Als wir sie verraten haben. Sie und die gesamte Stadt, nur um unsere Haut zu retten. Nichts anderes war es.
Man konnte es drehen und wenden, wie man wollte, es blieb Verrat an Leib und Leben, an ihrem Fleisch und Blut. Sie hatte versucht es zu vergessen, und als das nicht gelang, hatte sie das Gespräch mit Christoph gesucht. Aber der sah alles anders. Was geschehen war, war geschehen, hatte er nach ihrer Flucht immer wieder, beinahe schon gebetsmühlenartig, wiederholt. Was der Herrgott nicht ändern kann, können wir schon gar nicht ändern. Somit können wir ein Leben lang unserer Schuld nachtrauern, oder wir können das Leben, das uns geschenkt wurde, mit jedem Atemzug genießen.
Irgendwann hatte Helene ihm geglaubt, aber die Träume waren geblieben.
Deutz wurde zwischen den Heidfeldts und den Ackermanns nicht mehr erwähnt, und die Männer machten das, was sie am besten konnten: ein Unternehmen aufbauen. So wie alle Männer seit Anbeginn der Zeit – ob Soldat oder Kaufmann, ob Bauer oder König – taten sie, was getan werden musste. Und wenn etwas schiefging, wuschen sie sich die Blutschuld von den Händen und machten einfach weiter.
Es war an ihren Frauen, die Toten zu beweinen.
»Was machst du denn hier im Dunkeln?«
Helene fuhr herum. Ihr Herz pochte, sie fühlte sich ertappt. Es war aber nur ihr ältester Sohn, der grinsend an der Tür stand, ein Talglicht in der Hand.
»Lorenz! Musst du deine Mutter so erschrecken?«
Der junge Mann trat ein und stellte das Licht auf den fein gearbeiteten Holztisch, der in der Mitte des Raumes stand. »Heute ist ein Tag der Freude. Und die Mutter des Bräutigams steht in der dunklen Stube wie ein Geist.«
»Noch bist du kein Bräutigam. Also hüte deine Zunge.« Sie drohte ihm mit dem Finger, wie sie es immer getan hatte und es auch jetzt noch gelegentlich tat. Wenn auch nur spielerisch, denn er zählte achtzehn Lenze und war ein Mann.
Und ebenso spielerisch gehorchte Lorenz ihr. »Du hast recht. So nehmt meine Entschuldigung an, werteste Frau Mutter, in tiefer Demut.« Er beugte sein Haupt und verneigte sich mit Schwung.
Sie lachte und blickte ihn liebevoll an. Große, blaue Augen, aus denen der Schalk blitzte, ungebändigtes, dichtes Haar. Ein einnehmendes Wesen, seinem Vater gleich, und doch so anders. Wo Christoph sich bis heute Wagemut und Leichtsinn bewahrt hatte, fiel bei Lorenz zwischen all dem Lachen und den Scherzen zunehmend ein ernster, kluger Wesenszug auf. Eine Klugheit, die ihn schneller als alle anderen durch das Gymnasium geführt hatte. Und die ohne Zweifel schon bald ihrem Unternehmen dienlich sein würde.
Lorenz richtete sich auf. Seine Mutter machte einen Schritt auf ihn zu, strich ihm sanft über die Wange. »Wie bist du nur so schnell herangewachsen? Mein großer Sohn …« Sie zog ihre Hand zurück, sah ihm in die Augen. »Bist du dir sicher?«
Er wurde ernst. »Und wenn nicht? Würde das einen Unterschied machen?«
»Ich hoffe nicht. Wir haben alles bereits ausgehandelt, und Vertrag ist Vertrag, auch wenn die Heidfeldts unsere Freunde sind.«
Lorenz lächelte verschmitzt. »Mutter, ich liebe Anna. Das habe ich immer schon. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit ihr mein Leben zu verbringen. Heute wollen wir es verkünden, die Hochzeit folgt in Bälde, und mit Gottes Segen wird es gut sein. Für immer.«
Für immer …
Es war tröstlich, dass die Jugend eher handelte als wusste, dachte Helene. Sie selbst hatte schon sehr früh erkannt, was das Leben für einen bereithielt, dafür hatte ihre Kindheit im Hause einer Tagelöhnerfamilie gesorgt. Aber sie würde wie eine Löwin dafür kämpfen, dass ihren Kindern Derartiges erspart blieb.
Sie hatte es gut hier in Schwäbischwerd, sie alle hatten es gut hier, auch wenn der heutige Abend kein leichter werden würde. Doch das ließ sie ihrem Ältesten gegenüber unerwähnt. Lorenz wusste wahrscheinlich selbst ganz genau, was auf sie zukommen würde, wenn sich der Rat querstellte.
Er bot ihr seinen Arm. »Darf ich die Herrin des Hauses nach unten geleiten? Die Kutsche wartet.«
»Die Kutsche? Es sind doch nur ein paar Schritte zum Roten Hund.«
Er deutete zum Fenster. »Mutter, hast du eigentlich nur vor dich hingeträumt oder tatsächlich hinausgesehen?«
Sie wandte sich um, blickte durch das Butzenfenster. Dicke Schneeflocken stoben vom Himmel. Die Straße war bereits mit einem dichten weißen Saum überzogen.
Lorenz hatte recht getan. Bis sie spätnachts vom Roten Hund wieder heimkehrten, würde der Schnee knöchelhoch liegen. Und er würde locker sein, sodass man auf dem darunterliegenden Eis und dem Unrat ausrutschen konnte.
Helene schmunzelte und hakte sich im Arm ihres Sohnes ein. »Die Kutsche, also. Ist dein Vater schon da?«
»Nein, aber er hat mir versichert, dass er rechtzeitig im Hund sein wird. Er ist noch am Hafen, denn morgen früh kommen die Güter, die für Augsburg bestimmt sind.«
»Wenn die Landsknechte sie nicht abfangen.«
»Es sind keine gesichtet worden. Und Vater sagt, dass es bald vorbei sein wird.«
Helene teilte den Optimismus ihres Mannes nicht. Seit bald dreizehn Jahren führte das Heilige Römische Reich Deutscher Nation Krieg gegen die Osmanen im Osten. Jahr für Jahr schifften sich in der Gegend um Schwäbischwerd Kriegshaufen ein und fuhren die Donau stromabwärts, den Streitscharen des Sultans entgegen. Da den Söldnern und Landsknechten die Zeit schnell lang wurde, während sie auf die Schiffe warteten, plünderten sie regelmäßig alle Städte in der Umgebung der Häfen. Niemand hinderte die Männer daran, weil man sie für den Festungskrieg gegen die Heiden brauchte.
»Gebe Gott, dass dein Vater recht behält.« Helene sah an Lorenz vorbei, zur offenen Tür. »Wo sind deine Brüder?«
»Haben sich, glaube ich, damit abgefunden, dass sie nicht mitdürfen. Sie sind in der Küche bei Bartholomäus, maulen und lassen sich mit Essen und süßem Kram vollstopfen.«
»Es sei ihnen gegönnt. Wir sollten gehen, bevor sie es sich anders überlegen.« Helene wusste, dass sie ihren Zwillingen Lucas und Philipp zu viel durchgehen ließ. Aber es hatte nach Lorenz lange gedauert, bis wieder Kinderlachen im Haus erklungen war, denn die beiden Töchter, die Helene nach ihm geboren hatte, waren kurz nach der Taufe gestorben. Daher war sie überglücklich gewesen, als Lucas und Philipp am Leben geblieben waren. Das Glück hielt bis heute an und führte zu übermäßiger Nachsicht.
Mutter und Sohn verließen die Stube. Die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss, und bis auf die glosenden Holzscheite machte sich Dunkelheit in der Stube breit.