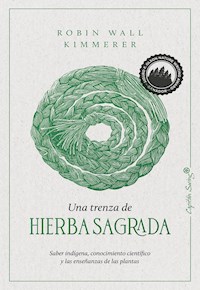Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Am Rand unserer alltäglichen Wahrnehmung, kaum sichtbar für das Auge, liegt eine andere Welt: ein Regenwald en miniature, ein Mikrobiom, bestehend aus Moosen, den primitivsten aller Pflanzen. Sie haben weder Blüten, Früchte noch Samen und bringen es dennoch auf 22 000 Arten. Sie haben keine Wurzeln, und doch sind sie seit ihrer Entstehung vor 400 Millionen Jahren tief verbunden mit dem Leben unzähliger anderer Organismen. Anschaulich und kunstvoll bietet Robin Wall Kimmerer in ihren persönlichen, mit indigenen Wissensformen und wissenschaftlicher Erkenntnis angereicherten Reflexionen Einblick in die Vielfalt dieser genügsamen, allen Widrigkeiten trotzenden Organismen. Und zeigt damit, dass der bloßen Existenz der Moose nicht nur aufgrund ihrer Schönheit unsere Aufmerksamkeit gelten sollte. Dem ersten Blick verborgen, offenbaren sie uns Blatt für Blatt eine Botschaft, die unbedingt gehört werden muss: wie es möglich ist, sich mit der Welt aufs Innigste vertraut zu machen und noch im unwegsamsten Gebiet in Verbundenheit zu überleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robin Wall Kimmerer
DAS SAMMELN VON MOOS
Eine Geschichte vonNatur und Kultur
Aus dem Amerikanischenvon Dieter Fuchs
NATURKUNDEN
NATURKUNDEN No 82
herausgegeben von Judith Schalansky
bei Matthes & Seitz Berlin
INHALT
Vorwort: Die Welt durch eine moosfarbene Brille betrachten
Die Stehenden Steine
Sehen lernen
Die Vorteile des Klein-Seins: Leben in der Grenzschicht
Zurück zum Teich
Sexuelle Asymmetrie und die Satellitenschwestern
Eine Affinität zum Wasser
Die Wunden verbinden: Moose als ökologische Nachfolger
Im Wald des Bärtierchens
Kickapoo
Möglichkeiten – Entscheidungen
Eine Landschaft der Chancen
Stadtmoose
Das Netz der Gegenseitigkeit: Indigene Verwendung von Moos
Der rote Sneaker
Splachnum: Ein Porträt
Der Besitzer
Der Wald bedankt sich bei den Moosen
Stummes Beobachten
Stroh zu Gold
Danksagungen
Literaturverzeichnis
Abbildungen
Die erwähnten Moose und ihre deutschen Bezeichnungen
Register
VORWORT
DIE WELT DURCH EINE MOOSFARBENE BRILLE BETRACHTEN
Meine früheste Erinnerung an »Naturwissenschaft« (oder war es »Religion«?) stammt aus meinem Kindergarten in der alten Grange Hall. Wir rannten zu den vereisten Fenstern und drückten uns die Nasen platt, um den ersten, schwindlig machenden Schneeflocken zuzusehen. Miss Hopkins war als Erzieherin viel zu erfahren, um die Begeisterung Fünfjähriger über den ersten Schnee bremsen zu wollen, und ging mit uns nach draußen. Eingepackt in Stiefel und Handschuhe umringten wir sie inmitten von lautlos wirbelndem Weiß. Aus der Tiefe ihrer Manteltasche holte sie eine Lupe. Den ersten Blick durch dieses Gerät werde ich nie vergessen – auf Schneeflocken, die den Ärmel ihres marineblauen Wollmantels schmückten, als seien sie Sterne am mitternächtlichen Himmel. Was sich hier zehnfach vergrößert an Komplexität und Detailliertheit darbot, ließ mir den Atem stocken. Wie konnte etwas so Kleines und Gewöhnliches wie Schnee derartig vollkommen sein? Noch jetzt erinnere ich mich an das Gefühl der Verheißung, des Mysteriums, das diesen ersten Blick begleitete. Zum ersten, aber bei weitem nicht zum letzten Mal spürte ich, dass die Welt aus viel mehr bestand als nur aus dem, was unmittelbar vor den Augen liegt. Ich sah den Schnee, der sich weich auf die Äste und Dächer senkte, mit dem komplett neuen Bewusstsein, dass jedes noch so kleine Häufchen ein ganzes Universum an sternförmigen Kristallen birgt. Wie ein Schock wirkte das Geheimnis, das mir der Schnee hier offenbarte. Die Lupe und die Schneeflocke waren eine Erweckung für mich, der Beginn des Sehens. Damals begann ich zu ahnen, dass die ohnehin schon wunderbare Welt noch schöner wird, je genauer man sie betrachtet.
Die richtige Betrachtungsweise von Moosen entspricht dieser frühen Erinnerung an eine Schneeflocke. Am Rand unserer gewöhnlichen Wahrnehmung findet sich in der Hierarchie des Schönen eine weitere Ebene: Blätter, so klein und perfekt gebaut wie eine Schneeflocke, und darin verborgenes Leben, so komplex wie faszinierend. Alles, was man dafür braucht, sind Aufmerksamkeit und der richtige Blick. Moose sind für mich ein Mittel, um Intimität mit der Landschaft herzustellen – fast eine Art Geheimnis des Waldes. Das vorliegende Buch ist eine Einladung in ebendiese Landschaft.
Dreißig Jahre nach meiner ersten Betrachtung von Moosen habe ich so gut wie immer eine Lupe um den Hals hängen. Ihre Schnur verwickelt sich mit dem Lederband meines Medizinbeutels, metaphorisch und auch ganz real. Mein Wissen um die Pflanzen stammt aus unterschiedlichen Quellen: den Pflanzen selbst, meiner naturwissenschaftlichen Ausbildung und einem intuitiven Zugang zum traditionellen Wissen meines Volkes, der Potawatomi. Schon lange, bevor ich im Studium die wissenschaftlichen Bezeichnungen der Pflanzen lernte, sah ich sie als meine Lehrmeister an. An der Uni verwickelten sich die zwei Betrachtungsweisen pflanzlichen Lebens, als Subjekt und Objekt oder Geist und Materie, wie die beiden Schnüre um meinen Hals. Die Art und Weise, in der ich die Wissenschaft der Pflanzen erlernte, verdrängte mein traditionelles Pflanzenwissen. So war die Abfassung dieses Buchs der Prozess, genau diese Kenntnis zurückzugewinnen und ihr den rechtmäßigen Platz einzuräumen.
Unsere Geschichten der alten Tage erzählen von einer Zeit, in der alle Lebewesen eine gemeinsame Sprache hatten – Drosseln, Bäume, Moose und Menschen. Diese Sprache ist aber längst in Vergessenheit geraten. So erfahren wir unsere jeweiligen Geschichten durch das Sehen, durch ein Betrachten der unterschiedlichen Lebensweisen. Ich möchte die Geschichte der Moose erzählen, da ihre Stimmen kaum wahrgenommen werden und wir so viel von ihnen lernen können. Sie haben wichtige Botschaften, die unbedingt gehört werden müssen, Sichtweisen von Spezies, die anders sind als die unsrige. Die Wissenschaftlerin in mir möchte mehr über das Leben der Moose erfahren, und in der Tat ist die Wissenschaft eine formidable Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen. Aber sie reicht nicht aus. Denn in der Geschichte geht es auch um eine Beziehung. Wir beide kennen uns schon lange, die Moose und ich. Beim Erzählen ihrer Geschichte habe ich gelernt, die Welt durch eine moosfarbene Brille zu betrachten.
Indigenes Wissen beruht auf dem Grundsatz, dass man etwas erst dann versteht, wenn man es mit allen vier Aspekten unserer Existenz erfasst hat: Verstand, Körper, Gefühl und Geist. Die wissenschaftliche Erkenntnis beruht ausschließlich auf empirischen Informationen über die Welt, die der Körper sammelt und der Verstand interpretiert. Um die Geschichte der Moose erzählen zu können, brauche ich die unterschiedlichen Ansätze, den objektiven wie den subjektiven. Die vorliegenden Essays geben beiden Arten des Erkennens Raum, lassen Materie und Geist kameradschaftlich Seite an Seite gehen. Und manchmal auch miteinander tanzen.
DIE STEHENDEN STEINE
Fast zwanzig Jahre gehe ich nun schon abends über diesen Weg, den Großteil meines Lebens, wie es scheint, und zwar barfuß, sodass die Erde gegen die Wölbung meiner Füße drückt. Nur selten habe ich eine Taschenlampe dabei, damit mich allein der Weg durch die Dunkelheit der Adirondack Mountains trägt. Die Füße berühren den Boden wie Finger eine Klaviertastatur und spielen aus dem Gedächtnis ein schönes, altes Lied, eines von Kiefernnadeln und Sand. Unbewusst steige ich über die dicke Wurzel beim Zuckerahorn, wo sich morgens immer die Strumpfbandnattern sonnen. Dort habe ich mir einmal den Zeh verstaucht, deshalb passe ich auf. Am Fuß des Hügels, wo der Regen den Pfad auswäscht, gehe ich ein paar Schritte durch die Farne, um den spitzen Kieseln auszuweichen. Dann folgt ein Streifen glatter Granit, und ich spüre noch die Wärme des Tages im Stein. Der Rest ist einfach, Sand und Gras, vorbei an der Stelle, wo meine Tochter Larkin als Sechsjährige in ein Wespennest getreten ist, vorbei an dem Dickicht aus Streifenahorn, in dem wir einmal eine ganze Familie Baby-Kreischeulen entdeckt haben, auf einem Ast aufgereiht und tief schlafend. Ich biege ab zu meiner Hütte, genau dort, wo ich die Quelle tropfen höre, ihre Feuchtigkeit riechen und spüren kann, wie das Wasser zwischen meinen Zehen aufsteigt.
Das erste Mal kam ich als Studentin her, um an der Cranberry Lake Biological Station mein vorgeschriebenes Praktikum in Feldbiologie abzuleisten. Hier kam es zu meiner ersten Begegnung mit Moosen, als ich Dr. Ketchledge durch den Wald folgte und mit einer Standard-Handlupe, einer Ward’s Scientific Student, die ich aus dem Geräteraum bekommen hatte und an einem speckigen Band um den Hals trug, die Moose entdeckte. Ich wusste, dass ich ihnen verfallen war, als ich am Ende des Kurses einen Teil meiner kargen College-Ersparnisse nahm und mir eine professionelle Lupe von Bausch & Lomb bestellte, die gleiche wie er.
Die habe ich immer noch, und ich trage sie an einer roten Schnur um den Hals, wenn ich meine eigenen Studenten über die Wege am Cranberry Lake führe, wohin ich zurückgekehrt bin, um dem Lehrkörper beizutreten und irgendwann die Bio-Station zu leiten. In all diesen Jahren haben sich die Moose längst nicht so stark verändert wie ich. Der kleine Fleck Pogonatum, den Ketch uns am Tower Trail gezeigt hat, ist immer noch da. Sommer für Sommer halte ich an, um ihn mir genauer anzusehen und über seine Langlebigkeit zu staunen.
In den letzten Jahren haben meine Studenten und ich uns mit Gestein beschäftigt und anhand der Kolonienbildung diverser Moosspezies versucht, so viel wie möglich über ihr Zusammenleben auf Felsblöcken zu erfahren. Jeder Gesteinsblock steht so einsam wie eine Insel in der wogenden See des Waldes. Seine einzigen Bewohner sind die Moose. Wir versuchen herauszufinden, warum auf dem einen Felsblock zehn oder noch mehr Moos-Arten friedlich zusammenleben, während ein nahegelegener Stein, äußerlich gleich, von einem einzigen, singulär hier wachsenden Moos beherrscht wird. Welches sind die Bedingungen, die nicht nur Individuen, sondern darüber hinaus auch gemischte Gemeinschaften ermöglichen? Das ist eine komplexe Fragestellung für Moose, von uns Menschen ganz zu schweigen. Am Ende des Sommers haben wir hoffentlich eine kleine Publikation fertig, unseren gelehrten Beitrag zur Wahrheit über Steine und Moose.
Die Adirondacks sind voll mit glazialen Felsblöcken, klobigen, wie zufällig hingeworfenen Granitstücken, die das Eis vor zehntausend Jahren hier zurückgelassen hat. Ihre moosbewachsenen Ausmaße lassen die Wälder urzeitlich wirken, und dennoch weiß ich, wie sehr sich die Szenerie um sie herum verändert hat, vom Tag, an dem sie hier auf einer unfruchtbaren Fläche des Gletscher-Abriebs gestrandet sind, bis zu den dichten Ahornwäldern, die sie heute umgeben.
Die meisten Blöcke reichen mir nur bis zu den Schultern, aber bei manchen brauchen wir eine Leiter, um sie vollständig untersuchen zu können. Meine Studenten und ich wickeln ein Maßband um sie herum. Wir messen Lichteinfall und pH-Wert, notieren die Anzahl der Spalten und die Stärke ihrer dünnen Humusschicht. Sorgfältig katalogisieren wir die Position sämtlicher Moos-Arten und sagen dabei laut ihre Namen. Dicranum scoparium. Plagiothecium denticulatum. Die Studentin, die alles mitschreiben muss, bittet um kürzere Bezeichnungen. Aber Moose haben in Amerika keine Spitznamen, denn niemand hat sich je für sie interessiert. Sie besitzen nur die wissenschaftlichen Bezeichnungen, die ihnen protokollgemäß und mit juristischer Präzision Carolus Linnaeus gegeben hat, der große Pflanzentaxonom. Sogar sein eigener Name, Carl Linné, erhalten von der schwedischen Mutter, wurde im Dienste der Wissenschaft latinisiert.
Etliche der Felsen hier haben Namen, die rund um den See als Bezugspunkte benutzt werden: Chair Rock, Gull Rock, Burnt Rock, Elephant Rock, Sliding Rock. Jeder Name erzählt eine Geschichte und verbindet uns immer, wenn wir ihn aussprechen, mit der Vergangenheit und gleichzeitig der Gegenwart dieses Ortes. Meine Töchter, die hier aufgewachsen sind und deshalb glauben, dass Felsen einfach Namen haben, erfinden eigene: Bread Rock, Cheese Rock, Whale Rock, Reading Rock, Diving Rock.
Die Bezeichnungen, die wir für Steine oder andere Wesen verwenden, hängen von unserer Sichtweise ab, also davon, ob wir von innerhalb oder außerhalb des Kreises sprechen. Der Name auf unseren Lippen enthüllt das Wissen, das wir voneinander haben, daher die süßen, geheimen Ausdrücke für unsere Liebsten. Die Namen, die wir uns selbst geben, sind eine mächtige Art der Selbst-Bestimmung, der Unabhängigkeitserklärung. Außerhalb des Kreises mögen die wissenschaftlichen Namen ausreichen, aber wie nennen sich innerhalb des Kreises die Moose selbst?
Ein großer Vorzug der Bio-Station ist, dass sie sich von Sommer zu Sommer kaum verändert. Wir können im Juni einfach hineinschlüpfen wie in ein verwaschenes Flanellhemd, das nach dem Holzrauch vom Vorjahr riecht. Sie ist eine Art Lebensgrundlage, unser wahres Zuhause, eine Konstante inmitten der anderweitigen Veränderungen. Es gab keinen einzigen Sommer, in dem in den Fichten beim Speisesaal keine Meisenwaldsänger genistet hätten. Mitte Juli, also bevor die Blaubeeren reif sind, streift regelmäßig ein hungriger Bär durchs Camp. Pünktlich wie die Uhr schwimmen zwanzig Minuten nach Sonnenuntergang die Biber am vorderen Steg vorbei, und der letzte Morgennebel findet sich immer am Südhang des Bear Mountain. Oh, manchmal verändert sich doch etwas. In einem harten Winter schiebt das Eis vielleicht Treibholz ans Ufer. Einmal ist ein silbriger, alter Stamm, dessen einer Ast wie der Hals eines Reihers aussieht, in der Bucht zwanzig Meter weitergewandert. Und in einem der Sommer fanden sich die Saftleckerspechte in einem anderen Baum wieder, nachdem die Krone der alten Zitterpappel vom Sturm weggeblasen wurde. Sogar die Veränderungen bilden bekannte Muster, etwa die Abdrücke der Wellen im Sand, der Wechsel von glatter Seeoberfläche zu meterhohem Wellengang, das Rascheln des Espenlaubs lange vor dem Regen, die abendlichen Wolken, deren Aussehen die Windstärke des nächsten Tages ankündigt. Ich schöpfe Kraft und Trost aus dieser körperlichen Intimität mit der Umgebung, dem Gefühl, die Namen der Felsen und außerdem meinen Platz auf der Welt zu kennen. An diesem wilden Ufer ist meine innere Landschaft ein nahezu perfektes Spiegelbild der äußeren Welt.
Umso faszinierter war ich von dem, was ich heute entdeckt habe, auf einem wohlbekannten Uferweg und nur wenige Meilen von der Hütte entfernt. Mich traf fast der Schlag. Orientierungslos schnappte ich nach Luft und blickte umher, um mich zu vergewissern, dass ich immer noch auf demselben Weg und nicht in irgendeiner Zwischenwelt war, wo die Dinge anders sind als gedacht. Ich bin diesen Weg öfter gegangen, als ich hier aufzählen kann, und dennoch war ich erst heute in der Lage, sie auch zu sehen: fünf Felsblöcke, jeder so groß wie ein Schulbus, dicht beisammen liegend und ineinandergeschmiegt wie ein altes Ehepaar, in den Armen des jeweils anderen sicher und geborgen. Der Gletscher muss sie in diese Liebesstellung geschoben und sich dann weiterbewegt haben. Andächtig umkreiste ich das Felsgebilde und ließ dabei die Fingerspitzen über seinen Moosbewuchs gleiten.
Auf der östlichen Seite befindet sich eine Öffnung, eine höhlenartige Dunkelheit zwischen den Steinen. Irgendwie wusste ich, dass sie da sein würde. Diese Tür, die ich noch nie zuvor gesehen habe, kommt mir eigenartig bekannt vor. Meine Familie gehört zum Bären-Clan der Potawatomi. Der Bär besitzt die Medizinkenntnis für das Volk und hat eine besondere Beziehung zu den Pflanzen. Er ist derjenige, der sie mit Namen anredet und ihre jeweilige Geschichte kennt. Wir rufen ihn an, um über eine Vision die Aufgabe zu finden, für die wir bestimmt sind. Mir scheint, ich folge dem Bären.
Die Landschaft ringsum wirkt alarmiert – jedes Detail hat eine übernatürliche Schärfe. Ich stehe auf einer Insel surrealer Ruhe, wo die Zeit so schwer wie der Fels vor mir wiegt. Als ich jedoch den Kopf schüttele, um wieder normal sehen zu können, höre ich das vertraute Rauschen der Wellen und die tschilpenden Rotschwänzchen über meinem Kopf. Die Höhle zieht mich in sich hinein, auf Händen und Knien ins Dunkel, unter die Tonnen an Fels, in Erwartung einer Bärenhöhle. Eine Biegung, und das Licht von draußen verschwindet hinter mir. Ich atme die Kühle ein, ohne jede Witterung eines Bären, nur von weicher Erde und dem Geruch des Granits. Mit den Fingern tastend, bewege ich mich vorwärts, ohne recht zu wissen, warum. Der Höhlenboden ist abwärts geneigt, trocken und sandig, als würde der Regen nie so weit eindringen. Vor mir, hinter einer weiteren Biegung, steigt der Tunnel wieder an. Grünes Waldlicht wird sichtbar, also schiebe ich mich weiter. Ganz offenbar bin ich durch eine Röhre gekrochen, die unter diesem Steinhaufen hindurch auf die andere Seite führt. Ich winde mich aus dem Tunnel, bin aber keineswegs wieder im Wald. Stattdessen gelange ich auf eine kleine, grasbewachsene Wiese, einen Kreis, der von den Felsen umschlossen ist. Das ist ein Zimmer, ein mit Licht erfülltes Zimmer, das wie ein rundes Auge hinauf ins Blau des Himmels blickt. Hier blüht Castilleja, und nach Heu duftender Farn grenzt an den Ring der stehenden Steine. Ich bin in der Mitte dieses Kreises. Es gibt keine Öffnung außer der, durch die ich gekommen bin, und ich spüre, wie sich dieser Eingang hinter mir verschließt. Ich suche den Kreis ab, ohne die Öffnung im Fels zu entdecken. Zuerst packt mich die Angst, aber das Gras riecht warm in der Sonne und die Wände sind voller Moos. Wie merkwürdig es ist, nach wie vor die Rotschwänzchen in den Bäumen draußen zu hören, in einem Paralleluniversum, das wie eine Fata Morgana verschwimmt, während mich die bemoosten Wände umschließen.
Unerklärlicherweise bin ich hier, in diesem Steinkreis, weit entfernt von jedem Denken, jedem Fühlen. Die Felsen sind voller Absicht, eine intensive Gegenwart, die Lebendiges anzieht. Dies ist ein Ort der Kraft, der vor Energie vibriert, ausgestrahlt in langen Wellen. Im Bann der Steinbrocken wird meine Anwesenheit gewürdigt.
Die Felsen sind jenseits jeder Schwerfälligkeit und Stärke, aber trotzdem geben sie einem grünen Atem nach, der so kräftig wie ein Gletscher ist, während das Moos ihre Oberfläche abnutzt und sie langsam, Körnchen für Körnchen, wieder zu Sand werden lässt. Zwischen Moosen und Steinen findet ein uraltes Gespräch statt, das reine Poesie sein muss. Über Licht und Schatten und das Driften der Kontinente. Das ist, was jemand die »Dialektik von Moos auf Gestein« genannt hat: »Ein Aufeinandertreffen von Unermesslichkeit und Winzigkeit, von Vergangenheit und Gegenwart, Weichheit und Härte, Ruhe und Schwingung, Yin und Yang« (G. Schenk, Moss Gardening, 1999). Das Materielle und das Spirituelle leben hier zusammen.
Mooskolonien sind vielleicht für Wissenschaftler ein Rätsel, nur wissen Moos und Stein alles voneinander. Als Intimpartner haben Moose eine detaillierte Kenntnis der Gesteinskonturen. Sie wissen, welchen Weg das Regenwasser durch eine Felsspalte nimmt, genau wie ich weiß, wie der Pfad zu meiner Hütte verläuft. Ich stehe in diesem Kreis und erkenne, dass Moose ihre eigenen Namen haben und schon lange vor Carl Linnaeus hatten, dem latinisierten Namensgeber der Pflanzen. Die Zeit vergeht.
Ich weiß nicht, wie lange ich weg war, ob Minuten oder Stunden. Für diesen Zeitraum hatte ich keine Empfindung meiner Existenz. Es gab nichts außer Fels und Moos. Moos und Fels. Als würde mir sanft eine Hand auf die Schulter gelegt, komme ich zu mir und blicke mich um. Ich bin aus der Trance erwacht. Über mir höre ich wieder die Rotschwänzchen tschilpen. Die Wände ringsumher sind übersät mit allen möglichen Moosen, und ich betrachte sie, als sähe ich sie zum ersten Mal. Ob grün oder grau, alt oder neu an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt – alle teilen sie diesen Moment der Ruhe zwischen den Gletschern. Meine Vorfahren wussten, dass Steine die Geschichten der Erde aufbewahren, und für einen Augenblick konnte ich sie hören.
Meine Gedanken kommen mir hier zu laut vor, wie ein ärgerliches Rauschen, das die Steine in ihrem Gespräch stört. Die Tür in der Wand ist wieder aufgetaucht, auch die Zeit setzt sich wieder in Bewegung. Ein Zugang zu diesem Steinkreis wurde geöffnet – und ein Geschenk gemacht. Ein Geschenk bringt Verantwortung mit sich. Ich hatte nicht den Wunsch, die Moose an diesem Ort zu benennen, sie mit den Linné’schen Bezeichnungen zu versehen. Meine Aufgabe bestand wohl eher im Mitnehmen der Botschaft, dass Moose ihre eigenen Namen haben. Ihre Existenz auf der Welt kann nicht allein durch Daten beschrieben werden. Sie rufen mir ins Gedächtnis, dass es Geheimnisse gibt, für die ein Maßband keine Bedeutung hat; Fragen und Antworten, für die in der Wahrheit über Felsen und Moose kein Platz ist.
Auf dem Weg hinaus ist der Tunnel weniger mühsam. Diesmal weiß ich, wohin ich mich bewege. Ich drehe mich noch einmal nach den Steinen um, dann setze ich meine Füße auf den bekannten Weg nach Hause. Ich weiß, dass ich einem Bären folge.
SEHEN LERNEN
Nach vier Stunden in 10 000 Metern Höhe habe ich mich der Lähmung eines Transkontinentalflugs ergeben. Vom Start bis zur Landung sind wir alle im Zustand ausgesetzter Animiertheit, in einer Pause zwischen Kapiteln unseres Lebens. Wenn wir durchs Fenster in die strahlende Sonne blicken, ist die Erde nur eine flache Projektion, deren Gebirgszüge auf Falten in der kontinentalen Haut reduziert sind. Ohne Rücksicht auf unsere Reise hier oben entfalten sich unten andere Geschichten. Brombeeren reifen in der Augustsonne heran, eine Frau packt den Koffer und zögert an der Türschwelle; ein Brief wird geöffnet, und zwischen den Seiten erscheint ein überraschendes Foto. Aber wir bewegen uns zu schnell und sind zu weit weg; wir bekommen keine der Geschichten mit, nur unsere eigene. Als ich mich vom Fenster wegdrehe, verschwinden sie in der zweidimensionalen, grün-braunen Landkarte unter uns. Wie eine Forelle, die in den Schatten eines Uferüberhangs gleitet und einen weiter auf die glatte Wasseroberfläche starren lässt mit der Frage, ob sie überhaupt da war.
Ich setze mir die neu erworbene, nach wie vor frustrierende Lesebrille auf und beklage meine mittel-alte Sehkraft. Die Wörter auf der Seite werden scharf und verschwimmen wieder. Wie ist es möglich, dass ich nicht mehr sehen kann, was einst so deutlich war. Mein fruchtloses Bemühen, zu sehen, was ich da direkt vor mir weiß, erinnert mich an meine erste Reise in die Regenwälder Amazoniens. Unsere indigenen Tourguides zeigten uns geduldig den Leguan auf einem Ast oder den Tukan, der durch die Blätter auf uns herabäugte. Was ihrem geübten Blick so offensichtlich war, erschien uns so gut wie unsichtbar. Ohne die nötige Erfahrung konnten wir das Muster aus Licht und Schatten einfach nicht als »Leguan« interpretieren, deshalb hatten wir ihn direkt vor der Nase und sahen ihn frustrierenderweise nicht.
Wir armen, kurzsichtigen Menschen, die wir weder die scharfe Fernsicht der Greifvögel noch die Panoramavision einer Stubenfliege besitzen. Mit unserem großen Gehirn wissen wir immerhin um die Grenzen unseres Sehvermögens. In einer für unsere Spezies seltenen Demut erkennen wir an, dass vieles auf unserer Welt nicht sichtbar ist, und ersinnen deshalb die erstaunlichsten Methoden ihrer Betrachtung. Infrarot-Satellitenbilder, optische Fernrohre und das Hubble-Weltraumteleskop rücken das Unermessliche ins Blickfeld. Elektronenmikroskope lassen uns das verborgene Universum unserer Zellen durchstreifen. Aber im mittleren Bereich, dem des bloßen Auges, scheinen unsere Sinne merkwürdig stumpf zu sein. Mit raffinierten Technologien versuchen wir zu sehen, was außerhalb unseres Vermögens liegt, aber für die zahllos funkelnden Facetten vor uns sind wir oft merkwürdig blind. Wir glauben, wir würden bereits sehen, dabei haben wir nur an der Oberfläche gekratzt. Unsere Sehschärfe in diesem mittleren Bereich scheint reduziert zu sein, allerdings nicht durch ein Versagen der Augen, sondern durch die Bereitschaft unseres Verstandes. Hat die Potenz unserer Geräte dazu geführt, dass wir dem bloßen Auge nicht mehr trauen? Oder lassen wir links liegen, was zur Betrachtung keine Technologie erfordert, dafür aber Dinge wie Zeit und Geduld? Dabei kann Aufmerksamkeit dem stärksten Vergrößerungsglas Paroli bieten.
Ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit dem Nordpazifik, am Rialto Beach der Olympic-Halbinsel. Als Festland-Botanikerin konnte ich es kaum erwarten, zum ersten Mal den Ozean zu sehen, deshalb spähte ich um jede Kurve der gewundenen Schotterpiste. Wir erreichten ihn in dichtem, grauem Nebel, der tief in den Bäumen hing und meine Haare mit Feuchtigkeit benetzte. Bei klarem Himmel hätten wir nur gesehen, was wir erwarteten: eine felsige Küste, üppige Wälder und die Weite des Meeres. Aber an diesem Tag war die Luft undurchsichtig, und die hinter uns liegende Hügellandschaft kam nur dann zum Vorschein, wenn sich die Wipfel der Sitka-Fichten durch die Wolken bohrten. Das Meer war allein durch seine dröhnende Brandung anwesend, aber draußen, jenseits der Gezeitenbecken. Hier, am Rand dieser Unermesslichkeit, war die Welt ganz klein geworden, denn der Nebel verdeckte alles außer der Mitteldistanz. Mein aufgestautes Verlangen, das Küstenpanorama zu sehen, richtete sich so auf die einzigen erkennbaren Dinge: den Strand und die verstreuten Gezeitenbecken.
Beim Herumstreifen in diesem Grau verloren wir uns schnell aus den Augen, denn meine Freunde verschwammen nach wenigen Schritten wie Geister. Nur unsere gedämpften Stimmen hielten uns zusammen, indem Funde wie ein perfekter Kieselstein oder die intakte Schale einer Scheidenmuschel vermeldet wurden. Vom Studium der Reiseführer wusste ich, dass wir in den Gezeitenbecken Seesterne entdecken »müssten« – in meinem Fall zum allerersten Mal. Einen hatte ich schon im Zoologie-Kurs gesehen, allerdings getrocknet, und jetzt wollte ich sie zu Hause erleben, wo sie ja eigentlich hingehörten. Ich suchte zwischen Muscheln und Napfschnecken, ohne einen zu entdecken. Es gab hier so viele Krebse und exotisch aussehende Algen, Seeanemonen und Käferschnecken, dass jeder Gezeitenbecken-Novize glücklich gewesen wäre. Aber keinen Seestern. Ich ging gebückt über die Felsen, hob mondfarbene Muschelschalen oder eigenwillig geformte Treibholzstückchen auf und hielt weiter Ausschau. Kein Seestern weit und breit. Enttäuscht richtete ich mich auf, um meinen steifen Rücken zu entlasten, und plötzlich – sah ich einen. Leuchtend orange klebte er direkt vor mir an einem Stein. Und dann war es, als würde ein Vorhang weggezogen, und ich sah sie überall. Wie Sterne, die an einem dunkler werdenden Sommerabend nach und nach zum Vorschein kommen. Orangefarbene Sterne in den Spalten eines schwarzen Felsbrockens, Sterne in geflecktem Burgunder und mit ausgestreckten Armen, violette Sterne, zusammengeballt wie eine Familie, die sich vor der Kälte schützt. Kaskadenartig wurde das Unsichtbare sichtbar.
Ein Cheyenne-Ältester hat mir einmal erklärt, dass man etwas am ehesten dann findet, wenn man nicht danach sucht. Für eine Wissenschaftlerin ist das natürlich eine problematische Vorgehensweise. Aber er meinte, man solle aus dem Augenwinkel betrachten und offen für Möglichkeiten sein, dann würde sich das Gesuchte offenbaren. Die Offenbarung, plötzlich das zu sehen, wofür ich nur kurze Zeit vorher noch blind gewesen war, ist für mich ein grandioses Erlebnis. Ich kann an diesen Augenblick zurückdenken und immer noch die Welle der Expansion spüren. Wie die Grenze zwischen meiner Welt und der eines anderen Wesens ruckartig verschoben wird und auf einmal Klarheit besteht, ein so demütig machendes wie gleichermaßen wunderbares Erlebnis.
Das plötzliche Gefühl eines visuellen »Bewusstseins« entsteht partiell durch die Entstehung eines »Suchbildes« im Gehirn. In einer komplexen visuellen Landschaft registriert das Gehirn zunächst alle eingehenden Informationen, ohne sie kritisch zu bewerten. Fünf orangefarbene Arme, sternförmig angeordnet, dazu ein glatter, schwarzer Fels sowie Licht und Schatten. Das ist, was ankommt, aber das Gehirn interpretiert eben nicht gleich, gibt dem Verstand also keine Bedeutungen weiter. Erst wenn das Muster wiederholt wird und der Verstand darauf reagiert, »erkennen« wir, was wir da sehen. Genauso werden Tiere zu geschulten Detektoren ihrer Beute, indem sie nämlich komplexe visuelle Muster nach der besonderen Konstellation absuchen, die für sie Nahrung bedeutet. Zum Beispiel sind Grasmücken sehr erfolgreiche Jäger, wenn eine bestimmte Raupe häufig auftritt und im Gehirn des Vogels dadurch ein entsprechendes Suchbild entsteht. Gibt es aber nur wenige, bleiben sie durchaus auch unentdeckt. Die neuralen Bahnen müssen durch Erfahrung trainiert werden, um zu erzeugen, was gesehen wird. Die Synapsen feuern, und die Sterne kommen heraus. Das Ungesehene ist plötzlich klar ersichtlich.
Im Hinblick auf Moose ist der Waldspaziergang eines 1,80 Meter großen Menschen mit einem Transkontinentalflug zu vergleichen – in 10 000 Metern Höhe. So hoch über der Erde und unterwegs zu einem anderen Ort laufen wir Gefahr, ein ganzes Universum unter unseren Füßen zu übersehen. Moose und andere Kleinlebewesen laden uns ein, für eine gewisse Zeit an den Rändern der gewöhnlichen Wahrnehmung zu verweilen. Dafür ist nichts als Aufmerksamkeit nötig. Schau auf spezielle Weise hin und entdecke eine komplett neue Welt.
Mein Ex-Mann hat mich wegen meiner Leidenschaft für Moose gern aufgezogen und gemeint, die seien doch höchstens als Deko gut. Für ihn waren sie nur eine Tapete des Waldes, die seinen Fotos von Bäumen die richtige Stimmung verleihen. In der Tat erzeugt ein Teppich aus Moos dieses grün schimmernde Licht. Aber fokussiere die Linse auf die moosige Tapete selbst, und der verschwommen grünliche Hintergrund wird nicht nur scharf, sondern lässt auch eine gänzlich neue Dimension erkennen. Die Tapete, die auf den ersten Blick gleichförmig strukturiert schien, ist in Wahrheit eine komplexe Tapisserie, eine golddurchwirkte, aufwändig gemusterte Oberfläche. Das »Moos« entpuppt sich als Vielzahl von Moosen ganz unterschiedlicher Ausformung. Es gibt Wedel, die an Miniatur-Farne erinnern, straußenfedernartige Fäden oder glänzende Büschel, die wie seidiges Babyhaar aussehen. Bei genauer Betrachtung eines bemoosten Baumstamms denke ich immer, ich betrete ein Märchen-Stoffgeschäft. Die Schaufenster sind voll bunter Gewebe und Farben, die einen dazu einladen, die ausliegenden Stoffballen genauer zu untersuchen. Man kann mit den Fingerspitzen über die silbrigen Tuchbahnen des Plagiothecium fahren und den schimmernden Brokat eines Brotherella betasten. Es gibt die dunklen Wollbündel des Dicranum, die goldenen Bettlaken des Brachythecium und die funkelnden Schleifchen des Mnium. Der knotig-braune Callicladium-Tweed ist über seine gesamte Fläche mit vergoldeten Campylium-Fäden durchschossen. Hier ohne genaueres Hinsehen vorbeizueilen, ist, wie wenn man ins Handy spricht und dabei an der Mona Lisa vorbeigeht.
Nähere dich diesem Teppich aus grünem Licht und Schatten, und schlanke Zweige bilden einen belaubten Baumwipfel über robusten Stämmen, Regen tropft durch den Baldachin, und scharlachrote Milben turnen im Blattwerk. Die Architektur des umgebenden Waldes wiederholt sich in der Form des Moosteppichs – der Nadel- und der Mooswald sind ein Spiegelbild des jeweils anderen. Fokussiere deinen Blick auf die Größe eines Tautropfens, dann wird die Waldlandschaft zur verschwommenen Tapete und ist plötzlich nur noch Hintergrund des scharfen Moosmikrosmos.
Die richtige Betrachtung von Moosen hat mehr mit Hören zu tun als mit Sehen. Ein flüchtiger Blick reicht da nicht. Einer weit entfernten Stimme zu lauschen oder im leisen Subtext eines Gesprächs Nuancen zu erhaschen, erfordert Aufmerksamkeit, ein Wegfiltern von Störgeräuschen, um die Musik mitzubekommen. Moose sind mitnichten Fahrstuhlmusik, eher die verwobenen Fäden eines Beethoven-Quartetts. Moose betrachtet man am besten so, wie man dem Wasser lauscht, wenn es über Steine fließt. Der beruhigende Klang eines Flusses hat viele Stimmen; das bewegte Rauschen, mit dem er sich selbst umspielt, und sein spritzender Aufprall an den Felsbrocken. Dann können – mit Bedacht und Ruhe – in dieser Fuge des Flussklangs die einzelnen Töne isoliert werden. Das Gleiten des Wassers über einen Felsblock, Oktaven höher als das dumpfe Brummen von malmendem Kies, das Gurgeln des Kanals, der sich zwischen zwei Steinen hindurchschleust, die glockenartigen Töne eines Tropfens, der in ein Wasserbecken fällt. So ist das auch beim Betrachten von Moosen. Sobald wir langsamer werden und näher herangehen, bilden und verbreiten sich in den verworrenen Tapisserie-Fäden Muster. Die Fäden sind sowohl abgelöst vom Ganzen als auch ein Teil davon.
Die Fraktalgeometrie einer einzelnen Schneeflocke zu kennen, macht eine Winterlandschaft noch zauberhafter. Eine Kenntnis der Moose bereichert unser Weltwissen. Diesen Wandel spüre ich, wenn ich meine Bryologie-Studenten den Wald mit ganz neuen Augen betrachten sehe.
Ich gebe diese Kurse im Sommer, dann streifen wir durch die Wälder und betrachten gemeinsam Moose. Die ersten Tage sind immer am aufregendsten, denn die Studenten lernen, die diversen Moosarten zu unterscheiden, erst mit bloßem Auge, dann mit der Lupe. Ich fühle mich wie die Geburtshelferin einer Erweckung, wenn ihnen erstmals klar wird, dass ein bemooster Stein nicht nur mit »Moos«, sondern mit zwanzig unterschiedlichen Arten von Moos bedeckt ist, jede davon mit ihrer eigenen Geschichte.
Beim Wandern und im Labor höre ich gern ihren Gesprächen zu. Mit jedem Tag wird ihr Wortschatz größer, und voller Stolz bezeichnen sie blattartig-grüne Triebe als »Gametophyten«, die kleinen, braunen Dinger obendrauf hingegen pflichtbewusst als »Sporophyten«. Die aufrechten, büscheligen Moose werden zu »akrokarpen«, während die mit horizontalen Wedeln »pleurokarpe« sind. Kann man diese Formen benennen, werden ihre Unterschiede umso vieles deutlicher. Mit den richtigen Worten kann man klarer sehen. Diese Worte zu finden, ist ein weiterer Schritt beim Sehen-Lernen.
Eine neue Dimension und damit auch ein neues Lexikon öffnen sich, wenn die Studenten anfangen, die Moose unters Mikroskop zu legen. Einzelne Blätter werden in mühsamer Dissektion abgelöst und auf einem Glasträger platziert, um genauer erforscht zu werden. In zwanzigfacher Vergrößerung betrachtet, sind die Blattoberflächen wunderschön geformt. Das Licht, das hell durch einzelne Zellen dringt, illuminiert ihre elegante Form. Beim Untersuchen dieser Stellen löst sich leicht die Zeit auf, als würde man eine Kunstausstellung mit verblüffenden Formen und Farben besuchen. Manchmal blicke ich am Ende des Seminars vom Mikroskop auf und erschrecke mich über die Schlichtheit der normalen Welt, ihre langweiligen, vorhersehbaren Formen.
Aufgrund ihrer Klarheit finde ich die Sprache der mikroskopischen Beschreibung bestechend. Der Rand eines Blattes ist nicht einfach ungleichmäßig; es gibt ein ganzes Glossar an speziellen Wörtern für das Aussehen einer Blattkante: gezähnt für große, breite Zähne, gesägt für einen zackigen Rand, fein gesägt, wenn die Zacken dünn und gleichmäßig sind, bewimpert für eine gefranste Kante. Ein Blatt, das wie ein Akkordeon aussieht, ist gefaltet, während flach eines bezeichnet, das so platt ist, als hätte man es zwischen zwei Buchseiten gepresst. Jede Nuance der Moos-Architektur hat ihre eigene Bezeichnung. Die Studenten benutzen sie wie die Geheimsprache einer Bruderschaft, und ich kann sehen, wie sie immer enger zusammenwachsen. Über die Worte entsteht auch eine Intimität mit der Pflanze, die von sorgfältiger Beobachtung zeugt. Sogar die Oberflächen einzelner Zellen haben ihre eigenen Bezeichnungen – mammillös für eine brustartige Schwellung, papillös für einen kleinen Hügel, und warzig, wenn es so viele Hügel sind, dass sie wie Windpocken aussehen. Auch wenn das wie eine ganz normale Fachsprache wirkt, sind diese Begriffe doch mit Leben erfüllt.
Den normalen Menschen sind Moose derartig unbekannt, dass kaum welche eine umgangssprachliche Bezeichnung haben. Am ehesten kennt man sie unter ihrem wissenschaftlichen, also lateinischen Namen, was die meisten Menschen davon abhält, sie bestimmen zu wollen. Ich hingegen mag die Fachtermini, denn sie sind so schön und raffiniert wie die Pflanzen, die sie bezeichnen. Mit welchem Rhythmus, welcher Musikalität diese Worte von der Zunge rollen: Herzogiella striatella, Thuidium delicatulum, Barbula fallax.
Für die Kenntnis der Moose sind ihre wissenschaftlichen Namen natürlich keineswegs zwingend. Die lateinischen Bezeichnungen, die wir ihnen geben, sind ja nur willkürliche Konstruktionen. Wenn ich hin und wieder eine neue Moos-Art entdecke und den offiziellen Namen erst noch herausfinden muss, nenne ich sie erst einmal so, wie es mir am schlüssigsten erscheint: grüner Samt, Lockenkopf oder roter Stengel. Der Wortlaut ist dabei unwesentlich. Wichtig scheint mir aber, dass man sie wahrnimmt, ihre Individualität anerkennt. Nach indigenem Verständnis wird jedes Lebewesen um uns herum als nicht-menschliche Person wahrgenommen, und jedes hat seinen eigenen Namen. Es ist ein Zeichen von Achtung, ein Lebewesen mit seinem Namen anzusprechen, und ein Zeichen von Respektlosigkeit, das nicht zu tun. Worte und Namen sind das, womit wir Menschen Beziehungen aufbauen, nicht nur untereinander, sondern auch mit den Pflanzen.
Die Bezeichnung »Moos« wird immer wieder für Pflanzen verwendet, die gar keines sind. Rentier-»Moos« ist eine Flechte, Spanisches »Moos« eine Blütenpflanze, See-»Moos« eine Alge und Bärlapp-»Moos« eine Gefäßpflanze. Was ist also ein Moos? Richtige Moose oder Bryophyten sind die primitivsten aller Landpflanzen. Oft werden sie durch das beschrieben, was ihnen im Vergleich zu bekannten, höher entwickelten Pflanzen fehlt. Sie tragen keine Blüten, Früchte oder Samen und haben keine Wurzeln. Sie besitzen kein Vaskulärsystem, kein Xylem oder Phloem zum internen Wassertransport. Sie sind die allereinfachsten Pflanzen, in ihrer Einfachheit aber äußerst elegant. Mit den wenigen, rudimentären Komponenten Stengel und Blatt hat die Evolution weltweit um die 22 000 Moos-Arten hervorgebracht. Jede ist die Variation eines gemeinsamen Grundthemas – eine einzigartige Kreation, designt für den Erfolg in winzigen Nischen des jeweiligen Ökosystems.
Die Betrachtung von Moosen gibt der Vertrautheit mit dem Wald Tiefe und Intimität. Durch den Wald zu gehen und eine Spezies schon fünfzig Schritte vorher – allein durch ihre Farbe – zu erkennen, verbindet mich sehr mit dem Ort. Dieses besondere Grün, seine spezielle Art, das Licht einzufangen, gibt seine Identität preis, genau wie man Freunde an ihrem Gang erkennt, lange bevor man das jeweilige Gesicht gesehen hat. So wie man in einem lärmigen Raum die Stimme einer geliebten Person heraushört oder im Gesichtermeer das Lächeln des eigenen Kindes entdeckt, ermöglicht eine intime Verbindung das Erkennen in einer viel zu oft sehr anonymen Welt. Dieses Gefühl der Verbindung entstammt einer besonderen Urteilsfähigkeit, einem Suchbild, das wiederum auf einer langen Zeit des Sehens und Hörens beruht. Die Intimität schenkt uns eine andere Betrachtungsweise, wenn die normale Sehschärfe nicht mehr ausreicht.
DIE VORTEILE DES KLEIN-SEINS: LEBEN IN DER GRENZSCHICHT
Das weinende Kind an meinem Arm handelt mir den strafenden Blick einer ohnehin schon ernsten Dame ein. Meine Nichte ist untröstlich, weil ich sie zum Überqueren der Straße an die Hand genommen habe. Aus Leibeskräften brüllt sie: »Ich bin nicht zu klein! Ich will groß sein!« Wenn sie nur wüsste, wie schnell sich ihr Wunsch erfüllen wird. Wieder im Auto, und nachdem sie die Schmach des Im-Kindersitz-Angeschnallt-Werdens jammernd über sich ergehen ließ, versuche ich, normal mit ihr zu reden, und erinnere sie an die Vorteile des Klein-Seins. Sie passt in das geheime Fort im Fliederbusch, wo sie sich vor ihrem Bruder verstecken kann. Und was ist mit den Geschichten auf Omas Schoß? Aber sie will nichts davon wissen. Auf dem Heimweg schläft sie ein, in der Hand den neuen Drachen und im Gesicht ihre trotzige Miene.
Als ich in ihrem Kindergarten ein bisschen Naturkunde machen sollte, nahm ich einen moosbedeckten Stein mit. Ich wollte von den Kindern wissen, was ein Moos denn sei. Sie ließen die Frage nach Tier, Pflanze oder Mineral links liegen und nannten gleich das hervorstechendste Merkmal: Moose sind klein. Kinder erkennen das sofort. Diese auffallendste Eigenschaft hat gewaltige Auswirkungen auf die Art und Weise, in der Moose die Welt bewohnen.
Moose sind klein, weil sie über kein Stützsystem verfügen, das sie aufrecht hält. Größere Moose kommen meist nur in Seen und Flüssen vor, wo ihr Gewicht vom Wasser getragen wird. Dass Bäume aufrecht und sicher dastehen, liegt an ihrem Leitgewebe, dem Xylem-Netzwerk aus dickwandigen Tubuluszellen, die als eine Art hölzernes Rohrleitsystem in der Pflanze Wasser führen. Moose sind die primitivsten aller Pflanzen und haben kein derartiges Leitgewebe. Wären sie größer, könnten ihre schlanken Stengel das eigene Gewicht nicht mehr tragen. Ohne Xylem kann auch kein Wasser aus dem Erdboden in die obersten Blätter geleitet werden. Nur Pflanzen von wenigen Zentimetern Höhe können sich hydriert halten.
Klein zu sein bedeutet aber keineswegs, erfolglos zu sein. Unter biologischen Gesichtspunkten sind Moose nämlich erfolgreich: Sie bewohnen so gut wie jedes Ökosystem der Erde und belaufen sich auf 22 000 verschiedene Arten. So wie meine Nichte kleine Orte zum Verstecken findet, können Moose in den diversesten Mikrogemeinschaften leben, in denen groß zu sein ein Nachteil wäre. Ob in den Rissen des Bürgersteigs, auf den Ästen einer Eiche, auf dem Rücken eines Käfers oder am Rand einer Klippe – Moose können all die kleinen Leerräume zwischen größeren Pflanzen füllen. Weil sie wunderbar an ein Leben in der Miniatur angepasst sind, ziehen Moose größte Vorteile aus ihrem Klein-Sein und wachsen nur auf eigene Gefahr hin über sich hinaus.