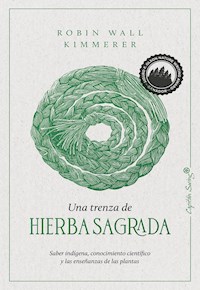16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Robin Wall Kimmerer flicht aus indigener Weisheit und wissenschaftlichen Erkenntnisse einen Zopf an Geschichten über die Großzügigkeit der Erde. Der Überraschungsbestseller aus den USA mit über einer Million verkaufter Exemplare. »Man sieht die Welt nie wieder so wie zuvor, nachdem man sie durch Kimmerers Augen gesehen hat.« Elizabeth Gilbert »Es ist die Art und Weise, wie sie Schönheit einfängt, die ich am meisten liebe, die Bilder von riesigen Zedern und wilden Erdbeeren, ein Wald im Regen und eine Wiese aus duftendem Süßgras werden bei Ihnen bleiben, lange nachdem Sie die letzte Seite gelesen haben.« Jane Goodall »Es gibt zwei Arten von Büchern, die einem durch schwere Zeiten helfen können. Eine davon verschiebt das Denken über die Welt: wie Robin Wall Kimmerers »Geflochtenes Süßgras«. Ich las es, als ich am Boden war; und es gab mir Trost und das Gefühl, dass es noch Hoffnung gibt für diesen Planeten.« Helen MacDonald
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 696
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Robin Wall Kimmerer flicht aus indigener Weisheit und wissenschaftlichen Erkenntnisse einen Zopf an Geschichten über die Großzügigkeit der Erde. Der Überraschungsbestseller aus den USA mit über einer Million verkaufter Exemplare.
»Man sieht die Welt nie wieder so wie zuvor, nachdem man sie durch Kimmerers Augen gesehen hat.«
Elizabeth Gilbert
»Es ist die Art und Weise, wie sie Schönheit einfängt, die ich am meisten liebe, die Bilder von riesigen Zedern und wilden Erdbeeren, ein Wald im Regen und eine Wiese aus duftendem Süßgras werden bei Ihnen bleiben, lange nachdem Sie die letzte Seite gelesen haben.«
Jane Goodall
»Es gibt zwei Arten von Büchern, die einem durch schwere Zeiten helfen können. Eine davon verschiebt das Denken über die Welt: wie Robin Wall Kimmerers »Geflochtenes Süßgras«. Ich las es, als ich am Boden war; und es gab mir Trost und das Gefühl, dass es noch Hoffnung gibt für diesen Planeten.«
Helen MacDonald
Über Robin Wall Kimmerer
Robin Wall Kimmerer, geboren 1953, ist Botanikerin und Mitglied der Citizen Potawatomi Nation. Ihr schon 2013 erschienenes Buch »Geflochtenes Süßgras« steht seit Anfang 2020 ununterbrochen auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Sie lebt in Syracuse, New York, wo sie SUNY Distinguished Teaching Professor für Umweltbiologie und Gründerin und Direktorin des Center for Native Peoples and the Environment ist.
Elsbeth Ranke, geboren 1972, Studium der Romanistik und Angewandten Sprachwissenschaft. Übersetzungen aus dem Französischen und Englischen, u. a. Erin Hunter, Frédéric Lenoir, E. O. Wilson, Dave Goulson, Lewis Wolpert, Hélène Beauvoir. André Gide-Preis 2004.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Robin Wall Kimmerer
Geflochtenes Süßgras
Die Weisheit der Pflanzen
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Elsbeth Ranke unter Mitarbeit von Wolfram Ströle und Friedrich Pflüger
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort
Süßgras pflanzen
Der Sturz der Himmelsfrau
Der Rat der Pekannussbäume
Das Geschenk der Erdbeeren
Eine Opfergabe
Astern und Goldrute
Die Grammatik des Belebten
Süßgras hegen
Ahornzuckermond
Zaubernuss
Das Werk einer Mutter
Der Trost der Seerosen
Der Dankbarkeitsschwur
Süßgras pflücken
Die Offenbarung in den Bohnen
Die Drei Schwestern
Wisgaak Gokpenagen: Ein Korb aus Schwarz-Esche
Mishkos Kenomagwen: Die Lehren des Grases
V. Ergebnisse
Ahorn-Nation: Ein Leitfaden für Bürger
Die Ehrenhafte Ernte
Süßgras flechten
In den Fußstapfen von Nanabozho: An einem Ort heimisch werden
Der Klang der Schneeglöckchenbäume
Im Kreis sitzen
Feuer am Cascade Head
Wurzeln schlagen
Umbilicaria: Der Nabel der Welt
Die Kinder des Waldes von einst
Zeuge des Regens
Süßgras verbrennen
Die Spuren des Windigo
Das Heilige und der Superfund
Maismenschen und Lichtmenschen
Kollateralschaden
Shkitagen: die Menschen des Siebten Feuers
Den Windigo besiegen
Epilog: Das Geschenk erwidern
Anmerkungen
Anmerkung zum Umgang mit Pflanzen und Tiernamen im amerikanischen Original
Anmerkung zum Umgang mit indigenen Sprachen
Anmerkung zu indigenen Geschichten
Quellen
Dank
Über die Autorin
Fußnoten
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne...
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort
Süßgras pflanzen
Der Sturz der Himmelsfrau
Der Rat der Pekannussbäume
Das Geschenk der Erdbeeren
Eine Opfergabe
Astern und Goldrute
Die Grammatik des Belebten
Süßgras hegen
Ahornzuckermond
Zaubernuss
Das Werk einer Mutter
Der Trost der Seerosen
Der Dankbarkeitsschwur
Süßgras pflücken
Die Offenbarung in den Bohnen
Die Drei Schwestern
Wisgaak Gokpenagen: Ein Korb aus Schwarz-Esche
Mishkos Kenomagwen: Die Lehren des Grases
V. Ergebnisse
Ahorn-Nation: Ein Leitfaden für Bürger
Die Ehrenhafte Ernte
Süßgras flechten
In den Fußstapfen von Nanabozho: An einem Ort heimisch werden
Der Klang der Schneeglöckchenbäume
Im Kreis sitzen
Feuer am Cascade Head
Wurzeln schlagen
Umbilicaria: Der Nabel der Welt
Die Kinder des Waldes von einst
Zeuge des Regens
Süßgras verbrennen
Die Spuren des Windigo
Das Heilige und der Superfund
Maismenschen und Lichtmenschen
Kollateralschaden
Shkitagen: die Menschen des Siebten Feuers
Den Windigo besiegen
Epilog: Das Geschenk erwidern
Anmerkungen
Anmerkung zum Umgang mit Pflanzen und Tiernamen im amerikanischen Original
Anmerkung zum Umgang mit indigenen Sprachen
Anmerkung zu indigenen Geschichten
Quellen
Dank
Über die Autorin
Fußnoten
Impressum
Für alle Hüter des Feuersmeine Elternmeine Töchterund meine Enkeldie an diesem schönen Ort noch zu uns kommen werden
Vorwort
Strecken Sie die Hand aus und lassen Sie mich ein Bündel frisch gepflücktes Süßgras hineinlegen, locker und luftig, wie frisch gewaschenes Haar. Oben sind die Halme glänzend goldgrün, weiter unten, dort, wo sie auf den Boden treffen, haben sie ein lila-weißes Band. Halten Sie sich das Bündel unter die Nase. Nehmen Sie den honigsüßen Vanilleduft wahr, hinter dem sich der Geruch von Flusswasser und schwarzer Erde verbirgt, und Sie verstehen den wissenschaftlichen Namen: Hierochloe odorata, duftendes, heiliges Gras1. In unserer Sprache heißt es wiingaashk, das süß duftende Haar von Mutter Erde. Atmen Sie es ein, und Ihnen werden nach und nach Dinge einfallen, von denen Sie nicht wussten, dass Sie sie vergessen hatten.
Wenn man eine Handvoll Süßgras am Ende zusammenbindet und in drei Strähnen unterteilt, kann man es flechten. Damit es ein weicher, glänzender Zopf wird, den man verschenken kann, braucht es eine gewisse Spannung. Jedes kleine Mädchen mit abstehenden Zöpfen kann es bestätigen: Beim Flechten muss man ziehen. Natürlich bekommt man das alleine hin – man kann das Ende an einen Stuhl binden, oder es zwischen die Zähne nehmen und rückwärts von sich selbst weg flechten –, aber am schönsten ist es, wenn jemand anderes das Ende hält, so dass beide sachte gegeneinander ziehen, dabei die Köpfe zusammenstecken, plaudern und lachen, sich gegenseitig auf die Hände sehen, die einen ganz still, während die anderen die schlanken Strähnen übereinanderschlagen, von rechts, von links. Das Süßgras bringt Menschen zusammen, in einen Austausch, bei dem die Haltende so wichtig ist wie die Flechtende. Der Zopf wird gegen Ende feiner und dünner, bis einzelne Halme geflochten und dann abgebunden werden.
Wollen Sie das Ende des Bündels halten, während ich flechte? Können wir unsere Hände durch Gras miteinander verbinden und einen Zopf zu Ehren der Erde flechten? Danach halte ich das Ende für Sie.
Ich könnte Ihnen einen Zopf Süßgras reichen, so dick und glänzend wie der Zopf, der meiner Großmutter über den Rücken fällt. Aber es steht mir nicht an, zu geben, und Ihnen nicht, zu nehmen. Wiingaashk gehört sich selbst. Also verschenke ich stattdessen einen Zopf aus Geschichten, für die Heilung unserer Beziehung zur Welt. Dieser Zopf besteht aus drei Strängen: dem Wissen der Indigenen, naturwissenschaftlicher Erkenntnis, und der Geschichte einer Wissenschaftlerin vom Stamm der Anishinaabe, die versucht, alles drei zusammenzubringen, um dem Wichtigsten zu dienen. Es ist ein Geflecht aus Wissenschaft, Geist und Geschichten, eine Pharmakopöe, ein Arzneimittelbuch mit heilsamen Geschichten, damit wir uns eine andere Beziehung vorstellen können, in der Mensch und Land füreinander gute Medizin sind.
Süßgras pflanzen
Süßgras pflanzt man am besten nicht durch Aussaat, sondern indem man Wurzeln direkt in den Boden steckt. So verbindet die Pflanze über Jahrhunderte eine Generation mit der nächsten, wird von einer Hand an die Erde und von dort wieder an die nächste weitergereicht. Ihr bevorzugter Lebensraum sind sonnige, feuchte bis nasse Wiesen. Gern wächst sie an Ackerrandstreifen.
Der Sturz der Himmelsfrau
Der Winter, wenn die grüne Erde unter einer Schneedecke zur Ruhe gebettet ist, ist die Zeit der Geschichten. Zu Beginn ruft der Erzähler diejenigen auf, die vor uns gegangen sind und die Geschichten an uns weitergegeben haben, denn wir sind nur Boten.
Am Anfang war die Himmelswelt.
Sie fiel kreiselnd wie ein Ahornsame vom Herbsthimmel.2 Durch ein Loch in der Himmelswelt ergoss sich eine Säule aus Licht und erleuchtete ihren Weg durch die Dunkelheit. Ihr Fall dauerte eine kleine Ewigkeit. Aus Angst, oder vielleicht aus Hoffnung, umklammerte sie ein Bündel in ihrer Hand.
Wie sie so abwärts trudelte, sah sie unten nur dunkles Wasser. Doch aus dieser Leere starrten viele Augen hinauf in den plötzlichen Lichtstrahl. Sie sahen etwas Kleines darin, ein Staubkorn in dem hellen Streifen. Als es näher kam, erkannten sie eine Frau, die Arme ausgebreitet, hinter ihr eine Fahne von langem schwarzem Haar, während sie auf sie zu kreiselte.
Die Gänse nickten einander zu und erhoben sich gemeinsam aus dem Wasser, in einer Welle von Gänsemusik. Sie spürte ihren Flügelschlag, als sie unter sie flogen, um sie aufzufangen. Weit weg von dem einzigen Zuhause, das sie je gekannt hatte, kam sie in der warmen Umarmung weicher Federn, die sie sachte nach unten trugen, wieder zu Atem. Und so fing alles an.
Die Gänse konnten die Frau nicht lange über dem Wasser halten und beriefen einen Rat ein, um zu beschließen, was zu tun war. Auf ihren Flügeln ruhend, sah sie, wie alle sich versammelten: Eistaucher, Otter, Schwäne, Biber, alle möglichen Fische. Da schwamm eine große Schildkröte in die Mitte und bot ihr ihren Rücken als Ruheplatz an. Dankbar trat sie von den Gänseflügeln auf die Kuppel des Schildkrötenpanzers. Die anderen begriffen, dass sie Land als Heimat brauchte, und berieten, wie sie sie dabei unterstützen könnten. Die Tieftaucher unter ihnen hatten sagen hören, am Grund des Wassers gebe es festen Schlamm, und erklärten sich bereit, davon zu holen.
Als Erster tauchte ein Eistaucher, aber es war zu weit, und nach einer langen Zeit kam er wieder herauf, ohne etwas mitgebracht zu haben. Einer nach dem anderen boten die anderen Tiere ihre Hilfe an – Otter, Biber, Stör –, aber Tiefe, Dunkelheit und Wasserdruck überforderten noch die kräftigsten Schwimmer unter ihnen. Keuchend kamen sie wieder, ihre Ohren brausten. Manche kamen auch gar nicht wieder. Bald war nur noch die kleine Bisamratte übrig, der schlechteste Taucher von allen. Unter den zweifelnden Blicken der anderen meldete sie sich zum Tauchgang. Ihre kleinen Beinchen ruderten wild, als sie sich in die Tiefe arbeitete, und sie blieb sehr lange fort.
Alle warteten und warteten auf seine Rückkehr. Manche fingen an, das Schlimmste für ihren Verwandten zu befürchten. Schließlich stieg ein Strom von Blasen herauf und trug Bisams kleinen, schlaffen Körper an die Wasseroberfläche. Er hatte sein Leben gegeben, um diesem unbeholfenen Menschen zu helfen. Doch da fiel den anderen auf, dass seine Pfoten etwas umklammerten, und als sie sie öffneten, lag darin eine kleine Handvoll Schlamm. Die Schildkröte sagte: »Hier, legt ihn auf meinen Rücken, ich trage ihn.«
Die Himmelsfrau beugte sich vor und verteilte den Schlamm mit den Händen auf dem Panzer der Schildkröte. Gerührt von den außerordentlichen Gaben der Tiere sang sie ein Dankeslied und begann zu tanzen, ihre Füße streichelten die Erde. Das Land wuchs und wuchs unter ihrem Dankestanz, von dem Klecks Schlamm auf dem Rücken der Schildkröte, bis die ganze Erde geboren war. Nicht von der Himmelsfrau alleine, sondern aus der Alchemie aller Gaben der Tiere, gepaart mit ihrer tiefen Dankbarkeit. Gemeinsam hatten sie geschaffen, was wir heute Turtle Island nennen, die »Schildkröteninsel«, unsere Heimat.
Als guter Gast war die Himmelsfrau nicht mit leeren Händen gekommen. Noch immer umklammerte ihre Hand das Bündel. Beim Sturz durch das Loch in der Himmelswelt hatte sie die Hand gereckt, um sich am Baum des Lebens festzuhalten, der dort wuchs. Dabei hatte sie Zweige, Früchte und Samen aller möglichen Pflanzen mitgenommen. Sie verstreute sie auf dem neuen Boden und umhegte jeden sorgsam, bis die Welt nicht mehr braun, sondern grün war. Durch das Loch aus der Himmelswelt ergoss sich Sonnenlicht und half den Samen beim Keimen. Überall sprossen Wildgräser, Blumen, Bäume und Heilkräuter. Und da jetzt auch die Tiere üppig zu fressen hatten, ließen sich viele von ihnen bei ihr auf der Schildkröteninsel nieder.
Nach unseren Geschichten war wiingaashk, Süßgras, die allererste Pflanze, die auf der Erde wuchs, und ihr Duft ist eine süße Erinnerung an die Hand der Himmelsfrau. Daher wird es als eine der vier heiligen Pflanzen meines Volks verehrt. Wer seinen Duft einatmet, dem fallen Dinge ein, von denen er nicht wusste, dass er sie vergessen hatte. Unsere Ältesten sagen, Zeremonien sind unsere Art, »uns ans Erinnern zu erinnern«; Süßgras ist darum eine kraftvolle zeremonielle Pflanze, die vielen indigenen Völkern sehr am Herzen liegt. Aber sie hat auch ihren praktischen Nutzen, aus ihr kann man wunderschöne Körbe flechten. Süßgras ist sowohl Heilkraut als auch eine Verwandte3 und hat dadurch sowohl einen spirituellen als auch einen praktischen Wert.
So viel Zärtlichkeit liegt darin, wenn wir einem geliebten Menschen die Haare flechten. Liebenswürdigkeit, Güte und noch mehr fließt zwischen der Flechtenden und derjenigen, deren Haar geflochten wird. Der Zopf verbindet sie miteinander. Wiingaashk wogt in Strähnen, lang und leuchtend wie frisch gewaschenes Frauenhaar. Und so sagen wir, es ist das fließende Haar von Mutter Erde. Wenn wir Süßgras flechten, flechten wir Mutter Erdes Haar, zeigen ihr unsere liebevolle Umsicht, unsere Sorgen um ihre Schönheit und ihr Wohlergehen, und unsere Dankbarkeit für alles, was sie uns gibt. Kinder, die die Geschichte von der Himmelsfrau von Geburt an hören, wissen bis tief ins Innerste um diese gegenseitigen Verpflichtungen zwischen Mensch und Erde.
Die Geschichte von der Himmelsfrau ist so reich und schillernd, dass sie sich für mich anfühlt wie eine unerschöpfliche Schale Himmelsblau. Sie umfasst unseren Glauben, unsere Geschichte, unsere Beziehungen. Wenn ich in diese gestirnte Schale blicke, sehe ich Bilder, die so geschmeidig ineinander wirbeln, dass Vergangenheit und Gegenwart eins werden. Die Bilder der Himmelsfrau sprechen nicht nur von unserer Herkunft, sondern auch davon, wie wir weitergehen können.
In meinem Labor hängt Bruce Kings Porträt der Himmelsfrau, Moment in Flight, an der Wand. Darauf gleitet sie auf den Flügeln der Gänse zur Erde, in ihrer Hand die Samen und Blumen. So blickt sie hinunter auf meine Mikroskope und Datenlogger. Es mag wie ein merkwürdiges Nebeneinander wirken, aber für mich gehört sie dorthin. Als Autorin, als Wissenschaftlerin und als Überbringerin der Geschichte von der Himmelsfrau sitze ich zu Füßen meiner älteren Lehrer und lausche ihren Liedern.
Montags, mittwochs und freitags um 9:35 Uhr sitze ich normalerweise in einem Hörsaal in der Universität und doziere über Botanik und Ökologie – kurz gesagt, ich versuche meinen Studierenden zu erklären, wie die Gärten der Himmelsfrau (manche nennen sie »globale Ökosysteme«) funktionieren. An einem ganz gewöhnlichen Morgen legte ich meinen Studierenden im Kurs Allgemeine Ökologie eine Umfrage vor. Unter anderem sollten sie die negativen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt bewerten. Fast alle zweihundert Studierenden erklärten mit größtem Selbstverständnis, Mensch und Natur passten schlecht zueinander. Es handelte sich um Studenten im 3.Studienjahr, die sich für eine Laufbahn im Umweltschutz entschieden hatten; damit war die Reaktion nicht sonderlich überraschend. Sie kannten sich aus mit der Mechanik des Klimawandels, der Vergiftung von Boden und Wasser, der Krise des Habitatverlusts. Später in der Umfrage sollten sie positive Wechselwirkungen zwischen Mensch und Land nennen. Die häufigste Antwort lautete »inexistent«.
Ich war verblüfft. Wie konnte es sein, dass sie sich nach zwanzig Jahren Ausbildung keinerlei positive Interaktion zwischen Mensch und Umwelt vorstellen konnten? Vielleicht hatten die negativen Beispiele, mit denen sie Tag für Tag zu tun haben – Industriebrachen, Massentierhaltung, Zersiedelung –, es ihnen unmöglich gemacht, zwischen Mensch und Erde irgendetwas Gutes zu sehen. Im selben Ausmaß, wie das Land verarmt war, hatte sich auch ihr Blickfeld verengt. Als wir nach dem Kurs darüber sprachen, merkte ich, dass sie sich nicht einmal vorstellen konnten, wie positive Beziehungen zwischen ihrer Art und anderen Lebewesen aussehen könnten. Wie können wir uns allmählich in Richtung ökologische und kulturelle Nachhaltigkeit bewegen, wenn wir uns nicht einmal vorstellen können, wie dieser Weg sich anfühlt? Wenn wir uns die Freigebigkeit der Gänse nicht vorstellen können? Mit der Geschichte der Himmelsfrau waren diese Studierenden jedenfalls nicht aufgewachsen.
Auf der einen Seite der Erde war die Beziehung der Menschen zur lebendigen Welt von der Himmelsfrau geprägt, die einen Garten für das Wohlergehen aller Lebewesen geschaffen hatte. Auf der anderen Seite gab es eine andere Frau mit einem Garten und einem Baum. Doch da sie von dessen Frucht gekostet hatte, wurde sie aus diesem Garten vertrieben, das Tor fiel krachend hinter ihr ins Schloss. Diese Mutter der Menschheit war dazu bestimmt, durch die Wildnis zu wandern und sich ihr Brot im Schweiße ihres Angesichts zu verdienen, nicht, indem sie ihren Mund mit den süßen, saftigen Früchten füllte, unter denen sich die Äste bogen. Sie wurde angewiesen, dass sie sich für ihr Essen die Wildnis, in die sie verbannt worden war, untertan machen sollte.
Dieselbe Art, dieselbe Erde, verschiedene Geschichten. Wie jede Schöpfungsgeschichte sind solche Kosmologien ein Quell für Identität und Orientierung gegenüber der Welt. Sie sagen uns, wer wir sind. Zwangsläufig sind wir von ihnen geprägt, egal, wie wenig präsent sie in unserem Bewusstsein sein mögen. Die eine Geschichte führt zur großzügigen Umarmung der lebendigen Welt, die andere zur Verbannung. Eine Frau ist unsere Gärtnerahnin, eine Mitschöpferin der guten grünen Welt, die ihren Nachkommen zur Heimat werden sollte. Die andere war eine Exilantin, die sich einen mühseligen Weg durch eine ihr fremde Welt bahnte, um zur wahren Heimat im Himmel zu gelangen.
Und dann begegneten sie sich – die Nachkommen der Himmelsfrau und die Kinder Evas –, und das Land um uns trägt die Narben dieser Begegnung, unsere Geschichten sind ihr Echo. Man sagt, die Hölle kennt keinen schlimmeren Zorn als den einer verhöhnten Frau, und so wird das Gespräch zwischen Eva und der Himmelsfrau wohl abgelaufen sein: »Schwester, du hast nun mal das kürzere Ende gezogen …«
Die Geschichte der Himmelsfrau, die allen indigenen Völkern im Gebiet um die Großen Seen gemeinsam ist, ist ein Fixstern in der Konstellation der Lehren, die wir Original Instructions oder Ursprüngliche Weisungen nennen. Allerdings sind das keine »Weisungen« im Sinne von Geboten oder Regeln; sie funktionieren eher wie ein Kompass: Sie bieten Orientierung, aber keine Landkarte; es ist unsere Aufgabe, diese durch unser Leben entstehen zu lassen. Was die Ursprünglichen Weisungen für unser Leben bedeuten, ist für jeden von uns und in jeder Epoche anders.
Zu ihrer Zeit lebten die ersten Völker der Himmelsfrau nach ihrem Verständnis der Ursprünglichen Weisungen: Für sie war es sinnvoll, Regeln zu haben, die die respektvolle Jagd, das Familienleben und die Zeremonien abdeckten. Ihre Maßstäbe des sorgsamen Umgangs scheinen nicht mehr zu unserer urbanen Welt von heute zu passen, wo »grün« ein Argument aus der Werbung ist und keine Wiese. Die Büffel sind verschwunden, die Welt hat sich weitergedreht. Ich kann den Fluss nicht wieder mit Lachs bevölkern, und meine Nachbarn würden Alarm schlagen, wenn ich Feuer an meinen Garten legen würde, um Weideflächen für Wapitis zu schaffen.
Damals, als die Erde den ersten Menschen willkommen hieß, war sie ganz neu. Jetzt ist sie alt, und manche fürchten, dass wir unser Gastrecht erschöpft haben, indem wir die Ursprünglichen Weisungen aus dem Blick verloren haben. Am Anfang der Welt waren die anderen Lebewesen ein Rettungsboot für die Menschen. Heute müssen wir ihres werden. Doch die Geschichten, die uns dabei Orientierung geben könnten, verblassen in unserer Erinnerung, wenn sie überhaupt noch erzählt werden. Was würden sie heute bedeuten? Wie können wir diese Geschichten vom Anfang der Welt in unsere Zeit übertragen, die ihrem Ende so viel näher ist? Die Landschaft hat sich verändert, aber die Geschichte bleibt. Und während ich immer wieder darüber nachdenke, scheint die Himmelsfrau mir in die Augen zu blicken und mich zu fragen, womit ich im Gegenzug sie beschenken werde, als Dank für ihre Gabe, für die Welt auf dem Rücken der Schildkröte.
Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass die erste Frau selbst eine Immigrantin war. Es war ein tiefer Sturz aus ihrer Heimat in der Himmelswelt, und sie ließ dort alle zurück, die sie kannten und liebten. Es gab keine Rückkehr. Seit 1492 sind die meisten Menschen in Amerika auch Immigranten, und als sie auf Ellis Island ankamen, ahnten sie wahrscheinlich nicht, dass unter ihren Füßen die Schildkröteninsel lag. Einige meiner Vorfahren gehören zum Volk der Himmelsfrau, und ich gehöre zu ihnen. Andere Vorfahren waren auch jüngere Immigranten: ein französischer Pelzhändler, ein irischer Zimmermann, ein walisischer Bauer. Und jetzt sind wir alle hier auf der Schildkröteninsel und versuchen, heimisch zu werden. Ihre Geschichten vom Ankommen mit leeren Taschen und nichts außer Hoffnung klingen so ähnlich wie die der Himmelsfrau. Nur mit einer Handvoll Samen und dem mageren Auftrag, »deine Gaben und Träume zum Guten zu nutzen« – derselbe Auftrag, den wir alle bekommen –, kam sie hier an. Sie nahm die Geschenke der anderen Lebewesen mit offenen Händen an und nutzte sie ehrenhaft. Die Gaben, die sie aus der Himmelswelt mitgebracht hatte, teilte sie mit allen, als sie sich selbst daran machte, hier heimisch zu werden.
Vielleicht hat die Geschichte der Himmelsfrau Bestand, weil auch wir ständig fallen. Unser Leben, das persönliche und das kollektive, folgt ihrer Bahn. Ob wir springen oder geschubst werden, oder ob der Rand der bekannten Welt zu unseren Füßen einfach zerbröckelt, wir fallen, kreiseln auf neue, unerwartete Orte zu. Und obwohl wir Angst haben vor dem Fallen, stehen die Geschenke der Welt bereit, uns aufzufangen.
Bei der Auslegung dieser Weisungen sollten wir auch bedenken, dass die Himmelsfrau damals nicht alleine kam. Sie war schwanger. Da sie wusste, dass einst ihre Enkel die Welt so erben würden, wie sie sie hinterließ, arbeitete sie nicht nur für ihr Gedeihen in ihrer eigenen Zeit. Die einstige Immigrantin wurde heimisch, indem sie mit dem Land in Austausch trat, indem sie gab und nahm. Für uns alle bedeutet Heimischwerden an einem Ort, dass wir so leben, als käme es auf die Zukunft unserer Kinder an, dass wir für das Land sorgen, als hinge daran unser materielles und spirituelles Leben.
Ich bekomme manchmal mit, wie die Geschichte von der Himmelsfrau als farbenreiche »Folklore« vor großem Publikum erzählt wird. Aber selbst wenn sie missverstanden wird, liegt in der Erzählung noch eine Kraft. Die meisten meiner Studierenden haben die Ursprungsgeschichte dieses Landes, in dem sie geboren sind, noch nie gehört, aber wenn ich sie ihnen erzähle, beginnt in ihren Augen etwas zu flackern. Können sie, können wir alle die Geschichte von der Himmelsfrau nicht als Artefakt aus der Vergangenheit, sondern als Lehre für die Zukunft verstehen? Kann ein Volk aus Immigranten noch einmal ihrem Beispiel folgen und indigen, also heimisch werden?
Sehen wir uns das Erbe Evas an, der Ärmsten, die aus dem Garten Eden vertrieben wurde: Das Land trägt die Wunden einer Missbrauchsbeziehung. Und zerbrochen ist dabei nicht nur das Land selbst, sondern vor allem auch unsere Beziehung zu ihm. Gary Nabhan schrieb einmal, wir können keinen sinnvollen Heilungsprozess, keine »restoration« erwirken, wenn wir nicht mit der »re-story-ation« anfangen – der »Rückvergeschichtung«. Das heißt, unsere Beziehung zum Land kann nicht gesunden, solange wir uns nicht seine Geschichten anhören. Aber wer soll sie uns erzählen?
In der westlichen Tradition gibt es eine anerkannte Hierarchie der Lebewesen, und natürlich steht ganz oben der Mensch – die Krone der Evolution, der Liebling der Schöpfung – und die Pflanzen ganz unten. In der indigenen Weisheit dagegen werden die Menschen oft als »kleine Brüder der Schöpfung« bezeichnet. Wir sagen, die Menschen haben am wenigsten Erfahrung mit dem Leben und müssen daher am meisten lernen – wir müssen uns nach den Lehrern unter den anderen Lebewesen umsehen und uns von ihnen leiten lassen. Ihre Weisheit zeigt sich in der Art, wie sie leben. Durch ihr Beispiel lernen wir. Sie sind schon länger auf der Erde als wir, sie hatten schon Zeit, zu verstehen. Sie leben über und unter dem Erdboden, verbinden die Himmelswelt mit der Erde. Die Pflanzen wissen, wie man aus Licht und Wasser Nahrung und Medizin macht, und dann geben sie sie weiter.
Ich stelle mir gerne vor, dass die Himmelsfrau beim Ausstreuen ihrer Handvoll Samen auf der Schildkröteninsel Nahrung für den Körper aussäte, aber auch für Vernunft, Gefühl und Geist: Sie hinterließ uns Lehrer. Die Pflanzen können uns die Geschichte der Himmelsfrau erzählen; wir müssen lernen, ihnen zuzuhören.
Der Rat der Pekannussbäume
Die Hitze flirrt über den Gräsern, die Luft ist schwer und weiß, erfüllt vom Gesang der Zikaden. Den ganzen Sommer über laufen sie schon barfuß, und trotzdem pieksen die trockenen Septemberstoppeln des Jahres 1895 ihre Fußsohlen, als sie durch die sonnenverbrannte Prärie laufen, die Füße erhoben wie beim Grass dance. Junge Weidenruten in verblichenen Jeans und sonst nichts, beim Laufen erkennt man ihre Rippen unter der schmalen, braunen Brust. Sie biegen zu dem schattigen Wäldchen ab, wo das Gras unter den Füßen weich und kühl ist, lassen sich mit ihrer schlaksigen Unbekümmertheit ins hohe Gras plumpsen. Ein bisschen ruhen sie im Schatten aus, dann springen sie auf die Füße und fangen mit der hohlen Hand Grashüpfer als Köder.
Die Angelruten stehen genau da, wo sie sie zurückgelassen haben, an einer alten Kanadischen Schwarzpappel. Sie stechen den Grashüpfern die Haken durch den Rücken und werfen die Leine aus, während der Schlick vom Bachbett kühl durch ihre Zehen quillt. Doch das Wasser bewegt sich kaum in dem kümmerlichen Rinnsal, das die Trockenheit hinterlassen hat. Nichts beißt an, nur ein paar Mücken. Bald sind die Aussichten auf eine Fischmahlzeit so dünn wie ihre Bäuche unter den verblichenen Jeans, die von einer Schnur zusammengehalten werden. Sieht aus, als gäbe es heute Abend wieder nur Zwieback und Tunke. Sie hassen es, mit leeren Händen heimzukommen und Mama zu enttäuschen, aber auch ein trockener Zwieback füllt schließlich den Magen.
Das Land hier am Canadian River mitten im Indianerterritorium4 ist eine hügelige Grassavanne mit Hainen in den Flussniederungen. Ein großer Teil davon wurde noch nie gepflügt, einfach, weil niemand einen Pflug hat. Die Jungen gehen flussaufwärts von Hain zu Hain in Richtung ihrer Parzelle, in der Hoffnung, irgendwo ein tiefes Becken zu finden, vergebens. Bis einer der Jungen mit dem Zeh an etwas Hartes, Rundes im Gras stößt.
Da ist eine, noch eine, und da noch eine – so viele, dass er kaum gehen kann. Er hebt eine harte grüne Kugel vom Boden auf und wirft sie durch die Bäume auf seinen Bruder wie einen Baseball, und dazu ruft er: »Piganek! Die nehmen wir mit!« Die Nüsse werden gerade erst reif, sie fallen und bedecken das Gras. Im Nu füllen die Jungen sich die Taschen und schichten noch einen großen Haufen auf. Pekannüsse sind gut zu essen, aber schwer zu tragen, als wollte man einen Scheffel Tennisbälle heben: Je mehr man nimmt, desto mehr liegen am Ende auf dem Boden. Sie hassen es, mit leeren Händen heimzukommen, und Mama würde sich so freuen – aber mehr als eine Handvoll kann man nicht tragen …
Die Hitze lässt ein wenig nach, als die Sonne tiefer sinkt und die Abendluft sich in der Senke breitmacht, kühl genug, dass sie zum Essen nach Hause rennen können. Mama ruft, und die Jungen kommen gelaufen, die mageren Beine pumpen mit letzter Kraft, ihre Unterhosen blitzen im verblassenden Licht weiß auf. Es sieht aus, als trügen sie jeder einen gegabelten Stamm, der ihnen wie ein Joch über den Schultern hängt. Mit triumphierendem Grinsen werfen sie sie ihr zu Füßen: zwei Paar abgetragene Hosen, an den Knöcheln mit Schnur zugebunden und prall gefüllt mit Nüssen.
Einer dieser mageren kleinen Jungen war mein Großvater, immer hungrig, um Essbares zu sammeln, wo immer er etwas fand. Zu Hause war er in einer Baracke in der Prärie von Oklahoma, als es noch »Indianerterritorium« war, kurz bevor alles weg war. Das Leben ist unvorhersehbar genug, aber noch weniger können wir beeinflussen, welche Geschichten über uns erzählt werden, wenn wir nicht mehr sind. Er würde sich scheckig lachen, wenn er erführe, dass seine Urenkel ihn nicht als dekorierten Veteran des Ersten Weltkriegs kennen, nicht als geschickten Mechaniker für neumodische Automobile, sondern als kleinen barfüßigen Jungen im Reservat, der in Unterhosen nach Hause rannte, die Hosen vollgestopft mit Pekannüssen.
Das Wort Pekan – die Frucht des Hickory- oder Pekannussbaumes (Carya illinoensis) – stammt aus den indigenen Sprachen. Pigan heißt Nuss, jede Nuss. Die Hickorys, Schwarznüsse und Butternüsse unserer nördlichen Heimat haben außerdem ihre eigenen Artennamen. Aber diese Bäume waren, wie unsere Heimat, für mein Volk verloren. Auf unser Land am Lake Michigan hatten die Siedler ihr Auge geworfen, und so wurden wir von Soldaten mit vorgehaltener Waffe den »Trail of Death«, den Weg des Todes, entlanggetrieben. Sie brachten uns an einen neuen Ort, weit weg von unseren Seen und Wäldern. Aber auch dieses Land erweckte jemandes Begehrlichkeit, also wurden wieder die Bündel aufgerollt, diesmal waren sie schon dünner. Innerhalb einer einzigen Generation wurden meine Vorfahren dreimal »umgesiedelt« – von Wisconsin nach Kansas, über weitere Zwischenstationen schließlich nach Oklahoma. Ob sie wohl über die Schulter einen letzten Blick auf die wie eine Fata Morgana glitzernden Seen zurückgeworfen haben? Haben sie die Bäume zum Andenken berührt, als sie immer seltener wurden, bis da nur noch Gras war?
So viel wurde auf diesem Weg verstreut, zurückgelassen. Gräber von der Hälfte der Menschen. Sprache. Wissen. Namen. Meine Urgroßmutter Sha-note, »Wind, der hindurchweht«, wurde Charlotte genannt. Namen, die die Soldaten oder die Missionare nicht aussprechen konnten, waren nicht erlaubt.
Als sie nach Kansas kamen, waren sie bestimmt erleichtert, entlang der Flüsse Haine mit Nussbäumen zu finden – Nüsse, die sie nicht kannten, die aber herrlich schmeckten und reichlich da waren. Da sie für diese neue Nahrung keinen Namen hatten, nannten sie sie einfach Nüsse – pigan –, was im Englischen zu pecan wurde.
Ich mache Pekannusskuchen nur zu Thanksgiving, wenn wir genügend Leute sind, um ihn aufzuessen. Besonders gern esse ich sie nämlich nicht, aber ich möchte diesen Baum ehren. Wenn ich seine Früchte den Gästen um den großen Tisch anbiete, erinnert mich das an den Willkommensgruß des Baums an unsere Vorfahren, als sie einsam und müde waren und so weit weg von zu Hause.
Zwar kamen die Jungen ohne Fische nach Hause, aber sie brachten fast so viel Eiweiß mit, als hätten sie ein paar Welse gefangen. Nüsse sind der Bratfisch der Wälder, voller Proteine und besonders voller Fette – »Arme-Leute-Essen«, und arm waren sie. Heute essen wir sie hübsch verpackt, auf Teig drapiert und gebacken, aber damals kochten sie sie zu Brei. Das Fett schwamm oben wie bei einer Hühnersuppe; sie schöpften es ab und lagerten es als Nussbutter ein: ein gutes Winteressen. Reich an Kalorien und Vitaminen – alles, was man braucht, um am Leben zu bleiben. Genau darum geht es ja auch bei Nüssen: dem Embryo alles zu liefern, was er braucht, um sein Leben zu beginnen.
Butternüsse, Schwarznüsse, Hickorys und Pekannüsse sind alle eng verwandte Mitglieder derselben Familie (Juglandaceae, Walnussgewächse). Unser Volk nahm sie mit, egal, wohin es zog, allerdings häufiger in Körben als in Hosen. Heute finden sich Pekannussbäume entlang der Flüsse der Prärie, sie haben die fruchtbaren Senken besiedelt, in denen die Menschen sich damals niederließen. Meine Nachbarn, Angehörige der Haudenosaunee, sagen, ihre Vorfahren liebten die Butternüsse so sehr, dass man an den Beständen heute gut erkennen kann, wo ihre Dörfer lagen. Und in der Tat steht in meinem Garten auf dem Hang oberhalb des Teichs ein Hain Butternussbäume, wie es ihn in »wilden« Wäldern nicht gibt. Jedes Jahr jäte ich rund um die jungen Pflanzen den Boden frei und gebe ihnen einen Eimer Wasser, wenn der Regen auf sich warten lässt. Zur Erinnerung.
Auf der Parzelle in Oklahoma steht heute ein Pekannussbaum, der die Überreste der alten Hütte beschattet. Ich stelle mir vor, wie Grammy Nüsse ausschüttet, um sie zu verarbeiten, und wie eine von ihnen wegrollt an eine günstige Stelle am Rand des Vorplatzes. Oder vielleicht bezahlte sie ihre Schuld an die Bäume, indem sie hin und wieder eine Handvoll Nüsse in ihren Garten pflanzte.
Wenn ich noch einmal an die alte Geschichte zurückdenke, fällt mir auf, wie schlau es von den Jungen im Pekannusshain war, so viele Nüsse heimzuschaffen, wie sie konnten: Nussbäume tragen nicht jedes Jahr, sondern häufig in unvorhersehbaren Abständen. Es gibt ein Auf und Ab mit vielen mageren Jahre und wenigen fetten, den sogenannten Mastjahren. Anders als etwa Steinfrüchte und Beeren, die uns einladen, sie auf der Stelle zu verzehren, bevor sie verderben, schützen Nüsse sich mit einer festen, fast steinharten Schale und einer grünen, ledrigen Hülle. Der Baum setzt nicht darauf, dass wir sie gleich wegfuttern, so dass der Brei uns vom Kinn tropft. Ihr Design bestimmt sie zum Winterfutter, wenn wir Fett und Proteine brauchen und viele Kalorien, um uns zu wärmen. Sie sind eine Reserve für schwere Zeiten, Embryo des Überlebens. Und der Lohn ist so reich, dass der Inhalt in einem Tresor geschützt ist, doppelt weggesperrt, eine Hülle in der Hülle. Das schützt den Embryo und seinen Nahrungsvorrat, aber gleichzeitig ist so dafür gesorgt, dass die Nuss von eifrigen Sammlern davongetragen und sicher eingelagert wird.
Der Weg durch die Schale ist ein hartes Stück Arbeit, und ein Eichhörnchen wäre schlecht beraten, sich zum Aufnage aufs offene Feld zu setzen, wo die Greifvögel lauern. Nüsse sind so gebaut, dass sie nach drinnen gebracht werden sollen, eingelagert für später im Bau eines Streifenhörnchens oder im Vorratskeller einer Hütte in Oklahoma. Wie bei allen gehorteten Vorräten geraten die einen oder anderen bestimmt in Vergessenheit – und schon ist ein Baum geboren.
Damit in den Mastjahren auch neue Wälder entstehen, muss jeder Baum Unmengen von Nüssen produzieren – so viele, dass diejenigen, die diese Samen gerne verzehren möchten, überfordert sind. Würde ein Baum sich jedes Jahr damit plagen, ein paar Nüsse hervorzubringen, würden diese sämtlich aufgefressen, und es gäbe keine neue Generation von Pekannussbäumen. Außerdem haben die Nüsse einen derart hohen Kaloriengehalt, dass die Bäume sich diesen Überfluss gar nicht jedes Jahr leisten können – sie müssen darauf sparen, wie eine Familie auf ein besonderes Ereignis spart. Mastbäume verbringen Jahre mit der Synthese von Zuckern, und statt sie nach und nach zu verbrauchen, stecken sie sie gleichsam unter die Matratze, bunkern also Kalorien in Form von Stärke in ihren Wurzeln. Erst als dort Überfluss herrschte, konnte mein Grandpa kiloweise Nüsse heimbringen.
Dieses zyklische Fruchten ist und bleibt eine Herausforderung für die Hypothesen von Baumphysiologen und Evolutionsbiologen. Waldökologen vermuten hinter dem Phänomen eine einfache energetische Gleichung: Du produzierst nur Früchte, wenn du es dir leisten kannst. Das leuchtet ein. Doch Wachstum und Kalorieneinlagerung verlaufen bei Bäumen je nach Standort in unterschiedlichem Tempo. Wie die Siedler, die das fruchtbare Ackerland bekamen, würden die glücklichen schnell reich werden und häufig Früchte tragen, während die im Schatten stehenden Nachbarn kämpfen müssten und nur selten Überfluss hätten; auf die Reproduktion müssten sie jahrelang warten. Wenn dem so wäre, würde jeder Baum in seinem eigenen Tempo Früchte tragen, und anhand seiner eingelagerten Stärkereserven wäre das auch vorhersagbar. Doch so ist es nicht. Wenn ein Baum Früchte trägt, dann tragen sie alle Früchte – es gibt keine Einzelgänger. Nicht ein Baum in der Gruppe, sondern die ganze Gruppe; nicht eine Gruppe im Wald, sondern alle Gruppen; alle im Umkreis und alle in der Region. Die Bäume handeln nicht als Individuen, sondern gewissermaßen als Kollektiv. Wie genau sie das anstellen, wissen wir noch nicht. Doch was wir hier sehen, ist die Macht der Einigkeit. Was einem passiert, passiert uns allen. Wir können zusammen hungern oder zusammen prassen. Alles Gedeihen beruht auf Gegenseitigkeit.
Im Sommer 1895 waren die Vorratslager überall im Indianerterritorium gefüllt mit Pekannüssen, so, wie die Mägen der Jungen und der Eichhörnchen. Für die Menschen war dieser plötzliche Überfluss wie ein Geschenk, eine Überfülle, die man einfach nur vom Boden aufzulesen brauchte – vorausgesetzt, man war schneller als die Eichhörnchen. Wenn nicht, würde es aber im nächsten Winter wenigstens viel Eichhörnchenragout geben. Die Pekanhaine geben immer wieder. So eine gemeinschaftliche Freigebigkeit mag mit dem Prozess der Evolution unvereinbar scheinen, denn da herrscht doch der Imperativ des individuellen Überlebens. Doch es wäre ein großer Fehler, wenn wir versuchen wollten, das individuelle Wohlbefinden von einem gesunden Ganzen zu trennen. Die Überfülle ihrer Früchte schenken die Pekannüsse auch sich selbst. Indem sie Eichhörnchen und Menschen sättigen, sichern sie auch ihr eigenes Überleben. Die Gene, die dazu beitragen, werden vom Fluss der Evolution in die nächsten Generationen mitgenommen, während die, die nicht teilhaben können, aufgegessen werden und in eine evolutionäre Sackgasse geraten. Genauso, wie Menschen, die an der Landschaft ablesen können, wo die Nüsse wachsen, und sie nach Hause in Sicherheit bringen, die Februarstürme überleben und dieses Verhalten an ihre Nachkommen weitergeben werden; nicht durch genetische Übertragung, sondern durch kulturelle Praxis.
Waldwissenschaftler beschreiben die Freigebigkeit der Mastbäume mit einer Hypothese über die Sättigung der Samenfresser. Demnach könnte die Geschichte so gehen: Wenn die Bäume mehr Samen produzieren, als die Eichhörnchen fressen können, überleben einige Nüsse. Und wenn die Eichhörnchen große Mengen Nüsse gehamstert haben, bekommen die trächtigen Eichhörnchenmamas mehr Babys pro Wurf, und ihre Population geht durch die Decke. Was wiederum dazu führt, dass die Greifvögel mehr Junge großziehen, und auch die Fuchsbauten füllen sich. Doch im nächsten Herbst sind die fetten Zeiten vorüber, weil die Bäume die Samenproduktion wieder heruntergefahren haben. Für die Eichhörnchen gibt es jetzt wenig zu hamstern – sie kommen mit leeren Händen nach Hause –, also ziehen sie wieder los, suchen immer weiter, und setzen sich damit noch mehr der angewachsenen Population aufmerksamer Greifvogel und hungriger Füchse aus. Das Verhältnis von Räuber zu Beute steht zu ihren Ungunsten, und durch Hunger und Raub bricht die Eichhörnchenpopulation ein, es wird still im Wald ohne ihre Geschäftigkeit. Man kann sich vorstellen, wie die Bäume jetzt einander zuflüstern: »Es sind nur noch ganz wenige Eichhörnchen übrig. Wäre das nicht ein guter Zeitpunkt zum Nüssemachen?« Da sprießen überall im Land die Pekanblüten und schicken sich an, für die nächste Rekordernte zu sorgen. Gemeinsam überleben die Bäume und gedeihen.
Die sogenannte Indianer-Umsiedlungspolitik5 der US-Regierung riss viele indigene Völker aus ihrer jeweiligen Heimat. Sie trennte uns von unserem traditionellen Wissen und unserer Lebensart, von den Gebeinen unserer Vorfahren, unseren Nahrungspflanzen – doch nicht einmal das zerstörte unsere Identität. Da versuchte die Regierung es noch einmal anders und trennte die Kinder von ihren Familien und Kulturen, schickte sie weit weg zur Schule, so weit, hofften sie, dass sie vergaßen, wer sie waren.
Überall im Indianerterritorium gab es Listen von sogenannten Indianeragenten, denen Kopfgeld gezahlt wurde für jedes Kind, das sie in die öffentlichen Internate schickten. Später taten sie, als hätten die Eltern die Wahl, und ließen sie Papiere unterschreiben, laut derer sie ihre Kinder »legal« ziehen ließen. Eltern, die das verweigerten, konnten dafür ins Gefängnis kommen. Einige hofften vielleicht, ihre Kinder bekämen so eine bessere Zukunft als eine karge Farm im staubtrockenen Land. Manchmal wurden Nahrungszuteilungen des Staates – Mehl voller Käfer und ranziger Speck, die den Büffel ersetzen sollten – zurückgehalten, bis die Kinder abgegeben waren. Vielleicht war es ein gutes Pekannussjahr, dann hielten sie die Agenten ein Jahr länger hin. Die Androhung, fortgeschickt zu werden, konnte einen kleinen Jungen bestimmt dazu bringen, seine Hosen mit Essen vollzustopfen und halb nackt nach Hause zu laufen. Und in einem schlechten Pekannussjahr kam der Indianeragent dann wieder und suchte nach mageren braungebrannten Jungs, die keine Aussicht auf ein Abendessen hatten – vielleicht war das das Jahr, in dem Grammy die Papiere unterschrieb.
Kinder, Sprache, Land: Fast alles wurde ihnen genommen, gestohlen, als sie gerade nicht hinsahen, weil sie mit dem Überleben beschäftigt waren. Nach all diesen Verlusten gab es aber immer noch etwas, was unser Volk nicht aufgegeben hatte: die Bedeutung des Landes. Für den Siedler bedeutete Land Eigentum, Immobilie, Kapital oder Bodenschätze. Für unser Volk dagegen war Land alles: Identität, Verbindung zu unseren Vorfahren, Heimat unserer nichtmenschlichen Verwandten, Apotheke, Bibliothek, Quelle von allem, was uns am Leben hielt. Unser Land war, wo unsere Verantwortung gegenüber der Welt verankert war, heiliger Boden. Es gehörte sich selbst; es war ein Geschenk, keine Ware, und niemand konnte es kaufen oder verkaufen. Und diese Bedeutung nahmen die Menschen mit, als sie aus ihrer alten Heimat an neue Orte vertrieben wurden. Ob es ihre Heimat war oder das neue Land, das ihnen aufgezwungen wurde, ihr gemeinsames Land gab den Menschen Kraft; es gab ihnen etwas, wofür sie kämpfen konnten. Und dieser Glaube war in den Augen der Regierung eine Bedrohung.
Nach Zwangsumsiedlungen durchs ganze Land, nach all den Verlusten und schließlich der Ansiedelung in Kansas kam die Regierung noch einmal zu meinem Volk und bot eine weitere Umsiedlung an, diesmal an einen Ort, der für immer ihnen gehören sollte, eine allerletzte Umsiedlung. Mehr noch: Den Menschen wurde angeboten, Bürger der Vereinigten Staaten zu werden, teilzuhaben an dem großartigen Land, das sie umgab, und von seiner Macht geschützt zu werden. Unsere Anführer, unter ihnen der Großvater meines Großvaters, überlegten, berieten, schickten zur Prüfung Delegationen nach Washington. Die Verfassung der Vereinigten Staaten war offenbar nicht imstande, die Heimat der indigenen Völker zu schützen. Die Vertreibungen hatten das überdeutlich klar gemacht. Das Eigentumsrecht von Bürgern, die individuelle Landbesitzer waren, schützte die Verfassung dagegen ganz explizit. Vielleicht war das der Weg zu einer dauerhaften Heimat für die Menschen.
Den Anführern wurde der Amerikanische Traum angeboten, das Recht, ihr Eigentum als Individuen zu besitzen, unbehelligt von den Launen einer unsteten Indianerpolitik6. Nie wieder würden sie von ihrem Land vertrieben werden. Nie wieder sollte es Gräber an einer staubigen Straße geben. Dazu brauchten sie nur den Gemeinschaftsbesitz an ihrem Land aufzugeben und sich zum Privateigentum zu bekennen. Schweren Herzens hielten sie den ganzen Sommer über Rat, rangen um eine Entscheidung, wägten die – wenigen – Optionen ab. Familien standen gegen Familien. Sollten sie in Kansas auf gemeinschaftlichem Land bleiben und das Risiko eingehen, es irgendwann ganz zu verlieren, oder als individuelle Landbesitzer mit gesetzlicher Garantie ins Indianerterritorium gehen? Der historische Rat tagte den ganzen heißen Sommer über an einem schattigen Ort, der als Pecan Grove bekannt wurde.
Wir wussten schon immer, dass Pflanzen und Tiere ihren eigenen Rat abhalten und eine gemeinsame Sprache sprechen. Besonders die Bäume sind unsere Lehrer. Doch offenbar hörte in jenem Sommer niemand hin, als die Pekanbäume rieten: Haltet zusammen, handelt gemeinsam, als ob ihr ein Mann wärt. Wir Pekannüsse haben gelernt, dass in der Einheit Kraft liegt, dass das einsame Individuum so leicht umgerissen wird wie der Baum, der außerhalb der Saison Frucht getragen hat. Die Lehren der Pekanbäume wurden nicht gehört, oder jedenfalls nicht beachtet.
Und so packten unsere Familien wieder einmal zusammen und zogen westlich ins Indianerterritorium, ins versprochene Land, und wurden zur Citizen Potawatomi Band. Müde und verstaubt, aber voller Hoffnung für ihre Zukunft, fanden sie an ihrem ersten Abend im neuen Land einen alten Freund vor: einen Pekannusshain. Sie zogen ihre Wagen unter seine schützenden Äste und begannen von vorn. Jedes Mitglied des Stamms, auch mein Großvater, ein Wickelkind, bekam eine Parzelle Land zugewiesen, das die Bundesregierung für ausreichend hielt, um darauf als Farmer seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Durch die Annahme der Staatsbürgerschaft stellten sie sicher, dass diese Parzellen ihnen nicht mehr genommen werden konnten. Außer natürlich, ein Bürger konnte seine Steuern nicht bezahlen. Oder ein Rancher bot ein Fässchen Whisky und viel Geld, »fair und klar«. Die nicht zugewiesenen Parzellen schnappten sich nicht-indigene Siedler wie hungrige Eichhörnchen die Pekannüsse. In der Zeit der Landzuweisung gingen mehr als zwei Drittel des Landes in den Reservaten verloren. Knapp eine Generation, nachdem das Land »garantiert« worden war, indem man das Gemeinschaftsgut dem Privatbesitz opferte, war das meiste davon verloren.
Die Pekannussbäume und ihre Verwandten besitzen eine Fähigkeit zum konzertierten Handeln, für ein gemeinsames Ziel, das über den individuellen Baum hinausgeht. Irgendwie sorgen sie dafür, dass alle zusammenhalten und so überleben. Wie sie das anstellen, ist immer noch schwer zu fassen. Einige Daten weisen darauf hin, dass die Fruktifikation durch bestimmte Umweltreize ausgelöst wird, etwa einen besonders nassen Frühling oder eine lange Wachstumssaison. Dank dieser günstigen physikalischen Bedingungen können alle Bäume einen Energieüberschuss anlegen, den sie in die Nüsse stecken können. Doch angesichts der großen Unterschiede zwischen den einzelnen Standorten ist es unwahrscheinlich, dass Umweltreize alleine diese Synchronizität bewirken können.
In alten Zeiten, so erzählen unsere Ältesten, sprachen die Bäume miteinander. Sie hielten ihren eigenen Rat und arbeiteten einen Plan aus. Doch vor langer Zeit beschloss die Wissenschaft, dass Pflanzen taub und stumm sind, dass sie ohne Kommunikation isoliert voneinander leben. Die Möglichkeit eines Gesprächs wurde summarisch abgetan. Die Wissenschaft versteht sich als rein rational, vollständig neutral, ein System der Wissensgenerierung, in dem die Beobachtung unabhängig vom Beobachter ist. Und doch kam man zu dem Schluss, dass Pflanzen nicht kommunizieren können, weil ihnen die Mechanismen fehlen, mit denen Tiere kommunizieren. Das Potenzial der Pflanzen wurde ausschließlich durch die Brille der tierischen Fähigkeiten beurteilt. Bis vor Kurzem ging niemand ernsthaft der Frage nach, ob Pflanzen vielleicht doch miteinander »sprechen«. Doch seit Ewigkeiten wird zuverlässig Pollen mit dem Wind transportiert, von den männlichen Bäumen entsandt an die weiblichen Empfängerinnen, damit die Nüsse wachsen. Wenn man dem Wind die Verantwortung für die Befruchtung anvertrauen kann, warum dann nicht auch Botschaften?
Heute gibt es stichhaltige Beweise dafür, dass unsere Ältesten recht hatten – Bäume sprechen tatsächlich miteinander. Sie kommunizieren über Pheromone; das sind hormonähnliche Verbindungen, die mit dem Wind übertragen werden und Bedeutung transportieren. Forscher haben etwa bestimmte Verbindungen identifiziert, die ein Baum freisetzt, wenn er von einem Insektenbefall gestresst ist – Schwammspinnerraupen, die sich an seinen Blättern satt fressen, oder Borkenkäfer unter seiner Haut. Der Baum setzt einen Notruf ab: »Hallo, ihr da drüben? Ich bin hier einem Angriff ausgesetzt. Ihr solltet besser die Zugbrücke hochziehen und euch wappnen für das, was auf euch zukommt.« Die Bäume, die windabwärts stehen, fangen die Botschaft ein, den Geruch der Gefahr. Damit haben sie Zeit, Defensivstoffe herzustellen. Gewarnt ist gewappnet. Die Bäume warnen einander, und die Invasoren werden abgewehrt. Davon profitiert das Individuum, und damit auch der ganze Wald. Offenbar besprechen Bäume die gemeinsame Verteidigung. Sprechen sie sich womöglich auch ab, um das Mastjahr zu synchronisieren? Es gibt so vieles, was wir mit unseren begrenzten menschlichen Fähigkeiten noch nicht wahrnehmen können. Gespräche unter Bäumen übersteigen unsere Vorstellungskraft noch bei Weitem.
Einige Studien zu Mastbäumen deuten darauf hin, dass der Mechanismus für die Synchronisierung nicht über die Luft läuft, sondern durch den Boden. Bäume in einem Wald sind häufig durch unterirdische Netzwerke verbunden, die sogenannte Mykorrhiza, also Pilzfasern an den Feinwurzeln der Bäume. In dieser Symbiose nehmen die Pilze mineralische Nährstoffe aus dem Boden auf und geben sie an den Baum ab; dafür erhalten sie Kohlenhydrate. Diese Mykorrhizae bilden mit ihren Pilzgeflechten möglicherweise Brücken zwischen individuellen Bäumen, so dass alle Bäume in einem Wald miteinander in Verbindung stehen. Und über diese Pilznetzwerke werden nun offenbar Kohlenhydratvorräte von Baum zu Baum umverteilt. Im Stil von Robin Hood wird von den Reichen genommen und den Armen gegeben, und am Ende erreichen alle Bäume zum selben Zeitpunkt denselben Kohlenhydrat-Überschuss. Sie weben ein Netz der Reziprozität, ein Netz von Geben und Nehmen. Damit verhalten sich alle Bäume wie einer, weil die Pilze sie miteinander vernetzt haben. Durch Einigkeit zum Überleben. Alles Gedeihen ist gegenseitig. Boden, Pilz, Baum, Eichhörnchen, Junge – alle profitieren von diesem Austausch.
Freigebig überschütten sie uns mit Nahrung, buchstäblich geben sie sich selbst hin, damit wir leben können. Doch im Geben sichern sie auch ihr eigenes Überleben. Unser Nehmen kommt ihnen im zyklischen Erschaffen des Lebens wieder zugute. Nach den Geboten der Ehrenhaften Ernte zu leben – also nur zu nehmen, was uns geschenkt wird, es gut zu nutzen, für das Geschenk dankbar zu sein und etwas zurückzugeben: in einem Pekanhain ist das einfach. Wir geben etwas zurück, indem wir den Hain pflegen, ihn vor Schaden schützen, Samen pflanzen, damit neue Haine die Prärie beschatten und die Eichhörnchen ernähren.
Heute, zwei Generationen später, nach der Umsiedlung, nach der Flächenzuweisung, nach den Internaten und der Diaspora, kehrt meine Familie zurück nach Oklahoma, zurück zu dem, was von der Parzelle meines Großvaters übrig geblieben ist. Vom Gipfel des Hügels aus kann man am Fluss entlang immer noch Pekanhaine sehen. Nachts tanzen wir auf den alten Powwow-Plätzen. Die uralten Zeremonien grüßen den Sonnenaufgang. Der Geruch nach Maissuppe und das Schlagen der Trommeln hängen in der Luft, als die neun Volksgruppen der Potawatomi, die durch die Vertreibung über das ganze Land verstreut wurden, für ein paar Tage im Jahr wieder zusammenkommen, um nach Zugehörigkeit zu suchen. Das Potawatomi Gathering of Nations, das Treffen der Potawatomi-Nationen, vereint das Volk, es ist ein Gegengift gegen die Teile-und-Herrsche-Strategie, die eingesetzt wurde, um unser Volk zu zersplittern und von seiner Heimat zu trennen. Synchronisiert wird unsere Zusammenkunft von unseren Anführern, aber wichtiger noch: Uns vereint etwas wie ein Mykorrhiza-Netzwerk, eine unsichtbare Verbindung von Geschichte, Familie und Verantwortung gegenüber unseren Vorfahren wie unseren Kindern. Als Nation fangen wir an, dem Rat unserer Ältesten, der Pekanbäume, zu folgen, indem wir zusammenhalten, zum Nutzen aller. Wir erinnern uns, was sie sagten: Alles Gedeihen ist gegenseitig.
Es ist ein Mastjahr für meine Familie; wir sind alle hier bei der Zusammenkunft, dicht an dicht lagern wir auf dem Boden, wie Samen für die Zukunft. Wie ein Embryo, der mit seinen Vorräten geschützt ist in Schichten von steinharten Schalen, haben wir die mageren Jahre überlebt und blühen nun gemeinsam. Ich schlendere in den Pekanwald, vielleicht genau an den Ort, wo mein Großvater einst seine Hosenbeine vollstopfte. Er würde staunen, uns alle hier anzutreffen, wie wir den Kreistanz tanzen und uns an die Pekannüsse erinnern.
Das Geschenk der Erdbeeren
Einmal hörte ich, wie sich Evon Peter – ein Angehöriger der Gwich’in, Vater, Ehemann, Umweltaktivist und Häuptling von Arctic Village, einem kleinen Dorf im Nordosten Alaskas –, jemandem als »Junge, der an einem Fluss aufgewachsen ist« vorstellte. Die Formulierung ist glatt und rutschig wie ein Flusskiesel. Meinte er einfach nur, dass er in der Nähe seiner Ufer aufgewachsen war? Oder meinte er die Obhut des Flusses, hatte der Fluss ihn wachsen lassen, ihm beigebracht, was er fürs Leben brauchte? Aufgewachsen an einem Fluss: Ich vermute, beides stimmt – das eine geht kaum ohne das andere.
Ich wuchs bei und mit den Erdbeeren auf, mit ganzen Feldern davon. Nichts gegen die Ahorne, Hemlocktannen, Weymouth-Kiefern, Goldruten, Astern, Veilchen und Moose im Hinterland des Bundesstaates New York, aber mein Gefühl für die Welt und meinen Platz in ihr gaben mir die winzigen Scharlach-Erdbeeren,7 die ich unter taunassen Blättern an Frühsommermorgen entdeckte. Hinter unserem Haus erstreckten sich, unterteilt durch Steinwälle, meilenweit alte Heuwiesen, die längst nicht mehr bewirtschaftet wurden, aber noch nicht zu Wäldern verbuscht waren. Wenn der Schulbus unseren Hügel hinaufgetuckert war, warf ich meinen rot karierten Schulranzen in die Ecke, zog mich um, bevor meiner Mutter einfiel, was ich erledigen sollte, und sprang über den Bach, um bei den Goldruten spazieren zu gehen. Unsere mentalen Landkarten enthielten alle Orientierungspunkte, die wir Kinder brauchten: das Fort unter dem Essigbaum, den Steinhaufen, den Fluss, die große Kiefer, deren Äste in so gleichmäßigen Abständen wuchsen, dass man bis in ihren Wipfel klettern konnte wie auf einer Leiter – und die Erdbeerplätze.
Im Mai, im Blütenmond, dem waabigwani-giizis, besprenkelten ihre weißen Blütenblätter mit gelber Mitte – wie eine kleine Wildrose – all das krause Gras. Wir merkten uns gut, wo sie standen, spähten auf dem Weg zum Fröschefangen regelmäßig unter die dreiteiligen Blätter, um zu prüfen, wie weit sie waren. Nachdem die Blüte endlich ihre Kronblätter abgeworfen hatte, erschien stattdessen ein winziger grüner Knubbel, und als die Tage länger und wärmer wurden, schwoll er zu einer kleinen weißlichen Beere an. Egal, wie sauer sie waren, wir aßen sie trotzdem, zu ungeduldig für das eigentliche Erlebnis.
Reife Erdbeeren roch man, bevor man sie sah, ihr Duft vermischte sich mit dem Geruch von Sonne auf feuchtem Boden. So roch der Juni, der letzte Schultag, wenn wir frei bekamen, und der Erdbeermond, ode’mini-giizis. Ich lag auf dem Bauch an meinen Lieblingsstellen, sah zu, wie die Beeren unter den Blättern süßer und größer wurden. Jede winzige wilde Beere war kaum größer als ein Regentropfen, die Samen in kleinen Grübchen unter der Blätterkappe. Von diesem Blickwinkel aus konnte ich nur die allerrötesten pflücken und die hellroten für morgen stehen lassen.
Noch heute, über fünfzig Erdbeermonde später, bin ich gerührt und überrascht, wenn ich eine Stelle mit Scharlach-Erdbeeren finde. Mich überkommt ein Gefühl von Unverdientheit und Dankbarkeit für die Freigebigkeit und Freundlichkeit, die in diesem unerwarteten Geschenk in rot-grüner Verpackung stecken. »Wirklich? Für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen.« Nach fünfzig Jahren werfen sie bei mir immer noch die Frage auf, wie ich auf ihre Freigebigkeit reagieren soll. Manchmal fühlt sich das nach einer dummen Frage an, mit einer ganz einfachen Antwort: Iss sie auf.
Aber ich weiß, dass andere sich das auch schon gefragt haben. In unseren Schöpfungsgeschichten spielt die Herkunft der Erdbeeren eine wichtige Rolle. Die hübsche Tochter der Himmelsfrau, die sie aus der Himmelswelt in ihrem Bauch mitbrachte, wuchs auf der guten grünen Erde auf, voller Liebe und geliebt von allen anderen Wesen. Doch es kam zu einer Tragödie, denn sie starb bei der Geburt ihrer Zwillinge, Flint (Feuerstein) und Sapling (Bäumchen). Mit gebrochenem Herzen begrub die Himmelsfrau ihre geliebte Tochter im Boden. Ihr letztes Geschenk, unsere am meisten verehrte Pflanze, wuchs aus ihrem Leib. Die Erdbeere spross aus ihrem Herzen. Auf Potawatomi heißt die Erdbeere ode min, Herzbeere. Für uns ist sie die Anführerin der Beeren, die erste, die Frucht trägt.
Die Erdbeeren waren diejenigen, die mir das Gefühl gaben, dass die Welt voller Geschenke sei, die alle zu unseren Füßen lägen. Ein Geschenk erhält man ohne eigenes Zutun, umsonst, es kommt zu uns, ohne dass wir darum gebettelt haben. Es ist keine Vergütung; kein Lohn für Arbeit, kein eingelöster Anspruch, auch kein moralischer Verdienst. Und doch ist es da. Wir müssen nur die Augen offen halten und wach sein. Geschenke gehören ins Reich der Bescheidenheit und des Geheimnisses – wie bei zufälligen Freundlichkeiten wissen wir nicht, woher sie kommen.
Die Felder meiner Kindheit überschütteten uns mit Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, herbstlichen Pekannüssen, Sträußen von Wildblumen für meine Mutter, und boten sonntägliche Familienausflügen. Sie waren unser Spielgelände, Rückzug, Naturtempel, unser ökologisches Klassenzimmer und der Ort, wo wir lernten, Konservendosen vom Steinwall zu schießen. Alles umsonst. Zumindest dachte ich das.
Damals erlebte ich die Welt als Schenkökonomie, in der »Güter und Dienstleistungen« nicht erworben, sondern als Geschenk von der Erde empfangen wurden. Zum Glück war mir nicht bewusst, wie meine Eltern kämpfen mussten, um in der Lohnwirtschaft über die Runden zu kommen, die fernab von diesem Feld wütete.
In unserer Familie war das, was wir einander schenkten, fast immer selbst gemacht. Für mich war das sogar die Definition eines Geschenks: etwas, was man für jemand anderen machte. All unsere Weihnachtsgeschenke bastelten wir selbst: Sparschweine aus leeren Putzmittelflaschen, Topfuntersetzer aus kaputten Wäscheklammern, und Püppchen aus pensionierten Strümpfen. Meiner Mutter zufolge machten wir das, weil wir kein Geld für gekaufte Geschenke hatten. Für mich war es keine Entbehrung; es war etwas Besonderes.
Mein Vater liebte wilde Erdbeeren, weshalb meine Mutter ihm zum Vatertag fast immer einen Erdbeerkuchen machte. Sie buk den knusprigen Tortenboden und schlug die schwere Sahnecreme, aber wir Kinder waren für die Beeren verantwortlich. Jeder bekam ein oder zwei alte Marmeladengläser und verbrachte den Samstag vor dem Fest draußen in den Feldern, und es dauerte ewig, bis wir sie voll hatten, weil immer mehr Beeren in unseren Mündern landeten. Schließlich kamen wir heim und kippten sie auf dem Küchentisch aus, um die mitgebrachten Käfer herauszulesen. Bestimmt übersahen wir auch welche, aber Dad gab zu der Extraportion Protein nie einen Kommentar ab.
Für ihn war Erdbeerkuchen das bestmögliche Geschenk, zumindest vermittelte er uns das. Es war ein Geschenk, das man niemals kaufen konnte. Als Kinder, die bei Erdbeeren aufwuchsen, war uns wahrscheinlich nicht klar, dass die Beerengabe vom Feld selbst kam, nicht von uns. Unser Geschenk waren Zeit und Aufmerksamkeit und Fürsorge und rot verklebte Finger. Herzbeeren, ja.
Geschenke der Erde oder von jemand anderem begründen eine besondere Beziehung, eine Art Pflicht zum Geben, Empfangen, und zum Erwidern. Das Feld beschenkte uns, wir beschenkten Dad, und wir versuchten, wiederum die Erdbeeren zu beschenken. Wenn die Beerenzeit vorbei war, bildeten die Pflanzen schlanke Ausläufer aus, um neue Pflanzen wachsen zu lassen. Mich faszinierte, wie sie über den Boden krochen und nach der richtigen Stelle zum Wurzelschlagen suchten, und so jätete ich kleine Stellen frei, wo die Ausläufer den Boden berührten. Bald würde der Ausläufer kleine Wurzeln austreiben, und im Herbst würde es dann noch mehr Pflanzen geben, die im nächsten Erdbeermond blühen würden. Das brachte uns niemand bei – die Erdbeeren zeigten es uns selbst. Weil sie uns ein Geschenk gemacht hatten, entstand zwischen uns eine anhaltende Beziehung.
Die Farmer in unserer Gegend bauten massenweise Erdbeeren an und heuerten häufig Kinder an, um diese für sie zu pflücken. Meine Geschwister und ich radelten die lange Strecke zur Farm der Crandalls, um uns mit Erdbeerpflücken ein Taschengeld zu verdienen. Einen Zehner für jedes Kilo. Doch Mrs. Crandall war eine pingelige Chefin. Sie stand in ihrer Kittelschürze am Feldrand und gab uns Anweisungen, wie wir pflücken sollten und dass wir ja keine Beeren zertreten sollten. Und sie hatte noch andere Regeln. »Diese Beeren gehören mir«, sagte sie, »nicht euch. Ich will keinen erwischen, wie er meine Beeren isst.« Ich kannte den Unterschied: Auf den Feldern hinter unserem Haus gehörten die Beeren sich selbst. An ihrem Stand am Straßenrand verkaufte diese Dame sie für sechzig Cent das Kilo.
Das war eine echte Lektion in Sachen Ökonomie. Wir mussten einen Großteil unseres Lohns ausgeben, wenn wir in unseren Fahrradkörben Beeren nach Hause fahren wollten. Natürlich waren diese Beeren zehnmal so groß wie unsere wilden, aber nicht annähernd so gut. Ich glaube nicht, dass wir die Plantagenerdbeeren je für Dads Kuchen verwendet haben. Es hätte sich einfach nicht richtig angefühlt.
Es ist merkwürdig, wie sehr sich ein Gegenstand – zum Beispiel eine Erdbeere oder ein Paar Socken – verändert, je nachdem, wie er in unsere Hände kommt, als Geschenk oder als Ware. Das Paar Wollsocken, das ich im Laden kaufe, rot-grau geringelt, ist warm und gemütlich. Vielleicht bin ich dem Schaf dankbar, das die Wolle gemacht hat, und der Arbeiterin an der Strickmaschine. Hoffentlich. Aber eine inhärente Verpflichtung gegenüber diesen Socken als Ware, als Privatbesitz, habe ich nicht. Es gibt keine Bindung außer dem höflich ausgetauschten »Dankeschön« mit der Verkäuferin. Ich habe sie bezahlt, und unser Austausch war in dem Moment zu Ende, als ich ihr das Geld gereicht habe. Der Tausch endet mit der Herstellung der Parität, dem Ausgleich. Die Socken werden mein Eigentum. Ich schreibe keinen Dankesbrief an das Kaufhaus.
Was aber, wenn genau diese rot-grau geringelten Socken meine Großmutter gestrickt und mir geschenkt hat? Das ändert alles. Ein Geschenk begründet eine andauernde Beziehung. Ich schreibe einen Dankesbrief. Ich passe gut auf sie auf, und wenn ich eine sehr liebe Enkelin bin, trage ich sie, wenn sie zu Besuch kommt, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht mag. An ihrem Geburtstag mache ich ihr sicher auch ein Geschenk. Der Wissenschaftler und Autor Lewis Hyde schreibt dazu: »Der Hauptunterschied zwischen Geschenk und Warenaustausch besteht darin, dass ein Geschenk eine emotionale Bindung zwischen zwei Menschen herstellt.«
Auf Walderdbeeren passt die Definition eines Geschenks, aber auf Erdbeeren aus dem Laden nicht. Den großen Unterschied macht die Beziehung zwischen Produzent und Verbraucher. Als jemand, der in Geschenken denkt, wäre ich schwer beleidigt, wenn ich wilde Erdbeeren im Laden liegen sähe. Ich würde sie sofort alle kidnappen wollen. Sie sollen nicht verkauft werden, nur verschenkt. Hyde erinnert uns daran, dass freiwillig gemachte Geschenke in einer Schenkökonomie nicht ins Kapital eines anderen übergehen können. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir: »Frau wegen Obstdiebstahls verhaftet. Bekennerschreiben der Erdbeerbefreiungsfront.«
Genau aus demselben Grund verkaufen wir kein Süßgras. Weil es uns geschenkt wird, sollte es auch anderen nur geschenkt werden. Mein lieber Freund Wally »Bear« Meshigaud war ein zeremonieller Feuerhüter unseres Volks und verbrauchte für unsere Rituale sehr viel Süßgras. Etliche Leute pflückten es auf eine gute Art und Weise für ihn, damit er immer genug auf Vorrat hatte, aber trotzdem ging es ihm bei großen Zusammenkünften manchmal aus. Bei Powwows und auf Märkten kann man erleben, wie unsere Leute für zehn Dollar den Zopf Süßgras verkaufen. Wenn Wally für eine Zeremonie dringend wiingashk brauchte, ging er manchmal zu einem dieser Stände zwischen den Buden mit frittiertem Brot oder Perlenschmuck. Er stellte sich dem Verkäufer vor, erklärte, was er brauchte, so, wie er auch auf einer Wiese das Süßgras um Erlaubnis gebeten hätte. Er konnte