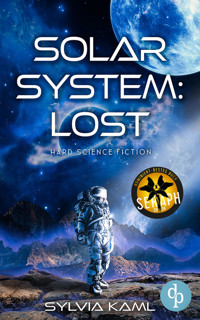5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Weltenbaum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Clara wächst als Tochter einer Baronin wohlhabend und behütet im städtischen Ruhrgebiet auf. Doch ihre heile Welt zerbricht jäh, als ihre Familie von Unbekannten überfallen und ermordet wird. In letzter Sekunde rettet ein seltsamer Hund mit mechanischen Beinen Claras Leben und führt sie in die Sicherheit eines abgelegenen Landes, fernab moderner Technologie. Hier muss Clara ihre Herkunft verbergen und sich dem einfachen Leben anpassen. Doch selbst in dieser idyllischen Abgeschiedenheit begegnen ihr seltsame Gestalten: Menschen und Tiere mit Prothesen, die sie unheimlich beobachten und mit einem grausamen Fürsten in Verbindung zu stehen scheinen. Die rätselhaften Ereignisse häufen sich und Clara beginnt zu glauben, dass sie selbst der Grund für all das Unheil ist. Getrieben von Angst und Verzweiflung trifft Clara eine folgenschwere Entscheidung, die ihr Leben und das Schicksal vieler Menschen für immer verändern wird. Ein fesselnder Roman über ein düsteres Familiengeheimnis, einen geheimnisvollen Fürsten und eine verbotene Liebe in einem alternativen Deutschland des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
WELTENBAUM VERLAG
Vollständige Taschenbuchausgabe
09/2024 1. Auflage
Das smaragdgrüne Monokel
© by Sylvia Kaml
© by Weltenbaum Verlag
Egerten Straße 42
79400 Kandern
Umschlaggestaltung: © 2023 by Magicalcover
Bildquelle: Depositphoto
Lektorat: Julia Schoch-Daub/Feder und Flamme Lektorat
Korrektorat: Petra Schütze
Buchsatz: Giusy Amé
Autorenfoto: Privat
ISBN 978-3-949640-88-9
www.weltenbaumverlag.com
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
Sylvia Kaml
Das smaragdgrüne Monokel
Historischer Steampunk Roman
Dieses Buch widme ich all denen, die den Versuch starten, es zu lesen.
1 Porzellanköpfe
Oktober 1880
Wo waren sie nur, die drei Kinder? Zwei Jungs und ein Mädchen in schmutzigen Kleidern. Sie trafen sich doch stets um dieselbe Uhrzeit an der Ziegelmauer der Fabrik gegenüber. Kam ein elegant gekleideter Herr mit Zylinder und Spazierstock zusammen mit einer Dame im langen Kleid, sprang das Mädchen nach vorne und bettelte sie an. Ob sie ihr mit dem Stock drohten oder nach ihrer Geldtasche griffen, tat nichts zur Sache. Die Ablenkung war es. Die beiden Jungs schlichen sich von hinten an, stahlen Taschenuhr oder Geldbeutel und stoben davon. Aber heute fehlte jede Spur von ihnen.
Clara senkte das Fernglas und verzog enttäuscht den Mund. Diesen Abend würde es wohl nichts zum Schauen geben, abgesehen von dem Moos zwischen den Backsteinen der Fabrikwand. Moment, wer war das? Sie blinzelte in die Sonne. Zwei Figuren tauchten an der Ecke auf. Clara hob das schwere Instrument erneut vor die Augen und drehte mit dem Mittelfinger an dem kleinen Rädchen, um die Linsen schärfer einzustellen. Sie erkannte eine Frau in einem kastanienbraunen Kleid und weinroten, hochgesteckten Haaren unter dem dunklen, beinahe schwarzen Hut. Sie musste etwa so alt wie ihre Mutter sein. Das Fernglas war derart hochwertig, dass Clara sogar den Leberfleck ausmachen konnte, der die rechte Wange der Frau zierte. So knapp unter dem äußeren Augenwinkel wirkte es wie eine schwarze Träne. Sie unterhielt sich mit einem Mann in beigem Anzug, Handschuhen und Zylinder, von dem Clara nur den Rücken sehen konnte. Worüber sie wohl sprachen? Die Mimik der Frau schien angespannt, beinahe skeptisch, als zweifele sie an dem Gehörten.
Auf einmal drehte der Mann sich um. Seine tiefbraune Hautfarbe hob sich deutlich von dem hellen Anzug ab und die dunklen Augen blickten genau in ihre Richtung, als würde er sie ähnlich klar durch die Linsen sehen können wie sie ihn. Clara zuckte erschreckt zusammen. Mit einem keuchenden Laut sprang sie hastig vom Fensterbrett auf ihr Bett, wobei das Fernglas polternd auf den Holzboden fiel. Das Herz ratterte in ihrem Brustkorb wie die Zahnräder von Vaters Taschenuhren.
Wer waren diese Personen? Clara saß beinahe jeden Tag nach dem Abendessen am Fenster ihres Zimmers und beobachtete die Straßen der großen Stadt, die sie nicht betreten durfte. Niemals war es geschehen, dass jemand zurückschaute. Es ängstigte sie, als verwehte die schützende und zuvor so vertrauensvolle Mauer wie ein Sandhügel im Sturm. Körnchen für Körnchen flogen davon.
Tief durchatmend schob sie sich ihre hellbraunen Locken hinter die Ohren und strich mit den Handflächen über das Gesicht. Ihr Herzschlag beruhigte sich. Was sagte Vater stets? Man müsse die Dinge der Welt mit Bedacht und einem klaren Verstand betrachten. Dieser mysteriöse dunkelhäutige Mann hatte gewiss nur zufällig zum Herrenhaus geblickt. Aus solcher Entfernung konnte er sie kaum erkannt, womöglich lediglich ein Blitzen der Sonne im Glas der Linsen bemerkt haben.
Mit Verdruss gesellte sich die Stimme ihrer Mutter zu der ihres Vaters und schimpfte sie ein verschrecktes, dummes Kind. Clara rutschte vom Bett und hob das Fernglas auf. Sie drehte es vorsichtig in den zitternden Händen. Die Linsen waren noch heil, welch ein Glück. Sie trat wieder ans Fenster und schaute vorsichtig hinaus. Die beiden mysteriösen Personen waren fort und das Straßenbild wie immer. Ein normaler Tag im goldenen Oktober. Das Gefühl, beobachtet zu werden, war wohl ein Hirngespinst ihrer überschwänglichen Fantasie, die Mutter stets beklagte.
Clara wunderte sich darüber, dass ihr Vater einen sonnigen Herbsttag so nannte. Was war golden an dieser Jahreszeit? Die Dächer der Fabriken hatten auch im Frühling oder Sommer dieselbe graue Farbe und der Himmel war stets erfüllt vom Schwefelgeruch der immer aktiver befeuerten Holz- und Kohleöfen.
In der Ferne ertönte das Pfeifen der vorüberfahrenden Lokomotive, deren Gleise die Gegend um Düsseldorf zerschnitten. Lediglich ihr Dampf war über den benachbarten Häusern zu sehen. Clara kannte Eisenbahnen und Dampfschiffe nur von Bildern und wünschte sich so sehr, sie einmal in echt bewundern zu können.
Sie mochte den Herbst. Sie liebte es, wenn sich die tiefstehende Sonne grell über die Dächer setzte und Schattenbilder in den Straßen erzeugte. Ihr Vater sagte immer, dass ihn Claras bernsteinfarbene Augen an einen Herbstwald erinnerten. Meinte er das mit golden? Sie kannte nur die beiden Bäume vor dem Herrenhaus, die in rotem und gelbem Laub standen. Einen echten Wald hatte sie selbst noch nie zu Gesicht bekommen, doch alleine die Vorstellung faszinierte sie.
Noch mehr aber liebte sie den Winter. Den dichten Schnee, der die Landschaft eindeckte wie ein weißer Schleier. Er fegte die sonst so gefüllten Straßen der Stadt leer und breitete seine Macht über alles aus. In seinen Tiefen wartete die unter eisiger Faust unterdrückte Natur still darauf, dass er seinen frostigen Griff lockerte und sie wieder aufleben ließe.
Als Tochter einer Baronin konnte sie es sich leisten, die kalte Jahreszeit zu mögen und die Stürme von einem warmen, ofenbeheizten Raum zu beobachten.
Clara stellte das Fernglas an dessen Platz auf der Fensterbank und blickte hinaus in den riesigen Hof, den ein schmiedeeisernes Tor umgab. Ohne das Gerät schien der Trubel der Großstadt weit entfernt. Teilhaben durfte sie nicht an ihm. Es sei zu gefährlich, hieß es. Sie solle in ihrem Alter geschützt auf dem Grundstück bleiben. Clara nahm eine ihrer Puppen in den Arm und beobachtete fasziniert das rote Luftschiff, das sich jeden Tag um dieselbe Zeit über den Dächern erhob. Was gäbe sie darum, damit einmal fliegen zu können. Es wirkte so leicht und frei.
Ein schriller Schrei ertönte. Clara zuckte zusammen und huschte auf den Balkon. Sie blickte durch die Metallstreben des Geländers und sah, wie eines der Dienstmädchen gerade aus dem Gebäude stürmte. Den weiten Rock in den Händen gerafft, damit sie größere Schritte machen konnte. Fred, der alte Gärtner, folgte ihr. Clara mochte ihn, er steckte ihrem Bruder und ihr immer die süßesten Beeren zu, ohne dass die Köchin oder Mutter es merkten.
Sie brauchte sich nicht anzustrengen, um zu hören, was Anna ihm erzählte, ihre Stimme war schrill genug.
»Dieses Balg!« Sie schluchzte theatralisch. »So etwas muss ich mir nicht bieten lassen. Ich kündige!«
Anscheinend hatte Archibald ihr wieder Schnecken oder Kröten in die Schuhe gesteckt. Fred redete beruhigend auf sie ein, doch das Meiste davon war zu leise, um es auf dem Balkon zu verstehen.
»Du hast ja recht«, antwortete Anna ihm deutlich ruhiger. »Aber diese ungezogenen Blagen … nein, ich werde nicht weniger laut sprechen, mir ist es ganz egal, ob die gnädige Frau mich hört. Der Junge ist erst fünf und er hat mehr grausame Streiche im Kopf, als mein Neffe Ottfried, der im Gefängnis sitzt. Von diesem Gör ganz zu schweigen. Zehn Jahre alt und benimmt sich wie die Kaiserin von China.«
Clara spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog.
»Du darfst nicht zu streng mit ihnen sein«, hörte sie Freds ruhige Stimme, sehen konnte sie nur seine Lederkappe von oben und die beschwichtigend ausgebreiteten Arme. »Sie sind arme Kinder.«
»Arme Kinder?«, rief Anna schrill. »Ich hör wohl nicht recht, sie bekommen alles, was sie verlangen.«
»Aber keine Liebe, Anna. Ihr schlechtes Benehmen ist nur ein Hilferuf nach Aufmerksamkeit. Hast du jemals gesehen, dass sie auch nur in die Arme genommen werden? Der gnädige Herr ist ständig unterwegs. Und wenn nicht, dann zieht er sich in sein Arbeitszimmer zurück und verlangt seine Ruhe. Die Freifrau hingegen ist der reinste Eisblock. Sie würde ihre Kinder nie umarmen, aus Angst, sie könnten ihr die teuren Kleider zerknittern oder beschmutzen. Sie bekommen Privatunterricht von alten Männern, die nach der Stunde sofort wieder verschwinden.« Fred ging einen Schritt auf das Hausmädchen zu. »Die Kleinen haben keine Freunde zum Spielen und die Dienstmädchen gehen abwechselnd ein und aus und reden ebenfalls kaum mit ihnen. Glaube mir, Anna, diese Kinder brauchen unser Mitleid, nicht unseren Hass.«
Die Magd seufzte theatralisch. »Du hast ein viel zu gutes Herz für diese Welt, Fred, und wohl auch zu viel Fantasie. Bleibe gerne aus Mitleid, wenn du magst. Ich hingegen werde mich gleich morgen nach einer Stelle umsehen, wo man meine Dienste wertschätzt.«
Sie gingen wieder ins Haus und Clara schlich langsam zurück in ihr Zimmer. Sie setzte sich auf das riesige weiche Bett und betrachtete ihre vielen teuren Puppen. Auf einmal fühlte sie sich schrecklich alleine in diesem großen Raum mit der hohen Zimmerdecke, die keinen Schutz zu bieten schien. Sie sah auf Emma in ihrem Arm. Diese Puppen, die viel zu schwer und zerbrechlich waren. Ihr wurde stets geboten, nie zu heftig mit ihnen zu spielen, sonst würden sie kaputtgehen. Eine Hitze staute sich in ihr. Eine Wut, die hinaus in die Welt geschrien werden wollte. Der Druck stieg bis hinauf in die Kehle wie bei einem Dampfkessel und presste Wasser in ihre Augen. Nein, sie sollte nicht weinen. Das gehörte sich nicht für eine junge Dame … nichts, was sie wollte oder fühlte, gehörte sich …
Clara öffnete das innere Ventil, das sich so lange aufgestaut hatte. Sie stieß einen spitzen Schrei aus und warf Emma mit voller Wucht an die Wand, dass der Porzellankopf an den Steinen zerschellte. Sie sah einige Sekunden mit Tränen in den Augen auf die Splitter ihrer Lieblingspuppe. Ihre Ohren glühten. Wenn das Mutter sähe! Gewiss hatte sie das Scheppern gehört. Der Schrecken wandelte sich in Frustration. Nichts würde geschehen. Die Baronin reagierte schon lange nicht mehr auf Laute aus dem Kinderzimmer. Ob Streit oder Weinen, alles schien ihr gleich. Vor Zorn über sich selbst ergriff sie auch ihre anderen Puppen und schmiss sie nacheinander an die Wand, dass die Porzellansplitter über den gewachsten Holzboden schlitterten. Einen Moment lang verharrte sie in der Stille. Niemand kam, um nach dem Rechten zu sehen. Spätestens morgen früh würde ein Bediensteter kommentarlos die Scherben wegkehren.
Sie vergrub ihren Kopf in die Kissen und weinte.
Der schwere Klumpen in Claras Magen löste sich auch am folgenden Tag nicht auf. Am Frühstückstisch stocherte sie nur in ihrem Obstsalat herum. Ihr Bruder Archibald hingegen stopfte wie immer alles Essbare in sich hinein, was aufgedeckt wurde.
Ihre Mutter sah sie über den steifen Kragen streng an und seufzte theatralisch. »Sitz gerade!«
Clara richtete sich murrend auf.
»Und iss gefälligst ordentlich, wir sind hier nicht bei den Bauern im Schweinestall!«
Clara legte die Gabel zur Seite und blickte ihrer Mutter in die dunklen Augen. Sie selbst besaß als einzige der Familie goldbraune. Auch ihre Locken waren hellbraun im Gegensatz zu den beinahe schwarzen ihrer Eltern und ihres Bruders. Dies hätte sie von ihrer Großmutter, hatte ihr Vater einmal gesagt. »Ist es mir erlaubt aufzustehen, Frau Mutter?«
Die Frau sah auf den unberührten Teller und zog ihre kantige Nase kraus. »Nun gut, du darfst gehen. Als Mädchen solltest du ohnehin deine schlanke Figur wahren. Letztes Weihnachten schien dies recht gefährdet bei dir.«
Clara spürte, wie ihre Wangen brannten. Bei Archibald, der wirklich langsam fett wurde, sagte Mutter nie etwas, aber sie konnte ihr nichts recht machen.
Sie warf die Serviette auf den Teller und ihrer Mutter einen wütenden Blick zu, den diese mit einem »Diese Kinder«-Stöhnen quittierte.
Clara lief aufgebracht nach draußen. Sie rannte zum Stall, während der kühle Herbstwind half, ihre aufflammenden Tränen zu trocknen. Es war ihr nicht erlaubt, ohne Reitkleid in die Ställe zu gehen, doch gerade deswegen tat sie es.
Clara liebte die Pferde. Sie konnte schon sehr gut reiten und hatte ein eigenes Pony, was sie auch selbst versorgte. Die Tiere zeterten nicht, wenn sich ein Fleck auf dem Kleid befand. Ihnen war es egal, ob man beim Halten einer Teetasse den kleinen Finger spreizt oder ob der Hofknicks perfekt ist. Sie liebten einen bedingungslos, sie schmusten auch mit dir, wenn du deine Hände nicht gewaschen hattest.
Archibald hingegen hatte kein Händchen für Tiere. Die Pferde scheuten oft, wenn er hereinkam. Er trat auch nur nach ihnen oder bewarf die streunenden Hunde hinter dem Tor mit Steinen. Dieser Faulpelz und Stubenhocker kam ohnehin kaum aus dem Haus, während Clara so oft wie möglich morgens über den Hof ritt. Er freute sich gewiss über die Maschinen und Automobile, die keine Pferde mehr benötigten.
Als sie den Stall betrat, stieg Clara der Geruch von Mist und Heu entgegen und das gescheckte Pony wieherte ihr mit gespitzten Ohren zu. Sie streichelte seinen Kopf.
»Tut mir leid, Flocke«, sagte sie traurig. »Jetzt habe ich doch die Möhre vergessen, die mir Fred extra für dich gegeben hat.« Sie drückte seine weichen Nüstern gegen ihre zornentbrannten Wangen und genoss den streichelnden Atem des Ponys. »Morgen bekommst du zwei, versprochen. Ach, sie sind alle so gemein zu mir, sei froh, dass du ein Pferd bist.«
Sie musste daran denken, wie die Pferde der Bauern noch immer auf den Feldern bis zur Erschöpfung arbeiteten und wie ihr Onkel eines der Jagdpferde erschossen hatte, nur weil es nicht mehr schnell genug war. Doch das erzählte sie Flocke nicht.
Clara richtete sich auf und fasste einen Entschluss: Sie würde abhauen! Einfach weglaufen. Über das Eisentor klettern und die große Stadt erkunden. Zu den drei Bettelkindern, die sie so oft beobachtet hatte, dass sie ihr beinahe wie enge Freunde schienen. Sie wirkten trotz der geflickten Kleider so heiter, haben gelacht und durften sich richtig schmutzig machen. Ja, sie würde zu diesen Kindern gehen und sie einfach fragen, ob sie mitmachen könnte. Vielleicht lernte sie ein paar Tricks. Sie würde die hochnäsigen reichen Pinkel ausplündern, mit anderen Straßenkindern eine geheime Diebesbande gründen, ganz so wie in den vielen Büchern, die sie las, und richtig berühmt und berüchtigt werden. Sie würden sich der »Clever-Klan« nennen und … sie schaute durch das Stallfenster und betrachtete mit gerunzelter Stirn das Eisentor. Es war zwei Meter hoch und jede Strebe endete in einem spitzen Stahlspieß. Clara biss sich auf die Unterlippe und ballte die behandschuhten Hände zu Fäusten. Irgendwie kam sie schon auf die andere Seite. Bald würde der Köhler mit seiner Lieferung kommen, dann könnte sie einfach heimlich durch das Tor huschen und ihr Abenteuer in der Stadt beginnen.
Clara drehte sich um, schritt energisch aus dem Stall und auf das große Tor zu, dem einzigen Durchgang des spitzen Metallzaunes, der das gesamte Grundstück einschloss. Die Fäuste entschlossen geballt. Mit jedem Schritt klopfte ihr Herz schneller. Sie dachte an die Warnungen ihres Vaters. Seine Erzählungen der Gefahren und des sicheren Todes, der dort auf kleine Mädchen lauerte. Sie versuchte mit aller Kraft, nicht auf diese Ermahnungen zu achten. Das Zittern der Hände und Zuschnüren der Kehle ignorierte sie. Dort in den Straßen befanden sich auch Kinder, die überlebten und denen bis auf zerlumptere Kleidung und hin und wieder Prügel von Ordnungshütern nichts Schlimmes zu widerfahren schien. Was könnten die ihr schon tun? Sie vielleicht auslachen, aber das war sie von ihrem Bruder gewohnt. Dann konnte sie immer noch gehen.
Sie blickte sehnsüchtig durch die Gitterstäbe und versuchte, hinter der dichten Hecke etwas von der Straße zu erkennen.
Endlich kam der Köhler mit seinem Gefährt angetuckert. Es wackelte, ratterte und pfiff Dampf aus seinem kleinen Schornstein, aber fuhr, ohne von Pferden gezogen zu werden, durch die Straßen.
Gerade wollte sie hinter der dampfenden Maschine mit dem kohlebeladenen Anhänger durch das noch offene Tor huschen, als ein seltsamer Laut sie erstarren ließ. Was war das? Ein Winseln? Es klang wie ein verletzter Hund. In diesem Moment tauchte tatsächlich eine Art Hund hinter dem Wagen auf, der den Köhler wohl hinein begleitet hatte. Ein großes Tier mit seidig schwarzem Fell. Doch irgendetwas stimmte mit seinem Gang nicht. Clara erschrak, als sie den Grund erkannte. Seine Beine waren künstlich. Alle vier bestanden aus Eisenstangen mit Zahnrädern als Gelenke und eiserne Spitzen als Krallen. Das Tier trottete leicht staksig auf sie zu und wedelte freundlich mit der langen Rute. Clara riss sich aus ihrer Erstarrung, beugte sich zu dem Wesen und streichelte ihm über den weichen Kopf. »Hallo. Du bist ja ein Hübscher.«
Der Hund versuchte, ihr mit seiner Zunge über das Gesicht zu lecken. Clara kicherte. »Igitt, lass das.«
»Er mag Sie«, ertönte eine tiefe Stimme. Erschrocken blickte sie auf und sah den breitschultrigen Köhler vor sich. Der hochgewachsene Mann mit dem Vollbart und der stählernen Beinprothese war ihr stets etwas unheimlich. Der Geruch nach Kohle wirkte auf sie, als käme dieser Mann aus einer finsteren Unterwelt. Mit pochendem Herzen blickte Clara hinter sich. Das metallene Tor hatte sich bereits wieder geschlossen, doch die Flucht schien unwichtig. Der Hund nahm jetzt ihre gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch.
»Gehört er Ihnen?«, fragte sie zaghaft.
Falls das Gesicht des Mannes eine Regung zeigte, war diese unter dem dichten Bart versteckt. »Sein Herr wollte ihn nicht mehr.« Der Köhler verdrehte kurz die Augen. »Er sei zu aufdringlich. Aber mich hindert er leider auch nur mit seinen Prothesen. Ich suche jemanden für ihn, der sich besser um ihn kümmern könnte.«
»Wie wird er genannt?« Claras Herz hüpfte vor Aufregung. Sie würde dieses Tier so gerne behalten. Doch er war sehr groß, reichte ihr bis zur Hüfte. Würde Vater dies gestatten?
»Er hat meines Wissens keinen Namen.«
»Ich möchte mich gerne um ihn kümmern. Sehr gerne.« Clara jauchzte innerlich bei dem bloßen Gedanken. Der Hund sprang wedelnd um sie herum, dass die Scharniere der Beine quietschten.
Der Mann lachte. »Wenn es Ihre Eltern erlauben, gehört er Ihnen. Eine Last weniger für mich.«
»Vater muss es einfach gestatten. Ich verzichte auf alle Weihnachtsgeschenke, solange er bei mir bleibt.« Sie sah mit einem strahlenden Lächeln zu dem Tier. »Ich werde ihn Findling nennen.« Ihre Stirn runzelte sich. »Was benötigen seine Prothesen an Pflege?«
»Ihr müsst sie lediglich jeden Morgen polieren und ölen, das genügt, und sie vor Kälte und Nässe schützen, damit die Beine nicht rosten.«
Clara nickte eifrig. »Ich werde mich gut um ihn kümmern, vielen Dank!«
Sie brachte Findling vorerst in den Stall und band ihn mit einem Strick in einer der Boxen fest. »Du musst leider bis heute Abend hier warten«, flüsterte sie und stellte ihm noch eine Schüssel Wasser hin. »Erst, wenn Vater heimkommt, kann ich dich ihnen vorstellen.« Ihre Mutter Wiltrud würde es sofort verbieten, aber ihr Vater war ein Freund jeglicher Mechanik und bastelte in seiner freien Zeit selbst an kleinen Uhrwerken oder seinen Automobilen herum. Clara setzte all ihre Hoffnung in die Besonderheit, die dieses halbmechanische Tier innehielt.
Clara wartete, bis ihr Vater zu Abend gegessen hatte und sich in sein Arbeitszimmer zurückziehen wollte.
»Vater?«, fragte sie zögerlich, ihr Herz klopfte bis zum Hals. »Haben Sie einen Moment Zeit?«
Die dunklen Augen des Freiherrn verengten sich. »Nicht heute Abend, Clara, ich bin sehr müde.«
»Es dauert nicht lange. Ich möchte Ihnen eine Erfindung zeigen. Der Köhler brachte sie und fragte, ob wir sie behalten würden.«
Ihr Vater hob die Stirn. »Eine Erfindung?«
»Warten Sie hier!« Clara rannte in den Stall und holte den Hund.
Sie führte Findling vor ihren Vater und der schmale und sonst so emotionslose Mann riss wie erhofft die Augen auf, als er die Prothesen erkannte. »Ich habe auf meinen Reisen bereits viele helfende Apparaturen gesehen, aber noch keine an einem Tier. Ich frage mich, wie die derart vorzüglich funktionieren können.« Er betastete den Hund staunend. Findling ließ es geduldig über sich ergehen, blickte aber immer wieder wie fragend zu Clara.
»Darf ich ihn behalten, Vater?« Mit gesenktem Kopf sah sie ihn flehend an. Die Funktion der Beine war ihr in diesem Moment völlig gleich. »Bitte! Ich verspreche auch, mich immer zu benehmen und das zu tun, was Mutter verlangt. Es wird keine der Streitereien mehr geben, die Sie so verabscheuen.«
Der Freiherr schien nur zur Hälfte zuzuhören, er untersuchte die Gelenke des Tieres. »Meinetwegen, wenn es dich glücklich macht.« Er legte den Kopf schief. »Welch faszinierende Mechanik! Die Beine sind pneumatisch gefedert und mit Kautschuk versiegelt. Ich wünschte, ich wüsste den Erbauer dieses Wesens. Ein wahrer Meister seines Fachs.«
»Danke!« Sie verspürte den Drang, ihrem Vater um den Hals zu fallen, doch sein Blick hielt sie davon ab. Er mochte keine Umarmungen. Stattdessen fiel sie Findling um den flauschigen Hals, der wie zur Bestätigung bellte.
Ihr Vater legte ihr zögerlich die Hand auf die Schulter, bevor er sich erhob. Es wirkte, als erwartete er einen Stromschlag.
»Um Himmels willen, was ist das für eine garstige Kreatur?«, schallte es durch den Raum.
Clara fuhr herum und sah ihre Mutter an der Tür stehen. »Höre nicht hin, Findling, du bist wunderschön!« Sie sagte das mehr ihrer Mutter zum Trotz als zu dem Tier, dessen Ohren sie demonstrativ zuhielt. Wie Wiltrud es bei ihnen tat, wenn jemandem aus dem Personal ein unanständiges Wort entfuhr.
Ihre Mutter schnappte nach Luft. »Als ob dieses Ding Gefühle hätte!« Sie wies zur Tür. »Schaff dieses Teufelswerk fort!«
Der Vater seufzte leise. Ein Laut, der ihr bereits sehr vertraut war. »Ich sicherte Clara zu, das Tier behalten zu können, Wiltrud«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Sie versprach dafür, sich anständig zu benehmen. Es ist kein Teufelswerk, sondern reine Mechanik.«
»Eine derartige Technologie existiert nicht ohne magisches Zutun!« Clara meinte, eine Furcht in den Augen ihrer Mutter zu lesen.
Ihr Vater hob beschwichtigend die Hände. »Ich bin kein Arzt, aber ich versichere dir, es gibt heutzutage Erfindungen, die erstaunlich sind. Ich verspreche dir, ich behalte das Tier im Auge und finde heraus, wie die Beine funktionieren.«
Wiltrud stemmte die Hände in die eng geschnürte Taille ihres roten Kleides und blies eine dunkle Locke aus ihrem Gesicht. »Nun gut, aber das Vieh bleibt mir nicht im Haus! Es kommt in den Stall, wo es hingehört!«
Clara hob stolz den Kopf und schritt an ihrer Mutter vorbei aus dem Raum. Findling wich nicht von der Seite des Mädchens. Als sie neben der Baronin waren, hob der Hund die Lefzen und fletschte seine riesigen Zähne.
Wiltrud riss entsetzt die Augen auf. Erneut flammte eine Angst in ihren Augen auf, als glaubte sie wirklich, der Hund käme aus der Hölle. Sie schwieg jedoch.
Clara freute das. Sie würde sich in Zukunft nichts mehr befehlen lassen, der Hund würde sie gewiss vor Strafen schützen.
Im Flur schaute sie zurück und sah den Blickwechsel zwischen ihren Eltern. Ihnen schien dieses Wesen mehr als unheimlich zu sein, doch es blieb wie so oft unerwähnt. Clara war dies nur recht.
2 Die »bösen Männer«
5 Jahre später
November 1885
Clara verbrachte jede freie Minute mit ihrem Hund, obwohl sie langsam zu einer Frau herangewachsen war und, Mutters Ansicht nach, andere Prioritäten haben sollte, als sich mit schmutzigen Tieren abzugeben. Dennoch änderte sich ihre Fürsorge und Zuneigung zu Findling nicht. Clara pflegte, ölte und polierte seine mechanischen Beine mit großer Leidenschaft. Mit der gleichen Hingabe bürstete sie sein Fell und auch, wenn sie nur Reste aus der Küche für ihn bekam, suchte sie daraus immer das Beste für ihn aus.
Sogar der Freiherr taute auf, wenn das Gespräch über die Maschinerie des Tieres ging, und Clara nutzte diesen Umstand so oft wie möglich. Sie genoss die seltene Zuneigung und Aufmerksamkeit ihres Vaters.
Als Findling einmal nach dem Ballspielen humpelte, klopfte sie besorgt an die Tür des Arbeitszimmers, in dem der Hausherr die Abende verbrachte.
»Ja?«, kam es von innen.
Clara öffnete mit pochendem Herzen die Tür. Das vertraute Duftgemisch von ledergebundenen Büchern, Bienenwachs und Öl drang ihr in die Nase. Obgleich sie bald schon sechzehn Jahre alt war, kam sie sich in diesem Raum noch immer wie ein kleines Mädchen vor. Ihr Vater schaute nicht auf. Er saß an seinem Schreibtisch und schraubte mit verklärtem Blick an einer Kuckucksuhr herum. Die Zahnräder und Federn lagen auf dem Tisch verteilt. Der kleine Holzvogel mit dem Schwanz aus echten Vogelfedern stand daneben und sah dem Treiben ungeduldig zu.
Clara stand eine Zeit lang da und wagte nicht, ihn aus seiner Zuflucht zu reißen. Schließlich räusperte sie sich. »Verzeihen Sie die Störung, Vater«, sagte sie leise, damit er nicht wieder das Gesicht verzog. »Es geht um Findling.«
Er hob den Blick und das Leben strömte in seine dunklen Augen. »Was ist mit dem Hund?«
»Wir spielten mit dem Ball. Er sprang ihm zu heftig hinterher und humpelt nun am rechten Vorderlauf.«
Ihr Vater legte sein Werkzeug nieder und erhob sich. »Ich werde es mir ansehen.«
Claras Miene hellte sich auf. »Danke!« Sie öffnete die Tür weiter und ein stark hechelnder Findling hüpfte auf drei stählernen Beinen lautstark auf dem Parkett herein, seine Rute wedelte noch immer fröhlich.
Der Hausherr runzelte die Stirn. »Darf das Tier nicht nur bis zum Foyer?«
Clara zog den Kopf ein. »Mutter sagte nichts, als ich ihr begegnete.«
Ihr Vater seufzte leise. »Du solltest die Baronin nicht derart aufregen.«
»Entschuldigen Sie, Vater.« Clara senkte beschämt den Kopf. »Ich werde Findling niemals hergeben, ganz gleich, ob sie es verlangt«, flüsterte sie und musste sich anstrengen, die Hände nicht zu Fäusten zu ballen.
»Sie wird ihn dir nicht nehmen, das versprach ich bereits.«
Clara hob den Kopf und glaubte, ein leichtes Lächeln auf seinen Lippen zu erkennen. »Können Sie ihm helfen?«, fragte sie hoffnungsvoll.
»Ich sehe es mir mal an.« Er kauerte sich zu dem Hund. »Komm her Findling, zeige mir mal deine Pfote.« Er untersuchte das Bein und Findling ließ es brav geschehen. »Es ist nur eine lockere Schraube, das bekommen wir wieder hin.« Er trat zum Schreibtisch und suchte nach dem passenden Werkzeug.
Clara strahlte. »Danke, Vater, vielen Dank! Was täte ich nur ohne Sie?«
Der Mann lächelte schwach und schaute auf den Schraubendreher in seiner Hand. »Du musst mir nicht danken, Kind. Du trägst nicht die Schuld an all dem.« Er sagte dies mehr zu sich selbst und Clara runzelte die Stirn. Es klang, als meinte er nicht nur die Verletzung des Hundes damit.
Am darauffolgenden Morgen strahlte die Sonne vom blauen Himmel und der Tag versprach kalt, aber trocken zu werden.
»Darf ich ausreiten, Mutter?« Clara versuchte, so brav wie möglich zu klingen. Sie wollte heute nur raus aus diesem Gefängnis. »Ich nehme auch Findling mit. Er passt auf, dass mir nichts geschieht.«
Die Baronin zog die Nase kraus. »Etwas anderes wäre auch seltsam.« Sie schüttelte den Kopf. »Dieses … Ding … weicht seit Jahren nicht von deiner Seite, als hinge es an einer unsichtbaren Leine.«
»Erlauben Sie es mir?«, drängte Clara. »Ich verspreche, noch vor dem Mittagessen heimzukehren.«
Ihre Mutter seufzte. »Nun gut, aber verabschiede dich zuvor von deinem Vater, er muss bald aufbrechen.«
Clara nickte. Auch wenn ihr Herz vor Freude platzte, verbiss sie sich ein Lächeln. Ihre Mutter würde sie dafür tadeln. Nur Dirnen lächelten und lediglich Narren zeigten öffentlich ihre Stimmungen.
Archibald kam in den Raum gestürzt. Sein Halstuch offen über dem Hemdkragen, als wäre er jetzt erst dabei gewesen, sich anzukleiden. »Frau Mutter, weshalb darf Clara ausreiten und ich nicht?« Er plusterte die Wangen auf und zeigte mit dem Finger auf sie. »Sie durfte es mit elf Jahren schon. Ich erreichte nun ebenfalls dieses Alter.«
Wiltrud seufzte theatralisch. Sie ging zu dem Jungen und band sein Halstuch zu einem adretten Knoten. »Es ist zu gefährlich dort draußen. Die vielen Kriminellen warten nur darauf, dass ein naiver blaublütiger Jüngling alleine auf die Straße geht. Sie werden dir den Schädel einschlagen.«
Ihr Bruder presste die Lippen zusammen, dass sie so blass wurden wie der Rest seiner Gesichtsfarbe. »Es ist des Hundes wegen, nicht wahr? Er knurrt jeden an, der ihr zu nahekommt. Deswegen darf sie das Grundstück verlassen. Ich will auch solch einen Hund. Kaufen Sie mir einen Hund, Mutter!«
Die Baronin erhob sich schwerfällig. »Ich werde mit deinem Vater darüber sprechen. Geh nun zurück in dein Zimmer.«
»Aber …«
»Kein Wort mehr!« Ihre strenge Stimme ließ Clara den Kopf einziehen. Auch Archibald schloss seinen Mund. Die Erfahrung lehrte beide, nicht weiter zu diskutieren.
Wiltrud raffte den Saum ihres blauen Kleides und schritt so energisch davon, dass die Unterröcke raschelten. Die beiden Kinder standen alleine im Flur. Clara erkannte, wie Archibalds Augen sich mit Tränen füllten und seine Lippen bebten, doch er bemühte sich sichtlich, keine Schwäche zu zeigen. Er tat ihr leid.
»Wir könnten gemeinsam ausreiten«, sagte sie. »Dann kann Findling uns beide beschützen.« Leicht gingen ihr diese Worte nicht über die Lippen, da sie ein anderes Ziel als das Geheimversteck wählen müsste, aber ihm zuliebe würde sie es tun.
Ihr Bruder sah zu ihr hoch und Clara erkannte, wie seine Mimik sanft wurde und die Mundwinkel ein leichtes Lächeln andeuteten. Er blickte beinahe sehnsüchtig zu Findling und streckte vorsichtig seine Hand aus, um ihn zu streicheln. Der Hund hob die Lefzen und wich ihm grummelnd aus. Archibalds Gesichtszüge verhärteten, er runzelte die Nase und hob das Kinn. »Das ist nicht nötig, ich bekomme auch einen Wachhund und der wird größer und stärker sein als deine armselige Version von der Straße!«
Clara verzog den Mund. »Wie du willst, dann bleibe eben zuhause, während ich auf Queen über die Felder trabe.« Sie warf ihre Locken in den Nacken und schritt aus dem Raum.
Erst auf dem Weg zu ihrem Gemach wurde ihr bewusst, wie sehr sie in diesem Moment ihrer Mutter geähnelt haben musste. Ihre Wangen brannten vor Scham bei dem Gedanken.
Clara kleidete sich in ihr eng geschnürtes, rotbraunes Reitgewand. Sie liebte es, wenn der passende Umhang sich beim Reiten über den beinahe gleichfarbigen Rücken ihrer Vollblutstute legte und den Damensattel verdeckte. Als ginge ihr Körper in den des Pferdes über. Zwei Wesen in einem.
Den Hut befestigte sie mit Haarnadeln an ihren hochgesteckten, hellbraunen Locken, die ihr blasses Gesicht umringten. Sie betrachtete sich in dem großen Rundspiegel und zog einen Schmollmund. Nun hatte sie das Alter erreicht, in dem man erwartete, dass sie mit ihren Eltern die Feierlichkeiten besuchte. Unter Menschen kommen. Mit anderen ihrer Gesellschaftsklasse Beziehungen aufbauen.
Ein flaues Gefühl machte sich in ihrem Magen breit. Bisher hatte sie sich immer davor drücken können. Aber wollte sie das denn noch länger? Wie Findling schien auch sie zweigeteilt. Die eine Clara, die zur Frau reifte, mochte den Gedanken, auf Bankette eingeladen und von jungen Männern umgarnt zu werden. Offiziell zu den Adligen dieses Landes gehören. Dies glich den Maschinenbeinen. Die andere Clara — die in ihrer Fantasie den Rest des echten Tieres symbolisierte — ähnelte einem verschreckten Kaninchen, das auf den Bahngleisen unter einem fahrenden Zug hockte, dessen Fahrtwind ihr Fell verwirbelte, und weder vor noch zurück konnte. Die bloße Vorstellung, fremde, ihr unbekannte Menschen zu treffen und dazu mit ihnen reden zu müssen, engte ihren Brustkorb ein und raubte die Luft zum Atmen. Doch wohin auch immer ihre Maschinenbeine von Mutter oder Gesellschaft geschickt wurden, dorthin musste auch der Rest folgen. Ob verschreckt oder nicht.
Clara seufzte still. Sie fühlte sich überhaupt nicht vorbereitet auf die Welt hinter den eisernen Toren.
Nur zu Pferd.
Sie nahm ihre Umhängetasche aus der Kommode, überprüfte den Inhalt und ging zum Hof. Der Knecht führte Queen gezäumt auf das Pflaster und reichte ihr die Gerte. Clara stieg in den Damensattel, während Findling freudig um das Pferd trabte. Auch er liebte diese seltenen Ausflüge.
Zu ihrem geheimen Platz am See war es nicht weit. Sie befanden sich im noblen Viertel Düsseldorfs. Die großen Häuser glichen Villen mit großem, eingezäuntem Grundstück.
Nach einem knappen Kilometer öffnete sich der Pflasterweg in weite, mit Morgennebel bedeckte Herbstwiesen und in der Ferne war bereits der Wald auszumachen. Die Stute hob den Kopf und spitzte erwartungsvoll die Ohren. Noch wenige Meter und sie würde Queen in Trab übergehen lassen.
Clara wusste genau, was in der Stute vorging. Auch ihr schien es, als roch sie die Freiheit in der Brise, die ihr entgegenwehte. Hier draußen verteilten sich die Passanten. Sie bog in einen Feldweg ein und ließ auch die letzten Kutschen und Reiter hinter sich. Endlich nicht mehr unter Beobachtung. Am liebsten hätte sie die Haarnadeln gelöst, sich den Hut vom Kopf gerissen und ihre Locken frei im Wind fliegen lassen.
Findling bellte aufgeregt, als sie Queen zu leichtem Galopp trieb, und sprang neben ihr her.
An dem kleinen, versteckten See mit der zerfallenen Holzhütte hielt sie an. Hier war ihr Geheimversteck, hier würde sie niemand finden oder verraten.
Sie stieg von der Stute und holte eine warme Wolldecke und das Buch aus der Umhängetasche. Ein perfektes Lesewetter für einen Liebesroman. Das ehemalige Dienstmädchen Anna hatte dieses Buch damals vergessen, als sie ging. Ihre Mutter hatte es in den Müll geworfen mit den Worten, dass sie niemals einen derartigen Schund in ihrem Haus dulden würde. Natürlich hatte dies Claras Neugier geweckt.
Die Geschichte war weder anspruchsvoll noch besonders spannend oder lehrreich, aber eine schöne Abwechslung zu den Büchern, die ihre Lehrer ihr gaben. Eine heile Welt, in der Menschen offen ihre Gefühle zeigten. Zudem las sie etwas von Mutter Verbotenes. Welch Frevel!
Sie breitete die Decke auf dem Gras aus und setzte sich darauf. Findling legte sich neben sie. Wie wundervoll dieser Ort doch war. Die Sonne brachte die Oberfläche des Sees zum Glitzern und der blaue Himmel, der sich darin spiegelte, täuschte über das ansonsten algengrüne Wasser hinweg. Die letzten Mückenschwärme des Jahres funkelten in den immer milder werdenden Strahlen der Sonne und die Luft war erfüllt mit dem Duft von Harz und Herbstlaub.
Heute würde sie das Buch zum fünften Mal beenden.
Clara ritt im Damensitz und mit erhobenem Kopf auf ihrem Vollblüter zurück zum Herrenhaus. Die Zeit der Romanwelt war vorüber und sie schlüpfte erneut in die Rolle der Baronesse. Die letzten fünfhundert Meter musste sie inmitten der mit heimkehrenden Arbeitern überfüllten Gassen zurücklegen. Sie mied es, auch nur einen der Fußgänger anzusehen. Selbst wenn einige Herren ihren Zylinder zum höflichen Gruß lüfteten, reagierte sie nicht darauf. Es sollte ihr gleich sein, was solche Menschen von ihr dachten. Im Stillen wusste sie jedoch, dass es ihre Unsicherheit war, die sie unter Arroganz zu verstecken suchte. Wie gerne wäre sie eine dieser normalen Menschen aus dem Roman.
Solche Träume sind Unfug!, erklang Mutters Stimme in ihrem Kopf. Clara war eine Freifrau und musste sich entsprechend zu benehmen wissen. Sie spürte zudem kein Verlangen, mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen. Die Konversationen der Gäste ihrer Eltern bei den diversen Feierlichkeiten waren ihr bereits zuwider, wie langweilig würde dann ein Gespräch mit dem niederen Volk in diesen schmutzigen, nach Unrat stinkenden Straßen sein?
Mit Findling als Begleiter fühlte sie sich sicher und sie wollte daran glauben, dass er und die Stute ihr als Freunde genügten.
Kurz vor dem Hoftor hielt der große Hund auf einmal inne und hob seine Nase in die Luft. Clara zügelte das Pferd und sah ihn stirnrunzelnd an. Was war los? Er sah auch nicht aus, als wäre er erschöpft, vielmehr, als empfinge er eine Nachricht von irgendwoher.
»Findling?«, fragte sie irritiert. »Was …« In diesem Moment drehte sich das Tier zu ihr um und knurrte sie aus tiefer Kehle an. Die ansonsten ruhige Stute warf nervös den Kopf nach oben und scheute verunsichert.
»Findling, hör auf!« Clara versuchte verzweifelt, ihr Pferd zu beruhigen. »Aus! Was ist in dich gefahren?«
Der Hund bellte stoßartig und fletschte die Zähne. Seine dunklen Pupillen schienen unnatürlich grün zu leuchten. Was war das? Clara gruselte es, ihr Herz pochte laut in ihren Ohren. Sie wollte absteigen und die nervöse Stute führen, als die neue Zofe vom Haus aus auf sie zugerannt kam.
»Reitet weg!«, rief sie Clara zu. »Schnell, Baronesse, verstecken Sie sich!«
»Aber …«
»Vertrauen Sie mir! Reiten Sie zu der kleinen Hütte am See, ich hole Sie dort.«
Findling bellte erneut aus tiefer Kehle und schnappte nach den Fesseln des Pferdes. Die Stute ging scheuend durch und galoppierte mit Clara über das Kopfsteinpflaster, hinaus aus der Stadt. Die Passanten auf den Straßen wichen ihr erschreckt aus und starrten ihr irritiert hinterher. Queens Hufe schleuderten ihnen den Dreck der Wege auf die Kleidung. Einige schüttelten den Kopf, andere hoben laut schimpfend ihre Spazierstöcke.
Als Clara das Pferd endlich wieder unter Kontrolle hatte, befand sie sich schon ganz in der Nähe des kleinen Hauses am See. Mit zitternden Armen ritt sie langsam dort hin. Alles in ihrem Kopf drehte sich, sie konnte keinen klaren Gedanken fassen.
Die Stute dampfte und auch Clara war trotz der kühlen Luft verschwitzt. Ihre Bluse klebte unangenehm an ihrem Rücken und sie fröstelte. Clara stieg ab und stand erneut, doch diesmal ratlos vor der zerfallenen Hütte, die fast komplett ins Unterholz versunken war. Sie wunderte sich darüber, dass die Zofe, die erst einige Monate bei ihnen angestellt war, von diesem Ort Kenntnis hatte.
Es dauerte nicht lange, bis die alte Frau herbeieilte. Auch ihre Kleidung wies Schweißflecken auf und ihr schwerer Atem qualmte in der Luft. Clara staunte, wie schnell die Zofe diese lange Strecke gemeistert hatte. Ob das an ihren Beinprothesen lag? Beide Beine endeten unter dem Knie in kupfernen Schächten mit Scharnieren ähnlich denen von Findling.
»Baronesse«, keuchte die Zofe außer Atem. »Was bin ich froh, dass Sie in Sicherheit sind. Das Gehöft wurde überfallen! Eine Horde maskierter Männer drang mit Schwertern in den Hof ein und«, sie schluckte, »töteten jeden, der sich ihnen in den Weg stellte. Auch Ihre Eltern und den jungen Herrn.«
Clara hörte still und ausdruckslos zu, in ihrem Kopf schien sich der Nebel des kleinen Sees auszubreiten und die umher wirbelnden Gedanken zu ersticken. Auf einmal brach es aus ihr heraus, wie ein Monster aus der Tiefe. Sie riss sich aus ihrer Erstarrung und sprang auf. »Sie lügen!«, brüllte sie.
»Nein, Baronesse.« Die Zofe hob abwehrend die Arme. »Ich würde nie …«
»Sie lügen!« Clara ballte die behandschuhten Hände zu Fäusten und hob die Gerte. »Welch eine Unverschämtheit, mir solch absurde Geschichten zu erzählen! Ich werde meinem Vater davon berichten. Das wird Konsequenzen haben, Sie werden entlassen!« Ihre Augen brannten. Sie drehte sich um und stieg aufs Pferd. »Ich werde zurück reiten, das ist lächerlich!«
Die Zofe riss erschreckt die Augen auf. »Nein, Kind! Sie werden Sie töten!«
Clara hörte nicht zu. Zorn brannte in ihrem Körper und schaltete ihr Denken aus. Sie trieb die erschöpfte Stute zur höchsten Eile an und galoppierte zurück zum Hof.
Das metallene Tor stand weit offen. Ein Anblick, der einen kalten Schauer über ihren Rücken laufen ließ. Noch niemals in ihrem Leben hatte sie dieses Tor so lange so weit geöffnet gesehen. Das Herrenhaus selbst wirkte verlassen. Kein Angestellter begegnete ihr, kein Gärtner arbeitete in den Vorgärten.
Clara ließ sich von ihrer Stute rutschen, warf die Gerte auf den Boden und rannte durch die weit offenstehende Tür ins Gebäude. Auch hier schien alles menschenleer, ein seltsamer Geruch lag in der Luft. Blut? Schweiß? Sie unterdrückte die aufflammenden Bilder ihrer Fantasie.
Der Duft von Eintopf drang in ihre Nase und übertünchte den Gestank. Sie warf einen Blick in die Küche. Der Raum, in dem sich höchstens in der Nacht niemand befand. Auch hier gähnende Leere. Auf dem Tisch lag ein eingefallener Brotteig auf ausgestreutem Mehl, den keiner knetete. Ein blubbernder Topf, aus dem der Geruch drang, köchelte unbewacht auf dem Herd. Clara wich zurück in den Flur. Sie wagte nicht, in diesen gruselig verlassenen Raum zu gehen.
Mit keuchender Atmung betrat sie das Kaminzimmer, in dem sich ihre Eltern aufgehalten hatten, bevor sie losgeritten war. Ihr Herz setzte einen Schlag aus. Der Freiherr lag leblos auf dem Boden, bereits in seinen dunklen Anzug bekleidet, den er für Reisen trug. Er wäre nach dem Essen gefahren. Claras Wangen brannten. Sie hatte versäumt, sich von ihm zu verabschieden. Ihre Mutter lag ausgestreckt neben ihm, in ihrem blauen Kleid. Nicht weit davon entfernt befand sich Archibald in gleicher Position. Sein Halstuch noch um, das Mutter ihm heute Morgen gebunden hatte. Die Kleidung blutüberströmt, der helle Teppich rot getränkt. Alle drei waren kalkweiß und wiesen einen tiefen Schnitt durch die Kehle auf, selbst der Junge.
Clara schnappte nach Luft, doch ihr Brustkorb war wie zugeschnürt, sie konnte nicht atmen. Der Raum begann sich zu drehen und sie stürzte in eine Finsternis.
Clara öffnete die Augen und merkte, dass sie auf dem hellen Sofa im Wintergarten lag. Findling saß neben ihr und leckte ihre Hand. Sie strich ihm über den Kopf und hörte, wie seine Rute erfreut auf den Bretterboden klopfte.
»Oh Baronesse«, sprach die Zofe neben ihr. Clara erkannte die alte Frau auf einem Stuhl sitzend und sich erschöpft ans Herz greifend. »Sie bringen mich noch ins Grab. Ich dachte schon, Sie wären ebenfalls ermordet worden.«
»Meine Eltern sind dort drüben«, sagte Clara mit leiser Stimme, ohne den Kopf zu heben. Sie starrte an die hölzerne Decke.
»Ich weiß.«
»Sie leben nicht mehr. Archibald auch nicht. Alles ist voll Blut.«
»Ich weiß. Kommen Sie. Wir müssen fliehen, bevor die bösen Männer wiederkommen.«
Clara fuhr erschreckt hoch, als hätte sie ein Blitz getroffen. »Die bösen Männer kommen zurück?« Panik verengte erneut ihren Brustkorb und sie rang nach Luft.
»Ich fürchte ja. Sie wollen auch Sie töten.« Die Frau reichte ihr die Hand. »Kommen Sie mit, ich verstecke Sie.«
»Sie wollen mich töten? Warum?«
»Weil sie böse sind.«
Clara stand langsam auf, doch es fühlte sich an wie von Marionettenfäden gezogen. Sie schien jegliches Gespür für ihren Körper verloren zu haben. Wie im Traum reichte sie der Frau zitternd ihre Hand. Ihr Inneres fühlte sich leer und kalt an, wie eine Maschine ohne den antreibenden Dampf.
Die Zofe zog sie über den Hof zum Tor.
»Mein Pferd, Findling …«, flüsterte Clara, doch die alte Frau schüttelte nur streng den Kopf.
Sie führte das Mädchen durch die Straßen. Clara folgte wie in einem Traum. Alles schien unwirklich, als wäre sie in eine dieser gläsernen Schneekugeln gezogen worden, deren Inhalt sie bisher nur von außen betrachtet hatte. Die Passanten, die auf einmal so riesig wirkten und mit finsterem Blick auf die herabzuschauen schienen. Das schmutzige, mit Unrat und Stroh bedeckte Kopfsteinpflaster, auf das sie noch niemals einen Fuß gesetzt hatte. Sie fühlte sich geschrumpft, unwirklich. Es stank nach Essensabfällen und Fäkalien, hin und wieder huschte eine Ratte vor ihnen in die schützende Dunkelheit der Kanäle. Ihr wurde übel und schwindelig. Die hohen Sohlen ihrer Reitschuhe schlitterten über die schlammigen Steine, doch die Zofe hielt fest ihre Hand und balancierte jedes Straucheln aus.
Clara bemerkte, dass die alte Frau sich des Öfteren umschaute, als fürchtete sie Verfolger. Ihr hingegen waren alle Menschen hier suspekt. Das Pärchen, deren Blicke stirnrunzelnd auf dem teuren, aber nun schmutzigen Reitkleid hängenblieben. Der Straßenmusiker, dessen Akkordeon die Laute einer gequälten Katze auswarf, deren Widerhall sie durch die Gassen verfolgte. Der dunkelhäutige Mann im beigen Anzug, der sie anzustarren schien, die Kinder in der Ecke, die wohl abwogen, ob sie einen Versuch wert wäre. Sie wollte nur fort von all den angsteinflößenden Blicken, raus aus diesem gruseligen, stinkenden Teil der riesig wirkenden Stadt, der sie zu erdrücken drohte.
Sie erreichten eine kleine Hütte inmitten des Trubels. Die Frau holte einen Schlüssel hervor und öffnete die Tür. Sie schob Clara rasch hinein, nicht ohne sich erneut umzuschauen. Es roch muffig, gepaart mit dem beißenden Gestank von Katerurin.
Der kleine, armselige Raum war vollgestopft mit allerlei Kram. Von Tonkrügen und Küchenutensilien auf dem kleinen Regal über bestickten Kissen auf dem zerschlissenen Sofa bis hin zu mehrfach gekitteten Vasen mit verstaubten Trockenblumen am Fenster. Zwei Katzen sprangen auf, als sie eintraten und verschwanden unter dem Sofa. Drei weitere lagen noch auf selbigem. Alles war bedeckt mit Tierhaaren und von etlichen Flecken auf Boden und Kissen wollte sie nicht den Ursprung erfahren. Wie konnte jemand so leben?
Die Frau verriegelte die Tür. »Mein Schwager wird gleich kommen und uns in seinem Wagen zum Bahnhof mitnehmen.«
Clara blickte die Frau zögerlich an. Ein Hoffnungsschimmer glomm auf. »Wir fahren mit der Eisenbahn?« Sie erinnerte sich an die Geschichten ihres Vaters, wie luxuriös ein solches Abteil eingerichtet und wie angenehm es zu reisen war im Vergleich zu den unbequemen Postkutschen von früher.
Die Zofe nickte. »Hermann kennt den Kantineur dort, der uns in einen der Güterwaggons schmuggeln wird.«
Clara schnappte nach Luft. »Güterwagen?« Hörte sie richtig? Endlich würde sie wie erträumt mit einer Lokomotive fahren können, da sollte sie wie Ware in einem zugigen Güterwaggon zwischen schmutzigen Kisten und Paketen hocken?
Die Frau öffnete eine Holztruhe und holte ein altes, muffiges Kleid, einen mit Flicken übersäten Mantel und zwei Stoffschuhe heraus. »Zieh das an!« Sie warf es auf die Sitzbank daneben, von der mit einem protestierenden Miauen eine weitere Katze sprang, die Clara gar nicht gesehen hatte.
Clara schnaubte. »Pfui Teufel, solch ein Lumpenkleid werde ich ganz sicher nicht anlegen!«
Die alte Frau richtete sich auf und stemmte ihre stämmigen Arme in die Hüften. »Kleide dich darin, Mädchen, wenn dir dein Leben lieb ist!« Ihre Stimme klang harsch. »Du bist nun bürgerlich und besitzlos. Du solltest deinen hübschen Kopf schön gebeugt halten, ansonsten werden die bösen Männer auch dich finden und dir die Kehle durchschneiden!«
Clara zuckte zusammen, als hätte sie eine Ohrfeige erhalten. Das heute erlebte wirkte noch immer nach und der ungewohnt strenge Blick der Zofe hielt sie davon ab, Empörung zu zeigen. Sie kämpfte die aufkommenden Tränen hinunter, schluckte hart und begann, ihr geliebtes Reitgewand auszuziehen.
Als sie in das fleckige und stinkende Leinenkleid stieg, das am Körper kratzte wie Hautausschlag, glich ihr Selbstbewusstsein einem leckgeschlagenen Schiff.
3 Ausgesetzt
November 1885
Clara stand alleine in der Kälte und starrte auf das triste Land um sie herum. Nur langsam erhob sich die Morgensonne über den weiten Horizont. Keine hohen Steinhäuser, die Schutz boten, nicht einmal eine Eisenbahnstrecke führte zu diesem Ort. Die Zofe hatte sie in einer Mietkutsche bis hierher gebracht und einfach aus dem Gefährt gestoßen.
Die Nachtluft roch klar, war aber auch klirrend kalt. Ein eisiger Wind blies ihr durch das schäbige Wollkleid. Helle Wolken zierten den orangefarbenen Morgenhimmel statt des Qualms von Schornsteinen. Die Kälte kam jedoch nicht gegen die in ihrem Inneren an. Der leere, dunkle Raum in ihrem Herzen verstaubte mit jeder Stunde mehr.
Sie musste sehen, wo sie eine Arbeit und eine Bleibe fände, bevor sie in der Nacht erfrieren oder verhungern würde. Ob es hier Wölfe gab? Oder Wegelagerer, die nur darauf warteten, eine junge Frau alleine zu erwischen? Sie fröstelte und ballte die klammen Hände zu Fäusten. Nein, sie würde sich nicht gehen lassen, immerhin war sie adliger Herkunft! Clara klammerte sich an die Wut, die ihre Angst verdrängte. Sie war das einzige, das ihr Innerstes mit Wärme füllen konnte.
Winzige Schneeflocken wirbelten vom Himmel. Ein frostiger Wind stach ihr ins Gesicht, als wollten Millionen winzige Eiskristalle sie von diesem fremden Ort verscheuchen, zu dem sie nicht gehörte. Immer wieder drängten sich die schrecklichen Bilder des letzten Tages in ihre Erinnerung. So viel Blut! Es war geschehen, sie war in diesem Albtraum gefangen, aus dem es kein Entrinnen gab.
Nun galt es, zu überleben.
Aber wie? Was sollte sie tun? Wohin gehen? Sollte sie in einem der Dörfer einen Wachmann suchen und ihre wahre Herkunft verraten? Sie würden einem solchen Lumpenmädchen kaum glauben und sie auslachen oder gar mit dem Knüppel verscheuchen wie einen Hausierer. Ihren wahren Namen zu nennen, könnte sie jedoch in Gefahr bringen. Vielleicht war sie nur hier sicher vor den Mördern. Die Zofe hätte doch ansonsten kaum diesen Aufwand betrieben, sie so weit fortzubringen. Aber warum hatte sie Findling nicht mitnehmen dürfen? Er hätte sie vor so vielem beschützen können.
Sie ging den Weg entlang, dessen Wagenspuren stellenweise zu harten Rillen gefroren waren. Zu kleinen Eisflächen erstarrte Pfützen füllten sie aus. Durch die Sohlen der dünnen Stoffschuhe, die dazu noch zu groß waren, spürte sie jeden Stein und dazu die eisige Kälte.
An einem hölzernen Zaun erkannte sie einen Mann stehen. Ein brummiger Kauz, in einen langen schwarzen Wollmantel gehüllt. Den Filzhut mit der breiten Krempe, den bereits Schneeflocken bedeckten, tief ins bärtige Gesicht gezogen. Sie beschleunigte ihre Schritte und wollte rasch an ihm vorbei. Diese Gestalt würde sie gewiss nicht um Hilfe bitten, da suchte sie lieber ein Kloster auf. Trotz ihrem immer schneller schlagenden Herzen wagte sie einen Blick zur Seite und schnappte innerlich erschreckt nach Luft. Das linke Auge des Mannes war künstlich, wie eine Prothese, und starrte sie direkt an, während das echte weggedreht und auf skurrile Weise abwesend wirkte. Clara wusste gar nicht, dass solch eine Apparatur bei Menschen möglich war, es gruselte und faszinierte sie zugleich. Sie wollte jedoch keinen untergebenen Eindruck machen und sah ihm direkt in die kupferne Iris, als sie auf seiner Höhe war. Der alte Mann verzog keine Miene. Er wies kurz auf den Wegweiser am Straßenrand. »Geh nach Alsfeld«, brummte er. Sein Atem, aus dem sie einen leichten Alkoholgeruch wahrnahm, kondensierte in der kalten Luft. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich um und hinkte an seinem Stock davon.
Clara dachte nicht weiter darüber nach und marschierte in Richtung des genannten Ortes. Das nahm ihr wenigstens eine Entscheidung ab.
Sie hüllte sich in den viel zu dünnen Mantel, ihre Nase tropfte und sie zitterte am ganzen Leib vor Kälte. Sie ging schneller, um sich warmzuhalten, dennoch kam ihr der Weg wie eine Ewigkeit vor. Was sollte sie überhaupt machen, wenn sie den genannten Ort erreichte? So spät am Tag noch Arbeit suchen? Wo sollte sie übernachten? In einer Scheune? Da würde sie bei dieser Kälte sicherlich erfrieren.
Der Wald lichtete sich und die Straße wurde breiter. Die ersten Gebäude tauchten in einer Senke vor ihr auf. Clara betrachtete das Städtchen, das Alsfeld sein müsste. Die Dächer einiger höherer Gebäude und Kirchtürme ragten zwischen etlichen Fachwerkhäusern hervor und eine alte Steinmauer umkreiste den inneren Teil, die ein Wachstum darüber hinaus jedoch nicht hatte aufhalten können. Der Ort wirkte durchaus freundlich und einladend, beinahe wie aus einem Märchen der Gebrüder Grimm. Clara wickelte den dünnen Mantel enger um sich, doch die Kälte ließ sich nicht stoppen.
Nach weiteren langen Minuten erreichte sie die Steinmauern eines Klosters. Sollte sie über ihren Schatten springen und hier um Hilfe bitten? So etwas war ihr stets zuwider. Entweder jemand wollte helfen, dann sollte er es von sich aus tun oder eben nicht, frotzelte der Stolz in ihr. Dann müsste man ihn auch in Ruhe lassen … aber woher sollten die Leute wissen, dass sie Hilfe benötigte, wenn sie nicht darum bat? In einem Gotteshaus half man für gewöhnlich gerne und freizügig.
Vielleicht konnte sie über ihren Schatten springen und sogar Freunde finden …
Sie dachte an Findling, den einzigen Freund, den sie je gehabt hatte, und ihr Herz sank wie Blei im Wasser. Wie es ihm wohl ging? Kümmerte sich jemand um ihn? Oder lief er irgendwo herrenlos und hungrig durch die Straßen, von Passanten getreten und die künstlichen Gelenke von Rost und Schmutz überdeckt? Eine tiefe Traurigkeit erfüllte sie bei dem Gedanken.
Clara kauerte sich auf einen Pfosten vor einem kleinen Laden und schlang fröstelnd die Arme um ihren Oberkörper. Sie merkte mit Verdruss, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten. Was sollte sie tun? Wo sollte sie hin? Sie war alleine, ganz alleine. Zum ersten Mal in ihrem Leben wollte sie das nicht mehr sein.
Noch bevor die erste Träne über ihre Wangen laufen konnte, stupste sie eine kalte Schnauze an. Clara sah auf und in die braunen Augen eines struppigen Schäferhundes, der sie beschnüffelte. Sein warmer Hundeatem ließ die Trauer hinwegschweben wie Schneeflocken im Wind. Sie berührte das Tier vorsichtig und als es sich schwanzwedelnd an sie schmiegte, streichelte Clara es. Leider hatte der Hund einen Strick um den Hals, er musste also jemandem gehören.
Ein junges Mädchen in ihrem Alter trat vor sie. »So kenne ich Branka gar nicht«, sagte sie freundlich. Lange blonde Haare schauten unter der grünen Wollhaube hervor, die glatter waren als Claras braune Locken. »Sonst ist sie nie so zutraulich zu Fremden. Sie mag dich.« Ihr Atem qualmte in der eisigen Luft.
»Ein schönes Tier.« Clara kraulte dem Hund die Ohren, sie genoss die Wärme, die er ausstrahlte.
Das fremde Mädchen zog sich ihren Wollmantel enger um den Körper, als ließe der Anblick Claras dünner Kleidung sie frösteln. »Wer bist du? Ich habe dich noch nie hier gesehen.«
»Ich wuchs in dem Kinderheim in Marburg auf«, antwortete sie mit der Lüge, die ihr die Zofe noch auf der Zugfahrt eingebläut hatte. Sie kannte den genannten Ort zwar nicht, hoffte aber, dass man so etwas von einem Heimkind auch nicht erwarten würde. »Weißt du vielleicht, wo ich hier eine Arbeit oder Bleibe finden könnte?«
»Ich bin Ingrid.« Die Blonde streckte Clara die Hand hin.
»Ich heiße Clara.« Sie erwiderte den zu weichen Händedruck widerwillig. Für eine Fremde war ihr das zu viel Körperkontakt.
»Oh, das ist ein schöner Name! So elegant. Wenn du willst, kannst du mit mir kommen, mein Vater sucht eine Hilfe. Eigentlich einen Mann.« Sie hielt die Hand vor den Mund und kicherte hinein. »Kennst du dich mit Pferden aus?«
Clara riss die Augen auf wie ein Kind, dem man einen Schokoladenkuchen versprach. »Ja, sehr gut sogar. Ich besaß selbst …« Sie verstummte rasch und biss sich auf die Zunge. Beinahe hätte sie sich verplappert. Wie es Queen wohl ging? Sicher würde ihr Onkel das Gut übernehmen und die wertvollen Pferde ebenfalls. Ob er hinter der Ermordung stand? Er war schon immer scharf auf das Vermögen seines Bruders gewesen …
Ingrid schien zum Glück nicht bemerkt zu haben, dass ihr Gegenüber den Satz nicht beendete.
»Das ist toll!« Sie klatschte begeistert in die Hände. »Vielleicht stellt dich mein Vater ein. Ihm gehört das Wirtshaus auf dem Hügel.« Sie zeigte den Weg zurück. »Dann hätte ich endlich eine Freundin. In die Stadt ist es immer so ein weiter Weg. Am besten, du kommst gleich mit. Hierher, Branka!«
Wieder die Anhöhe hinauf, die sie gerade hinuntergekommen war? Clara seufzte innerlich, sagte jedoch nichts.
Ingrid nahm den Hund am kurzen Strick und winkte Clara zu, ihr zu folgen. Gemeinsam gingen sie die breite und wie es aussah, häufig befahrene Straße entlang.
Das Mädchen redete ohne Punkt und Komma, während sie den Hügel bestiegen. Clara war froh darüber. So konnte sie unbemerkt ihren Gedanken nachhängen. Sie hörte zwar kaum, was ihre Begleitung erzählte, aber gewiss würde sie alles noch mehrmals zu Ohren bekommen. So irrsinnig viel zu berichten konnte es schließlich nicht geben in diesem winzigen Ort. Es würde sicher nicht einfach sein, diese aufdringliche Person ständig um sich haben zu müssen, dennoch freute sie sich sehr über diese Begegnung. Pferde! Erst der Tipp des Mannes, dann der Hund. Das konnte kein Zufall sein, nein, es war ihre Bestimmung. Sie würde die Stelle bekommen, daran glaubte sie fest.
Vor dem Wald bog Ingrid nach links in einen Feldweg ein. Die Strecke war nicht allzu steil, aber das stetige Ansteigen beschwerlich und zehrte an Claras Kräften. Ihre Waden schmerzten und der leere Bauch beschwerte sich lautstark über mangelnde Energie. Sie wünschte sich, ihre Beine wären künstlich wie die Findlings, mit einer Feder, die einfach aufgezogen werden konnte, um sie wieder zum Laufen zu bringen.
Lediglich Ingrids Gerede lenkte sie ab. Dem recht stämmig gebauten Mädchen schien der Weg nicht das Geringste auszumachen.
Als sie das Wirtshaus erreichten, musste Clara sich bemühen, nicht zu laut zu schnaufen. Immerhin fror sie nicht mehr. Neugierig sah sie sich um. Es war ein schickes, zweistöckiges Gebäude aus Fachwerk mit einem hölzernen Stall daneben. Der Geruch von Pferdemist stieg in ihre Nase und ließ ihr Herz schneller schlagen.
Auch einen Verschlag mit Hühnern gab es neben dem in der Kälte qualmenden Misthaufen, und einen kleinen Gemüsegarten, der jetzt jedoch langsam einschneite. Nur die Stangen des Grünkohls verrieten seinen Zweck.
Vor dem Gebäude hing ein großes, hölzernes Schild, das mit Ketten an einem Pfahl schwang. Zur Pfefferhöhe stand darauf geschrieben.
Ingrid ließ Branka los, die jedoch nicht von Claras Seite wich, und winkte dem Mann zu, der gerade aus dem Stall trat. »Vater!«
Die stämmige Gestalt mit der in der Bauchregion deutlich gespannten grünen Weste blickte mürrisch auf die Neuankömmlinge. Mit zusammengekniffenen Augen musterte er Clara von oben bis unten und schien zu erkennen, dass es sich hierbei offensichtlich um keinen zahlenden Gast handelte.
»Was schleppst du solch eine Lumpen-Dirne hierher«, brüllte er. »Wenn das die Gäste sehen! Spiele im Dorf oder am besten gar nicht mit so etwas.«
Ingrid zuckte zusammen und zog den Kopf ein. »Das ist Clara, meine neue Freundin, sie sucht Arbeit.«
»Wir brauchen keine Hilfe im Schankraum oder willst du, dass ich deine Faulheit und die deiner Mutter auch noch bezahle?« Der Wirt stand mit gerötetem Gesicht und erhobenem Zeigefinger vor den beiden, wie eine Dampfmaschine ohne Ventil. Clara erkannte, dass die Tochter zu sehr eingeschüchtert wirkte, um noch argumentieren zu können. Mit einem verachtenden Blick betrachtete sie den keifenden Vater. Solche Choleriker, die gleich schimpften und nicht zuhörten, waren ihr zuwider. Sie besann sich jedoch. Als Besitzlose gehörte Clara nun zum niederen Volk, das musste sie lernen zu akzeptieren.
Sie neigte höflich den Kopf. »Guten Tag, werter Herr. Entschuldigen Sie mein Auftreten, aber ich besitze leider keine bessere Kleidung. Ich benötige Arbeit, um Selbiges zu ändern, und hörte, Sie suchen jemanden für den Stall?«
Dem Mann fielen fast die Augen aus dem Kopf, er riss den Mund auf, um etwas zu erwidern, doch irgendetwas in Claras Blick oder Haltung schien ihn abzuhalten. Langsam schloss er den Mund wieder, die Gesichtsmuskeln entspannten und das Rot klang ab. Dann schob er seine Mütze nach hinten und kratzte sich mit der breiten Hand über die Glatze.
»Nun, versuchen kann ich es ja mal. Die bisherigen Burschen waren so unfähig, da kann ein Weibsbild kaum schlimmer sein. Hast du schon mit Pferden gearbeitet? Auch mit diesen neumodischen Automobilen? Hier am Gasthof rasten häufig allerlei Reisende mit vielerlei Gefährt.«
»Ja, Herr, ich kann bereiten und vermag auch einige Maschinen zu warten und zu reinigen.«
Der Mann lachte schallend auf. »Eine hohe Meinung scheinst du ja von dir zu haben, der Rest wird sich zeigen. Aber was soll’s, versuchen wir es. Du kannst im Stall schlafen und bekommst Essen und Trinken. Wenn du gut bist und einer der edleren Gäste was springen lässt, gehört es dir. Doch ob es zusätzlich Lohn von mir gibt, kommt drauf an, ob du was taugst!«
Kein Wunder, dass der nur unqualifizierte Angestellte bekam, dieser Geizkragen! Das glich einer Leibeigenschaft! Clara sprach ihre Gedanken nicht laut aus. Sie presste die Lippen zusammen und nickte ihm untergeben zu.
Ingrid neben ihr stieß einen unterdrückten Jauchzer aus. Sofort drehte sich ihr Vater zu ihr. »Und du marsch in die Schankstube! Dass alles sauber ist, wenn ein zahlender Gast kommt!«
Das Mädchen zuckte zusammen und rannte los.
4 Wölfe
2 ½ Jahre später
März 1888
Wie jeden Morgen weckte sie das Krähen des Hahns, der den Sonnenaufgang begrüßte. Clara schlug die Augen auf und beobachtete eine Weile die Staubflocken, die in den dünnen Lichtstrahlen tanzten. Hier oben im Heulager über den Pferdeboxen war es auch im Winter relativ warm. In ganz kalten Nächten schlief sie zwischen den Pferden in den Boxen. Nun war es bereits März und die Sonne gewann spürbar an Kraft.
Über zwei Jahre war sie nun bei dem Wirt der Pfefferhöhe, wie der Hügel genannt wurde, angestellt. Ihren achtzehnten Geburtstag vor einem Monat ließ sie unerwähnt. Die Wirtsfamilie fragte sie nie nach persönlichen Dingen, was sie begrüßte. Clara war für alle hier nur eine Waise und Besitzlose. Alleine dieses Datum könnte die bösen Männer wieder auf ihre Spur bringen. Sie glaubte jedoch immer mehr, dass ihr Onkel hinter den Morden steckte, um den Besitz zu ergattern. Sollte er daran ersticken!