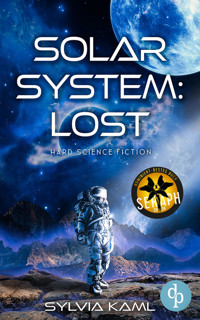9,49 €
9,49 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Menschliche Kolonisten verließen die zerstörte Erde, um sich auf einem entfernten Mond ein eigenes Utopia zu erschaffen. Doch die Besiedelung geschieht nicht ohne Folgen für die Ureinwohner des Himmelskörpers und ein Konflikt ist unausweichlich. Die Menschheit steht erneut in Gefahr, durch eigene Fehler endgültig ausgerottet zu werden. Dieses Buch beinhaltet alle fünf Bände der Serie: Krieg (1), Überleben (2), Fremde (3), Jäger und Beute (4) und Opfer (5)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Impressum © 2025 Sylvia Kaml, Winsterstr. 67a, D-45481 Mülheim an der Ruhr
Alle Rechte vorbehaltenDie in diesem Buch dargestellten Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht vom Autor beabsichtigt.Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.Lektorat: Paul Lung, Michael SpitzerCoverdesign von: Sylvia Kaml via Canva.comLogo: Hera N. Hunter
Kolonie Neumond
Dieses Sammelband enthält alle Bände der fünfteiligen Science-Fiction-Serie.
Sylvia Kaml
Sammelband
Teil 1-5
Teil 1
Krieg
1.
»Wie wäre es mit einem Besuch im Tiergehege morgen? Wir haben schon so lange nichts mehr als Familie unternommen.«
Mit gehobenen Augenbrauen schaue ich von dem Reader auf. Ist das tatsächlich mein viel beschäftigter Vater, der gerade diese Worte sagte? Da steht er vor mir im Türrahmen, der schmale Mann mit den dunkelblonden Haaren und blauen Augen und schaut mich fröhlich an. Beinahe falle ich in sein Lächeln ein. Der Zoo! Den Ort liebe ich noch immer. Früher waren wir häufig dort, bei jedem Gehege studierte ich die Anzeigen so oft, bis ich das Leben und Verhalten sämtlicher Tiere des Mondes auswendig konnte. Genau, wie ich alle verfügbaren Bücher über Lebewesen auf der früheren Erde verschlungen habe. Dennoch halte ich meine Mundwinkel in Zaum. Obwohl mich der Gedanke, diesen Ausflug mit der Familie zusammen zu unternehmen, mehr als reizt, will ich mir mit meinen zwölf Jahren keine Blöße geben.
Ich verziehe den Mund. »In den Zoo? Das ist doch nur was für Kleinkinder!« Den abfälligen Tonfall bereue ich sofort, als sich ein Schatten der Betrübnis über das fein gezeichnete Gesicht meines Vaters legt. Ihm sieht man es sofort an, dass er in einem Labor arbeitet, finde ich. »Warum überhaupt?«, werfe ich schnell hinterher. Er soll nicht aufgeben, nein, er muss mich weiter überreden, bis ich scheinbar genervt nachgeben werde. »Du bist doch sonst immer so beschäftigt.«
Mein Vater tritt nun ganz in das Wohnzimmer und setzt sich zu mir auf das Sofa. »Ja«, sagt er mit sanfter Stimme. »Das neue Projekt hat mich die letzten Monate stark eingespannt. Ich hatte keine Zeit mehr für die Menschen, die mir am meisten bedeuten, das tut mir sehr leid. Aber jetzt habe ich eine Woche frei, da dachte ich, wir unternehmen wieder mal etwas zusammen. Morgen ist Samstag, da bist du nicht in der Schule und Lionel hat keine Vorlesung.«
»Du hast Urlaub?« Ich lege den Reader zur Seite und wechsele von der halb liegenden Stellung in eine Sitzposition über, die Beine noch auf der Couch lassend. »Dann könnten wir eine Tour durch den westlichen Dschungel machen. Das wollten wir doch schon immer mal! Raus aus der Stadt.« Upsi, besinne ich mich. Mal wieder habe ich meine Fassade zu früh fallengelassen. Ich schaffe es einfach nicht, cool zu sein.
Vater schüttelt mit ernster Miene den Kopf. »Es wurde ein Reiseverbot für alle Menschen aus Neumond verhängt. Zur Sicherheit. Es gab wieder Überfälle.«
Ich schlucke. »Die Predyler?«
Die Ureinwohner dieses Mondes geben mir noch immer eine Gänsehaut. Sie sind unheimliche, beinahe gruselige Kreaturen, uns Menschen so ganz unähnlich.
Außer Biran. Der ist anders, er gehört nicht wirklich zu diesen Wesen. Zumindest ist das in meiner Vorstellung so. Aber ich darf ihn nicht erwähnen, Biran ist mein Geheimnis.
Vater nickt. »Ja, Luna. Es ist leider zu gefährlich für uns Menschen dort draußen geworden. Wir sollten eine Zeit lang in der sicheren Stadt bleiben, bis sich die Wogen wieder glätten.«
»Hast du deshalb frei? Weil ihr keine Aufträge mehr habt? Stimmt es, was die anderen sagen? Dass es Unruhen in den Bergwerken und auf den Farmen um Neumond herum gibt?«
Er geht nicht auf meine Frage ein. »Ich würde die Zeit einfach gerne nutzen, um mit der ganzen Familie etwas Schönes zu unternehmen«, sagt er stattdessen. »Wer weiß, wann wir wieder die Gelegenheit dazu haben. Vielleicht kommt es doch zu einer offenen Auseinandersetzung.«
»Patrik!« Die helle Stimme meiner Mutter durchschneidet die Luft wie ein scharfes Messer. Sie steht mit Händen in die Hüften gestemmt am Türrahmen. Wie lange schon, weiß ich nicht. »Hör auf, dem Kind Angst zu machen. Es wird sich alles einspielen. Ganz gewiss.«
Ich hasse es, von ihr Kind genannt zu werden. Luna ist zwar auch nur mein Spitzname, aber zumindest ein Name.
»Wir sollten den Tatsachen in die Augen blicken, Lisa.« Mein Vater spricht wie immer leise, dennoch schwingt eine ungewohnte Besorgnis in seinem Ton mit.
Mutter schüttelt energisch den Kopf, ihre Wangen wiesen sie roten Flecken auf, die sie immer bekam, wenn sie sich aufregte oder Sport machte. »Ich sehe nur eine brüllende, kriminelle Horde, die gegen unsere Polizei keinerlei Chancen hat.« Ihre Stimme klingt kühl, beinahe sachlich, doch ich weiß, dass sie die aktuellen Probleme nur von mir fernhalten möchte. Aber ich bin kein kleines Kind mehr, das behütet werden muss. Dennoch krampft sich mein Magen zusammen, als ich an die gefährlich aussehenden Ureinwohner denke und wie sie mit scharfen Klauen und Zähnen unser Haus stürmen und sich auf uns stürzen.
In diesem Moment tritt mein Bruder ins Wohnzimmer. »Und ob die Chancen haben. Wir Menschen sind mal wieder dabei, uns selbst auszurotten«, sagt er kühl und spaziert an Mutter vorbei in die Küche.
Lionel ist sieben Jahre älter als ich. Er hat gerade die Schule beendet und sein Jurastudium begonnen. Ich bemerke, wie ähnlich er Vater geworden ist in den letzten Monaten. Nicht nur optisch, auch in seiner ganzen Art und politischen Einstellung.
»Wie wäre es erst einmal mit einem Guten Abend, junger Mann?«, schimpft Mutter, doch nur halbherzig.
Mein Bruder ignoriert sie und schlurft mit einem Glas Wasser in der Hand wieder zurück ins Wohnzimmer.
Vaters Gesicht hellt sich schlagartig auf, als er uns alle gemeinsam in einem Raum sieht. »Was ist nun?« Er reibt feierlich die Handflächen ineinander, als hätte es die Diskussion zuvor nicht gegeben. »Wollen wir ins Tiergehege morgen?«
Ich nicke heftig.
Mutter lächelt ebenfalls und zwinkert Vater dankbar zu. Der Ärger scheint vergessen. Sie reagiert oft emotional, ist aber niemals nachtragend.
Lionel hingegen trinkt sein Glas leer und stellt es etwas zu laut auf den Tisch.
»Ohne mich. Ihr wisst, was ich davon halte, Tiere zu unserer Belustigung in Käfige zu sperren.«
Mutter lässt einen theatralischen Stoßseufzer von sich.
Lionel hebt abwehrend die Hände. »Ich bin nicht in Stimmung für eine Diskussion darüber, also keine Sorge«, kommentiert er ihren offensichtlichen Gedankengang. »Geht einfach ohne mich und habt einen netten Tag.« Mit diesen Worten verschwindet er die Steintreppe nach oben.
Ich presse die Lippen aufeinander und blicke zu Boden. So gerne hätte ich mal wieder etwas mit meinem Bruder unternommen.
Ich hänge unheimlich an ihm, auch wenn ich es niemals offen zugeben würde.
»Wie wäre es mit dem Schwimmbad oder der Einkaufszeile?« Mein Vater fährt sich mit der Hand über die Haare.
»Da geht unser nun erwachsener, ach so vernünftiger Sohn gewiss auch nicht mit, das wäre ja Spaß«, spottet Mutter. »Lass ihn, wir gehen morgen alleine in den Zoo.«
Vater deutet ein Lächeln an, wirkt aber sichtlich enttäuscht. »Ja, machen wir das.«
Mit dem Reader in der Hand sinke ich tiefer in die Couch und versuche, mich in die Geschichte des Romans hineinzuversetzen. Es gelingt mir nicht. Meine Augen wandern über Wörter und Zeilen, aber die Gedanken wandern immer wieder fort. Ich blättere um, ohne die Seite wirklich gelesen zu haben.
Vaters Verhalten bereitet mir Sorgen. Er wirkt irgendwie seltsam verzweifelt, als will unbedingt er einen letzten Wunsch erfüllt bekommen. Als würde es später keine Gelegenheit mehr dazu geben. Weiß er mehr als wir? Ist es denn schon so ernst? Sind wir tatsächlich kurz vor einem Krieg mit den Ureinwohnern des Mondes? Diese Überlegung ängstigt mich mehr, als ich zugeben möchte. Es würde nur Mutters Sorge um mich bestätigen. Aber ist ein militärischer Konflikt überhaupt denkbar bei der Ungleichheit? Wollen die mit Speeren auf unsere mit Maschinengewehren bewaffneten Soldaten stürmen?
Es stimmt, die Neumonder Nachrichten sind in den letzten Wochen bis zum Überquellen gefüllt mit Berichten über die ursprünglichen Mondbewohner. Das ist durchaus etwas Ungewöhnliches, da man sie früher kaum erwähnte. Es wurde stets ein gewisser Abstand eingehalten, eine strikte, kulturelle Trennung. Diese reptilienartigen Wesen blieben uns fremd, werden lediglich als Arbeiter und Dienstboten in der Stadt geduldet, leben jedoch außerhalb in Siedlungen. Um ihre Kultur zu wahren, heißt es. Je mehr die Ureinwohner sich nun aber unserer Obrigkeit widersetzen, desto misstrauischer und auch ängstlicher werden wir Menschen ihnen gegenüber. Es gibt immer wieder die gleiche Berichterstattung in den Medien: Protestierende Gruppen von Predylern fordern Rechte und Anerkennung, während Menschen gegen die schleichende, feindliche Übernahme unserer Kultur durch diese dubiosen, blutrünstigen Ureinwohner aufmarschieren.
Mich nervt das Ganze nur noch.
Auf einmal stürzt Lionel zurück ins Wohnzimmer. »Macht mal die Nachrichten an!«
Mein Vater brüht sich gerade einen Tee und blinzelt irritiert. »Was? Warum?«
»Jake hat mir übers Com geschrieben, da geht es ab in der Stadtmitte.« Er wirkte auf einmal nicht mehr so gelassen, sondern unsicher und nervös.
Eine Furcht steigt in mir auf. Das mulmige Gefühl einer Bedrohung, die zwar den Magen zusammenzieht, aber nicht greifbar ist. »Ich möchte das gar nicht sehen, lass den Bildschirm aus!«, rufe ich aus. Niemand hört auf mich.
Meine Eltern setzen sich zu mir auf das Sofa, Lionel nimmt auf dem Sessel daneben Platz. Vater schaltet den großen Monitor an der Wand an und wählt mit dem Sprachbefehl den Nachrichtensender Neumonds.
Sofort ist das gesamte Wohnzimmer mit Licht und Ton erfüllt. Ich starre wie gebannt auf den Bildschirm, der die Nachrichten in brutaler dreidimensionaler Schärfe zeigt. In der nahen Innenstadt ist es während einer erneuten Demonstration zu Ausschreitungen gekommen. Eine Reporterin berichtet vor der Kamera. Sie muss trotz Mikrofon mit lauter Stimme gegen Rufchöre, Sirenen, Schreie und Befehle aus Megafonen ankämpfen. Im Hintergrund sieht man ein Gerangel von Personen, Polizisten mit Knüppeln und Schilden in Schutzkleidung. Noch weiter entfernt durchdringen Blaulichter und rote Ziellaser verschwommen den Qualm von Tränengas.
Es dauert eine Weile, bis wir uns einen Reim aus dem Geschehen machen können. Trotz meiner Furcht verfolge auch ich gebannt die Vorgänge auf dem Bildschirm.
»Das war nur eine Frage der Zeit.« Vater schüttelt betrübt den Kopf. »Viel zu lange haben wir weggesehen, das Offensichtliche ignoriert. Jetzt zahlen wir für unsere Arroganz und ich kann es diesen Wesen nicht einmal verdenken.«
»Nicht verdenken?« Mutter schnappt regelrecht nach Luft. Es ist ihr deutlich anzusehen, dass sie am liebsten die Bilder auf dem Bildschirm anschreien würde, bis sie platzen wie eine Seifenblase und sich für immer auflösen. »Diese undankbaren Kreaturen bekamen alles von uns. Luxus, Geld, Wohnraum, Ländereien. Unsere Vorfahren teilten brüderlich, was sie damals bitter für sich selbst hätten gebrauchen können. Wir haben ihnen Arbeit gegeben, sie kultiviert. Und wie danken sie es uns nun? Mit Demonstrationen und Aufständen!« Sie schüttelt heftig den Kopf, ihre hellbraunen Locken wirbeln dabei wild durcheinander.
»Die Ureinwohner vertreten die Ansicht, dass all die Ländereien ihr rechtmäßiges Eigentum sind«, versucht mein stets diplomatischer Vater, das Geschehen zu verteidigen.
Mutter schnaubt. »Sie lebten noch weit entfernt in ihren Steppenhütten, als wir Menschen den Mond erreichten. Wir haben dieses Fleckchen Land zuerst entdeckt. Ob man nun von einem fremden Kontinent einwandert oder aus dem All, ist gleich. Die Kolonisten hatten damals kaum eine andere Wahl, als hier zu landen, sonst wären sie dem Tod geweiht gewesen. Mir ist natürlich bewusst, dass die menschliche Zivilisation die Einheimischen irritiert, ja geistig überfordert hat. Primitivität ist jedoch keine Entschuldigung für ein undankbares, asoziales Verhalten.« Sie hebt den Zeigefinger. Diese wohlbekannte Geste lässt mich unbewusst den Kopf einziehen. Mutter wird selten wütend, aber wenn, dann richtig. Nun ist sie wirklich in Fahrt, die Stimme wird immer schriller. Ich ahne, dass ihre irrationale Wut aus einer Sorge um ihre Familie heraus kommt. Wie eine Löwin, die ihre Jungen vor Leid beschützen möchte, sich aber dabei gegen einen fahrenden Zug wirft.
»Das Amt für Menschenrechte hat wahrscheinlich recht mit der Theorie, dass diese Echsen rein von ihrer Genetik her aggressiver und gewalttätiger sind«, fährt sie fort. »Immerhin ist es eine Spezies, die andere Lebewesen zur Nahrungsaufnahme tötet.«
»Die Predyler sind als Karnivoren auf fleischhaltige Nahrung angewiesen, dafür können sie nichts«, mischt sich Lionel mit seiner tiefen Stimme ein, die immer wie eine wohlige Decke auf mein Gemüt wirkt.
Mutter dreht sich ruckartig zu ihrem Sohn auf dem Sessel um. »Das behaupte ich mitnichten, aber es bedeutet eben auch, dass sie von der Natur aus dazu geschaffen sind, andere zu vernichten und zu verschlingen.« Sie verzieht angewidert das Gesicht. Mit dem roten Lippenstift sieht das beinahe witzig aus, wie eine Comicfigur. Ich muss trotz der ernsten Situation ein Grinsen verkneifen.
Lionel hebt die Brauen. »Wir Menschen haben ebenfalls einst Fleisch gegessen und Tiere getötet.«
Mein Blick scheint Pingpong zwischen den beiden zu spielen, während mich das Gefühl beschleicht, mein Bruder genießt es, sie zu reizen.
»Wir haben auch Kriege geführt. Früher.« Mutter kommt immer mehr in Rage. »Ja, wir waren einst primitiv, jedes Wesen entwickelt sich weiter. Aber das ist mitnichten der Punkt. Ein Mensch kann überleben, ohne Wirbeltiere zu töten, sie nicht. Daher ist es nur richtig, anzunehmen, dass sie von der Natur dazu beschaffen sind, Raubtiere zu sein und andere Leben abzuschlachten. Sie könnten niemals so zivilisiert werden wie wir, da sie immer wieder Tod und Blut benötigen.«
Lionel bleibt zumindest äußerlich gelassen. »Das ist Unsinn. Außerdem brauchen sie kein Blut, sondern Arachidonsäure und auch Vitamin B12. Theoretisch lässt sich das schon künstlich herstellen, so wie es die Lebensmittelingenieure für uns machen.«
Mutter öffnet den Mund, um etwas zu erwidern, doch ich warte die Argumente nicht ab. Stattdessen stehe ich auf, nehme den Reader und gehe hinauf in mein Zimmer.
Die Gespräche im Wohnzimmer dauern noch lange an. Ich höre weg, will nicht nachdenken, sondern diese Bilder so schnell wie möglich vergessen.
Mich in das Schneckenhaus zurückziehen, das Mutter die Jahre über fleißig um mich gebaut hat.
2.
Meine Flucht vor der Realität bleibt erfolglos. Kaum setzt sich Vater am nächsten Morgen zu uns an den Frühstückstisch, macht er auch schon die Nachrichten an.
Ich verdrehe die Augen und stochere lustlos in dem Müsli herum, sage aber nichts. Zumindest keine dreidimensionalen Bilder.
Die Nachrichtensprecher hören nicht auf zu berichten. Noch nie habe ich mir langweilige Mainstream-Musik oder Werbung so herbeigesehnt wie heute.
Doch das gestrige Ereignis schwebt noch immer wie eine finstere Wolke über der Stadt. Die anfangs friedlich abgelaufene und angemeldete Protestaktion der Predyler ist auf beiden Seiten zu Straßenkämpfen eskaliert. Bis geschah, was wohl früher oder später geschehen musste: Ein bekannter Rädelsführer der Predyler, der auf der gestrigen Demo in eine Schlägerei geriet, erlag seinen Verletzungen. Er verstarb noch auf der Straße, lebensrettende Hilfsmaßnahmen wurden angeblich behindert. Die Sanitäter sagen, sie seien von predylen Demonstranten attackiert worden, die Ureinwohner wiederum behaupten, unsere Mediziner hätten gar kein Interesse daran gehabt, zum Opfer zu gelangen, sondern ihn kaltherzig sterben lassen.
Dieser Vorfall scheint sich nun als Wendepunkt des Geschehens zu entpuppen. Das, was Vater befürchtet hat, traf ein. Die Einheimischen beschuldigen die Polizisten, ihren Redner regelrecht hingerichtet zu haben. Tatsächlich war er unbewaffnet und hatte sich laut Amateuraufnahmen nicht einmal zur Wehr gesetzt.
Der Fall geht in einer gefühlten Dauerschleife als Eilmeldung durch alle Medien, wird überall diskutiert und die Meinungen polarisieren wie niemals zuvor auf dem Mond.
Wir gehen nicht zum Zoo. Keiner von uns ist nach diesen Meldungen noch in der Stimmung auf einen friedlichen Familienausflug.
Entgegen meiner stillen Sehnsucht, alles Negative zu ignorieren, verfolge ich weiter die Nachrichten. Es ist wie ein Sog, dem man kaum widerstehen kann. Ob aus Angst oder Sensationsgier, vermag ich nicht zu sagen, aber meine Augen hängen wie gebannt an jeder Szene.
Während die Politiker noch überlegen, wie sie die bereits vorhandene Gefahr abwenden könnten, und vor Entscheidungen zurückschrecken, eskaliert die Situation auf den Straßen. Immer mehr aufständische Predyler werden von den mittlerweile überforderten Polizisten niedergeprügelt und verhaftet. Es kommt zu Streiks, auch Anschläge seitens der Einheimischen des Mondes treten gehäuft auf. Sie fordern ihre Rechte, zügig. Die menschliche Armee schreitet schließlich ein, um innere Sicherheit zu gewährleisten, doch es vermag keiner mit der Situation umzugehen. Die verhüllten Gesichter der gepanzerten Spezialeinheiten helfen kaum der Deeskalation. Protestierende Ureinwohner stehen so nicht mehr anderen Lebewesen, sondern ausdruckslosen Schutzmasken und Schilden gegenüber.
Ein Psychologe sagte einen Satz, an den ich mich bei solchen Szenen immer erinnern muss, doch niemand sonst scheint ihn gehört zu haben: Unsicherheit führt zu Furcht, Furcht zu Hass und Hass schließlich zu noch mehr Gewalt. Weitere Demonstranten sterben.
Langsam aber sicher wird das Wegsehen schwerer; der Ruf nach Gleichberechtigung stetig lauter. Die ersten Gerüchte über einen baldigen Krieg kommen auf.
Ich sitze an meinem Schreibtisch und schaue auf das Pad mit den Mathehausaufgaben. Zahlenreihen und Formeln verschwimmen vor meinen Augen, verwandeln sich in schwarze Gestalten mit langen Hälsen und spitzen Zähnen. Die Angst vor den Einheimischen, die als Bedrohung der menschlichen Zivilisation samt ihren Werten angesehen werden, ist uns allen gegenwärtiger als je zuvor.
Doch immer, wenn ich über diese gefährlichen Kreaturen nachdenke, erscheint ein anderes Gesicht in meiner Erinnerung, und ich sehe mich außerstande, es zu verdrängen. Dunkle, sanft blickende Augen sowie ein Lächeln mit dezent gelber Verfärbung der Hautpigmente um den Mund herum. Sind diese freundschaftlichen Gefühle nur kindliche Einbildung gewesen? Kann man sich derartig in seinem Eindruck täuschen?
Kurzentschlossen stehe ich auf, gehe in den Flur und klopfe zweimal fest an die Holztür von Lionels Zimmer. Ohne eine Antwort abzuwarten, drücke ich die Klinke hinunter und trete ein.
Mein Bruder sitzt auf dem Bett und hört über die Kopfhörer Musik. Wie sehr wünsche ich mir auch ein Com. Alle Freunde haben eines, nur ich nicht. Mutter und Vater sind da stur, so etwas gibt es in unserem Haushalt frühestens mit sechzehn.
Ich seufze innerlich.
»Lionel?«
Er reagiert nicht.
»Lionel!«, rufe ich lauter.
»Was ist?«, fragt mein Bruder sichtlich genervt, er sieht nicht einmal auf.
»Darf ich dich etwas fragen?« Ich hocke mich zu ihm auf den Bettrand.
Endlich hebt er den Kopf und entfernt die Ohrstöpsel, aus denen noch gut hörbar scheppernde Töne hallen. Seine Stirn ist gerunzelt, die hellblauen Augen schauen aber erwartungsvoll. »Schieß los!«
Mein Mut verfliegt.
»Ich wollte … was denkst du …«, druckse ich herum, den Blick auf die Finger gerichtet. Ich muss mir mal wieder die Nägel feilen. Suna hat immer so toll manikürte Fingernägel, wie macht sie das nur? Aber sie ist auch cool, im Gegensatz zu mir.
»Na los, du Träumer, ich habe nicht ewig Zeit«, reißt mein Bruder mich aus den Gedanken.
Ich atme tief durch, die Finger ineinander reibend. »Hast du schon einmal einen Predyl aus direkter Nähe gesehen?« So, jetzt ist der Anfang gemacht, nun gibt es kein Zurück mehr. Mein Herz rast wie vor einem Mathetest.
Lionel stutzt. »Nein. Eigentlich nicht. Wieso? Hast du?«
Ich nicke stumm und presse die Lippen zusammen. Warum fühlt sich das an, als beichte ich ihm Drogenkonsum oder sowas.
Mein Bruder hebt die Brauen. »Tatsächlich? Wo und wann denn?«
»Es ist schon einige Jahre her. Ich war acht oder so. Kannst du dich an das heiße Sommerjahr erinnern, als vor unserem Wohnhaus der Brunnen gebaut wurde? Das hatte einer von denen gemacht. Ein Junge, nicht viel älter als ich damals.« Ein Jahr auf diesem Mond zieht sich über vier Zyklen auf der Erde. Die Kolonisten wollten sich jedoch nicht zu sehr umstellen mit ihrer Zeitrechnung, sodass der eigentliche Jahreswechsel über zwei Sommerjahre geht, denen zwei Winterjahre folgen. Stunden, Tage und Monate wurden auf ein Zehnersystem umgestellt, dann an den Rhythmus des Himmelskörpers angepasst.
Lionel setzt sich auf, schaltet das Com aus und steckt die Ohrstecker in ihr Case. Er schaut mich zwinkernd an.
»Erzähl, wie du siehst, ich bin ganz Ohr.«
Ich atme tief durch und offenbare ihm mein bislang so sorgsam gehütetes Geheimnis.
* * *
Es war am Nachmittag eines der Sommerjahre, als ich einen der Einheimischen zum ersten Mal aus der Nähe sah. Wir schrieben das Jahr 315 nach der Landung, einen Monat zuvor war mein achter Geburtstag gewesen. Als ich aus der Schule kam, hockte so ein Wesen vor dem Nachbarhaus und baute an einem Brunnen. Der Vorgarten der Khans geht in unseren über, sodass ich an dem Arbeitsplatz vorbeigehen musste. Angst verspürte ich damals keine, eher Neugierde. Wir waren weniger vorbelastet durch die Nachrichten. Der Predyl schien außerdem noch klein, von seiner Entwicklung her nicht viel älter als ich. Predyler wachsen schneller als Menschen, sodass dieses Kind an Jahren gerechnet gewiss jünger war, ihre Lebenserwartung beträgt nur etwa zwei Drittel der unseren.
Ich fand ihn hübsch. Jeder sagt immer, dass die Ureinwohner dämonisch hässlich seien. In Cartoons und Satiresendungen werden sie entweder als furchteinflößende oder lächerliche Kreaturen dargestellt. Ich wunderte mich, dass dieses Kind so anders aussah, als ich es mir vorgestellt hatte. Natürlich wurden in der Schule echte Fotos und Filme von den Predylern gezeigt, doch mit den ganzen gruseligen Geschichten im Hinterkopf blieben auch diese verzerrt in meiner Erinnerung.
Streng genommen sehen sie uns sogar ähnlich. Sie sind aufrecht gehende Vierglieder mit einem Endoskelett. Allerdings scheinen deren Vorfahren keine Primaten gewesen zu sein, wie die unseren, sondern eher eine Art befiederter Echsen. Die Ureinwohner besitzen ebenfalls zwei Beine und Arme. Die lederartige Haut ist mit einem samtartigen Flaum bedeckt. Die Hände haben nur drei Finger mit gegenüberliegendem Daumen. Ihre Oberschenkel wirken gedrungen, fast stämmig, doch die dünneren Unterschenkel sowie der federnde Ballenstand lassen das Laufen grazil elegant aussehen.
Der Hals ist länger als der unsere, oft tragen sie darum einen bunten Schal oder enganliegende Ketten darum. Ihr Gesicht ähnelt trotz des Flaums einem Reptil. Das dieses Kindes erinnerte mich ein wenig an die Bauchhaut eines Krokodils, auch wenn ich die Tiere der Erde nur noch aus Büchern kenne. Die beiden Hauptaugen sind schwarz und stehen weiter auseinander. Statt einer Nase befindet sich in der Mitte eine Art drittes Auge, das kleiner und immer geschlossen ist. Die schuppenartigen Furchen in der Gesichtshaut mit den vielen Muskeln geben ihnen mehr Möglichkeiten einer Mimik. Anhand spezieller Pigmentteilchen sind sie in der Lage, die Haut im Gesicht ganz dezent in verschiedenen Farben erscheinen zu lassen. Ohrmuscheln sieht man unter der Kopfbehaarung keine. Der Mund ist breiter, die Zähne gleichmäßig spitz. Zum Reißen anstatt zum Kauen gedacht. Fleischfresser eben.
Die sogenannten Haare werden oft lang getragen und ähneln dem Aufbau von Federn. Sie wachsen jedoch nicht in harten Kielen, sondern in elastischen Haupthaaren, von denen fächerartig weitere, dünnere abzweigen. Das lässt sie weich, fast samtig erscheinen.
Ich erinnere mich noch, dass ich fasziniert von diesen daunenartigen Haaren des Wesens war, die in der Sonne glänzten, und ein schier unbändiges Verlangen verspürte, mit der Hand darüber zu streichen. Doch ich hielt mich mit aller Kraft zurück.
Die meisten von ihnen haben sehr dunkle Haut, mit samtigem schwarzem Flaum bedeckt, und schwarze Kopfbefiederung. Einige sind auch pigmentlos, dann sind ihre Haare weiß und die großen Augen rot wie bei Albinos.
Bei uns Menschen gibt es zwar alle möglichen Haarfarben, von Blond über Rot und Braun bis hin zu Schwarz, aber nur wenige wirklich Dunkelhäutige. Es hat sie wohl auf der Erde oft gegeben, jedoch waren kaum welche von ihnen auf den Kolonistenschiffen gewesen. Warum, weiß ich nicht. Meine Haare sind hellbraun, die Iris blau wie bei Lionel.
Dieses Predylkind hatte pechschwarze Kopfbehaarung, in deren Strähnen rote Tonperlen geflochten waren, sowie große, dunkle Augen. Seinen Blick empfand ich als sanft, beinahe melancholisch. Ich konnte nicht sagen, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelte.
Am meisten jedoch fiel mir der Anhänger auf, den es um den Hals trug. Ein an einem braunen Lederriemen hängender, dreieckiger blauer Stein, der in der Sonne glänzte.
Ich erinnere mich noch, dass ich dastand und das Predylkind fasziniert anstarrte. Bis es den Kopf hob und meinen Blick unsicher erwiderte. Es trug einen gestrickten Schal um den Hals, einen Pulli aus Blaugras – einer faserreichen Pflanze, aus der man Stoffe fertigen kann – sowie gegerbte Lederhosen. Blaugraskleidung kannte ich damals schon als robuste Arbeits- oder Winterkleidung. Man darf es nicht direkt auf der Haut tragen, sie ist oft rau und kratzt fürchterlich. Baumwolle ist jedoch zu teuer für die Einheimischen und man munkelt, dass sie aufgrund ihrer reptilienhaften Hautbeschaffenheit ohnehin weniger fühlen. Ihre Ledersachen wiederum stellen sie selbst her. Ein zivilisierter Mensch würde sich kaum wie ein Wilder in tote Tiere kleiden. Schuhe trug dieses Kind keine, die jeweils zwei Fußzehen waren schwarz mit kurzen Krallen.
Wer von uns zuerst die Mundwinkel zu einem Lächeln hochzog, daran erinnere ich mich nicht, doch es brach das Eis und die Unsicherheit verflog. Ein stilles, vorbehaltloses Einverständnis zwischen zwei Kindern. Ich mochte es auf Anhieb, trotz des fremdartigen Aussehens. Dennoch schritt ich eher zaghaft zu ihm, genau wusste ich nicht, ob das Hochziehen der Mundwinkel wirklich eine freundliche Geste war, auch wenn die Augen so sanft blickten. Glücklicherweise verbarg es dabei diese gruseligen, spitzen Zähne, die ich von den Fotos kannte. Ich stand unsicher lächelnd vor ihm, während meine Finger etwas nervös mit den dekorativen Stoffbändern des fein gewebten Baumwollkleides spielten.
»Hallo«, sagte ich.
»Guten Tag«, erwiderte es höflich in unserer Sprache.
Da waren sie, die Zähne!
So unheimlich wie auf den Bildern wirkte die Mimik gar nicht. Ein wenig bedrückte mich der Gedanke allerdings, dass solch eine Kreatur von der Evolution geschaffen war, andere Lebewesen zu essen.
Das Kind schichtete weiter die Steine aufeinander, als hatte es den kleinen Menschen vor sich als gefahrlos eingeschätzt.
Neugierig sah ich ihm zu und malte dabei mit meiner Schuhspitze Kreise in den aufgeschütteten Sand.
»Bist du ein Junge oder ein Mädchen?«
»Ich bin ein Junge.«
»Ich bin ein Mädchen.« Ich wusste zwar nicht, ob diese Information nötig war, immerhin trug ich ein geblümtes Sommerkleid, aber es erschien mir höflicher. »Was machst du da?«
»Ich baue den Brunnen für die Bewohner des grünen Hauses dort.«
Er antwortete, ohne aufzusehen oder mit der Arbeit innezuhalten. Die ganze Art war sehr erwachsen, seine Kindheit schien schon länger beendet.
»Mit so großen Steinen? Meine Mama sagt, Kinder dürfen nicht schwer tragen.«
Der Junge verzog die Mundwinkel. »Sie meinte sicher nur euch Menschenkinder. Ich bin ein Predyl, ich muss mir das Essen verdienen.«
»Hast du Hunger?«
Bevor er antworten konnte, rannte ich ins Haus. In dem großen Gebäude aus hellem Sandstein mit vielen Parteien hastete ich die Treppe hinauf in unsere Wohnung, die niemals abgeschlossen war. In diesem Viertel wohnten nur Menschen, denen kann man vertrauen.
In meinem Zimmer angekommen, schnappte ich mir die Spardose, holte anschießend noch ein großes Stück Kuchen aus der Küche und lief dann wieder hinaus in den Garten.
»Hier!« Ich reichte ihm lächelnd die Sachen. Jetzt könnte er nach Hause spielen gehen. Zu einem der vielen von den Menschen angelegten Weiher zum Beispiel, es war ja so heiß heute. Ich hatte keine Ahnung, wie es in den Dörfern um Neumond herum aussah oder wie die Einheimischen lebten. »Nun hast du Essen, wenn ihr so etwas esst, und das ist mein Taschengeld.« Ich wies auf die Spardose. »Du kannst für heute aufhören zu arbeiten.«
Er lächelte, nun nicht mehr so unterdrückt, wie zuvor. Doch was war das? Einzelne Bereiche um seinen Mund herum veränderten plötzlich die Farbe. Ich blinzelte, um sicherzugehen. Ja, da war es, eine Gelbfärbung auf der dunklen Haut, an verschiedenen Stellen im Wechsel. Weniger grell, wie ich es mir aus Erzählungen vorgestellt hatte, eher wie kleine, lebensschwache Flämmchen, aber auf dem schwarzen Untergrund deutlich zu erkennen. Fasziniert davon musste ich an den Begriff eines strahlenden Lächelns denken. Bedrohlich wirkte es zumindest nicht.
Ich kicherte. »Du funkelst ja!«
Der Junge sah schnell zu Boden. Die gelben Flecken verschwanden und die Haut war wieder einheitlich schwarz.
Schade.
Er nahm den Kuchen, aber nicht die Spardose. »Behalte dein Geld. Sonst heißt es noch, ich hätte dich bestohlen.« Während er das sprach, hielt er das Gebäck misstrauisch nahe an sein Gesicht, als wolle er trotz der fehlenden Nase riechen, ob es essbar sei. Dann legte er es auf seine Tasche. Diese Handlung passierte schnell, fast instinktiv.
»Nein, ich möchte, dass du die Spardose nimmst!«, rief ich trotzig. Ich hatte eigentlich immer erreicht, was ich wollte. »Nächsten Monat bekomme ich eh Neues.«
»Wie ist dein Name?«, fragte der Junge, ignorierte aber mein Fordern.
»Luna, und deiner?«
»Ich werde Biran genannt.« Seine Stimme klang noch immer ruhig und eher emotionslos.
»Hallo Biran. Bist du öfter hier? Dann können wir vielleicht mal zusammen was spielen.« Ich hielt die Hände am Rücken und wippte vor Vorfreude darauf auf den Zehen. Das wäre so aufregend. Was Predylkinder wohl für Spiele kannten?
»Ich weiß nicht, ob deine Eltern das dir erlauben würden, dass du mit einem von uns spielst.«
»Ich kann spielen, mit wem ich will.« Am liebsten hätte ich mit dem Fuß aufgestampft.
»He!«, rief plötzlich unser Nachbar aus dem Fenster.
Biran zuckte zusammen. Schnell versteckte er den Kuchen in seiner Tasche und arbeitete weiter.
»Kleine! Belästigt die Echse dich?«
Es war Professor Khan. Ich erinnere mich, wie sehr ich bei dem strengen Tonfall erschrak. Als Nesthäkchen war ich recht verwöhnt und noch nie angebrüllt worden. Den Nachbarn hatte ich bisher nur als netten, alten Herrn gekannt.
Nun kam er mit seinem Spazierstock auf uns zu. »Du Bengel arbeitest gefälligst weiter, sonst werde ich dir das Quatschen vom Lohn abziehen!« Er hob drohend den Stock und der Junge duckte sich, als wäre er Hiebe gewohnt. Der Anblick brach mir das Herz.
»Nein!«, rief ich und musste mich sehr anstrengen, nicht zu weinen. »Es war meine Schuld, ich habe ihn ausgefragt. Er kann nichts dafür.«
Professor Khan fuchtelte weiter mit dem Gehstock in der Luft herum. »Diese Tagediebe suchen doch immer eine Gelegenheit zum Faulenzen. Geh ins Haus, Mädchen. Hat dir dein Vater nicht gesagt, dass du mit diesen Gaunern kein Gespräch beginnen sollst?«
Schnell drehte ich mich um und rannte in unsere Wohnung. Einerseits aus Angst vor Professor Khan, aber auch, weil ich vor dem Jungen nicht weinen wollte. Im Zimmer bemerkte ich, dass ich noch immer die Spardose in der Hand hatte. Voller Wucht schmiss ich sie an die Steinwand, warf mich auf das Holzbett, das knarrend protestierte, und vergrub mein tränennasses Gesicht unter den Stofftieren.
Ich konnte mir nicht erklären, weshalb der Professor uns beide so angebrüllt hatte.
Warum durfte ich mit keinem Predylkind reden? Was war so schlimm daran?
Biran baute noch vier Tage an dem Brunnen, doch ich traute mich nicht mehr, ihn anzusprechen. Ich fürchtete, er bekäme sonst Ärger. Stattdessen beobachtete ich ihn von meinem Fenster aus. Manchmal trafen sich unsere Blicke, dann lächelte er mir zu oder winkte heimlich. Ich lächelte und winkte zurück. Es war so aufregend, wie eine verbotene Liebe, wie die Geschichte von Romeo und Julia. Irgendwann kam er nicht mehr. Ich weinte den ganzen Tag in der Gewissheit, meinen Romeo nie wiederzusehen.
* * *
»Ich malte sogar ein Bild von Biran mit dem Anhänger, der mir so gefallen hat, in mein Tagebuch«, ende ich die Erzählung. Lionel sitzt neben mir, er hat die ganze Zeit über geschwiegen. »Eine echte Zeichnung, weißt du? Keine Karikatur. Daher kann ich mich bis heute noch an ihn erinnern. Ich muss oft an ihn denken. Immer, wenn ich diese Geschichten über die angeblich so barbarischen Echsen höre.« Ich sehe meinen Bruder mit großen Augen an. Nun weiß er alles.
Lionel mustert mich nachdenklich, doch in seinem Blick ist auch eine deutliche Skepsis zu erkennen. »Es sind sicherlich nicht alle so, wie es die Medien darstellen. Es kann aber genauso sein, dass deine Erinnerung an diesen Jungen mit den Jahren etwas beschönigt wurde. Du fandest ihn faszinierend und nett, weißt aber nicht, was er heute als ausgewachsener Jäger für einen Charakter hat.«
Ich presse die Lippen zusammen und schaue zu Boden. Mein Bruder hat mal wieder recht, ich sollte keiner weich gespülten Kindheitserinnerung nachhängen. »Dennoch war es nicht in Ordnung, wie der Professor ihn damals behandelt hat«, sage ich leise.
»Nein, das war es nicht, da hast du recht«, stimmt Lionel zu.
Nach der Schule gehe ich für gewöhnlich immer sofort heim. Ich verabrede mich kaum noch mit Freundinnen, habe ohnehin nur noch zwei. Alle Mädchen in meinem Alter kaufen sich die neueste Mode, tragen starkes Makeup und wollen unbedingt cool oder attraktiv für die Jungs sein, während ich mich zum unscheinbaren Mauerblümchen entwickle. Statt im Trend zu bleiben, werde ich nur verträumter. Das macht sich leider auch in den Noten bemerkbar, daher muss ich zusätzlich noch länger für die Arbeiten lernen. Aber mich interessieren weder Jungs noch Mädchen. Vielleicht bin ich nicht normal oder ein Spätzünder?
Heute gebe ich dem Druck nach und kaufte mir einige schicke Klamotten in den Geschäften der Einkaufzeile.
Vielleicht hilft das, etwas mehr dazuzugehören.
Lustlos gehe ich mit den vollen Einkaufsbeuteln in Richtung Bahnhof über das breite Kopfsteinpflaster. Es riecht nach Schmieröl und dem Gummiabrieb der Elektrofahrzeuge. Hier ist fast alles aus Stein gebaut. Steine gibt es genug auf diesem Mond, in allen Größen. Steine und Eis. Zwei Drittel des Trabanten sind mit Gletschern bedeckt. Zumindest haben wir ausreichend Trinkwasser, auch wenn es meist unterirdisch verläuft. Wie so oft stelle ich mir vor, wie es früher auf der Erde ausgesehen hat. Natürlich bevor die Menschheit ihren einstigen Ursprungsplaneten in eine lebensfeindliche Öde und Müllhalde verwandelte.
Was ist mit den Personen geschehen, die nicht hatten fliehen können? Sind sie noch am Leben? Haben sie es vielleicht geschafft, die Erde wieder auf Vordermann zu bekommen? Eher nicht. Laut den Überlieferungen war damals die berechnete Wahrscheinlichkeit, dass eines der gestarteten Kolonistenschiffe einen bewohnbaren Planeten finden würde, angeblich höher, als daheim zu überleben. Nun, zumindest unsere Vorfahren hatten es offensichtlich geschafft.
Kurz vor dem Bahnhof bleibe ich abrupt stehen. Ich höre Rufe und sehe, wie Polizisten eine große Gruppe protestierender Einheimischer auseinandertreiben. Einige dieser Demonstranten werden mit Schlagstöcken verprügelt und in die Dienstwägen gezerrt, doch die meisten fliehen in alle Himmelsrichtungen. Das Herz klopft mir bis zum Hals und ich bin wie erstarrt. Bisher kenne ich solche Bilder nur aus den Nachrichten, aber nicht live und so verdammt nah! Einige rennen in meine Richtung. Mein Fluchtinstinkt setzt ein und vertreibt die Lähmung. Ich renne Deckung suchend in eine schmale Sackgasse zwischen den Häusern und halte keuchend inne. Von hier lässt sich die Szene aus sicherer Entfernung beobachten.
Mein Puls rast und treibt eine Hitzewelle durch meinen Körper und mir den Schweiß in den Nacken.
Einer der Einheimischen, die in meine Richtung geflohen sind, biegt in diese Gasse ein. Der Schreck durchzuckt meinen Körper wie ein heller Blitz. Rasch springe ich in den Schatten zweier überfüllter Müllcontainer. Es stinkt so widerlich nach Essensresten, dass mir übel wird, ich traue mich jedoch nicht, weiter durch den Mund zu atmen, aus Angst, gehört zu werden. Ich presse den Rücken fest an die kalte Hauswand, die Einkaufstaschen noch mit den Händen umklammert, und wünsche mir, in der Mauer verschwinden zu können. Wenn ich doch nur weniger auffällige Kleidung anhätte. Der gelbe Pulli mit der weißen Jeans ist mehr als ungeschickt. Aber es war heute früh schon so warm gewesen, da wollte ich mal hellere Farben tragen, um die Laune zu heben. Prima gelaufen.
Schritte nähern sich. Die Fußfolge klingt ungewöhnlich. Der Predyl!
Ich halte den Atem an.
Bald kommt er an dem Versteck vorbei. Was, wenn er mich entdeckt? Als Geisel nimmt oder tötet?
Die Ureinwohner sind angeblich so stark, dass sie einem Menschen mit einem Hieb den Kopf abreißen können. Heißt es zumindest. Spielen sie womöglich mit ihrer Beute, wie einige Raubtiere es tun? Wird mein Tod kurz und schmerzhaft sein oder qualvoll lang? Der Angstschweiß lässt mich frösteln.
Die Schritte werden langsamer, wirken unstet, kommen näher. Wer immer es ist, er scheint ebenfalls ein Versteck zu suchen. Ich atme so leise und flach wie möglich, um nicht gehört zu werden.
Der verzerrte, langbeinige Schatten eines Predyls geistert an der gegenüberliegenden Wand, erzeugt vom Tageslicht, das von der Straße aus die Gasse beleuchtet. Ich starre mit weit aufgerissenen Augen auf das Schattenspiel vor mir. Der Ballengang, die wilden Haare und der lange Hals lassen die Silhouette wie eine Figur aus einem Gruselroman wirken. Es fehlen nur noch spitze Krallen an den Fingern.
Ich wage kaum, zu atmen, stehe wie erstarrt gegen die kalte Steinwand gelehnt, noch immer die Stoffbeutel umklammert.
Nun taucht eine dunkle Gestalt in meinem Sichtfeld auf. Sie dreht den Kopf und sieht mich an. Die dichte Mähne scheint sich in diesem Moment anzuheben, was alles noch bedrohlicher wirken lässt.
Ich reiße wie zu einem stummen Schrei den Mund auf, doch dann schließe ich ihn wieder. Schlucke. Biran!
Ich weiß sofort, dass er es ist, selbst wenn es mir schwerfällt, diese Kreaturen auseinanderzuhalten. Er trägt den Anhänger mit dem blauen Stein um den Hals, auch denselben gestrickten Schal. Er muss es sein.
So verzerrt und unheimlich zuvor der Schatten an der Wand auf mich wirkte, so geschmeidig ist die lebende Gestalt nun vor mir. Alleine der Gedanke an meine romantisierte Kindheitsträumerei nimmt ihr allen Schrecken.
Er blickt stumm mit ausdruckslosen Augen. Ob er mich erkennt? Ich nehme all meinen Mut zusammen, klammere mich an die positiven Erinnerungen des kleinen Jungen, und gehe behutsam einen Schritt nach vorne.
»Du bist Biran, oder? Du hast damals den Brunnen neben unserem Haus gebaut«, sage ich hastig, in der Hoffnung, dass er es wirklich ist und mir nichts tun wird, wenn ich kein namenloser Mensch unter vielen für ihn bin. Das Herz schlägt mir bis zum Hals. Er ist ein Einheimischer, er hasst meine Spezies.
Es dauert einige Sekunden, dann entspannt sich seine Muskulatur und die Arme senken sich leicht.
»Du erinnerst dich daran?« Er klingt tiefer, irgendwie sanft, so wie der Blick dieser dunklen Augen. Nur die Stirn erscheint gewellt, aber ich kann die Mimik nicht einschätzen.
Biran ist groß geworden, doch sehr dünn. Seine Gesichtsknochen schauen deutlich hervor und die Kleidung wird kaum von dem schmalen Körper ausgefüllt.
Ich schäme mich bei dem Anblick, da ich in letzter Zeit ziemlich zugenommen habe. Wie das eben manchmal so ist in der Pubertät. Ich bin nicht die ehrgeizige Sportskanone, sondern lese lieber zuhause gemütlich, zeichne oder träume einfach nur vor mich hin.
Dazu halte ich noch zwei große Einkaufsbeutel mit teuren Klamotten in der Hand. Mein verzweifelter, wenn auch wenig erfolgversprechender Versuch, trotz überschüssiger Pfunde und stetiger Verklemmtheit in der Schule unter die Coolen zu kommen.
Ich verspüre den Drang, etwas zu sagen, mich beliebt zu machen. Mein Leben zu retten. »Natürlich tue ich das. Ich habe nur so geschwärmt für dich damals.« Ein zu unsicheres Lachen. »Es war so schwer in dem Alter, niemandem davon zu erzählen.«
Biran zieht ebenfalls die Mundwinkel hoch, eine Mimik, die an ein Lächeln erinnert. Es wirkt dennoch gezwungen, ich vermisse die Gelbfärbung um seine Lippen. Ist das vielleicht nur Einbildung gewesen? Ich überlege, ob es aufgrund der Situation so gekünstelt aussieht oder ob sie sich diese Geste nur von den Menschen abgeschaut haben und selbst gar nicht lächeln.
Während meines Grübelns verhärtet sein Blick erneut. Weitere Falten tauchen auf.
Ich staune insgeheim, wie ausdrucksvoll die Gesichter dieser Wesen sind. Er denkt gewiss darüber nach, was er mit mir tun soll. Ich schlucke, mein gesamter Körper bebt.
»Wir steuern auf eine harte Zeit zu, was?«, frage ich nach einer Weile betretener Stille und merke, wie sich meine Schultern versteifen. Ich muss unbedingt weiter mit ihm reden, diesem Wesen keine Gelegenheit lassen, ohne Überlegung zuzuschlagen.
»Es sieht so aus.«
Zu meiner großen Erleichterung geht Biran auf das Gespräch ein.
»Hasst du mich?«, frage ich. Ein dicker, drückender Kloß bildet sich in meiner Kehle, der mir fast den Atem raubt. Bloß nicht heulen jetzt!
»Nein.«
»Aber ihr hasst alle Menschen?«
»Nein, nicht alle.«
Ich betrachte ihn ängstlich und neugierig zugleich. Seine federartigen, schwarzen Haare fallen voluminös bis hinunter auf die Schultern, sie erinnern etwas an die Mähne eines Löwen. So umrandet wirkt das dunkle Gesicht in dem schwachen Licht beinahe menschlich.
»Ich denke, ich würde alle hassen, wenn ich du wäre«, druckse ich.
»Du bist noch fast ein Kind.« Er tritt behebe von einem Bein auf das andere. Seine Zehen stecken in Lederschuhen, die mit Riemen über der hohen Ferse befestigt sind.
»Dennoch«, breche ich mit erstickender Stimme heraus und verfluche mich im Stillen für meine mangelnde Selbstkontrolle. »Ich hätte nicht alles glauben dürfen, was man über euch behauptet. Ich habe weggesehen, wie wir alle.« Tränen steigen mir in die brennenden Augen, ich kann es nicht verhindern. Der Kloß in der Kehle schwillt an. »Es tut mir leid.« Ich sehe ihn wieder vor mir: Ein kleiner Junge, der sich duckt, als Professor Khan mit dem Stock droht wie zu einem Tier. Ich bin fett und verwöhnt, während er sichtlich ausgehungert vor mir steht. All diese Bilder schießen mir durch den Kopf. »Vergib mir!«
Erst hier, in dieser Gasse, in diesem Augenblick, verstehe ich wirklich, was auf unserem Mond vor sich geht. Jetzt erst lasse ich es an mich heran. Der Damm der Ignoranz reißt auseinander und die Erkenntnis bricht wie eine Flutwelle über mir zusammen. Ich stehe da wie ein Häufchen Elend und ringe keuchend nach Luft.
Birans Augenlider zucken, er wirkt sichtlich irritiert über die unerwartete Begegnung sowie meinen heftigen Gefühlsausbruch. »Der Krieg hat nicht einmal richtig angefangen. Die meisten Menschen denken, dass ihr gewinnen werdet.« Beim Sprechen dreht er sich nervös nach Polizisten um, durch den langen Hals ist der Kopf erstaunlich mobil und erinnert an die Bewegungen eines Vogels.
»Selbst wenn.« Ein Schluchzen entfährt mir bei den Worten. »Ihr habt recht. Deswegen will ich mich hiermit entschuldigen. Für uns alle. Auch wenn das für dich hier jetzt lächerlich klingen mag.«
Seine Gesichtsmuskeln entspannen sich. »Nein«, sagt er sanft. »Das klingt keinesfalls lächerlich. Im Gegenteil. Ich danke dir.«
Er tritt mir entgegen und ich weiche ängstlich zurück, werde aber bald von der Mauer in meinem Rücken hart gestoppt. Biran legt mir die Hand auf eine Schulter, nickt noch einmal, verschwindet dann flink hinter der nächsten Häuserecke. Ich stehe da, umklammere die Einkaufsbeutel und fühle mich erbärmlich.
3.
Zwei Wochen nach meinem dreizehnten Geburtstag wird offiziell der Krieg erklärt. Anfangs realisiert kaum jemand, was das wirklich für uns bedeutet. Viele meiner Schulkameraden diskutieren ununterbrochen darüber, doch ich will nichts davon hören. Stattdessen ziehe ich mich noch mehr zurück und verdränge es so lange, wie es mir möglich sein wird. Die Begegnung mit Biran hat sich in meine Seele gebrannt. Ich kann die immer schlimmer werdende Propaganda gegen die Ureinwohner nicht mehr ertragen und die Angst erledigt den Rest. Ich fühle mich wie die drei Affen: will nichts davon hören, nichts sehen und nichts dazu sagen.
Erst als Vater eines Abends die Nachricht verkündet, dass er eingezogen wird, weckt mich der Schrecken aus dem Schlaf der Verdrängung.
»Nein!«, hallt mein entsetzter Ruf durch die Küche.
Mutter sitzt nur stumm mit aschfahlem Gesicht neben uns, eine Sprachlosigkeit, die ich so noch nie bei ihr erlebt habe.
Vater blickt mich mit sanfter Miene an. »Ich muss, Kleines. Es ist meine Pflicht.« Seine Stimme ist leise, fast flüsternd.
Ich springe auf.
Der Stuhl fällt polternd nach hinten um und knallt auf den Fliesenboden. »Das können doch andere machen! Du bist Wissenschaftler in einem Labor! Was wollen die von dir? Lass die kämpfen, die so etwas gelernt haben. Die echten Soldaten mit Ausbildung! Du kannst für die Medikamente entwickeln oder Waffen oder so.«
»Berufssoldaten gibt es zu wenige, da wir niemals wirklich auf einen Krieg vorbereitet waren«, erklärt Vater geduldig. »Ich habe eine Grundausbildung in der Armee gemacht, das mussten wir alle. Auch die Frauen werden eingezogen, wenn sie alt genug sind und keine Kinder unter sechzehn Jahren betreuen.«
»Nein!«, schreie ich und haue wütend mit den Handflächen auf den Tisch. »Ich werde keine blöde Grundausbildung zur Soldatin machen! Lionel hat so etwas ebenfalls verweigert, er hat stattdessen Sozialstunden genommen! Was wollen die überhaupt von dir? Es kann dich keiner zwingen, in einen dämlichen Krieg zu ziehen!«
Die blauen Augen meines Vaters strahlen Nachgiebigkeit aus. Die vertraute Wärme in seinem Blick fügt mir körperliche Schmerzen zu. Dieser sanftmütige Mann ist geschaffen, um eine Familie zu haben, um Kindern Gutenachtgeschichten vorzulesen, um mit ihnen in den Zoo zu gehen! Mir solch eine friedsame Person mit Gewehr in einem Feuergefecht vorzustellen, ist undenkbar.
»Es ist Pflicht. Sollte ich verweigern, kann es sein, dass ich eingesperrt werde.«
Mein Kopfschütteln ist hektisch und unkoordiniert. Der Raum verschwimmt in einen Tränenschleier, doch der Schmerz steigert nur meinen Zorn. »Wofür brauchen die so schmächtige Typen wie dich? Wir kämpfen gegen primitive Ureinwohner! Wir besitzen intelligente Waffen und Armeewagen und Geschütze und … und … und ausgebildete Strategen! Warum sind diese bescheuerten Echsen nicht schon längst besiegt? Weshalb gibt es die überhaupt noch?« Meine Stimme erstickt in Schluchzen.
Ich schlucke, aber meine Kehle schnürt sich immer enger zu. Vater macht Anstalten, mich in den Arm zu nehmen, doch ich stoße ihn zur Seite, steige über den umgefallenen Stuhl und renne hoch ins Zimmer. Den Kopf unter Kissen vergraben, gebe ich den Tränen freien Lauf.
Ich weine nicht nur aus Wut über mich selbst, den Krieg und die Regierung. Ich habe schreckliche Angst um das Leben meines Vaters. Ich liebe ihn so sehr, mehr als Mutter. Er ist ein ruhiger, fairer und stets diplomatischer Akademiker, keinesfalls ein Kämpfer.
Patrik Peterson wird bereits die nächste Woche abgeholt und in eine Ausbildungsstätte gebracht. Erst danach wird er am Krieg beteiligt sein.
Ich umarme Vater zum Abschied, will ihn nie wieder loslassen. Doch die Zeit lässt sich nicht aufhalten, so sehr man das auch wünscht. Mutter weint noch stundenlang, nachdem er gegangen ist.
Ich fange endlich an, die Nachrichten zu verfolgen.
Der offene Kampf ist viele Kilometer weit weg am Stadtrand und ich hoffe so sehr, dass es wieder Frieden geben wird, bevor die ersten Bomben hierher durchdringen.
Wir besitzen zwar tatsächlich die besseren Waffen, doch die Einheimischen sind uns zahlenmäßig weit überlegen und haben in den Wäldern um die Metropole Heimvorteil, kaum einer von uns kennt sich dort aus. Ihre geschickte Guerillataktik traf uns völlig unvorbereitet. Dazu kommt, dass die Menschen nach der Landung hier auf dem Mond ihre Aufmerksamkeit eher dem Aufbau einer Stadt und der Versorgung gewidmet haben statt der Verteidigung. Sie waren eine Gruppe Kolonisten, voller Idealismus, ihr Utopia zu gründen. Wer bereitet sich da auf einen Krieg vor?
Es gibt zwar eine Armee, doch primär der Tradition wegen. Wir konstruierten niemals schwere oder intelligente Geschütze, besitzen keine Panzer und Kampfflieger, wie sie in den alten Filmaufnahmen der Erde zu sehen sind. Die Menschen lebten in Frieden mit sich, während die Ureinwohner nie als eine ernst zu nehmende Gefahr angesehen wurden. Welch folgenschwerer Trugschluss!
Scheinbar vereinzelte Aufständische überfielen zuerst die lebensmittelliefernden Farmen, tauchten plötzlich überall auf und verschwanden nach einem Schusswechsel genauso rasch wieder. Unsere Armee reagierte relativ schnell, indem sie bereits im letzten Jahr die Waffenproduktion um ein Vielfaches ankurbelte und Strategen einstellten.
Zu einem offenen Gefecht kam es aber erst, als die Nahrungsmittel knapp wurden und menschliche Soldaten ausrücken mussten.
Mittlerweile gibt es täglich große Verluste auf beiden Seiten. Die Stimmen, die anfangs noch über die Einheimischen lachten, verstummen rasch.
Waren wir deshalb so schnell zu einer Kriegserklärung bereit, weil viele nur eine Begründung suchten, diese Lästlinge endgültig auszurotten?
Ich weiß es nicht.
Die Ureinwohner umlagern Neumond inzwischen. Sie kontrollieren unsere Lebensmittelzufuhr, indem sie die Farmen rund um die Metropole besetzen. Selbst die äußeren Bergwerke sind von der Versorgung abgeschnitten.
Ein knappes Jahr danach wird mein Bruder eingezogen. Er ist gerade einmal zwanzig Jahre alt.
Lionel der Künstler. Lionel der Romantiker, der Träumer. Lionel, der Unterschriften gegen den Zoo gesammelt hat, weil ihm das Ausbeuten von Lebewesen zuwider ist. Der Lionel, der den Wehrdienst aufgrund ethischer Bedenken verweigerte.
Ich befürchte, er wird keinen einzigen Tag an der Front überleben …
Sechs Monate später läutet es an unserer Haustür. Neugierig trete ich aus meinem Zimmer in den Flur. Mutter hat bereits die Tür geöffnet und ich vernehme die mir unbekannten, dunklen Stimmen von Männern. Selbst in der oberen Etage spüre ich den eisigen Wind beim Öffnen des Eingangs hereinwehen und rieche den Schnee. Das plötzliche Schluchzen, das durch das Pfeifen des Sturms dringt, verpasst mir eine Gänsehaut. Ich gehe zögerlich die Treppe hinunter und beobachte, wie Mutter von einem älteren Offizier in grauer Uniform gestützt ins Wohnzimmer geführt wird. Völlig aufgelöst scheint sie kaum wahrzunehmen, was der hochgewachsene Mann ihr eindringlich zuredet.
Ein eiskalter Schauer durchfährt meinen Körper. Mir ist in diesem Moment klar, was passiert sein muss. Lionel!
Zitternd laufe ich weiter die Treppe hinunter, Schritt für Schritt den Impuls, wieder hoch zu stürzen und das Gesicht unter Stofftieren zu vergraben, ignorierend. Ich gehe nicht in das Wohnzimmer, sondern bleibe fröstelnd an der halb geöffneten Tür stehen.
Gesprächsfetzen, unverständliches Gemurmel, Mutters Schluchzen. Eine Frage zum Ort der Beisetzung.
Um meine Kehle liegt ein enges Band, das sich immer mehr zuschnürt. In Gedanken sehe ich Lionels tote, starre Augen vor mir.
Dann die tiefe Stimme eines Mannes: »Wir werden uns selbstverständlich um die Kremation Ihres Gatten kümmern.«
Ein schrilles Aufheulen meiner Mutter bei diesen Worten.
Gatte?
Vater! Nicht Lionel. Mein Papa! Tot. Irgendwo kalt und leblos in einem Schützengraben.
Ich werde ihn niemals lebendig wiedersehen. Nie wieder seine ruhige, sanfte Stimme hören oder seine tröstende, warme Umarmung spüren oder in seine hellen Augen schauen können. Seine Ideen, sein Können, seine Kreativität, die Gedanken und Erfahrungen … alles unwiderruflich ausgelöscht. Einfach so. Ein kluger Wissenschaftler, der mit seinen Entdeckungen noch so viel hätte verbessern können auf diesem Mond, fällt in einem sinnlosen Krieg. Warum? Wofür? Was soll dieser Mist überhaupt?
Ich unterdrücke einen stöhnenden Laut, drehe mich auf dem Absatz um, renne in mein Zimmer und schlage mit voller Wucht die Tür zu. Zum ersten Mal in meinem Leben schiebe ich den Riegel vor. Ich fingere zitternd an dem kühlen Metall, bis es mir gelingt. Der Krieg mit all seinem Leid soll dort draußen bleiben und nicht hereinkommen. Niemals.
Mutter ist seit diesem Tag nie wieder so wie früher. Sie verzweifelt fast am Tod ihres Mannes. Für mich hingegen sind die nächsten Wochen kaum anders als die davor. Vielleicht deshalb, weil Vater ohnehin die ganzen Monate fort war und ich mir so leicht einreden kann, dass er noch irgendwo kämpft.
Auch als endlich die Urne zur Beisetzung hergebracht wird, breche ich nicht zusammen. Mutter schon.
Sie muss von meiner Oma nach Hause gebracht werden, unfähig, bei der Trauerfeier teilzunehmen. Nur Mutters Eltern leben noch. Geschwister haben beide meiner Elternteile nicht, allerdings unfreiwillig. Das ist leider keine Seltenheit. Bereits auf der Erde sind immer mehr Menschen aufgrund der vergifteten Natur steril gewesen. Dort hatte es jedoch technisch Möglichkeiten gegeben, dennoch Nachkommen zu zeugen. Dies alles ist hier mangels Ressourcen nicht machbar. Die Fruchtbarkeit der Menschen auf dem Mond hat zwar mit jeder Generation stetig wieder zugenommen, da diejenigen, die Kinder bekommen können, oft sehr viele haben, doch einige bleiben weiterhin unfreiwillig kinderlos.
Meine Eltern erzählten uns von der steten Angst, keine Kinder bekommen zu können, bis Mutter endlich mit Lionel schwanger wurde und alles auf wundervolle Weise glatt verlief. Nach ihm hatten sie erneut lange vergeblich versucht, noch ein Kind zu bekommen, dass ich nach sieben Jahren eine regelrechte Überraschung war.
Nun aber werden die so mühevoll erschaffenen und sehnlichst gewünschten Leben wieder ausgelöscht. Jeden Tag etliche von ihnen. Einfach so. Aufgrund eines in meinen Augen völlig vermeidbaren Konflikts. Wäre unsere sturköpfige Regierung etwas mehr auf die Forderungen der Ureinwohner eingegangen, hätte dies alles vielleicht verhindert werden können.
Aber darüber nachzudenken wäre müßig und reißt nur mehr Fetzen aus dem ohnehin schon verwundeten Inneren. Es ist geschehen, unabänderbar.
Opa Andi und Oma Hilda ziehen bei uns ein. Sie spenden gleichzeitig ihr eigenes Haus an die Flüchtlinge aus den zerstörten Gebieten, die in Scharen ins Innere der Stadt pilgern.
In Mutter ist seit dem Tag etwas gestorben, ein Funken erloschen, eine Hoffnung geraubt. Ich beobachte, wie sie monoton die Arbeiten im Haushalt erledigt und Essen besorgt, doch sie ist nie wieder so wie früher. Wenn ich sie so sehe, hoffe ich nur, dass Lionel überleben wird. Mehr Kummer verkraftet diese Frau nicht, die für eine Kriegszeit viel zu zierlich gebaut und emotional ist.
Meine Mutter nimmt mich seitdem immer öfter in den Arm und drückt mich an sich. Ich will ihr diesen Trost gerne spenden, auch wenn es mir sehr schwerfällt. Es kommt mir vor, als müsse ich damit das stille Versprechen geben, sie vor noch mehr Leid zu schützen. Das kann ich aber nicht. Dieses Gefühl der Verantwortung lastet wie ein eisernes Joch auf meinen Schultern und drückt mich weiter zu dem Boden, auf dem ich am liebsten stumm und reglos liegen bleiben will. Für immer.
4.
Mein Leben wird zu einer Monotonie. Es besteht lediglich aus drei Begriffen: Warten, Hoffen, Überleben.
Tage verschmelzen zu Wochen, und Wochen zu Monaten.
Der Schnee taut, das letzte Winterjahr vergeht und das erste Sommerjahr folgt. Der ewige Kreislauf. Oft schaue ich zum Himmel und beobachte den roten Gasriesen, um den sich der Trabant dreht. Einer der vielen Milliarden von Himmelskörpern in dieser Galaxie, der sich nicht daran stört, was die kleinen, dummen Lebewesen auf seiner Mondoberfläche so anstellen.
Ich begrüße die Wärme, doch die längeren Sonnenstunden zeigen nur deutlicher die Zerstörung der Stadt und das Leid auf den Gesichtern der Menschen.
Die Nachrichten über den Krieg ebben ab, lediglich einige der offiziellen Radiosender sind noch zu empfangen. Es wird unheimlich leer und still um die offiziellen Stellen und Behörden. Im städtischen Netz hingegen tummeln sich nun Privatleute, die den Drang haben, den eigenen Schmerz in die Welt hinauszurufen.
Mutter sitzt häufig an ihrem Computer und liest deren Geschichten. Oft rinnen dann Tränen über ihr Gesicht. Heute ertönt wieder ihr Schluchzen, das mich zur Raserei bringt. Ich werfe das Geschirrtuch neben die Spüle, bevor ich zu ihr ins Wohnzimmer gehe.
»Warum tust du dir so etwas an?«, fauche ich wütend. Ihre tränennasse, schmerzverzerrte Miene gleicht einem Messer, das mir in die Eingeweide sticht. »Weshalb liest du den Schwachsinn? So bringst du doch nur noch mehr Leid in dein Leben, als ohnehin schon da ist. Ich raff das nicht!«
Mutter hebt ihren Blick und sieht mich an. Wieder das Gefühl eines Stiches, diesmal in den Brustkorb. Da, wo das Herz ist.
»Ich muss wissen, was dort draußen geschieht«, sagt sie mit einem geduldigen Lächeln und wischt sich die Tränen von den Wangen. »Manchmal hilft der Gedanke, nicht alleine zu sein. Auch, wenn die Geschichten der anderen wehtun.«
Ich will etwas sagen, bringe aber kein Wort heraus. Mutter steht auf, geht zu mir und umarmt mich. Ich erwidere die Geste nicht, sondern stehe nur steif da.
»Hoffentlich fällt der Strom bald wieder aus«, flüstere ich trotzig. »Dann musst du den Mist nicht lesen.«
Diese fremden Menschen mit ihren Geschichten interessieren mich nicht. Sie verletzen nur die, die mir wichtig sind. Das, was ich wirklich wissen will, kann mir keiner von denen sagen. Lebt Lionel noch? Wenn ja, wie geht es ihm? Doch ich möchte das vor Mutter nicht erwähnen, jetzt, wo sie endlich aufgehört hat zu weinen.
Wir bekommen von der Front kaum mehr etwas mit. Einzig die Detonationen sind bis hierher zu hören. Oftmals tief in die Nacht hinein. Dann liege ich auf dem Bett und drücke mir meine alten Stofftiere auf das Gesicht und die Ohren. Mutter hat sie mit Lavendelblüten gefüllt, um Schädlinge fernzuhalten. Ich liebe diesen Duft, doch in solchen Momenten ruft selbst der kein Gefühl der Sicherheit hervor. Jede der Explosionen kann Soldaten getötet haben
… könnte Lionel treffen!
Wenn der Wind den schalen Geruch des Sprengstoffes in die Stadt weht, bilde ich mir ein, auch Blut und Verwesung riechen zu können.
Die Trinkwasserleitungen funktionieren noch, aber die Lebensmittel werden streng rationiert. Niemand kann genau sagen, wann der nächste Transporter es schafft, Nahrungsmittel von den äußeren Speichern in die Innenstadt zu befördern. Viele der Lieferwagen werden von feindlichen Soldaten gestoppt oder auch von hungernden Stadtbewohnern überfallen.
Menschen, die kriminell sind! So etwas hat es zuvor nie gegeben auf dem Mond. Zumindest nicht offiziell.
~
Es ist das erste Sommerjahr 323 nach der Landung und mein 16. Geburtstag. Eine Möglichkeit zu feiern gibt es nicht. Ich fühle mich auch am wenigsten danach.
Sechzehn.
Endlich mündig? Ich dürfte nun wählen, einen Führerschein machen und leichten Alkohol trinken. Meine Jugend in vollen Zügen genießen. Die verhöhnende Ironie darin legt sich wie ein bitterer Beigeschmack auf meine Zunge.
Wie sehr habe ich als Kind diesen Moment herbeigesehnt. Und nun? Was bedeutet das? Werde ich bald einen Brief bekommen, der beschreibt, dass es meine bürgerliche Pflicht ist, als gesunde, diensttaugliche und kinderlose junge Frau der Armee beizutreten? Bleibt Mutter jetzt auch nicht mehr verschont, da sie keine unmündigen Kinder mehr zu versorgen hat?
Ich bleibe an dem Morgen lange im Bett liegen, möchte herauszögern, dass dieser Tag beginnt.
Irgendwann im Laufe des Vormittags nagt das schlechte Gewissen an mir und ich gehe nach unten, um zumindest meinen Großeltern im Haushalt zu helfen. Da sitzt nur Opa Andi, der mit einem Lächeln auf dem hageren Gesicht aufsteht.
»Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, meine Große«, sagt er und Tränen funkeln in den hellbraunen Augen, die bereits einen weißlichen Schleier bekommen. Er umarmt mich.
»Danke.« So wirkliche Freude mag nicht aufkommen, aber die Berührung tut gut, trotz der dünnen, knochigen Statur, die mein Opa mittlerweile hat. Er verweigert zu oft das Essen, um uns mehr zu lassen.
»Wo ist Lisa?«
»Deine Mutter ist mit Oma zum Markt. Sie versuchen, etwas Mehl zu bekommen.« Opa lächelt, noch immer glänzen seine Augen feucht. »Vielleicht reicht es für einen Kuchen, es ist immerhin ein wichtiger Tag für dich.«
Ich stutze. »Wir haben doch kein Geld mehr und unsere Rationen gibt es erst am Montag.«
»Deine Mutter hatte noch Schmuck übrig, sie will versuchen, ihn einzutauschen, damit du etwas Besonderes bekommst an deinem großen Tag.«
Tränen füllen meine Augen. Vor Rührung und schlechtem Gewissen. Ob es wirklich noch Menschen gibt, die Schmuck wollen? Eine Zukunft dafür sehe ich persönlich nicht, aber alleine der Versuch berührt mein Herz.
Ich koche für alle einen Tee aus den Kräutern unseres Gartens und hole das letzte gute Geschirr hervor.
Mit einem lauten Schlag fliegt die Eingangstür auf. Ich höre Oma panisch brüllen: »Einen Arzt! Andi! Hol einen Arzt!«
Opa und ich erreichen zur selben Zeit den Flur. Meine Großmutter steht panisch schreiend an der Tür, während sie mit aller Kraft den schlaffen Körper ihrer Tochter über die Schwelle zerrt. Mutters Kopf ist nach vorn gebeugt, ihre hellbraunen Locken überdecken völlig das Gesicht. Sowohl Hände als auch Kleidung meiner Oma sind voller Blut. Ich stoße einen entsetzten Schrei aus.
Opa Andi stürzt nach draußen. Natürlich wird er keinen Arzt finden, die dienen alle an der Front, aber zwei Häuser weiter wohnt ein Krankenpfleger im Ruhestand.
Omas Kraft scheint sie zu verlassen, der leblose Körper meiner Mutter sinkt auf den Boden. Ich will zu ihr stürzen und helfen, doch meine Beine versagen den Dienst. Alles in mir erstarrt. Ich kann nur steif und stumm dastehen und das Geschehen stumm mit aufgerissenen Augen beobachten. Meine Augen erfassen ihr Gesicht, wie es auf dem kalten Steinboden liegt. Es ist durch eine großflächige Wunde an der Schläfe blutverschmiert, kalkweiß, die Lippen bläulich, der Mund geöffnet und der Blick starr.
Oma Hilda nimmt den Kopf ihrer Tochter in beide Hände und redet leise auf sie ein. Doch ich weiß, dass es zu spät ist. Diese Tatsache trifft mich wie ein heftiger Schlag ins Gesicht. Sie ist tot. Meine Mutter ist an meinem 16. Geburtstag gestorben.
Oma murmelt weiter vor sich hin und wiegt den blutigen Kopf in ihren Händen. Opa stürzt zusammen mit einem älteren, bärtigen Mann durch die noch offene Tür.
Der ehemalige Krankenpfleger kniet vor Lisa nieder und untersucht sie hektisch. Dann blickt er zu meinen Großeltern auf, die ihn fast flehend ansehen, schüttelt jedoch langsam den Kopf.