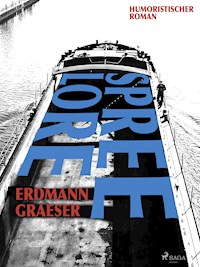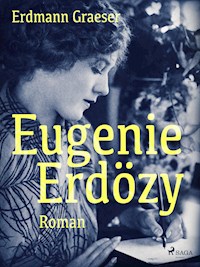Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der alte Weißbiergarten der "ollen Lemkes" ist schon lange eine Institution in Schöneberg. Trotz des Näherrückens der Großstadt Berlin hält er lange allen Neuerungen stand. Man hört das Rollen der Kegelbahn, die Hühner strolchen durch den Garten und der "jriene Aal mit Jurkensalat" ist einen Ausflug allemal wert. "Das Spukhaus in Schöneberg", der zweite Band der humoristischen Romanfolge um Lemkes Witwe, beginnt mit dem Gerücht, dass "der olle Lemke vakoofen will". Und tatsächlich zieht Lemke mit seiner Gattin, die nicht mehr ganz taktfest auf den Beinen steht, in die Stadt. Dort geht das verrückte Treiben der Familie aber genauso weiter wie schon immer. Onkel Karl, dauerpleite und immer auf Pump aus, kommt auf Besuch mit seiner Riesentöle "Nulpe". Ein Grundstück hat er schon an Land gezogen – natürlich per Kredit –, jetzt will er die Lemkes als Bauherren gewinnen. Bei Tante Marie, deren selbstgepflückte Hausapotheke mehr krank als gesund macht, gerät das Geburtstagskränzchen beinahe in schwermütige Fahrwasser und als "Jroßmutta" stirbt, wird mit großem Trara Beerdigung gefeiert. Mit seinen Erzählungen über die Lemkes und ihrem großen Familien- und Freundeskreis lässt Erdmann Graeser es wieder auferstehen: das legendäre Berlin, das Zille so kongenial gezeichnet hat. Es ist die Welt der kleinen Leute, die das Herz auf dem rechten Fleck haben und das Leben so nehmen, wie es kommt.Den kleinen Leute aufs Maul geschaut – die Erzählungen um die Familie Lemke im Original Berliner Dialekt verfasst als amüsante und herzerfrischende Milieustudie des Berlin aus alten Tagen.Erdmann Graeser (1870–1937) war ein deutscher Schriftsteller. Als Sohn eines Geheimen Kanzleirats im Finanzministerium in Berlin geboren, ist Graeser zwischen Nollendorfplatz und Bülowbogen im Berliner Westen aufgewachsen. Graeser studierte Naturwissenschaften, brach jedoch das Studium ab und arbeitete zunächst als Redakteur für die "Berliner Morgenpost" und später als freier Schriftsteller. Er wohnte viele Jahre in Berlin-Schöneberg und zog nach seinem literarischen Erfolg nach Berlin-Schlachtensee im Bezirk Zehlendorf. 1937 starb er an einem Herzleiden. Sein Grab liegt auf dem Gemeindefriedhof an der Onkel-Tom-Straße in Zehlendorf. In seinen Unterhaltungsromanen thematisierte Graeser die Lebenswelt der kleinen Leute im Berlin seiner Zeit und legte dabei auch großen Wert auf den Berliner Dialekt. Zu seinen bekanntesten Romanen gehören "Lemkes sel. Witwe", "Koblanks", "Koblanks Kinder" und "Spreelore". Einige seiner Romane wurden später auch für Hörfunk und Fernsehen bearbeitet.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erdmann Graeser
Das Spukhaus in Schöneberg
und andere humoristische Erzählungenaus der RomanfolgeLemkes sel. Wwe.
Saga
Das Spukhaus in Schöneberg
© 1937 Erdmann Graeser
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711592403
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Im Spukhaus in Schöneberg
Wind und Wetter hatten im Laufe der Jahre das große Schild mit der Inschrift: „Zur Märzwiese, Restaurant und Kegelbahn“, arg mitgenommen, aber der „olle reiche Lemke“, wie ihn die Leute nannten, dachte nicht daran, die Farbe auffrischen zu lassen.
Unverändert hatte sich der große Garten erhalten, nur daß er jetzt, da bei den Straßenregulierungen ringsum Anschüttungen vorgenommen worden waren, so tief lag, daß die Gäste, wie sonst ein paar Stufen hinauf, eine kleine Treppe hinuntersteigen mußten.
Da unten aber spazierten die Hühner wie früher zwischen den klobigen, grüngestrichenen Tischen, brannten abends die flackernden Petroleumlampen, sah man Herrn Lemke an heißen Sommertagen in Hemdsärmeln mit der Gießkanne umhergehen und die Wege sprengen. Und auch das Rollen der Kegelkugeln hörte man, die Stimme des Jungen, der sein „Jrennadier“ und „alle neine“ durchdringend schrie und dabei die nackten Beine anzog, daß ihn die stürzenden Kegel und sausenden Kugeln nicht trafen.
Und man hätte glauben können, daß Lemkes alter Weißbiergarten trotz des Aufschwungs, den Schöneberg genommen, trotz des Näherrückens Berlins unverändert und siegreich allen Neuerungen standhalten werde, wenn da nicht merkwürdige Gerüchte im Umlauf gewesen wären. Irgendwo hatte es einer gelesen, war es durchgesickert, daß der „olle Lemke vakoofen wolle“. Und man glaubte auch die Gründe zu kennen: erstens, die „olle Lemken“ war nicht mehr so taktfest auf den Beinen und konnte sich nicht mehr so wie früher um die Wirtschaft kümmern. Man merkte das schon am Essen, das lange nicht mehr so gut wie sonst war. Und die alten Stammgäste drückten die Augen ein und schnalzten mit der Zunge, wenn sie von dem „jrienen Aal mit Jurkensalat“ und den großen Portionen Gänsebraten schwärmten, die man einstmals hier bekommen. Zweitens aber – und wenn man davon sprach, dämpfte man jedesmal die Stimme, denn der „olle Lemke“ konnte „sehre eklij“ werden, wenn er es hörte – „war irgendwas mit dem alten Haus los“. Andere sagten es geradezu heraus: „Es spukte“ oder: „Lemkes selige Witwe ging um.“ Man hatte – besonders die beiden Dienstmädchen, die in der Küche hantierten – oft genug in der Nacht einen schrillen Schrei gehört, und wenn der „olle Lemke“ auch zehnmal am andern Morgen behauptete, daß seine Frau nur schlecht geträumt habe, so ließ man es sich doch nicht ausreden, daß noch etwas anderes „dran“ sei, denn man hörte es ja auch nachts oben auf dem Boden rumoren.
Alle Milchmänner, die mit ihren Frauen von Wilmersdorf und Schöneberg zur Milchablieferung nach Berlin fuhren, spähten jedesmal, wenn sie vorüberkamen, nach dem Garten und dem im Grün des Nußbaumes und der Linden versteckten Hause, grüßten zuvorkommend den „ollen Lemke“ und erwarteten irgend etwas Neues zu erfahren – aber da war keine Veränderung zu bemerken, alles war beim alten.
Nur den jungen Herrn Lemke, den Sohn, sah man jetzt wieder häufiger und wunderte sich, was aus dem schmächtigen, tolpatschigen Burschen, der immer für ein bißchen dumm gegolten, für ein selbstbewußt auftretender, stattlicher Mensch geworden war. Und jedesmal erinnerte man sich dann an die alte Geschichte, wie damals der junge Lemke mit der Anna, dem hübschen, forschen Dienstmädchen, seinen Eltern durchgebrannt war, um dann in Berlin ganz von vorn anzufangen, „wie dunnemals seen Jroßvata“, der auch keinen Dreier besessen und es dann doch zu solcher Wohlhabenheit und solchem Ansehen in Schöneberg gebracht hatte.
„Aba det haben se beede ihren Frauen zu vadanken“, pflegten dann die alten Schöneberger Bauern hinzuzusetzen, „wat die Jroßmutta für een resolutes Frauenzimma jewesen is, merkt ma ja am besten daraus, det se jetz noch nach ihrem Tode im Hause ’rumwirtschaft’.“
Nachmittags, wenn die Sonne nicht mehr ganz so grell schien, sahen die Vorübergehenden „die kranke Lemken“ vor der Haustür sitzen, umgeben von einer Hühnerschar, die darauf wartete, daß für sie etwas abfiel. „Ach herrjeh“, hieß es dann jedesmal mit Bedauern, „wat is aus die schöne, rotbackige Frau jeworden – die wird’s wohl nich mehr lange machen“. Und dann freute man sich über Herrn Wilhelm Lemke, der so zu seiner Mutter hielt und jeden Tag den weiten Weg von der Landsberger Straße bis nach Schöneberg machte, um zu erfahren, wie es mit der Kranken stände.
„Wenn se sich man ’n Dokter nehmen wollten, det Jeld haben se doch dazu!“ sagten die Leute. Aber „die Lemken“ wollte von den Ärzten nichts wissen. „Ick halt’ nischt von die janzen Dokters“, wehrte sie jedesmal ab, „die können mir ooch nich helfen, die denken man imma jleich an’t Schneiden und Absäbeln. Nee, nee, det muß von janz alleene besser werden. Und et fehlt mir ja ooch nischt, ick hab’ ja keene Schmerzen, bloß det ick ’n bißken schwach uff die Beene bin und keene Luft krieje. Wenn ick janz stille sitze, merk’ ick ibahaupt nischt von, nur ’rumloofen derf ick nich mehr so wie frieher!“
Eines Tages kam auch Tante Marie mit nach Schöneberg hinaus. Unter ihrem Umschlagetuch verbarg sie mit großer Geheimnistuerei einen Gegenstand, der sich als eine alte Zigarrenkiste entpuppte, die sie als ihre „Hausapotheke“ bezeichnete. Tante Marie hatte die Absicht, die Kranke „nu ’mal jründlij zu kurieren“, aber ehe sie damit anfing, legte sie der Lemken die Karten. Ja, die Karten hatten wieder mal recht, „da stand die Krankheit“ – und sie wies auf die schwarzen Kreuze –, „aba et war ooch Hoffnung vorhanden“, und darum öffnete Tante Marie die Zigarrenkiste und begann unter den Fläschchen und blauen Tüten zu suchen. „’n Kapital steckt hier drinne“, wiederholte sie fortwährend, „wat braucht man denn det teire Jeld die Apothekas in ’n Rachen zu werfen?“ Und da ihr ja die Mittel nichts kosteten, denn sie hatte sich die heilkräftigsten Kräuter – Lindenblüten, Stiefmütterchen- und Kamillentee selbst gesammelt oder von Onkel Karl schenken lassen, ging sie nicht sparsam damit um, sondern beschloß gleich eine Radikalkur. „Die Hauptsache is, det die Krankheit erst ’mal or’ntlij ’rauskommt.“ Und die durchschlagenden Erfolge, die sie dann mit einem ganz besonders wirksamen Tee erzielte, der auch ihr immer geholfen hatte, veranlaßten sie, wieder und immer wieder darauf hinzuweisen, wie dringend notwendig für jeden Haushalt solch eine Apotheke sei. Dem alten Herrn Lemke leuchtete das auch ein, und als Tante Marie am nächsten Tage wiederkam, wurde sie in die gute Stube geführt, wo auf dem Tische ein zierliches kleines Schränkchen stand – „’ne wirkliche Hausapotheke, die ick in ’ne richtje Apotheke jekooft habe, damit Se sich nich imma mit die olle Zijarrnkiste zu schleppen brauchen“ – wie Herr Lemke zur Erklärung sagte.
Aber Tante Marie war gar nicht so entzückt davon. Mißtrauisch besah sie sich die eleganten Glasstöpselfläschchen, die etikettierten Salbentöpfchen und bunten Pillenschachteln und schüttelte bedenklich den Kopf. Interesse erregte bei ihr nur die kleine, seltsam gebogene Schere, die sie für ein Operationsmesser hielt. Und sie konnte auch gar nicht Herrn Lemke zustimmen, der nun mit diesem Heilmagazin einem ganzen Heer von Krankheiten Trotz bieten wollte.
„Is ja nischt drinne in die kleenen Pullen, bloß Uffmachung, ick halte det Jeld for wejjeschmissen. Hätten Se mir man lieba wat von jesajt. Wenn nu zwee uff eenmal krank werden, denn is for keenen jenug da, nee, da is mir meene Apotheke doch ville lieba!“
Und darum blieb die elegante Hausapotheke unbenutzt stehen, und Tante Marie kurierte mit ihren Mitteln weiter. Aber es wurde und wurde nicht besser mit der Kranken. Und eines Morgens sagte Wilhelm Lemke, der die ganze Nacht über bei seiner Mutter gewacht hatte: „Nee – det jeht so nich mehr weita, hier muß wat Ernstliches jeschehen“ und ging und holte einen Arzt.
Doch wie es schien, wurde der auch nicht klug aus dem Zustand der Kranken, aber er schrieb ein langes Rezept und traf die Anordnung, daß Frau Lemke im Bett blieb. Sie jammerte zwar: „Nee, nee, Herr Dokter, ick derf mir nich festlejen, denn is’s aus und vorbei mit mir“ – aber als nun alle auf sie einredeten und ihr gut zusprachen, fügte sie sich endlich.
Gegen Tante Marie, die sich einmischte und dem Doktor widersprach, wurde der alte Arzt grob. „Sie mit Ihrer verdammten Quacksalberei machen, daß Sie überhaupt ganz aus der Krankenstube kommen. Ihnen geb’ ich die Schuld, daß man mich nicht früher gerufen hat. Legen Sie sich Ihre Karten alleine, und machen Sie selbst solche Pferdekuren durch, aber probieren Sie das nicht bei anderen, wenn Sie Alledie nicht auf dem Gewissen haben wollen!“
Tante Marie war wie vor dem Kopf geschlagen, ging hinaus, packte umständlich ihre Karten und die Zigarrenhausapotheke zusammen und verschwand, ohne einem Menschen Adieu gesagt zu haben.
„Nulpe“
Es wurde nicht besser, aber auch nicht gerade schlechter mit der „ollen Frau Lemke“, und Dr. Knast, der täglich seinen Besuch bei ihr machte, dachte manchmal, daß sie mit ihrer Natur den alten Weidenbäumen da draußen auf den Schöneberger Wiesen glich: man konnte denken, es seien morsche, tote Stümpfe, aber an jedem entdeckt man doch noch etwas Grünes – so frisch, so saftig wie in den besten Jugendjahren des Baumes.
Mit dem „jroßartijen Bejräbnis“, auf das man sich schon gespitzt, war’s also vorläufig nichts, dafür wurde die Nachbarschaft durch eine andere Überraschung entschädigt: Der „olle“ Herr Lemke hatte Haus und Grundstück verkauft. Noch zweifelte man daran, aber eines Morgens blieb die grüne Zauntür geschlossen, und in den nächsten Tagen hörte man oft das Geschrei flüchtender Hühner, das dann immer jäh verstummte. Und dann wußte man, daß wieder eins gefangen und geschlachtet worden war. Bis endlich der große Garten still und öde dalag und die Berliner, die an schönen Nachmittagen hier vorüberzogen, ahnungsvoll prophezeiten: „Na – nu wird det nich mehr lange dauern, denn wird hier ooch jebaut werden, schade um den scheenen Jarten mit die ollen prachtvollen Beime, lange jenug hat er sich ja jehalten.“
Hinten an der Rückseite des Hauses hielten Tag für Tag Rollfuhrwerke und Möbelwagen, auf denen die grünen Stühle und Tische und schließlich auch der Hausrat fortgeschafft wurden. Sang- und klanglos waren die alten Lemkes dann plötzlich ebenfalls verschwunden, ohne daß man Gewißheit darüber bekommen, für welche Summe der Garten denn nun eigentlich verkauft worden war und welche Pläne das Ehepaar hatte.
Doch dann brachten die Milchhändler einige Zeit darauf die Nachricht nach Schöneberg, daß sie die alte kranke Lemken an dem Parterrefenster eines Hauses hatten sitzen sehen. „Dichte bei die Bülowstraße, aba in die Potsdama Straße – da wohnen se jetz, wir haben ihr deitlich akannt, se hat uns ja ooch noch zujenickt“, sagten die Milchfrauen. Und wen von den Schönebergern der Weg nach Berlin führte, der paßte nun scharf auf die Fenster jenes Hauses auf, und wer Glück hatte, sah die Lemken da auch manchmal sitzen, wenn die gelbe Herbstsonne auf die blanken Scheiben fiel.
„Der Olle nennt sich nun Rentje und looft mit ’ne jriene jestickte Mitze ’rum. Manchmal buddelt er ooch vorne in den kleenen Jarten und flanzt da allen Tod und Deibel an. Die Frau soll’s ja nu wieda ’n bißken besser jehen, bloß ’rumloofen kann se nich mehr, weil se Wasser in die Beene hat. Da wird se nu in’n Rollstuhl durch die Stuben jefahren, manchmal hält ooch ’ne Droschke vor die Türe, und denn fahren alle beede mang’n Tierjarten – leisten können se sich’s ja, denn det Haus jehört sie!“
So erzählte man sich, aber mehr erfuhr man auch nicht, denn wie es drinnen in den großen, gemütlichen Stuben zuging, wußte man nicht. Nur die Hausbewohner erhielten dann und wann einen kurzen Einblick, wenn sie die Miete bezahlen kamen. Dann saß der „olle Lemke“ an seinem Mahagonie-Rollpult und quittierte mit seiner dicken Unterschrift, die nicht trocken werden wollte trotz des vielen Goldsandes, den er auf die nassen großen Buchstaben streute. Dann mußten die Mieter warten, denn der „olle Lemke“ war ein bißchen ängstlich, daß sie beim Zusammenkneifen der Quittung die Schriftzüge verwischen könnten. Während sie nun dastanden und Herr Lemke in weichen Filzschuhen auf der Stubendiele hin- und herbanlancierte, besahen sie sich die Einrichtung: den braunen Kachelofen, in dem – trotz der warmen Witterung draußen – schon das Feuer sprühte, lauschten auf die unheimlich langen Triller des echten Harzers, der nebenan in der Stube sang, oder stellten Betrachtungen über die großen Lithographien an, die rechts und links von dem Regulator über dem schwarzen Ledersofa hingen und den alten Kaiser und seine Gemahlin darstellten.
Und wenn Herr Lemke diesen Blick auffing, konnte er manchmal im Unteroffizierston fragen: „Sind Sie Soldat jewesen – welchen Rejement?“ Und wenn der Alte guter Laune war, fragte er wohl auch weiter, hörte interessiert zu, verfiel dann aber in eigene Erinnerungen, brummelte vor sich hin und warf dem Kaiserbild gerührte Blicke zu. Wie zur Entschuldigung oder Erklärung setzte er dann hinzu: „Wie ick in Schöneberj noch den Jarten hatte, da war schon im März an sein’n Jeburtstaj imma wat jefällij. Da feierten wir Frihlingsanfang, und die Jäste saßen in’t Freie, und der Flieda wurde schon jrien!“
Dann zog Herr Lemke sein rotes Taschentuch und schneuzte sich gewaltig, und wenn das Gedröhne verstummte, mahnte eine wehmütige Stimme aus der Nebenstube: „Vata – wat rejste dir wieda so unnütz uff, laß doch die ollen Jeschichten, et jeht uns doch jetz ooch nich schlecht!“
„Nee, jewiß nich, aba man denkt doch an so wat und kann et nich vajessen! Ick vasteh’ et ja ooch jetz noch nich, wie ick’s ibers Herz habe bringen können, mir von den scheenen Jarten zu trennen!“
Und in dieser Stimmung, die die Mieter stets wahrzunehmen wußten, gelang es am leichtesten, Herrn Lemke für allerlei Verbesserungen und Reparaturen in den Wohnungen gefügig zu machen. Dieser Stimmung verdankten sie die neuen Tapeten, die glänzend braungestrichenen Dielen, die sauber getünchten Küchen, denn dann pflegte der Alte jedes Anliegen mit einem: „Jajaja“ zu beantworten, und was er versprochen, das hielt er, wenn er sich auch nachher über seine Gutmütigkeit ärgerte.
Eines Sonntagsnachmittags – die Glocken der Zwölfapostelkirche hatten gerade geläutet – riß es draußen an der Korridorklingel, daß die alte Frau Lemke vor Schreck in ihrem Rollstuhl in die Höhe ging. „Jott und Vata“, sagte sie, die Hand aufs Herz drückend, und rang nach Atem, „da is sicherlich wat ins Haus passiert!“ Und sie ließ schwach und hilflos den Kopf auf die Brust sinken.
Auch Herr Lemke saß wie versteinert auf dem Sofa und lauschte voll Erwartung, was da kommen würde. Beide hörten, wie Minna, das neue Dienstmädchen, durch den Korridor rannte, die Sicherheitskette wegschob, einen Aufschrei ausstieß, dann aber offenbar die Fassung wiedergewann und mit jemand verhandelte.
„Nu möcht’ ick bloß schon wissen, wat da draußen los is!“ schrie Herr Lemke mit Schlachtkommandostimme. „Minna, komm’ ’rin, mach’ aba die Türe zu!“
„Ick kann ja nich, der Mann hält ja det Been vor“, schrie Minna zurück.
„Wer hält hier de Beene vor, na warte mal, ick hol’ mir jetz bloß mal ’n Plättbolzen“, rief Herr Lemke aufspringend, und während er durch den Korridor lief, brüllte er: „Stemm’ dir jejen, Minna, aba feste, klemm’ ihn in, klemm’ ihn janz gehörij in!“
Als Herr Lemke mit dem Plättbolzen ankam, stand der Mann bereits im Korridor: „Ick zehle jetz bis drei, und wenn meen Hund denn nich ooch drinne is – sind Se jeliefert, Freilein!“ Und sich zu Herrn Lemke wendend, sagte er: „Man muß ja’n lieben Jott for allens danken, aba so’n Dussel is mir wahaftij noch nich vorjekommen – saje ihr immafort, ick bin ’n juta Bekannta, aba se kann nich heeren!“
„Na – alooben Se mal, det is doch ooch keene Art nich, mit wem ha’ ick denn eijentlij det Vajniejen?“
„Nu kennt der mir ooch nich mehr, nee, et is nischt, wenn die Leite so alt werden“, sagte der Mann, „ick merk’ schon, mit den Besuch ha’ ick mir ’rinjeritten, wär’ ick man lieba nich jekommen!“
„Wenn Se bloß keene Reden halten wollten, sonnern sajen, wer Se sind! Da könnte ja jeder kommen und meen Bekannta sind!“
„Jetz will ick erst ’mal bei meen’n Hund“, sagte der Mann, „der is det nich jewöhnt, det’r alleene uff de Treppe sitzen soll, nu fängt er schon an zu jaulen!“ Und zur Tür hinausrufend, setzte er drohend hinzu: „Kusch’ dir, Nulpe, sonst dreh’ ick dir den Schnörjel nach links!“
„Nu kenn’ ick Ihnen“, sagte Herr Lemke, „Sie waren damals uff die Hochzeit von meenen Sohn!“
„Janz recht, ick bin Onkel Karrel“, sagte der Mann, „schade um Ihre scheene Vastehste, die hat ’n bißken bei det Stubensitzen jelitten. Nu lassen Se mir ’mal ’raus, ick muß die Töle erst eene stechen, denn wenn die nich ab und zu ’ne Reinijung kriejt, is se nich zu bändjen!“
Damit drängte er sich an dem fassungslosen Mädchen zur Tür hinaus, packte einen zottigen großen Hund am Halsband und schrie ihn an: „Mit dir ha’ ick mir verkooft, ’ne Ratze biste, aba keen amerikanischa Bluthund – wat wi’ste denn nu von mir – hier is ja deen jutet Herrchen!“ Und sich zu Herrn Lemke wendend, sagte Onkel Karl kummervoll: „Ick jloobe nemlij, der Hund is varrickt – nu seh’n Se bloß ’mal det Karnickel, jetz kennt er mir wieder nich!“
„Ja – et scheint so, villeicht is’s janich Ihrer“, sagte Herr Lemke, „Minna, jeh’ ’rin und saj’ meene Frau Bescheed, denn det kann hier noch lange dauern!“
„Denn loof’, du Karnalje du“, sagte Onkel Karl, den Hund, der sich fortwährend hatte freimachen wollen, wieder loslassend, „loof’ bei’n Schinder und laß dir schlachten!“ Und sich zu Herrn Lemke wendend, sagte Onkel Karl: „Det kommt davon, weil wir nicht jleich ’rinkonnten! Nu muß ick hinta ihn her, und wenn ick ihm dann wejloofe, kommt er wieder hinta mir her, so macht er det imma, denn sonst is’s ’n sehr anhänglichet Tier. Lassen Se also die Türe offen, wir kommen jleich wieder zurück – adje so lange!“
Und damit rannte Onkel Karl davon, und man hörte ihn auf der Straße schrille Pfiffe ausstoßen und in allen Tonarten „Nulpe“ schreien.
Onkel Karl baut
„Der Hund is man bloß vapriejelt“, sagte Frau Lemke, als Onkel Karl dann mit „Nulpe“ in der Stube war.
„Na, machen Se’n ’mal det Maulkörbchen ab, da werden Se sehen, wie er zuschnappt. Nee, ick hab’n uff’n Mann dressieren wollen, und da is er so jeworden. Aba et is ja bloß, det man drüba red’t! Nu von wat anneres, denn det Biest vasteht ja jedes Wort, et vadreht schon wieder so dehmlich die Oojen in’n Kopp“, suchte Onkel Karl das Gespräch abzulenken. „Det is hier Ihre jute Stube – wahr?“
„Ja“, sagte Herr Lemke, der sich nur schwer von dem an der Tür kratzenden „Nulpe“ abwenden konnte, „eijentlich jehört noch ’n Klavier ’rin, aba wer soll denn druff spielen?“
„Da find’t sich schon imma eener, det is’s wenijste“, sagte Onkel Karl, „soll ick Se eens beschaffen – ganz billij?“
„Ick kann mir ja schon denken, wat for eens, aba lieberst nich –“, und Herr Lemke kratzte sich bedenklich den Kopf, „Se meenen doch det, wat früha meene Schwiejatochta in det untairdsche Lokal hatte und wat denn nachher bei den Fischhändla kam?“
„Ja – bei Onkel Aujusten und Tante Liesen, die aba bis jetz noch keenen Dreier abjezahlt haben. Erstens jehört se’t nich, un zweetens: Wat soll det da bei die so nutzlos ’rumstehen, wo Ihre kranke Frau jetz sonne jroße Freide dran haben könnte! Nulpe, kratz’ nich, sonst schmeiß ick dir’n Stiebel an’n Kopp – ja kieck man so dusselij, dir meene ick, wen denn sonst!?“
„Is aba ooch wahr“, sagte Frau Lemke, „’n bißken Musik wär’ doch sehr scheen, wo man nu janischt mehr hört, denn wegen die Mieta müssen wa jedesmal die Leiakastenmänna von’n Hof jagen, so leid et uns ooch tut.“
„Also – abjemacht, Seefe“, sagte Onkel Karl, „ick beschaff’ et Sie, nächsten Sonntaj steht’s hier, und wenn Se wollen, bring’ ick eenen her, der perfekt druff spielen kann!“
„Ach – den Herrn Hahn, wat? Iber den sich meen Sohn so jeärjert hat“, sagte Herr Lemke, „den wollen wa man lieba in die Versenkung lassen, der Kerrel hat dunnemals meene Schwiejatochta ins Jerede jebracht!“
„Is doch allens man bloß Klatsch jewesen von die vadammte Bande aus de Ackastraße. Hier in’n feinen Westen weeß doch keen Mensch wat von. Nulpe, wennste nu nich uffhörst, kriste den annern Stiebel ooch noch an’n Kopp!“
„Na, det können wir uns noch allens iberlejen“, sagte Herr Lemke, „wodrieber ick mir aba schon die janze Zeit wundere, det is Ihr Aussehn. Se haben sich mächtig vaändert, wat, Mutta?“
„Finden Se?“ – Onkel Karls Augen suchten einen Spiegel – „ja, det macht woll die Ausrüstung. Ick hab’ mir nehmlich uff die Landwirtschaft jeschmissen. Heitzutaje muß man doch allens zu vawerten suchen, wahr? Und wo ick nu so jute Kenntnisse in die Naturwissenschaften habe ...“ Er schwieg bescheiden, aber nach einigen Sekunden setzte er hinzu: „Nebenbei bau’ ick ooch!“
„So?“ sagte Herr Lemke gedehnt und sah seine Frau bedeutsam an, „det vastehn Se also ooch so jut? Wat ick Ihn’n schon imma frajen wollte – wat sind Sie’n eejentlij von Beruf, irjend wat missen Se doch jelernt haben?“
„Ick?“ Onkel Karl faßte in die Westentasche, holte einen Priem vor, biß davon ein Stück ab und schob es in die Backentasche. „Ick bin frieha uff See jewesen, vastehen Se? Aber als ick denn bei den jroßen Sturm aus’n Mastkorb jeschleidert wurde, jab ick die Seefahrerei wieder uff und hab’ denn so ’rumjesimpelt – bis jetz – nu bin ick Landwirt und Bauuntanehma in eene eenzichte Person!“
„So?“
„Ja –“, sagte Onkel Karl mit großer Befriedigung, daß die Sache endlich einmal festgestellt worden war. „Ja, ick bin schon ’n jutet Sticke in de Welt ’rumjekommen und hab’ wat zu sehen jekriejt. Woher hätt’ ick denn det ooch allet sonst – irjendwo muß et doch herkommen. Sie mißten mal rauskommen bei mir, Herr Lemke, und sich meene Plantasche ansehen, staunen wirden Se!“
„Ja, unsa Sohn hat uns schon von azehlt“, sagte Frau Lemke, „wir kennen allet nach die Beschreibung, ooch von Ihre Bauerei wissen wir, von det Blockhaus!“
„Ach, Se denken, so wat bau’ ick bloß?“ Onkel Karl schüttelte mit einem nachsichtigen und überlegenen Lächeln den Kopf. „Nee, liebe Frau Lemke, det wär’ woll nich det richtje! Ick hab’ da draußen ’ne scheene Eckpazelle gekooft und laß ’ne sojenannte Mietskaserne ufführen, denn det rentiert sich imma am besten. Die ersten Balkenlaje is schon fertij, eene Bank jibt denn det Jeld zum Weitabau – det is Usus so –, aba nu bin ick ’n bißken int Stocken jeraten, denn ’n Laie macht sich ja keene Vorstellung, wat da allet drum und dran hängt.“
„So?“ sagte Herr Lemke und mahnte durch einen sanften Stoß seine Frau zur Vorsicht.
Aber Onkel Karl, trotzdem er eben Nulpe pantomimisch mit Stiefelwerfen bedroht, hatte es bemerkt und sagte gekränkt: „Se brauchen Ihre Jattin ja nich zu knuffen; wenn Se nich wollen, denn nich. Ick dachte bloß eben, wo ick Sie nu det scheene Klavier beschafft hab’, wirden Se mir ooch ’n bißken jefällij sind. Wa’m soll ick mir denn an’n Halsabschneida wenden, wo ick sonne reichen Vawandten hab’? Nulpe, wennste jetz nich jleich ruhij bist und die Schnauze hältst, hau’ ick dir ’n Brejen in! – Zu’n Hund kann man Schnauze sajen, det is nich unanständij“, fügte Onkel Karl wie zur Entschuldigung hinzu und sah Frau Lemke fragend an.
„Denn ’n Schnabel hat er ja nich –“, sagte die Kranke mit einem zustimmenden Lächeln.
„Nee – sonst könnten ja die Hunde zwitschern.“ Und Onkel Karl sah Frau Lemke dankbar an, als wäre sie auf seiner Partei.
Die Tür öffnete sich, Minna – mit einem Tablett voll Gläsern und Flaschen – kam herein und machte, als sie an Onkel Karl vorbei mußte, einen großen Bogen.
„Ach Jott – ick tu’ Ihn’n nischt –, nehmen Se sich lieberst vor den Hund in acht. Wenn Se den zufällij uff’n Schwanz treten sollten, streckt er Sie mit eenen Tatzenschlaj zu Boden!“
Als Herr Lemke mit seltener Kunstfertigkeit die Weißbierflaschen öffnete, die Gläser gefüllt und alle getrunken hatten, sagte Onkel Karl: „Wie wär’ det mit’n Jungen von den Nulpe – Herr Lemke, wollen Se eenen haben, ’n hibschet Exemplar?“
„Nee – danke! Ibrijens, ist denn die Töle da ’ne Sie?“ fragte Herr Lemke. „Ick hab’ ihr bisher for’n Er jehalten!“
„Det is ooch keene Ihr und keene Sie, sonnern ’n Er“, sagte Onkel Karl, stolz auf seinen Hund.
„Denn vasteh’ ick nich, wie de Vieh Junge kriejen soll!“
„Jott, is det allet eene Umständlijkeet“, sagte Onkel Karl ein bißchen verdrießlich, „ick meene natierlich, wenn die Sie von den Er Junge kriejt!“
„Ach so, nu ha’ ick Ihn’n schonst vastanden“, sagte Herr Lemke, befriedigt mit dem Kopf nickend, „vasteh’ schonst, ja ja – Sie haben noch ’ne Sie zu Hause!“
„Nee, leida eben nich“, sagte Onkel Karl.
„Denn kann ick mir nich helfen, denn bleibt mir die Jeschichte schleiahaft“, sagte Herr Lemke, „Mutta – vastehst du denn det?“
„Ihr habt eich jejenseitij ’n bißken vaheddert“, sagte Frau Lemke, „seh’ ma, Vata, er meent ...“
„Nee, nee, aklär’s mir lieba nich“, wehrte der Alte ab, „mir platzt sonst wat in’n Kopp. Ick will ja jakeen so’n Biest, keen junges und keen altes nich!“
„Denn nich“, sagte Onkel Karl gekränkt, „denn behalte ick se, bis ick ’n wirklichen Liebhaba for finde!“
„Det wird woll ooch det beste sind, prost“, sagte Herr Lemke, nach dem Glase fassend.
„Prost – na, und wie is nu mit det Jeld jejen jute Sichaheet?“
Herr Lemke schüttelte ruhig und gelassen den Kopf: „Nee, meen Lieba, wenn Se desterwejen herjekommen sind, tut mir’s um Ihre Stiebeln leid. Ick will Ihn’n nämlich sajen, det ick den Rummel janz jenau kenne. Ick seh’t ja hier vorne uff die Schöneberjer Wiesen, wo se wie varrickt zu bauen anjefangen haben, lauta vakrachte Häusa, keene Lieferanten und keene Handwerka sind bezahlt worden, Vorteel davon haben nur die Kerls, die die mittellosen Leite zu’t Bauen vaanlaßt haben. Wenn ick Ihn’n heite fimfhundert Tala jebe – morjen sind se alle, da haben Se een Loch zujestoppt und ’n anneres is offen!“
„Also fimfhundert –“, sagte Onkel Karl, eine große, lederne Brieftasche vornehmend, „jejen Wechsel oda wat wollen Se for ’ne Sichaheet?“
„Nich ’n Dreier“, sagte Herr Lemke grob. „Mann, lassen Se die Finga von die janze Bauerei, lejen Se sich lieba ’ne Piereselhecke an, det is jescheita, da riskieren Se nischt!“
„Aba, wennste ihn helfen könn’st?“ sagte Frau Lemke leise, als sie sah, wie Onkel Karl, noch immer zögernd, die lederne Brieftasche in die Nankingjacke steckte.
„Nee, den is nich zu helfen“, sagte der Alte, „haste die dicke Brieftasche jesehen, det sind allet unbezahlte Rechnungen!“
„Se hätten mir ja später det Haus abkoofen können“, sagte Onkel Karl.
„Wat’n für’n Haus, det jehört Se doch janich!“
„Aba det Jrundstück!“
„So?“ sagte Herr Lemke gedehnt, „ick weeß et zufällij aba bessa, Sie jehört nischt weita als die Schulden uff det Jrundstück und uff den Bau – dafor werden Se vaantwortlij jemacht werden!“
„Et soll mir mal eener wat tun wollen“, sagte Onkel Karl drohend, „komm, Nulpe, wir jehen los!“
„Geld her oder ich fall’ um“
Tag für Tag war dann Onkel Karl, dem allmählich etwas bänglich zumute wurde, umhergelaufen, um das Geld, das er den Bauhandwerkern schuldete, aufzutreiben. Eine Ahnung stieg in ihm auf, daß ihn dieser Herr Hahn, den er eigentlich bisher für einen großen „Schafskopp“ gehalten, in eine „vaflixte Patsche“ gebracht hatte. Wie schön hatte das damals geklungen: „Wollen Sie ein reicher Mann werden? Jetzt haben Sie Gelegenheit dazu – mit Nichts können Sie anfangen – und wenn Sie in zwei, drei Jahren das Haus gut verkauft, haben Sie so viel, daß Sie bis an Ihr Lebensende in einer Gummiequipage fahren können.“