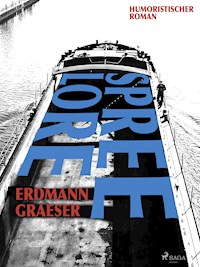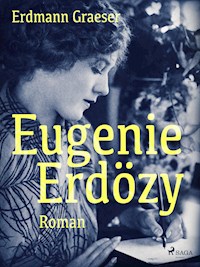Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Tempelhofer Feld in Berlin an einem herbstlichen Sonntagnachmittag Ende der 1870er Jahre. Väter gehen mit ihren Söhnen zum Drachensteigenlassen an die Natur und im Ausschank der Brauerei Tivoli ist mächtig was los. Dort arbeitet auch Mamsell Röschen und wird, wie üblich, von ihrem Fast-Verlobten Ferdinand Koblank, genannt Nante, aufgesucht. Heute hat sie ihm aber eine traurige Mitteilung zu machen: Ihr Vater hat sich entschieden gegen eine Verlobung mit dem als Schürzenjäger geltenden jungen Mann ausgesprochen. Ferdinand nimmt es einigermaßen unbekümmert, und Rösschen ist überzeugt, dass er ihr dennoch treu bleiben wird. Daher widersteht sie auch allen Annäherungsversuchen von Anton Timpe und legt es ihm als perfide Strategie aus, als er ihr versichert, Ferdinand stehe kurz vor der Verlobung mit Auguste, der Tochter des reichen Zibulke. Ihr bricht es schier das Herz, als im Hause Zibulke nun tatsächlich bald die Hochzeitsglocken läuten und Nante mit seinem Gustchen im Haus in der Bülowstraße einzieht. Während Anton weiterhin erfolglos um Röschen wirbt, werden im Hause Koblank zwei Kinder geboren: Zuerst der kleine Theo, dann das zarte, winzige Mädchen Elli, deren Geburt leider zugleich ihrer ebenfalls sehr zarten Mutter das Leben kostet – woraufhin Ferdinand von seiner verzweifelten Schwiegermutter des Mordes an ihrer Tochter bezichtigt wird. Während er sich nun zunehmend von den Zibulkes entfremdet, erinnert sich Nante, der nun verwitwete Vater zweier kleiner Kinder, wieder an seine Jugendliebe, das Röschen, und sucht erneut den Kontakt zu ihr. Und die so schmählich Sitzengelassene hat ihn ja insgeheim nie aufgehört zu lieben ... Werden Theo und Elli bald eine liebende Stiefmutter haben? Erdmann Graesers großer Berliner Familienroman, voller herzhaft realistischem Humor, tief humanistischer, einfühlsamer Liebe und mit reichlich Berliner Kodderschnauze erzählt, wurde nach seinem Ersterscheinen 1921 bis in die achtziger Jahre hinein immer wieder aufgelegt und ist nun zum ersten Mal auch als E-Book erschienen.Erdmann Graeser (1870–1937) war ein deutscher Schriftsteller. Als Sohn eines Geheimen Kanzleirats im Finanzministerium in Berlin geboren, ist Graeser zwischen Nollendorfplatz und Bülowbogen im Berliner Westen aufgewachsen. Graeser studierte Naturwissenschaften, brach jedoch das Studium ab und arbeitete zunächst als Redakteur für die "Berliner Morgenpost" und später als freier Schriftsteller. Er wohnte viele Jahre in Berlin-Schöneberg und zog nach seinem literarischen Erfolg nach Berlin-Schlachtensee im Bezirk Zehlendorf. 1937 starb er an einem Herzleiden. Sein Grab liegt auf dem Gemeindefriedhof an der Onkel-Tom-Straße in Zehlendorf. In seinen Unterhaltungsromanen thematisierte Graeser die Lebenswelt der kleinen Leute im Berlin seiner Zeit und legte dabei auch großen Wert auf den Berliner Dialekt. Zu seinen bekanntesten Romanen gehören "Lemkes sel. Witwe", "Koblanks", "Koblanks Kinder" und "Spreelore". Einige seiner Romane wurden später auch für Hörfunk und Fernsehen bearbeitet.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erdmann Graeser
Koblanks
Roman
Einer Berliner
Familie
Saga
Koblanks
© 1959 Erdmann Graeser
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711592465
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
1
Der Sommer war überreif, der Herbst, an den noch niemand so recht glauben wollte, kam. Wem es nicht die Anzeichen der Natur verrieten – die seltsam klare Luft, die feinen blauen Dunstschleier abends und morgens in den Baumwipfeln –, dem kündete es ein anderes untrügliches Zeichen: die Berliner Jungen zogen zum Drachenfest aufs Tempelhofer Feld hinaus.
Aber nicht mehr allein, die Angehörigen kamen mit, denn die Väter – wieder jung – waren ebenfalls vom Drachenfieber erfaßt worden. Schon von weitem, ehe das freie Gelände da draußen vor dem Halleschen Tor-Bezirk erreicht war, sah man bereits die Drachen unter dem blauen Himmel flimmern – in allen Farben, einen immer höher als den anderen. Überall auf dem ausgedörrten Grase Menschen – die meisten hatten es sich bequem gemacht, lagen auf dem Rücken, blinzelten nach den Drachen, verfolgten jede Bewegung und lachten schadenfroh hinter denen her, die sich in eiligem Lauf vergeblich abquälten, ihren Drachen zum Aufstieg zu bringen.
Wie das Mauerwerk einer Festung ragten die starken Wände der Brauerei Tivoli aus der Ebene. Von dort klangen heute, am Sonntagnachmittag, die Töne der Kapelle, und in den Konzertgarten zog alles, was den Groschen Eintrittsgeld bezahlen konnte und sich nun bei Bier und Gänsebraten oder Jauerschen Würsten mit Meerrettich von der Mühsal einer langen Arbeitswoche erholen wollte.
»Büblein wirst du ein Rekrut,
Merk dir dieses Sprüchlein gut ...«,
tönte es schmetternd. Die Kellner balancierten auf hochgehobenen Händen große Servierbretter, besetzt mit schäumenden Bierseideln, alte, verhutzelte Frauen bahnten sich mühsam durch das Gewühl einen Weg und verkauften, von Tisch zu Tisch humpelnd, Salzbrezeln zum Anreizen des Durstes für die Erwachsenen oder runde, steinharte Pfefferkuchen für die Kinder; zuweilen kam auch ein Händler, an Bindfäden in der Luft hinter sich herziehend ein Gewirr roter, grüner oder blauer Ballons, die den Jüngsten von manchen Vätern gern als Notbehelf für einen Drachen gekauft wurden.
Die Luft war durchbraust vom Rufen, Schreien und Sprechen Tausender von Menschen – ein Berliner Sonntagnachmittag Ende der siebziger Jahre.
Ununterbrochen eilten die Kellner nach dem Bierausschank oder dem Büfett, wo unter Leitung von Mamsell Röschen Schmidt die Portionen Gänsebraten mit Gurkensalat, die Wiener Schnitzel oder Kalbsnierenbraten aufgestellt und an die Kellner abgegeben wurden.
An solchen Tagen war Mamsell Röschen die Munterkeit selbst und konnte wie ein Kapitän im Sturmgebraus kommandieren – immer freundlich und bereit, jeden Augenblick selbst mit Hand anzulegen. Heute aber mußte ihr was verquer gegangen sein, denn in ihrem hübschen frischen Gesicht war ein recht trübseliger Zug, der allen auffiel, die mit ihr sprachen.
Man konnte ja den Anlaß leicht erraten: Der »schöne Ferdinand« hatte es in der letzten Zeit wieder einmal zu arg getrieben. Die Küchenmägde erzählten die tollsten Geschichten von ihm, dem Schürzenjäger. Wenn er, auf dem Kutschbock sitzend, mit dem Brauerwagen über das Tempelhofer Feld jagte, brauchte er nur mit der Peitsche zu winken oder mit der Zunge zu schnalzen, und jedes Mädel, das er da unterwegs traf, war sofort bereit, ein Stück mit ihm zu fahren. Na, und dann ...
Und das, trotzdem sie doch alle wußten, daß er mit der Mamsell so gut wie verlobt war!
Plötzlich zuckte Röschen zusammen – über den freien Vorplatz, der das Wirtschaftsgebäude vom Konzertgarten trennte, kam Ferdinand Koblank, der seinen freien Tag hatte. Auch sonntags ging er stets in dem weißen Drillichanzug, die Hosen steckten in hohen, blankgeputzten Schaftstiefeln, die Mütze saß schräg auf dem braunen Kraushaar, und im Knopfloch glühte eine rote Nelke. Der Mann strotzte von Kraft und Gesundheit – es war schon richtig: mit dem wagte keiner anzufangen, selbst wenn er ihm das Mädel vor der Nase wegnahm.
In der Nähe des Küchenfensters blieb er stehen, griff nach einem der klobigen Schwefelholzbehälter, die dort auf dem runden eisernen Tischchen standen, strich aber das Hölzchen an der Kehrseite seiner Hose an und brannte dann, nachdem sich der Schwefeldunst verzogen, eine Zigarre an. Während der ganzen Zeit schielte er zu Röschen hinüber.
Endlich sah sie zu ihm hin und nickte unmerklich. Da setzte er gelassen seinen Weg weiter fort, trat durch eine kleine eiserne Hinterpforte auf die Straße hinaus und ließ sich wartend in einer Sandgrube dicht neben der Steinmauer nieder.
Hier war es merkwürdig still und einsam. Das Brausen und der Lärm der Blechmusik aus dem Biergarten war kaum zu hören. Die Menschen, die das Feld belebten, kamen mit ihren Drachen nicht her, nur ein paar armselige Existenzen, die sich in ihrer Zerlumptheit abgesondert hatten, lagen da und dort in dem dürren stacheligen Bocksbartgrase, die verbeulten Hüte auf den Gesichtern, und verschliefen die Zeit. Pennbrüder! dachte Ferdinand verächtlich. Vor ihm blühten ein paar Stauden wilder Zichorie, blau wie Kornblumen, Kohlweißlinge flatterten träge vorüber, und ein Goldkäfer irrte verzweifelt durch die unendliche Sandwüste zu Füßen des Wartenden. In der Luft war ein süßlicher Malzduft, vermischt mit dem Geruch der frischgepichten riesigen Biertonnen, die hinter der Mauer zum Trocknen in der Sonne standen.
Da klappte die kleine Eisentür – Röschen kam. Ferdinand stand auf und ging ihr entgegen. Sie gaben sich die Hände, aber Röschen sah fort. Ihre blauen Augen wurden plötzlich naß – sie fuhr mit dem Zipfel der weißen Latzschürze darüber und sagte: »Ick komme dir bloß rasch Bescheid sagen, Nante! Vater will’s nich zujeben!«
Das rote, frische Gesicht des Bierfahrers blieb unverändert, nur die weißen starken Zähne faßten den Zigarrenstummel fester. »Will also nich – Ri-Ra-Rösiken?«
Nun weinte sie bitterlich, achtete nicht mehr darauf, daß die frischgewaschene Schürze beim Abtrocknen der Tränen zerknittert wurde.
»Ick konnt’ mir’s ja denken«, sagte Ferdinand. »Ick hab’ nischt – ebensowenig wie dein Oller hatte, als er dunnemals anfing. Und wenn er nu det Haus in die Möckernstraße hat und den Jroßkotz ’rausbeißt, versteh’ ick ja, det er für seine Tochter eenen anderen Schwiegersohn haben will. Na – denn weene man nich, Ri-Ra-Rösiken, laß dir eenen aussuchen und werde jlicklich mit ihm!«
»Nante – kann ick wat for?« schluchzte sie. »Vater hat sich nach dir erkundigt und jehört, wie du es treibst ...«
Ferdinand Koblank verteidigte sich gar nicht. »Na denn also – Fräulein Röschen – war es woll heute das letztemal, wo Sie mir ...«
Sie hob erschrocken den Kopf, als er sie wieder mit Sie anredete, und starrte ihn an.
Er hielt ihr die Hand hin, aber sie ergriff sie nicht, sondern schlug plötzlich laut aufweinend die Hände vors Gesicht, wandte sich um und ging rasch davon. Gleich darauf schnappte die kleine Eisentür ins Schloß, der Schlüssel wurde umgedreht und abgezogen.
Die Dämmerung kam, die Familien, die auf der Ebene im Sonnenschein gelagert, rüsteten zum Aufbruch. Überall wurden die Drachen aus der Luft geholt und stürzten dann zuletzt, die Spitze nach unten, rauschend und krachend zur Erde. Eine Völkerwanderung nach der im grauen Dunst liegenden Stadt begann – das Feld wurde allmählich einsam.
Auch Ferdinand war, ganz in Gedanken versunken, der Stadt zugeschritten, schließlich ans Hallesche Tor gekommen, überlegte nun einen Augenblick und ging dann am Kanal entlang weiter.
Ick werde Vatern ’mal wieder uffsuchen, dachte er. Der alte Koblank, der seinen Posten als Güterinspektor bei der Potsdamer Bahn kürzlich aufgegeben hatte, lebte jetzt als Witwer einsam hoch oben unter dem Dach eines der ersten Häuser in der Flottwellstraße. Da hatte er einen weiten Überblick über die Bahngleise, sah abends die bunten Signallaternen aufflammen, hörte den Pfiff der Lokomotiven und philosophierte bei seiner Pfeife Rosenblättertabak über Welt und Menschen still vor sich hin. Denn er war ein sinnierlicher Herr.
»Nanu?« fragte er verwundert, als er die Tür geöffnet und den Sohn erkannt hatte. »Nanu, was treibt dich denn her?« Er ließ ihn in die Stube vorangehen und wies auf einen Stuhl am Fenster.
Ferdinand faßte in die Brusttasche und hielt ihm ein paar Zigarren hin. Der Alte schüttelte den Kopf. »Behalt man«, sagte er, »ich rauch’ am liebsten meine Piepe, die Dinger haben ja keine Luft!«
»Aber du hast ja man bloß noch Pollack drinne!«
Ja, die Pfeife war ausgebrannt, gab nur noch Schmirgeltöne von sich. Der Alte zog ein paarmal kräftig, ohne gleich zu antworten. Er ärgerte sich stets, wenn sein Sohn »berlinerte«, denn von Jugend auf hatte er darauf gehalten, daß Ferdinand »ordentlich« spräche – obwohl er, der Alte, sich in der Erregung ebenfalls gehenließ. Aber er war der Sohn eines prinzlichen Leibkutschers, hatte gute Umgangsformen gelernt und hätte es gern gesehen, wenn der Junge einen Beruf ergriffen, der ihn in die Höhe gebracht. »Wenn du bloß beim Militär geblieben wärst, den Zivilversorgungsschein bekommen hättest«, sagte er seufzend.
»Na ja – Vater – ick weeß ja!«
Der Alte hatte nun doch eine Zigarre genommen und sie in der Hand zerbröckelt, während er den Sohn forschend betrachtete. »Wie geht’s dir denn eigentlich?«
»Jott – ick lebe meinen juten Tag! Mir kann keener – ick brauch’ mir nich anranzen zu lassen und strammzustehen – mache, wat ick will!«
»Und was machste dann später–als alter Mann, ohne Pension?«
»Ick pfeif’ uff die paar Jroschen!«
»Ja – jetzt – aber nachher!«
»Denn werd’ ick Totenjräber!«
Der Alte sah ihn mit einem Blick an, in dem die ganze Verdrossenheit lag, die er seit Jahren gegen den widerspenstigen Sohn aufgespeichert hatte – aber er schwieg. Wozu sich den schönen Sonntagabend verderben! Als er dann aber Ferdinand so weltverloren in den Abendhimmel starren sah, durchfuhr ihn plötzlich ein Schreck. »Na, sprich doch, dir is doch was, Nante, haste was ausgefressen, dann sag’s doch!«
»Nee – Vater, mach dir keene Sorge!«
»Denn das würdest du mir doch auch nicht antun?« fragte der Alte, noch immer mißtrauisch.
»Ick mach’ dir keene Schande – also keene Bange – so eener bin ick nu doch nich.«
»Janz richtig kommt mir die Kiste aber nicht vor!«
Ferdinand lachte. »Ick war nur herjekommen, um zu sehen, wie es dir jeht, Vater, nu will ick aber wieder türmen – adje!« Er reichte dem Alten die Hand.
»Adjes, Nante! Du solltest dir ’ne tüchtige Frau nehmen, die tut dir not.«
»Det werde ick ooch – du jlaubst ja nich, wie rasch det jehen kann.«
Er nickte noch einmal zum Abschied und ging davon.
2
Graue Dunstschleier lagerten in der Frühe des nächsten Tages über dem Feld, schwanden aber schnell, als die Sonne höher stieg. Es wurde wieder ein herrlicher Spätsommertag, so wie gestern.
Im Zuckeltrab fuhr Ferdinand auf der Landstraße nach Berlin. Heute war die weite Ebene leer, nur eine Schafherde mit ihrem Hirten in einiger Entfernung zu sehen, und zuweilen klang aus der Gegend der Hasenheide ein Trompetensignal – dort übten Soldaten. Dann und wann ein Lokomotivenpfiff oder das heisere Krächzen einer Krähenschar, die das Peitschenknallen und das Räderrollen des herannahenden Wagens aufgescheucht hatte.
Überall, wohin heute der schöne Ferdinand kam, wunderte man sich, wie eilig er es hatte. Wenn er sonst die Bierfässer in die Gastwirtschaften rollte oder die Achtel- und Vierteltonnen in die Haushaltungen trug, war es immer mit großem Hallo geschehen, und die Dienstmädchen waren nachher noch stundenlang in heller Aufregung gewesen. Heute kniff er sie ja auch in die Backen und bloßen Arme, drückte wohl die eine oder andere an die Lederschürze – aber man merkte, er tat es nur aus Gefälligkeit, ohne selbst ein Vergnügen dabei zu haben.
Nun lenkte er den Wagen um den Belle-Alliance-Platz in die Lindenstraße und hielt vor dem Hause des Töpfermeisters Zibulke. Dieses Haus stammte noch aus der ersten Bebauung der Straße, war zweistöckig mit ehemals rotem, jetzt schwarz gewordenem Ziegeldach, machte aber in seiner schmucklosen Einfachheit einen wohltuenden, gediegenen Eindruck.
Der »olle Zibulke«, wie immer in merkwürdig großkarierten Hosen, stand vor der Haustür und überwachte den Mops seiner angejahrten, etwas verwachsenen Tochter.
»Schon wieder een Achtel?« fragte er verdrießlich, als Ferdinand, das Fäßchen auf der Schulter, mit kaum merkbarem Gruß an ihm vorbeiging.
»Wenn Se nich wollen?« Ferdinand machte kurzerhand kehrt. »Fräulein Aujuste hat bestellt – alle vierzehn Tage soll ick kommen!«
»Wenn meine Tochter det so bestimmt, is’s ooch richtig – also man ’ruff damit!«
Herr Zibulke sah ihm mit kritischen Blicken nach, wie er die weißgescheuerten Treppen nach dem ersten Stock hinaufstieg, wandte sich dann aber wieder der Betrachtung des Mopses zu, der auf dem Rinnsteinbrett vor der Tür stand.
»Wat jlotzte, Mufti? Du fängst im Leben keene Ratte nich! Und wat sollsten ooch mit ’ne Ratte, wo du dein’ Futternapp nich mal leerfrißt!«
Ein Drehorgelspieler kam, von einer Kinderschar gefolgt, in diesem Augenblick aus einem Nachbarhause und wollte an Herrn Zibulke vorbei in den Flur.
»Raus – hier wird nicht jedudelt!« sagte der Alte.
Der Drehorgelspieler zog ergeben weiter, die Kinder aber begannen Herrn Zibulke aus sicherer Entfernung zu beschimpfen:
»Olle Töpperschürze! Jeizkragen!«
Er tat, als hörte er nichts. Da begann die Rotte zu singen:
»Aujuste Zibulke kriejt keenen Mann,
Drum schafft sie beizeiten ’nen Mops sich an,
Da freut sich der Olle und is vajniejt,
Weil er so billig ’nen Schwiegersohn kriejt!«
Herr Zibulke machte unwillkürlich eine Bewegung, als wolle er seine Holzpantinen abziehen und in die Schar schleudern. Doch er überlegte es sich. Schon einmal war ihm auf diese Weise ein Pantoffel abhanden gekommen, weil er nicht getroffen und einer der Jungen das Ding aufgehoben hatte und damit geflüchtet war. So hielt er es für das beste, dem Hunde zu pfeifen und in die Wohnung zu gehen.
Herr Zibulke hatte, weil sie zu viel Lärm machten, die neuen schweren Pantinen auf der Treppe ausgezogen und war in Strümpfen hinaufgegangen. Als er jetzt die nur angelehnte Korridortür aufmachte, sah er, wie Liese, das Dienstmädchen, erschrocken von der Küchentür zurückprallte.
»Nanu, du kiekst woll durchs Schlüsselloch, wat jibt’s denn da drinne so Scheenet – wat?«
»Fräulein Juste hat mir ’rausjeschickt, als der scheene Ferdinand kam!«
»Na – laß doch die beeden, da sollste eben nich bei sind. Wart, ick werd’ dir! Wirste jetz jleich den Mülleimer ’runtertragen!«
Und als das Mädchen verschwunden war, klinkte Herr Zibulke die Tür auf und trat in die Küche.
Fräulein Auguste hatte einen Taler in der Hand, den sie jetzt, als sie ihren Vater erblickte, in die Schürzentasche zu stecken suchte. Sie war aber zu aufgeregt, das Geldstück entfiel ihr, rollte durch die Küche, gerade auf Ferdinand zu. Er trat mit dem Fuß darauf, hob es aber nicht auf.
Herr Zibulke bückte sich schnell und nahm den Taler. »Na – det dauert ja heite hier so lange? Wa’m jeht ihr denn nich in die gute Stube, wenn ihr euch so wat Wichtiges zu sagen habt, det Liese ans Schlüsselloch horcht!«
Ferdinand sah ihn pfiffig an: »Wir hatten janischt Wichtiges. Fräulein Aujuste wollte mir nur ’nen Taler Trinkjeld jeben – ick mach’ mir aber nischt aus ’n Taler Trinkjeld!«
»Sondern?« sagte Herr Zibulke. Und als Ferdinand nur die Achseln zuckte, setzte er hinzu: »Aber aus tausend – wat?« Ferdinand lachte laut auf. »Und wenn Sie fufzigtausend sagen, wird’s mir noch nich heiß!«
»Aber bei hunderttausend, wat?«
»Det käme druff an!«
»So? Ja – da werden die jungen Männer schwach! Kenn’ ick, weeß ick! Da bekommen se jleich Jefühle! Sagen Se mal, wie is denn, woll’n Se nich nächsten Donnerstag ’ne scheene Landpartie mitmachen – per Kremser, wat?«
Ferdinand hatte nicht nein, aber auch nicht ja gesagt, nur nach Fräulein Auguste geblickt – ein Blick, der sie von oben bis unten erfaßte, unter dem sie sich förmlich wand.
Nun war er auf der Rückfahrt. An einem der Chausseebäume auf dem Tempelhofer Feld saß eine merkwürdige Gestalt, ein noch junger Mensch, bekleidet mit Manchesterhosen, schwarzem Rock und großem Schlapphut. Um den Hals hatte er ein rotes Tuch geschlungen, in der Hand hielt er eine Schnapsflasche. Er saß da und sang:
»Kommen Se ’rin, kommen Se ’rin, kommen Se ’rin,
Kommen Se ’rin in die jute Stube ...«
Ferdinand hielt den Wagen an: »Timpe – Anton Timpe, du hast woll blauen Montag jemacht?«
Der Mensch erhob sich schwerfällig, starrte den Bierfahrer ein Weilchen an und sagte: »Ick kenne dir – du bist der scheene Ferdinand! Mein Name is Anton Timpe. Steinmetz Anton Timpe – ein Künstlerer aus die Möckernstraße – Jrabkreuze – Todesengel – jeborstene Säulen.«
»Jawoll – det weeß ick! Und wenn du deine Kusine siehst – Röschen Schmidt –, denn sage ihr man: Der scheene Ferdinand hat ’ne andere.«
Aber der »Künstlerer« Anton Timpe betrachtete diese Mitteilung nur als Aufforderung zum Singen. Er nahm noch einen kräftigen Schluck aus der Flasche und hob dann mit lauter Stimme an:
»Herr Schmidt, Herr Schmidt –
Wat bringt det Rösken mit?
’n Schleier und ’n Federhut –
Der steht dem Rösken jar zu jut ...«
Und schwankend setzte er sich in Bewegung und torkelte über das von der Sonne durchglühte Feld. Ferdinand schnalzte mit der Zunge und zog die Zügel an. Die beiden wohlgenährten Braunen setzten sich, schon längst ungeduldig durch die umschwärmenden Bremsen, sofort in Gang, und als sich Ferdinand dann noch einmal umsah, war Anton Timpe mit seiner Schnapsflasche am Horizont verschwunden.
Am Abend aber kletterte Ferdinand durch den lockeren, weißen Sand zum Kreuzberg hinauf und ließ sich neben dem Denkmal des Freiheitshelden nieder. Weltabgeschieden und einsam saß er da und starrte auf das bunte Durcheinander der Dächer.
Ein letzter Sonnenglanz lag über der großen Stadt, aus allen Schornsteinen kringelte blauer oder grauer Rauch. In weiter Ferne leuchtete die goldene Gestalt auf der Siegessäule, Ferdinand erkannte auch die grüne Kuppel des Schlosses, den Turm der Jerusalemer Kirche, in der er eingesegnet worden war – und plötzlich legte er den Kopf an das eiserne Gitter, schluckte und würgte, wischte sich mit dem Handrücken die naßgewordenen Augen und sagte halblaut: »Ja, ja – Ri-Ra-Rösiken – alles is futsch.« Als er sich wieder aufrichtete, war die Dämmerung völlig hereingebrochen, Berlin lag in schweren, grauen Dunstschleiern, nur das fahle Grün der Bäume aus den Gärten am Fuße des Berges schimmerte noch deutlich erkennbar herauf.
Ferdinands Gesicht hatte alle Weichheit verloren. Er erinnerte sich, wie Mamsell Röschen fortgeblickt, als er am Nachmittag am Küchenfenster vorbeigegangen war.
»Zu arm bin ick ihr – na, denn soll se sehen, det der reiche Vater von eener andern froh is, wenn er mir kriejen kann. Da hab’ ick nu mal wirklich eene jeliebt, und da muß es nu so kommen! Und nu will ick ooch nich mehr, nu renne ick in mein Unjlick und mache beede Oojen zu!«
3
Als der schöne Ferdinand erklärt hatte, daß er am nächsten Donnerstag nicht fahre, weil er etwas »Wichtiges« vorhabe und deshalb den ganzen Tag frei haben müsse, war es in der Brauerei zu einer unerwartet scharfen Auseinandersetzung gekommen. Ferdinand merkte, daß dahinter etwas stecken mußte, daß man etwas gegen ihn hatte – gegen ihn, der doch von jeder Ausfahrt neue Kundschaft brachte.
Gut, dann wollte er es darauf ankommen lassen, ob man ihm wirklich kündigte. Aber ihm war doch etwas unbehaglich, als er nun heute früh statt des weißen Drillichanzuges seinen guten, schwarzen Rock angezogen und statt der Mütze einen harten, runden Hut aufgesetzt hatte. Die Sachen hatten, weil er sie fast nie brauchte, in der Mottenkiste gelegen und rochen nach persischem Insektenpulver – ein Geruch, der Ferdinand immer an Tod und Begräbnis erinnerte, da er die Sachen bisher nur bei solchen traurigen Gelegenheiten getragen hatte.
Und dieser Geruch saß ihm in der Nase und wirkte auf seine Stimmung. Der Rock paßte ihm außerdem nicht mehr, war zu eng geworden und kniff ihn in den Achselhöhlen. Und der Teufel wußte, wie es zuging, aber in diesem Anzug wurde er stets ein tolpatschiger Bursche, der sich selbst ungeschickt vorkam.
All das aber hatte ihn nicht gehindert, sein Vorhaben auszuführen, zu Fuß nach der Lindenstraße zu gehen und die Landpartie mitzumachen.
Eine merkwürdige Gesellschaft, die da, in dem Kremser vereinigt, von den zwei mageren, sehnigen Pferden gezogen, unterwegs nach Pichelsberge war. Herr Zibulke hatte einen »Salz- und Pfeffernen« an und sah mit dem vorgebundenen Chemisett und dem breiten Umlegekragen ganz manierlich aus. Seine Frau aber schien nur aus einem türkischen Umschlagetuch und einem Kapotthut mit Kamillenblüten zu bestehen, denn der Kopf war ihr auf die Brust gesunken – sie schlief, trotz der holperigen Fahrt. Fräulein Auguste war ganz in Weiß mit einer schottisch karierten Schärpe und einem Florentiner mit Vergißmeinnicht. Sie saß neben Ferdinand und lutschte Fruchtbonbons, weil sie den Schlucken bekommen hatte – einen hartnäckigen Schlucken von solcher Heftigkeit, daß sie jeden Augenblick zusammenfuhr. Der Herr neben ihr, ein Onkel oder Vetter – Ferdinand verwechselte die Verwandtschaftsgrade noch –, hatte eine riesige grüne Botanisierbüchse auf den Knien, die ganz mit blauen Pflaumen gefüllt war. Trotzdem ihn seine Frau, bei der sich eine Korsettstange gelöst und durch das »Lila-Seidene« gebohrt hatte, dringend warnte, hörte er nicht auf sie, aß unentwegt Pflaumen und spuckte die Kerne über den Kopf eines kleinen, blonden Mädchens, das sich dann jedesmal sein Haar befühlte und »Aua!« sagte.
Auch die übrigen Personen waren Verwandte, aber Leute, die es nicht so gut verstanden hatten, in der Gründerzeit reich zu werden, wie der »olle Zibulke«, und die nun heute, auf seine Kosten, einen guten Tag leben wollten. Denn das schätzten sie an ihm: Wenn er sie einmal einlud, dann knickerte er mit dem Gelde nicht, so genau er sonst auch mit jedem Pfennig zu rechnen verstand. Freilich, solche Einladung war ein seltenes Ereignis und hatte immer ihren bestimmten Grund – heute konnte man ihn sich denken, wenn man auf den strammen Bierfahrer und Gustchen sah. Verständnisinnige Blicke flogen hin und her. Gewiß, gewiß – einen solchen Schwiegersohn hätte sich jede der Frauen gewünscht, wenn er – was gehabt hätte! Aber er hatte doch nichts! Na, Zibulke konnte es sich ja leisten – wo hätte er denn schließlich auch sein Geld lassen sollen. Es war höchste Zeit, daß Gustchen einen Mann bekam!
Die Männer nuppelten an ihren Zigarren, deren Stummel sie in kleine Weichselrohrspitzen steckten oder auf Streichhölzer spießten, wenn sie sie mit den Fingern nicht mehr halten konnten. Der eine war Schuhmacher, der andere Klempner, ein dritter Glaser – alle selbständige Leute, die es sich leisten konnten, mal einen Tag im Jahr ihr kleines Ladengeschäft zu schließen, um einen Ausflug zu machen.
Und sie sprachen von den Freuden, die ihrer warteten. Man wollte Kahn fahren, schaukeln und nach der Scheibe schießen, man wollte Kaffee kochen, im Walde lagern, das mitgenommene Viertel Bier trinken, das zwischen den Hinterrädern des Kremsers schaukelte. Die Hauptfreude aber galt dem Mittagessen – die Frauen waren froh, daß sie einmal nicht selbst zu kochen brauchten.
»Sie jlooben janich, za Hause esse ick fast nie ordentlich, der Geruch macht mir schon immer satt, wenn ick selber koche«, sagte die Glaserfrau, »aber jehen wir mal ins Lokal, kann ick die Portsjon nich jroß jenug kriegen!«
Doch die Schustersfrau, an die sie sich gewandt, rückte unruhig hin und her und sagte halblaut: »Wenn bloß die Männer nich immer herkiekten – ick möchte mir jerne mein Küh abschnallen, ick kann uff det Ding nich mehr sitzen!«
»Sie haben es sich woll alleene jemacht – na ja! Wenn eener die Mode mitmachen will, muß er ooch schon det Jeld dafor ausjeben. Meins sitzt – is aber ooch een jekooftes!«
Auch zwei junge Mädchen waren noch da, Töchter dieser Mütter, die Fräulein Augustes Schlucken komisch fanden. »Huppla – jetz denkt er an mir«, sagte die eine jedesmal, wenn Auguste zusammenzuckte. »Det wär’ ja ooch noch scheener, wenn er an ’ne andere dächte«, meinte die zweite Kusine und sah Ferdinand lachend an. »Jott – wie könnte ick den Mann lieben, wenn er meiner wäre! So’n Jerippe – die Juste – bloß weil sie Jeld hat! Nee – die Männer taugen allesamt nischt«, flüsterte sie dann der anderen zu.
»Besser wie’n Mops sieht er ja aus, aber meiner müßte schwarz sind. Neulich war een Italjener mit ’nem Leierkasten bei uns uff’n Hof – ick sage dir: Schwarze Locken und Jlutoojen!«
Der weiße Staub, den die Räder und die Pferdehufe aufwühlten, schwebte ständig als Wolke hinter dem Kremser – aber nun kam der Wagen auf die Waldchaussee, man hörte Finkenschmettern und das Hämmern des Spechtes. Im Weggraben blühten blaue Glockenblumen und rote Federnelken, Schmetterlinge taumelten träge dahin, und zuweilen drang eine Welle würzigen Kiefernadelduftes in den Wagen.
Da bekam man sofort Hunger und packte die mitgenommenen Frühstücksvorräte aus: Butterstullen, mit Schweizer Käse oder Schinken belegt, Schrippen, mit Braunschweiger Wurst bestrichen, sogar halbe Zervelat- und Leberwürste kamen zum Vorschein, Karbonaden und harte Eier. So genügsam diese Leute sonst auch lebten, so packten sie doch für Landpartien stets ein, als fürchteten sie, da draußen nicht das geringste zu erhalten. Aus Bierflaschen wurde schwarzer Kaffee getrunken, und die Männer nahmen aus Feldflaschen, die sie in der Rocktasche aufbewahrten, einen Schluck Kümmel.
Die Stimmung, die vorher abgeflaut, war nach dem Essen sofort wieder lebhaft. Frau Zibulke blickte jetzt munterer um sich und zeigte wieder ihren einzigen Vorderzahn – ein langes, gelbes Ding, wie es Bulldoggen besitzen.
»Wozu wir eijentlich so weit fahren!« sagte sie kopfschüttelnd. »Man hat nischt von, is nich ausjeschlafen und muß nu schwarze Lorke trinken, wo man so schön an’n Kaffeetisch sitzen könnte. Jrade, ehe es losjing, kam erst der Milchmann! Der Bäckerjunge war überhaupt noch nich da, und der Frühstücksbeutel mit die Schrippen wird nu den janzen Tag an die Türe bammeln, bis sich die olle Lorenzen oder die Kinder von Kieperts die Semmeln holen. Vielleicht brechen sie ooch in, denn dadran merken die Diebe, det keener nich zu Hause is. Uff det Meechen, die Liese, is ja keen Verlaß nich! Die schließt hinten ab und jeht mit ihrem Jrenadier in die Hasenheide!«
So nöhlte die Alte vor sich hin, ohne daß sich jemand um sie kümmerte. Nur Herr Zibulke sagte: »Kenn’ ick – weeß ick. Nu sei still, Mutter, schlaf weiter, wir wecken dir, wenn’s soweit is.«
»Is dein Schlucken noch nich weg?« erkundigte sie sich dann bei der Tochter. »Du mußt dir uff’n Magen drücken und die Puste anhalten, solange wie’ste kannst!«
»Hab’ ick alles schon jemacht, Mutter!«
»Na – denn weeß ick nich! Denn laß dir von Onkel Fritzen ’ne Prise jeben und niese mal – det hilft immer!«
Als sie aber sah, daß die Tochter gar nicht hinhörte, wickelte sie sich wieder in ihr türkisches Umschlagetuch, der Kamillenblütenhut sank vornüber, sie schlief weiter.
Ferdinand hatte sein Frühstück aus dem Zibulkeschen Vorratskorb bekommen. Immer wieder hatte ihm Gustchen eine fettgestrichene Stulle, ein paar Eier oder Karbonaden hingereicht. In kleinen Endstücken blauer Kaffeetüten hatte sie Salz und Pfeffer, und in einem henkellosen Tassenkopf führte sie sogar Mostrich bei sich. Denn sie liebte alles scharf gewürzt, und als besondere Delikatesse hatte sie deshalb auch ein paar saure Gurken mitgenommen, die ganz zum Schluß vorgeholt und redlich mit ihm geteilt wurden.
Der böse Schlucken hatte sich endlich beruhigt, und als nun die Kusinen zu singen begannen, stimmte sie mit ein:
»Im Wald und auf der Ha–ide –
Da hab’ ich meine Freu–ide –
Ich bin ein Jägersmann ...«
Und singend kam man auf die tiefgelegene Chaussee, die sich am Wasser hinzog, und hielt endlich vor dem großen Gartenlokal.
Dort war es gar nicht so still und einsam, wie man erwartet hatte. Vor der Ausspannung hielten schon mehrere Kremser, und unten, am Wasser, saßen – an zusammengerückten Tischen – ein paar andere Gesellschaften. Berliner, die es sich ebenfalls in der Woche geleistet hatten, hinaus ins Grüne zu fahren. Von der Kegelbahn herüber klang das Rollen der Kugeln und das Krachen der zusammenstürzenden Kegel und gleich darauf immer die Stimme des Jungen: »Jrenadier!« oder »Alle Neine!«
Der Kellner, ein älterer Mann in Hemdsärmeln und mit blauer Latzschürze, näherte sich und sah mit philosophischer Gelassenheit zu, wie die Ankömmlinge im Garten umherirrten. Denn immer, wenn ein Teil der Gesellschaft schon saß, machte dieser oder jener den Vorschlag, noch einen günstigeren Platz zu wählen – so zog man von einem Tisch zum anderen, bis endlich Frau Zibulke erklärte, daß sie nun sitzen bliebe, wo sie sitze, und nicht mehr aufstehe.
»Keen Deibel kriegt mir hier mehr weg, det ihr’s wißt – und damit basta!« sagte sie.
»Na – denn wollen wir man ooch!« stimmte ihr Mann zu. Und so gruppierte man sich um die grüngestrichenen Tische, und der philosophische Kellner holte aus seinem Latz eine zusammengefaltete Speisekarte und überreichte sie Herrn Zibulke, den er sofort als das Haupt der Gesellschaft herausgewittert hatte.
Mit ausgestreckter Hand, sie weit von sich haltend, studierte dieser die Karte. »Also – es jibt Wiener Schnitzel und –«
»Wie teier?« fragte Frau Zibulke.
»Laß man«, sagte er, »also Schnitzel, denn Rührei mit Schinken, denn Jänsebraten – det is allens! Ick bin for Jänsebraten – wenn er jut is, Meester?« fragte er den Kellner. »Wir haben nischt Schlechtes«, sagte der Kellner. »Aber Sie können ooch noch Brathecht kriegen – janz frischen!«
»Man bloß nich – mit die ville Jräten«, sagte Frau Zibulke, »kaum hat man wat innen Mund jesteckt, denn muß man’s wieder ’rausholen. Denn schon liebers Jänsebraten – wenn’s wahrscheinlich ooch det Teierste uff die janze Karte is!«
»Scheen – also Jänsebraten«, sagte der philosophische Kellner, »eenmal, zweemal oder wie ville? Also for alle Herrschaften – det kleene Fräulein da ooch ’ne janze Portsjon? – ick frage man bloß zur Sicherheit. Wünscht eener der Herren den Teil mit’n Stietz – denn det jibt Liebhaber dafor.«
Ja – Herr Zibulke selbst war Liebhaber des Schwanzstückes. »Mir schadet keen Fett nich«, sagte er, »andere kriegen jleich immer Jrieben ins Gesicht – ick nich. Bloß ’n juten Konjack muß ick nachher haben!«
4
Es war Spätnachmittag geworden, als die Gesellschaft aus dem Walde zurückkehrte. Man hatte sich dort gelagert, nachdem man Blindekuh und Schwarzen Mann gespielt und müde geworden war. Die meisten hatten verschlafene Gesichter und freuten sich jetzt auf den Kaffee, den die Glasersfrau gekocht hatte. »Extra stark – beinah’ zwei Lot auf jede Kanne«, sagte sie.
Altdeutscher Napfkuchen und Streuselkuchen kam aus den Vorratskörben zum Vorschein, die jungen Mädchen gingen umher und legten zu jeder Tasse ein Stück.
Da sagte plötzlich Frau Zibulke: »Jottedoch, wo is denn Justchen?«
Alle sahen sich an – die Männer schmunzelten, die Frauen drehten sich seitwärts und lachten, und die jungen Mädchen kicherten. »Na – wat habt ihr euch denn so – wat is denn los? Is etwa bei’t Kahnfahren wat passiert?«
»Det nu jrade nich – abers ...«
»Na, wo is sie denn?« fragte Frau Zibulke nun ganz ärgerlich. »Vater – wo is unse Juste – da stehste nu und plinkerst mit die Oojen – wat soll det? Is doch keene Art nich, det Meechen so alleene ’rumrennen zu lassen! Weeß doch jeder, wat sich schickt – Frau Lindemann, wat haben Se denn?«
»Mein Jott«, sagte die Glasersfrau, »nu kriege ick’s, wo ick die einzigste war, die wat jetan hat, während ihr im Walde jepennt habt. Reene Zufall war’s, det ick vorhin jesehen habe, wie die Juste mit den scheenen Ferdinand da drüben langjejangen is – mang die Kuscheln! So, na nu machen Se sich ’n Versch druff, Frau Zibulke!«
»Da kommen sie ja ooch«, sagte Onkel Fritz, der Klempner, »nu kiekt nich alle so hin, und bringt sie nich in Verlegenheit – wir sind ja alle mal jung jewesen – wat, Olle?« Und er gab seiner Frau einen liebevollen Puff.
»Det sag’ ick ooch«, sagte Herr Zibulke, »setzen wir uns, trinken wir jetz Kaffee, und nachher werde ick mir mal den jungen Mann ’n bißken abseits nehmen und ’n Wörtchen mit ihm sprechen. Ick bin ja selber neujierig, wat er mit meine Tochter so janz alleene zu bereden jehabt hat. Also – trinken wir Kaffee.«
Und diese Aufforderung wurde in einem Tone gesagt, daß alle augenblicklich folgten. Man war so eifrig um den Tisch herum beschäftigt, daß niemand das näher kommende Paar beachtete, nur das kleine Mädchen mit dem offenen Haar starrte das glühende Gesicht Gustchens an – unverwandt, unverwandt. Und dann sagte es plötzlich bedauernd: »Ach Jott – in det scheene weiße Kleid lauter Jrasflecke – na, aber Justchen, konntest du dir nich ’n bißken vorsehen?« Da kreischten alle auf vor Lachen, wollten ersticken vor Lachen, konnten sich kaum beruhigen.
Bei einbrechender Dunkelheit trat man die Heimfahrt an. Die Stocklaternen brannten, die Lichter in den schaukelnden Lampions an der Kremserdecke wurden angezündet, und die Pferde zogen an, langsam ging es hinauf auf die Chaussee – dann, als der Wagen gleichmäßig dahinratterte, begann man zu singen:
»Ich weiß nicht, was soll es bedeuten ...«
Aber der Schuhmacher, der den ganzen Tag über schweigsam gewesen war und jetzt erst auftaute, meinte: »Det paßt nich – singen wir’n Lied, wo sich jeder wat bei denken kann. Ick schlage vor: Mit’n Pfeil un Bojen ...«
Und jubelnd fielen alle ein und starrten dabei in die dunkle Ecke, wo Ferdinand und Gustchen saßen, während sie herausfordernd sangen:
Ȇber Berg und Tal
Kommt der Schütz jezogen,
Früh im Sonnenstrahl ...«
Gustchen schmiegte sich, jetzt ganz ungeniert gegen alle Beobachtung, nur noch enger an Ferdinand, er aber, der nach der Unterredung mit Herrn Zibulke kräftig getrunken hatte, saß steif und aufrecht da – in seinem Gesicht war angestrengtes Grübeln, als suche er zu erfassen, was heute eigentlich geschehen.
Der Mond schien durch die Kiefernwipfel, und die Fledermäuse huschten um den Wagen – da wurde die Gesellschaft müde, und einer nach dem anderen nickte ein. Nur Herr Zibulke nicht – er saß vorn auf dem Kutscherbock, kratzte sich die Backe und murmelte zuweilen etwas vor sich hin, als überlege und rechne er.
Aber dann ratterte der Wagen plötzlich auf hartes Pflaster hinauf, und Charlottenburg kam in Sicht. Bald darauf war man in Berlin angelangt.
5
Ein langer Plankenzaun, grün geworden von Wind und Wetter. Dahinter hohe Holzstapel, schwarze Berge von Steinkohle und Torf. Über der Einfahrt ein ehemals weißes Schild, geschmückt mit einem Paar gekreuzter Hämmerchen, in der Mitte die Inschrift: »Holz- und Kohlenhandlung von Karl Schmidt«, kaum noch leserlich. Ein von pulverisierter Kohle schwarzgefärbter Weg führte von der Möckernstraße zu einem ausrangierten Güterwagen ohne Räder, über dessen Tür das Wort »Comptoir« stand. Die Fensterchen waren mit kleinen Gardinen verhängt und vor jedem ein grüner Kasten angebracht, in dem Fuchsien, Oleanderableger in Bierflaschen und Heliotroptöpfe standen.
Kam man im Winter in diesen Raum, so prallte man zurück vor der übergroßen Hitze, die darin herrschte, aber auch heute – an diesem schönen Herbstnachmittag mit goldenem Sonnenschein – war das »Comptoir« schon geheizt, denn der alte Herr Schmidt liebte die Wärme. Er saß in einem hohen Lehnstuhl vor seinem Rollpult, die Stahlbrille, deren Bügel tief ins Fleisch schnitten, auf der Nase und blätterte in seinen Kundenbüchern. Vor ihm, am Fensterchen, hüpfte in einem Holzbauer trillernd ein Kanarienvogel. Zu Füßen des Alten lag ein gelber, struppiger Hund, der jähzornig nach den großen, blauen Fliegen schnappte, die ihn umsummten, dann aber seine Aufmerksamkeit gleich wieder auf die Tauben richtete, die nickend und pickend auf dem freien Platz vor dem Eingang der Bude stolzierten. Da – plötzlich erhob sich der Schwarm mit knatterndem Flügelschlag und ließ sich dann in weitem Rundbogen auf dem schwarz gewordenen, schrägen Ziegeldach des nahen Wohnhauses nieder. Gleich darauf erhob sich auch der Hund, dehnte und streckte sich und trottete hinaus.
Herr Schmidt blickte erwartungsvoll über die Brillengläser, dann, als er die Eintretende erkannte, nahm er das Stahlgestell von der Nase und schob es äußerst behutsam in ein Pappfutteral. »Na« – sagte er – »Röschen, du? Wat bringste Schönes? Haste denn heute schon wieder Ausjang?«
»Aber Vater, haste denn Mutters Todestag janz verjessen? Wir müssen doch uff’n Kirchhof!«