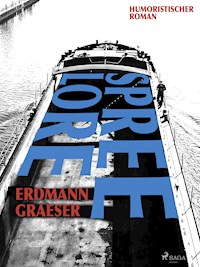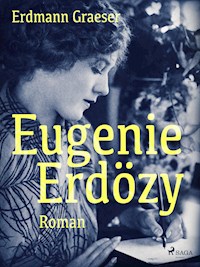Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Anpacken kann sie, die Anna, wenn die Gäste in Scharen in den legendären Weißbiergarten der Lemkes kommen. Was sollen sie bis nach Schöneberg laufen. Hier, zwischen den Fliederbüschen im Schatten der Bäume, sitzt man auch gut. Aber Lemkes Sohn Willem schöne Augen machen und so mir nichts, dir nichts in die Wirtschaft "rinzuheiraten", das geht für Frau Lemke zu weit: Anna muss gehen. Doch wahre Liebe duldet keinen mütterlichen Widerstand und abends ist auch Willem verschwunden. In der Ackerstraße im hohen Norden betreibt Annas Tante eine dunkle Kellerwirtschaft – kein schönes Zuhause für den verwöhnten Sohn. Willems heimliche Hoffnung, dass seine Mutter Frieden schließt und das junge Paar zurückholt, erfüllt sich nicht. Aber seine patente junge Frau hat nicht umsonst bei Frau Lemke gelernt, wie man eine Wirtschaft zum Blühen bringt. Jedenfalls nicht mit "Soleia und Buletten"! Erstaunt beobachtet die Nachbarschaft, wie mit Pinsel und hellblauer Farbe aus dem Kellerloch eine ansehnliche Gaststätte mit neuen Gardinen und frischem Anstrich wird. Der Höhepunkt der allgemeinen Verwunderung aber ist erreicht, als der Maler mit kolossalem Aufwand von blauer Farbe die Inschrift anbringt: "Zur unterirdischen Tante". So beginnt Erdmann Graesers fünfteilige Familienchronik um die Nachfahren von Lemkes seliger Witwe, die das alte Berlin der Gründerzeit aus der Sicht der kleinen Leute so lebendig und komisch schildert. Ob Tante Marie, Onkel Karl oder die Lemkes: alle sind zum Verlieben verrückte Berliner Originale. Schon der erste Band der fünfteiligen Romanfolge um die Nachfahren von Lemkes seliger Witwe steckt voller Berliner Witz und skurriler Situationskomik. Die Lemkes, allesamt Berliner Originale, haben das Herz auf dem rechten Fleck. Ihr Alltag beschreibt lebendig und voller Humor das boomende Berlin der spannenden Gründerjahre aus der Sicht der kleinen Leute.Erdmann Graeser (1870–1937) war ein deutscher Schriftsteller. Als Sohn eines Geheimen Kanzleirats im Finanzministerium in Berlin geboren, ist Graeser zwischen Nollendorfplatz und Bülowbogen im Berliner Westen aufgewachsen. Graeser studierte Naturwissenschaften, brach jedoch das Studium ab und arbeitete zunächst als Redakteur für die "Berliner Morgenpost" und später als freier Schriftsteller. Er wohnte viele Jahre in Berlin-Schöneberg und zog nach seinem literarischen Erfolg nach Berlin-Schlachtensee im Bezirk Zehlendorf. 1937 starb er an einem Herzleiden. Sein Grab liegt auf dem Gemeindefriedhof an der Onkel-Tom-Straße in Zehlendorf. In seinen Unterhaltungsromanen thematisierte Graeser die Lebenswelt der kleinen Leute im Berlin seiner Zeit und legte dabei auch großen Wert auf den Berliner Dialekt. Zu seinen bekanntesten Romanen gehören "Lemkes sel. Witwe", "Koblanks", "Koblanks Kinder" und "Spreelore". Einige seiner Romane wurden später auch für Hörfunk und Fernsehen bearbeitet.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erdmann Graeser
Zur unterirdischen Tante
und andere humoristische Erzählungenaus der Romanfolge
Lemkes sel. Wwe.
Saga
Zur unterirdischen Tante
© 1987 Erdmann Graeser
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711592434
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
„Zur unterirdischen Tante“
„Nu singt se schon wieda“, sagte Herr Lemke verwundert. „Heite abend soll se ihre Sachen packen und abziehn, ick hab’s ihr jesajt, und nu singt se schon wieda janz vajniejt.“
„Villeicht ihr Schwanenjesang“, sagte Frau Lemke, „eegentlich is ja schade um ihr, zujreifen konnt’ se, die Anna, aber ick mach’ ma doch zehnmal lieba allet alleene, als det ick hier so wat ins Haus dulde!“
Frau Lemke schüttete die grünen Bohnen, die sie abgezogen hatte, auf den Tisch, nahm die weiße Schürze mit dem Abfall zusammen und ging durch den Ziegelsteinflur hinten nach dem Hofe.
Alle Hühner liefen sofort herbei, als sie aber merkten, daß es nichts für sie zum Picken gab, wichen sie enttäuscht wieder zurück. Frau Lemke strich die Schürze glatt – ja, und nun mußte sie doch in die Küche gehen.
Anna putzte noch immer an dem großen Messingkessel.
„Laß man sind, er is ja jut“, sagte Frau Lemke, „jeh’ man jetz ruff und mach’ wat for dir, sonst kommt deen Korb nich wech!“
„Denn nehm’ ick’n huckepack, Jold is ja nich drinne, sonst könnt’ er stehenbleiben, und allet wär’ in schönste Ordnung!“
„Meenste? Det mach’ dir man ab. Du hast dir det ja janz scheen ausjedacht, hier so in die Wirtschaft ’rinzuheiraten, aber du hast dir vaspekuliert!“
„Villeicht ooch nich“, sagte Anna, „Willem liebt mir und ick liebe ihn, und wat nu kommt, det werden Se ja seh’n, Frau Lemke, de Jrundlage is jelejt.“
„So, na denn is ja allet in Ordnung und wir brauchen uns jejenseitig nich weiter uffzurejen.“
„Nee, wer hat denn wieda anjefangt, ick doch nich!“
Anna wischte sich die nassen Hände hinten am Rock ab, zog die aufgekrempelten Ärmel herunter und ging hinaus. Im Flur stellte sie, wie sonst, die Holzpantinen unten an die Treppe und stieg barfuß die Stufen hinauf.
„Willem, Willem“, rief nun Frau Lemke in den Keller. Als sie keine Antwort bekam, stieg sie vorsichtig hinunter. „Diese Dusterheet, ick werd’ mir hia noch mal ’s Jenick brechen“, räsonierte sie, „Willem, wo steckste denn?“
„Hia, Mutta, wat wiste denn? Ick bin doch bein Abzappen!“
„Laß mal sind, komm mal ’ruff.“
„Nee, Mutter, ’t hat keen Zwech nich, ick weeß ja, watte willst!“
„Willem, meen Sohn, willste dir von det Meechen wirklich zun Dussel machen lassen?“ fragte Frau Lemke sanft.
„Dieses wenijer, aba ick liebe ihr!“
„Willem“, sagte Frau Lemke und tastete sich zu ihm durch, „Willem, als du noch so kleen wast, dette noch keene Beene hattest, da wolltste durchaus Jrienspan fressen. Wo man ’n Sticke Messing war, haste wie’n Wilda d’ran jeleckt, bis et blitzeblank war. Na, wenn ick dir nu jelassen hätte? Aba ick war imma hinter dir her, hab’ dir jleich imma ’n Finger ’ringestochen und Seifenwasser hintajejossen, bis allet wieder ’rauskam!“
Wilhelm hatte zu schluchzen angefangen. „Ick – weeß – ja, Mutta –“ er konnte kaum sprechen – „ooch dunnemals, wo ick mir die türk’sche Bohne in die Neese jestochen hatte und du se mir mit de Haarnadel ’rausjepolkt hast, ick – weeß et ja noch allet wie heite – aber ick kann nich, Mutta, ich kann nich, wahaftjen Jott nich, ick liebe ihr ßu sehr!“
„Schnaub’ dir ’mal erst, Willem“, sagte Frau Lemke, „det kann ja keen Mensch mit anhören, nich mit de Finga, det is ja ’ne Schweinerei, wennste denn wieda die Pullen anfaßt, hia haste meen Tuch! Siehste, watte noch for’n kleener Junge bist, und so wat will nu heiraten!“
„Will ick ooch!“
„Bloß jut, det dir Vater nich hört, der würd’ dir schon mit will ick ooch!“
„Det is’s ja eben, ihr behandelt mir immer noch wie’n Stepsel, bloß weil se mir bei de Soldaten nich jenommen hab’n!“
„Ja, et wär’ wahaftig jut jewesen, wenn se dir in de Mache jekriejt hätten“, sagte Frau Lemke ärgerlich, „du jloobst imma, Mutter wird schon kommen, wenn’s dir dreckich jeht, aber diesmal nich, Willem, diesmal jeb ick Vatern recht!“ Und drohend setzte sie hinzu: „Jberleg’s dir, ehste Dummheiten machst, wir lassen dir, ’s soll keener nachher sajen, wa haben unsa eenz’ches Kind unjlicklich gemacht, ick hab’ ma mit Vatern besprochen, wir sind eenich!“
„Wir ooch!“ sagte Wilhelm.
„Dafor hätt’ste ja nu eben ’ne Knallschote vadient, aba ick werd’ mir nich an so’n jroßen Lümmel vajreifen“, sagte Frau Lemke, „du bist eben hinten und vorne mit’n Dämelsack jeschlagen!“
Sie wandte sich kurz ab, stieg die Kellertreppe hinauf und ging durchs Haus vorn in den Garten.
Dort, unter dem Nußbaum und den alten Linden, saßen bereits die ersten Gäste. Auf der Kegelbahn wurde es schon lebendig, und Vater Lemke, in Hemdsärmeln, eine blaue Schürze vor dem runden Bauch, lief – in jeder Hand drei große Weißbiergläser balancierend – geschäftig zwischen den grüngestrichenen Tischen umher.
Es war Zeit, daß sie an den Ausschank kam, der Garten würde „voll werden“, der schöne Sommertag lockte die Berliner, trotzdem es in der Woche war, in Scharen heraus, und die meisten blieben hier hängen, der Weg war zu weit, was sollten sie bis nach Schöneberg laufen, zwischen den Fliederbüschen, im Schatten der Bäume saß man ja auch gut.
Und dann begannen die Kegelkugeln regelmäßig zu rollen, und der Junge schrie: „Jrenadier“ und: „Alle neine.“ Vater Lemke hatte keine Zeit mehr, bei seinen Gästen zu sitzen und sich erzählen zu lassen, daß Berlin immer weiter vorrückt und daß die Grundstücke im Preise stiegen. Und Mutter Lemke, jetzt ganz hochrot, bückte sich immerfort unter den Schanktisch, nahm die Steinkruken aus dem kühlen, weißen Sande, lockerte die Korkenstrippen und goß, ohne auch nur ein bißchen von dem Schaum zu verspritzen, die großen runden Gläser voll.
„Keene Hilfe, keene Hilfe“, sagte sie einmal zu ihrem Mann.
„Na, wo is denn Willem?“
„Der bockt, Vater, da werden wa noch ville Ärjer haben!“
„Ick nich, fällt mir janich in, mach’ man, Mutta, mach’ – jrienen Aal und Jurkensalat – drei Portsjonen, mach’ man aba jleich mehr ßurecht, die sind ja heite wie varickt nach!“
„Bei die Hitze is det ja ooch det eenz’che, wat man ’runterkriejen kann!“ – –
Dann kam die Dämmerung, Vater Lemke mußte heute selbst auf die Stühle klettern und die Petroleumlaternen im Garten anzünden.
„Wo is denn Herr Willem, wo is denn heite Ihr Sohn –?“ fragte manchmal ein Kegler.
„Der hat ’ne dicke Backe, kann sich nich sehen lassen“, sagte Herr Lemke.
Die Nachtschmetterlinge stießen sich die Köpfe an den heißen Zylindern, fielen tot und versengt zur Erde, und Frau Lemke, die nun, am Spätabend, auch noch Zeit gefunden hatte, vor dem Hause zu sitzen und den Tag zu überdenken, sagte jedesmal: „Kiek mal, Vater, wieder so’n scheener, jroßer Mottenkopp, arme Biesters!“
Dann hörte man vom Kirchturm aus dem Dorf die Uhr schlagen. „Zehne, Vater!“
Die letzten Gäste brachen auf und zogen singend durch die stille Sommernacht heim. Herr Lemke schloß die Gartentür, drehte die trübe brennenden Lampen aus und kam ins Haus. In der Gaststube stand seine Frau, einen Leuchter in der Hand, und starrte vor sich hin. Jetzt hob sie den Kopf und sagte: „Vater, Willem is nich da!“
Herr Lemke kniff das linke Auge zusammen und zielte mit dem andern starr auf seine Frau. So stand er einen Augenblick unbeweglich, dann nahm er ihr plötzlich den Leuchter weg und stieg die Bodentreppe hinauf. Es dauerte eine ganze Weile, bis er wieder herunterkam. Schweigend stellte er den Leuchter hin und begann, hinter dem Ladentisch stehend, Kasse zu machen. Seine Frau war auf einen Stuhl gesunken, die Hände lagen ihr schlaff im Schoß.
„Vater – –?“ sagte sie.
Er machte eine ärgerliche Kopfbewegung, weil er sich verrechnen konnte, wenn er jetzt auf ihre Frage einging, und zählte weiter. „So, det stimmt so unjefähr“, die Spannung in seinem Gesicht ließ nach, „also hat er bloß die Sparbüchse von sich mitjenommen!“ Er schob das Geld in einen Leinwandbeutel und sagte: „Na, nu komm man, Mutta, nu woll’n wa man schlafen jeh’n!“
„Ick – kann – nich schlafen“, sagte Frau Lemke, sie schluckte und würgte und wischte sich die Tränen mit der Hand ab, „ick hab’ doch so jut mit’n jeredet und ihm noch meen Schnupptuch jejeben!“
„Da wird er sich die Aussteier ’rinjeknippert haben“, sagte Herr Lemke, „hör’ man uff mit die Heulerei, det hat nu keen Zwech mehr. Wenn’t Jeld alle is, wird er schon wiedakommen, denn schmeiß ick’n aba ’raus!“
„Vater, wie kannste so reden“, sagte Frau Lemke, „hätt’ste det von unsen Willem jedacht?“
„Ja, Mutta, du bist aber ooch dran schuld, wie kannste’n da oben schlafen lassen! Du hast immer jetan, als müßt’ er sich bei dir noch an’n Rockzippel festhalten!“
„Nu, jib mir man die janze Schuld, ick jloobe ja noch nich, det er wech is, vielleicht will er uns bloß’n Schreck injagen. Wo soll er denn ooch hin mit die paar Talers!“
„Wenn ihn det Meechen in die Mache hat, det is ’ne Kanalje, die denkt sich, wir werd’n schon kleen beijeben, die spekuliert uff dein weeches Herz. Aber se soll sich jeschnitten haben, ick rühr’ keenen Finger, und wehe dir, Mutta, wennste etwa hinter meen’ Rücken wat anfängst. Loofen lassen, det is det richtje, imma loof, loof mit die Karline, ihr werdet eich schon dicke kriejen!“
Immer mehr redete sich Herr Lemke in Wut hinein. Sein Gesicht war braunrot geworden. Nun drehte er die Lampe über dem Schanktisch aus, nahm den Leuchter und ging vorneweg. „Schlafen jehen, wer weeß, wie morjen die Jeschichte aussieht, heite kann ick mir nich mehr ärjern, sonst platzt ma die Jalle!“
„Zur unterirdischen Tante“
In der Ackerstraße, im äußersten Norden Berlins, betrieb Anna Zanders Tante eine Kellerwirtschaft. Frau Puhlmann war eine schiefgewachsene kleine Person mit kümmerlichem grauen Scheitel und einem roten Wolltuch um den Hinterkopf.
„Scheene Jeschichte det“, sagte sie, als ihr Anna alles erzählt. „Und wo is er denn nu?“
„Draußen wart’t er!“
„Na, wat heeßt denn det, se werden dir’n stehlen, deen’ Willem, den tu’ dir man in de Kommode und heb’ dir’n uff oder laß’n for Angtreh sehen, det scheint mir ja der richt’ge Held zu sind!“
„Tante, wenn du so anfängst, zieh’ ick sofort wieder Leine. Desterwejen bin ick nich herjekommen! Du kannst froh sind, wenn du mir in die Wirtschaft hier kriest!“ „Ja, dir!“
„Und Willem gehört zu mir, et is imma jut, wenn ’ne Mannsperson bei is, hier bei die Sorte, wo alle Oojenblicke mal Krach is!“
„Ja, wo soll ick eich denn aba untabringen, wa können doch nich alle drei in die kleene Kamurke schlafen!“
„Nee, det jenierte mir ooch, aber in die Loschiestube!“
„Det jeht nich!“
„Na, wa’m soll denn det nich jehn? Jeht allens, wenn man bloß will. Natürlich krieste deen Jeld!“
„Ach so, wa’m hasten det nich jleich jesagt, na, denn hol’n man ’rin, aber laß’n nich fallen!“
„Tante, ick sag’s dir noch ma’, laß det sind, koppschei derfsten nich machen!“ Sie klopfte an die Fensterscheibe und winkte Wilhelm herein. Dann stellte sie vor: „Jestatte, liebe Tante, meen Breitjam Willem Lemke – –! Lieber Willem, meene Tante Marie!“
„Na – det is sehr feierlich, wat, Herr Lemke,“ sagte Frau Puhlmann, „aber meene Nichte is von kleen uff so jewesen – immer jroßartig, det hat se jeerbt – von ihre Mutta – die war ooch immer for det Jroßkotzige. Uff mir wirkt det imma ansteckend, also wenn ick bitten derf, nehmen Se jefälligst Platz – womit kann ick dienen, meene Herrschaften, denn ihr werdet woll mächtjen Hunger hab’n?“
„Tante, laß doch det Affentheata“, sagte Anna mit einem verweisenden Blick, „natürlich haben wa Hunger, det Jeschleppe mit den Korb! Wenn uns der Kutscha nich mitjenommen, krauchten wa womöglich noch draußen ’rum!“
Als die Tante hinter den Schanktisch ging, faßte Anna Wilhelm um die Schulter: „Na, dir is woll noch ’n bisken bammlich? Det vazieht sich, morjen früh is allens wech! Und denn kannste je deene Eltern schreiben, wo du bist. Und nu jräm dir nich, Willem, und jib ma etwa keene Schuld, det is allens so von alleene jekommen. Et is sehr gut, dette nu lernst, uff eejene Beene zu stehen, du wärst sonst ewich ’n Schlappschwanz jeblieb’n. Det sag ick dir!“
Nachher, als sie die Bouletten und die Soleier gegessen hatten, wurde die Quartierfrage nochmals besprochen.
„Du brauchst dich wahrhaftig keene Umstände zu machen, Tante, du hast deene Kamurke, Willem nimmt die Loschiestube, und ick weeß schon, wo ick bleibe. Ick werd’ dir noch deen Bette beziehn, Willem - Tante, jib man die Blaukarierten ’raus, un denn wollen wir machen, det wa in die Posen kommen, sonst knick’ ich um!“
Wilhelm hatte gleich am nächsten Tage an seine Mutter geschrieben und auf Antwort gehofft, aber zwei Wochen waren seitdem vergangen, ohne daß ein Brief eingetroffen wäre. Heimlich hatte er ganz fest damit gerechnet, daß die Mutter kommen und ihn und Anna zurückholen werde; nun, als es nicht geschah, erbitterten sich seine Gedanken, und das half ihm über die Traurigkeit und den Trennungsschmerz hinweg. In der ersten Zeit glaubte er, sich gar nicht in die neue Umgebung einleben zu können; der dunkle Keller, die engen Räume und Tante Maries Wesen bedrückten ihn.
Aber Anna ließ ihm keine Zeit zum Kopfhängen, er mußte ihr fortwährend zur Hand gehen. „Det is keen Betrieb hir, Tante“, hatte sie gesagt, „hi muß feste Zuch hinter jemacht werden, sonst vaschimmeln wir allesamt in det Kellerloch. So kommen wir uff keenen jrienen Zweich, wenn hi abends zwee, drei sonne ollen Bowken sitzen und an ihre Neeje nippen. Wozu jibt’s denn hi Bier, die Jäste müssen Durscht kriejen. Außerdem, Tante, wie sieht det von draußen aus, mit die roten Kattunvorhänge und die bekleckerte Wand, da traut sich ja keen Mensch ’rin, denkt jeder, et is ’ne Reiberhöhle. Und denn, Tante, det Kind muß doch ’n Namen haben, die Leute müssen doch wissen, wo se hinjehören. Da müssen wa uns ’mal alle drei hinsetzen und wat Feines ’rausknobeln. ‚Zur Tante Marie‘ oder ‚Zun strammen Willem‘ oder so wat Ähnliches, det zieht! Ooch mit die Soleia und die Buletten, Tante, det is doch nischt, wer soll denn det jeden Tach hintakriejen, da verjeht ee’n ja der App’tit. Nee, der Jeruch muß jleich jeden in die Neese fahren - saura Hering, oder ooch Heringssalat, oder Kartoffelpuffa, und Sonntags machen wa ’mal Schweinebraten oder Jänsebraten, und jeben ’ne ordentliche Portsjon, det die Jäste denken, se kriejen’s immer so!“
Und so sehr sich Tante Marie auch gegen diese Reformen wehrte, weil sie tief in den Beutel fassen mußte, schließlich gab sie doch nach, denn Anna ließ keine Ruhe. Sie hatte gesehen, wie es andere machten, wie solch eine kleine Wirtschaft plötzlich Zuspruch erhielt, wenn es gemütlich und behaglich dort zuging. Und von Frau Lemke hatte sie gelernt, wie man die Küche einrichten müsse, was zu kochen sei, um den Ansprüchen der Gäste zu genügen. „Se missen denken, se sind bei Muttern, und det se’s zu Hause ooch nich besser kriejen können!“
Tante Marie ließ sich wirklich überreden, neue Gardinen anzuschaffen, und zum Erstaunen der Nachbarschaft und besonders der Straßenjungen erschien eines Tages ein genial, aber auch ein wenig verhungert aussehendes Individuum, das mit einem gewaltigen Pinsel die Wände zwischen den Kellerfenstern und die Tür mit einer schönen, hellbraunen Farbe bemalte. Und dann wurden Zettel angemacht: „Frisch gestrichen“.
„Wat is denn bei Puhlmanns los“, sagten die Leute, „die Olle will wohl ihre Sparjroschens loswerden?“
Und nachdem der schöne hellbraune Anstrich getrocknet und der Malkünstler einige Tage unsichtbar geblieben war, sah ihn die Nachbarschaft eines Morgens wieder, wie er geheimnisvolle Arabesken auf die glänzenden Flächen zeichnete und dabei Weißbier trank.
Als die Kinder aus der Schule kamen, waren sie nicht schlecht verwundert, daß aus den Arabesken Buchstaben geworden waren. „Alle Sorten verschiedene Biere“ lasen sie und erzählten es zu Hause Vater und Mutter. Und diese Sensation dauerte fort. „Weiß- und Bayrisch-Bier, echter Nordhäuser Korn“ stand am nächsten Tage neben der Kellertür; der Höhepunkt der allgemeinen Verwunderung aber war erreicht, als der geniale Künstler auf einen Stuhl stieg, seinen Malstock über dem Kellereingang anlegte und mit einem kolossalen Aufwand von blauer Farbe die Inschrift anbrachte:
„Zur unterirdischen Tante“
„Die missen jeerbt haben“, war die öffentliche Meinung, denn anders konnte sich die Ackerstraße diesen großartigen Aufschwung dieser bisher ganz unbeachteten Kellerwirtschaft nicht erklären. Und als am nächsten Sonnabend ein Stuhl mit einer weißen Schürze vor dem Kellereingang aufgehängt wurde und dieses weithin sichtbare Zeichen verkündete, daß es heute bei der unterirdischen Tante frische Blut- und Leberwurst gäbe, besah sich die Nachbarschaft auch das Lokal von innen.
Der Eindruck war günstig. Die Tante hatte statt des alten roten Wolltuches eine Art weißer Haube auf dem Hinterkopf, hielt sich aber trotz dieses Schmuckes etwas zurück. Hinter dem Schanktisch stand Anna, das gelbe Haar zu einem riesigen Knoten oben auf dem Kopf getürmt und von unzähligen starken Nadeln zusammengehalten. Die dicken roten Arme waren von den Ellenbogen ab frei und verkrochen sich nur ab und zu in dem Latz der weißen Schürze.
Wilhelm reichte ihr zu. Trotz seiner blütensauberen Hemdärmel und der neuen blauen Schürze machte er mehr den Eindruck eines angenommenen Hausknechtes. Und die Gäste hielten ihn auch zumeist dafür, nur die Stammkundschaft wußte, daß er der Sohn des „ollen Lemke“ sei, der „da draußen bei Schöneberg“ die bekannte Gastwirtschaft „Zur Märzweiße“ hatte. Von den zarten Banden, die zwischen Anna und Wilhelm herrschten, merkte man nichts. Sie kommandierte ihm nur: „Willem, det Wassa in’n Kessel is nicht mehr heeß, du mußt nei uffsetzen, aba ’n bisken dalli!“ - „Willem, hol’ man imma schon neue Pullen, du siehst doch, det det nich mehr langt!“
Und während sie einschenkte, die dampfenden Würste auf die Teller legte, Sülze zerschnitt und die „selbst eingemachten Rollmöpse“ aus dem Fäßchen nahm, spekulierte sie: „Die Jäste kieken noch zu sehr in die Winkel, nächsten Sonnabend laß ick ’n Leierkasten oder eenen mit ’ne Zieharmonika kommen!“
Als der größte Ansturm vorüber, nahm Wilhelm Annas Platz hinter dem Schanktisch ein, sie selbst ging zu den Gästen, mischte sich in das Gespräch und erkundigte sich, ob das Essen geschmeckt habe und das Bier gut sei. Gewiß, ja, zu klagen hatte keiner, im Gegenteil. Aber trotzdem gab es einige spekulante Köpfe, die ihr andeuteten, was sie noch alles tun könne, um dem Lokal die „richtige Fasson“ zu geben. Die Wand nach dem Logiszimmer müsse sie durchbrechen lassen und dort ein Billard aufstellen, es wäre auch gut, wenn sie einen „rejulären Mittagstisch“ einrichtete und abends „länger uff“ hielte.
„Ja ja, eens nach’s andre, man bloß nich drängeln“, jetzt müsse sie doch erst mal an die Hochzeit denken. Das gab Anlaß zu allerlei Andeutungen, die sie jedoch so parierte, daß sie die Lacher nachher auf ihrer Seite hatte.
Besuch in Schöneberg
Tante Marie hatte sich schließlich überreden lassen und die alten Lemkes in Schöneberg aufgesucht, um ihnen mitzuteilen, daß der Hochzeitstag festgesetzt sei, und zu fragen, ob die Eltern denn nicht auch an dem Glück ihres Sohnes teilnehmen wollten.
Einen ganzen Tag fast war Tante Marie fortgeblieben, nun kam sie in der Abendstunde müde, verstaubt und mit einem Strauß verwelkter Feldblumen nach der Ackerstraße zurück und verlangte erst eine Tasse Kaffee, ehe sie erzählen wollte. Aber wenn sie der Kaffee auch wieder munterer machte, so war doch nicht viel aus ihr herauszubringen. „Der Olle is jrob jewesen“, sagte sie, „nehmen Se’s ma nich ibel, Willem, aber zu dem bringt mich keen Deibel mehr ’raus, und wenn ick ’n junget Meechen wär’ und Ihnen heiraten sollte, for den Schwiegervata bedanke ick mir! Ihre Frau Mutter hat jeweent, aba der Olle hat se jleich so anjeschnauzt, det se’n Schlucken jekriejt hat. ‚Wat’n for’n Sohn?‘ hat er immer jefragt, ‚Se sind woll mit’n Kopp wo jejen jeloofen, liebe Frau, ick hab’ keen’ Sohn nich, und wünschen Se sonst noch wat?‘ Na, ick hab’n ja Bescheed jestochen, denn uff de Schnauze bin ick ja ooch nich jrade jefallen, aber et hätte doch ooch allens anders sein können, nich wahr?“
„Mutta hat jeweent?“ fragte Wilhelm, der nichts anderes gehört zu haben schien.
„Wat nutzt uns det“, sagte Anna ärgerlich, „dafor koof ick ma nischt, aba nu wissen wir wenigstens, wat los is, nu kann ja die Heiraterei losjehen!“
„Ach, und scheen is draußen jeweesen“, sagte Tante Marie, „da trillern de Lerchen, und det blieht und jrient uff die Wiesen. Und denn der scheene, jroße Jarten mit den Nußbaum und die Hühna!“
„Ja, die kennten wir nu ruppen, for die Hochzeitsgäste, na, wat nich is, is nich! Und wennstet etwa bereust, Willem, denn sag’s frei ’raus, ick will dir nich unjlicklich machen.“
„Ihre Mutta hat mir ja sehr jut jefallen“, sagte Tante Marie, und die hätte Sie gewiß nach ’n Jruß bestellt, aba der Olle stand imma neben und paßte wie so’n Schießhund uff. Na, ick hab’ ihm ja ooch jesagt, jlicklich wird ihn seen hartet Herz nich machen!“
„Janz jewiß nich“, sagte Anna, „so wie ick ihn kenne, tut er ab ooch bloß so, er spielt sich jerne n’ bisken als Witerich uff. Du kannst ibazeicht sind, Willem, wennste jetz kämst und mir sitzen lassen wolltest, wirde er dir erst recht forn Dussel halten!“
Wilhelm äußerte sich dahin, daß es auf jeden Fall etwas schwierig sein dürfte, die Zufriedenheit seines Vaters zu erringen: „Ick weeß nich, woran et liejt, er hat ma von kleenuff forn Dussel jehalten, aber eejentlich, so demlich bin ick doch nich?“
„Nu laß man dein’n Jeisteszustand“, sagte Anna, „die Hauptsache is det Herz, nich wahr, Tante?“
Aber Tante Marie war in ein ganz trübseliges Fahrwasser mit ihren Gedanken geraten: „Des Vaters Sejen baut die Kinder Häuser, aba der Mutta Fluch reißet sie nieda“, sagte sie feierlich.
„Det paßt janich hierher“, meinte Anna, „höchstens umjekehrt, und denn stimmt’s ooch noch nich. Bis jetzt hat uns noch keen Mensch wat jebaut!“
Tante Marie hielt das für eine Anspielung: „Ja, ja, wenn ick man schon in’n Sarch läje, denn könntet ihr ja mit den Kram machen, wat ihr wolltet!“
Ach, is det scheen hier“, sagte Anna, „Tante, dir derf man wahaftich nich ’rauslassen, dir is die freie Natur nich jut bekommen, abr ick hab’ ma jleich so wat jedacht, als ma heite morjen die Spinne über die Beene jeloofen is. Meenswejen, setzt eich alle hin und weent eich aus, denn seid ihr’s los, ick kann nich, ick bin nich im jeringsten jerihrt!“
Sie ging hinaus in den Schankraum, um die Gäste, die schon ungeduldig waren, zu bedienen. Gewiß, es wäre schöner gewesen, wenn sie da draußen, in dem großen Weißbiergarten, Wirtin hätte sein können, aber wenn es nun einmal nicht war, konnte sie es doch nicht erzwingen. Und schließlich war sie auch so zufrieden, denn sie merkte ja, daß sie eine glückliche Hand hatte. „Et flutschte“, wie sie sagte, die Gaststube war nie leer. „Freilein, Se sind ’n so schnuddlijet Frauenzimmer, jeben Se mir noch ’n Bittern“, pflegten die Droschkenkutscher zu sagen, wenn sie ihren Abstecher in die „unterirdische Tante“ machten, und andere, die nach ihrer eigenen Meinung zu oft in den Keller stiegen, entschuldigten sich vor sich selbst: „Da bin ick schonst wieder, abr Se haben ooch so wat Anziehendes, Freileinken!“
Det wird sich bald ausjefreileint haben“, sagte Anna dann stets, „wer weeß, ob Se denn abr noch wiedakommen?“
„Erst recht, sonne junge Frau, die wird denn erst schön mollig, objleich Se det janich mehr nötig haben“, sagten die Schwerenöter unter den Gästen. Andere wollten Genaueres wissen: „Ja, wann is denn nu die Hochzeit, die janze Ackerstraße wartet und wartet, abr det zieht sich so in die Länge.“