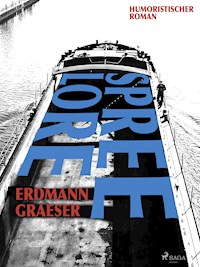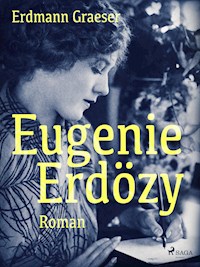Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Unterhaltungsschriftsteller Erdmann Graeser – eigentlich, auch literarisch, in Berlin zu Hause – machte sich im Jahr 1921 zu einer Erkundungsreise durch Deutschland auf und besuchte Leipzig. Für die "Leipziger Allgemeine Zeitung" zog er als Flaneur durch die Pleißestadt und verfasste in insgesamt 13 Kolumnen "Skizzen von einem vielseitigen Stadtbild", die in diesem Band zusammengefasst sind. In anschaulich-plastischen Bildern und auf humorvolle Weise schildert er Leben und Ansichten von Leipzig – er schreibt vom Kuchenangebot in den Cafés genauso wie über die tanzenden kleinen Mädchen beim "Vornehmen Jugendfestball", dem "dezenten Tanz" oder auch dem "Schneidigen Ball"; vom Betrieb auf der Rennbahn oder im Leipziger Zoo, aber auch vom ganz einfachen und kärglichen Leben der armen Leute. Seine Betrachtungen bieten ein ganz besonderes Lesevergnügen, das ein untergangenes Leipzig wieder zum Leben erweckt und es vor dem Auge des Lesers so plastisch und realistisch Gestalt annehmen lässt, dass es fast scheint, als sei er selbst der Spaziergänger, der da durch die Gassen und über die Plätze der Stadt flaniert.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erdmann Graeser
Leipzig
– wie ich es sah
Aufzeichnungen eines Flaneurs
Entdeckt von Wolfgang U. SchütteMit einem Vorwort von Joachim Nowotny
Saga
Leipzig – wie ich es sah
© 2005 Erdmann Graeser
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711592519
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Vorwort
Ausnahmezustand. Heiter
Da kommt einer im schönen Mai aus Berlin nach Leipzig, um die Reize der Gaststadt im leichten, pointierenden Stil eines wohlwollenden Flaneurs für einen ähnlich gelaunten Leser aufzuschreiben. Beinahe nebenher findet er an den Mauern der Johanniskirche Spuren blutiger Auseinandersetzungen, die nicht älter als zwei Monate sind. Hat er sich doch ausgerechnet im Jahr 1921 aufgemacht, um bis in den Sommer hinein den Ort seiner vergnüglichen Erkundungen zu besuchen. Die mit einem Generalstreik verbundenen sogenannten Märzkämpfe zwischen mitteldeutschen Arbeitern und einer Obrigkeit, die sich der Hilfe schlagender Militärs bedient, sind gerade vorbei. Noch herrscht in Sachsen der Ausnahmezustand. Es gibt Sondergerichte, Verurteilung zu lebenslanger und Festungshaft. Nicht nur die Leipziger und keineswegs allein die Armen haben tagtäglich einen anderen sehr lästigen Gast zu Tisch: Den Hunger. Die Folgen des verlorenen (Ersten) Weltkrieges lasten auf dem Land, einem Ascheberg gleich, aus dem immer wieder die Glut aus aufständischen und konterrevolutionären Nestern schießt. Gerade hat der britische Premier dem Botschafter der Deutschen Regierung ein Ultimatum überreicht, wonach das Reich 132 Milliarden Reichsmark als Reparationsschulden an die Siegermächte zu zahlen hat. Anderenfalls droht die Besetzung des Ruhrgebietes. Im Osten gibt es Kämpfe zwischen Polen und Deutschen um Gebiete Oberschlesiens, die beide beanspruchen. Sogenannte Erfüllungsgehilfen – das sind vor allem Politiker, die sich den überaus harten Bedingungen des Versailler Vertrages beugen wollen – werden nicht nur von erzreaktionärer Seite her übel beschimpft. Einen von ihnen, den Reichsfinanzminister Erzberger, wird man am 8. August heimtückisch ermorden. Die Kohle- und Umsatzsteuer muß erhöht werden, da die Sieger der Bitte der deutschen Regierung um Stundung von Reparationszahlungen nicht nachkommen wollen.
Wie man es auch dreht und wendet: Es ist ein bitterer Frühling, ein harter Sommer, in denen sich Erdmann Graeser aufgemacht hat, Leipzigs Reize zu suchen. Er will sie nicht nur sehen, er will sie anders sehen: In freundlich-friedlicher Absicht, mit der Gemütsverfassung des unbeschwert Reisenden, der die ganz und gar unfreundlichen Zeitläufte weitgehend ignoriert. Kann das gutgehen? Muß sich nicht einer, der solches unternimmt, den Vorwurf gefallen lassen, ihn habe die Verdrängungssucht zu oberflächlicher Betrachtung verdammt? Das hieße freilich zu verdächtigen, was gerade in Notzeiten bitter gebraucht wird: Ein Überlebenswille aus heiterem Geiste. Ich sage hier Geist und nicht Gemüt. Das kippt leicht um zu Mißmut. Graeser verfügt über genügend Witz, um das Kunststück gelingen zu lassen. Wenn er die Vergangenheit bemüht, dann sucht er sie bei den Zeitgenossen früherer Jahrhunderte auf und gewinnt auf diese Art und Weise eine läßliche Zuversicht, wenn nicht gar eine für den Feuilletonisten gefährliche Nähe zur Verklärung. Etwa wenn er das Schillerhaus besucht und nachgerade aus dem Gegensatz zwischen des Dichters betulich-bescheidener Unterkunft und der überaus herzlichen Aufnahme durch den Gönnerkreis die Überzeugung gewinnt, das Lied an die Freude kann nur hier und nirgendwo anders zum ersten Mal gejubelt worden sein. So erklärt, glaubt es der Leser gern. Den jungen Goethe sucht Graeser dort auf, wo der seinen Spaß fand: Bei Klärchen Schönkopf und Friederike Oeser, den Töchtern respektabler Leipziger Bürger. Den Dichter Gellert spürt er in der Gruft der Johanniskirche auf, er schenkt ihm die Minuten der Beachtung, die der fast Vergessene neben der letzten Ruhestätte Bachs sonst kaum genießt. Und der durchaus nicht in Ehrfurcht erstarrte Gruftbesucher vergißt keineswegs den Totengräber Müller zu loben, dessen Pingelichkeit beim Begleichen eines Eichensarges auf des Thomaskantors Spur führte. Fast nebenbei erklärt Graeser Leipzig zur Weltstadt, indem er das Blütenfest im Park Meusdorf (wo ist es geblieben?) mit dem Pariser Montmartrefest vergleicht und sich gern einreden läßt, er befände sich mithin auf dem größten Tanzsaal Europas. Bei Felsche probiert er die berühmten Pfannkuchen, im Thüringer Hof sucht er jene Art von unprätentiöser Behaglichkeit, die er offenbar in Berlin nicht finden kann. Beim Wetten während des Pferderennens macht er mit dem Glück des Anfängers einen kleinen Gewinn. So bleibt er inmitten des Trubels bei heiterer Gelassenheit. Freilich lächelt er hie und da über den Leipziger Dialekt, aber es geschieht ohne die Überheblichkeit, mit der man im übrigen Deutschland gewöhnlich das Sächsische quittiert. Vor dem Völkerschlachtdenkmal ergeht es ihm, wie es den meisten noch heute ergeht: Man erschauert angesichts der aufgetürmten Kolossalität, nicht aber im Gedenken an die auf Leipzigs Feldern Gefallenen.
An manches wird der Leser erinnert, was der letzte Krieg im Stadtbild tilgte. Die Johanniskirche, das Bildermuseum am Augustusplatz, die Albertsäle, die Markthalle, beinahe alle typischen Leipziger Höfe. Der Brühl, heute wenig mehr als ein Straßenname, war in den Zwanzigern voller Leben. Graeser weiß es anschaulich zu beschreiben. Und o Wunder, wo einst vor allem die Pelzhändler jüdischen Glaubens für heftige Bewegung sorgten, spricht er von ihnen als Menschen. Von solchen wie du und ich. Das mochte damals noch weniger üblich gewesen sein, als es heute ist.
Soviel noch: Man möge Herausgeber und Verleger dieses Büchleins in die Nähe des Verfassers der Leipziger Ansichten rücken. Auch ihr Ehrgeiz erscheint auf sympathische Art aus einem heiter ironischen Gemüt zu kommen. Wer müht sich sonst, solche Texte aufzufinden und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen?
Juli 2005
Joachim Nowotny
Zu dieser Ausgabe
„Von der Voraussetzung ausgehend, daß es für den Einheimischen immer interessant sei, zu erfahren, wie seine Vaterstadt auf den Fremden wirke, der mit seinen Augen Längstgewohntes betrachtet, haben wir den bekannten Berliner Romanschriftsteller Erdmann Graeser gebeten, in einer kurzen Artikelreihe zu berichten, wie er Leipzig sah“, leitete die Redaktion der „Leipziger Allgemeinen Zeitung. Mitteldeutsche Tageszeitung für Handel, Industrie und Landwirtschaft, Früher Stadt- und Dorfanzeiger“ im Jahr 1921 und zwar in der Nummer vom Sonntag, dem 15. Mai – das war immerhin der 71. Jahrgang des Blattes – die Artikelserie ihres Berliner Kollegen ein. Dieser war zu jener Zeit bereits ein außerordentlich bekannter Berliner Romanschriftsteller und so fehlten im Einleitungstext die Hinweise „auf seinen berühmt gewordenen sechsbändigen Roman ‚Lemkes sel. Witwe‘ und auf das tiefgreifende Bekenntnisbuch, den Roman ‚Der Kandidat des Lebens‘ (Verlag Ullstein & Co.)“, nicht.
Die kurze Artikelreihe mit dem einfachen, aber treffenden Titel „Leipzig – wie ich es sah“ dürfte selbst für den Leipzig-Kenner eine angenehme Überraschung sein. In dieser Edition sind nach über achtzig Jahren erstmals alle Beiträge ungekürzt und unbearbeitet zusammengefaßt.
Bei Felsche
Reisen heißt: Sein Ich an fremden Orten wiederfinden.
Wenn das wahr ist, so fand ich mein Ich in Leipzig zuerst bei Felsche wieder. Ja – das war unbestreitbar Ich, der da mit nimmermüden Händen nach den Pfannkuchen langte, die zu anmutigem Berge gehäuft auf der Metallschale lagen, „Café Français“ stand auf dieser Schale eingraviert – so hatte das Kaffeehaus am Augustusplatz vor dem Kriege geheißen. Jetzt nennt man es einfach „Felsche“, nach dem Namen des Inhabers. – –
Da sitze ich also nun, esse einen Pfannkuchen nach dem anderen (ohne mir nach jedem den Daumen und Finger abzulecken, wie die schönen Mädchen ringsum!) und ich bin so froh bewegt, weil ich mir keinen großen, grünbaumwollenen Regenschirm und keine Sacktasche mit eingesticktem Königspudel für diese Reise gekauft habe, wie ich zuerst gewollt, um für einen ganz echten Sachsen gehalten zu werden. Jetzt erkenne ich ja: Die Sachsen sehen ganz anders aus, als wie ich sie auf der Bühne in Berlin zu bewundern gewohnt bin. Ich begreife: Die Bühnen-Sachsen sind Karikaturen, wie die Bühnen-Engländer mit den großkarierten Anzügen. Die Leipziger aber sind Großstadtmenschen, sind Klein-Pariser (Kollege Goethe hat ganz recht – wie immer!) und in der Mode, der Damenmode, uns weit voraus. Die wadenfreien Röcke der Berlinerinnen kommen mir plötzlich wie Schleppkleider vor, als ich jetzt so manches holde Kind kniekehlenfrei über den Kies des Augustusplatzes schweben sehe. Diese Überlegenheit stimmt mich ein wenig melancholisch – Trost gewährt mir nur die Kopfbedekkung der Droschkenkutscher, die nicht ganz so einheitlich ist, denn vor dem Bahnhof sah ich etliche mit Mützen, andere mit gewölbten Filzhüten, wieder andere mit schwarzlackierten Pappzylindern und schließlich welche mit echten seidenen Klapphüten – diese Droschkenkutscher lassen sich offenbar nicht unter einen Hut bringen.
Mit diskretem Rattern gleiten die Elektrischen vorüber, zuweilen wird es so still, daß ich – auf der Terrasse – die Finken höre, die in dem frischen Grün der Baumkronen schmettern. Die Riesenfläche des Platzes wird nicht leer, unaufhörlich kommen und gehen, gehen und kommen Menschen über diesen Platz, der wie ein Magnet auf alles wirkt, was Beine und Räder hat, und der einem ehemaligen Exerzierplatz gleicht. Aber ich unterdrücke diese Ansicht, denn mein Reisehandbuch belehrt mich, daß sich mit dem Augustusplatz „in bezug auf Großartigkeit und Schönheit kaum ein Platz in einer anderen Stadt vergleichen lasse.“ – Solche mit Bestimmtheit vorgetragenen Ansichten schüchtern mich immer ein und ich schlage deshalb rasch nach, was über den Mendebrunnen gesagt wird, den ich da rechts sehe und der mit seinen nach allen Richtungen vorgestreckten Haken wie ein riesiger Kleiderständer auf mich wirkt. Und ich erschrecke, bin beschämt, als ich nun lese, wie viele Koryphäen der Kunst sich zusammengefunden haben, um diesen Monumentalbrunnen zustande zu bringen, den Paul Heyse mit einem Sprüchlein geschmückt, das mit den Worten beginnt: „Zum Himmel streben...“
Ach, ich weiß ja noch nicht, daß ich nicht nur in der Stadt der Höflichkeit, sondern auch in der der Superlative bin, in der Stadt mit dem größten Bahnhof der Welt, dem größten Denkmal der Welt, dem größten Tanzsaal der Welt, dem größten Volkspark der Welt und dem größten Vergnügungs-Etablissement der Welt, denn alles dies erfahre ich erst in den nächsten Tagen, als ich schon dicht an dem Mendebrunnen vorbeizugehen wage, ohne Angst, an irgend etwas von ihm hängen zu bleiben, unbesorgt jetzt, daß mir der vorgestreckte Fuß oder ein Arm der Figuren den Hut vom Kopfe schlagen werde – kurz, als ich mich, sozusagen, schon etwas eingewöhnt habe und mein Blick für das Absonderliche bereits abgestumpft ist. Da werde ich schwach und gebe zu, daß auch der Mendebrunnen etwas Schönes sei. Warum auch sich mit diesen liebenswürdig-höflichen Menschen streiten, deren Artigkeit mich überrascht. Das Mädelchen, das ich vorhin auf der Straße um eine Auskunft bat, tat einen Augenaufschlag, wie die Duse und sagte: „Es tut mir herzlich leid, das weiß ich nicht!“ Und die Verkäuferin in dem Ansichtskartengeschäft zwitscherte beim Bezahlen: „Danke recht sehr!“ Der Zigarrenhändler hielt mir den Anzünder bereit und sagte: „Bitte, wenn sich der Herr bedienen wollen!“ Nur einmal bin ich während meines Aufenthaltes in Leipzig angeschrien worden – aber auch nicht von einem Menschen, sondern nur von einer Inschrift, durch die Worte: „Erst Hosen zu!“ Die ich las, gerade als ich irgendwo weggehen wollte...
Wie ich da so sitze und über meine ersten Eindrücke nachdenke, verdrießt es mich plötzlich, daß man mir die Milch gleich in die Tasse gegossen hat. Ich weiß, es geschieht aus Sparsamkeit – aber in meinem Hotel serviert man mir doch den Kaffee so, daß ich nach meinem eigenen Belieben Milch zugießen kann. Und ist nicht etwa für Verschwendung – bewahre! Trotzdem es ein erstklassiges Hotel ist, übt man streng die Tugend der Sparsamkeit, wie die mit Krepp-Papier gedeckten Tische beweisen, mit Krepp-Papier, das bis zum letzten ausgenutzt wird, denn ich finde, diese Tischtücher, zu handlichem Format zerschnitten, nachher an anderem Orte wieder.
Radlerinnen, Autos, Equipagen und Droschken – alles, was da vorüberfährt, bringt dem Fußgänger keine Gefahr, bewegt sich, trotz größter Schnelligkeit so behutsam, als sei ein Menschenleben wirklich noch ein Menschenleben. Und doch hat dieser Wagenverkehr etwa nichts Kleinstädtisches. Der brave Karl von Holtei würde sich wundern, wenn er dieses Rädergewirr beobachten könnte, und sicherlich heute seinen Ausspruch korrigieren, in dem er, trotz aller ekstatischen Bewunderung für diese Stadt, doch von einer „nicht gänzlich abzulegenden Kleinstädterei Leipzigs“ spricht.
„Gestatten?“ fragt der Kellner, und schon nimmt er mir die Kuchenplatte vor der Nase fort, da ich seiner Meinung nach offenbar genug gegessen habe. Ich gebe dem fürsorglichen Manne recht und beschließe, mich satt zu fühlen, zumal – wie ich jetzt beim Bezahlen merke – das Vergnügen – „in dem Gelde läuft!“
Aber am Nachmittag bin ich schon wieder da, jetzt in einem Raum, den ich „Damenzimmer“ taufe, weil die Weiblichkeit überwiegt. Sie sitzt, hofft, wartet – Gott weiß auf was! Zuweilen wird ein Spiegelchen aus dem eleganten Lackledertäschchen oder dem Perlbeutel genommen und die Frisur, das Gesicht, nachprüfend betrachtet. Und immer dieselbe Szene, wenn einer Neuangekommenen die Kuchenplatte zur Auswahl auf das Marmortischchen gesetzt wird: Die sanftesten Mädchenaugen bekommen da plötzlich den Ausdruck gleich dem eines Stoßvogels. Während die eine Hand die Platte langsam dreht, zuckt die halberhobene andere mit den griffbereiten Fingern unschlüssig in der Luft – je nach der Aussicht, die sich bietet, denn einmal angefaßt, kann man den Kuchen doch kaum wieder zurücklegen. Und wenn man dann endlich doch zulangt, scheint man sich allemal vergriffen zu haben – denn während man ißt, haften die Blicke zehrend an einem anderen Kuchen, der noch auf der Platte liegt...
Unter der jungen, eleganten Damenwelt auch viele behäbige Mütterlichkeit mit Töchterlichkeit, die Ansichtskarten schreibt und diese zur Unterschrift am Tische kreisen läßt. Aber das ist keine Eigentümlichkeit der Leipzigerin allein, das tut auch die Berlinerin ebenso gern, wie schon der vor dem Kriege Deutschland bereisende Duret beobachtete und sich darüber wunderte, daß – selbst dem Adressaten ganz Fremde – die Karten dann zur Unterschrift vorgelegt erhalten und muß, gleichsam entschuldigend, notieren: „Unbekannterweise grüßt...“