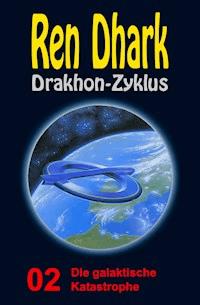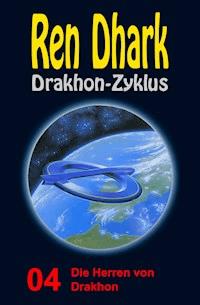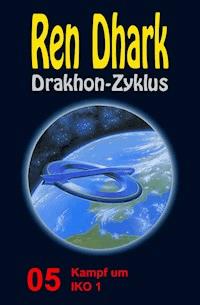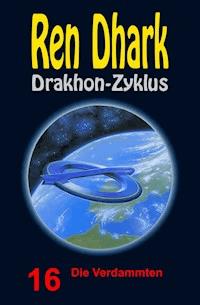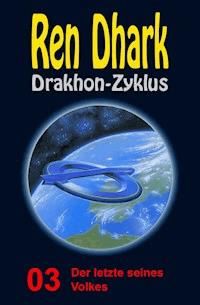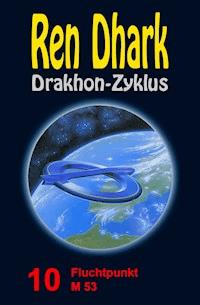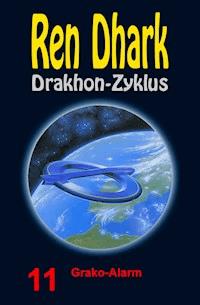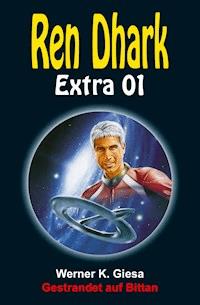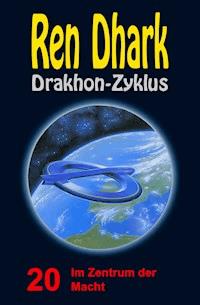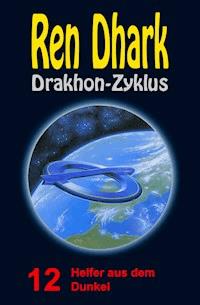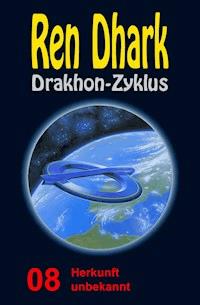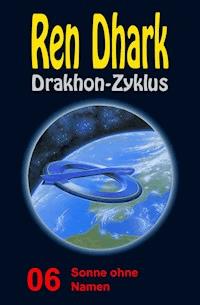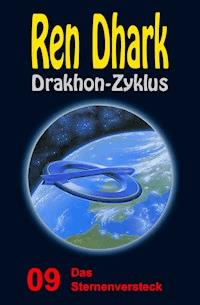
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HJB
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Ren Dhark Drakhon-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Ren Dhark findet die Rahim – und entdeckt die schreckliche Gefahr, die alles Leben in der Milchstraße zu vernichten droht. Gleichzeitig setzt ein geheimnisvoller Mann auf der Erde einen unglaublichen Plan in die Tat um: Er will das gesammelte Wissen der Menscheit stehlen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Ren Dhark
Drakhon-Zyklus
Band 9
Das Sternenversteck
von
Werner K. Giesa
Uwe Helmut Grave
Manfred Weinland
nach einem Exposé von
Hajo F. Breuer
Inhalt
Titelseite
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Empfehlungen
Ren Dhark Classic-Zyklus
Ren Dhark Drakhon-Zyklus
Ren Dhark Extra
Clayton Husker: T93
Clayton Husker: Necronomicon Tales
Impressum
Prolog
Die galaktische Katastrophe, die Ende des Jahres 2057 die Milchstraße heimsuchte, hat sämtliche technischen Errungenschaften der Mysterious, die nicht von einem Intervallfeld geschützt waren, in nutzlosen Schrott verwandelt. Darüber hinaus hatten die Völker der Milchstraße alle unter den Folgen der Energiefront aus dem Hyperraum zu leiden, ob sie nun Mysterioustechnik benutzten oder nicht. Bewußtlosigkeit, Kurzschlüsse und Unfälle forderten allen technisch entwickelten Zivilisationen einen hohen Blutzoll ab. Allein auf der Erde fanden mehr als 50 Millionen Menschen den Tod.
Ren Dhark vermutet einen Zusammenhang zwischen dieser Katastrophe, den verheerenden Strahlenstürmen in der Galaxis und der unerklärlichen Entdeckung der Galaxis Drakhon, die mit der Milchstraße zu kollidieren droht. Weil offenbar auch die Grakos, jene geheimnisvollen Schattenwesen, die so unerbittliche Feinde aller anderen intelligenten Lebensformen zu sein scheinen, unter den Folgen der kosmischen Katastrophe leiden und ihre Angriffe eingestellt haben, bricht Ren Dhark mit seinen Getreuen zu einer Expedition nach Drakhon auf. Da die Erde nach dem Ausfall ihrer meisten S-Kreuzer auf kein Raumschiff verzichten kann, steht für die Expedition nur ein einziges Schiff zur Verfügung: die POINT OF.
Ausgerüstet mit von den Nogk konstruierten Parafeldabschirmern steuert das terranische Flaggschiff noch einmal den Planeten Salteria an, auf dem die letzten Salter Zuflucht bei den paramental enorm starken Shirs gefunden hatten. Diesen gewaltigen Kolossen war es offenbar gelungen, die Erinnerungen und Sinneseindrücke der Terraner beim ersten Aufenthalt auf ihrer Welt fast nach Belieben zu manipulieren.
Beim Einflug nach Drakhon macht die Funk-Z der POINT OF eine erstaunliche Entdeckung: In der fremden Galaxis, die beim ersten Besuch funktechnisch »tot« war, wimmelt es nun von Kommunikationssignalen im Hyperraum. Offenbar hatte auch in dieser Sterneninsel ein kosmischer Blitz zugeschlagen, der die hier lebenden Völker aber früher außer Gefecht gesetzt haben muß als die Bewohner der Milchstraße…
Ren Dhark erhält Hinweise auf das geheimnisumwitterte Volk der Rahim, das Drakhon früher mit seiner Supertechnik beherrscht haben soll, aber seit rund 600 Jahren verschwunden ist. Den Commander packt das Jagdfieber: Die Parallelen zu den Mysterious sind kaum zu übersehen!
Zusammen mit einem Regierungsvertreter der höchst friedfertigen Zivilisation der Galoaner macht sich Dhark auf die Suche nach den Rahim. Unterstützung erhält er von dem S-Kreuzer MAYHEM unter dem Kommando von Ralf Larsen. Der bringt nicht nur die neusten Nachrichten aus der Milchstraße und Dharks Freundin Joan Gipsy mit nach Drakhon, sondern auch eine Ladung Tofirit. Denn wie man inzwischen entdeckt hat, dient das exotische Superschwermetall als Treibstoff für die Ringraumer der Mysterious. Mit vollem T-Vorratsbehälter schalten die Ringschiffe auf eine neue, bisher unbekannte Betriebsart um. In diesem »Vollbetriebsmodus« erreichen sie bisher ungeahnte Leistungswerte.
Doch nicht einmal diese neue Leistungsfähigkeit schützt Ren Dhark und seine Getreuen vor den Rahim. Denn als sie das vermeintliche Versteck der geheimnisvollen Rasse in einer Pseudo-Dunkelwolke anfliegen, werden sie Opfer eines Paraangriffes von unvorstellbarer Kraft…
1.
Noch bevor er die Lider hob, wußte er, daß etwas passiert war.
Etwas von erschreckender Tragweite.
Aber ich lebe, dachte er. Und öffnete die Augen.
Ren Dhark war sicher, daß er die Zentrale der POINT OF noch niemals zuvor so still erlebt hatte. Als hätten selbst die Energiemeiler, deren sonores Summen sonst jeden Winkel durchdrang, den Dienst eingestellt – als sei das kraftvolle Feuer darin für immer erloschen.
Nicht nur die Stille traf ihn bis ins Mark, mehr noch die unglaubliche Einsamkeit, die das logistische Zentrum des Ringraumers ausstrahlte. Ein Gefühl des Verlorenseins bemächtigte sich des Mannes mit dem weißblonden Haar, der sich im Kommandositz wiederfand – und der nur schwer begreifen konnte, daß er ganz allein in dem in seiner Höhe über zwei Decks reichenden Raum, dem Herz der POINT OF, sein sollte.
Ein Herz, das aufgehört hatte zu schlagen?
Er schüttelte den Kopf. Selbst ein flüchtiger Blick auf die Instrumente in seiner Umgebung genügte, um ihm zu zeigen, daß die Aggregate im Normalbereich arbeiteten.
Und dennoch war die Situation weit davon entfernt, normal zu sein.
Wo sind bloß alle hin? dachte er und wuchtete seinen Körper aus dem Sessel.
Zu stehen war seltsam. Es fühlte sich so anders an als sonst. Hatte sich die schiffsinterne Schwerkraft verändert?
Er tippte einen Befehl in die Lehne des Kommandositzes ein. Sofort huschten die angefragten Daten über das Display.
Tatsächlich: Die Schwerkraft lag nur noch bei knapp 0,5 Gravo!
Aber weniger als diese Halbierung der an Terra orientierten Bordgravitation beunruhigte Dhark das Verschwinden der Zentralebesatzung.
Er aktivierte die Bordsprechanlage und rief nacheinander unterschiedliche Stationen des Schiffes an: Funk-Z, Maschinenraum, Waffensteuerungen, Astrophysikalische und Astronomische Abteilung…
Von keiner erhielt er Antwort.
Die Stille nahm eine beängstigende Dimension an.
»Checkmaster!«
Der Superrechner, der in der Lage war, sich sowohl telepathisch als auch über die Bordsprechsysteme oder Folien zu artikulieren, schwieg.
Dhark erinnerte sich an die letzten bewußten Sekunden vor seinem Erwachen in dieser verrückten Situation: Sie hatten jene Zone innerhalb der »falschen« Dunkelwolke angesteuert, in der laut Checkmaster ein reger Funkverkehr herrschte – obwohl kein Mensch an Bord diese Feststellung anhand seiner Instrumente hatte bestätigen können.
Unmittelbar nach Erreichen des Sektors hatte sich etwas in Dharks Verstand gebohrt – und sein Bewußtsein ausgelöscht. Ein Angriff! hatte er noch gedacht, bereits unfähig zu reagieren.
Die gequälten Schreie anderer Betroffener in seiner Nähe dröhnten ihm noch in den Ohren.
War es denkbar, daß die POINT OF geentert worden war? Daß alle Besatzungsmitglieder bis auf ihn verschleppt worden waren?
Aber warum hätte man ihn – und nur ihn – zurücklassen sollen? Ausgerechnet den Commander des Schiffes und Leiter der Expedition in diesen abgelegenen Bereich Drakhons, in dem sie gehofft hatten, auf die Rahim zu stoßen. Auf die einstigen Herren dieser Galaxis, von der eine tödliche Bedrohung für die gesamte Milchstraße ausging – und die, falls die Katastrophe eintrat, selbst im Inferno miteinander kollidierender Sternmassen vernichtet werden würden.
Sein Blick streifte die Bildkugel, die majestätisch über dem Kontrollpult schwebte und holographisch die Umgebung der POINT OF darstellte.
Den Sternenraum, der sich ihnen innerhalb der vermeintlichen Dunkelwolke erschlossen hatte. Dunkel traf die Wirklichkeit nicht annähernd. Eine sonst bestenfalls im Zentrum einer Galaxis übliche Helligkeit herrschte. Manche Sterne standen nur Lichtmonate auseinander, und ihr Strahlendruck schien sämtliche Partikel, die von außen betrachtet eine geschlossen dichte Materiewolke vorgaukelten, zu den Rändern des »Hohlraums« zu treiben.
Eine nachgerade absurde Vorstellung.
Und dennoch: Hier war sie Realität geworden.
Die Astrophysiker und Astronomen hatten noch so demonstrativ die Köpfe schütteln und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen können, es war und blieb Fakt: Hier herrschten Bedingungen, die den Naturgesetzen Hohn sprachen und nur erklärlich wurden, wenn man die Gegebenheiten als künstlich erschaffen einstufte.
Künstlich erschaffen von den Rahim?
Ein Versteck hatte jemand das Innere der Wolke bereits unmittelbar nach dem Einflug genannt. Dhark erinnerte sich nicht mehr genau, wer es gewesen war. Das war auch nicht die Frage.
Die Frage war: Lebten, versteckten sich hier die fieberhaft gesuchten Rahim?
Die, von denen man sich Hilfe bei der Verhinderung der drohenden Verschmelzung zweier Galaxien erhoffte? Und die darüber hinaus im Verdacht standen, identisch zu sein mit den Mysterious – jenen Geheimnisvollen, die einst auch dieses Fabelschiff, die POINT OF, erbaut hatten…?
*
Ren Dhark wandte sich dem Trennschott der Zentrale zu. Die Fortbewegung in reduzierter Schwerkraft war gewöhnungsbedürftig, erinnerte ein wenig an einen Traum.
Das Schott reagierte nicht auf seine Annäherung – es blieb auch dann noch verschlossen, als er bereits unmittelbar davorstand und nur die Hände hätte ausstrecken müssen, um es zu berühren.
Unschlüssig blieb er stehen.
Zum erstenmal kam ihm in den Sinn, daß er ein Gefangener sein könnte.
Aber warum er – er allein? Was war aus den anderen geworden? Sie wären nie geflohen und hätten ihn auf seinem Platz zurückgelassen…
Wirklich nicht?
Auch wenn ihm keine Situation einfiel, die eine solche Handlung begründet hätte, denkbar war alles.
»Hallo!« rief er, stemmte die Fäuste in die Hüften und drehte sich langsam wieder um, so daß er das 25 mal 25 Meter durchmessende Herz der POINT OF wieder überblicken konnte.
Alle Plätze waren verwaist. Sein Freund Dan Riker war ebenso verschwunden wie der Astronom Jens Lionel, der Offizier Hen Falluta, Tino Grappa an den Ortungssystemen – und… und… und…!
Folgerichtig reagierte auch niemand auf sein Rufen.
Fast niemand.
Irritiert blieb Dharks Blick an der Unitallverkleidung des Checkmasters hängen.
Ich halluziniere, dachte er. Für einen Moment hatte er tatsächlich geglaubt, eine Bewegung dort auszumachen. Eine… Gestalt.
Seine Verunsicherung gipfelte in einem abgehackten, kurzen Lachen.
»Checkmaster!« wandte er sich noch einmal an das Bordgehirn des rätselumwobenen Ringraumers. Bis heute war unklar, auf welcher Basis dieser Rechner eigentlich arbeitete. Schon des öfteren war geargwöhnt worden, er könne kein rein kybernetischer Komplex sein, sondern enthalte biologische Komponenten – zu menschlich-störrisch war mitunter sein Verhalten. »Checkmaster! Melde dich, das ist ein Befehl!«
Schweigen. Stille.
Dhark kehrte zum Platz des Commanders zurück. Er wollte die MAYHEM und die H’LAYV kontakten, um auf diesem Weg vielleicht auch Aufschluß über die Geschehnisse an Bord der POINT OF zu erlangen.
Von beiden Schiffen erfolgte keine Reaktion, obwohl die Bildkugel sie in unmittelbarer Nähe parallel zur POINT OF driftend wiedergab.
Die Vorstellung, daß auch der S-Kreuzer und das galoanische Forschungsschiff entvölkert sein könnten, jagte neuerliche Adrenalinstöße durch Dharks Körper.
Und wieder nahm er eine huschende Bewegung wahr – diesmal aus den Augenwinkeln.
Blitzschnell wirbelte er herum.
Und starrte ungläubig auf das unitallfarbene Wesen, das gerade hinter Tino Grappas Sitz wegzutauchen versuchte, sich dann entdeckt sah – und sich mit einem diebisch-vergnügten Ausdruck auf dem Gesicht langsam aufrichtete.
Ohne daß es den Mund bewegte, sagte es: »Ich wollte dich nicht erschrecken. Es ist nur so aufregend, endlich wieder einen Körper zu besitzen…«
*
Regungslos wartete Dhark, bis der Fremde sich näherte.
Eigentlich das Fremde – denn obwohl nackt, wies sein Körper keine eindeutigen Merkmale auf, die sich einem Geschlecht hätten zuordnen lassen.
Ein Neutrum, dachte Dhark.
Das Geschöpf war haarlos und wirkte, obwohl seine Haut, ja selbst seine Augen von derselben blauvioletten Farbe wie das Unitall des Ringraumers waren, keine Sekunde lang wie ein Roboter. Obwohl haarlos, war es unglaublich ästhetisch anzuschauen. Darüber hinaus bewegte es sich mit der Geschmeidigkeit eines Leoparden. Es überragte Dhark um einen ganzen Kopf. Bis auf die fehlenden Geschlechtsmerkmale entsprach es in seinem Aussehen einem Menschen – beziehungsweise der idealisierten Darstellung eines solchen.
Ein wenig erinnerte die Gestalt an die gewaltigen Statuen, die man auf so vielen Planeten der heimatlichen Galaxis gefunden hatte und den Mysterious zusprach – doch diese waren gesichtslos und von anderer Farbe – golden – gewesen.
Und dennoch…
Die Idee, so absurd sie auch scheinen mochte, begann sich in Dharks Denken zu verwurzeln.
… war es nicht denkbar, daß…?
Ihm stockte der Atem. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, und sämtliche feinen Härchen auf seinen Armen und im Nacken stellten sich auf.
Nein, dachte er. Unmöglich!
Doch die Hoffnung, die Sehnsucht und sein tiefstes Wünschen widersprachen: Es war möglich. Wenn nicht hier, an diesem Ort – dem Sternenversteck – wo dann…?
Er räusperte sich.
»Bist du…« fragte er, »… bist du – ein Rahim?«
Das Wort »Mysterious« verkniff er sich.
Ein Lächeln teilte die Lippen des Fremden. Selbst seine Zähne wirkten wie aus Unitall gegossen. »Erkennst du mich wirklich nicht?« fragte er, und es klang beinahe beleidigt. »Nach all den Jahren?«
»Nach all den Jahren?« echote Dhark.
Sein Gegenüber nickte. »Natürlich. Ich bin es – der Checkmaster.«
*
Dhark starrte den Blauen an. Seine Gefühle fuhren Achterbahn. »Du willst der Checkmaster sein?« Er schüttelte den Kopf. Eine Farce, dachte er. Gleichzeitig ertappte er sich dabei, daß etwas in ihm zu glauben – und zu akzeptieren begann.
»Von Wollen kann keine Rede sein«, erwiderte die perfekt modellierte Gestalt. »Andernfalls wäre ich keine halbe Ewigkeit gefangen gewesen.«
»Gefangen?«
»Im Hyperraum.«
Es wurde immer absurder. »Woher kommst du? Wo war dein… Körper während all der Zeit?«
Der Checkmaster erwiderte nichts. Unendliche Tragik, Melancholie, umflorte seinen Blick. Diese Augen wirkten unglaublich lebendig – trotz ihrer Farbe, die an den harten, unnachgiebigen Stahl des Schiffes erinnerte.
»Du gefällst dir immer noch als Rätsel«, hielt Dhark ihm vor.
»Willst du nicht lieber wissen, was passiert ist?«
»Ich war bewußtlos.«
»Wie viele andere.«
»Aber wo sind die anderen?«
»Sie wurden von ihnen weggebracht. Bevor sie auch dich, als letzten, holen konnten, griff ich ein. Ich riegelte den Zugang hermetisch ab. Aber das Schott wird nicht standhalten. Wir haben nicht mehr viel Zeit.«
Dhark hatte das Gefühl, als würde eine Saite in ihm reißen. »Sie?« fragte er. »Von wem redest du?«
»Wir wurden angegriffen. Dieser Angriff – mobilisierte mich. In letzter Konsequenz. Ich hätte noch immer nicht in meinen Körper zurück gekonnt, wäre die Lage nicht so aussichtslos. Du bist der Kommandant. Ich muß mich mit dir abstimmen, bevor ich handele.«
Dhark hob die Brauen. »Was meinst du mit ›handeln‹?«
»Dieses Schiff«, erklärte der Checkmaster, »darf niemals in Feindeshand fallen. Es stellt ein zu großes Machtgebilde dar – richtig eingesetzt.«
So wie er es betonte, suggerierte er, daß die Menschen den Ringraumer all die Jahre falsch, zumindest aber noch nicht in seiner wahren Effizienz benutzt hatten.
»Worauf willst du hinaus?«
Er umging die Antwort, indem er sagte: »Ich zeige dir, was mit den anderen passiert ist.«
Als Dhark dem ausgestreckten Arm folgte, sah er, wie der Weltraum aus der Bildkugel wich. Statt dessen öffneten sich mehrere »Fenster«, die Bilder aus den verschiedenen Stationen des Ringraumers übertrugen, aus Korridoren und A-Gravschächten.
Dhark hatte nie etwas Entsetzlicheres gesehen.
Und hörte kaum, wie der Checkmaster sagte: »Du bist der einzige Überlebende der drei Schiffe.«
*
»Wie – ist es dazu gekommen? Wer waren die Angreifer? Wie konnten sie überhaupt in das Schiff gelangen – und wo kamen sie her? Wir hatten keine Feindortung, bevor…«
»Bevor du dein Bewußtsein verloren hast?«
»Ja.«
»Sie besitzen ganz offenkundig besondere Tarnschirme. Nicht nur ihre Schiffe, auch die Enterkommandos sind völlig unsichtbar.«
»Woher willst du das wissen?«
»Die Bilder sprechen für sich.« Wieder eine Geste, fast menschlich anmutend, und sofort veränderten sich in der Bildkugel die Szenen. Alle Bewegungen liefen rückwärts. Eine Aufzeichnung…
Dhark wurde Zeuge, wie Menschen hilflos durch die Gänge flohen – vor etwas Unsichtbarem. Er sah die vertrauten Gesichter: Tschobe, Wonzeff, Bebir, Doraner…
Endlos war die Reihe der Namen. Die Reihe der Freunde und Weggefährten, die vor seinen Augen in der Strahlenglut unsichtbarer Schützen starben.
»Nur die Besatzung der Zentrale wurde paralysiert«, kommentierte der Checkmaster. »Alle anderen fielen den tödlichen Waffen der Eindringlinge zum Opfer.«
»Aber – was sollte das für einen Sinn machen?«
»Sie wollten nur die Elite des jeweiligen Schiffes lebend in ihre Hand bekommen«, versetzte der Checkmaster mit unglaublichem Zynismus – ohne sich dessen jedoch überhaupt bewußt zu sein. »Ergibt das Sinn genug für dich?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube dir nicht.«
»Du siehst die Bilder. Wir müssen handeln.«
»Was erwartest du von mir?«
»Daß du sie legitimierst.«
»Sie?«
»Die Selbstvernichtung. Dieses Schiff darf nie in den Besitz einer Spezies mit solchem Vernichtungswillen gelangen!«
»Wo warst du damals – als wir das Schiff in Besitz nahmen? Wir Terraner.«
Der Checkmaster schwieg. Der Blaue, zu dem er geworden war, verzog keine Miene.
»Ich glaube dir nicht«, wiederholte Dhark und wich vor dem geschlechtslosen Wesen zurück. »Du lügst.« Er machte eine ausholende Bewegung, die jäh stoppte, als sich hämmernder Schmerz in seinen Schädel bohrte. »Aaaallllleeeessssss hhhhiiiiieeerrrrr iiiiisssttttt Lllllüüüüggggggeeeeeeeeee…!«
Der unitallfarbene Humanoide hob noch drohend die Faust. Dann »zerdehnte« er. Wie Dharks Stimme. Verwandelte sich in eine Erscheinung, die an unzählige Mehrfachbelichtungen erinnerte, von denen eine jede um Millimeter versetzt zur anderen stand.
Dasselbe geschah mit der übrigen Umgebung, mit der Bildkugel, den Konsolen, Wänden, Decke und Fußboden.
Ren Dhark hatte das Gefühl, in einem mit Überlichtgeschwindigkeit enteilenden gläsernen Zug zu sitzen.
Dann stülpte sich Nacht über seinen Geist.
2.
Auch nach einem halben Jahr roch die Luft in den Slums von Rio de Janeiro noch nach Feuer, Asche und Staub. Kaum jemand hatte es für nötig gehalten, aufzuräumen und die gröbsten Schäden zu beseitigen – Aufräumarbeiten kosteten Geld.
Damals, im Spätherbst 2057, war ein Schattenschiff der Grakos durch den nogkschen Abwehrschirm um Terra gedrungen und zwischen Stadtrand und Dschungelreservat aufgeschlagen. Es war vernichtet worden, und überlebende Grakos waren mordend durch die Straßen gehuscht – wenn sie abgeschossen wurden, explodierten sie wie kleine Thermalbomben und richteten weitere Zerstörungen an…
Rio hatte sich davon nach diesem halben Jahr noch nicht wieder erholt. Man schrieb jetzt den April des Jahres 2058, doch es würde noch etliche Zeit dauern, bis buchstäblich Gras über diese Katastrophe wuchs und bis die Schäden repariert wurden. Wer kümmerte sich schon darum, ob die Ärmsten der Armen endgültig obdachlos wurden? Den Reichen war das egal.
Den Karneval hatten sie wie immer gefeiert, unbeeindruckt von den Verwüstungen, und die Festwagen und Straßentänzer der Sambaschulen kamen ohnehin nicht in die Nähe der Slumgebiete. Das Geld, das die Touristen in die Hotels und Lokale trugen, verschwand wie üblich in den Taschen der reichen Besitzer und Schutzgelderpresser, und das Geld, das die Touristen dort nicht ausgaben, verschwand wie üblich in den Händen der Taschendiebe und Straßenräuber, die auch nicht davor zurückschreckten, jemandem die Kehle durchzuschneiden, wenn der seinen Besitz nicht freiwillig abliefern wollte.
Juanita Gonzales schnitt niemandem die Kehle durch. Sie hielt sich mit Ladendiebstählen einigermaßen über Wasser. Erstaunlicherweise war sie noch niemals dabei erwischt worden – wieso, das wußte sie nicht. Sie wußte nur mit ziemlicher Sicherheit, daß niemand sie sah, wenn sie nicht gesehen werden wollte!
Die anderen Straßenkinder hatten es schwerer. Häufig wurden sie erwischt und von den Erwachsenen verprügelt oder sogar der Polizei übergeben. Das war das schlimmste aller Übel. An den »normalen« Erwachsenen konnte man sich rächen, an den Polizisten nicht. Und gegen das, was die so manchem kleinen Dieb antaten – vor allem, wenn es sich um Mädchen handelte –, war eine Tracht Prügel noch harmlos.
Auch in dieser Hinsicht hatte die Zehnjährige, deren Eltern längst tot waren, bisher immer Glück gehabt. Den Vater hatte vor zwei Jahren ein Tourist erschossen, der leider zu früh gemerkt hatte, daß er beklaut worden war. So zumindest hatten andere es Juanita später erzählt. Der Tourist, obwohl nicht im Besitz einer gültigen Erlaubnis für seinen Blaster, hatte Stadt und Land unbehelligt wieder verlassen dürfen.
Und die Mutter war umgekommen, als die Schatten mordend durch die Vorstädte geisterten.
Selbständig war Juanita da schon längst gewesen; sie erzählte niemandem mehr, wohin sie ging und was sie tat. Nach Vaters Tod hatte sie mit ihren kleinen Diebstählen für ihre Mutter mitgesorgt, die beiden hatten mehr schlecht als recht leben können. Jetzt, nach Mutters Tod, war es einfacher, weil Juanita nur noch für sich selbst sorgen mußte, aber in den Nächten weinte sie und wünschte sich die schützenden Arme und die streichelnden Hände, die sie nie wieder spüren würde. Nie wieder, und es gab nicht einmal ein Grab, auf das sie Blumen legen konnte, die sie irgendwo in den Vorgärten der Reichen pflückte oder den Händlern stibitzte, und wo sie Zwiesprache mit ihrer Mutter halten konnte.
Nie wieder…
Manchmal redete sie mit Vater an dessen Grab. Darauf stand ein einfaches Holzkreuz mit einem ungeschickt eingeschnitzten Namen. Juanita konnte ihn lesen; doch, sie hatte Lesen und Schreiben und Rechnen gelernt, wenn auch nicht sehr gut. Emilio Gonzales, 5.10.2020 – 4.10.2055. Er hatte die Invasion der Giants überlebt, und einen Tag vor seinem Geburtstag hatte ihn dieser verfluchte Tourist ermordet, für gerade mal dreißig Dollar, die Vater ihm weggenommen hatte. Diese dreißig Dollar hätten den Mörder nicht arm gemacht, aber die Familie hätte fast einen Monat davon leben können. Juanita haßte die Reichen. Sie hatten, was anderen fehlte, und sie wollten nichts hergeben, obgleich sie im Überfluß lebten und lachend zusahen, wie andere hungerten.
Aber mit Vater zu sprechen war etwas anderes als Mutters sanfte Hände zu fühlen.
Nie wieder…
Grakos nannte man die schattenhaften Mordkreaturen. Juanita haßte die Grakos noch mehr als die Reichen.
Oft, in ihren schlimmen Träumen, sah sie die Bilder wieder wie damals, als sie angstvoll zum Himmel hinaufgestarrt hatte. Sah das schattenhafte böse Raumschiff, sah die drei terranischen Kriegsschiffe, die mit ihm durch die Öffnung im Schutzschirm glitten. Sah wieder die grellen Energiestrahlen der Abwehrstellungen am Boden emporjagen, sah, wie die drei terranischen Schiffe zu kleinen, tückisch grellen Sonnen am Himmel wurden und wie das Schattenschiff brennend und immer noch mit seinen seltsam tiefschwarzen, aber dennoch leuchtenden Energiefingern zerstörerisch um sich tastete, um dann einzuschlagen… sah die Abfangjäger, die sich auf das abgestürzte Wrack stürzten und es zur Explosion brachten…
Manchmal sah sie auch die gespenstischen Gestalten durch die Straßen hasten. Sah sie explodieren wie Bomben, wenn jemand auf sie schoß.
Die Alpträume kamen seltener in den letzten Wochen, aber sie waren immer wieder da. Die bösen Träume von verwehendem Staub, von Trümmern, von Feuern und glühender Asche, die vom Himmel regnete, Träume vom Sterben, voller Blut und Schreie, und stets war es Juanita, die schrie, wenn sie aus den Träumen emporschreckte und glaubte, sich wieder in dem Inferno zu befinden.
Und Mutter war nicht mehr da, um sie zu trösten, um ihr zu versprechen, daß alles wieder gut wurde.
Nie wieder…
»Da! Da ist sie!« gellte ein Schrei.
Juanita drehte sich erschrocken um.
Und dann begann sie zu laufen.
*
Die anderen – das war Felipos Bande. Felipo war wenigstens fünfzehn, und er war einer der Stärksten in den Straßen dieses Slumviertels. Wer nicht für ihn war, der war gegen ihn und wurde verprügelt, davongejagt oder verschwand für immer. Wer in den Straßen Rios erfolgloser blieb als Felipo, den ließ er durchaus in Ruhe. Aber wehe, jemand »erwirtschaftete« mehr als der schwächste aus Felipos Bande – dann gab es nur zwei Möglichkeiten: sich der Bande anzuschließen oder unterzugehen.
Beides wollte Juanita nicht.
Was konnte sie denn dafür, daß sie besser war als die anderen? Wenn die sich doch so dumm anstellten…? Und sie mochte Felipo nicht! Der war böse. Er zwang die anderen, zu tun, was er wollte. Vielleicht zwang er sie sogar, zu töten. Juanita wollte nicht töten. Sie hatte genug Tod gesehen.
Sie rannte!
Felipos Bande hetzte hinter ihr her, aufgepeitscht von den laut gebrüllten Befehlen ihres Anführers. Juanita wußte, was ihr bevorstand. Felipo, dieser Scheißkerl, hatte die Geduld verloren und wollte ihr einen Denkzettel verpassen. Und ihr natürlich wegnehmen, was sie in den letzten Stunden erbeutet hatte!
In panischer Angst rannte sie davon, achtete nicht darauf, wohin sie mit ihren nackten Füßen trat. Unrat, Scherben… nur weg von hier, irgendwohin, wo Felipos Bande sie nicht mehr erwischen konnte!
Bald schon geriet sie außer Atem. Die anderen nicht. Das waren Jungs, große Jungs, allesamt älter und kräftiger als Juanita. Sie waren das schnelle Laufen gewohnt. Juanita dagegen hatte nie so schnell vor zugreifenden Händen und hinter ihr herrennenden Bestohlenen flüchten müssen. Sie wurde einfach nicht gesehen…
Felipos Leute aber sahen sie, und sie ließen nicht locker. Sie wollten ja ein Lob von ihrem Anführer…
Juanita wußte, daß sie nicht mehr lange durchhalten würde. Sie bekam bereits Seitenstechen. Es tat so weh, sie mußte langsamer werden.
Und zu allem Unglück machte sie auch noch den Fehler, in eine Sackgasse zu laufen!
Früher war das eine durchgehende, breite Straße gewesen. Aber seit hier ein paar der mörderischen Schattengespenster explodiert waren nicht mehr. Zwei Häuser waren eingestürzt. Ihre Trümmer versperrten den Durchgang. Hier endete Juanitas Flucht. Sie konnte die Trümmer nicht überklettern.
Sie stand mit dem Rücken zur Wand.
Die anderen rannten jetzt nicht mehr. Sie wußten ihr Opfer in der Falle. Langsam kamen sie heran, in breiter Front die ganze Straße versperrend. Einige ballten bereits die Fäuste. Und dann sah Juanita voller Entsetzen Messer in den Händen einiger der Malandros!
War das nur Drohung, um sie einzuschüchtern, oder wollten diese jungen Teufel ihre Messer tatsächlich an der Zehnjährigen erproben?
»Nein«, flüsterte sie, wich noch einen Schritt zurück und stolperte dabei, stürzte in die Trümmerwand hinter ihr. »Nein, nicht, bitte! Ich habe euch doch nichts getan! Laßt mich doch in Ruhe – bitte…«
Einer der Jungen lachte spöttisch auf. Die anderen rückten stumm näher, und dieses Schweigen war noch schlimmer als ob sie irgendein Kriegsgeschrei von sich gegeben hätten.
Plötzlich sprangen zwei von ihnen wie auf Kommando vor und packten Juanita, rissen sie wieder auf die Beine. Sie schrie auf, versuchte sich zu wehren, um sich zu schlagen, zu treten, zu kratzen, zu beißen, sie spuckte und fluchte – alles, was ihr einfiel. Aber gegen die Kraft der beiden großen Jungen kam sie nicht an. Ein dritter schlug ihr mehrmals ins Gesicht.
Dann waren die anderen da, die mit den Messern. Sie fuchtelten mit den Klingen vor Juanitas Gesicht herum.
»Was wollt ihr von mir?« keuchte sie.
Einer der Messerhelden stand jetzt direkt vor ihr. Er näherte die Klinge ihrem Gesicht. Sie sah die Messerspitze auf ihr rechtes Auge zukommen, immer näher, immer näher…
»Nicht!« keuchte sie. »Tu das nicht, bitte…« Sie wand sich verzweifelt in den stählernen Fäusten ihrer Bezwinger. Aber so sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte sich nicht befreien.
»Zum Klauen brauchst du zwei Hände, aber auf ein Auge kannst du doch bestimmt verzichten«, höhnte der Junge.
Und flog meterweit durch die Luft.
*
Plötzlich war da ein Mann. Woher er gekommen war, wußte niemand. Er tauchte einfach mitten zwischen den Jungen auf, ließ seine Fäuste kreisen. Den Messerhelden hatte er gleich als ersten an Hemdkragen und Hosenbund erwischt und schleuderte ihn durch die Luft, als wiege er überhaupt nichts. Dann erwischte er zwei weitere mit gewaltigen Ohrfeigen, setzte einen, der Karate gegen ihn anwenden wollte, mit einer blitzschnellen Kombination aus Tritten und Schlägen außer Gefecht.
Die beiden Typen, die Juanita so eisern festgehalten hatten, ließen jetzt los und gingen in Kampfstellung. Wer auch immer der Fremde war – er störte die Kreise von Felipos Bande, und das konnten sie nicht auf sich sitzen lassen. Auch wenn es ein Erwachsener war – er gehörte nicht hierher und verdiente eine Abreibung, so wie sie auch für Juanita vorgesehenen war.
Gleich zu mehreren stürzten sie sich auf den Mann.
Der machte einen überraschenden Sprung rückwärts – und hielt plötzlich einen Blaster in der Hand.
Das war nicht unbedingt etwas, das die Jungs wirklich abschreckte. Sie spritzten auseinander, um den Fremden zu irritieren. Zu leicht wollten sie es ihm nicht machen!
Er es ihnen aber auch nicht.
Er schoß!
Er zielte nicht, kreiselte einfach nur herum und gab Dauerfeuer. Dabei berührten Finger seiner anderen Hand eine grün glimmende Sensorfläche der Waffe. Aus dem Blaster zuckte eine seltsam anmutende Strahlbahn, die wie eine rasante Abfolge von leuchtenden Punkten und Strichen erschien, Morsezeichen nicht unähnlich. Während der Sensorberührung weitete sich der Strahl zu einer Art Fächer aus, der über die Messerhelden hinwegstrich. Die Jungen, die davon getroffen wurden, brachen zusammen.
Der Blaster arbeitete völlig lautlos.
Wer noch laufen konnte, der lief jetzt, so schnell ihn seine Füße trugen. Innerhalb weniger Augenblicke war der ganze Spuk vorbei…
*
»Danke, Senhor!« stieß Juanita hervor. Vor ihren Augen verschwamm alles; sie hatte Mühe, sich zu konzentrieren.
Angst und Schock wirkten immer noch in ihr nach. Sie hatte noch nicht so recht begriffen, daß die Gefahr für sie vorbei war. Daß der Fremde sie gerettet hatte.
Sie starrte seinen Blaster an. Sie mußte an ihren Vater denken, der mit einem Blaster erschossen worden war. Und dieser fremde Mann sah aus wie ein Tourist… er war gut gekleidet, er war hellhäutig, groß, muskulös, mit hellem Haar… und die Waffe in seiner Hand sah furchtbar aus.
Irgendwie – fremdartig…
Auch wenn Juanita Gonzales erst zehn Jahre jung war, Waffen hatte sie schon viele gesehen, und alle flößten ihr Angst ein. Diese aber ganz besonders, weil sie so unbekannt aussah…
Der Mann ließ den Blaster jetzt wieder irgendwo unter seiner Kleidung verschwinden. Er kauerte sich vor Juanita nieder.
»Bist du in Ordnung, ja? Du siehst gar nicht gut aus…«
»Mir ist schlecht«, klagte sie.
»Was ist mit denen da? Hast du sie totgeschossen?«
»Nein«, sagte der Fremde. »Hätten sie es denn verdient, getötet zu werden?«
Juanita schüttelte heftig den Kopf. »Niemand verdient das. Töten ist eine Sünde. Wer tötet, ist böse.«
»Ja«, sagte der Fremde leise. »Ja, du hast recht. Deshalb sind sie auch nicht tot. Nur paralysiert – betäubt, wollte ich sagen.«
»He, ich weiß, was paralysiert heißt!« entfuhr es ihr. »Ich bin nicht dumm!«
»Sagt ja auch keiner. Was wollten die von dir?«
»Weiß nicht.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust, versuchte sich in ein imaginäres Schneckenhaus zurückzuziehen. »Sind sie wirklich nicht tot?«
»Wenn ich’s dir doch sage! In ein paar Stunden stehen sie wieder auf und überfallen die nächsten Leute.«
Sie hob den Kopf und sah ihn an. »Du hast mich gerettet. Danke. Hast du einen Namen?«
»Jim. Jim Smith«, sagte er. »Und du?«
»Juanita Gonzales. Du bist einer von den Touristen?«
»Ich glaube nicht«, sagte er langsam, als müsse er überlegen, was das Wort bedeutete. »Nein, ich bin eigentlich kein Tourist. Oder… vielleicht doch?«
»Ich hasse Touristen. Einer hat Vater ermordet.«
»Dann bin ich sicher keiner. Ich möchte nicht, daß du mich haßt, Juanita. Komm, laß uns von hier verschwinden. Es ist keine gute Gegend, und ich fürchte, daß diese Bande bald mit Verstärkung zurückkommt. Was wollten die überhaupt von dir?«
»Weiß nicht.«
»Immer noch nicht? Na schön«, sagte er. »Dann sollten wir trotzdem gehen. Wenn sie zurückkommen, können sie sich ja um ihre Leute kümmern. Glaubst du nicht, daß sie noch leben? Geh zu ihnen, fühle ihren Puls. Oder leg dein Ohr an ihre Nasen und höre und spüre sie atmen.«
»Wohin willst du mit mir gehen?« wollte sie mißtrauisch wissen.
Er lächelte. »Oh, du scheinst für dein Alter schon ganz schön gewitzt zu sein.«
»Ich bin immerhin zehn!« machte sie ihm energisch klar. »Also, wohin?«
»Irgendwohin, wo es ruhiger ist und wir uns unterhalten können. Und wo wir etwas zu essen bekommen. He – ich bezahle!«
»Du bist ein komischer Tourist, Jim Smith«, sagte sie kopfschüttelnd und fragte sich, ob Vater und Mutter ihm über den Weg getraut hätten.
Aber diese Entscheidung mußte sie nun ganz allein treffen.
*
Smith hoffte, daß er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Die letzte Bestätigung stand noch aus, denn während der Flucht hatte das Mädchen, wohl bedingt durch die panische Angst vor den Verfolgern, versagt – hatte seine besondere Gabe nicht benutzt. Das machte Smith etwas nachdenklich.
Vielleicht hätte er sich die Gewißheit rascher verschaffen können, indem er eines der kleinen Geräte benutzte, die er unter dem Hemd in einer Tasche vor seiner Brust trug. Aber damit hätte er die Kleine wohl noch mehr verängstigt oder zumindest verunsichert.
Das war aber das genaue Gegenteil von dem, was er wollte.
Sie gehörte zu den wenigen »Begabten« – vermutlich sogar, ohne es zu wissen. Alles deutete für Smith darauf hin, daß sie keine wirkliche Kontrolle über ihre Gabe hatte.
Aber das spielte nur eine untergeordnete Rolle.
Er wollte diesem Mädchen helfen, denn Juanita Gonzales konnte auch ihm helfen. Ein einsames, verlorenes Kind, im Staub der Straße heimatlos um seine Existenz kämpfend. Mager, hungrig nach Leben und nach Zuneigung, in schmutziger, zerlumpter Kleidung, verängstigt – und doch loderte in seinen dunklen Augen zuweilen ein geradezu wütendes Lebensfeuer.
Er wollte nach der Hand des Mädchens greifen, aber Juanita wich vor der Berührung zurück. So durchmaßen sie einzeln nebeneinandergehend die Straßen, vorbei an überquellenden Mülleimern und pfeifenden Ratten, einem Ziel entgegen, das nur Jim Smith kannte. Und niemand wagte mehr, sie zu bedrohen.
3.
Es geschah ohne Vorwarnung.
Rhaklan, der Galoaner, fiel. Schlug hart auf, blieb reglos liegen und begrub Shodonn unter sich. Shodonn, den galoanischen Weisen, der in den Seelenchip vor Rhaklans Brust eingeschlossen war.
Augenblicklich versagte die chipeigene visuelle Wahrnehmung der Umgebung. Shodonn »sah« nichts mehr außer Schwärze und Dunkelheit. Als hätte ihn ein Erdrutsch verschüttet.
Er versuchte nach Rhaklan zu rufen, aber falls die künstliche Stimme überhaupt aus dem faustgroßen Gerät drang, so verhallte sie ungehört. Unerwidert.
Shodonn handelte. Der größte Teil der Technik, die sich in dem Chip ballte, diente zur Erhaltung seines abgespeicherten Bewußtseins. Darüber hinaus gab es jedoch auch drahtlose Schnittstellen, die es dem Unsterblichen ermöglichten, sich mit den wichtigsten Instrumenten der kurzzuschließen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!