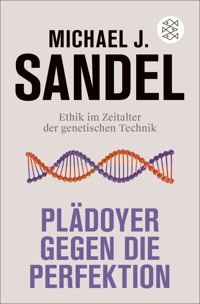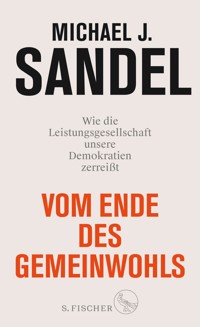24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Michael J. Sandels bahnbrechende Kritik am globalen Kapitalismus – erstmals in deutscher Übersetzung Unsere Gegenwart hat ein Demokratie-Problem. Zum einen sind unsere Gesellschaften gespalten wie nie zuvor: Befeuert durch die sozialen Medien treiben uns rassistische Ausschreitungen, Populismus, soziale Ungleichheit und eine weltweite Pandemie in die Vereinzelung. Zum anderen hat eine global ausgerichtete, von unseren Regierungen vollkommen unregulierte Wirtschaft der Politik den Rang abgelaufen. Seit nunmehr 40 Jahren macht der Neoliberalismus aus Bürgern Gewinner oder Verlierer des globalen Kapitalismus – mit verheerenden Folgen für unsere Demokratie. In seinem monumentalen Werk zeichnet Michael J. Sandel ein historisch informiertes und philosophisch inspiriertes Bild unserer demokratievergessenen Zeit. Und er führt aus, was wir tun müssen, damit aus Konsumenten wieder Bürger werden, die ihre Gesellschaft aktiv gestalten. »Das Unbehagen der Demokratie« ist die nun erstmals auf Deutsch vorliegende, vollständig überarbeitete und aktualisierte Ausgabe von Michael J. Sandels Klassiker »Democracy's Discontent«, der 1996 in den USA erschien und seither die Debatten um Neoliberalismus und Kapitalismus entscheidend prägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Ähnliche
Michael J. Sandel
Das Unbehagen in der Demokratie
Was die ungezügelten Märkte aus unserer Gesellschaft gemacht haben
Eine Neuausgabe für unsere gefahrvollen Zeiten
Über dieses Buch
Michael J. Sandels bahnbrechende Kritik am globalen Kapitalismus – erstmals in deutscher Übersetzung
Unsere Gegenwart hat ein Demokratie-Problem. Zum einen sind unsere Gesellschaften gespalten wie nie zuvor: Befeuert durch die sozialen Medien treiben uns rassistische Ausschreitungen, Populismus, soziale Ungleichheit und eine weltweite Pandemie in die Vereinzelung. Zum anderen hat eine global ausgerichtete, von unseren Regierungen vollkommen unregulierte Wirtschaft der Politik den Rang abgelaufen. Seit nunmehr 40 Jahren macht der Neoliberalismus aus Bürgern Gewinner oder Verlierer des globalen Kapitalismus – mit verheerenden Folgen für unsere Demokratie. In seinem monumentalen Werk zeichnet Michael J. Sandel ein historisch informiertes und philosophisch inspiriertes Bild unserer demokratievergessenen Zeit. Und er führt aus, was wir tun müssen, damit aus Konsumenten wieder Bürger werden, die ihre Gesellschaft aktiv gestalten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Michael J. Sandel, geboren 1953, ist politischer Philosoph. Er studierte in Oxford und lehrt seit 1980 in Harvard. Seine Vorlesungsreihe über Gerechtigkeit begeisterte online Millionen von Zuschauern und machte ihn zum weltweit populärsten Moralphilosophen. »Was man für Geld nicht kaufen kann« wurde zum internationalen Bestseller. Seine Bücher beschäftigen sich mit Ethik, Gerechtigkeit, Demokratie und Kapitalismus und wurden in 27 Sprachen übersetzt. Bei S. FISCHER erschien zuletzt »Vom Ende des Gemeinwohls. Wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt« (2020).
Helmut Reuter, geboren 1946, arbeitet seit 1995 als freier Übersetzer aus dem Englischen und Französischen. Neben den Werken Michael J. Sandels hat er u.a. Bücher von John Hands, Lawrence M. Krauss oder Niall Ferguson übersetzt. Er lebt in der Nähe von München.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Vorwort zur Neuausgabe
Vorwort zur Originalausgabe
Einführung zur Neuausgabe
1. Die politische Ökonomie der Bürgergesellschaft
Liberale und republikanische Freiheit
Wozu ist die Wirtschaft da?
2. Wirtschaft und Tugend in der frühen Republik
Bürgersinn und Verfassung
Föderalisten gegen Jeffersonianer
Hamiltons Finanzsystem
Republikanische politische Ökonomie
Die Debatte über Manufakturen im Inland
Ökonomische Auseinandersetzungen in der Jackson-Ära
Die politische Ökonomie der Jacksonianer
Die politische Ökonomie der Whigs
Das Gemeinwohl
3. Freie Arbeit versus Lohnarbeit
Zivilgesellschaftliche und voluntaristische Konzepte
Lohnarbeit und Sklaverei
Freie Arbeit und republikanische Politik
Labor-Republikanismus im »Vergoldeten Zeitalter«
Der Achtstundentag
Lohnarbeit vor den Gerichten
Der Untergang des zivilgesellschaftlichen Ideals
4. Gemeinschaft, Selbstverwaltung und Reform in der Ära der Progressiven
Die Auseinandersetzung mit einem Zeitalter der Organisation
Progressive Reform: Der Bildungsehrgeiz
Die politische Ökonomie der Progressiven
Die dezentrale Sichtweise
Die nationalistische Vision
Die konsumorientierte Vision
Von der Bürgergesellschaft zum Verbraucherwohl
Gesetzgebung gegen Handelsketten
Die Anti-Kartellbewegung
5. Liberalismus und die keynesianische Revolution
Konkurrierende Vorstellungen der New-Deal-Reform
Staatliche Ausgaben als Lösung
Keynesianische Wirtschaftslehre und die prozedurale Republik
Vermeidung politischer Kontroversen
Das Bildungsprojekt wird aufgegeben
6. Triumph und Geburtswehen der prozeduralen Republik
Der Moment der Vorherrschaft
Das voluntaristische Versprechen
Das Selbstbild der Ära
Der Herrschaftsverlust
Tastende Versuche, die Unzufriedenheit aufzugreifen
Die Politik des Protests: George C. Wallace
Staatsbürgerliches Engagement: Robert F. Kennedy
Moralismus und Management-Orientierung: Jimmy Carter
Libertärer Konservatismus vs. Kommunaler Konservatismus: Ronald Reagan
Schluss Auf der Suche nach einer Philosophie des Öffentlichen
Republikanische Freiheit: Schwierigkeiten und Gefahren
Der Versuch, das Bildungsprojekt zu meiden
Wiederbelebung der politischen Ökonomie der Bürgergesellschaft
Gemeinschaft organisieren
Das zivilgesellschaftliche Argument gegen Ungleichheit
Globale Politik und spezielle Identitäten
Jenseits der Staatssouveränität und des souveränen Selbst
Epilog Was falsch lief: Kapitalismus und Demokratie seit den 1990er Jahren
Globalisierung
Finanzmarkt-Kapitalismus
Wall Street gegen Main Street
Obamas Entscheidung
Zwangsversteigerungen von Häusern
Boni an der Wall Street
Keine Rechenschaftspflicht
Populistische Gegenbewegung
Ungleichheit und Oligarchie: das System manipulieren
Ungleichheit und Leistungsgesellschaft: Gewinner und Verlierer
Ehre dem Gründervater des Finanzwesens
Politik nach der Pandemie: Jenseits des Neoliberalismus?
Register
Für Kiku
Vorwort zur Neuausgabe
In den Jahren seit der Veröffentlichung der ersten Ausgabe dieses Buches hat sich die Unzufriedenheit mit der Demokratie vertieft. Sie hat sich so zugespitzt, dass Zweifel an der Zukunft der amerikanischen Demokratie aufgekommen sind. In dieser Neuausgabe, mit der die Geschichte durch die Jahre mit Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama weitergeführt und die Präsidentschaft von Donald Trump sowie die COVID-19-Pandemie einbezogen wird, versuche ich zu erklären, warum das so ist. Die erste Ausgabe umfasste zwei Teile. Einer behandelte die amerikanische Verfassungstradition, der andere den öffentlichen Diskurs über die Wirtschaft, um zu zeigen, wie die Philosophie der Öffentlichkeit des zeitgenössischen Liberalismus sich auf jedem dieser Gebiete entfaltete. Für die aktuelle Ausgabe habe ich die verfassungsrechtliche Darstellung weggelassen; stattdessen konzentriere ich mich auf die Debatten, die sich mit der Wirtschaft beschäftigen. Wenn wir uns ansehen, wie diese Debatten sich im Zeitalter der Globalisierung entwickelt haben, kann das dazu beitragen, dass wir besser verstehen, wie wir an diesen gefährlichen Punkt gekommen sind.
Seit Democracy’s Discontent 1996 erschienen ist, bin ich denen, die auf das Buch reagiert haben, eine Menge Dank schuldig geblieben. Besonderen Dank schulde ich Anita L. Allen und Milton C. Regan, die am Law Center der Georgetown University ein denkwürdiges Symposion einberufen haben. Das Symposion mit Dekanin Judith Arens als Gastgeberin war eine hochkarätige Versammlung von Rechts- und Polittheoretikern die das Buch kritisch kommentiert haben. Allen und Regan gaben eine Sammlung dieser und anderer Kommentare und Rezensionen heraus; der Band mit dem Titel Debating Democracy’s Discontent erschien 1998. Durch diese Aufsätze habe ich viel gelernt, und allen, die dazu beigetragen haben, bin ich zutiefst dankbar: Christopher Beem, Ronald S. Beiner, William E. Connolly, Jean Bethke Elshtain, Amitai Etzioni, James E. Fleming, Bruce Frohnen, William A. Galston, Will Kymlicka, Linda C. McClain, Clifford Orwin, Thomas L. Pangle, Philip Pettit, Milton C. Regan, Richard Rorty, Nancy L. Rosenblum, Richard Sennett, Mary Lyndon Shanley, Andrew W. Siegel, Charles Taylor, Mark Tushnet, Jeremy Waldron, Michael Walzer, Robin West und Joan C. Williams.
Für hilfreiche Kommentare zum Epilog der Neuausgabe danke ich Kiku Adatto, George Andreou und David M. Kennedy. Katrina Vassallo redigierte das Manuskript professionell und umsichtig. Besonderen Dank schulde ich Ian Malcolm, meinem Lektor bei Harvard University Press, der über viele Jahre hinweg dazu beitrug, die Idee für diese Neuausgabe zu entwickeln. Zusammen mit seinem überragenden redaktionellen Urteilsvermögen verfügt Ian über eine außergewöhnliche Fähigkeit, genau die richtige Balance zwischen Führung und Geduld aufzubringen. Meine Söhne Adam und Aaron, bei der ersten Ausgabe fröhlich dabei, waren bei dieser Ausgabe klingende Resonanzkörper und kenntnisreiche Kritiker. Ihnen und vor allem Kiku bin ich zu Dank verpflichtet. Auch diese überarbeitete Neuausgabe ist ihr gewidmet.
Vorwort zur Originalausgabe
Die Politische Philosophie scheint oft in einiger Entfernung von der Welt zuhause zu sein. Prinzipien sind eine Sache, Politik eine andere, und selbst unsere besten Bemühungen, unseren Idealen gerecht zu werden, sind selten erfolgreich. Die Philosophie mag in unseren moralischen Bestrebungen schwelgen, doch die Politik handelt mit widerspenstigen Fakten. Tatsächlich könnten manche sagen, das Problem der amerikanischen Demokratie bestehe darin, dass wir unsere Ideale zu ernst nähmen, dass unser Reformeifer den Respekt für die Kluft zwischen Theorie und Praxis überhole.
Wenn aber die Politische Philosophie in einem gewissen Sinn nicht umsetzbar ist, ist sie in einem anderen Sinn unvermeidlich. Das betrifft den Aspekt, in dem die Philosophie von Beginn an in der Welt zu Hause ist; unsere Verhaltensweisen und Institutionen sind Verkörperungen von Theorie. Unser politisches Leben könnten wir kaum beschreiben, und noch weniger könnten wir uns dort engagieren, ohne auf eine mit Theorie befrachtete Sprache zurückzugreifen – Theorien von Rechten und Pflichten, Bürgerschaft und Freiheit, Demokratie und Rechtswesen. Politische Institutionen sind nicht einfach Werkzeuge, die unabhängig konzipierte Ideen umsetzen – sie sind selbst Verkörperungen von Ideen. Sosehr wir uns solchen letztgültigen Fragen wie nach der Bedeutung von Gerechtigkeit oder der Natur des guten Lebens widersetzen mögen – einem können wir uns nicht entziehen, nämlich der Tatsache, dass wir irgendeine Antwort auf diese Fragen leben – wir leben unentwegt irgendeine Theorie.
In diesem Buch erkunde ich die Theorie, die wir jetzt im Amerika von heute leben. Ich möchte die Philosophie des Öffentlichen dingfest machen, die in unseren Verhaltensweisen und Institutionen enthalten ist, und zeigen, wie Spannungen in der Philosophie in der Praxis in Erscheinung treten. Wenn die Theorie nie ihre Distanz beibehält, sondern von Beginn an in der Welt zu Hause ist, finden wir vielleicht einen Hinweis auf unsere Stellung in der von uns gelebten Theorie. Wenn wir uns der in unserem öffentlichen Leben enthaltenen Theorie widmen, hilft uns das vielleicht, unsere politische Lage zu diagnostizieren. Möglicherweise zeigt sich dabei, dass das Dilemma der amerikanischen Demokratie nicht nur in der Kluft zwischen unseren Idealen und Institutionen besteht, sondern auch in den Idealen selbst und in dem Selbstbild, das unser öffentliches Leben widerspiegelt.
Der erste Teil dieses Buches entstand 1989 im Rahmen der Julius Rosenthal Foundation Lectures an der Northwestern University School of Law. Ich danke Dekan Robert W. Bennett und der Fakultät für ihre herzliche Gastfreundschaft und ihre tiefgehenden Fragen, dazu auch für ihre Erlaubnis, die Vorlesungen in dieses größere Projekt aufzunehmen. Ich konnte auch einige Gelegenheiten nutzen, Teile dieses Buches bei Fakultäten und Studenten zu testen – an der Brown University, der University of California in Berkeley, der Indiana University, der New York University, der Oxford University, der Princeton University, der University of Utah, der University of Virginia, am Institut für Humanwissenschaften in Wien und bei Sitzungen der American Political Science Association, der Association of American Law Schools, der Society for Ethical and Legal Philosophy, und beim Harvard University Law School Faculty Workshop. Teile des dritten und vierten Kapitels erschienen in früheren Versionen in der Utah Law Review 1989, no. 3 (1989): 597–615, bzw. in der California Law Review 77, no. 3 (1989): 521–538.
Für großzügige Unterstützung bei der Forschung und der Fertigstellung dieses Buches danke ich der Ford Foundation, dem American Council of Learned Societies, dem National Endowment for the Humanities und dem Sommerforschungsprogramm der Harvard Law School.
Kollegen am Institut für Staatswissenschaft und an der Law School in Harvard waren eine beständige Quelle anregender Gespräche zu den Themen dieses Buches. Besonderen Dank schulde ich den Harvard-Absolventen und Studenten in meinem Kurs »Law and Political Theory: The Liberal and Republican Traditions«, die meine Argumente einer strengen kritischen Prüfung unterzogen. Besonders dankbar bin ich Freunden, die mir in verschiedenen Stadien dieses Projekts ausführliche schriftliche Kommentare zu Teilen oder zum ganzen Manuskript zukommen ließen: Alan Brinkley, Richard Fallon, Bonnie Honig, George Kateb, Stephen Macedo, Jane Mansbridge, Quentin Skinner und Judith Jarvis Thomson. John Bauer und Russ Muirhead steuerten Forschungshilfe bei, die weit über das Sammeln von Informationen hinausging und mein Denken stark beeinflusste. Bei Harvard University Press hatte ich das Glück, mit Aida Donald zusammenzuarbeiten, einer vorbildlichen Lektorin, die zudem geduldig war, und mit Ann Hawthorne, die das Buch im Endstadium kompetent und sorgfältig durchsah. Was ich bei diesem Buch am meisten bedaure, ist die Tatsache, dass meine Freundin und Kollegin Judith N. Shklar es nicht mehr im fertigen Zustand erleben durfte. Dita war mit vielem, was ich zu sagen hatte, nicht einverstanden, und doch war sie von meinen ersten Tagen in Harvard ein Quell von Ermutigung und Ratschlägen – voll beschwingter und belebender intellektueller Kameradschaft.
Während ich an diesem Buch arbeitete, wuchsen meine Söhne von Babys zu Jungen heran. Sie machten diese Jahre des Schreibens zu einer Zeit der Freude. Schließlich spiegelt das Buch vieles wider, was ich von meiner Ehefrau Kiku Adatto gelernt habe – einer begabten Schriftstellerin über amerikanische Kultur. Sie trug mehr als jeder andere dazu bei, dieses Buch zu verbessern, das ich ihr in Liebe widme.
Einführung zur Neuausgabe
Gefahr für die Demokratie
Unser staatsbürgerliches Leben läuft nicht besonders gut. Ein besiegter Präsident stachelt einen wütenden Mob an, das Kapitol zu stürmen und den Kongress gewaltsam davon abzuhalten, die Wahlergebnisse zu bestätigen. Nach mehr als einem Jahr der Präsidentschaft von Joe Biden glauben die meisten Republikaner immer noch, Donald Trump sei die Wahl gestohlen worden. Sogar als eine Pandemie mehr als eine Million amerikanischer Leben fordert, zeigen wütende Streitereien über Masken und Impfstoffe, in welch polarisiertem Zustand wir uns befinden. Öffentliche Empörung wegen der Tötung unbewaffneter Schwarzer durch Polizisten löst eine landesweite Abrechnung mit rassisch unterlegter Ungerechtigkeit aus, doch Staaten im ganzen Land führen Gesetze ein, die es erschweren, bei Wahlen abzustimmen.
Trumps Präsidentschaft und ihre bösen Folgen werfen finstere Schatten auf die Zukunft der amerikanischen Demokratie. Doch unsere staatsbürgerlichen Probleme haben nicht mit Trump angefangen und sind mit seiner Niederlage nicht beendet. Seine Wahl war ein Symptom brüchig gewordener sozialer Bindungen und einer beschädigten demokratischen Ordnung.
Die Trennung zwischen Gewinnern und Verlierern hat sich jahrzehntelang vertieft – sie hat unsere Politik vergiftet und uns auseinandergebracht. Seit den 1980er und 1990er Jahren haben unsere regierenden Eliten ein Projekt der neoliberalen Globalisierung vollzogen, das denen an der Spitze enorme Profite, den meisten arbeitenden Menschen jedoch Jobverlust und stagnierende Löhne brachte. Die Befürworter meinten, die Zuwächse der Gewinner könnten dafür verwendet werden, die Verlierer der Globalisierung zu entschädigen. Doch diese Entschädigung kam nie an. Die Gewinner nutzten ihre Beute, um sich an höherer Stelle Einfluss zu erkaufen und ihre Gewinne zu konsolidieren. Der Staat hörte auf, als Gegengewicht zu konzentrierter wirtschaftlicher Macht zu wirken. Demokraten und Republikaner taten sich zusammen, um die Wall Street zu deregulieren, wofür sie beträchtliche Wahlkampfspenden einstrichen. Als die Finanzkrise von 2008 das System an den Rand des Abgrunds beförderte, gaben sie Milliarden aus, um die Banken zu retten, überließen es normalen Wohnungsbesitzern aber, sich selbst zur Wehr zu setzen.
Wut über die Bankenrettung und die Auslagerung von Arbeitsplätzen befeuerte populistische Proteste quer durch das politische Spektrum – auf der Linken die Occupy-Bewegung und Bernie Sanders überraschend starke Herausforderung Hillary Clintons im Jahr 2016, auf der Rechten die Tea-Party-Bewegung und die Wahl von Trump.
Einige der Anhänger Trumps wurden von seinen rassistischen Appellen angezogen. Doch er nutzte auch die Wut, die aus legitimen Klagen hervorging. Vier Jahrzehnte neoliberaler Regierungsführung hatten eine Ungleichheit der Einkommen und des Reichtums herbeigeführt, die man seit den 1920er Jahren nicht mehr erlebt hatte. Die soziale Mobilität kam zum Stillstand. Unter unablässigem Druck von Unternehmen und ihren politischen Verbündeten ging es mit den Gewerkschaften bergab. Die Produktivität nahm zu, doch die Arbeiter erhielten einen immer kleineren Anteil dessen, was sie produzierten. Die Finanzwelt beanspruchte einen wachsenden Anteil der Firmengewinne, investierte jedoch weniger in neue produktive Unternehmen als in spekulative Aktivitäten, die wenig dazu beitrugen, der Realwirtschaft zu helfen. Anstatt Ungleichheit und stagnierende Löhne direkt zu bekämpfen, rieten die Mainstream-Parteien den Arbeitern, sich durch einen Hochschulabschluss zu verbessern.
Trumps Wirtschaftspolitik brachte wenig für die arbeitenden Menschen, die ihn unterstützten, doch seine Feindseligkeit gegen Eliten und deren Globalisierungsprojekt fand starken Widerhall. Sein Versprechen, entlang der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen und Mexiko dafür bezahlen zu lassen, ist ein typisches Beispiel. Seine Zuhörer fanden dieses Versprechen nicht nur deswegen mitreißend, weil sie glaubten, damit würde die Zahl der um ihre Jobs konkurrierenden Immigranten verringert. Die Mauer stand für etwas Größeres: die Wiederaufrichtung von nationaler Souveränität, Macht und Stolz. Zu einer Zeit, in der globale Wirtschaftskräfte nur noch eingeschränkt zuließen, dass Amerika seine Macht und seinen Willen behauptete, und in der multikulturelle, kosmopolitische Identitäten die traditionellen Vorstellungen von Patriotismus und Zugehörigkeit komplizierter machten, konnte der Grenzwall »Amerika wieder groß machen«. Er sollte die Gewissheiten bestärken, die von löchrigen Grenzen und fluiden Identitäten des globalen Zeitalters in Zweifel gezogen worden waren.
Als 1996 die erste Ausgabe von Democracy’s Discontent erschien, war der Kalte Krieg zu Ende gegangen. Amerikas Version eines liberalen Kapitalismus schien – als einziges erhalten gebliebenes System – zu triumphieren. Es lockte das Ende der Geschichte und der Ideologie. Ein Präsident der Demokraten verringerte das Bundesdefizit, um das Vertrauen der Anleihemärkte zu gewinnen; Wirtschaftswachstum nahm zu, die Arbeitslosigkeit ging zurück. Und doch konnte man inmitten von Frieden und Wohlstand unter der Oberfläche Befürchtungen in Bezug auf das Projekt der Selbstverwaltung erkennen:
In dem Maß, in dem zeitgenössische Politik souveräne Staaten und souveräne Individuen in Frage stellt, ist es wahrscheinlich, dass sie Reaktionen auf Seiten derer provoziert, die Mehrdeutigkeit verbieten, Grenzen schließen und die Unterscheidung zwischen Insidern und Outsidern verschärfen wollen und die eine Politik fordern, die ›unsere Kultur und unser Land zurückholt‹, um mit aller Macht unsere ›Souveränität wiederherzustellen‹.[1]
Die machtvolle Gegenbewegung kam zwei Jahrzehnte später. Doch die Missstände, die Trump den Wahlsieg brachten, wurden durch seine Präsidentschaft nicht beigelegt – auch nicht durch seine Niederlage nach nur einer Amtszeit. Begünstigt durch die Pandemie, übertriebene Vetternwirtschaft, hartnäckige rassistische Ungerechtigkeit und toxische soziale Medien ist die Unzufriedenheit mittlerweile durchdringender als ein Vierteljahrhundert zuvor – erbitterter, ja sogar tödlich.
In den 1990er Jahren nahm die Unzufriedenheit die Form diffuser Ängste an – es verstärkte sich das Gefühl, dass wir die Kontrolle über die Kräfte verlieren, die unser Leben lenken, und dass das moralische Geflecht von Gemeinschaft sich aufzulösen beginnt. Wo die globale Wirtschaft wichtiger wurde, spielte der Nationalstaat, traditionell der Ort der Selbstverwaltung, eine geringere Rolle. Die Größenordnung des Wirtschaftslebens wuchs über die Reichweite demokratischer Kontrolle hinaus.
Als das Projekt der Selbstverwaltung schwächer wurde, lockerten sich auch die Bindungen zwischen den Bürgern. Es war unwahrscheinlich, dass die Institutionen globaler Herrschaft das gemeinsame Verständnis und die wechselseitigen Verpflichtungen förderten, die für eine demokratische Bürgergesellschaft nötig sind. Durch die schwindende wirtschaftliche Bedeutung von Landesgrenzen wurden nationale Loyalitäten und Zugehörigkeiten ausgehöhlt. Die in der neuen Ökonomie aufblühenden qualifizierten Eliten entdeckten, dass sie mit den Unternehmern, Erneuerern und Fachkräften in aller Welt mehr gemeinsam hatten als mit den Bürgern ihres eigenen Landes. Als Unternehmen Arbeitskräfte und natürlich auch Verbraucher finden konnten, die auf der anderen Seite des Globus zu Hause waren, wurden sie unabhängiger von denen, die näher an der Heimat lebten.
Arbeitskräfte, deren Lebensunterhalt an die Nachbarschaft und den Ort gebunden war, bemerkten das. Die neue Art, wirtschaftliche Tätigkeit zu organisieren, verstärkte die Ungleichheit, untergrub die Würde der Arbeit und entwertete nationale Loyalität und Unabhängigkeit. Die politische Spaltung, auf die es ankam, bestand für die Gewinner nicht mehr zwischen Links gegen Rechts, sondern offen gegen abgeschottet. Diejenigen, die Freihandelsabkommen ebenso in Frage stellten wie die Auslagerung von Arbeitsplätzen in Niedriglohnländer und den ungehinderten Kapitalfluss über Landesgrenzen, wurden als engstirnig abgestempelt, als wäre Opposition gegen die neoliberale Globalisierung mit Bigotterie gleichzusetzen. Gemäß dieser Logik erschien Patriotismus als primitiv, als Flucht vor der offenen, reibungsfreien Welt, die lockte, und als Trost für die Zurückgebliebenen.
Damals war ich besorgt, dass bedeutende transnationale Projekte – Umweltabkommen, Menschenrechtskonvention, die Europäische Union – scheitern könnten, weil sie nicht imstande waren, die gemeinsamen Identitäten und das zivilgesellschaftliche Engagement zu fördern, die zu ihrer Erhaltung notwendig waren. »Die Menschen werden großen, fernen Einheiten, wie wichtig sie auch sein mögen, keine Loyalität schwören, solange diese Institutionen nicht irgendwie mit politischen Einrichtungen verbunden sind, in denen sich die Identität der Teilnehmer spiegelt.«[2] Selbst der Europäischen Union, »einem der erfolgreichsten Experimente supranationalen Regierens, fiel es schwer, eine gemeinsame europäische Identität zu pflegen, die ausreicht, ihre Mechanismen zur wirtschaftlichen und politischen Integration zu stützen«.[3]
2016 war es Großbritanniens Abstimmung, die EU zu verlassen, welche die gut qualifizierten Eliten der Metropolen schockierte – ebenso wie Trumps Wahl ein paar Monate später. Der Brexit und die Grenzmauer symbolisierten beide eine Reaktion gegen eine vom Markt getriebene, technokratische Regierungsweise, die Jobverluste, stagnierende Löhne, wachsende Ungleichheit mit sich gebracht und bei der arbeitenden Bevölkerung das bittere Gefühl ausgelöst hatte, die Eliten würden auf sie herabschauen. Die Abstimmung für den Brexit und Trumps Wahl waren schmerzgeplagte Versuche, wieder Stolz und nationale Souveränität zu behaupten.
Die Unzufriedenheit, die in den 1990er Jahren – während der Glanzzeit des Washingtoner Konsens – unter der Oberfläche gegrummelt hatte, verhärtete sich jetzt und stülpte die Mainstream-Politik um. Die Ahnung von den entmachtenden Auswirkungen des globalen Kapitalismus wich der schonungslosen Einsicht, dass das System zugunsten von Großunternehmen und Reichen manipuliert war. Befürchtungen wegen des Verlusts der Gemeinschaft machten Platz für Polarisierung und Misstrauen.
Selbstverwaltung verlangt, dass wirtschaftliche Macht durch politische Institutionen zur Rechenschaft angehalten wird. Außerdem erfordert sie, dass Bürger sich gegenseitig ausreichend miteinander identifizieren und deshalb den Eindruck haben, an einem gemeinschaftlichen Projekt mitzuwirken. Heute sind beide Bedingungen in Frage gestellt.
Quer durch das politische Spektrum erkennen viele Amerikaner, dass der Staat von mächtigen Interessen gekapert worden ist, was dem Durchschnittsbürger wenig Mitsprache bei der Art lässt, in der wir regiert werden. Wahlkampfspenden und Armeen von Lobbyisten ermöglichen es Unternehmen und den Reichen, die Regeln zu ihren Gunsten zu verbiegen. Eine Handvoll mächtiger Firmen dominiert Spitzentechnologie, soziale Medien, Internetsuche, Onlinehandel, Telekommunikation, Bankwesen, Arzneimittel und andere Schlüsselbranchen – sie alle zerstören Wettbewerb, treiben die Preise, verstärken Ungleichheit und fordern eine demokratische Kontrolle heraus.
Indessen sind die Amerikaner zutiefst gespalten. Kulturkriege toben darüber, wie rassistische Ungerechtigkeit zu bewältigen sei, was wir unseren Kindern über unsere Vergangenheit beibringen sollten, wie mit Einwanderung, bewaffneter Gewalt, Klimawandel, Impfverweigerung bei COVID-19 umzugehen sei; und die Flut an Desinformation, verstärkt durch die sozialen Medien, verpestet die Sphäre der Allgemeinheit. Einwohner von demokratisch dominierten Bundesstaaten und republikanisch dominierten Staaten, von Metropolregionen und ländlichen Gemeinden sowie Menschen mit beziehungsweise ohne Universitätsabschlüssen führen zunehmend ein getrenntes Leben. Wir beziehen unsere Nachrichten aus unterschiedlichen Quellen, glauben an unterschiedliche Fakten und treffen wenige Menschen, deren Meinungen oder deren sozialer Hintergrund sich von unserem unterscheidet.
Diese beiden Aspekte unseres Dilemmas – nicht rechenschaftspflichtige wirtschaftliche Macht und verfestigte Polarisierung – hängen zusammen. Beide entmachten demokratische Politik.
Die Kulturkämpfe sind so kontrovers und so unwiderstehlich, dass sie uns davon abhalten, gemeinsam das System von einseitiger Manipulation zu befreien. Diejenigen, die diese Kämpfe schüren und entzünden, tragen dazu bei, wirtschaftliche Regelungen von Reformbewegungen mit breiter Basis zu isolieren.
Es ist kein Wunder, dass unser öffentlicher Diskurs hohl klingt. Was als politische Debatte gilt, besteht entweder aus engstirniger technokratischer Sprache, die niemanden begeistert, oder aus Schreiduellen, in denen Parteianhänger anprangern und deklamieren, ohne wirklich zuzuhören. Der schrille, überhitzte Tonfall von Fernsehnachrichten – ganz zu schweigen von den sozialen Medien – ist ein Sinnbild für diesen Zustand.
Um die amerikanische Demokratie wieder aufleben zu lassen, müssen wir zwei Fragen erörtern, die von der technokratischen Politik der jüngsten Jahrzehnte vernebelt worden sind: Wie können wir die Wirtschaft so reformieren, dass sie demokratischer Kontrolle zugänglich wird? Und wie können wir unser gesellschaftliches Leben wieder so aufbauen, dass die Polarisierung abgeschwächt wird und die Amerikaner befähigt werden, zu effektiven demokratischen Bürgern zu werden?
Wirtschaftliche Macht zur Verantwortung zu ziehen und die Bürgerschaft zu stärken – auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären es verschiedene politische Projekte. Das erste befasst sich mit Macht und Institutionen, das zweite behandelt Identität und Ideale. Ein zentrales Thema dieses Buches lautet, dass zwischen beiden Projekten ein Zusammenhang besteht. Wenn wir die Eroberung demokratischer Einrichtungen durch Oligarchen rückgängig machen wollen, kommt es darauf an, den Bürgern die Fähigkeit zu vermitteln, sich selbst als Teilnehmer eines gemeinsam geteilten öffentlichen Lebens zu begreifen.
Diese Denkweise geht uns gegen den Strich. Wir verstehen uns zumeist weniger als Bürger denn als Verbraucher. Wenn wir wegen der Machtkonzentration bei Großfirmen besorgt sind, so vor allem deshalb, weil Monopole die Preise hochtreiben. Wenn wir uns auf Big Pharma verlassen, bedeutet das höhere Preise für Medikamente. Verringerter Wettbewerb im Bankensektor heißt höhere Gebühren für Kreditkarten und Bankkonten. Wenn es nur wenige Fluglinien gibt, kostet es mehr, irgendwohin zu fliegen.
Doch der »Fluch der Größe«, wie Louis D. Brandeis es ausgedrückt hat, ist nicht nur für Verbraucher ein Problem. Er ist auch ein Problem für die Selbstverwaltung. Wenn die Pharmaindustrie zu mächtig ist, wird sie eine Reform des Gesundheitswesens blockieren und auf langfristigem Patentschutz bestehen, der – sogar während einer Pandemie – die Herstellung von Generika und Impfstoffen verhindert. Wenn die Banken zu groß sind und deshalb nicht scheitern dürfen, werden sie sich auf riskante Spekulationen einlassen, weil sie wissen, dass die Steuerzahler für den Schaden einstehen müssen, wenn ihre Wetten schiefgehen. Und sie werden Versuche abwehren, ihrem verantwortungslosen Handeln mit Regulierungen zu begegnen.
Im Verlauf der amerikanischen Geschichte haben Politiker, Aktivisten und Reformer die zivilgesellschaftlichen Folgen von Unternehmensmacht erörtert. So wollte die Anti-Kartellbewegung in ihren Anfängen die politische Macht von Großunternehmen im Zaum halten. Ihre Hauptsorge galt nicht in erster Linie einer Verhinderung hoher Verbraucherpreise. Nach dem Zweiten Weltkrieg verblasste die zivilgesellschaftliche Begründung für das Kartellrecht, und die verbraucherpolitische Begründung gewann die Oberhand.
Doch heute erinnert uns der Aufstieg der Großtechnologie und der sozialen Medien daran, dass der Fluch der Größe nicht allein höhere Verbraucherpreise einschließt. Facebook ist kostenlos. Die Schäden, die es anrichtet, betreffen die Demokratie. Seine große, ungeregelte Macht ermöglicht, dass unsere Wahlen aus dem Ausland beeinflusst und dass Hasskampagnen, Verschwörungsmythen, Fake News und Desinformation in beispiellosem Maßstab ungefiltert verbreitet werden. Diese gefährlichen zivilgesellschaftlichen Folgen werden inzwischen erkannt. Weniger offensichtlich ist, wie sehr unsere Aufmerksamkeitsspanne zersetzt wird. Wenn man unsere Aufmerksamkeit in Beschlag nimmt, unsere persönlichen Daten abgreift und sie an Werbefirmen verkauft, die uns Anzeigen im Sinne unserer Vorlieben unterjubeln, dann bedroht das nicht nur unsere Privatsphäre; es untergräbt auch die geduldige, aufmerksame Einstellung gegenüber der Welt, die für demokratische Beratungen notwendig ist.
Wir sind nicht daran gewöhnt, uns der zivilgesellschaftlichen Folgen ökonomischer Macht anzunehmen. Unsere Debatten über Wirtschaftspolitik betreffen zumeist das Wirtschaftswachstum und – in geringerem Maß – die Verteilungsgerechtigkeit. Wir diskutieren, wie der Kuchen zu vergrößern ist und wie die Stücke zu verteilen sind. Doch wenn wir mit diesem Ansatz über die Wirtschaft nachdenken, erfassen wir einen zu schmalen Ausschnitt. Denn er geht fälschlicherweise davon aus, dass Wirtschaft dazu da sei, das Wohlergehen der Verbraucher zu maximieren. Doch wir sind nicht nur Konsumenten – wir sind auch demokratische Bürger.
Als Bürger haben wir ein Interesse am Aufbau einer Wirtschaft, die dem Projekt der Selbstverwaltung freundlich gegenübersteht. Das heißt, dass wirtschaftliche Macht demokratischer Kontrolle unterworfen sein muss. Außerdem erfordert es, dass alle imstande sein müssen, sich unter würdigen Bedingungen ein anständiges Leben zu verdienen, am Arbeitsplatz und in öffentlichen Angelegenheiten mitzureden und Zugang zu einer breit gestreuten zivilgesellschaftlichen Bildung zu haben, die sie befähigt, über das Gemeinwohl zu verhandeln.
Herauszufinden, welche wirtschaftlichen Abkommen am besten zur Selbstverwaltung passen, ist eine umstrittene Angelegenheit. Im Vergleich zu den bekannten Debatten darüber, wie das BIP zu fördern, die Beschäftigung zu steigern und die Inflation zu vermeiden sei, sind Auseinandersetzungen über die zivilgesellschaftlichen Folgen der Wirtschaftspolitik weniger fachtechnisch und eher politisch. Diese breitere zivilgesellschaftliche Tradition der wirtschaftlichen Auseinandersetzung bezeichne ich als »die politische Ökonomie der Bürgergesellschaft«.
Diese – wenn auch in den letzten Jahrzehnten verborgene – Tradition hat die Terminologie des öffentlichen Diskurses in der Geschichte Amerikas lange geprägt. Obwohl sie gelegentlich zur Verteidigung anrüchiger Anliegen herangezogen wurde, hat sie auch radikale demokratische Reformbewegungen inspiriert. Democracy’s Discontent (dt. Das Unbehagen in der Demokratie) zielt unter anderem auf die Frage ab – das gilt sowohl für die erste als auch für die neue Ausgabe –, ob der demokratische und befähigende Aspekt unserer zivilgesellschaftlichen Tradition dazu beitragen kann, dass wir uns eine Alternative zu der heute vertrauten neoliberalen, technokratischen Art ökonomischer Argumentation vorstellen können.
1.Die politische Ökonomie der Bürgergesellschaft
Turbulente Zeiten veranlassen uns, die Ideale aufzurufen, nach denen wir leben. Doch im heutigen Amerika ist das nicht so einfach. In einer Zeit, in der demokratische Ideale in anderen Ländern wanken, kann man sich aus gutem Grund fragen, ob wir sie zu Hause verloren haben. Unser öffentliches Leben ist von Unzufriedenheit geprägt. Die Amerikaner glauben nicht, dass sie bei der Art, in der sie regiert werden, viel mitzureden hätten, und trauen der Regierung nicht zu, dass sie das Richtige tut.[1] Das Vertrauen in unsere Mitbürger nimmt immer schneller ab.[2]
Inzwischen sind die politischen Parteien unfähig, unseren Verhältnissen einen Sinn zu geben. Die Hauptthemen der nationalen Debatte – das richtige Maß des Wohlfahrtsstaates, das Ausmaß von Rechten und Ansprüchen, der richtige Umfang staatlicher Regulierung – beziehen ihre Form aus den Auseinandersetzungen früherer Tage. Diese Themen sind nicht unwichtig, aber die beiden Sorgen, die im Zentrum der Unzufriedenheit mit der Demokratie liegen, erfassen sie nicht. Das ist erstens die Befürchtung, dass wir individuell wie kollektiv die Kontrolle über die Mächte verlieren, die unser Leben bestimmen. Und zweitens das Gefühl, dass sich das moralische Geflecht um uns herum – von der Familie über das Stadtviertel bis zur Nation – auflöst. Diese beiden Befürchtungen – vor dem Verlust der Selbstbestimmung und der Erosion der Gemeinschaft – definieren gemeinsam die Ängste unseres Zeitalters. Es handelt sich um eine Angst, die von der vorherrschenden politischen Agenda nicht beantwortet oder auch nur aufgegriffen worden ist.
Warum ist Amerikas Politik schlecht dafür gerüstet, die Unzufriedenheit zu mildern, in der sie inzwischen versunken ist? Die Antwort findet sich jenseits der politischen Auseinandersetzungen unserer Zeit – in der Philosophie des Öffentlichen, die sie beseelt. Mit der Philosophie des Öffentlichen meine ich die politische Theorie, die unserer Praxis innewohnt, die Annahmen über Bürgerschaft und Freiheit, die unser öffentliches Leben bestimmen. Dass die zeitgenössische amerikanische Politik nicht imstande ist, überzeugend von Selbstbestimmung und Gemeinschaft zu sprechen, hat etwas mit der Philosophie des Öffentlichen zu tun, nach der wir leben.
Eine Philosophie des Öffentlichen ist ein schwer fassbarer Gegenstand, weil wir sie ständig vor Augen haben. Sie bildet den oft unbedachten Hintergrund für unseren politischen Diskurs und unsere Zwecke. In normalen Zeiten kann sich die Philosophie des Öffentlichen leicht der Aufmerksamkeit derer entziehen, die nach ihr leben. Doch Zeiten der Angst erfordern eine gewisse Klarheit. Sie bringen Grundprinzipien zwangsläufig an die Oberfläche und bieten eine Chance für kritische Reflexion.
Liberale und republikanische Freiheit
Die politische Philosophie, nach der wir leben, ist eine bestimmte Version der liberalen politischen Theorie. Ihr Kerngedanke besagt, dass der Staat gegenüber den von seinen Bürgern vertretenen moralischen und religiösen Ansichten neutral sein sollte. Weil die Menschen uneinig über die beste Lebensweise sind, sollte der Staat keine spezielle Sicht eines guten Lebens per Gesetz bekräftigen. Vielmehr sollte er einen Gesetzesrahmen schaffen, der die Menschen als freie und unabhängige Personen respektiert, die imstande sind, ihre eigenen Werte und Ziele zu wählen.[1] Da dieser Liberalismus den Vorrang fairer Prozeduren vor speziellen Zielen behauptet, könnte man das von ihm bestimmte Leben als prozedurale Republik bezeichnen.[2]
Wenn man die herrschende politische Philosophie als eine Version der liberalen politischen Theorie ansieht, ist es wichtig, zwei unterschiedliche Bedeutungen von Liberalismus auseinanderzuhalten. Im normalen Sprachgebrauch der amerikanischen Politik ist Liberalismus das Gegenteil von Konservatismus; es ist die Einstellung derer, die einen großzügigeren Wohlfahrtsstaat und einen größeren Umfang von sozialer und wirtschaftlicher Gleichheit vorziehen.[3] In der Geschichte der politischen Theorie hat der Liberalismus eine andere, weiter gefasste Bedeutung. In diesem historischen Sinn beschreibt der Liberalismus eine Denktradition, die Toleranz und Respekt für individuelle Rechte hervorhebt. Sie verläuft von John Locke, Immanuel Kant und John Stuart Mill bis zu John Rawls. Die Philosophie des Öffentlichen in der zeitgenössischen amerikanischen Politik ist eine Version dieser liberalen Denktradition, und unsere Debatten laufen innerhalb dieser Begriffe ab.
Die Vorstellung, Freiheit bestehe in unserer Fähigkeit, unsere eigenen Ziele zu wählen, kommt in unserer Politik und in unserem Recht stark zum Ausdruck. Ihr Geltungsbereich ist nicht auf diejenigen begrenzt, die in der amerikanischen Politik eher als Liberale denn als Konservative bekannt sind; sie findet sich im gesamten politischen Spektrum. So meinen Republikaner gelegentlich, eine Besteuerung von Reichen, um Wohlfahrtsprogramme zu finanzieren, sei eine Form von erzwungener Solidarität. Auf diese Weise werde die Freiheit der Leute verletzt, selbst zu entscheiden, was sie mit ihrem Geld machen. Demokraten meinen gelegentlich, der Staat solle allen Bürgern ein anständiges Niveau bei Einkommen, Wohnen und Gesundheit gewährleisten – wer durch wirtschaftliche Not gebrochen sei, sei nicht wirklich frei, auf anderen Gebieten eine Entscheidung zu treffen. Die beiden Seiten sind sich darüber uneinig, wie der Staat handeln sollte, um die individuelle Entscheidung zu respektieren. Doch beide gehen davon aus, Freiheit bestehe darin, dass die Menschen ihre Werte und Ziele selbst wählen.
Diese Sicht der Freiheit ist so vertraut, dass sie ein beständiges Merkmal der politischen und konstitutionellen Tradition Amerikas zu sein scheint. Doch die Amerikaner haben Freiheit nicht immer so verstanden. Als vorherrschende Philosophie des Öffentlichen ist die Version des Liberalismus, die unsere gegenwärtigen Debatten bestimmt, erst seit kurzem angekommen – eine Entwicklung aus der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Am besten erkennt man ihren unverwechselbaren Charakter in der Gegenüberstellung mit einer konkurrierenden politischen Theorie, die von ihr allmählich ersetzt wurde. Dabei handelt es sich um eine Version der republikanischen politischen Theorie.
Im Zentrum der republikanischen Theorie steht die Idee, dass Freiheit davon abhängt, an Selbstbestimmung teilzuhaben. An sich ist diese Vorstellung nicht inkonsistent mit der liberalen Freiheit. Die Teilnahme an Politik kann eine der Möglichkeiten sein, mit denen die Menschen entscheiden, ihre Ziele zu verfolgen. Doch nach der republikanischen politischen Theorie umfasst die gemeinsame Selbstverwaltung noch mehr. Sie bedeutet, dass Mitbürger über das Gemeinwohl beraten und dazu beitragen, das Schicksal der politischen Gemeinschaft zu gestalten. Doch um gut über das Gemeinwohl beraten zu können, braucht man mehr als nur die Fähigkeit, die eigenen Ziele zu wählen und die Rechte der anderen zu achten. Es erfordert Kenntnisse über öffentliche Angelegenheiten und auch ein Gefühl der Zugehörigkeit, Sorge für das Ganze, eine moralische Verbindung mit der Gemeinschaft, deren Schicksal auf dem Spiel steht. Die Teilhabe an der Selbstbestimmung erfordert demnach, dass die Bürger bestimmte Charaktereigenschaften oder zivilgesellschaftliche Tugenden besitzen oder sich aneignen. Das aber heißt, dass eine republikanische Politik gegenüber den von ihren Bürgern vertretenen Werten und Zielen nicht neutral sein kann. Die republikanische Vorstellung von Freiheit erfordert – anders als das liberale Konzept – formende Politik, eine Politik, die in den Bürgern die charakterlichen Eigenschaften kultiviert, die zur Selbstverwaltung notwendig sind.
Wozu ist die Wirtschaft da?
Der Kontrast zwischen der liberalen und der republikanischen Vorstellung von Freiheit legt zwei unterschiedliche Möglichkeiten nahe, über die Wirtschaft nachzudenken – zwei Antworten auf die Frage: »Wozu ist die Wirtschaft da?« Die liberale Antwort legte Adam Smith in Der Wohlstand der Nationen (1776) vor, wo er schrieb, dass »Ziel und Zweck aller Produktion … der Verbrauch [ist].«[1] John Maynard Keynes wiederholte diese Antwort im 20. Jahrhundert: »Um noch einmal das Offensichtliche festzuhalten: allein Konsum ist Ziel und Zweck aller wirtschaftlichen Tätigkeit.«[2] Dem würden die meisten zeitgenössischen Ökonomen zustimmen.
Doch das, was Keynes offensichtlich erschien, ist nicht die einzige Möglichkeit, den Zweck der Wirtschaft zu erfassen. Der republikanischen Tradition zufolge dient wirtschaftliche Tätigkeit nicht allein dem Konsum, sondern auch der Selbstbestimmung. Wenn Freiheit davon abhängt, dass wir zur gemeinsamen Selbstverwaltung fähig sind, sollte uns die Wirtschaft in die Lage versetzen, nicht nur Konsumenten, sondern auch Bürger zu sein. Das beeinflusst die Art und Weise, in der wir über Wirtschaftspolitik und ökonomische Regelungen debattieren. Als Verbraucher interessiert uns vor allem das, was die Wirtschaft hervorbringt: Wie verbessert sie das Wohl der Verbraucher, und wie wird das Nationalprodukt verteilt? Als Bürger interessiert uns auch die Struktur der Wirtschaft: Welche Arbeitsbedingungen ermöglicht die Volkswirtschaft, und wie organisiert sie produktive Tätigkeit?
Aus Sicht der zivilgesellschaftlichen Freiheit kann eine Wirtschaft nicht in dieser Weise neutral sein. Die Organisation der Arbeit formt die Art, in der wir einander sehen, die Art, wie wir gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung vergeben. Die Organisation von Produktion und Investitionen legt fest, ob Bürger bei der Gestaltung der Kräfte mitreden können, die ihr Leben lenken – am Arbeitsplatz wie in der Politik. In diesem Sinne ist das republikanische Konzept der Freiheit anspruchsvoller als die liberale Vorstellung. Eine ertragreiche, florierende Wirtschaft würde Verbrauchern ermöglichen, ihre persönlichen Vorlieben umfassender zu erfüllen als eine Volkswirtschaft mit geringerem BIP. Doch wenn die Arbeitsbedingungen in einer solchen Volkswirtschaft abstumpfend oder erniedrigend wären oder wenn die Struktur der Wirtschaft sich demokratischer Kontrolle entzöge, wäre sie unfähig, dem Streben nach der für die Freiheit entscheidenden Selbstbestimmung im republikanischen Sinn eine Antwort zu bieten.
In unserer politischen Tradition sind sowohl die liberale als auch die republikanische Vorstellung der Freiheit ständig präsent gewesen, wenn auch in wechselndem Maß und in relativer Bedeutung. Grob gesagt war das republikanische Denken in der früheren Geschichte Amerikas vorherrschend, der Liberalismus später. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist der zivilgesellschaftliche oder bildende Aspekt unserer Politik weitgehend dem Liberalismus gewichen, der auf Neutralität gegenüber konkurrierenden Vorstellungen des guten Lebens besteht.
Diese Verschiebung beleuchtet unser aktuelles politisches Problem. Denn ungeachtet ihrer Anziehungskraft, fehlt es der liberalen Sicht an den zivilgesellschaftlichen Ressourcen, mit denen die Selbstbestimmung aufrechterhalten werden kann. Dieser Mangel gibt ihr kaum Möglichkeiten, das Gefühl der Entmachtung aufzugreifen, das unser öffentliches Leben beeinträchtigt. Die Philosophie des Öffentlichen, nach der wir leben, ist nicht in der Lage die von ihr versprochene Freiheit zu sichern, weil sie den für Freiheit erforderlichen Sinn für Gemeinschaft und das zivilgesellschaftliche Engagement nicht vermitteln kann.
Wie die liberale Vorstellung der Freiheit das republikanische Konzept allmählich verdrängt hat, ist eine lange und verwickelte Geschichte. Es begann mit Debatten zwischen Jefferson und Hamilton über die Rolle des Finanzwesens im amerikanischen Leben und darüber, ob Amerika eine Nation der Manufakturen werden sollte. Diese Geschichte umfasst die Debatten der Jackson-Ära über das Bankenwesen und staatlich finanzierte Verbesserungen (im Jargon von heute »Infrastruktur«), gefolgt von brisanten Vorkriegs-Auseinandersetzungen zum moralischen Status von Sklaverei und Lohnarbeit. Als das Industriezeitalter eine Nationalökonomie formte, tauchten in den Debatten der Progressiven Ära liberale und republikanische Themen auf, die den richtigen Umgang mit Zusammenschlüssen von Unternehmen und Großkapital betrafen. Ansätze, wirtschaftliche Macht demokratischer Rechenschaft zu unterwerfen, bestimmten die Frühzeit des New Deal; sie verloren jedoch bald gegen eine stärker werdende Fokussierung darauf, wie die makroökonomische Nachfrage zu steuern war. Nach dem Zweiten Weltkrieg machte die politische Ökonomie der Bürgergesellschaft einer politischen Ökonomie des Wachstums Platz. Im Zeitalter der Globalisierung wäre der zivilgesellschaftliche Aspekt der ökonomischen Auseinandersetzung durch den zunehmenden Glauben an Märkte und an eine stärkere Rolle für das Finanzwesen fast ausgelöscht worden. Dass die hohlen, technokratischen Begriffe des öffentlichen Diskurses öffentliche Frustration hervorrufen, legt jedoch nahe, dass das Streben nach Selbstbestimmung anhält.
Die folgende Interpretation der politischen Tradition Amerikas ist ein Versuch, unsere derzeitigen politischen Verhältnisse zu diagnostizieren. Außerdem ist sie ein Versuch, gewisse zivilgesellschaftliche Ideale und Möglichkeiten zurückzufordern – nicht aus Nostalgie, sondern in der Hoffnung, über unseren Weg jenseits des privatisierten und polarisierten politischen Momentums nachzudenken. Die historische Bilanz, die ich vorlege, zeigt kein Goldenes Zeitalter, in dem mit der amerikanischen Demokratie alles in Ordnung war. Die republikanische Tradition existierte zusammen mit der Sklaverei, mit dem Ausschluss der Frauen aus dem Bereich des Öffentlichen, mit vermögensrechtlichen Bestimmungen für die Stimmabgabe und mit Fremdenfeindlichkeit; tatsächlich stellte sie manchmal die Begriffe bereit, mit denen diese Praktiken begründet wurden.
Doch die republikanische Tradition mit ihrer Betonung von Gemeinschaft und Selbstverwaltung könnte – ungeachtet all ihrer düsteren Episoden – ein Korrektiv für unser verarmtes zivilgesellschaftliches Leben darstellen. Wenn wir uns die republikanische Vorstellung der Freiheit als Selbstverwaltung in Erinnerung rufen, könnte uns das veranlassen, Fragen zu stellen, die wir zu stellen vergessen haben: Welche ökonomischen Abmachungen sind günstig für die Selbstbestimmung? Wie könnte unser politischer Diskurs die von den Menschen in die Öffentlichkeit getragenen moralischen und religiösen Überzeugungen aufgreifen, statt ihnen auszuweichen? Und wie könnte das öffentliche Leben einer pluralistischen Gesellschaft in Bürgern das erweiterte Selbstverständnis pflegen, das für zivilgesellschaftliches Engagement notwendig ist? Wenn die Philosophie des Öffentlichen heute wenig Raum für zivilgesellschaftliche Erwägungen lässt, könnte es hilfreich sein, sich daran zu erinnern, wie frühere Generationen von Amerikanern solche Fragen erörtert haben – bevor die prozedurale Republik Fuß fasste.
2.Wirtschaft und Tugend in der frühen Republik
Sehen wir uns an, wie wir heute über die Wirtschaft nachdenken und streiten, und vergleichen es damit, wie die Amerikaner während eines großen Teils ihrer Geschichte über Wirtschaftspolitik debattiert haben. In der heutigen amerikanischen Politik kreisen unsere ökonomischen Auseinandersetzungen meist um zwei Erwägungen: Wohlstand und Fairness. Welche Steuerpolitik, Haushaltsvorschläge oder Regulierungspläne die Leute auch bevorzugen mögen – gewöhnlich setzen sie sich für etwas ein, weil die Maßnahmen zum Wirtschaftswachstum beitragen oder die Einkommensverteilung verbessern; die Menschen behaupten, ihre Politik würde den Kuchen der Wirtschaft vergrößern, die Kuchenstücke fairer verteilen oder beides zusammen. Diese Rechtfertigungen von Wirtschaftspolitik sind uns so vertraut, das es aussehen könnte, als seien die Möglichkeiten damit erschöpft. Doch unsere Debatten über Wirtschaftspolitik waren nicht immer auf Größe und Verteilung des Nationalprodukts fokussiert. In der amerikanischen Geschichte befassten sie sich oft auch mit einer anderen Frage: Welche wirtschaftlichen Regelungen wirken sich am günstigsten auf die Selbstverwaltung aus? Zusammen mit Wohlstand und Fairness haben die zivilgesellschaftlichen Folgen der Wirtschaftspolitik im politischen Diskurs Amerikas oft eine große Rolle gespielt.
Thomas Jefferson verlieh dem zivilgesellschaftlichen Aspekt der ökonomischen Auseinandersetzung seinen klassischen Ausdruck. In seinen Betrachtungen über den Staat Virginia (1787) sprach er sich dagegen aus, im großen Maßstab inländische Manufakturen zu entwickeln, weil die agrarisch geprägte Lebensweise rechtschaffene Bürger hervorbringe, die gut für die Selbstverwaltung geeignet seien. »Jene, die mit dem Erdboden arbeiten, sind das erwählte Volk Gottes«, die Verkörperung »wahrer Tugend«. Die politischen Ökonomen Europas könnten behaupten, dass jedes Land für sich selbst produzieren sollte, doch Manufakturen im großen Maßstab würden die Unabhängigkeit untergraben, die für die republikanische Bürgerschaft notwendig sei. »Abhängigkeit führt zu Willfährigkeit und Käuflichkeit, schnürt dem Keim der Tugend die Luft ab und schafft geeignete Werkzeuge für die Ränke des Ehrgeizes.« Jefferson hielt es für besser, wenn »unsere Werkstätten in Europa bleiben«, womit die moralische Korruption, die mit ihnen einhergehe, vermieden werde. Es sei besser, die hergestellten Waren einzuführen als die Manieren und Gewohnheiten, die ihre Herstellung begleiten.[1]
Dass Jeffersons Lob diejenigen, »die mit dem Erdboden arbeiten«, als rechtschaffene republikanische Bürger pries, stand in starkem Gegensatz zu dem Arbeitssystem, das seine Plantage in Monticello am Laufen hielt. Obwohl Jefferson die Sklaverei im Allgemeinen beklagte – er bezeichnete sie als »gnadenlosen Despotismus«[2] –, besaß er während seiner Lebenszeit mehr als 600 versklavte Afro-Amerikaner. Sie bestellten sein Land, dienten in seinem Haus und arbeiteten in seiner Nagelfabrik. Angesichts des Systems rassischer Unterordnung, das sie vom öffentlichen Leben ausschloss, konnte sie die Arbeit – ob gelernt oder ungelernt –, zu der sie gezwungen wurden, kaum in die Lage versetzen, Bürger zu sein. Wie Jeffersons wohlklingende Worte in der Unabhängigkeitserklärung drückte seine politische Ökonomie der Bürgerschaft ein Ideal aus, das weit von seiner Lebensführung entfernt war.[3] Doch das Ideal stand für attraktive zivilgesellschaftliche Bestrebungen: Wirtschaftliche Regelungen sollten zumindest teilweise nach der Art der von ihnen hervorgebrachten Bürger beurteilt werden.
Jeffersons Gründe gegen Produktion in großem Maßstab spiegelte eine Einstellung zur Politik wider, die in der klassischen republikanischen Tradition verwurzelt war. Im Mittelpunkt der republikanischen Theorie steht der Gedanke, dass Freiheit Selbstbestimmung erfordert, die wiederum von der Tugend des Gemeinsinns abhängig ist. Diese Idee herrschte in den politischen Ansichten der Gründergeneration vor. »Öffentliche Tugend ist die einzige Grundlage der Republik«, schrieb John Adams kurz vor der Unabhängigkeit. »Es muss eine positive Leidenschaft für das Gemeinwohl, für das öffentliche Interesse, für Ehre, Macht und Ruhm vorhanden sein – im Denken der Menschen etabliert sein, oder es kann weder einen republikanischen Staat noch echte Freiheit geben.«[4] Dem stimmte Benjamin Franklin zu: »Nur tugendhafte Menschen sind zur Freiheit fähig. Wenn Nationen korrupt und lasterhaft werden, benötigen sie mehr Herren.«[5]
Auch aus der republikanischen Tradition lernten die Gründer, dass sie bürgerliche Tugenden nicht als gegeben ansehen konnten. Im Gegenteil – Bürgersinn war ein zerbrechliches Ding, immer in Gefahr, durch korrumpierende Kräfte wie Luxus, Reichtum und Macht geschwächt zu werden. Die Angst, der Bürgersinn könne verloren gehen, war ein ständiges republikanisches Thema. »In einer Republik sind Tugend und schlichte Umgangsformen in allen Rängen und Graden der Menschen unabdingbar notwendig«, schrieb John Adams. »Doch in allen Rängen und Graden der Menschen, selbst in Amerika, gibt es so viel Schurkerei, so viel Käuflichkeit und Korruption, so viel Geiz und Ehrgeiz, eine solche Gier nach Profit und Kommerz, dass ich manchmal bezweifle, ob es ausreichend Bürgersinn gibt, um eine Republik zu tragen.«[6]
Wenn Freiheit nicht ohne Tugend überleben kann und Tugend immer zum Verfall tendiert, dann steht die republikanische Politik vor der Herausforderung, den moralischen Charakter der Bürger zu bilden oder umzubilden, um deren Bindung an das Gemeinwohl zu stärken. Das öffentliche Leben einer Republik muss eine formative Rolle erfüllen, die darauf abzielt, Bürger einer bestimmten Art heranzuziehen. »Die Rolle eines großen Politikers besteht darin, den Charakter seines Volkes zu formen«, verkündete Adams, »in den Menschen die Verrücktheiten und Laster auszulöschen, die er sieht, und in ihnen die Tugenden und Fähigkeiten zu schaffen, die er für wünschenswert erachtet.«[7] Eine republikanische Regierung könne gegenüber dem moralischen Charakter ihrer Bürger oder den von ihnen verfolgten Zielen nicht neutral sein. Sie müsse vielmehr darangehen, ihren Charakter und ihre Ziele zu bilden, um die öffentlichen Angelegenheiten zu fördern, von denen die Freiheit abhängt.
Die Revolution war selbst aus der Angst vor dem Verlust des Bürgersinns hervorgegangen – als verzweifelter Versuch, die Korruption zu bekämpfen und republikanische Ideale zu verwirklichen.[8] In den 1760er und 1770er Jahren verstanden die amerikanischen Siedler ihren Kampf mit England in republikanischen Begriffen. Die englische Verfassung war durch ministerielle Manipulation des Parlaments gefährdet, und was schlimmer war, das englische Volk war inzwischen »zu korrupt und zu geschwächt, um seine Verfassung auf ihre Grundsätze zurückzuführen und ihr Land zu verjüngen«.[9] In dem auf das »Stempelgesetz« folgenden Jahrzehnt erschienen den Siedlern die Versuche des Parlaments, in Amerika Souveränität auszuüben, als »Verschwörung der Macht gegen die Freiheit«, als kleiner Teil eines größeren Angriffs auf die englische Verfassung selbst. Dieser Glaube war es »vor allem anderen, der die [Siedler] schließlich in die Revolution trieb«.[10]
Die republikanischen Prämissen schürten nicht nur die Befürchtungen der Siedler – sie bestimmten auch die Ziele der Revolution. »Wesenskern des Republikanismus war, eigene Interessen für das höhere Gut des Ganzen zu opfern, und das umfasste für Amerikaner das idealistische Ziel ihrer Revolution … Abgesehen von ›Freiheit‹ beschworen die Revolutionäre keinen Ausdruck häufiger herauf als ›das Gemeinwohl‹«, das für sie mehr bedeutete als die Summe individueller Interessen. In der Politik kam es nicht darauf an, zwischen konkurrierenden Interessen zu vermitteln, sondern darauf, über sie hinauszugehen und das Wohl der Gemeinschaft insgesamt anzustreben. Die Unabhängigkeit sollte mehr sein als der Bruch mit England, nämlich eine Quelle moralischer Erneuerung; sie sollte Korruption abwenden und den moralischen Geist erneuern, der Amerikaner für den republikanischen Staat tauglich machte.[11]
Ambitionierte Hoffnungen dieser Art mussten zwangsläufig enttäuscht werden, was in den Jahren unmittelbar nach der Unabhängigkeit auch eintrat. Als es der Revolution nicht gelang, die von ihren Anführern erhoffte moralische Reformation hervorzubringen, kamen neue Befürchtungen um das Schicksal der republikanischen Regierung auf. Während der »kritischen Periode« der 1780er Jahre zeigten sich führende Politiker und Autoren besorgt, dass der vom Kampf gegen England beseelte Bürgersinn dem ausufernden Streben nach Luxus und Eigeninteresse gewichen war. »Welch erstaunliche Veränderungen wenige Jahre mit sich bringen können«, sagte George Washington 1786. »Von dieser Höhe, auf der wir standen, von dem geebneten Pfad, der unsere Schritte einlud, so tief gefallen zu sein, so verloren! Das ist wahrhaft beschämend!«[12]
Bürgersinn und Verfassung
Die wachsenden Zweifel an den Aussichten der Bürgertugend in den 1780er Jahren lösten zweierlei Reaktionen aus – die eine formativ, die andere prozedural. Die erste war bestrebt, durch Erziehung und andere Mittel die Tugenden nachdrücklicher zu vermitteln. Die andere wollte Tugenden mit Hilfe von Verfassungsänderungen weniger notwendig machen.
In seinem Vorschlag für öffentliche Schulen in Pennsylvania verlieh Benjamin Rush dem formativen Impuls starken Ausdruck. Er erklärte 1786, die einer Republik angemessene Erziehungsweise vermittle vorrangige Gefolgschaft für das Gemeinwohl: »Man möge unseren Schüler lehren, dass er sich nicht selbst gehört, sondern öffentliches Eigentum ist. Man lehre ihn, seine Familie zu lieben, doch man lehre ihn gleichzeitig, dass er sie aufgeben und sogar vergessen muss, wenn das Wohlergehen seines Landes dies erfordert.« Mit einem entsprechenden System öffentlicher Erziehung, behauptete Rush, sei es »möglich, Männer in republikanische Maschinen zu verwandeln. Das hat zu erfolgen, wenn wir von ihnen erwarten, dass sie ihre Rolle in der großen Maschinerie der Staatsregierung angemessen ausführen.«[1]
Die ereignisreichste prozedurale Reaktion auf republikanische Befürchtungen wegen des mangelnden Bürgersinns war die Verfassung von 1787. Die Verfassung war mehr als ein Mittel gegen die Fehler der Artikel der Konföderation – sie hatte den weiter reichenden Ehrgeiz, »den Republikanismus Amerikas vor den tödlichen Auswirkungen von privatem Glücksstreben zu schützen«, vor den gewinnsüchtigen Beschäftigungen, welche die Amerikaner so sehr banden und sie vom Gemeinwohl ablenkten.[2]
Obwohl die Verfassung durch die Furcht angestoßen wurde, dass der Bürgersinn verloren gehen könnte, zielte sie nicht darauf ab, den moralischen Charakter der Menschen zu heben – zumindest nicht direkt. Stattdessen strebte sie nach Verfassungswerkzeugen, die den republikanischen Staat, um ihn zu schützen, weniger von der Tugend der Bevölkerung abhängig machen sollten.
Als die Gestalter der Verfassung sich in Philadelphia versammelten, waren sie zu dem Schluss gekommen, dass Bürgersinn etwas war, was von den meisten Leuten meist nicht erwartet werden konnte. Einige Jahre zuvor hatte Alexander Hamilton sich über die republikanische Hoffnung lustig gemacht, dass Tugend bei normalen Bürgern den Vorrang vor Eigeninteresse erhalten könnte: »Wir mögen predigen, bis wir des Themas – dass uneigennützige Einstellung in Republiken notwendig ist – überdrüssig sind, ohne einen Einzigen bekehrt zu haben. Der tugendhafte Verkünder wird weder sich selbst noch irgendeinen anderen davon überzeugen, sich mit einer doppelten Portion Haferbrei zu begnügen, anstatt für seine Dienste ein vernünftiges Gehalt zu bekommen. Wir könnten uns ebenso gut mit dem Gemeineigentum der Spartaner an Gütern und Frauen, mit ihren eisernen Münzen, ihren langen Bärten oder ihrer schwarzen Suppe begnügen.« Die republikanischen Vorbilder Griechenland und Rom seien für Amerika ebenso wenig geeignet, meinte Hamilton, wie das Beispiel der Hottentotten oder der Lappländer. Noah Webster, ein führender Anwalt der Verfassung, stimmte ihm zu: »Tugend, Patriotismus oder die Liebe zum eigenen Land waren nie ein festes, fortwährendes Prinzip und keine Stütze des Staates. Sie werden es auch nie sein, solange sich die Natur der Menschen nicht ändert.[3]
Im Federalist Nr. 51 erläuterte Madison, wie der republikanische Staat – im Gegensatz zu klassischen Lehren – schließlich seinen Frieden mit Interessen und Ambitionen machen könne. Freiheit würde nicht vom Bürgersinn abhängen, sondern auf einer Struktur von Mechanismen und Prozeduren beruhen, mit denen sich konkurrierende Interessen gegenseitig in Schach halten und ausbalancieren würden: »Ambition muss so gelenkt werden, dass sie der Ambition entgegenwirkt. Die Interessen der Menschen müssen mit den verfassungsmäßigen Rechten des Ortes verknüpft werden. Es mag ein schlechtes Licht auf die menschliche Natur werfen, dass solche Einrichtungen notwendig sein sollten, um den Missbrauch staatlicher Macht zu kontrollieren. Doch was ist der Staat anderes als die größte aller Spiegelungen menschlicher Natur? Wenn Menschen Engel wären, dann wäre kein Staat notwendig. Wenn Engel die Menschen regieren würden, wären weder innere noch äußere Kontrollen der Regierung notwendig.«[4] Laut Madison würde die Verfassung das »Fehlen besserer Motive« durch institutionelle Werkzeuge ausgleichen, mit denen »gegensätzliche und konkurrierende Interessen« gegeneinandergestellt würden. Die Aufteilung der Macht unter Exekutive, Legislative und Judikative, die Teilung der Macht zwischen den Regierungen der Föderation und der Länder, die Teilung des Kongresses in zwei Körperschaften mit unterschiedlichen Bestimmungen und Wahlbezirken sowie die indirekte Wahl des Senats gehörten zu den »Erfindungen der Vorsicht«. Mit ihnen sollte die Freiheit gesichert werden können, ohne dass man sich übermäßig auf die Tugend der Bürger verlassen musste. »Abhängigkeit vom Volk ist zweifellos die vorrangige Kontrolle über den Staat«, räumte Madison ein, »doch die Erfahrung hat die Menschheit gelehrt, wie notwendig zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen sind.«[5]
Obwohl die Autoren der Verfassung klassische republikanische Annahmen revidierten, hielten sie in zwei wichtigen Punkten an republikanischen Idealen fest. Erstens glaubten sie weiterhin, dass die Tugendhaften regieren sollten und der Staat eine Art von Gemeinwohl anstreben sollte, das über die Summe privater Interessen hinausreichte. Zweitens gaben sie den Bildungsehrgeiz der republikanischen Politik nicht auf – die Vorstellung, dass die Regierung daran interessiert sei, Bürger einer bestimmten Art zu kultivieren.
Selbst Madison, der entscheidende Architekt jener Mechanismen, die »die Ansichten der Allgemeinheit verfeinern und erweitern«[6] sollten, bekräftigte, dass Tugend unter den Menschen für eine Selbstverwaltung unabdingbar sei. Zumindest, sagte er vor der Ratifizierungsversammlung in Virginia, benötigten die Menschen die Tugend und die Intelligenz, tugendhafte Vertreter zu wählen. »Gibt es denn unter uns keine Tugend? Wenn das so ist, dann sind wir in einer desolaten Lage. Keine theoretischen Kontrollen, keine Staatsform können uns Sicherheit geben. Die Annahme, irgendeine Staatsform werde Sicherheit oder Glück gewährleisten, ohne dass es im Volk Tugend gibt, ist eine trügerische Vorstellung.«[7] In seiner Abschiedsrede wiederholte George Washington die bekannte republikanische Sichtweise: »Tugend oder Moral ist eine notwendige Quelle der Regierung durch das Volk.«[8]
Hamilton wies dem Staat auch eine formative Rolle zu, obwohl die Eigenschaft, die er zu fördern hoffte, nicht der traditionelle Gemeinsinn war, sondern die Bindung an die Nation. Im Federalist Nr. 27 meinte er, die neue nationale Regierung würde ihre Autorität nur dann etablieren, wenn es ihr gelänge, das Leben und die Gefühle der Menschen zu durchdringen: »Je mehr die Bürger daran gewöhnt sind, in den normalen Vorfällen ihres politischen Lebens auf sie zu treffen, je mehr sie mit ihrer Sicht und ihren Gefühlen vertraut wird, je weiter sie in genau die Themen eindringt, welche die empfindsamsten Saiten berühren und die aktivsten Quellen des menschlichen Herzens in Wallung versetzen, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie die Achtung und die Bindung an die Gemeinschaft vermittelt.« Für Hamilton hing der Erfolg der nationalen Regierung davon ab, wie gut sie die Gewohnheiten der Menschen formen, ihre Empfindungen wecken, ihre Zuneigung gewinnen konnte, »um durch jene Kanäle und Strömungen zu [zirkulieren], in denen die Passionen der Menschheit von Natur aus fließen«.[9]
Obwohl die Verfassungsväter glaubten, der republikanische Staat brauche eine bestimmte Art von Bürger, sahen sie die Verfassung nicht als das entscheidende Werkzeug für moralische oder zivilgesellschaftliche Besserung. Für die formative Dimension des öffentlichen Lebens sahen sie sich anderswo um – bei Bildung, Religion und in einem weiteren Sinn bei den sozialen und ökonomischen Regelungen, die den Charakter der neuen Nation definieren sollten.
Föderalisten gegen Jeffersonianer
Nach der Ratifizierung ging die politische Debatte Amerikas von Verfassungsfragen zu ökonomischen Fragen über. Doch die wirtschaftliche Debatte drehte sich nicht nur um Volksvermögen und Verteilungsgerechtigkeit; sie befasste sich auch mit den zivilgesellschaftlichen Folgen wirtschaftlicher Regelungen – damit, welche Art von Gesellschaft in Amerika entstehen und welche Art von Bürgern sie fördern sollte.[1]
Zwei wichtige Themen zeigen, wie stark zivilgesellschaftliche Erwägungen im politischen Diskurs der frühen Republik vertreten waren. Das erste war die Debatte über Hamiltons Finanzsystem – daraus ging die Spaltung zwischen Föderalisten und Republikanern hervor. Das zweite betraf die Debatte darüber, ob man Fabrikationsstätten im eigenen Land zulassen sollte – eine Debatte, die über Parteigrenzen hinweg verlief.
Hamiltons Finanzsystem
Als erster Finanzminister machte Hamilton dem Kongress Vorschläge zu öffentlichen Schulden, einer Nationalbank, einer Münzanstalt und zur Warenproduktion. Obwohl alle außer dem letzten angenommen wurden, entzündeten die Vorschläge eine Menge Kontroversen; insgesamt führten sie Gegner zu dem Schluss, Hamilton sei bestrebt, den republikanischen Staat zu untergraben. Sein Programm für die Staatsfinanzen erwies sich als besonders umstritten. Es weckte Befürchtungen, dass Hamilton plane, in Amerika eine politische Ökonomie wie in Großbritannien zu schaffen – beruhend auf Patronage, Einflussnahme und Verbindungen. In seinem Report on Public Credit (1790) schlug er vor, die Bundesregierung solle die aus der Revolution stammenden Schulden der Staaten übernehmen und sie mit den vorhandenen Bundesschulden zusammenlegen. Weiter schlug er vor, die konsolidierten Schulden nicht zu tilgen, sondern sie mit dem Verkauf von Wertpapieren an Investoren zu finanzieren. Mit Einkünften aus Zöllen und Verbrauchssteuern sollten dann die laufenden Zinsen beglichen werden.[2]
Um seinen Finanzierungsplan zu untermauern, legte Hamilton vielfältige ökonomische Argumente vor – er würde die Kreditwürdigkeit der Nation herstellen, einen Währungsvorrat schaffen, eine Quelle für Investitionen bieten und so das Fundament für Wohlstand und Reichtum schaffen. Doch über diese ökonomischen Überlegungen hinaus verfolgte Hamilton ein ebenso wichtiges politisches Ziel – er wollte dafür sorgen, dass eine reiche und einflussreiche Klasse von Investoren ein finanzielles Interesse an der neuen nationalen Regierung hatte, um Unterstützung für sie aufzubauen.
Hamilton befürchtete, dass lokale Empfindungen die nationale Autorität schädigen könnten, und zweifelte, ob uneigennützige Tugend Loyalität gegenüber der Nation wecken konnte. Deshalb sah er in einem öffentlichen Finanzwesen ein Werkzeug zum Aufbau der Nation: »Wenn all die Gläubiger der öffentlichen Hand ihre Zinsen aus einer Quelle erhalten, werden sie alle das gleiche Interesse haben. Und da sie das gleiche Interesse haben, werden sie sich zusammentun, um die finanziellen Vereinbarungen des Staates zu unterstützen.« Wenn Schulden der Staaten und des Bundes getrennt finanziert würden, meinte er, »gibt es unterschiedliche Interessen, die unterschiedliche Wege vorzeichnen. Diese Einigkeit und der Einklang der Ansichten unter den Gläubigern … wird wahrscheinlich wechselseitiger Eifersucht und Gegnerschaft weichen.«[3]
Durch regelmäßige Zinszahlungen auf eine nationale Schuld würde die nationale Regierung »sich in die monetären Interessen jedes einzelnen Staates einbringen« und »sich in jeden Industriezweig einschleusen«, womit sie die Unterstützung einer wichtigen Klasse der Gesellschaft gewinne.[4] Eine wohlwollende Zeitung schrieb damals, »eine nationale Schuld bindet viele Bürger an die Regierung, die aufgrund ihrer Zahl, ihres Wohlstands und Einflusses möglicherweise mehr zu ihrer Erhaltung beitragen als eine Truppe von Soldaten«.[5]
Es war der politische Ehrgeiz Hamiltons, der die Kontroverse am stärksten anheizte. Was Hamilton als Aufbau der Nation ansah, hielten andere für eine Art von Bestechung und Korruption. Für eine Generation von Amerikanern, die der ausübenden Gewalt äußerst misstrauisch gegenüberstanden, erschien Hamiltons Finanzierungsplan wie ein Anschlag auf den republikanischen Staat. Er erinnerte an die Praxis des britischen Premierministers Robert Walpole im 18. Jahrhundert, der bezahlte Agenten der Regierung im Parlament unterbrachte, um die Politik der Regierung zu stützen. Die Tatsache, dass Gläubiger der Regierung im Kongress saßen und Hamiltons Finanzprogramm unterstützten – obwohl Hamilton nicht vorschlug, Kongressmitglieder anzuheuern –, kam Gegnern ähnlich korrupt vor. Solche Gläubiger seien keine uneigennützigen Förderer des Gemeinwohls, sondern interessierte Parteigänger der Verwaltung und der Politik, die ihre Investitionen absicherte.[6]
Republikanische Befürchtungen wegen einer Verschwörung der Macht gegen die Freiheit hatten die Revolution angetrieben. Jetzt schien Hamilton in Amerika erneut das englische System der Staatsfinanzierung – das die Republikaner wegen seiner Abhängigkeit von Patronage, Verbindungen und Spekulation verachteten – errichten zu wollen. Hamilton räumte ein, was seine Gegner befürchteten – dass Großbritannien sein Vorbild war. In einem Tischgespräch mit Adams und Jefferson verteidigte er sogar dessen Abhängigkeit von Patronage und Korruption. Adams stellte fest, die britische Verfassung sei, wenn man sie von der Korruption reinige, das Vollkommenste, was sich der menschliche Verstand ausgedacht habe. Hamilton erwiderte, »befreie sie von der Korruption und gib ihr eine gleichberechtigte Vertretung des Volkes, dann würde daraus eine nicht handlungsfähige Regierung. Wie sie gegenwärtig dasteht, mit all ihren vermeintlichen Mängeln, ist sie die vollkommenste Regierung, die es je gab.« Der entsetzte Jefferson kam zu folgendem Schluss: »Hamilton war nicht nur ein Monarchist, sondern für eine auf Korruption gegründete Monarchie.«[7]
Die Gegner des Hamilton’schen Finanzwesens brachten zwei unterschiedliche Argumente dagegen vor. Eines betraf dessen Folgen für die Verteilung, das andere seine zivilgesellschaftlichen Konsequenzen. Das Verteilungsargument wandte sich gegen die Tatsache, dass nach Hamiltons Plan die Reichen auf Kosten der gewöhnlichen Amerikaner gewinnen würden. Spekulanten, die von den ursprünglichen Besitzern Revolutionsanleihen zu einem Bruchteil ihres Wertes gekauft hatten, konnten jetzt riesige Profite einstreichen – mit Zinsen, die mit den von normalen Bürgern getragenen Verbrauchssteuern bezahlt werden sollten.
Gemessen an der Rolle, die sie in den politischen Debatten der 1790er Jahre spielte, war die Besorgnis wegen der Verteilung jedoch zweitrangig im Vergleich zu einem breiteren politischen Einwand. Das Argument, das Jeffersons Republikanische Partei ins Leben rief, lief darauf hinaus, dass Hamiltons politische Ökonomie die Moral der Bürger korrumpieren und die für eine republikanische Regierung entscheidenden sozialen Verhältnisse untergraben würde. Als die Republikaner einwandten, Hamiltons System würde die Ungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft vertiefen, ging es ihnen weniger um Verteilungsgerechtigkeit an sich, sondern um die Notwendigkeit, die großen Unterschiede der Vermögen zu vermeiden, die eine republikanische Regierung in Gefahr brachten. Zivilgesellschaftliche Tugend brauchte die Fähigkeit, unabhängige und uneigennützige Entscheidungen zu treffen. Doch Armut zeugte Abhängigkeit, und großer Reichtum zeugte Luxus und Ablenkung von öffentlichen Angelegenheiten.[8]
In einem Brief an Präsident Washington betonte Jefferson 1792 diese moralischen und zivilgesellschaftlichen Überlegungen. Hamiltons Finanzsystem, beklagte er, ermutige Wertpapierspekulation und »nährt in unseren Bürgern Gewohnheiten von Laster und Müßiggang statt von Fleiß und Moral«. Es schaffe eine »korrupte Schwadron« in der Legislative, deren letztes Ziel sei, »den Weg zu einem Wechsel vorzubereiten – von der aktuellen Regierungsform zu einer Monarchie, deren Vorbild die englische Verfassung sein soll«.[9]
Mitte der 1790er Jahre schlossen sich republikanische Autoren der Attacke an. Hamiltons Programm erschaffe eine Geldaristokratie, korrumpiere die Gesetzgebung, und es »fördert eine allgemeine Sittenverderbnis und einen starken Niedergang republikanischer Tugend«.[10] Effektenbesitzer im Kongress, die dem Finanzministerium zu Diensten sind, bildeten »eine große und beachtliche Truppe, vereint in einer engen Phalanx durch das Band wechselseitiger Interessen, die sich vom Interesse der Allgemeinheit unterscheiden«.[11] Der republikanische Publizist John Taylor fasste später die moralische und zivilgesellschaftliche Kritik des Finanzwesens der Föderalisten zusammen: »Die Manieren und Grundsätze werden imitiert und beeinflussen den Nationalcharakter … doch welche zu imitierenden Tugenden treten in der Aristokratie unseres gegenwärtigen Zeitalters auf? Wo Geiz und Ehrgeiz ihre ganze Seele ausmachen – welche private Moral wird so eingefüllt, und welcher Nationalcharakter wird damit erschaffen?«[12]