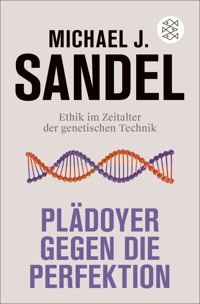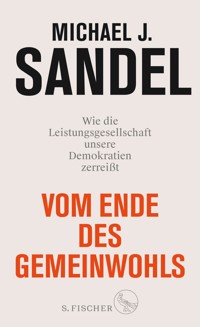16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Plädoyer des Bestseller-Autors und Philosophen Michael J. Sandel gegen die immer stärker um sich greifende Kommerzialisierung unserer Lebensbereiche In unserer Welt scheint heute so gut wie alles käuflich zu sein. Selbst Lebensbereiche, deren Wert eigentlich unbezifferbar ist – Gesundheit, Politik, Recht und Gesetz, Kunst, Sport, Erziehung, Familie und Partnerschaft – haben im freien Markt ihren Preis. Aus unserer Marktwirtschaft ist eine Marktgesellschaft geworden. Hellwach, lebensnah und zugänglich spürt Michael J. Sandel in seinem internationalen Bestseller »Was man für Geld nicht kaufen kann« den moralischen Grenzen des Marktes nach: Welche Rolle spielt er in unseren Demokratien? Wie frei darf er sein? Und wie können wir jene moralischen Güter und gesellschaftlichen Werte schützen, die man für Geld nicht kaufen kann?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Ähnliche
Michael J. Sandel
Was man für Geld nicht kaufen kann
Die moralischen Grenzen des Marktes
Über dieses Buch
Das Plädoyer des Bestseller-Autors und Philosophen Michael J. Sandel gegen die immer stärker um sich greifende Kommerzialisierung unserer Lebensbereiche
In unserer Welt scheint heute so gut wie alles käuflich zu sein. Selbst Lebensbereiche, deren Wert eigentlich unbezifferbar ist – Gesundheit, Politik, Recht und Gesetz, Kunst, Sport, Erziehung, Familie und Partnerschaft – haben im freien Markt ihren Preis. Aus unserer Marktwirtschaft ist eine Marktgesellschaft geworden. Hellwach, lebensnah und zugänglich spürt Michael J. Sandel in seinem internationalen Bestseller »Was man für Geld nicht kaufen kann« den moralischen Grenzen des Marktes nach: Welche Rolle spielt er in unseren Demokratien? Wie frei darf er sein? Und wie können wir jene moralischen Güter und gesellschaftlichen Werte schützen, die man für Geld nicht kaufen kann?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Michael J. Sandel, geboren 1953, ist politischer Philosoph. Er studierte in Oxford und lehrt seit 1980 in Harvard. Seine Vorlesungsreihe über Gerechtigkeit begeisterte online Millionen von Zuschauern und machte ihn zum weltweit populärsten Moralphilosophen. »Was man für Geld nicht kaufen kann« wurde zum internationalen Bestseller. Seine Bücher beschäftigen sich mit Ethik, Gerechtigkeit, Demokratie und Kapitalismus und wurden in 27 Sprachen übersetzt. Bei S. FISCHER erschien zuletzt sein Klassiker »Das Unbehagen in der Demokratie. Was die ungezügelten Märkte aus unserer Gesellschaft gemacht haben«.
Helmut Reuter, geboren 1946, arbeitet seit 1995 als freier Übersetzer aus dem Englischen und Französischen. Neben den Werken Michael J. Sandels hat er u.a. Bücher von John Hands, Lawrence M. Krauss oder Niall Ferguson übersetzt. Er lebt in der Nähe von München.
Inhalt
[Widmung]
Einführung: Märkte und Moral
Der Triumph des Marktes
Alles ist käuflich
Die Rolle der Märkte neu denken
1 Privilegien
Fast Track
Überholspuren
Das Geschäft mit dem Schlangestehen
Schwarzmarkt für Arzttermine
Ärzte auf Abruf
Marktkonformes Denken
Märkte vs. Warteschlangen
Märkte und Korruption
Was ist falsch am Schwarzhandel mit Eintrittskarten?
Zelten im Yosemite-Nationalpark
Papstmessen zu verkaufen
Bruce Springsteen
Die Ethik der Warteschlange
2 Anreize und Belohnungen
Bargeld für die Sterilisation
Die Ökonomie des Lebens
Geld für gute Schulnoten
Gesund leben
Perverse Anreize
Geldbußen vs. Gebühren
170000 Euro für zu schnelles Fahren
U-Bahn-Tickets und Videos
Die Ein-Kind-Politik in China
Die Lizenz zum Kinderkriegen
Handelbare Verschmutzungsrechte
Klimakompensation
Ein Nashorn schießen
Ein Walross schießen
Ökonomische und moralische Vernunft
3 Wie Märkte die Moral verdrängen
Was für Geld zu kaufen ist und was nicht
Gekaufte Entschuldigungen und Festreden
Geschenke …
… und Geldgeschenke
Gekaufte Ehren
Zwei Einwände gegen Märkte
Die Verdrängung marktfremder Normen
Endlager für atomare Abfälle
Spendentage
Der Kommerzialisierungseffekt
Handel mit Blut
Zwei Lehrsätze
Sparsamkeit in der Liebe
4 Das Geschäft mit dem Tod
Tote Bauern
Der Zweitmarkt für Lebensversicherungen
Wetten auf den Tod
Eine kurze Moralgeschichte der Lebensversicherung
Terminkontrakte auf Terrorakte
Das Leben der Anderen
Todesanleihen
Der Handel mit Memorabilien
The Name of the Game
VIP-Logen
Moneyball
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Was ist falsch an der Kommerzialisierung?
Kommunalsponsoring
Rettungsschwimmer und Ausschankrechte
U-Bahn-Stationen und Naturpfade
Streifenwagen und Hydranten der Feuerwehr
Gefängnisse und Schulen
Die gespaltene Gesellschaft
Danksagung
Sachregister
Für Kiku in Liebe
Einführung: Märkte und Moral
Manches ist für Geld nicht zu kaufen. Aber nicht mehr viel. Heutzutage steht fast alles zum Verkauf, wie die folgenden Beispiele zeigen:
Zellen-Upgrade im Knast: 82 Dollar pro Nacht. Im kalifornischen Santa Ana und einigen anderen Städten erhalten Strafgefangene, die kein Gewaltverbrechen begangen haben, gegen Bezahlung bessere Haftbedingungen – etwa eine saubere, ruhige Zelle abseits der weniger zahlungskräftigen Gefangenen.[1]
Benutzung der für Fahrgemeinschaften reservierten Spur als Alleinfahrer: acht Dollar während des Berufsverkehrs. Minneapolis und andere Städte versuchen Staus zu verringern, indem sie Alleinfahrer dafür bezahlen lassen, auf Sonderspuren fahren zu dürfen – die Preise variieren je nach Verkehrslage.[2]
Kosten für das Austragen eines Embryos durch eine indische Leihmutter: 6250 Dollar. Paare aus dem Westen, die Leihmütter suchen, tun dies zunehmend in Indien, wo diese Praxis legal ist und die Kosten nur ein Drittel dessen betragen, was man in den USA dafür bezahlt.[3]Das Recht, in die USA einzuwandern: 500000 Dollar. Ausländer, die 500000 Dollar investieren und mindestens zehn Arbeitsplätze in einer Region mit hoher Arbeitslosigkeit schaffen, erhalten auf Wunsch eine Green Card, die ihnen unbefristetes Aufenthaltsrecht gibt.[4]
Das Recht, ein Schwarzes Nashorn (eine bedrohte Tierart) zu schießen: 150000 Dollar. Südafrika erlaubt Ranchern inzwischen, Jägern das Recht zum Abschuss einer beschränkten Zahl von Nashörnern zu verkaufen, um den Landwirten dadurch einen Anreiz zu geben, die gefährdete Art zu züchten und zu schützen.[5]
Die Handynummer eines Arztes: ab 1500 Dollar pro Jahr. Für Patienten, die bereit sind, eine jährliche Gebühr von 1500 bis 25000Dollar zu entrichten, bieten immer mehr Hausärzte an, über Handy erreichbar zu sein und noch am selben Tag einen Termin mit ihnen zu vereinbaren.[6]
Das Recht, eine Tonne Kohlenstoff zu emittieren: 13 Euro. Die EU hat einen Emissionshandel für Kohlenstoff eingeführt, der es Firmen ermöglicht, das Recht zur Umweltverschmutzung zu verkaufen oder zu kaufen.[7]
Die Aufnahme an einer angesehenen Universität: ? Dollar. Der Preis wird nicht offiziell genannt, doch Vertreter von Spitzenunis haben dem Wall Street Journal erzählt, dass sie einige Studenten mit eher bescheidenem Notenschnitt aufnehmen, deren Eltern wohlhabend und spendabel sind.[8]
Nicht jeder kann es sich leisten, dergleichen zu kaufen. Zum Glück gibt es heutzutage zugleich massenhaft neue Wege, Geld zu verdienen. Wer ein wenig Extra-Cash benötigt, kann sich hier inspirieren lassen:
Vermietung der Stirn (oder anderer Körperteile) zu Werbezwecken: 777 Dollar. Die Air New Zealand heuerte dreißig Leute an, sich den Schädel rasieren zu lassen und auf diesem eine wieder entfernbare Tätowierung zur Schau zu stellen: »Abwechslung gefällig? Ab nach Neuseeland.«[9]
Menschliches Versuchskaninchen in einer Arzneimittelstudie für eine Pharmafirma: 7500 Dollar. Abhängig von der physischen Belastung durch das Testverfahren kann die Bezahlung auch höher oder niedriger ausfallen.[10]
In Somalia oder Afghanistan für ein privates Militärunternehmen kämpfen: von 250 Dollar pro Monat bis 1000 Dollar pro Tag. Die Bezahlung hängt von Qualifikation, Erfahrung und Staatsangehörigkeit ab.[11]
Nächtliches Schlangestehen am Capitol Hill in Vertretung eines Lobbyisten, der an einer Anhörung im Kongress teilnehmen will: 15 bis 20 Dollar pro Stunde. Die Lobbyisten bezahlen Warteschlangen-Firmen, die ihrerseits unter anderem Obdachlose anheuern, die sich in die Schlange stellen.[12]
Ein Buch lesen: zwei Dollar. Um Kinder zum Lesen zu ermuntern, werden Zweitklässler in Dallas in einer Schule mit unterdurchschnittlichem Leistungsniveau für jedes gelesene Buch bezahlt.[13]
In vier Monaten 14 Pfund abnehmen: 378 Dollar. Firmen und Krankenversicherungen bieten Übergewichtigen finanzielle Anreize zur Gewichtsreduzierung und anderen Arten gesunder Lebensführung.[14]
Sie kaufen die Lebensversicherungspolice einer erkrankten oder älteren Person, bezahlen die laufenden Prämien und kassieren nach dem Todesfall die Versicherungssumme: potenziell Millionen (je nach Police). Diese Art, auf das Leben Fremder zu wetten, ist zu einer Branche mit einem Volumen von 30 Milliarden Dollar geworden. Je früher der Unbekannte stirbt, desto mehr verdient der Anleger.[15]
Wir leben also heute in einer Zeit, in der fast alles ge- und verkauft werden kann. Im Lauf der letzten drei Jahrzehnte haben es die Märkte – und die damit verbundenen Wertvorstellungen – geschafft, unser Leben wie nie zuvor zu beherrschen. Nicht, dass wir uns bewusst dafür entschieden hätten. Es scheint einfach über uns gekommen zu sein.
Als der Kalte Krieg zu Ende ging, erfreuten sich die Märkte und das Marktdenken verständlicherweise eines hohen Ansehens. Kein anderes Organisationsprinzip hat bei der Produktion und Verteilung von Gütern ähnlich viel Überfluss und Wohlstand hervorgebracht. Doch während sich immer mehr Länder in aller Welt auf die Marktmechanismen verließen, geschah noch etwas anderes. Im Leben der Gesellschaft begannen die Wertvorstellungen des Marktes eine immer größere Rolle zu spielen. Ökonomie wurde zu einer Herrschaftswissenschaft. Inzwischen gilt die Logik des Kaufens und Verkaufens nicht mehr nur für materielle Güter – sie lenkt zunehmend das Leben insgesamt. Es wird Zeit, uns zu fragen, ob wir so wirklich leben wollen.
Der Triumph des Marktes
Die Jahre und Jahrzehnte vor der Finanzkrise von 2008 waren durch den unbedingten Glauben an die Märkte und die positiven Folgen der Deregulierung gekennzeichnet – es war eine Ära der triumphierenden Märkte. Sie begann Anfang der 80er Jahre, als Ronald Reagan und Margaret Thatcher ihre Überzeugung verkündeten, dass nicht Staaten, sondern Märkte der Schlüssel zu Wohlstand und Freiheit seien. In den 90ern setzte sich diese Ansicht mit dem Wirtschaftsliberalismus von Bill Clinton und Tony Blairfort, die den Glauben daran, dass Märkte das vorrangige Mittel zur Herstellung des Gemeinwohls seien, in moderater Form aufgriffen und konsolidierten.
Heute wird dieser Glaube in Frage gestellt. Die Ära der triumphierenden Märkte hat ein Ende gefunden. Die Finanzkrise säte nicht nur Zweifel an deren Fähigkeit, das Risiko effizient zu streuen, sondern löste bei vielen Menschen auch das Gefühl aus, dass die Märkte sich von der Moral abgekoppelt hätten und wir diese beiden Sphären irgendwie wieder miteinander verknüpfen müssten. Was das bedeuten könnte oder wie wir es zustande bringen sollten, ist allerdings unklar.
Manche halten das moralische Versagen der Märkte für die Folge von Gier, die dazu geführt habe, dass die Entscheidungsträger unverantwortliche Risiken eingingen. Dieser Ansicht nach besteht die Lösung darin, die Gier zu zügeln, auf die Integrität und die Verantwortung der Banker und Führungskräfte an der Wall Street zu bestehen und vernünftige gesetzliche Regeln einzuführen, mit denen sich verhindern ließe, dass sich eine ähnliche Krise wiederholt.
Diese Diagnose trifft bestenfalls teilweise zu. Obwohl Gier sicherlich eine Rolle in der Finanzkrise gespielt hat, geht es hier um etwas Größeres. Die schicksalhafteste Änderung der letzten drei Jahrzehnte war nicht die Zunahme der Gier. Es war die Ausdehnung der Märkte und ihrer Wertvorstellungen in Lebensbereiche, in die sie nicht gehören.
Um diesen Zustand zu ändern, müssen wir mehr tun, als gegen die Gier zu wettern; wir müssen die Rolle überdenken, die die Märkte in unserer Gesellschaft spielen sollten. Wir brauchen eine öffentliche Debatte darüber, was es heißt, die Märkte in ihre Schranken zu weisen. Und als Voraussetzung für diese Debatte müssen wir die moralischen Grenzen der Märkte durchdenken. Wir müssen uns fragen, ob es Dinge gibt, die für Geld nicht zu haben sein sollten. Das Übergreifen von Märkten und marktorientiertem Denken auf Aspekte des Lebens, die bislang von Normen außerhalb des Marktes gesteuert wurden, ist eine der bedeutsamsten Entwicklungen unserer Zeit.
Denken Sie an die Ausbreitung von gewinnorientierten Schulen, Kliniken und Gefängnissen und an die Auslagerung von Kriegshandlungen an private Militärunternehmen. (Im Irak und in Afghanistan waren mehr Angestellte privater Sicherheits- und Militärunternehmen im Einsatz als Soldaten der US-Armee.[1])
Denken Sie daran, dass öffentliche Polizeikräfte durch private Sicherheitsfirmen abgelöst werden – besonders in den USA und in England, wo es mittlerweile doppelt so viele private Sicherheitsleute wie Polizeibeamte gibt.[2] Denken Sie an die aggressive Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente. (Jemand, der in den USA die Fernsehwerbung vor den Abendnachrichten sieht, könnte glauben, das bei Weitem größte Gesundheitsproblem der Welt sei nicht die Malaria, die Onchozerkose oder die Schlafkrankheit, sondern eine grassierende Epidemie der erektilen Dysfunktion.)
Oder denken Sie an die Werbung in öffentlichen Schulen, an den Verkauf des Rechts, Parks und öffentlichen Einrichtungen »Namen zu geben«, die Vermarktung von Eiern und Sperma mit »definierten Eigenschaften«, die Auslagerung der Schwangerschaft an Ersatzmütter in Entwicklungsländern, den Handel von Unternehmen und Staaten mit Emissionsrechten oder das amerikanische System der Finanzierung von Wahlkämpfen, das beinahe den Eindruck erweckt, man könne das Wahlergebnis kaufen.
Vor dreißig Jahren waren wir noch weit davon entfernt, Gesundheit, Ausbildung, öffentliche Sicherheit, Strafvollzug, Umweltschutz, Freizeit, Fortpflanzung und andere gesellschaftliche Güter über die Märkte zuzuteilen. Heute halten wir das weitgehend für selbstverständlich.
Alles ist käuflich
Warum sollten wir uns darüber Sorgen machen, dass wir auf dem Weg in eine Gesellschaft sind, in der alles käuflich ist?
Aus zwei Gründen – einer davon hat mit Ungleichheit zu tun, der andere mit Korruption.
Zuerst die Ungleichheit: In einer Gesellschaft, in der alles käuflich ist, haben es Menschen mit bescheidenen Mitteln schwerer. Je mehr für Geld zu haben ist, desto schwerer fällt der Reichtum (oder sein Fehlen) ins Gewicht.
Bestünde der einzige Vorteil von Reichtum darin, Jachten, Sportwagen und teure Feriendomizile erstehen zu können, würden Ungleichheiten bei Einkommen und Vermögen nicht sehr viel bedeuten. Doch weil man mit Geld mittlerweile immer mehr kaufen kann – etwa politischen Einfluss, gute medizinische Versorgung, eine Wohnung in einer guten Wohngegend statt in einem Viertel mit hoher Kriminalität, Zugang zu Eliteschulen –, wird die Verteilung von Einkommen und Reichtum zu einem immer bedeutsameren Faktor. Wo alles von Wert ge- und verkauft wird, macht allein der Besitz von Geld den Unterschied aus.
Das erklärt, warum die letzten Jahrzehnte für Familien aus der Unter- oder Mittelschicht besonders schwierig gewesen sind. Nicht nur ist die Kluft zwischen Reichen und Armen größer geworden, die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche hat auch den Stachel der Ungleichheit zugespitzt, indem sie dem Geld eine bedeutendere Rolle zugewiesen hat.
Der zweite Grund, weshalb wir zögern sollten, alles zu kommodifizieren, also zur Handelsware zu machen, ist nicht so einfach darzustellen. Es geht dabei nicht um Ungleichheit und Fairness, sondern darum, dass Märkte tendenziell zersetzend wirken. Werden die guten Dinge des Lebens mit einem Preis versehen, können sie korrumpiert werden. Das liegt daran, dass Märkte nicht nur Güter zuteilen, sondern auch bestimmte Einstellungen gegenüber den gehandelten Gütern ausdrücken und diese verstärken. Bezahlt man Kinder fürs Bücherlesen, bringt man sie vielleicht dazu, mehr zu lesen, lehrt sie aber zugleich auch, Lesen eher als Fron zu betrachten und nicht als vorbehaltlos zu genießende Quelle von Zufriedenheit. Die Versteigerung von Studienplätzen an die Meistbietenden steigert vielleicht die Einkünfte eines College, könnte aber auch seine Integrität und den Wert seiner Abschlüsse schmälern. Das Anheuern ausländischer Söldner, die unsere Kriege ausfechten, mag das Leben unserer Bürger schonen, geht aber zu Kosten der staatsbürgerlichen Verantwortung aller.
Ökonomen gehen oft davon aus, dass Märkte keinen Einfluss auf die dort gehandelten Güter hätten. Doch das ist nicht wahr. Märkte hinterlassen ihren Stempel. Manchmal verdrängen die Werte des Marktes andere Werte, die wir lieber erhalten sollten.
Selbstverständlich sind die Menschen uneins darüber, welche Werte wir schützen sollten und warum. Um also entscheiden zu können, was für Geld zu haben – und nicht zu haben – sein sollte, müssen wir darüber nachdenken, welche Werte die unterschiedlichen Bereiche des sozialen und staatsbürgerlichen Lebens beherrschen sollten. Und genau darum geht es in diesem Buch.
Hier ein Ausblick auf die Antwort, die ich anzubieten habe: Wenn wir beschließen, dass bestimmte Güter ge- und verkauft werden dürfen, entscheiden wir – zumindest implizit –, dass es in Ordnung ist, sie als Waren zu behandeln, als Werkzeuge für den Profit und den Gebrauch. Doch nicht alle Güter werden angemessen bewertet, wenn man sie als Ware betrachtet.[1] Menschen zum Beispiel. Die Sklaverei war schrecklich, weil sie Menschen zu Waren degradierte, die auf Versteigerungen gehandelt wurden. Diese Menschen wurden nicht auf angemessene Art behandelt – nämlich als Personen, die Würde und Achtung verdienen –, sondern als Werkzeuge für den Profit und als Gebrauchsgegenstände.
Ähnliches gilt auch für andere Güter und Handlungsweisen. Wir erlauben nicht, dass Kinder auf dem Markt gehandelt werden. Selbst wenn die Käufer die erworbenen Kinder nicht misshandeln, wäre ein Kindermarkt Ausdruck und Förderung einer falschen Art und Weise, Kinder wertzuschätzen. Sie als Ware zu betrachten ist nicht angemessen – sie sind als Wesen zu sehen, die der Liebe und Fürsorge bedürfen. Oder nehmen wir die Rechte und Pflichten als Staatsbürger. Wer als Schöffe verpflichtet wird, darf keinen Ersatzmann anheuern, der ihn vertritt. Ebenso wenig erlauben wir es den Bürgern, bei einer Wahl ihre Stimme zu verkaufen, selbst wenn sich ein Käufer dafür finden ließe. Und warum nicht? Weil wir glauben, dass Bürgerpflichten nicht als Privateigentum betrachtet werden sollten, sondern vielmehr als Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. Outsourcing degradiert sie hingegen – sie werden dadurch auf falsche Weise wertgeschätzt.
Diese Beispiele illustrieren einen umfassenderen Zusammenhang: Manche Dinge werden beschädigt oder herabgesetzt, wenn man sie in Waren verwandelt. Um also entscheiden zu können, wo der Markt hingehört und wo er auf Abstand gehalten werden sollte, müssen wir darüber nachdenken, wie wir die fraglichen Güter bewerten – Gesundheit, Ausbildung, Familienleben, Natur, Kunst, Bürgerpflichten und so weiter. Dies sind moralische und politische und nicht bloß ökonomische Fragen. Um sie lösen zu können, müssen wir von Fall zu Fall diskutieren, welche moralische Bedeutung diese Güter besitzen und wie sie angemessen zu bewerten sind.
Eine solche Debatte fand in der Ära der triumphierenden Märkte nicht statt. Das führte dazu, dass wir – ohne es recht zu bemerken und ohne es je zu beschließen – allmählich keine Marktwirtschaft mehr hatten, sondern anfingen, eine Marktgesellschaft zu sein.
Der Unterschied: Eine Marktwirtschaft ist ein Werkzeug – ein wertvolles und wirksames Werkzeug – für die Organisation produktiver Tätigkeit. Eine Marktgesellschaft jedoch ist eine Lebensweise, in der das Wertesystem des Marktes in alle Aspekte menschlicher Bemühung eingesickert ist. Sie ist ein Ort, an dem alle sozialen Beziehungen marktförmig geworden sind.
Die große Debatte, die in der heutigen Politik nicht geführt wird, geht also um die Funktion und die Reichweite der Märkte. Wollen wir eine Marktwirtschaft oder eine Marktgesellschaft? Welche Rolle sollten Märkte im öffentlichen Leben und in persönlichen Beziehungen spielen? Wie können wir entscheiden, welche Güter handelbar und welche hingegen durch Werte beherrscht sein sollten, die nicht dem Markt unterliegen? Wo sollte die Verfügungsmacht des Marktes ihre Grenzen finden?
Um diese Fragen wird es im Folgenden gehen. Da sie umstrittene Vorstellungen von einer guten Gesellschaft und einem guten Leben berühren, kann ich keine definitiven Antworten versprechen. Ich hoffe aber, wenigstens eine öffentliche Diskussion dieser Fragen anzustoßen und einen philosophischen Rahmen anzubieten, innerhalb dessen sie geklärt werden können.
Die Rolle der Märkte neu denken
Selbst wenn Sie mit mir darin übereinstimmen, dass wir uns mit den großen Fragen über die Moral von Märkten auseinandersetzen müssen, bezweifeln Sie vielleicht, dass unser öffentlicher Diskurs der Aufgabe gewachsen ist. Diese Sorge ist legitim. Jeder Versuch, die Rolle und Reichweite der Märkte zu überdenken, sollte zunächst zwei einschüchternde Hindernisse zur Kenntnis nehmen: zum einen Macht und Prestige des Marktdenkens, die auch nach dem schlimmsten Marktversagen in 80 Jahren fortbestehen; zum anderen das Ressentiment und die Inhaltsleere, die unsere öffentlichen Debatten kennzeichnen. Diese beiden Phänomene sind nicht vollkommen unabhängig voneinander.
Das erste Hindernis erscheint rätselhaft. Die Finanzkrise von 2008 wurde weithin als moralisches Urteil über die unkritische Marktvergötzung betrachtet, die quer durch das politische Spektrum drei Jahrzehnte lang vorgeherrscht hatte. Der Beinahe-Zusammenbruch einst mächtiger Finanzfirmen der Wall Street und die Notwendigkeit, sie auf Kosten des Steuerzahlers zu retten, schien ganz sicher eine Neubewertung der Märkte anzustoßen. Sogar Alan Greenspan – als Vorsitzender der Federal Reserve der USA eine Art Hohepriester des Glaubens an die Märkte – bekannte, schockiert und fassungslos zu sein, dass sein Vertrauen in die Kraft der freien Märkte zur Eigenkorrektur sich als Irrtum herausgestellt habe.[1] Die durch und durch marktfreundliche britische Zeitschrift The Economist zeigte auf der Titelseite ein zu einer Pfütze zerfließendes Wirtschaftslehrbuch und darüber die Schlagzeile »What went wrong with economics?«.[2]
Die Ära der triumphierenden Märkte hatte ein verheerendes Ende genommen. Nun würde, so dachte mancher, ganz gewiss eine Zeit moralischer Bewertung anbrechen, eine Saison nüchternen, genaueren Nachdenkens. Doch es kam anders.
Der spektakuläre Zusammenbruch der Finanzmärkte schwächte den Glauben an die Märkte nur geringfügig. Tatsächlich diskreditierte die Finanzkrise den Staat mehr als die Banken. Laut Umfragen im Jahr 2011 gab die amerikanische Öffentlichkeit der US-Bundesregierung größere Schuld an den wirtschaftlichen Problemen des Landes als den Finanzinstituten der Wall Street – zwei von drei Befragten waren dieser Ansicht.[3]
Die Finanzkrise hatte die USA und einen großen Teil der Weltwirtschaft in den schlimmsten Abschwung seit der Weltwirtschaftskrise des letzten Jahrhunderts gestürzt und Millionen Menschen den Arbeitsplatz gekostet. Dennoch führte sie nicht dazu, dass wir grundsätzlich neu über die Märkte nachdachten. Ihre auffälligste politische Folge in den USA war stattdessen der Aufstieg der Tea-Party-Bewegung, deren Regierungsskepsis und Marktvertrauen selbst Ronald Reagan zum Erröten gebracht hätten. Im Herbst 2011 trug zudem die Bewegung »Occupy Wall Street« Protest in Städte der gesamten USA und rund um die Welt. Diese Demonstrationen richteten sich gegen die Macht der Großbanken und Unternehmen sowie gegen die wachsende Ungleichheit von Einkommen und Reichtum. Ungeachtet ihrer unterschiedlichen ideologischen Ausrichtung gaben sowohl die Tea-Party-Bewegung als auch Occupy Wall Street der populistischen Empörung gegen die Bankenrettung eine Stimme.[4]
Sieht man von diesen Protestbekundungen ab, blieben ernsthafte Debatten über Rolle und Reichweite der Märkte jedoch weitgehend aus. Demokraten wie Republikaner streiten in den USA wie üblich über Steuern, Ausgaben und Budgetdefizite, nur dass sie es jetzt mit noch größerer Parteilichkeit tun und weniger denn je dazu fähig sind, das Volk von ihrer Sache zu begeistern oder zu überzeugen. Die politische Desillusionierung hat sich vertieft, weil die Bürger sich zunehmend von einem politischen System im Stich gelassen fühlen, das nicht in der Lage ist, für das Gemeinwohl zu handeln oder die vordringlichsten Fragen der Gesellschaft anzugehen.
Dieser prekäre Zustand des öffentlichen Diskurses ist das zweite Hindernis für eine Debatte über die moralischen Grenzen von Märkten. In einer Zeit, in der politische Auseinandersetzung vor allem aus Schreiduellen im Kabelfernsehen, ätzenden Statements im Rundfunk und ideologischen Schlammschlachten auf den Gängen des Kongresses besteht, kann man sich nur schwer eine politische Debatte über so umstrittene Themen wie Fortpflanzung, Erziehung, Ausbildung, Gesundheit, Umwelt oder Bürgerpflichten vorstellen. Ich glaube aber, dass eine solche Debatte möglich ist und unser öffentliches Leben stärken würde.
Manche halten unsere Politik für übersättigt mit moralischen Überzeugungen: Zu viele Menschen glauben demnach zu tief und zu heftig an ihre eigenen Überzeugungen und wollen sie allen anderen aufzwingen. Ich meine, dass damit unsere missliche Lage falsch gedeutet wird. Das Problem unserer Politik ist nicht ein Übermaß moralischer Auseinandersetzung, sondern ein Mangel daran. Unsere Politik ist überhitzt, weil sie leerläuft – ihr fehlt es an moralischer und spiritueller Substanz. Sie schafft es nicht, sich auf die großen Fragen einzulassen, die den Menschen auf der Seele liegen.
Die moralische Entleerung der zeitgenössischen Politik hat mehrere Ursachen. Da ist zum einen der Versuch, Begriffe des guten oder richtigen Lebens aus dem öffentlichen Diskurs zu verbannen. In der Hoffnung, konfessionelle Zwistigkeiten zu vermeiden, bestehen wir häufig darauf, dass die Bürger von ihren moralischen und spirituellen Überzeugungen zu schweigen haben, wenn sie den öffentlichen Raum betreten. Doch es war genau dieses Widerstreben, Argumente über das gute Leben in die Politik einfließen zu lassen, was entgegen aller guten Absichten den Weg dafür bereitet hat, dass der Markt triumphieren und das marktkonforme Denken sich hartnäckig halten konnte.
Das marktkonforme Denken selbst lässt die moralische Auseinandersetzung auf seine eigene Weise aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Der Reiz der Märkte besteht unter anderem darin, dass sie keine Urteile zu den von ihnen befriedigten Vorlieben abgeben. Sie fragen nicht danach, ob bestimmte Güter höher oder anders bewertet werden sollten als andere. Wenn jemand bereit ist, für Sex oder eine Niere zu bezahlen, so fragt der Ökonom nur: »Wie viel?« Märkte erheben keinen mahnenden Zeigefinger. Sie unterscheiden nicht zwischen bewundernswerten und niedrigen Vorlieben. Jeder, der einen Handel abschließt, entscheidet selbst, welchen Wert er den gehandelten Dingen beimisst.
Diese neutrale Einstellung gegenüber Werten ist der Wesenskern des marktkonformen Denkens und erklärt weitgehend, warum es so attraktiv erscheint. Doch unser Widerstreben, uns auf von Moral und Glauben geprägte Auseinandersetzungen einzulassen, hat zusammen mit unserer Übernahme der Marktideologie einen hohen Preis gefordert: Es hat dem öffentlichen Diskurs die moralische und staatsbürgerliche Energie entzogen und zu der technokratischen und verwaltungstechnischen Politik geführt, die inzwischen viele Gesellschaften plagt.
Eine Debatte über die moralischen Grenzen der Märkte würde uns die gesellschaftliche Entscheidung ermöglichen, in welchen Bereichen Märkte dem Gemeinwohl dienen und wo sie nichts zu suchen haben. Außerdem würde sie unsere Politik beleben, weil konkurrierende Begriffe des guten Lebens in der Öffentlichkeit diskutiert würden. Denn wie sonst könnten solche Auseinandersetzungen geführt werden? Wenn man der Meinung ist, dass bestimmte Güter beschädigt oder entwertet werden, wenn man sie kauft oder verkauft, dann muss man auch überzeugt sein, dass es andere, bessere Arten gibt, damit umzugehen. Es ergibt kaum einen Sinn, von einer Entwertung gewisser Tätigkeiten – etwa der Elternschaft oder der staatsbürgerlichen Pflichten – zu reden, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass zum Beispiel die Rolle als Elternteil oder Staatsbürger besser oder schlechter erfüllt werden kann.
Noch immer entziehen sich diese Lebensbereiche weitgehend der Logik des Marktes. Eltern ist es nicht erlaubt, ihre Kinder zu verkaufen, und Staatsbürger dürfen ihre Stimme nicht veräußern. Der Grund dafür ist einfach: Wir glauben, ein Verkauf solcher Dinge bewerte sie auf falsche Weise und kultiviere schlechte Einstellungen.
Wollen wir die moralischen Grenzen von Märkten überdenken, müssen wir uns diesen Fragen stellen und gemeinsam und öffentlich darüber diskutieren, wie die von uns geschätzten sozialen Güter zu bewerten sind. Es wäre naiv, zu erwarten, dass selbst eine robust und offen geführte öffentliche Debatte zu Einigkeit bei jeder umstrittenen Frage führen würde. Sie würde aber ein gesünderes öffentliches Leben mit sich bringen. Und sie würde uns bewusst machen, welchen Preis wir dafür entrichten, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der alles zum Verkauf steht.
Wenn wir an die Moral der Märkte denken, fallen uns zuerst die Banken der Wall Street ein mit ihren rücksichtslosen Missetaten, die Hedgefonds und Rettungsaktionen und die Reform der Börsenregeln. Doch die moralische und politische Herausforderung, vor der wir stehen, ist profaner und gleichzeitig tiefgreifender: Es geht darum, Rolle und Reichweite der Märkte in unserem sozialen Handeln, unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und in unserem Alltagsleben zu überdenken.
1Privilegien
Niemand steht gerne in einer Warteschlange. Manchmal kann man freilich dafür bezahlen, um sich vordrängeln zu dürfen. Schon seit Langem ist bekannt, dass ein ansehnliches Trinkgeld für den Maître eines angesagten Edelrestaurants in Stoßzeiten die Wartezeit verkürzen kann. Solche Trinkgelder sind quasi Bestechungsgelder und werden diskret gehandhabt. Im Fenster weist kein Schild darauf hin, dass jemand, der bereit ist, dem Kellner am Empfang einen Fünfziger zuzustecken, sofort einen Tisch bekommt. In den letzten Jahren ist der Verkauf von derlei Sonderrechten jedoch zur vertrauten Praxis geworden.
Fast Track
Lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen machen Flugreisen zu einer Tortur. Allerdings muss nicht jeder in Serpentinen anstehen. Wer Tickets für die erste Klasse oder die Business Class kauft, hat Priorität und darf an den anderen vorbei zur Überprüfung schreiten. Bei British Airways nennt sich das »Fast Track« – ein Service, der Passagiere der oberen Preisklassen auch bei der Pass- und Einwanderungskontrolle die Warteschlange überspringen lässt.[1]
Die meisten können es sich jedoch nicht leisten, in der ersten Klasse zu fliegen, weshalb die Fluglinien begonnen haben, den Passagieren der Holzklasse die Möglichkeit einzuräumen, diese Privilegien zum Überspringen der Schlange extra zu erwerben. Für einen Aufschlag von 39 Dollar verkauft einem United Airlines vorrangiges Boarding für den Flug von Denver nach Boston. Dazu gehört auch das Recht, sich bei der Sicherheitskontrolle vorn einzureihen. Der Londoner Luton Airport bietet eine noch erschwinglichere Option für die Überholspur an: Wer sich nicht lange anstellen mag, bezahlt umgerechnet etwa 7 Euro und wandert an die Spitze der Schlange.[2]
Kritiker monieren, dass es bei der Sicherheitskontrolle in Flughäfen keine käufliche Überholspur geben sollte. Die Kontrollen seien ein Aspekt der nationalen Sicherheit und keine Annehmlichkeit wie etwa ein größerer Sitzabstand oder Vorrang beim Boarding. Die mit der Sicherheit an Bord verbundene Belastung sollten alle Passagiere gleichermaßen tragen. Die Fluglinien erwidern, jeder sei derselben Kontrollintensität unterworfen, nur die Wartezeit ändere sich halt je nach Preis. Solange jedermann den gleichen Körperscan durchlaufen müsse, sei die kürzere Wartezeit in der Security-Schlange ein Vorteil, den sie nach Belieben verkaufen dürften.[3]
Auch Freizeitparks haben damit angefangen, das Recht zum Vordrängeln käuflich anzubieten. Üblicherweise verbringen die Besucher vor den beliebtesten Attraktionen Stunden mit Warten. Mittlerweile gibt es in den Universal Studios Hollywood und anderen Vergnügungsparks jedoch eine Möglichkeit, die Wartezeit zu vermeiden: Man bezahlt ungefähr das Doppelte des normalen Eintrittsgeldes und erhält dafür einen Ausweis, mit dem man ans vordere Ende der Schlange springen kann. Ein beschleunigter Zugang zur Geisterbahn mag moralisch unproblematischer sein als der privilegierte Weg durch die Sicherheitskontrolle eines Flughafens, doch auch hier beklagen manche Beobachter diese Praxis, die ihrer Ansicht nach eine gesunde bürgerliche Gewohnheit zersetzt: »Vorbei die Zeiten, als die Schlange an der Kasse des Freizeitparks noch der große Gleichmacher war, wo jede Familie im Urlaub auf demokratische Weise wartete, bis sie an der Reihe war«, schrieb ein Kommentator.[4]
Interessant ist, dass viele Vergnügungsparks diese Praxis oft verschleiern. Um die gewöhnlichen Kunden nicht zu verprellen, komplimentieren sie ihre Premiumgäste durch Hintertürchen und gesonderte Tore; andere stellen einen Begleiter, der den Weg der VIP-Gäste an der Warteschlange vorbei erleichtert. Dieses Bedürfnis nach Diskretion legt nahe, dass das Vordrängeln gegen Bezahlung – sogar im Vergnügungspark – dem Gefühl zuwiderläuft, es sei ein Gebot der Fairness, dass alle gleichermaßen zu warten hätten, bis sie an der Reihe sind. Auf der Webseite von Universal für den Ticketverkauf ist von dieser Zurückhaltung allerdings nichts zu spüren. Dort wird der Ausweis zum Überspringen der Schlange (149 Dollar) mit unmissverständlicher Offenheit angepriesen: »Bei allen Fahrgeschäften, Shows und Attraktionen stehen Sie damit ganz vorne in der Schlange!«[5]
Wer das Überspringen der Warteschlange in Vergnügungsparks abstoßend findet, könnte sich vielleicht für eine traditionelle Sehenswürdigkeit entscheiden – etwa das Empire State Building. Für 22 Dollar (Kinder zahlen 16) kann man mit dem Lift hinauf ins 86. Stockwerk fahren und dort einen spektakulären Blick auf New York genießen. Leider zieht diese Attraktion jährlich mehrere Millionen Besucher an, und die Wartezeit vor dem Lift kann manchmal Stunden ausmachen. Deshalb bietet das Empire State Building inzwischen eine Überholspur an: Für 45 Dollar pro Person kann man einen Express-Ausweis kaufen, der die Wartezeit vor dem Aufzug und der Sicherheitskontrolle erheblich verkürzt. 180 Dollar für eine vierköpfige Familie zu berappen, damit man schnell nach oben kommt, mag überteuert erscheinen. Doch die Webseite für Tickets weist darauf hin, dass der Express-Ausweis »eine fantastische Möglichkeit ist, die Zeit in New York optimal zu nutzen, indem Sie die Warteschlange im Empire State Building umgehen und direkt zu einer der großartigsten Aussichten gelangen«.[6]
Überholspuren
Der Trend zur schnellen Sonderspur lässt sich auch auf den Freeways der USA beobachten. Zunehmend können dort Pendler dem zäh fließenden Berufsverkehr gegen Bezahlung auf eine schnelle Sonderspur entkommen. Es begann in den 80ern mit Spuren für Fahrgemeinschaften. In der Hoffnung, Staus und Luftverschmutzung zu reduzieren, richteten die Staaten Express-Spuren für Pendler ein, die bereit waren, Mitfahrer aufzunehmen. Alleinfahrer, die auf den Sonderspuren erwischt wurden, hatten mit hohen Geldstrafen zu rechnen.
Manche setzten daher sogar aufblasbare Puppen auf den Beifahrersitz und hofften, die Polizeistreifen so täuschen zu können. In einer Folge der Sitcom Curb Your Enthusiasm kommt Larry David auf die geniale Idee, sich in die Sonderspur quasi einzukaufen: Angesichts des dichten Verkehrs auf dem Weg zu einem Baseballspiel der Los Angeles Dodgers heuert er eine Prostituierte an – nicht für Sex, sondern um mit ihm zum Stadion zu fahren. Dank der schnellen Nummer auf der Sonderspur kommt er rechtzeitig zum ersten Pitch dort an.[1]
Inzwischen halten es viele Pendler genauso – ohne dafür eine Prostituierte anheuern zu müssen. Für Gebühren von bis zu 10 Dollar während der Stoßzeit können Alleinfahrer das Recht zur Nutzung der Sonderspuren für Fahrgemeinschaften erstehen. San Diego, Minneapolis, Houston, Denver, Miami, Seattle und San Francisco gehören zu den Städten, die inzwischen das Recht auf schnelleres Pendeln verkaufen. Die Maut variiert üblicherweise mit dem Verkehrsaufkommen – je zäher der Verkehr, desto höher die Gebühr. (In den meisten Orten können Autos mit zwei oder mehr Insassen die Sonderspuren nach wie vor gratis benutzen.) Auf dem Riverside Freeway östlich von Los Angeles zockelt der Berufsverkehr in den Gratisspuren mit 20 bis 30 Stundenkilometern dahin, während die zahlenden Kunden auf der Express-Spur mit 90 Sachen vorbeirauschen.[2]
Einige halten nichts davon, das Recht, eine Überholspur zu benutzen, käuflich zu machen. Sie meinen, die Ausbreitung von schnellen Sonderspursystemen käme lediglich den Reichen zugute und verweise die Armen ans Ende der Schlange. Gegner der gebührenpflichtigen Sonderspuren bezeichnen sie als »Lexus-Spuren« (in Anlehnung an die berühmte japanische Luxuskarosse) und meinen, sie seien unfair gegenüber den Pendlern mit bescheidenen Mitteln. Aber nicht alle sehen das so. Die Befürworter argumentieren, es sei nichts Falsches daran, für schnelleren Service mehr zu verlangen. Federal Express fordert für die Zustellung über Nacht einen Zuschlag. Die örtliche Reinigung verlangt mehr, wenn sie die Kleidung noch am selben Tag reinigen soll. Dennoch beschwert sich keiner, dass es unfair sei, wenn FedEx ein Paket bevorzugt zustellt oder die Reinigung ein Hemd schneller reinigt als andere.
Für einen Ökonomen stehen lange Schlangen bei Gütern und Dienstleistungen für Vergeudung und Ineffizienz; sie sind ein Hinweis, dass das Preissystem es nicht geschafft hat, Nachfrage und Angebot zur Deckung zu bringen. Lässt man die Leute für eine schnellere Abfertigung am Flughafen, in Vergnügungsparks und auf Autobahnen bezahlen, verbessert das die wirtschaftliche Effizienz – weil die Zeit der Menschen mit einem Preis versehen wird.
Das Geschäft mit dem Schlangestehen
Selbst wenn es einem nicht möglich ist, sich in die Spitze der Schlange einzukaufen, kann man gelegentlich jemanden anheuern, der sich für einen anstellt. Das New Yorker Public Theater veranstaltet im Central Park jeden Sommer kostenlose Shakespeare-Aufführungen. Karten für die Abendvorstellungen sind jeweils von 13 Uhr an erhältlich, und die Warteschlange bildet sich schon Stunden vorher.
Als 2010 Al Pacino den Shylock im Kaufmann von Venedig gab, war die Nachfrage nach Karten besonders stark.
Viele New Yorker wollten das Stück unbedingt sehen, hatten aber nicht die Zeit, sich so lange anzustellen. Nach einem Bericht der New York Daily News ließ dieses Dilemma ein reges Kleingewerbe aufblühen – zahlreiche Menschen boten an, sich stellvertretend anzustellen und so Tickets für diejenigen zu beschaffen, die bereit waren, für diese Bequemlichkeit zu bezahlen. Die Schlangesteher boten ihre Dienste auf diversen Webseiten an. Als Gegenleistung für die Zeit in der Warteschlange konnten sie ihren vielbeschäftigten Kunden bis zu 125 Dollar pro Karte für die an sich kostenlosen Aufführungen abnehmen.[1]
Das Theater versuchte, die bezahlten Schlangesteher von der Ausübung ihres Gewerbes mit der Behauptung abzuhalten, dies sei »nicht im Sinne der Veranstaltungsreihe ›Shakespeare in the Park‹«. Das öffentlich subventionierte Public Theater sei kein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern habe die Aufgabe, großes Theater für ein breites Publikum aus allen Schichten der Bevölkerung zugänglich zu machen. Andrew Cuomo, damals New Yorks Justizminister, zwang die größte einschlägige Webseite dazu, die Werbung für die Karten und die Dienste der Schlangesteher zu beenden. Er stellte fest: »Tickets zu verkaufen, die kostenlos sein sollen, nimmt den New Yorkern die Möglichkeit, sich der Leistungen zu erfreuen, die diese vom Steuerzahler unterstützte Institution bereitstellt«.[2]
Nicht nur im Central Park können Leute Geld machen, indem sie anstehen und warten. In Washington, D.C., wird das Geschäft mit dem Schlangestehen gerade zu einer staatlichen Institution. Wenn Kongress-Ausschüsse Anhörungen zu Gesetzesvorschlägen abhalten, reservieren sie einige Sitze für die Presse und die Allgemeinheit – nach dem Prinzip »wer zuerst kommt, mahlt zuerst«. Je nach Thema und Raumgröße können sich die Warteschlangen für die Anhörungen schon einen Tag zuvor oder noch früher bilden, manchmal gar im Regen oder in winterlicher Kälte. Firmenlobbyisten sind scharf darauf, an diesen Anhörungen teilzunehmen, um in den Pausen die beteiligten Abgeordneten anzusprechen und bei Gesetzen, die ihre Branche betreffen, auf dem Laufenden zu bleiben. Doch die Lobbyisten verbringen ungern Stunden in der Schlange, um sich einen Platz zu sichern. Ihre Lösung: Sie bezahlen Tausende Dollar für Firmen, die Leute beschäftigen, um sich dort anzustellen.
Diese Firmen rekrutieren Rentner, Kurierfahrer und immer häufiger auch Obdachlose, die den Elementen trotzen und einen Platz in der Schlange besetzen. Die Schlangesteher warten erst draußen, wandern dann mit dem Voranschreiten der Schlange in die Räume der Verwaltungsgebäude im Kongress und stellen sich vor den Räumen für die Anhörung an. Kurz vor Beginn der Veranstaltung eilen die betuchten Lobbyisten herbei, tauschen den Platz mit ihren schäbig gekleideten Stellvertretern und nehmen an der Sitzung teil.[3]
Die Firmen verlangen von den Lobbyisten zwischen 36 und 60 Dollar pro Wartestunde in der Schlange, was bedeutet, dass es 1000Dollar oder mehr kosten kann, einen Platz in einer Anhörung zu ergattern. Die Platzhalter selbst bekommen pro Stunde 10 bis 20 Dollar. Die Washington Post sprach sich in einem Leitartikel gegen diese Praxis aus und bezeichnete sie als »erniedrigend« für den Kongress und als »herablassend gegenüber der Öffentlichkeit«. Die demokratische Senatorin Claire McCaskill aus Missouri versuchte erfolglos, sie verbieten zu lassen. »Die Vorstellung, dass bestimmte Interessengruppen Plätze für Anhörungen des Kongresses in gleicher Weise kaufen wie Tickets für ein Konzert oder ein Fußballspiel, erscheint mir als anstößig«, erklärte sie.[4]
Das Warteschlangen-Business hat inzwischen den Sprung vom Kongress zum U.S. Supreme Court geschafft. Wenn das Oberste Gericht in großen, die Verfassung betreffenden Fällen mündliche Vorträge anhört, ist es nicht einfach, einen Platz zu bekommen. Wer jedoch bereit ist, dafür zu bezahlen, kann einen Stellvertreter anheuern, der einem einen Platz auf der Galerie des höchsten Gerichts im Land verschafft.[5]
Die Firma LineStanding.com beschreibt sich selbst als »führend in der Branche des Anstehens«. Als Senatorin McCaskill ein Gesetz einbrachte, das diese Praxis verbieten sollte, setzte sich Mark Gross, der Eigner dieses Unternehmens, zur Wehr. Er verglich Anstehen in der Warteschlange mit der Arbeitsteilung am Fließband Henry Fords: »Jeder Arbeiter am Band war zuständig für seine spezielle Aufgabe.« So wie Lobbyisten sich gut darauf verstünden, bei Anhörungen präsent zu sein und »alle Aussagen zu analysieren«, und Senatoren wie Kongressabgeordnete es beherrschten, »eine gut begründete Entscheidung zu treffen«, seien Schlangesteher eben gut im, nun ja, Warten. »Arbeitsteilung macht aus Amerika einen Ort, wo jeder eine passende Arbeit finden kann«, behauptete Gross. »Anstehen mag als seltsame Praxis erscheinen, doch letztlich ist es ein ehrlicher Job in einer freien Marktwirtschaft.«[6]
Oliver Gomes, der beruflich in der Warteschlange steht, sieht das genauso. Er wohnte in einer Obdachlosenunterkunft, als man ihn für diesen Job anheuerte. CNN interviewte ihn, als er bei einer Anhörung zum Klimawandel für einen Lobbyisten in der Warteschlange die Stellung hielt. »Als ich in den Räumen des Kongresses saß, ging es mir ein wenig besser«, erklärte Gomes gegenüber CNN. »Ich fand es erhebend und kam mir vor wie, nun ja, also, wie jemand, der vielleicht dazugehört; vielleicht kann ich ja sogar auf dieser kleinen untergeordneten Ebene etwas beitragen.«[7]
Was für Gomes eine Chance bedeutete, erlebten einige Umweltaktivisten als frustrierend. Als sie zur Klimawandel-Anhörung kamen, ließ man sie nicht ein. Die bezahlten Platzhalter der Lobbyisten hatten schon alle verfügbaren Plätze in dem Raum okkupiert.[8] Natürlich ließe sich vorbringen, dass die Umweltaktivisten, wenn ihnen denn wirklich viel daran gelegen war, an der Anhörung teilzunehmen, sich ja auch die Nacht über hätten anstellen können. Oder sie hätten ein paar Obdachlose dafür bezahlen können, an ihrer Stelle zu warten.
Schwarzmarkt für Arzttermine
Schlangestehen gegen Bezahlung ist kein ausschließlich amerikanisches Phänomen. Als ich kürzlich in China war, erfuhr ich, dass bezahltes Schlangestehen bei den Spitzenkliniken Pekings zur Routine geworden ist. Die Marktreformen der letzten beiden Jahrzehnte haben dazu geführt, dass zahlreiche öffentliche Krankenhäuser geschlossen wurden, was besonders die ländlichen Gebiete getroffen hat. So reisen Patienten vom Land mittlerweile zu den großen öffentlichen Kliniken der Hauptstadt und lassen vor den Registrierungsbüros lange Warteschlangen entstehen. Sie stellen sich über Nacht und manchmal tagelang an, um ein Ticket für einen Arzttermin zu erhalten.[1]
Die Tickets kosten nicht viel – nur 14 Yuan (etwa 2 Dollar). Doch es ist nicht leicht, eines zu ergattern. Anstatt nun Tage und Nächte in der Warteschlange zu verbringen, kaufen manche Patienten die Tickets auf dem Schwarzmarkt. Die Schwarzhändler verdienen ihr Geld mit der klaffenden Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Sie heuern Leute an, die sich für Tickets anstellen, und verkaufen diese dann für viele hundert Dollar weiter – das ist mehr, als ein normaler Bauer in Monaten verdient. Termine bei führenden Spezialisten sind besonders begehrt und werden von den Schwarzhändlern verhökert wie Karten für die Champions League. Die Los Angeles Times schilderte die Schwarzmarktszene vor der Registrierungsstelle einer Pekinger Klinik so: »Dr. Tang. Dr. Tang. Wer will ein Ticket für Dr. Tang? Rheumatologie und Immunologie.«[2]
Schwarzmarkttickets für Arzttermine haben etwas Widerliches an sich. Zum einen belohnt das System die Makler und nicht diejenigen, die Hilfe leisten. Wenn ein Termin beim Rheumatologen 100 Dollar wert sein soll, dann könnte Dr. Tang zu Recht fragen, warum der größte Teil des Geldes an Schwarzhändler fällt statt an ihn oder seine Klinik. Dem dürften Ökonomen zustimmen; sie würden den Kliniken raten, ihre Preise zu erhöhen. Tatsächlich haben einige Kliniken in Peking inzwischen spezielle Ticketschalter eingerichtet, wo die Termine teurer und die Warteschlangen kürzer sind.[3] Dieser Ticketschalter mit höheren Preisen ist die Klinikversion der VIP-Ausweise in Vergnügungsparks oder der Fast Tracks auf Flughäfen – eine Möglichkeit, die Warteschlange gegen Bezahlung zu überspringen.
Aber unabhängig davon, wer angesichts der hohen Nachfrage abkassiert, ob nun die Schwarzhändler oder die Klinik – die Überholspur zum Rheumatologen wirft eine grundlegendere Frage auf: Sollten Patienten die Möglichkeit erhalten, die Warteschlange für medizinische Versorgung einfach deswegen zu überspringen, weil sie es sich leisten können, mehr zu bezahlen?
Angesichts der Schwarzhändler und der speziellen Ticketschalter in Pekinger Kliniken liegt diese Frage nahe. Doch die gleiche Frage lässt sich auch bei einer weniger auffälligen Form des Vordrängelns stellen, die in den USA immer häufiger praktiziert wird. Es ist das Aufkommen der »Concierge medicine« – Ärzte, die rund um die Uhr verfügbar sind, ähnlich wie das Personal eines guten Hotels.
Ärzte auf Abruf
Auch wenn es in den Kliniken in den USA nicht von Schwarzhändlern wimmelt, ist medizinische Versorgung oft mit langen Wartezeiten verbunden. Arzttermine müssen Wochen, manchmal Monate im Voraus vereinbart werden. Kommt man dann zum Termin, kann es sein, dass man im Wartezimmer Moos ansetzt, nur um anschließend in hastigen zehn oder fünfzehn Minuten abgefertigt zu werden. Der Grund: Die Krankenversicherungen bezahlen den Allgemeinärzten nicht viel für Routinetermine. Deswegen haben sie üblicherweise 3000 oder mehr Patienten in ihrer Kartei und peitschen täglich 25 bis 30 Termine durch.[1]
Viele Patienten und Ärzte empfinden dieses System als frustrierend, weil es den Medizinern wenig Zeit lässt, ihre Patienten kennenzulernen oder ihre Fragen zu beantworten. Deswegen bietet inzwischen eine wachsende Zahl von Ärzten eine attraktivere Form der Versorgung an: die »Concierge medicine«. Wie der Portier eines Fünf-Sterne-Hotels steht der Arzt rund um die Uhr zur Verfügung. Für jährliche Gebühren von 1500 bis 25000 Dollar wird dem Patienten garantiert, dass er am selben oder am folgenden Tag einen Termin erhält – ohne Wartezeit, ohne Zeitdruck bei der Konsultation und mit der Möglichkeit, rund um die Uhr per E-Mail oder Handy mit dem Arzt Kontakt aufzunehmen. Und wenn man einen Topspezialisten konsultieren möchte, wird einem der persönliche Arzt den Weg ebnen.[2]
Damit sie diesen aufmerksamen Service gewährleisten können, reduzieren die so arbeitenden Ärzte die Zahl der von ihnen versorgten Patienten drastisch. Mediziner, die ihre Praxis solchermaßen umstellen wollen, benachrichtigen ihre vorhandenen Patienten schriftlich und stellen sie vor die Wahl, sich für den neuen Service ohne Wartezeit, aber mit jährlicher Gebühr anzumelden oder sich einen anderen Arzt zu suchen.[3]
Eine der ersten Arztpraxen dieser Art (und eine der teuersten) ist die 1996 gegründete MD2. Für jährlich 15000 Dollar pro Person und 25000 Dollar für die ganze Familie verspricht das Unternehmen einen »absoluten, unbeschränkten und exklusiven Zugang zu Ihrem persönlichen Arzt«.[4] Jeder Arzt betreut nur 50 Familien. Wie die Firma auf ihrer Webseite erklärt, sei es für die »Verfügbarkeit und das Niveau der von uns bereitgestellten Dienste absolut unerlässlich, unsere Praxis auf wenige Auserwählte zu beschränken«.[5] Wie die Zeitschrift Town & Country berichtet, gleicht »das Wartezimmer von MD2 eher der Lobby eines Ritz-Carlton als der Praxis eines Arztes«. Doch nur wenige Patienten suchen die Praxis überhaupt auf. »CEOs und Firmeninhaber, die keine Zeit für einen Arztbesuch haben, ziehen es vor, die medizinische Behandlung zu Hause oder im Büro in Anspruch zu nehmen.«[6]
Andere Praxen mit entsprechendem Service versorgen die obere Mittelschicht. MD-VIP, eine in Florida sitzende kommerzielle Kette, bietet Termine am gleichen Tag und Sofortservice (der Anruf wird nach dem zweiten Klingelton beantwortet) für 1500 bis 1800Dollar pro Jahr an und akzeptiert Versicherungsleistungen für medizinische Standardverfahren. Die teilnehmenden Ärzte fahren ihren Patientenstamm auf 600 Personen zurück, was es ihnen ermöglicht, mehr Zeit für jeden Patienten aufzubringen.[7] Die Firma versichert, dass »Warten nicht zu den Erfahrungen beim Arztbesuch gehört«. Laut der New York Times stellt eine MD-VIP-Praxis in Boca Raton im Wartezimmer Obstsalat und Biskuitgebäck bereit. Weil dort aber ohnehin kaum jemand warte, blieben die Naschereien oft unberührt.[8]
Für die rund um die Uhr erreichbaren Ärzte und ihre zahlenden Kunden ist diese Form der medizinischen Versorgung genau so, wie sie sein sollte. Statt 30 Patienten täglich empfangen die Ärzte acht bis zwölf Patienten und kommen finanziell immer noch gut weg. Die unter dem Dach von MD-VIP arbeitenden Mediziner behalten zwei Drittel der Jahresgebühr (ein Drittel geht an die Firma); das heißt, eine Praxis mit 600 Patienten nimmt jährlich 600000 Dollar allein an festen Gebühren ein. Dabei sind die Behandlungshonorare, die von der Krankenkasse gezahlt werden, noch gar nicht eingerechnet. Für Patienten, die es sich leisten können, sind Arzttermine ohne Zeitdruck und zeitlich unbeschränkter Zugang zu einem Arzt ein Luxus, der sein Geld wert ist.[9]
Natürlich hat das eine Kehrseite: Die Rundumversorgung für wenige geht damit einher, dass alle anderen in die überfüllten Patientenkarteien der übrigen Ärzte abgeschoben werden.[10] Insofern lässt sich hier der gleiche Einwand geltend machen, der gegen jedes System mit Überholspur erhoben wird: Es ist unfair gegenüber all denen, die schmachtend auf der Kriechspur zurückbleiben.
Die Vorzugsmedizin unterscheidet sich sicherlich von den speziellen Ticketschaltern und dem Schwarzhandel mit Arztterminen in Peking. Denn wer sich keinen Arzt mit Vorzugsbehandlung leisten kann, findet in der Regel auch anderswo eine anständige medizinische Versorgung. Wer sich dagegen in Peking keinen Schwarzhändler leisten kann, muss tage- und nächtelang anstehen.
Doch die beiden Systeme haben eines gemeinsam: Sie ermöglichen es den Begüterten, die Warteschlange für medizinische Versorgung zu überspringen. In Peking verläuft das Vordrängeln zwar unverschämter als in Boca Raton – zwischen dem Radau in der überfüllten Registrierungsstelle und der Ruhe des Wartezimmers mit den Biskuits scheinen Welten zu liegen. Doch dies liegt nur daran, dass das Ausscheren aus der Warteschlange schon durch das Entrichten der Gebühr im Verborgenen stattgefunden hat, wenn der Patient der Vorzugsmedizin seinen Termin wahrnimmt.
Marktkonformes Denken
Dies alles sind Zeichen unserer Zeit. In Flughäfen und Vergnügungsparks, in den Fluren des amerikanischen Kongresses und den Wartezimmern der Ärzte wird die Ethik der Warteschlange – »immer der Reihe nach« – durch die Ethik des Marktes ersetzt: »Man bekommt, was man bezahlt hat.« Und diese Verschiebung spiegelt eine umfassendere Bewegung: das zunehmende Übergreifen des Geldes und der Märkte auf Lebensbereiche, die einst von anderen Normen beherrscht wurden.
Das Recht, die Warteschlange zu überspringen, ist nicht das schmerzlichste Beispiel dieses Trends. Aber indem wir fragen, was an Schlangestehen, Schwarzhandel mit Arztterminen und anderen Formen des Vordrängelns richtig oder falsch sein mag, schärfen wir unseren Blick für die moralische Dimension – und die moralischen Grenzen – des marktkonformen Denkens.
Ist irgendetwas falsch daran, Leute zum Anstehen anzuheuern oder Arzttermine im Schwarzhandel zu verticken? Die meisten Ökonomen verneinen das. Mit einer Ethik der Warteschlange können sie nicht viel anfangen. Warum sollte sich jemand beschweren, fragen sie, wenn ich einen Obdachlosen dafür bezahle, dass er sich an meiner Stelle in die Schlange einreiht? Warum sollte ich daran gehindert werden, mein Terminticket zu verkaufen, anstatt es selbst zu nutzen?
Ihr Plädoyer für die Herrschaft der Märkte beruft sich auf zwei Argumente. Eines speist sich aus der Achtung für die Freiheit des Einzelnen, das andere stellt den Gedanken der Nutzenmaximierung ins Zentrum der Überlegungen. Ersteres ist ein Argument der Libertarianer, die davon ausgehen, dass Menschen frei kaufen und verkaufen dürfen, was ihnen beliebt, solange sie nicht die Rechte anderer verletzen. Libertarianer sind gegen Gesetze, die den Schwarzhandel mit Arztterminen untersagen, und zwar mit der gleichen Begründung, wie sie gegen gesetzliche Beschränkungen der Prostitution oder des Organhandels sind. Sie glauben, solche Gesetze würden die Freiheit des Einzelnen verletzen, weil sie die Legitimität von Entscheidungen in Zweifel zögen, die Erwachsene einvernehmlich getroffen hätten.
Das zweite Argument für die Märkte, das unter Ökonomen gängiger ist, gründet sich auf utilitaristische Überlegungen. Demnach nützt der Austausch auf dem Markt sowohl Käufern als auch Verkäufern, wodurch das Gemeinwohl oder der gesellschaftliche Nutzen insgesamt gesteigert wird. Die Tatsache, dass mein Stellvertreter in der Warteschlange und ich einen Handel abschließen, beweist, dass wir im Ergebnis beide besser dastehen. Wenn ich 125 Dollar bezahle, um das Shakespeare-Stück sehen zu können, muss ich anschließend besser dran sein, denn sonst hätte ich den Stellvertreter nicht engagiert. Und mit 125 Dollar für die Stunden in der Warteschlange muss es meinem Vertreter besser gehen, sonst hätte er den Job nicht übernommen. Also ziehen wir beide einen Vorteil daraus. Genau das meinen die Ökonomen, wenn sie behaupten, freie Märkte würden Güter effizient zuteilen. Weil Märkte den Menschen ermöglichen, Geschäfte zum beiderseitigen Vorteil abzuschließen, teilen sie die Güter denjenigen zu, die sie am meisten schätzen, was sich darin ausdrückt, dass sie bereit sind, dafür zu bezahlen.
Mein Kollege, der Ökonom Gregory Mankiw, ist Autor eines der am häufigsten benutzten Lehrbücher für Ökonomie in den USA. Er verwendet das Beispiel des Schwarzhandels mit Arztterminen, um die Vorzüge des freien Marktes zu illustrieren. Zunächst erklärt er, ökonomische Effizienz bedeute, Güter auf eine Weise zuzuteilen, die »das wirtschaftliche Wohl aller in der Gesellschaft« maximiere. Dann merkt er an, dass freie Märkte zu diesem Ziel beitragen, indem sie »das Angebot an Gütern an die Käufer weiterleiten, die sie am meisten schätzen, was sich daran zeigt, wie viel sie zu bezahlen bereit sind«.[1] Nehmen wir die Schwarzhändler für Arzttermine: »Soll eine Ökonomie ihre raren Ressourcen effizient zuteilen, müssen Güter an jene Verbraucher fallen, die sie am meisten schätzen. Schwarzhandel mit Arztterminen ist ein Beispiel, wie Märkte effiziente Ergebnisse erzielen … Indem die Schwarzhändler den höchsten Preis verlangen, den der Markt hergibt, stellen sie sicher, dass Konsumenten mit der höchsten Bereitschaft, für die Tickets zu bezahlen, sie auch bekommen.«[2]
Falls dieses Argument zutrifft, sollte man Schwarzhändler und Firmen zur Vermittlung von Schlangestehern nicht schmähen, weil sie die Integrität der Warteschlange stören. Man sollte sie vielmehr preisen, weil sie den gesellschaftlichen Nutzen mehren, indem sie unterbewertete Güter für jene verfügbar machen, die am meisten dafür zu zahlen bereit sind.
Märkte vs. Warteschlangen
Was lässt sich dann zugunsten der Ethik der Warteschlange vorbringen? Warum sollte man versuchen, bezahlte Schlangesteher und Schwarzhändler aus dem Central Park oder vom Capitol Hill zu verbannen? Ein Sprecher von »Shakespeare im Park« bot folgende Begründung an: »Sie nehmen jemandem einen Platz und ein Ticket weg, der dabei sein und gerne eine Produktion von Shakespeare im Park sehen möchte. Wir wollen, dass die Leute dieses Erlebnis gratis bekommen.«[1]
Der erste Teil des Arguments ist falsch. Bezahlte Stellvertreter in der Warteschlange und Schwarzhändler reduzieren die Gesamtzahl der Zuschauer einer Vorstellung nicht; sie verändern nur die Zusammensetzung des Publikums. Der Sprecher meint zwar zu Recht, dass die Stellvertreter Tickets beanspruchen, die sonst Leuten zufallen würden, die weiter hinten in der Schlange stehen und das Stück sehr gerne sehen möchten. Doch er reicht die Karten ja nur weiter an Menschen, die das Stück auch wirklich gerne sehen möchten. Genau deshalb berappen sie ja 125 Dollar für einen Stellvertreter in der Schlange.
Wahrscheinlich meinte der Sprecher, dass der Schwarzhandel