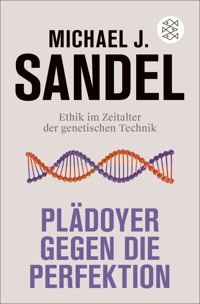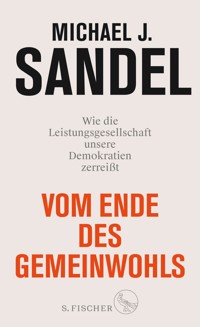16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Philosoph Michael Sandel setzt sich in diesem Buch mit den zentralen moralischen und politischen Themen unserer Zeit auseinander: Er beleuchtet Sterbehilfe und Abtreibung, Homosexuellenrechte wie Stammzellenforschung, »Affirmative Action« sowie die Kluft zwischen Arm und Reich, die Rolle der Märkte und den Platz der Religion im öffentlichen Leben. Inwieweit kann Moral Einfluss auf die Politik nehmen? In seinen wegweisenden Essays argumentiert Michael Sandel für eine gerechte, moralische Gesellschaft und für ein staatsbürgerliches Freiheitsverständnis, das es Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, eigene Wertvorstellungen in die Gemeinschaft einzubringen. »Ein Buch zur Orientierung in schwieriger Zeit.« Morgenpost am Sonntag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Ähnliche
Michael J. Sandel
Moral und Politik
Gedanken zu einer gerechten Gesellschaft
Über dieses Buch
Der Philosoph Michael Sandel setzt sich in diesem Buch mit den zentralen moralischen und politischen Themen unserer Zeit auseinander: Er beleuchtet Sterbehilfe und Abtreibung, Homosexuellenrechte wie Stammzellenforschung, »Affirmative Action« sowie die Kluft zwischen Arm und Reich, die Rolle der Märkte und den Platz der Religion im öffentlichen Leben. Inwieweit kann Moral Einfluss auf die Politik nehmen?
In seinen wegweisenden Essays argumentiert Michael Sandel für eine gerechte, moralische Gesellschaft und für ein staatsbürgerliches Freiheitsverständnis, das es Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, eigene Wertvorstellungen in die Gemeinschaft einzubringen.
»Ein Buch zur Orientierung in schwieriger Zeit.« Morgenpost am Sonntag
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Michael J. Sandel, geboren 1953, ist politischer Philosoph. Er studierte in Oxford und lehrt seit 1980 in Harvard. Seine Vorlesungsreihe über Gerechtigkeit begeisterte online Millionen von Zuschauern und machte ihn zum weltweit populärsten Moralphilosophen. »Was man für Geld nicht kaufen kann« wurde zum internationalen Bestseller. Seine Bücher beschäftigen sich mit Ethik, Gerechtigkeit, Demokratie und Kapitalismus und wurden in 27 Sprachen übersetzt.
Helmut Reuter, geboren 1946, arbeitet seit 1995 als freier Übersetzer aus dem Englischen und Französischen. Neben den Werken Michael J. Sandels hat er u.a. Bücher von John Hands, Lawrence M. Krauss oder Niall Ferguson übersetzt. Er lebt in der Nähe von München.
Inhalt
Einleitung zur deutschen Ausgabe
TEIL I Auf dem Weg zu einer politischen Ökonomie des Staatsbürgertums
Oft gehen wir [...]
Marktdenken als moralisches Denken: Warum Ökonomen sich erneut auf politische Philosophie einlassen sollten
Moralische Verstrickungen
Das Geschäft mit dem Schlangestehen
Wie Märkte ihren Abdruck hinterlassen
Flüchtlingsquoten und Abholen im Kindergarten
Geldbußen vs. Gebühren
Die Lizenz zum Kinderkriegen
Ein Walross gegen Bezahlung schießen
Die Verdrängung marktfremder Normen
Endlager für nukleare Abfälle
Spendentage
Der Kommerzialisierungseffekt
Handel mit Blut
Sparsamkeit in der Liebe
Marktdenken als moralisches Denken
Die moralische Ökonomie der Spekulation: Glücksspiel, Finanzwirtschaft und Gemeinwohl
Investieren und Zocken
Einkommen und Gewinn
Die Ethik der Spekulation
Spekulation auf Leben und Tod
Eine kurze Moralgeschichte der Lebensversicherung
Das Leben der anderen
Todesanleihen
Amerikas Suche nach einer Philosophie des Öffentlichen
Liberale Freiheit gegen republikanische Freiheit
Die politische Ökonomie des Staatsbürgerlichen
Der Fluch der Größe
Der Neue Nationalismus
Der New Deal und die keynesianische Revolution
Keynesianismus und Liberalismus
Der Augenblick der Weltherrschaft
Reagans staatsbürgerlicher Konservativismus
Die Risiken der republikanischen Politik
Wo Liberale sich fürchten, Stellung zu beziehen
Globale Politik und partikulare Identitäten
Jenseits von souveränen Staaten und souveränen Individuen
TEIL II Moralische und politische Streitpunkte
In diesem Teil [...]
Der Bereich des Öffentlichen als Handelsmarke
Sport und staatsbürgerliche Identität
Geschichte zu verkaufen
Sollten wir Verschmutzungsrechte kaufen?
Ehre und Ressentiment
Die Debatte zur Affirmative Action
Sollten Opfer bei der Urteilsfindung mitreden dürfen?
Clinton und Kant über das Lügen
Gibt es ein Recht auf Sterbehilfe?
Embryonalethik – die moralische Logik der Stammzellforschung
Moralische Auseinandersetzung und liberale Tolerierung – Abtreibung und Homosexualität
Persönlichkeitsrechte: Intimität und Selbstbestimmung
Von der alten Privatsphäre zur neuen
Die Minimalbegründung der Tolerierung: Abtreibung
Die voluntaristische Begründung der Tolerierung: Homosexualität
Epilog
TEIL III Liberalismus, Pluralismus und Gemeinschaft
Die Essays in [...]
Moral und das liberale Ideal
Gerechtigkeit als Zugehörigkeit
Die Gefahr der Auslöschung
Deweys Liberalismus und der unsere
I
II
Herrschaft und Hybris im Judentum – was ist falsch daran, Gott zu spielen?
Pluralismus: ethisch und deutend
Religiöse Anthropologie
Biotechnologie: Spielen wir Gott?
Der prometheische Geist
Gebändigte Hybris: Beteuerung der Endlichkeit
Sabbat und Schlaf
Götzenanbetung
Politischer Liberalismus
Widerspruch gegen den Vorrang des Rechten vor dem Guten
Verteidigung des Vorrangs des Rechten vor dem Guten
Politischer versus umfassender Liberalismus
Die politische Konzeption der Person
Eine Bewertung des politischen Liberalismus
Das Ausklammern schwerwiegender moralischer Fragen
Das Faktum eines vernünftigen Pluralismus
Die Grenzen des liberalen öffentlichen Vernunftgebrauchs
Rawls zum Gedenken
Die Grenzen des Kommunitarismus
Die Irrtümer des Kommunitarismus
Das Recht auf Religionsfreiheit
Das Recht auf Redefreiheit
Einleitung zur deutschen Ausgabe
Ein auffälliges Merkmal des heutigen demokratischen Lebens ist, dass die Bürger fast überall – und aus guten Gründen – von der Politik frustriert sind. In den meisten demokratischen Gesellschaften gelingt es Politikern und politischen Parteien nicht mehr, große und allgemein bedeutsame Fragen aufzugreifen – insbesondere Fragen, die Ethik und Werte betreffen.
Der öffentliche Diskurs speist sich entweder aus technokratischen, auf Managementaspekte begrenzten Gesprächen oder aus höchst parteilichen, erbitterten Schaukämpfen, deren Teilnehmer einander anschreien, anstatt sich auf eine vernunftgesteuerte Auseinandersetzung einzulassen. All das führt zu einem ausgehöhlten öffentlichen Diskurs ohne moralische Bedeutung. Es ist diese Leere der politischen Auseinandersetzung während der letzten Jahrzehnte, die der weitverbreiteten Unzufriedenheit zugrunde liegt, die wir in den meisten Demokratien beobachten. Sie treibt auch das Aufkommen von Protestparteien und -bewegungen voran; in ihnen kommen der wachsende Zorn und die Frustration gegenüber den etablierten Parteien zum Ausdruck, die es nicht schaffen, Fragen aufzugreifen, die den Leuten Sorgen bereiten.
Die Menschen wollen, dass Politik große Themen abhandelt: jenes der Gerechtigkeit zum Beispiel, Gemeinwohl oder die Frage, was es heißt, Staatsbürger zu sein. Heute aber schafft es der politische Mainstream-Diskurs zumeist nicht, solche Themen aufzugreifen. Eine der dringlichsten Herausforderungen unserer Zeit besteht darin, die verlorengegangene Kunst der demokratischen Auseinandersetzung wieder aufleben zu lassen. Wir brauchen einen öffentlichen Diskurs, der moralisch aufgeladener ist als jener, der in der heutigen Politik vorherrscht.
Die Kapitel dieses Buches erkunden die Gründe für den verarmten öffentlichen Diskurs unserer Zeit. Außerdem soll darin eine Möglichkeit skizziert werden, wie eine moralisch gewichtigere Form der politischen Auseinandersetzung aussehen könnte. Obwohl diese Texte zu unterschiedlichen Zeitpunkten der vergangenen drei Jahrzehnte verfasst wurden, haben sie einige Themen gemeinsam. Da ist erstens die Tatsache, dass die managementgeprägte Politik, die ohne moralische Bezüge auskommt, sich zeitgleich mit dem »Glauben an den Sieg des Marktes« etabliert hat. Damit meine ich die Annahme, Marktmechanismen seien die vorrangigen Werkzeuge zur Verwirklichung des Gemeinwohls. Dieser Glaube manifestierte sich speziell in den späten 70ern und 80ern – im Rahmen der von Margaret Thatcher und Ronald Reagan vertretenen Ideologie des Laissez-faire und des freien Marktes. Doch selbst als diese Gestalten in den 90ern von der politischen Bühne verschwunden waren, stellten die Mitte-Links-Parteien, die an ihre Stelle traten, deren grundlegende Annahme vom Primat des Marktes nicht in Frage. Politische Lenker wie Bill Clinton in den USA, Tony Blair in Großbritannien und Gerhard Schröder in Deutschland mäßigten die Marktgläubigkeit zwar, konsolidierten sie zugleich aber auch. Sogar die 2008 einsetzende Finanzkrise löste keine weitreichende öffentliche Debatte über die angemessenen Rollen von Geld und Markt in einer guten Gesellschaftsform aus.
Viele der folgenden Texte befassen sich mit der in den letzten Jahrzehnten erfolgten Umwandlung des gesellschaftlichen Lebens in ein Handelsgut; sie setzen sich mit der Frage auseinander, was es moralisch und zivilgesellschaftlich bedeutet, wenn fast alles käuflich gemacht wird. In Teil I werden diese Themen explizit erörtert: Dort vertrete ich die Meinung, dass Märkte aus sich heraus nicht imstande sind, Gerechtigkeit oder Gemeinwohl zu definieren, und dass die Ökonomie durchaus keine wertneutrale Wissenschaft des menschlichen Verhaltens und gesellschaftlicher Entscheidungen ist, sondern ein Ableger sowohl der Moralphilosophie als auch der Politischen Philosophie.
Die Aufsätze in Teil II behandeln verschiedene moralische und politische Kontroversen in Hinblick auf ein zweites übergreifendes Thema: die unvermeidliche Verknüpfung der politischen Argumentation mit moralischen und spirituellen Idealen. Hier werden einige heißumstrittene moralische und politische Fragen der letzten Jahrzehnte aufgegriffen, darunter die unter »Affirmative Action« [auch als »positive Diskriminierung« bezeichnet] zusammengefassten Quotenregelungen zugunsten benachteiligter Minderheiten in den Zulassungsverfahren von Universitäten und bei der Vergabe von Arbeitsplätzen; auch geht es um Beihilfe zum Suizid, Abtreibung, Schwulenrechte, Stammzellforschung, Verschmutzungsrechte, Lügen in der Politik, das Strafrecht, moralische Grenzen des Marktes, die Bedeutung der Tolerierung sowie um die Rolle der Religion im öffentlichen Leben.
Im Rahmen dieser Kontroversen tauchen immer wieder bestimmte Fragen auf: In unserem moralischen und politischen Leben gelten die Rechte des Einzelnen und die Entscheidungsfreiheit als bedeutende Ideale – bilden sie aber auch die angemessene Grundlage für eine demokratische Gesellschaft? Können wir einen argumentativen Weg durch die schwierigen moralischen Fragen finden, die sich im öffentlichen Leben stellen, ohne umstrittene Vorstellungen von Tugend und vom guten Leben zu erörtern? Wenn – wie ich behaupte – unsere politischen Auseinandersetzungen den Fragen zum guten Leben nicht ausweichen können, wie können wir dann damit umgehen, dass in modernen Gesellschaften eine spürbare Uneinigkeit zu solchen Fragen herrscht?
Die Kapitel in Teil III sehen von den in Teil II erörterten speziellen moralischen und politischen Kontroversen ab, um die Vielfalt der heute besonders ausgeprägten liberalen politischen Theorie zu untersuchen und deren Stärken und Schwächen zu bewerten. Der Terminus »liberal« hat dabei in Europa eine andere Bedeutung als in den USA. In Europa bezieht sich »liberal« üblicherweise auf die marktfreundlichen Ansichten des Laissez-faire, während der Begriff in den USA eine Politik kennzeichnet, die staatsbürgerliche Freiheiten und verschiedene Versionen des Wohlfahrtsstaates vertritt. Doch ein im weiteren Sinn verstandener Liberalismus verweist auch auf politische Theorien, welche den Respekt gegenüber Pluralismus und den Rechten des Einzelnen hervorheben. Diese Art Liberalismus betrachte ich in Teil III.
Eine der zentralen Debatten zum Liberalismus innerhalb der politischen Philosophie betrifft die Frage, ob die Achtung für Pluralismus und individuelle Rechte erfordert, dass das Gesetz gegenüber konkurrierenden Vorstellungen des guten Lebens neutral zu sein hat. Einige der wichtigsten zeitgenössischen Denker innerhalb der liberalen Tradition, darunter John Rawls und Jürgen Habermas, waren bestrebt, liberalen Institutionen und Praktiken eine Legitimation zu verschaffen, die sich gegenüber umfassenden moralischen, spirituellen und metaphysischen Anschauungen neutral verhält. Ich dagegen bringe vor, dass eine solche Neutralität weder möglich noch wünschenswert ist. Die Texte in Teil III legen diese Argumentation dar und bieten Beispiele für politische Theorien, die sich offen und ausdrücklich auf moralische und spirituelle Ideale beziehen und sich dabei dennoch dem Pluralismus verpflichtet sehen. Liberale sorgen sich oft, dass eine Einladung moralischer und religiöser Auseinandersetzungen in den öffentlichen Raum die Gefahr von Intoleranz und Zwang heraufbeschwöre. Ich versuche auf diese Besorgnis zu reagieren, indem ich zeige, dass ein substantieller moralischer Diskurs keinen Widerspruch zu fortschrittlichen öffentlichen Zielen darstellt und dass eine pluralistische Gesellschaft keineswegs davor zurückschrecken muss, sich auf die moralischen und religiösen Überzeugungen einzulassen, die ihre Bürger ins öffentliche Leben einbringen.
Viele Essays in diesem Band verwischen die Grenzlinie zwischen Politischer Philosophie und politischem Kommentar, und sie stellen in zweifacher Hinsicht die Unternehmung einer Philosophie des Öffentlichen dar: Sie sehen in den politischen und rechtlichen Auseinandersetzungen unserer Tage nicht nur eine Chance für die Philosophie an sich, sondern sie stehen auch für den Versuch, Philosophie in der Öffentlichkeit zu betreiben – sie sollen die Moralphilosophie und die Politische Philosophie im zeitgenössischen öffentlichen Diskurs zum Tragen bringen und die Bürger dazu einladen, sich mit den großen Fragen zu beschäftigen, die in den Dilemmata unseres Alltagslebens stecken.
TEIL IAuf dem Weg zu einer politischen Ökonomie des Staatsbürgertums
Oft gehen wir davon aus, Debatten über die Wirtschaft beträfen genau zwei Fragen: wie Wirtschaftswachstum zu fördern ist und wie man dessen Früchte gerecht verteilt. Die erste Frage gilt vor allem als technische, die zweite eher als normative Frage. Es führt jedoch in die Irre, auf diese Art über Wirtschaft nachzudenken. Denn damit wird eine zu scharfe Trennlinie zwischen wirtschaftlicher Sachkenntnis und moralischer Auseinandersetzung gezogen. Zudem lässt sich mit diesem Ansatz nicht erklären, auf welche Weise ökonomische Vereinbarungen jene Einstellungen, Normen und Tugenden fördern (oder auch aushöhlen) können, die eine Demokratie erst möglich machen.
In Teil I soll gezeigt werden, was es für die Wirtschaft bedeuten würde (und zeitweilig schon bedeutet hat), wenn sie als moralisches und staatsbürgerliches Projekt konzipiert würde. Das Kapitel Marktdenken als moralisches Denken wendet sich gegen die Vorstellung, Ökonomie sei eine wertneutrale Wissenschaft der gesellschaftlichen Entscheidungen, und schlägt vor, die Wirtschaftswissenschaft wieder an die ältere Tradition der Moralökonomie und der Politischen Ökonomie anzuknüpfen. Die moralische Ökonomie der Spekulation veranschaulicht die Verknüpfung von Wirtschaftsdenken und moralischem Denken. Hier wird der Frage nachgegangen, ob zwischen Zocken im Casino und Finanzspekulation ein moralischer Unterschied besteht (beides hat in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen). Dadurch, dass sich das heutige Wirtschaftsleben auf den Bereich der Finanzen fokussiert, entstehen die größten Gewinne mittlerweise nicht mehr durch die Herstellung von Produkten, sondern durch die Verwaltung von Risiken. Darum stellt sich die Frage, was die wachsende Rolle von Zufall und Glück im Wirtschaftsleben sowie der Niedergang der Arbeit in moralischer und staatsbürgerlicher Hinsicht mit sich bringen.
Das dritte Kapitel dieses Abschnitts wirft einen Blick in die Geschichte anhand einiger konkreter Beispiele für eine politische Ökonomie des Staatsbürgertums. Mit Bezug auf die politische Tradition der Vereinigten Staaten wird dort gezeigt, dass unsere Debatten sich nicht immer auf den Umfang und die Verteilung des Bruttosozialprodukts konzentriert haben; ebenso wenig erscheint die konsumorientierte, individualistische Lesart als einzige Möglichkeit, sich Freiheit vorzustellen. Denn während weiter Strecken der amerikanischen Geschichte wurde die politische Auseinandersetzung durch eine anspruchsvollere staatsbürgerliche Konzeption der Freiheit bestimmt. Die neue Größenordnung des politischen Lebens im Zeitalter der Globalisierung macht das staatsbürgerliche Projekt sicher komplizierter, aber dennoch erinnert uns das staatsbürgerliche Konzept der Freiheit an Fragen, die zu stellen wir inzwischen vergessen haben: Wie können starke ökonomische Kräfte dazu gebracht werden, der Demokratie zu nützen? Ist Selbstverwaltung unter den Bedingungen einer globalisierten Wirtschaft möglich? Welche Formen von Solidarität und Gemeinschaft können demokratische Gesellschaften in einem durch vielfältige Identitäten und komplexe Persönlichkeiten geprägten pluralistischen Zeitalter überhaupt noch wecken?
Marktdenken als moralisches Denken: Warum Ökonomen sich erneut auf politische Philosophie einlassen sollten
Es gibt einiges, was man für Geld nicht kaufen kann – zum Beispiel Freundschaft. Wollte ich mehr Freunde haben, würde der Versuch, welche käuflich zu erwerben, eindeutig scheitern. Ein angeheuerter Freund ist nicht dasselbe wie ein echter Freund. Mit dem Geld, das die Freundschaft erkauft, löst sich das Gut, das ich zu erwerben wünsche, gleichsam auf.
Doch die meisten Güter gehören nicht zu dieser Kategorie. Nehmen wir das Beispiel Nieren. Durch einen Kauf werden sie nicht zerstört. Manche Menschen befürworten einen Markt für menschliche Organe, andere sind dagegen. Doch diejenigen, die sich gegen einen Handel mit Nieren aussprechen, können nicht behaupten, dass ein Nieren-Markt das erstrebte Gut zerstören würde. Eine gekaufte Niere erfüllt ihre Aufgabe, wenn die passenden Voraussetzungen gegeben sind. Einwände gegen einen Handel mit menschlichen Organen müssten daher anderer Natur sein. Nieren lassen sich mit Geld kaufen (der Schwarzmarkt belegt dies); die Frage lautet, ob man das erlauben sollte.
In meinem Buch Was man für Geld nicht kaufen kann versuche ich zu zeigen, dass Marktwert und Marktdenken zunehmend in Lebensbereiche vordringen, die zuvor von Normen beherrscht wurden, die nicht der Marktlogik folgen.[1] Fortpflanzung und Kinderbetreuung, Gesundheit und Erziehung, Sport und Freizeit, Strafjustiz, Umweltschutz, Militärdienst, Wahlkämpfe, öffentliche Bereiche und Gemeindeleben: Überall spielen Geld und Märkte eine immer größere Rolle.
Ich halte diese Tendenz für beunruhigend. Wenn man jeder menschlichen Tätigkeit einen Preis zuweist, zersetzt man bestimmte moralische und staatsbürgerliche Werte, um die man sich sorgen sollte. Aus diesem Grund brauchen wir eine öffentliche Debatte über die Frage, wo Märkte dem Gemeinwohl dienen und wo sie nicht hingehören.
Hier möchte ich ein ähnliches Thema behandeln: Wenn es darum geht, zu entscheiden, ob dieses oder jenes Gut nach Marktprinzipien verteilt werden soll oder aber nach Grundsätzen, die nicht vom Markt bestimmt werden, dann erweist sich die Wirtschaftswissenschaft als schlechter Ratgeber. Auf den ersten Blick mag das merkwürdig erscheinen, denn ein zentrales Thema der Volkswirtschaftslehre ist es, die Mechanismen des Marktes zu erklären. Wieso also ist es der Wirtschaftslehre nicht gelungen, eine überzeugende Grundlage für die Entscheidung zu liefern, was verkäuflich sein soll und was nicht?
Der Grund dafür liegt darin, dass sich die Wirtschaftslehre als wertneutrale Wissenschaft am menschlichen Verhalten sowie an gesellschaftlichen Entscheidungen orientiert. Ich werde versuchen zu zeigen, dass die Entscheidung darüber, welche gesellschaftlichen Praktiken tatsächlich von Marktmechanismen gesteuert werden sollten, eine Form des ökonomischen Denkens erfordert, die eng mit moralischen Überlegungen verknüpft ist.
Allerdings behauptet der Mainstream des ökonomischen Denkens, vom umstrittenen Terrain der Politischen Philosophie und der Moralphilosophie unabhängig zu sein. Wirtschaftswissenschaftliche Lehrbücher betonen die Unterscheidung zwischen »positiven« und normativen Fragen, zwischen Erklären und Vorschreiben. Das populäre Buch Freakonomics formuliert den Unterschied ganz einfach: »Moral repräsentiert die Art und Weise, wie die Welt (…) funktionieren sollte – während die Ökonomie uns zeigt, wie sie tatsächlich funktioniert.« Die Ökonomie befasse sich einfach nicht mit Moral.[2]
Moralische Verstrickungen
Die Ökonomen haben ihren Gegenstand nicht immer in dieser Weise verstanden. Seit Adam Smith haben die klassischen Ökonomen die Wirtschaftslehre als Zweig der Moralphilosophie und der politischen Philosophie konzipiert. Doch die Art der Wirtschaftswissenschaft, die heute in der Regel gelehrt wird, präsentiert sich als eine autonome Disziplin, die nicht darüber urteilt, wie Einkommen zu verteilen oder dieses oder jenes Gut zu bewerten seien. Die Vorstellung, dass die Wirtschaftswissenschaft eine wertfreie Disziplin sei, war schon immer fragwürdig. Doch je mehr die Märkte ihren Zugriff auf nichtökonomische Lebensbereiche ausdehnen, desto stärker verstricken sie sich in moralische Fragen.
Ich schreibe hier selbstverständlich nicht über die normalen lehrbuchmäßigen Grenzen der Märkte. Ein beträchtlicher Teil der ökonomischen Analyse befasst sich mit dem Aufspüren von Fällen des »Marktversagens« oder von Situationen, in denen die Marktkräfte ohne Unterstützung wahrscheinlich kein effizientes Ergebnis liefern würden, etwa bei Märkten mit unzureichendem Wettbewerb, negativen oder positiven externen Effekten, öffentlichen Gütern, unvollständigen Informationen und dergleichen. Ein weiterer Teil der ökonomischen Literatur behandelt Fragen der Ungleichheit, neigt dabei jedoch dazu, Ursachen und Folgen der Ungleichheit zu analysieren und gleichzeitig zu behaupten, nicht an normative Fragen der Fairness und der Verteilungsgerechtigkeit zu glauben. Die Auslagerung von Urteilen über Gleichheit und Gerechtigkeit ins Feld der Philosophen scheint die Unterscheidung zwischen positiven und normativen Fragen zu festigen.
Diese intellektuelle Arbeitsteilung führt jedoch aus zwei Gründen in die Irre. Erstens »ist die Ökonomie eine moralische Wissenschaft«, wie Atkinson angemerkt hat, auch wenn oft das Gegenteil beteuert wird.[3] Effizienz spielt nur insofern eine Rolle, als sie dazu führt, dass es der Gesellschaft besser geht. Doch was gilt hier als besser? Die Antwort hängt von einigen Vorstellungen zum Gemeinwohl oder zu den öffentlichen Gütern ab. Obwohl »die Wohlfahrtsökonomie« in den letzten Jahrzehnten weitgehend aus der Mainstream-Ökonomie »verschwunden ist«, schreibt Atkinson, »haben die Ökonomen nicht aufgehört, Aussagen zur Wohlfahrt zu machen«. Artikel in Wirtschaftszeitschriften »sind voll mit Aussagen zur Wohlfahrt« und kommen, wie er feststellt, zu »eindeutigen normativen Schlüssen«, obwohl die dahinterstehenden Grundsätze weitgehend ungeprüft bleiben. Zumeist beruhen die Schlussfolgerungen auf utilitaristischen Annahmen. Doch wie Rawls und andere Philosophen dargelegt haben, strebt der Utilitarismus danach, den Wohlstand zu maximieren, ohne dessen Verteilung in Betracht zu ziehen. Atkinson fordert eine Wiederbelebung der Wohlfahrtsökonomie, die die Mängel des Utilitarismus anerkennt und eine größere Spanne von Verteilungsgrundsätzen einbezieht.
Es lässt sich noch aus einem weiteren Grund bezweifeln, dass die Wirtschaftswissenschaft eine wertfreie Wissenschaft der gesellschaftlichen Entscheidungen sein kann. Dieser Grund weist über Debatten zur Verteilungsgerechtigkeit hinaus auf Debatten zur Verwandlung aller Dinge in ein Handelsgut. Sollte Sex käuflich sein? Was ist mit Leihmutterschaft oder Schwangerschaft gegen Bezahlung? Sind Söldnerarmeen falsch, und falls ja, wie sollte stattdessen der Wehrdienst zugewiesen werden? Sollten Universitäten eine bestimmte Anzahl an Studienplätzen verkaufen, um Geld für sinnvolle Zwecke aufzutreiben, etwa für eine neue Bibliothek oder Stipendien für begabte Studenten aus benachteiligten Familien? Sollten die USA das Recht auf Einwanderung verkaufen? Was wäre, wenn amerikanische Staatsbürger das Recht bekämen, ihre Staatsbürgerschaft an Ausländer zu verkaufen und mit ihnen den Platz zu tauschen? Sollten wir einen freien Markt für die Adoption von Babys erlauben? Sollte es den Leuten gestattet werden, ihre Wählerstimme zu verkaufen?
Manche dieser umstrittenen Nutzungsmöglichkeiten von Märkten würden die Effizienz erhöhen, weil sie wechselseitig vorteilhafte Tauschoptionen schüfen. In manchen Fällen könnten negative externe Faktoren die Vorteile für Käufer und Verkäufer ausgleichen. Doch selbst bei fehlenden externen Faktoren gibt es Markttransaktionen, die aus moralischen Gründen bedenklich sind.
Einer dieser Gründe ist, dass schwerwiegende Ungleichheit den freiwilligen Charakter eines Tauschvorgangs untergraben kann. Wenn ein hoffnungslos verarmter Bauer eine Niere oder ein Kind verkauft, könnte die Verkaufsentscheidung letztlich von den Notwendigkeiten seiner Lage erzwungen sein. Ein vertrautes Argument zugunsten der Märkte – dass die Parteien den Bedingungen des Handels ohne Zwang zustimmen – wird durch ungleiche Verhandlungspositionen in Frage gestellt. Wenn wir wissen wollen, ob eine Marktentscheidung frei erfolgt, müssen wir fragen, welche Ungleichheiten in den gesellschaftlichen Hintergrundsbedingungen eine sinnvolle Übereinkunft schwächen. Das ist eine normative Frage, die von den verschiedenen Theorien der Verteilungsgerechtigkeit unterschiedlich beantwortet wird.
Ein zweiter Einwand bezieht sich nicht auf Fairness und beeinflusste Zustimmung, sondern auf die Tendenz marktüblicher Praktiken, nicht marktkonforme Werte, die es wert sind, bewahrt zu werden, zu beschädigen oder zu verdrängen. Beispielsweise würden wir zögern, einen Markt für Kinder zu schaffen, weil weniger betuchte Eltern durch einen solchen Handel aus dem Markt gedrängt würden oder für sie nur die billigsten, am wenigsten erwünschten Kinder übrigblieben (das Fairness-Argument). Doch wir könnten auch deswegen gegen einen solchen Markt sein, weil Kinder, denen man ein Preisschild anheftet, zu Objekten gemacht werden – man missachtet ihre Würde und zersetzt die Norm der bedingungslosen Elternliebe (das Korruptionsargument).
Auch dort, wo Märkte die Effizienz erhöhen, können sie unerwünscht sein, wenn sie moralisch bedeutsame, aber nicht marktkonforme Werte beschädigen oder verdrängen. Bevor wir also entscheiden können, ob wir beispielsweise einen Markt für Kinder schaffen, müssen wir herausfinden, welche Werte und Normen die gesellschaftlichen Praktiken der Kindererziehung und Elternschaft leiten sollten. In diesem Sinne sind moralische Überlegungen eine Voraussetzung für Marktdenken.
Für diejenigen, die davon ausgehen, dass alle Werte lediglich subjektive Vorlieben sind, die einer vernünftigen Argumentation nicht bedürfen, mag die Vorstellung, manche Wege der Abwägung von Werten seien angemessener oder moralisch vertretbarer als andere, seltsam erscheinen. Doch derartige Entscheidungen sind unvermeidlich, und sie gehen – mal implizit, mal explizit – stets einher mit unseren Entscheidungen, ob dieses oder jenes Gut handelbar sein sollte.
Den Ökonomen ist der moralische Einwand gegen die Monetarisierung aller Beziehungen durchaus bewusst. Beispielsweise stellt Joel Waldfogel (wie viele andere) die Rationalität von Geschenken in Frage.[4] Wenn er die von ihm so genannte »Wertvernichtung durch Weihnachten« analysiert, berechnet er den Nutzwertverlust, der sich ergibt, wenn die Leute Präsente machen, anstatt den Gegenwert in Geld zu überreichen. Die Praxis des Schenkens innerhalb der Verwandtschaft führt er auf das »Stigma des Geldgeschenks« zurück. Er fragt jedoch nicht, ob dieses Stigma gerechtfertigt sein könnte, sondern nimmt einfach an, es sei ein irrationales Hindernis für den Nutzen, das idealerweise überwunden werden sollte. Die Möglichkeit, dass die Stigmatisierung von Geldgeschenken – zumindest unter Liebespaaren, Ehegatten und nahen Angehörigen – für Normen wie Aufmerksamkeit und Bedachtsamkeit stehen könnte, die es wert sind, dass man sie würdigt und zu ihnen ermutigt, zieht er nicht in Betracht.
Auch Alvin Roth erkennt moralische Einwände gegen die Umwandlung gewisser gesellschaftlicher Praktiken in Handelsgüter an, wenn er von »Abscheu als Einschränkung des Marktes« schreibt.[5] Um diese Art Abscheu zu bekämpfen, schlägt er unentgeltlichen Nierentausch und andere Mechanismen vor, mit denen ein offener Handel vermieden werden kann. Anders als Waldfogel behandelt er Abscheu nicht als irrationales, den Nutzen beeinträchtigendes Tabu; er nimmt sie einfach als gesellschaftliche Tatsache hin und entwirft Möglichkeiten, sie zu umgehen. Roth bewertet die von ihm erörterten Abscheu erregenden Praktiken nicht moralisch; er fragt nicht, welche Fälle von Abscheu unüberlegte Vorurteile widerspiegeln, gegen die man etwas unternehmen sollte, und welche Beispiele für moralisch bedeutsame Erwägungen stehen, die man würdigen sollte. Dieses Widerstreben, über Abscheu zu urteilen, könnte das Zögern des Ökonomen widerspiegeln, sich auf normatives Terrain zu begeben.
Doch das Vorhaben, unentgeltlichen Tausch zu organisieren, setzt einige moralische Urteile darüber voraus, welche Fälle von Abscheu gerechtfertigt sind und welche nicht. Nehmen wir das Beispiel menschlicher Organe. Jeder erkennt an, dass Leben gerettet werden könnten, würden mehr Organe für Transplantationen zur Verfügung gestellt. Manche jedoch verwerfen einen Handel mit Nieren, weil sie meinen, die Entnahme eines Organs und dessen Verpflanzung in den Körper eines anderen Menschen verletzten die Heiligkeit und Integrität des menschlichen Körpers. Andere sind dagegen, weil sie finden, ein Handel mit Nieren mache den Menschen zum Objekt, indem er uns dazu bringe, unseren Körper als Eigentum zu betrachten und als eine Ansammlung von Ersatzteilen, die man für Profite nutzen könne. Andere wiederum sind für einen Handel mit Nieren, weil wir Eigentümer unserer selbst seien und deshalb nach Belieben darüber entscheiden können sollten, wie wir aus unserem Körper Nutzen ziehen.
Ob ein offener Nierenhandel oder ein unentgeltlicher Nierentausch jeweils moralisch vertretbar ist, hängt zumindest teilweise davon ab, welche dieser Einstellungen gegenüber dem menschlichen Körper und dem Menschen selbst korrekt ist. Falls die erste Ansicht zutrifft, sind alle Formen der Organtransplantation, ob gegen Bezahlung oder durch Spende, verwerflich, ungeachtet der Leben, die dadurch gerettet werden könnten. Trifft die zweite Ansicht zu, sind Transplantationen von Spendernieren moralisch vertretbar, nicht aber Transplantationen von gekauften Nieren. Sofern Nierentausch die Ethik des Spendens wahrt und eine geldgierige, den Menschen zum Objekt reduzierende Einstellung dabei vermieden wird, berücksichtigt er die moralischen Vorbehalte der zweiten Ansicht. Falls die dritte Ansicht zutrifft, sollten wir Nierenübertragungen nicht auf unentgeltlichen Tausch beschränken, sondern es den Menschen auch gestatten, Nieren gegen Geld zu handeln.
Es sind weder Effizienzmängel im Sinne der Ökonomen noch Fragen der Ungleichheit, mit denen die Märkte die moralischen und staatsbürgerlichen Praktiken am stärksten zersetzen. Eher geht es um den Verfall, der eintreten kann, wenn wir alle menschlichen Beziehungen in Markttransaktionen verwandeln und alle guten Dinge im Leben so behandeln, als seien sie Handelsgüter. Die ökonomische Literatur, die Stigma und Abscheu anerkennt, fällt implizite Urteile über diese Fragen; andernfalls wäre sie nicht in der Lage, Marktlösungen oder marktähnliche Alternativen vorzuschlagen. Aber sie bringt die Grundlage dieser Urteile nicht zur Sprache und verteidigt sie nicht. Wenn sie das täte, würde sie die ökonomische Vernunft nämlich über die Lehrbuch-Unterscheidung zwischen positiver und normativer Fragestellung hinausbringen und die Konzeption der Wirtschaftswissenschaft als wertneutrale Wissenschaft gesellschaftlicher Entscheidungen in Frage stellen. Ich werde zu zeigen versuchen, wie sich dies verhält, indem ich die Argumente für und gegen die Anwendung von Marktmechanismen in einigen umstrittenen Zusammenhängen gegeneinander abwäge.[6]
Das Geschäft mit dem Schlangestehen
Wenn Kongress-Ausschüsse Anhörungen abhalten, reservieren sie einige Sitze für die Presse und stellen der Allgemeinheit Plätze zur Verfügung, die nach dem Prinzip »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst« vergeben werden. Firmenlobbyisten sind scharf darauf, an diesen Anhörungen teilzunehmen, hassen es aber, stundenlang anzustehen, um sich einen Platz zu sichern. Ihre Lösung: Sie bezahlen Tausende Dollar an Firmen, die wiederum Obdachlose und andere beschäftigen, um sich dort anzustellen.[7]
Die Firma LineStanding.com beschreibt sich selbst als »führend in der Branche des Anstehens im Kongress«. Sie berechnet 50 Dollar pro Stunde fürs Schlangestehen – einen Teil davon zahlt sie den Leuten, die anstehen und warten. Das Geschäft wurde jüngst auf den US Supreme Court ausgeweitet. Wenn das Gericht in bedeutenden Verfassungsfällen mündlich verhandelt, ist die Nachfrage nach Plätzen weitaus größer als das Angebot. Wer jedoch zu bezahlen bereit ist, dem verschafft LineStanding.com einen Sitzplatz beim obersten Gericht des Landes. Das Geschäft blühte bei der Verhandlung zu Obamas Krankenversicherungsgesetz im Juli 2012, als die Schlange sich drei Tage im Voraus bildete. Für die Fälle zur Ehe gleichgeschlechtlicher Partner im Juni 2013 stellten manche Leute sich fünf Tage im Voraus an, was den Preis für einen Platz im Gerichtssaal auf etwa 6000 Dollar trieb.[8]
Was die Effizienz betrifft, lässt sich nur schwer ein Einwand gegen das Geschäft mit dem Schlangestehen finden. Die Obdachlosen, die stundenlang anstehen, erhalten eine Bezahlung, welche das Warten lohnend macht. Diejenigen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen, erhalten Zugang zu einer Kongressanhörung oder einer Verhandlung vor dem Supreme Court, an der sie dringend teilnehmen wollen, und sind bereit, dafür zu bezahlen. Die Firma, die den Handel einfädelt, verdient ebenfalls Geld. Alle Parteien stehen besser da, keiner ist schlechter dran.
Trotzdem erheben einige Leute Einwände. Die demokratische Senatorin Claire McCaskill aus Missouri versuchte erfolglos, das bezahlte Schlangestehen vor dem Kongress verbieten zu lassen. »Die Vorstellung, dass bestimmte Interessengruppen Plätze für Anhörungen des Kongresses in gleicher Weise kaufen wie Tickets für ein Konzert oder ein Footballspiel, erscheint mir als anstößig«, erklärte sie.[9]
Aber was genau ist dagegen einzuwenden? Ein Einwand bezieht sich auf die Frage der Gerechtigkeit: Es sei unfair, dass reiche Lobbyisten den Markt für Anhörungen des Kongresses monopolisieren und normale Bürger der Möglichkeit berauben, daran teilzunehmen. Doch ungleiche Zugangschancen sind nicht der einzige störende Aspekt daran. Nehmen wir einmal an, Lobbyisten würden besteuert, wenn sie Firmen fürs Anstehen einschalten, und die Steuereinnahmen würden dafür verwendet, genau diese Dienste auch für den Normalbürger erschwinglich zu machen. Die Subventionen könnten etwa in Form von Gutscheinen erfolgen, die für ermäßigte Sätze bei den Firmen einzulösen wären, die das Geschäft mit dem Schlangestehen betreiben. Damit ließe sich die Ungerechtigkeit dieses Systems mildern. Doch ein weiterer Einwand bliebe weiterhin bestehen: Verwandelt man den Zugang zum Kongress in ein handelbares Gut, dann wird dieser entwürdigt und abgewertet.
Deutlicher wird dies, wenn wir uns vor Augen halten, warum der Kongress den Zugang zu seinen Beratungen überhaupt »unter Preis« anbietet. Nehmen wir an, der Kongress würde in seinem Bestreben, die Staatsverschuldung zu reduzieren, für den Eintritt zu seinen Anhörungen Geld verlangen – sagen wir 1000 Dollar für einen Sitz in der ersten Reihe des Haushaltsausschusses. Viele würden sich dagegen aussprechen – nicht nur, weil eine Eintrittsgebühr unfair gegenüber denen wäre, die sich das nicht leisten können, sondern auch, weil Eintrittsgebühren für das Publikum einer Kongressanhörung eine Art Korruption bedeuten würden.
Bei Korruption denken wir oft an unrechtmäßig erworbene Einnahmen. Doch der Begriff umfasst weit mehr als Schmiergeld und rechtswidrige Zahlungen. Wird ein Gut oder eine gesellschaftliche Praxis korrumpiert, würdigt man sie herab; man legt den falschen Maßstab an, um ihren Wert zu bestimmen.[10] Eintrittsgebühren für Anhörungen des Kongresses sind in diesem Sinne Korruption. Denn damit wird der Kongress behandelt, als sei er ein Gewerbe und nicht eine Institution der repräsentativen Demokratie.
Zyniker dürften erwidern, der Kongress sei bereits ein Gewerbe, weil er routinemäßig Einfluss verkaufe und bestimmten Lobbygruppen Vergünstigungen gewähre. Warum also sollte man dies nicht gleich offen zugeben und Eintritt verlangen? Nun, weil auch Vorteilsgewährung und Insidegeschäfte bereits Beispiele für Korruption sind. Sie bedeuten eine Herabwürdigung der Regierung. Jeder Korruptionsvorwurf geht unausgesprochen mit einer bestimmten Vorstellung der angemessenen Zwecke und Ziele einer Institution (in diesem Fall des Kongresses) einher. Die Branche der bezahlten Vertreter in der Warteschlange am Capitol Hill, eine Erweiterung der Lobby-Branche, ist unter diesem Aspekt korrupt. Das Ganze ist nicht illegal, und die Bezahlung erfolgt vor aller Augen, dennoch wird damit der Kongress herabgewürdigt: Man behandelt ihn als Quelle privater Gewinne und nicht als Ausdruck staatsbürgerlicher Gleichheit.
Damit ist nicht unbedingt gesagt, dass Schlangestehen die beste Möglichkeit darstellt, den Zugang zu Kongressanhörungen oder mündlichen Verhandlungen des Obersten Gerichts zuzuteilen. Eine andere, besser mit dem Ideal der staatsbürgerlichen Gleichheit zu vereinbarende Alternative als Anstehen oder Bezahlen bestünde darin, die Eintrittskarten über eine Online-Lotterie zu vergeben – unter der Bedingung, dass sie nicht übertragbar sind.
Wie Märkte ihren Abdruck hinterlassen
Ehe wir entscheiden können, ob ein Gut über Märkte, Schlangestehen, per Lotterie, nach Bedürfnis, Verdiensten oder anderweitig zugeteilt werden sollte, müssen wir entscheiden, um welche Art von Gut es sich handelt und wie es zu bewerten ist. Dazu ist ein moralisches Urteil erforderlich, das Ökonomen, zumindest in ihrer Rolle als Sozialwissenschaftler, nur widerstrebend fällen wollen.
Es gehört zum Reiz der Marktlogik, dass sie anscheinend eine Möglichkeit zur Zuteilung von Gütern bietet, die ohne Urteile auskommt. Jeder Teilnehmer eines Handels entscheidet, welchen Wert er den zu tauschenden Gütern beimisst. Wenn jemand bereit ist, für Sex oder eine Niere zu bezahlen, und ein Erwachsener diese Güter bereitwillig verkaufen möchte, fragt der Ökonom nicht, ob die Parteien die Güter angemessen beurteilt haben. Mit solchen Fragen würde sich die Wirtschaftswissenschaft in Kontroversen über Tugend und das Gemeinwohl verstricken und damit gegen die Kriterien einer vorgeblich wertneutralen Wissenschaft verstoßen. Und dennoch ist es schwierig zu entscheiden, wo Märkte angemessen sind, ohne diese normativen Fragen anzuschneiden.
Der Lehrbuchansatz vermeidet dieses Dilemma, indem er – in der Regel vorbehaltlos – annimmt, dass die Bedeutung eines Gutes nicht verändert wird, wenn man es mit einem Preis versieht. Ohne Erklärung geht er davon aus, dass Kaufen und Verkaufen den Wert der gehandelten Dinge nicht mindern. Im Falle materieller Güter mag diese Annahme plausibel sein. Ob man mir einen Flachbildschirm verkauft oder schenkt, das Gerät wird in jedem Fall funktionieren. Doch die Annahme kann falsch sein, wenn Marktmethoden ihre Reichweite auf zwischenmenschliche Beziehungen und staatsbürgerliche Praktiken ausdehnen – etwa Sex, Kindererziehung, Lehren und Lernen, Wählen und so weiter. Wenn die Marktlogik ihre angestammten Felder verlässt und sich außerhalb des Reichs von Fernsehern und Toastern begibt, dürften Marktwerte die sozialen Praktiken verändern – und das nicht immer zum Besseren.
Flüchtlingsquoten und Abholen im Kindergarten
Sehen wir uns beispielsweise den Vorschlag für die Einrichtung eines globalen Marktes für Flüchtlingsquoten an. Jedes Jahr suchen mehr Flüchtlinge Asyl in Ländern, die bereit sind, sie aufzunehmen. Angeregt von der Idee der handelbaren Verschmutzungsrechte, schlug ein Rechtsprofessor eine Lösung vor: Ein internationales Gremium weist jedem Land eine jährliche Flüchtlingsquote zu, die auf seinem nationalen Wohlstand beruht; anschließend können die Länder untereinander mit diesen Verpflichtungen handeln. Wenn also beispielsweise Japan jährlich 10000 Flüchtlinge zugewiesen bekommt, sie aber nicht aufnehmen will, könnte es Russland oder Uganda dafür bezahlen, sie einreisen zu lassen. Nach der Logik des Marktes profitieren alle. Russland oder Uganda erhalten eine neue Quelle für Staatseinnahmen, Japan wird seinen Verpflichtungen gerecht, indem es Flüchtlinge auslagert, und es finden mehr Flüchtlinge Asyl als ohne eine entsprechende Regel.[11]
Zugunsten dieses Plans wird vorgebracht, dass Länder wahrscheinlich höhere Flüchtlingsquoten akzeptieren würden, wenn sie die Freiheit hätten, sich herauszukaufen. Ein Markt für Flüchtlinge hat jedoch etwas Widerliches an sich, selbst wenn er den unmittelbar Betroffenen einen Vorteil bietet. Aber warum erscheint er eigentlich so verwerflich? Dies hat damit zu tun, dass ein Markt für Flüchtlinge unsere Einstellung zu den Flüchtlingen verändert. Er ermutigt seine Teilnehmer – Käufer, Verkäufer und auch diejenigen, deren Recht auf Asyl da verschachert wird –, Flüchtlinge als Bürde anzusehen, die man loswerden sollte oder aber als Einkommensquelle erschließen kann – nicht aber als Menschen in Gefahr.
Man könnte diesen erniedrigenden Effekt einräumen und dennoch zu dem Schluss kommen, dass das Verfahren mehr Gutes als Schlechtes bewirke. Das Beispiel zeigt aber, dass Märkte keine rein mechanischen Apparate sind. Sie verkörpern bestimmte Normen. Sie unterstellen – und fördern – bestimmte Weisen, die ausgetauschten Güter zu bewerten.
Ökonomen gehen oft davon aus, dass Märkte die von ihnen gelenkten Güter unversehrt lassen. Doch das ist nicht wahr. Märkte beeinflussen die gesellschaftlichen Normen. Häufig zerfressen oder verdrängen Marktanreize andere, marktfremde Normen.
Eine bekannte Untersuchung mehrerer Kindergärten in Israel zeigt, wie das ablaufen kann.[12] Die Einrichtungen standen vor einem bekannten Problem: Eltern holen ihre Kinder manchmal zu spät ab, und die Erzieher müssen die Kinder dann beaufsichtigen, bis die verspäteten Eltern auftauchen. Um das Problem zu lösen, legten die Kindergärten eine Geldbuße für verspätetes Abholen fest. Wenn man davon ausgeht, die Menschen würden auf finanzielle Anreize reagieren, sollte man erwarten, dass die Buße die Häufigkeit der verspäteten Abholungen verringern würde. Stattdessen jedoch häuften sich die verspäteten Abholungen sogar.
Wie ist das zu erklären? Mit der Einführung einer Strafgebühr wurden die Normen geändert. Vorher hatten verspätete Eltern ein schlechtes Gewissen, denn sie bereiteten den Erziehern Unannehmlichkeiten. Jetzt aber sahen die Eltern eine verspätete Abholung als Service an, für den sie bezahlen konnten. Sie betrachteten die Geldbuße als Gebühr. Anstatt dem Erzieher etwas aufzuzwingen, bezahlten sie ihn einfach für seine längere Arbeitszeit. Falls die Bezahlung für verspätetes Abholen dafür sorgen sollte, dass die zusätzlichen Kosten der Verspätung ausgeglichen wurden, war sie wohl ein Erfolg; aber wenn die Eltern durch die Zahlungen eines Bußgelds von Verspätungen abgehalten werden sollten, war die Maßnahme gescheitert.
Geldbußen vs. Gebühren
Worin besteht der Unterschied zwischen einer Geldbuße und einer Gebühr? Es lohnt sich, darüber nachzudenken.
Geldbußen stehen für moralische Missbilligung, während Gebühren schlicht Preise darstellen, die kein moralisches Urteil implizieren. Wenn wir für das Wegwerfen von Abfällen ein Bußgeld festsetzen, so bewerten wir diese Handlung als falsch. Wenn jemand eine Bierdose in den Grand Canyon wirft, zieht das nicht nur Entsorgungskosten nach sich, sondern es zeigt auch eine Einstellung, die wir als Gesellschaft nicht ermutigen wollen. Nehmen wir an, die Geldbuße dafür beträgt 100 Dollar, und ein reicher Wanderer ist der Ansicht, so viel sei es ihm wert, sein Leergut nicht mitschleppen zu müssen. Er tut so, als sei die Strafe eine Gebühr, und wirft die leeren Dosen in den Grand Canyon. Obwohl er dafür später bezahlt, sind wir der Ansicht, er habe etwas falsch gemacht – weil er den Grand Canyon wie eine teure Müllkippe behandelt, hat er ihm nicht den angemessenen Wert beigemessen.
Oder nehmen wir Behindertenparkplätze. Ein emsiger Kleinunternehmer ohne körperliche Behinderungen möchte in der Nähe seiner Baustelle parken. Für die Bequemlichkeit, den Wagen auf einem Behindertenparkplatz abzustellen, zahlt er bereitwillig die hohe Geldbuße; für ihn sind das Betriebskosten. Glauben wir nicht, er verhalte sich falsch, auch wenn er das Bußgeld bezahlt? Er tut so, als sei die Strafe einfach eine teure Parkgebühr. Damit aber ignoriert er die moralische Dimension der Angelegenheit. Er missachtet die Bedürfnisse der Behinderten und den Wunsch der Gemeinschaft, ihnen gerecht zu werden und bestimmte Parkplätze für sie zu reservieren.
In der Praxis kann die Unterscheidung zwischen einer Geldbuße und einer Gebühr schwanken. In China wird die Geldbuße für Verstöße gegen die staatliche Ein-Kind-Politik von wohlhabenden Chinesen zunehmend als Preis für ein zweites Kind gesehen. Diese Maßnahme, vor mehr als drei Jahrzehnten zur Eindämmung des chinesischen Bevölkerungswachstums eingeführt, erlaubt den meisten Paaren in urbanen Gebieten nur ein Kind. (Familien auf dem Land dürfen ein zweites Kind bekommen, wenn das erste ein Mädchen ist.) Die Geldbuße variiert je nach Region, erreicht in großen Städten jedoch 200000 Yuan (etwa 30000 Euro) – für einen durchschnittlichen Arbeiter eine schwindelerregende Summe, aber für reiche Unternehmer, Sportstars und Berühmtheiten problemlos zu berappen.[13]
Die Beamten der Familienplanung haben versucht, den strafenden Aspekt der Sanktion wiederherzustellen, indem sie die Bußgelder für begüterte Regelbrecher anhoben, Berühmtheiten anprangerten, die gegen die Vorschrift verstoßen hatten, und Geschäftsleute mit überzähligen Kindern von Regierungsaufträgen ausschlossen. »Für die Reichen sind die Bußgelder Peanuts«, erklärte Zhai Zhenwu, ein Soziologieprofessor der Universität von Renmin. »Die Regierung müsste sie härter anfassen, da, wo es wirklich weh tut: bei ihrem Ruhm, ihrem Ansehen und ihrer Stellung in der Gesellschaft.«[14]
Die chinesischen Behörden sehen in dem Bußgeld eine Strafe und möchten das damit verbundene Stigma aufrechterhalten. Sie wollen es nicht zur Gebühr verkommen lassen. Der Hauptgrund ist nicht so sehr die Sorge, dass begüterte Paare zu viele Kinder bekommen könnten; die Zahl reicher Regelverletzer ist relativ klein. Ihnen geht es um die Norm, auf der diese Politik beruht. Wäre das Bußgeld lediglich eine Gebühr, würde der Staat damit das Recht auf weitere Kinder an diejenigen verkaufen, die fähig und bereit sind, dafür zu bezahlen.
Die Lizenz zum Kinderkriegen
Seltsamerweise haben einige westliche Ökonomen einen marktkonformen Ansatz für Geburtenkontrolle gefordert, der stark dem Gebührensystem ähnelt, das die chinesischen Regierungsvertreter vermeiden wollen. Diese Ökonomen haben Länder, die ihr Bevölkerungswachstum einschränken sollen, dazu gedrängt, handelbare Fortpflanzungsgenehmigungen auszugeben. 1964 schlug Kenneth Boulding zur Kontrolle der Überbevölkerung ein System handelbarer Fortpflanzungslizenzen vor. Dabei sollte jeder Frau eine (oder je nach Regelung auch eine zweite) Bescheinigung ausgestellt werden, die ihr das Recht auf ein Kind einräumte. Von dieser Lizenz könnte sie dann Gebrauch machen oder sie zum aktuellen Preis verkaufen. Boulding stellte sich einen Markt vor, in dem Menschen mit dringendem Kinderwunsch solche Zertifikate kaufen, und zwar von (wie er etwas taktlos formulierte) »Armen, Nonnen, alten Jungfern und so weiter«.[15]
Diese Regelung wäre weniger restriktiv als ein System fixer Quoten wie bei der Ein-Kind-Politik. Außerdem wäre sie ökonomisch effizienter, da die Güter (in diesem Fall: Kinder) den Kunden zufielen, die am ehesten bereit wären, dafür zu bezahlen.
Kürzlich haben zwei belgische Ökonomen Bouldings Vorschlag erneut ins Spiel gebracht. Sie verwiesen darauf, diese Regelung habe – weil wahrscheinlich die Reichen Fortpflanzungslizenzen von den Armen kaufen würden – den zusätzlichen Vorteil, dass die Ungleichheit verringert würde, da die Armen eine neue Einkommensquelle erschlössen.[16]
Es gibt Leute, die gegen jegliche Begrenzung der Fortpflanzung sind, während andere glauben, das Recht darauf könne zur Vermeidung von Überbevölkerung in legitimer Weise eingeschränkt werden. Lassen wir diese prinzipielle Uneinigkeit einmal beiseite und stellen uns eine Gesellschaft vor, die entschlossen ist, eine obligatorische Bevölkerungskontrolle einzuführen. Zwei Möglichkeiten kämen in Frage: ein fixes Quotensystem, das jedem Paar nur ein Kind zubilligt und Verstöße mit einem Bußgeld ahndet, und ein marktkonformes System, das jedem Paar einen handelbaren Gutschein zur Fortpflanzung ausstellt. Gegen welche Regelung gäbe es weniger einzuwenden?
Aus Sicht der Ökonomen ist die zweite Regelung eindeutig vorzuziehen. Frei entscheiden zu können, ob man den Gutschein nutzen oder verkaufen möchte, stellt einige Menschen besser, ohne andere schlechter zu stellen. Diejenigen, die Gutscheine kaufen oder verkaufen, gewinnen etwas (sie schließen einen beiderseits vorteilhaften Handel ab), und diejenigen, die damit nicht auf den Markt gehen, sind nicht schlechter dran als unter einem fixen Quotensystem – sie können immer noch ein Kind bekommen.
Dennoch hat eine Regelung, bei der Menschen mit dem Recht aufs Kinderkriegen Handel treiben, etwas Beunruhigendes. Zum Teil liegt dies daran, dass solch ein System unter der Bedingung der Ungleichheit ungerecht erscheint. Es widerstrebt uns, Kinder zum Luxusgut zu machen, das für Reiche, nicht aber für Arme erschwinglich ist. Neben dem Fairness-Einwand steht der potentiell zersetzende Effekt auf die Einstellungen und Normen von Eltern im Raum. Im Kern der Transaktion liegt nämlich ein moralisch beunruhigendes Verhalten: Eltern, die sich ein weiteres Kind wünschen, müssen andere mögliche Eltern dazu bringen oder verlocken, ihr Recht auf ein Kind zu verkaufen.
Einige dürften einwenden, dass ein Markt, auf dem Kinder oder ein Anrecht auf sie gehandelt werden, den Vorzug der Effizienz besitze: Er vergebe Kinder an diejenigen, die sie am meisten schätzen, was sich an der Zahlungsfähigkeit messen ließe. Doch der Handel mit dem Recht auf Fortpflanzung kann eine nur am Geld interessierte Mentalität gegenüber Kindern fördern und die Norm der bedingungslosen Liebe zu ihnen beschädigen. Würde Ihre Liebe zu Ihren Kindern etwa nicht beeinträchtigt, wenn Sie einige davon nur hätten, weil Sie andere Paare bestochen haben, kinderlos zu bleiben? Wären Sie nicht wenigstens versucht, diese Tatsache vor Ihren Kindern zu verbergen? Wenn ja, kann man aus gutem Grund zu dem Schluss kommen, dass ein Markt für Lizenzen zum Kinderkriegen ungeachtet möglicher Vorzüge die Elternschaft beschädigen würde – was für eine feste Quote, wie anrüchig diese auch sein mag, nicht gilt.
Wenn wir beschließen, ob wir ein Gut zur Handelsware machen oder nicht, müssen wir mehr in Betracht ziehen als Effizienz und Gerechtigkeit. Wir müssen auch fragen, ob nicht marktkonforme Normen durch Marktnormen verdrängt werden, und wenn ja, ob das nicht einen Verlust bedeutet, der uns Sorgen machen sollte.
Ein Walross gegen Bezahlung schießen
Nehmen wir eine andere Art von handelbarer Quote: das Recht, ein Walross zu schießen. Einst kam das atlantische Walross in den arktischen Regionen Kanadas häufig vor, doch der massige, wehrlose Meeressäuger war eine leichte Beute für Jäger, und gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Population stark zurückgegangen. 1928 verbot Kanada die Walrossjagd; ausgenommen war eine kleine Quote für die Inuit, eingeborene Jäger mit Subsistenzwirtschaft, deren Lebensweise sich seit gut 4500 Jahren um die Walrossjagd dreht.
In den 90ern wandten sich Führer der Inuit mit einem Vorschlag an die kanadische Regierung: Konnte sie den Inuit nicht erlauben, ihr Recht auf den Abschuss einiger Walrosse aus ihrer Quote an Großwildjäger zu verkaufen? Die Zahl der getöteten Walrosse würde gleich bleiben, die Inuit würden die Jagdgebühren kassieren, den Trophäenjägern als Führer dienen, den Abschuss überwachen und Fleisch wie Felle behalten, so wie sie das immer getan hatten. Damit würde das wirtschaftliche Wohl einer armen Gemeinschaft verbessert, ohne die geltenden Quoten zu überschreiten. Die kanadische Regierung war einverstanden.
Für die Gelegenheit, ein Walross zu schießen, reisen mittlerweile reiche Trophäenjäger aus aller Welt in die Arktis. Für dieses Privileg bezahlen sie zwischen 6000 und 6500 Dollar. Sie kommen sicher nicht wegen des Nervenkitzels der Jagd oder der sportlichen Herausforderung. Walrosse sind harmlose Geschöpfe, die sich langsam bewegen und für Jäger mit Gewehren kein Problem darstellen. In seinem eindrucksvollen Bericht im New York Times Magazine verglich C.J.Chivers die Walrossjagd unter Aufsicht der Inuit mit »einer langen Bootsfahrt, an deren Ende man auf einen sehr großen Sitzsack schießt«.[17] Die Führer manövrieren das Boot bis auf etwa 15 Meter an das Walross heran und geben dem Jäger ein Zeichen, wann er schießen soll. Chivers schilderte die Szene, als ein Jäger aus Texas seine Beute erlegte: »Die Kugel des Jägers klatschte in den Hals des Bullen, riss seinen Kopf herum und warf das Tier auf die Seite. Aus dem Einschussloch sprudelte Blut. Reglos lag der Bulle da. Der Jäger setzte sein Gewehr ab und griff nach der Videokamera.« Dann machte sich die Inuit-Mannschaft an die harte Arbeit, das tote Walross auf eine Eisscholle zu hieven und den Kadaver zu zerlegen.
Der Reiz einer solchen Jagd ist schwer zu ergründen. Sie stellt keine Herausforderung dar, weshalb sie weniger als Sport denn als eine Art todbringender Tourismus erscheint. Nicht einmal eine Trophäe kann sich der Jäger zu Hause an die Wand hängen. In den USA sind Walrosse geschützt, und es ist illegal, Körperteile dieser Tiere ins Land zu bringen.
Warum also sollte man ein Walross abschießen? Anscheinend geht es darum, je ein Exemplar all der Tierarten zu erlegen, die von Jagdvereinen aufgelistet werden – etwa die »Großen Fünf« Afrikas (Leopard, Löwe, Elefant, Nashorn und Kapbüffel) oder den »Grand Slam« der Arktis (Karibu, Moschusochse, Eisbär und Walross).
Dieses Ziel ist nicht gerade anerkennenswert; manche finden es sogar ausgesprochen widerlich. Aus Sicht der Marktlogik spricht jedoch einiges dafür, den Inuit zu erlauben, ihr Recht auf Abschuss einer bestimmten Zahl von Walrossen zu verkaufen: Sie selbst erschließen damit eine neue Einkommensquelle, die »Listenjäger« erhalten die Möglichkeit, ihre Bilanz der getöteten Tiere zu vervollständigen, und die Quoten werden nicht überschritten. In dieser Hinsicht entspricht der Verkauf des Walross-Abschussrechts dem Verkauf des Rechts auf Fortpflanzung oder Verschmutzung: Sobald eine Quote vorhanden ist, schreibt die Marktlogik vor, dass ein Handel mit den Konzessionen das Gemeinwohl mehrt. Er sorgt dafür, dass einige besser dastehen, ohne dass andere schlechter dran sind.
Und doch ist der Markt für Walross-Abschüsse moralisch äußerst fragwürdig. Selbst wenn es vernünftig ist, den Inuit weiterhin zu erlauben, für ihren Lebensunterhalt Walrosse zu jagen, wie sie das seit Jahrhunderten tun, ist das Recht, die Walross-Abschüsse zu verkaufen, aus zwei Gründen moralisch verwerflich. Erstens hilft dieser bizarre Markt, einen perversen Wunsch zu erfüllen, dem in jeder denkbaren Berechnung eines gesellschaftlichen Nutzens kein Gewicht zukommen sollte. Was immer man von anderen Formen der Großwildjagd halten mag: Der Wunsch, ohne jegliche Herausforderung oder Jagd ein hilfloses Säugetier aus kurzer Entfernung zu töten, nur um es auf einer Liste abhaken zu können, ist es nicht wert, erfüllt zu werden. Im Gegenteil, man sollte dagegen angehen. Zweitens: Wenn die Inuit das Recht, die ihnen zugeteilten Walrosse zu töten, an Außenstehende verkaufen, beschädigen sie die Bedeutung und den Zweck der Ausnahmeregelung, die man ihrer Gemeinschaft zugestanden hat. Die Lebensweise der Inuit zu würdigen und ihre von alters her bestehende Abhängigkeit von der Walrossjagd zu respektieren ist eine Sache. Etwas anderes ist es jedoch, dieses Privileg in eine bezahlte Konzession zum beiläufigen Töten umzuwandeln.
Natürlich kann man über die moralischen Urteile streiten, die hinter diesen Einwänden stehen. Die einen könnten das System handelbarer Walrossquoten verteidigen, weil der Wunsch, ein Walross zu schießen, nicht pervers, sondern moralisch legitim sei, weshalb er bei der Bestimmung des Gemeinwohls einbezogen werden solle. Man könnte auch vorbringen, dass nicht außenstehende Beobachter, sondern die Inuit selbst festlegen sollten, was als Achtung ihrer kulturellen Traditionen zu gelten habe. Ich aber will auf Folgendes hinaus: Die Entscheidung, ob man den Inuit erlauben soll, ihr Recht auf den Abschuss von Walrossen zu verkaufen, erfordert, dass man sich mit diesen konkurrierenden moralischen Urteilen auseinandersetzt und die Widersprüche auflöst.
Die Verdrängung marktfremder Normen
Märkte für Flüchtlingsquoten, Lizenzen zum Kinderkriegen und das Recht, ein Walross zu schießen, sind (ungeachtet ihrer Effizienz in ökonomischer Hinsicht) insofern fragwürdige Regelungen, als sie die Einstellungen und Normen beschädigen, welche die Behandlung von Flüchtlingen, Kindern und gefährdeten Arten regeln sollten. Das Problem, das ich hier hervorhebe, ist nicht, dass solche Märkte für Menschen, die sich käufliche Güter nicht leisten können, unfair sind (obwohl das sehr wohl zutreffen kann). Vielmehr geht es darum, dass der Verkauf solcher Dinge Schaden anrichten kann.
Die übliche Logik der Wirtschaftswissenschaft geht davon aus, dass die Umwandlung eines Gutes in eine Handelsware – also dadurch, dass man es zum Verkauf stellt – seinen Charakter nicht verändert; der Markt steigert die ökonomische Effizienz, ohne die Güter selbst zu verändern. Doch diese Annahme ist zweifelhaft. Wenn Märkte auf Lebensbereiche übergreifen, die bis dahin traditionell von marktfremden Normen geprägt wurden, verliert die Vorstellung, dass Märkte die auf ihnen getauschten Güter nicht tangieren oder gar beschädigen, an Plausibilität. Immer mehr Forschungsergebnisse bestätigen, was der gesunde Menschenverstand nahelegt: Finanzielle Anreize und andere Marktmechanismen können fehlschlagen, indem sie Normen ohne Marktbezug verdrängen.
Die Kindergartenstudie ist ein gutes Beispiel. Mit der Einführung einer Gebühr für verspätetes Ankommen stieg die Zahl zu spät kommender Eltern, anstatt zu sinken. Es trifft zweifellos zu, dass sich der normale Preiseffekt bei ausreichender Höhe des Bußgelds (sagen wir 1000 Dollar pro Stunde) durchsetzen würde. Für meine Argumentation kommt es jedoch allein darauf an, dass die Einführung eines finanziellen Anreizes (oder einer entsprechenden Abschreckung) marktfremde Einstellungen und Normen manchmal beschädigen oder verdrängen kann. Wann und in welchem Umfang der »Verdrängungseffekt« über den Preiseffekt siegt, ist eine empirische Frage, doch schon die bloße Existenz eines »Verdrängungseffekts« zeigt, dass Märkte nicht neutral sind: Führt man einen Marktmechanismus ein, können sich Charakter und Bedeutung einer gesellschaftlichen Praxis dadurch ändern. Falls das zutrifft, müssen wir für die Entscheidung, einen finanziellen Anreiz oder eine handelbare Quote einzuführen, in jedem Einzelfall die marktfremden Werte und Normen abschätzen, die solche Mechanismen verdrängen oder verändern könnten.
Der Verdrängungseffekt zeigt sich auch in mehreren anderen Studien.
Endlager für nukleare Abfälle
Als die Einwohner einer Gemeinde in der Schweiz befragt wurden, ob sie ein atomares Endlager bei sich genehmigen würden, falls das Schweizer Parlament beschlösse, es dort einzurichten, stimmten 51 Prozent zu. Anschließend wurde den Befragten die Zumutung versüßt: Das Parlament schlägt vor, das atomare Endlager dort zu errichten, und bietet an, alle Einwohner mit einer jährlichen Ausgleichszahlung zu entschädigen.[18] Doch das angebotene Geld führte nicht zu einer erhöhten Bereitschaft der Bürger, das Endlager anzunehmen; vielmehr halbierte sich die Zustimmungsquote von 51 auf 25 Prozent. Ähnliche Reaktionen auf finanzielle Angebote ergaben sich auch an anderen Orten, wo die ansässige Bevölkerung sich atomaren Endlagern widersetzte.[19]
Warum akzeptierten die Leute die nuklearen Abfälle ohne Gegenleistung eher als gegen Bezahlung? Für viele spiegelte die Bereitschaft, das Endlager zu akzeptieren, den Gemeinschaftsgeist wider – sie erkannten an, dass das Land als Ganzes von Kernenergie abhängt und der radioaktive Müll irgendwo gelagert werden muss. Falls sich herausstellte, dass ihre Gemeinde das sicherste Lager bot, waren sie zu einem Opfer fürs Gemeinwohl bereit. Sie waren jedoch nicht gewillt, ihre Sicherheit zu verkaufen und ihre Familien gegen Geld einem Risiko auszusetzen. Tatsächlich erklärten 83 Prozent derer, die die vorgeschlagene Bezahlung ablehnten, ihren Widerstand damit, dass sie nicht bestechlich seien.[20] Das Angebot einer privaten Bestechungssumme hatte eine staatsbürgerliche Frage in eine monetäre Frage verwandelt. Die Einführung von Marktnormen verdrängte ihren Sinn für staatsbürgerliche Pflichten.[21]
Spendentage
Israelische Oberschüler gehen jedes Jahr an einem festgelegten Spendentag von Tür zu Tür und bitten um Gaben für ehrenwerte Anliegen – zum Beispiel Krebsforschung oder Hilfen für behinderte Kinder. Gneezy und Rustichini führten ein Experiment durch, um festzustellen, wie sich finanzielle Anreize auf die Motivation der Schüler auswirken.[22] Sie unterteilten die Schüler in drei Gruppen. Einer Gruppe wurde eine kurze motivierende Ansprache über die gesellschaftliche Bedeutung des Anliegens gehalten, bevor man sie losschickte. Die zweite und dritte Gruppe bekamen die gleiche Rede zu hören, ergänzend dazu wurde ihnen aber auch eine finanzielle Belohnung auf Grundlage der gesammelten Beträge in Aussicht gestellt: ein Prozent für die eine, zehn Prozent für die andere Gruppe. Die Beteiligungen sollten nicht aus den gesammelten Beträgen abgezweigt werden, sondern aus einer separaten Quelle stammen.
Wenig überraschend, sammelten die Schüler, denen man zehn Prozent geboten hatte, mehr Spenden als die mit einem Prozent Provision. Die unbezahlten Schüler aber sammelten mehr als die beiden bezahlten Gruppen. Gneezy und Rustichini kamen zu folgendem Schluss: Wenn man Menschen motivieren will und dabei auch an finanzielle Anreize denkt, sollte man entweder »genug oder gar nichts bezahlen«.[23]
Selbst wenn das zutreffen mag, erfahren wir durch diese Geschichte noch mehr. Sie enthält auch eine Lektion darüber, wie Geld Normen verdrängt.