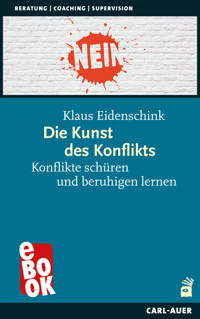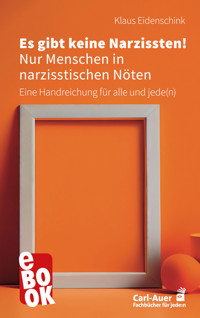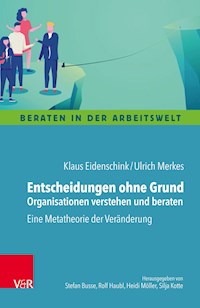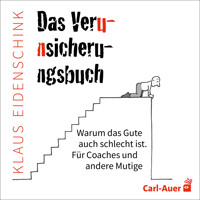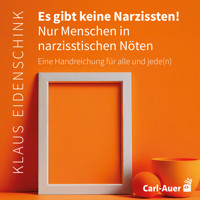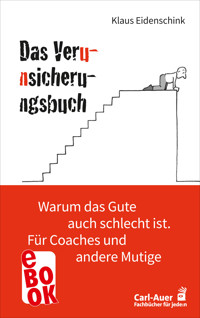
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Fachbücher für jede:n
- Sprache: Deutsch
"Dieses Verunsicherungsbuch schafft in hervorragender Weise (innere) Sicherheit. Dazu schenkt es viele Denkwege mit befreienden Perspektiven an Stelle von schlichtem Schwarz-weiß-Denken. Es zeigt brillant, dass Multivalenzen in uns Menschen kein Problem sind, sondern dass sie gerade in Zeiten erlittener Krisen zu stimmigen, ganzheitlich balancierten Lösungen führen können, wenn man sie zu nutzen weiß. In einer unsicher bleibenden Welt brauchen ja nicht nur Fachleute der helfenden Berufe, sondern wir alle einen kompetenten Umgang mit den Ambi- bzw. Multivalenzen in uns. Dieses Werk weist in sehr kluger Weise, mit philosophischer Tiefe und wertvoller Praxisrelevanz facettenreich und für unterschiedliche Kontexte den Weg, um mit bleibenden Multivalenzen in uns und im Umgang mit Anderen inneren Frieden, Erfüllung und flexible Handlungsfähigkeit zu schaffen. Abseits vom ständigen Selbstoptimierungswahn hilft es, auf unsere Grenzen zu achten und als vielschichtige Wesen unsere Würde zu erleben." Dr. Gunther Schmidt Was ist denn eigentlich »das Bessere«? Ein Buch, das verunsichern soll – echt jetzt? Ist denn das Leben nicht unsicher genug? Schon, aber wer das Gute sucht, sollte auch dessen Kehrseiten kennen. Dieses Buch reflektiert 50 Themen, die besonders für Coachs und Berater von Bedeutung sind, im Grunde aber für alle, die sich und ihre Mitmenschen besser verstehen lernen wollen. Klaus Eidenschink hinterfragt grundlegende Aspekte von Beratung, die gängigerweise als gut, richtig, erstrebenswert oder glücksverheißend gelten. Er lenkt dabei den Blick auf Fragen, die in der Praxis von Coachs und Beratern häufig vernachlässigt werden oder unbeantwortet bleiben: Was ist denn eigentlich das Bessere? Und für wen? Woran lässt es sich erkennen? An guten Gefühlen? Beim Einzelnen? In dessen Umfeld? Die vorübergehende Verunsicherung, die solche Fragen auslösen können, gleicht das Buch leicht durch die angebotenen Alternativen im Hinblick auf Beobachtung, Analyse und Intervention aus. Am Ende steht die Erkenntnis, dass der Weg zu den Sternen manchmal auch über das Raue und Schmerzliche gehen kann. Der Autor: Klaus Eidenschink; Studium der Theologie, Philosophie und Psychologie; Organisationsberater, Coachingausbilder, Exekutive-Coach; Senior Coach im Deutschen Bundesverband Coaching e. V. (DBVC); Gründer und Leiter von Hephaistos, Coaching-Zentrum München; in der Geschäftsleitung des Gestalttherapeutischen Zentrums Würmtal. Arbeitsschwerpunkte: Beratung und Coaching des Top-Managements von großen Konzernen und mittelständischen Unternehmen in Fragen der Konfliktbewältigung, Changemanagement und der Entwicklung von Vorstands- und Geschäftsführerteams; Coaching von Manager:innen in komplexen Entscheidungssituationen; Teamentwicklungen mit sogenannten "schwierigen" Teams; Klärung von Konflikten zwischen Gruppen und Abteilungen. Veröffentlichungen u. a.: Die Kunst des Konflikts. Konflikte schüren und beruhigen lernen (3. Auf. 2024), Es gibt keine Narzissten! Nur Menschen in narzisstischen Nöten. Ein Handreichung für alle und jede(n) (2. Aufl. 2024).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Eidenschink
Das Verunsicherungsbuch
Warum das Gute auch schlecht ist.
Für Coaches und andere Mutige
2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Illustrationen: Katrina Franke
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich/Melanie Szeifert
Umschlagmotiv: Katrina Franke
Redaktion: Nicola Offermanns
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0570-1 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8513-0 (ePUB)
ISBN 978-3-8497-0571-8 (Audiobook)
© 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Vorrede
Zum Start: Die Ambivalenzen im Guten, Richtigen und Wahren
1 Für wen ist das Gute gut?
2 Angenehme Gefühle können trügen
3 Ist das, was man will, auch gut?
4 Der Schaden von Selbstverbesserung
5 Soll das innere Kind »Heimat finden«?
6 Die seelische Selbstverbesserungsanstalt
7 Bedürfnis – was ist das?
8 Die Sache mit der seelischen Gesundheit
9 Wenn die Person nicht zur guten Rolle passt
10 Veränderung aus Absicht(slosigkeit)
11 Woran kann man Gutes erkennen?
12 Ist »positives Denken« positiv?
13 Flucht in die Gesundheit
14 Wenn Empathie in die Symbiose führt
15 Lohnt es sich, sich zu verwöhnen?
16 Ist Frieden friedlich?
17 Vorsätze: Segen oder Fluch?
18 Zur Tragik und Unerlässlichkeit von Ambition
19 Vom Zwang der Freiheit
20 Balance als Scheinlösung
21 Das Gute hat immer Konkurrenz
22 Sollte man eins werden mit sich selbst?
23 Selbstbestätigung oder Verunsicherung?
24 Selbstbewusstsein oder Selbst-Bewusstsein?
25 Das falsche »wahre Selbst«
26 Ist Wahrheit gewiss?
27 Trügerischer Erfolg
28 Über Scheinheiligkeit von Konsens
29 Lösungen machen bisweilen blind
30 Funktionalisierte Achtsamkeit
31 Einfach machen! Ernsthaft?
32 Kann Denken wahr sein?
33 Gleichheit der Ungleichen?
34 Grenzen setzen? Geht nicht!
35 Warum autonome Menschen nicht autark sind
36 Führung kann nie gut sein
37 Planen mit Überraschungen?
38 Ohnmächtige Allmacht
39 Vom Schaden idealer Beziehungen
40 Über Loch-rauskrabbel-Probleme
41 Authentisch sein in sozialen Rollen
42 Das Merkmal von Scharlatanen
43 Fehler machen dürfen? Nein!
44 Vertrauen braucht Misstrauen
45 Stärken stärken?
46 Das Recht auf Unglück
47 Ein Appell, die Appelle bleiben zu lassen
48 Recht haben führt ins Unrecht
49 Über nicht ehrliche Ehrlichkeit und heilsame Intransparenz
50 Böse und gut
Zum Schluss: Sicher werden im Umgang mit Unsicherheit
Danksagung
Literatur
Über den Autor
»There is a crack in everything. That’s how the light gets in.«
Leonhard Cohen
Vorrede
»Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.«
Franz Kafka
Verunsicherung als Zielsetzung? Echt jetzt?
Haben wir nicht genug Unsicherheit in der Gesellschaft, in Organisationen, in der Politik, in der Beratungsbranche, ja eigentlich überall? Brauchen wir statt Verunsicherung nicht Sicherheit gebende Orientierungen und klare, wahre Handlungskonzepte, an denen wir uns festhalten können? Wo sind die eindeutigen Antworten auf die Frage, wie und woran sich Individuen, Gruppen, soziale Gemeinschaften und Organisationen orientieren können?
Sind es nicht gerade Berater und Coaches1, die dafür bezahlt werden, ihre Kunden mit Lösungen auf sicheres Gelände zu begleiten? Sollten nicht gerade Berater wissen, was gut und richtig ist? Welches Leistungsversprechen können sie noch abgeben, wenn sie selbst nicht wissen, was hilfreich ist und was nicht? All diese Fragen sind voller Implikationen, voller Vorannahmen, voller Selbstverständlichkeiten, die keine sind.
Was, wenn das vermeintlich Gute und Richtige gar nicht nur gut und richtig ist? Was, wenn in einer komplexen Welt einfache Antworten eher verdächtig oder gar grundfalsch sind? Was, wenn anstelle von äußeren Lösungen eher Antworten im individuellen Innenleben benötigt werden? Wenn das Klare in einer unklaren Welt eher falsche Sicherheit bietet? Wenn Kompetenz im Umgang mit dem Unklaren, dem Vagen, dem Verwickelten, dem Rätselhaften gefragt wäre und nicht Eindeutigkeiten, die der Welt nicht gerecht werden?
Dann braucht es in der Tat ein Verunsicherungsbuch wie das vorliegende. Dies ist ein Buch für Rätselfreunde, für Liebhaberinnen des Unbestimmten und des neu zu Bestimmenden. Menschen, die mit der Möglichkeit rechnen, dass das, was man für gut hält, auch schlecht sein könnte, halten das passende Buch in den Händen. Denen liefert es nicht neue, bessere Wahrheiten, sondern erst mal ungewöhnliche und variantenreiche Reflexionen, die Selbstverständliches und Gewohntes hinterfragen. Es will dem Vertrauten die verborgenen, unvertrauten Aspekte abgewinnen. In den Schattenwürfen der Lichtkegel verbergen sich die Phänomene, die erklären, warum das Gute bisweilen schlechte Züge haben kann.
Das Buch sucht und braucht mutig-ängstliche Leser. Nicht an jeder Stelle, nicht überall in gleicher Weise. Mut braucht man im Unbekannten. Angst hat man im Unsicheren. Mögliche Erkenntnisse und Beruhigungen können sich bisweilen erst einstellen, wenn man sich für Momente ins Undefinierte und Vage fallen lässt. Dort, wo die Schattenlichter warten und nicht mehr so ganz klar ist, wie sich hell und dunkel verteilen und ineinanderwirken.
Wer dazu Lust hat, der ist hier richtig.
Klaus Eidenschink
Krailling, im Juli 2024
1 Die deutsche Sprache stellt derzeit keine Formen zur Verfügung, in denen sich alle Identitäten – Männer, Frauen, Diverse – in gleichem Maß leicht wiederfinden können. Daher bitte ich alle Menschen, die den Text lesen, sich gemeint zu fühlen und sich in allen gewählten Bezeichnungen selbst zu erkennen.
Zum Start: Die Ambivalenzen im Guten, Richtigen und Wahren
»Der Umweg ist das Ziel.«
Peter Fuchs
Dieses Buch wird sich mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Umgang mit guten Zielen, mit der Bestimmung des Guten, mit der Erkenntnis von Wahrheit, mit Sinn und Erfolg, mit Glück und Unglück auseinandersetzen. Auf der anderen Seite reflektiert es den Stellenwert von Krisen, die Bedeutung von unangenehmen Empfindungen bei Veränderungen, mögliche Irrtümer über sich selbst und das nur vermeintlich Gute.
Dies sind allesamt Themen, die nicht nur für Coaches und Berater essenziell sind, sondern für alle, die sich und ihre Mitmenschen besser verstehen lernen wollen. Die Anlässe für Beratung liegen meist im Wunsch, glücklicher, gesünder, erfolgreicher, stabiler und zielgerichteter zu werden. Da liegt es eigentlich nahe, Rechenschaft abzulegen, wie tragfähig die bestehenden Konzepte von Glück, Gesundung und Erfolg sind.
Berater, Coaches, Therapeuten, Trainer, Facilitators – alle wollen helfen, etwas zum Besseren zu wenden. Nur was ist das Bessere? Und für wen? Wer kann es erkennen? Woran lässt es sich erkennen? Ist es irrtumsfrei bestimmbar? Kann man es sich ausdenken? Oder muss man es erfühlen? Erkennt man es an guten Gefühlen? Am Glück? Für den Einzelnen? Für das Umfeld? Für alle? Oder geht der Weg zu den Sternen auch über das Raue, Schmerzliche, wie schon die Stoa wusste? All solche Fragen werden in diesem Buch eine Rolle spielen.
»Alle Menschen wollen das Gute. Aber wir Menschen können uns darin irren, was gut für uns ist!«
Diese Sentenz ist alt. Sie ist von Platon, der im Dialog »Gorgias« schon das Beispiel nennt, dass jemand, der Lust am Quälen hat, sich im Irrtum darüber befindet, dass seine Handlungen gut sind. Damit ist schon mal klar, dass es kein Phänomen der Wohlstandsgesellschaft oder Merkmal einer hyperindividualistischen Gesellschaft ist, sondern es ist seit alters her ein Ringen: Wie kann Leben glücken, und warum haben Menschen ein immenses Potenzial, sich unglücklich zu machen und es auch zu bleiben?
Früher war es vermeintlich einfach: Es galt als Anmaßung, selbst zu entscheiden, was gut ist. Stattdessen versuchte man, auf göttliche Gebote zu hören, die eigene Entscheidungen, worin das Gute besteht, fast überflüssig machten. Das Gute war vorgegeben und die Aufgabe bestand darin, die Abweichung zu vermeiden. Aber auch das gelang nicht. Man nannte es sündigen. Selbst die Gerechten fielen sieben Mal am Tag. Der Irrtum, das Versagen wurden normalisiert und ließen sich über Reue und Vergebung korrigieren.
Heutzutage ist das schwieriger. Es gilt oft als Makel und Versäumnis, nicht das Beste aus sich zu machen. Die Lebensaufgabe in der modernen Welt lautet, glücklich zu sein. Der Kampf ums Überleben ist bei einem Großteil der Menschen in der westlichen Welt dem Ringen um ausreichend Glück gewichen. Doch können wir Menschen so einfach wissen, was uns glücklich macht? Was ist eigentlich Glück? Und warum scheint es so vielversprechend? Auf welche der inneren Stimmen sollen wir hören? Liegt es vielleicht mehr an der Art, wie wir auf unser Leben und die Welt schauen, ob wir Glück oder Unglück sehen?2
Wir sind nicht automatisch in einer seelischen Verfassung, die garantiert, dass wir gute Entscheidungen fällen können bzw. sie in Handlungen umsetzen. Jeder kennt es von sich und anderen: Wir suchen nach der richtigen Ernährung und verirren uns in den Empfehlungen. Wenn wir zu wissen glauben, was gesund ist und was nicht, dann essen wir trotzdem Ungesundes. Selbst wenn es gelingt, »richtige« Entscheidungen auch konsequent zu leben – sind wir dann wirklich glücklich?
Für Coaches und Berater verschärft sich das Problem. Sie müssen bestimmen, wer denn nun entscheidet, was für den Klienten gut ist? Da gibt es unterschiedliche Lager. Die einen glauben, das Gute zu kennen, und versuchen, den Klienten dorthin zu bringen. Dann aber wäre für alle das Gute gleich, und es bliebe das Problem, wie man nun den Klienten dorthin bringt. Da man weder im Kopf des anderen denken und in ihm fühlen kann noch in ihm handeln, haben Coaches dieses Zuschnitts ein Umsetzungsproblem. Sie werden im Grunde zu (schlechten) Pädagogen alten Stils, die ihre Klienten zum Richtigen hin »erziehen« wollen.
Das andere Lager glaubt, dass die richtige Erkenntnis des Guten im Klienten liegt. Dann muss man ihn fragen, wo er hinmöchte. Auch das hat gewaltige Tücken. Denn – um ein deutliches Beispiel zu wählen – frage ich den Alkoholsüchtigen, was ihm guttäte, wird er mir von seinem Wunsch nach einer großen Flasche Rum erzählen. Wenn ich ihm helfe, dieses Beschaffungsproblem zu lösen, habe ich einen sehr zufriedenen Kunden (selbst wenn er weiß, dass es ihm »eigentlich« nicht guttut). Er wird mich auch neuerlich beauftragen. Es ist sogar ein besonders sicherer Weg, an Folgeaufträge zu kommen. Aber tue ich damit Gutes? Wäre es einfach, Alternativen ins Spiel zu bringen? Mit welchem Recht täte man das? Bei Sucht ist es vermeintlich noch einfach. »Deine Leber wird Schaden nehmen!« – damit interveniert man im Namen von Gesundheit (und wechselt ins erste Lager der Pädagogen und Problemlöser). Aber was ist, wenn der andere lieber glücklich süchtig ist und ein kürzeres Leben in Kauf nehmen will? Gibt es eine Pflicht, gesund zu leben? Juli Zeh hat dies in ihrem Roman Corpus Delicti sehr eindrücklich dargestellt, mit welchen absurden und totalitären Konsequenzen man zu rechnen hätte.
Weniger auffällig – aber prinzipiell gleich – ist das Problem, wenn die Sucht nicht (Substanz-)Drogen gilt, sondern »Glücksdrogen« wie – die Aufzählung mag zunächst überraschen – Erfolg, Karriere, Reichtum, Mäzenatentum, Sport, Sex, Kinder, Reisen, Gärtner etc., von denen man sich ein erfülltes Leben, Sinn oder Sicherheit verspricht. Was unterscheidet den Satz »Ohne Schnaps kann ich nicht leben!« von Sätzen wie »Ohne Sport (alternativ: ohne Kinder, ohne Sex, ohne Reisen, ohne sinnvolle Arbeit etc.) kann ich nicht leben«? Oder beratungsnäher: »Ich möchte/Wir möchten der/die Erfolgreichste(n) sein.« Denn Erfolg, Sport, Kinder, Sex, Arbeit und Reisen können in ihrer seelischen Funktion den gleichen Stellenwert haben wie Schnaps. Sie lenken ab von unangenehmen Gefühlen, vom Schmerz früh erlebter Wunden, von Einsamkeit, von Sinnlosigkeit, von fehlender emotionaler Tiefe oder der Unbeholfenheit, intensiven Kontakt mit anderen zu erleben.
Hier nimmt das Buch seinen Ausgang. Wenn weder Berater noch Klienten eindeutig wissen können, was Problem und was Lösung ist, bzw. beide Seiten irrtumsanfällig sind, dann hilft es nicht, sich auf eine Seite zu schlagen. Dann könnten Perspektivenwechsel und Anreicherungen mit weiteren Möglichkeiten hilfreich sein. Und vor allem individuelles und genaues inneres Erforschen – nicht nur bei und mit den Klienten, sondern vor allem auch als Berater und Coach immer wieder neu in sich selbst. Das soll hier versucht werden.
Das Buch entfaltet sich anhand von 50 Themen, die jeweils einen grundlegenden Aspekt hinterfragen, der gängigerweise als gut, richtig, erstrebenswert oder glücksverheißend angesehen wird. Ich versuche dabei, Facetten zu thematisieren, die ich für vernachlässigt erachte, Einseitigkeiten im Gebrauch zu benennen und Alternativen anzubieten.
Die Kapitel sind weitgehend in sich abgeschlossen und bauen nicht aufeinander auf. Man kann das Buch also rückwärts, durcheinander oder einfach nach den eigenen Interessen lesen. Selbstverständlich auch in der von mir gewählten Reihenfolge. Ich rate eher zum häppchenweisen »Verzehr«. Dann bleibt zwischen den Texten Zeit zum Verdauen sowie zum Entwickeln eigener Gedanken.
2 Siehe dazu das großartige Buch von Elke Heidenreich (2024) Altern: Alle wollen alt werden, aber niemand will es sein. Ist das nicht absurd?
1 Für wen ist das Gute gut?
»Wer das Gute für gut hält, verdirbt es.«
Friedrich Nietzsche
Die Frage ist merkwürdig, oder? Wenn der Coach den Klienten fragt, was er will, dann bekommt er eine Antwort. Meistens jedenfalls. Aber wer antwortet? Von dem Konzept, dass die Psyche ein monolithisches, einheitliches Etwas sei, hat man sich in vielen psychologischen Theoriebildungen, vor allem aber in den meisten psychotherapeutischen Schulen, verabschiedet. Die Seele ist ein von vielen Möglichkeiten und Interessen bevölkertes Gebiet. »Ich bin viele!« ist das einschlägige Motto. Wenn das so ist, stellt sich allerdings sofort die Frage, welcher »Teil« des Klienten antwortet auf die Frage nach dem guten Ziel der Beratung? Für welchen Teil ist das Gute gut? Könnte es Teile geben, für die das Gute schlecht ist? Wie kommt es zu »Teilen«, also zu der Möglichkeit, dass die Seele mit sich selbst sprechen kann und damit auch mit sich selbst im Clinch liegen kann? Wie stabilisieren sich solche »Sub-Persönlichkeiten«, sodass man ihnen auch Namen oder Bezeichnungen geben kann? Warum ist es geboten, die Psyche als mannigfaltiges Geschehen zu begreifen und nicht als ein »Ich« oder ein »Selbst«?3
Keine Person kann sich selbst durchsichtig sein. Wenn man sich selbst beobachtet und wahrnimmt, registriert man immer nur einen Ausschnitt. Insbesondere kann man die sich selbst beobachtende Instanz nicht gleichzeitig selbst beobachten. Also sieht man etwas und wird gleichzeitig blind, weil man eben nicht darauf schauen kann, was jenseits des gewählten Ausschnittes ist. Deshalb ist es selbst beobachtenden Systemen wie der Psyche nicht möglich, einen Gesamtüberblick der internen Prozesse zu haben. Jede Selbstbeobachtung ist eine Wahl, die auch anders ausfallen könnte.
Jede Sicht eines Klienten auf sich selbst ist somit ein Fragment und nie das Ganze! Solche »Teile«4 des Innenlebens sind keine feststehenden inneren Instanzen, sondern Platzhalter für zahllose innere Konfliktmöglichkeiten. Damit eine Veränderung seelischer Muster möglich wird, ist es unerlässlich, dass diese Selbstrepräsentanzen getrennt und unabhängig voneinander erlebt werden.5 Jede Selbstauskunft des Klienten, die mit »Ich …« beginnt, ist demnach immer fragwürdig. Wenn jemand etwas will oder nicht will, dann könnte eine andere Repräsentanz in ihm das genau andersherum empfinden. Andere Aspekte der Psyche des Klienten haben andere Ansichten, Absichten, Gefühle und Wünsche. Wie sehr dieses Phänomen so gut wie jede Beratung bestimmt, lässt sich recht einfach erkennen.
In der Regel kommen Klienten mit einem Anliegen, das die Form hat »Ich möchte Mich verändern!« Wer will denn da wen verändern?6
Dieser simple Satz macht offenbar, dass die Psyche nicht aus einem Guss ist. Es sind mindestens zwei Repräsentanzen im Spiel. Darin zeigt sich gleichzeitig, wie unvollständig die Selbstkenntnis des Betroffenen ist: Wüsste nämlich das »Ich«, warum das »Mich« für den ihm eigenen Veränderungswunsch »motiviert« werden muss, dann bräuchte es gar kein Coaching, denn dann hätte der Klient sich ganz von selbst verändert. Deshalb muss man erforschen, wie das »Mich« auf den Wunsch des »Ich« reagiert, dass es verändert werden soll! In aller Regel ist dieses Mich vom Coachingziel des Ich nicht sehr begeistert und wehrt sich. Coaching läuft also immer Gefahr, zum Mittel der »Überwindung« des Mich im Dienst des Ich zu werden. Welche Bedeutung hat es, dass das Ich etwas anderes will als das Mich? Welche Folgen hat dieser innere Konflikt für die Veränderungsdynamik?
Der Coach muss klären: Wer von den beiden Aspekten des Klienten – Ich oder Mich – ist nun der Auftraggeber? Viele denken, dass es das Ich sei, also die innere Instanz, mit der der Klient sich identifiziert. Denn das ist der relevante Unterschied der beiden: Das Ich ist der Teil der Psyche, der das Sagen hat. Das Mich ist derjenige, der aus der Perspektive des Ich (!) unerwünscht, ungeliebt, ungünstig, unperfekt, untauglich etc. ist. Was aber, wenn genau darin das eigentliche Problem liegt? Oft sind diese Ichs geprägt von Vorstellungen, wie man zu sein hat. Sie repräsentieren Normen oder Ideale, sie sind voll von Selbstverbesserungsideen und treiben das Mich an, um schneller, angepasster, stärker, unabhängiger, perfekter, ausdauernder oder durchsetzungsfähiger zu werden.7
Nicht selten sind sie eine Verinnerlichung früher Bezugspersonen. In dem Fall ist das Ich gar nichts »Eigenes«, sondern es hat Ziele und Werte von anderen übernommen. Das Mich entpuppt sich dann als die eigentliche Instanz der Psyche, die den Job übernommen hat, sich gegen Entfremdung und gegen Vereinnahmung zur Wehr zu setzen. Oder es repräsentiert wichtige Ängste, Beschämungen und Schuldgefühle, die integriert und gerade nicht weggemacht werden sollten. Denn genau sie sind der Schlüssel für nachhaltige Veränderung der innerseelischen Gewohnheiten und Muster.
In all diesen Fällen wäre es im Coaching ein Kardinalfehler, wenn man vorschnell Partei ergreift und dem Ich hilft, seine Ziele zu erreichen. Mit der Frage »Was wollen Sie im Coaching erreichen?« droht man demnach, sich auf die momentane Identifikation des Klienten als Gesprächspartner einzuschränken.
Wer das gegenwärtig sprechende Verlautbarungsorgan des Klienten für dessen ganze Wahrheit hält und dem Klienten hilft, dessen Ziele zu verfolgen, schadet ihm in vielen Fällen, da dann das Ich und der Coach sich verbünden und das Mich des Klienten zu verbessern versuchen. Dann entsteht nämlich eine Situation von zwei (Coach und Ich) gegen einen (Mich). Damit würde sich in vielen Fällen die seelische Tragik des Klienten im Coaching fortsetzen bzw. würde dort noch verstärkt werden. Statt Hilfe fände eine Reinszenierung ungünstiger Selbstregulationsmuster statt.
Deshalb ist jedes Veränderungsanliegen grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen und aufklärungsbedürftig. Jeder Zustand, den ein Mensch einnimmt, ist selbst hergestellt. Jemand der Angst hat, dem fällt die Angst nicht frühmorgens von der Decke in den Schädel, sondern er produziert dieses Gefühl auf eine ihm unbekannte Weise. Soll nun diese Angst im Coaching beseitigt werden, wird dies die Ängste des ängstlichen Teils zusätzlich schüren. Die Selbstabkapselung der angsterzeugenden seelischen Prozesse wird zunehmen, sollte es im Coaching gelingen, die Ablehnung unerwünschter Gefühle zu perfektionieren. Stattdessen wäre es wichtig herauszufinden, wie der Klient seine Ängste täglich neu erzeugt bzw. aufrechterhält.
Nimmt man diese Überlegungen ernst, ist zu Beginn jeder psychologischen Beratung die wichtigste Frage: Welcher Teil des Klienten spricht (mit mir)? Welche Seite von ihm möchte seine Vorstellung des Guten für die Gesamtperson verwirklicht sehen?8 Ebenso wichtig wäre es, die Seiten des Klienten zu erforschen, die erst gar nicht zu Wort kommen. Hinter jedem Problem könnte man den zugrunde liegenden inneren Konflikt erforschen und bearbeiten. Coaching wäre ein Erkundungsraum und der Ort, in dem die Kräfte des Klienten sich neu und anders organisieren und strukturieren können.
3 Zu all diesen Fragen gibt es eine Fülle an Literatur. Als Einstieg eignet sich ganz gut Staemmler (2015).
4 Andere psychologische Begriffe für diese Unterscheidung sind Seiten, Ego-States, Modi, Teammitglieder, Selbstanteile, Selbstrepräsentanzen, Selbstpositionen, Introjekte, innere Stimmen, innere Kinder und Erwachsene, Ich-Zustände, um hier nur die wichtigsten zu nennen. Ich werde im Weiteren von Selbstrepräsentanzen sprechen.
5 Diese Auffassung teilen inzwischen sehr viele Konzepte: Inneres Team (Schulz von Thun 2004), Ego-State (Fritzsche et al. 2014; Watkins u. Watkins Huth 2019), Schematherapie (Jacob 2013; Migge 2013; Roediger 2009a; b; Roediger et al. 2013; Sachse et al. 2008), Stuhlarbeit (Staemmler 2015, 2009, 1995), (Boeckh u. Wulf 2019), IFS (Dietz u. Dietz 2007), systemische Teilearbeit (Holmes 2014; Peichl 2007, 2013, 2019, 2022) u. v. a. m.
6 Ich verstehe in der Folge das Ich als einen »Teil« des Klienten und das Mich als einen anderen »Teil«, sodass man sich vorstellen kann, dass diese beiden Seelenteile miteinander agieren und im Dialog sind.
7 Es gibt in den meisten Menschen viele dieser inneren Konflikte zwischen Ich und Mich. Diese sind also keine dauerhaften »Teile«, sondern aktivierte innere Spannungszustände, die sich so beschreiben lassen.
8 Eine umfangreiche persönlichkeitspsychologische Begründung dieser Überlegungen findet sich bei Staemmler (2015).
2 Angenehme Gefühle können trügen
»Im Schmerz ist so viel Weisheit wie in der Lust: Er gehört gleich dieser zu den arterhaltenden Kräften ersten Ranges.«
Friedrich Nietzsche
Wer sich verändern möchte, will sich – in welcher Hinsicht auch immer – besser fühlen. Was sollte uns sonst motivieren? Also: Schlechte Gefühle runter, gute Gefühle hoch. Doch geht es so einfach? Gibt es den direkten Weg von unangenehmen zu angenehmen Gefühlen? Kann man unangenehme Gefühle abstellen? Sind angenehme Gefühle nie trügerisch? Sind es vielleicht manche der unangenehmen Gefühle, die uns den Weg weisen zu mehr Freiheit?9
Grob geschätzt kamen 85 % meiner Coaching- und Therapieklienten in den letzten 30 Jahren auch deshalb zu mir, um sich unangenehmer Gefühle zu entledigen. Was sollte nicht alles verschwinden: Ängste, Schuldgefühle, Unsicherheit, Scham, Eifersucht, Trauer, Neid, Groll, Ärger, Wut, Verzweiflung, Grauen, Grausamkeit, Ohnmacht, Leere u. a. m.! Die Strategie, seelisch unangenehme Empfindungen abschalten zu wollen, ist weit verbreitet. Das ist einleuchtend – und es hat gewaltige Nebenwirkungen. Das wird klarer, wenn man diese Vorgehensweise auf körperliche Vorgänge überträgt.
Wer als Kind auf die heiße Herdplatte greift und sich die Handfläche so stark verbrennt, dass alle Empfindungen dort abgestorben sind, würde zu Recht sagen, er habe eine Behinderung. Denn er braucht als Erwachsener für den Fall, dass er neuerlich mit der Hand auf einer heißen Herdplatte landet, sekundäre Wahrnehmungskanäle – etwa den Geruchssinn –, um zu merken, dass etwas schiefläuft. So ist es mit unangenehmen Gefühlen auch. Sie sind unersetzliche Signale, um sich im Leben zu orientieren. Angst, Trauer, Scham, Schuld etc. sind nötig wie die Nerven in der Handfläche. Alle diese Gefühle informieren mich über die eigenen seelischen Verarbeitungsstrategien oder geben mir Hinweise, welche äußeren Reize mich in innere Schwierigkeiten bringen.
Wenn man nun ständig – ohne oder mit wenig Bezug zur aktuellen Situation10 – mit unangenehmen Gefühlen zu tun hat, dann kann das daran liegen, dass man ihre Funktion nicht verstanden oder herausgearbeitet hat. Sie sind nämlich vermutlich keine Antwort auf die Gegenwart mehr, sondern ein Ergebnis eigener Erwartungsmuster.
Was ist mit Erwartungsmustern gemeint? Wer sich zeigen will und in der Vergangenheit gelernt hat, dass andere ihn beschämen, wird in der Gegenwart vorsichtig und ängstlich agieren, solange ihm die erlernten Annahmen unbewusst schlimme Folgen prophezeien. Anders formuliert: Die erlernten, unbewussten Annahmen bestimmen das Handeln, nicht die aktuelle Situation. Die Prozesse, die Angst auslösen, sind nicht die äußeren Trigger, sondern die inneren Vorstellungen.
Wer nun eine derartige Angst oder andere Gefühle aus der obigen Liste nicht haben möchte und sie deshalb abschalten will, bestraft sich selbst mit einer seelischen Leidensspirale bzw. bedroht sich mit psychischer Selbstverstümmelung. Denn an den Vorannahmen solch ängstlicher, beschämter oder beschuldigter Seiten ändert sich nichts, wenn man sie – oft mithilfe von Kurzzeit- oder Erfolgscoaching – verdrängt, abspaltet oder schönzureden versucht. Denn dann weiß man weder, welchen inneren Grund die Angst hatte, noch hat man mit ihr Verbindung aufgenommen, noch konnte man selbst lernen, mit dieser Angst anders umzugehen, noch konnte man sie integrieren.
Unangenehme Gefühle nicht mehr fühlen zu wollen, ist erst mal verständlich. Gelingt es, dreht sich die seelische Leidensspirale weiter im Kreise. Der nachvollziehbare Wunsch, sich »gut« oder »besser« zu fühlen, bildet den Boden für derartige Zielsetzungen und die Vielzahl an Beratungsformen, die schnelle Besserung versprechen. Das Problem sind allerdings nicht die Gefühle selbst, sondern es ist die Bewertung dieser Gefühle. Sicher – solche Empfindungen sind sehr unangenehm. Wenn man sie verlässlich und wiederkehrend erlebt, dann hat dies wichtige Gründe.
Einer könnte sein, dass man mit ihnen allein war
ein anderer, dass sie mit Bedürfnissen »verklebt« sind
11
ein weiterer, dass man nicht gelernt hat, mit emotionaler Intensität umzugehen
ein weiterer, dass man sich in solchen Zuständen ablehnt, denkt es sei etwas nicht in Ordnung oder
dass man Sorge hat, andere kämen damit nicht zurecht.
Die Muster, die dazu führen, dass man sein eigenes (!) Erleben bekämpft und etwas anderes fühlen will, als man fühlt, sind endlos. Wer dies tut oder sich dabei auch noch unterstützen lässt, macht sich unglücklich.
Verbündet sich ein Therapeut oder ein Coach nun mit dem Klienten im Kampf gegen die als unangenehm etikettierten Zustände, dann kommt zur Selbstablehnung noch die damit verbündete Fremdablehnung. Es gibt viele Tricks, um Klienten in »gute« Gefühlslagen zu bringen und »positive« Gedanken zu evozieren. Das ist leicht und zu Beginn (!) eines Beratungsprozesses so gut wie immer falsch.12 Denn meist sind es die als unangenehm erlebten Gefühle, die einen mit wichtigen Informationen über sich und seine Geschichte versorgen. Sie sind das Tor, das verschlossene Selbstwahrnehmungsebenen eröffnet. Am wichtigsten aber ist: Der seelische Schmerz ist häufig die Instanz, die von vergessenen und vermeintlich gefährlichen Bedürfnissen weiß.
Warum ist das so? Wenn Menschen (früh) mit manchen ihrer Bedürfnisse bekämpft, ignoriert oder ausgenutzt wurden, verknüpfen sich diese Bedürfnisse mit unangenehmen Gefühlen. Sie werden mit Schmerz besetzt. Wenn man sich diese Bedürfnisse als Erwachsener wieder zugänglich machen möchte, kommt man an diesen schmerzlichen Empfindungen nicht vorbei. Sie sind der Hinweis, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist, sondern dauerhaft oder immer wieder die neue Gegenwart dominiert. Um folglich wieder zu seinem Bedürfnis zu finden, muss auch der damit verbundene und immer wieder aktualisierte Schmerz durchlebt werden. Wer Altes nicht wiederholen will, muss das gespeicherte Unglück anschauen lernen. Das gilt es im nächsten Kapitel genauer zu verstehen.
9 Anregungen finden sich bei: Baer u. Frick-Baer (2017); Damasio (2003); Kast (2001); Koemeda-Lutz (2009); Lammers (2016); Stümpfel (2006); Heller u. Doerne (2020); Schneider et al. (2012).
10 Wer sich vor dem heranstürmenden Hund fürchtet, hat eine Emotion mit Gegenwartsbezug, wer um einen geliebten, verstorbenen Partner trauert, ebenso, und wer stolz ist, eine Abschlussprüfung bestanden zu haben, auch.
11 Dazu später mehr!
12 Viele Coaches versuchen das, weil sie hoffen, mit diesem Ansatz das Wiederkommen des Klienten sicherzustellen. Das geht allerdings auch anders. Wenn im Rahmen des Beziehungsaufbaus im Vordergrund steht, der »eigentlichen« Not mit Interesse, Empathie, Aufmerksamkeit, liebevollem und gemeinsamem Erforschen auf die Schliche zu kommen, ist die Motivation genauso gegeben. Wichtig ist nur, dass es kein Wühlen im Schmerz oder der Vergangenheit ist, sondern dass es dazu dient, die Gegenwart zu begreifen.
3 Ist das, was man will, auch gut?
»Nichts hat einen stärkeren psychischen Einfluss auf ein Kind als das ungelebte Leben seiner Eltern.«
C. G. Jung
Der Begriff »Bedürfnis« bezeichnet unsere Fähigkeit als Menschen zu spüren, was wir brauchen, was wir wollen und was uns guttun könnte. Die Erkenntnis dessen, was uns nährt und wachsen lässt, ist also kein ausschließlich kognitiver Vorgang, sondern eine umfassende Selbstwahrnehmungsleistung. Diese Form der Selbstkenntnis ist bei fast allen Menschen ohne tiefergehende Auseinandersetzung mit eigenen Mustern leichter oder stärker eingeschränkt. Warum?
Wir erlernen die Regulation unserer Bedürfnisse sehr früh im Kontakt mit anderen. Mit manchem, was wir als Kinder wollen – sei es Nah-Sein, Für-sich-Sein, Unbekümmert-Sein, Geschützt-Sein, Einzigartig-Sein oder Zugehörig-Sein –, erleben wir bestärkende und verbindende Resonanz, bei anderem jedoch laufen wir ins Leere, werden beschämt oder abgewertet, erfahren Zurückweisung oder Aggression. Geschieht dies regelmäßig – z.B. »Immer dann, wenn ich Trost brauche, ist keiner da!« –, umschließt und ummantelt ein Schmerz dieses Bedürfnis. Aus einem Bedürfnis wird ein »Aua-Bedürfnis«. Kein Kind will »Aua«. Also bringt es das Bedürfnis zum Verschwinden, damit der Schmerz weggeht, und sucht sich gleichzeitig ein Ersatzbedürfnis, das die Lücke füllt.
Wer behauptet, jeder wüsste selbst am besten, was für ihn gut ist, vergisst, dass man vergessen möchte, was einem guttut, wenn es mit Schmerz gekoppelt ist. Jeder, der auch nur mit einem einzigen Bedürfnis unzureichende Resonanz erfahren hat – also jeder! –, ist nicht mehr an seinem Bedürfnis, sondern an der Vermeidung des zugehörigen Schmerzes orientiert. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass man »eigentlich« Angenehmes als unangenehm empfindet. Man erlebt Nähe als bedrängend oder vereinnahmend, man erlebt Für-sich-sein-Wollen mit Sorge vor Isolation, man erlebt Freiheit als zu riskant, Pläne als Korsett, Hervortun als gefährlich, Zugehörigkeit als Ich-Verlust – um mal nur ein paar wenige Beispiele zu nennen.
Es gibt deshalb z. B. keine Angst vor Nähe! Denn Nähe ist für die Seele lebensnotwendig – nicht immer und nicht mit jedem, aber per se ist Nähe angenehm. Ist jedoch Nähe mit Angst vor Vereinnahmung verbunden, führt es dazu, dass man Nähe mit unangenehmen Erwartungen verknüpft. Fragt man nun so jemanden, was er sich wünscht, ist die Antwort: »Ich möchte lernen, mich besser abzugrenzen!«13 Das ist allerdings in diesem Beispiel der vollkommen falsche Fokus, weil er dazu dient, die Angst zu beruhigen und nicht das Nähebedürfnis von damit verbundenen Ängsten zu befreien.
Es gibt folglich auch keine Angst vor Freiheit, stattdessen nur Angst, dass Freiheit zu riskant ist und ihr Gebrauch zum Schaden gereicht. In diesem Fall ist die Antwort auf die Frage, was man sich wünscht, wieder der Versuch, im Außen (!) das Risiko zu mindern, z. B. also: »Ich möchte in einem psychologisch sicheren Team arbeiten!« Man will also nicht lernen, mit einem Risiko zurechtzukommen, sondern man möchte risikolos frei sein. Das geht nicht. Das Bedürfnis nach Sicherheit missbraucht man somit, um dem Risiko der Freiheit zu begegnen. Eine erlernte Angst lässt sich durch günstige äußere Umstände nie wirklich beruhigen. Aber sie lässt sich bearbeiten und auflösen.
Für das dritte Beispiel gilt Ähnliches. Wer sich hervortut und sich zeigt und eine an diesen Wunsch gekoppelte Angst vor Beschämung in sich trägt, wird vorsichtig sein. Fragt man ihn, was er sich wünscht, könnte eine Antwort lauten: »Ich möchte, dass hier im Team alle gleich viel gelten und wichtig sind!« Auch das ist ein Versuch anhand äußerer Bedingungen den inneren Konflikt zu beruhigen. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit dient dazu, der Angst vor Einzigartigkeit zu begegnen. Da aber niemand die äußeren Verhältnisse kontrollieren und sicherstellen kann, wird die Angst bleiben.
Ob also ein Wunsch einem Bedürfnis oder der Vermeidung einer Angst dient, muss erforscht werden. Es ist entscheidend, dass man die Funktion eines Impulses oder Anliegens lesen lernt – bei sich selbst und im Dialog mit anderen. Sonst verfehlt man sich. Man irrt sich in Bezug auf das, was man will, weil man nicht weiß, warum man es will.
Psychologisch sagt man, dass ein Stabilisierungsinteresse und kein Veränderungsinteresse vorliegt.14 Man will besser werden im Abwehren der unangenehmen Gefühle: Der Erfolg in der Karriere soll die Minderwertigkeitsgefühle überdecken. Das Erreichen von Zielen soll Sinn ins Leben bringen und innere Leere verschwinden lassen.
Darum sind alle Arten von unangenehmen Gefühlen potenziell die Türöffner, um verlorene Bedürfnisse wiederentdecken zu können, sich vom Zwang der Vermeidung zu befreien und die Nutzlosigkeit von Ersatzbedürfnissen zu erkennen. Dazu muss man sich diesen Seiten seiner selbst zuwenden können – und nicht sie auszumerzen oder zu verbessern suchen.
13 Um Missverständnisse auszuschließen: Innere Grenzen zu spüren und diese auszudrücken, kann natürlich auch einem Distanzbedürfnis entsprechen bzw. eine Reaktion auf übergriffiges oder symbiotisches Kontaktverhalten anderer sein. Wie jedes Verhalten muss man es auf seine Funktion hin untersuchen.
14 Collatz u. Sachse (2011).
4 Der Schaden von Selbstverbesserung
»Das Streben nach Vollkommenheit macht manche Menschen vollkommen unerträglich.«