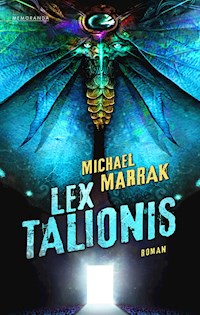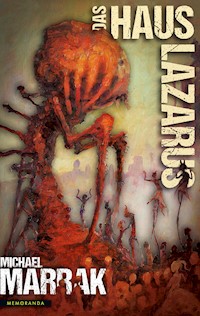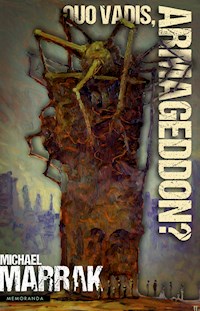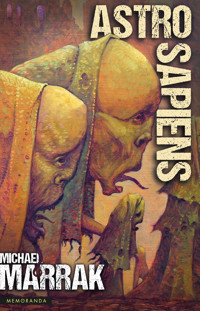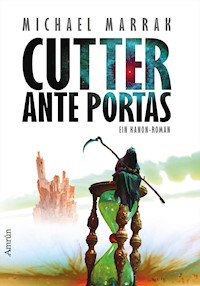Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Memoranda
- Sprache: Deutsch
Als sogenannter Rekon verfügt der Fallanalytiker Alexander ›Lex‹ Crohn über die Gabe in die Vergangenheit zu blicken. Ausgelöst werden diese als ›Echos‹ bezeichneten Visionen durch das Berühren eines am Tatort befindlichen Gegenstands oder des Opfers selbst. Die Erkenntnis, es in seinem aktuellen Fall mit demselben totgeglaubten Feind zu tun zu haben, der vor acht Monaten für eine bizarre Mordserie verantwortlich war, lässt Lex ahnen, dass er und seine Mitstreiter diesmal nicht die Jäger sind, sondern die Gejagten. Doch haben sie es wirklich nur mit einem Gegner zu tun, oder ist das, was sie verfolgt, womöglich fähig, sich in seinen ahnungslosen Wirten zu reproduzieren? Wem können sie noch vertrauen? Und wie sollen sie eine Entität bekämpfen, die ihr Katz-und-Maus-Spiel nicht nur auf die reale Welt beschränkt, sondern Lex in seinem vermeintlich ureigenen Territorium heimsucht: der Echo-Dimension? Die Suche nach dem Ursprung des Übels führt zurück in eine dunkle Vergangenheit – in eine Welt aus Tränen, Leid, Blut und Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Michael Marrak: De Profundis
© 2023 Michael Marrak (Text)
© 2023 Michael Marrak, nach Motiven von Holger Much (Titelbild)
© dieser Ausgabe 2023 by
Memoranda Verlag Hardy Kettlitz
Alle Rechte vorbehalten
Korrektur: Christian W. Winkelmann
Gestaltung: Hardy Kettlitz & Michael Marrak
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12
12053 Berlin
www.memoranda.eu
ISBN: 978-3-948616-84-7 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-948616-85-4 (E-Book)
Inhalt
VORSPIEL
TEIL 5
DER ZORN DES HOMUNKULUS
ZWISCHENSPIEL 4
TEIL 6
DER ARCHITEKT DER SÜNDE
ZWISCHENSPIEL 5
TEIL 7
DIE SYMMETRIE DER SCHATTEN
ZWISCHENSPIEL 6
TEIL 8
DAS ECHO DES BLUTES
EPILOG
Who never ate his bread in sorrow,
Who never spent the midnight hours
Weeping and waiting for the morrow,—
He knows you not, ye heavenly powers.
Suffering is permanent, obscure, and dark
And has the nature of infinity.
OSCAR WILDE, De Profundis
VORSPIEL
Als die letzten Häuser vor dem Abteilfenster vorbeizogen, waren Zoës Tränen längst getrocknet. Ihre Bestürzung war der Wut gewichen, die Wut letztlich der Resignation. Was übrig blieb, war das in Flashbacks wiederkehrende Entsetzen darüber, was geschehen war – und eine diffuse Angst, die sie kaum einen klaren Gedanken fassen ließ. Auf sie folgten Verzweiflung und Resignation – und schließlich eine Traurigkeit, die in eine tiefe innere Leere mündete.
An jeder neuen Haltestation befürchtete Zoë, dass Polizisten oder Zivilfahnder einsteigen könnten, um die Abteile nach ihr zu durchsuchen. Während vor dem Fenster die Lauben und Parzellen einer Schrebergartensiedlung vorbeihuschten, drehten Zoës Gedanken sich um den Fremden, mit dem sie hinter dem Haus ihrer Stiefmutter aneinandergeraten war. Irgendetwas an ihm war anders gewesen als bei gewöhnlichen Menschen – ganz zu schweigen von gewöhnlichen Polizisten oder Ermittlern. Zoë fand keine Worte für dieses Gefühl. Einerseits hatte er etwas Aufrichtiges, Wahrhaftiges ausgestrahlt, dem sie sich gerne anvertraut hätte, andererseits hatte ihn eine Aura umgeben, die ihr selbst jetzt, als sie an diese Begegnung zurückdachte, noch einen kalten Schauer über den Rücken jagte.
Nach ihrer Flucht aus dem Haus hatte sie mit dem Gedanken gespielt, die Speicherkarte ihres Handys zu entfernen und das Gerät zu entsorgen. Im letzten Augenblick hatte sie es wieder aus dem Bahnhofsmülleimer gefischt und es dabei belassen, es in den Flugmodus zu versetzen und das GPS zu deaktivieren.
Je weiter der Zug sich von der Stadt entfernte, desto nervöser wurde sie. Es stand außer Frage, dass spätestens seit dem Zwischenfall hinter der Villa nach ihr gefahndet wurde. Der Fremde, den sie mit einem Tritt ins Reich der Träume geschickt hatte, hatte ihr Gesicht gesehen, und für die Behörden war sie beileibe keine Unbekannte.
Ihre Flucht war eine Fahrt ins Ungewisse, ein Trip ohne wirkliches Ziel, in der Hoffnung, fern der Stadt einen Unterschlupf für die kommenden Tage zu finden. Womöglich hatte der Bahnhofswärter von St. Alban vorübergehend eine Bleibe für sie. Er würde sie bestimmt wiedererkennen, spätestens wenn sie ihm ihren Namen sagte. Ihm konnte sie sich anvertrauen und das Desaster erklären, ohne befürchten zu müssen, dass er sofort die Polizei verständigte.
Mit einem flauen Gefühl im Magen blickte Zoë dem abfahrenden Triebwagen nach, dann sah sie sich auf dem Bahnsteig um. Alles wirkte vertraut und gleichzeitig irritierend fremd. Die Formen, Farben und Geräusche wollten nicht zu ihren Erinnerungen passen. Selbst der von Kondensstreifen durchzogene Abendhimmel wirkte falsch.
Außer ihr hatten nur eine Handvoll weiterer Passagiere den Zug verlassen, durchweg alte Menschen, in deren Gegenwart Zoë bemüht war, sich ihre Bestürzung nicht anmerken zu lassen.
Zwar war sie seit Jahren nicht mehr hier gewesen, doch eine derartige Veränderung hatte sie nicht erwartet. Die gesamte Station war modernisiert und die Strecke zweigleisig ausgebaut worden. Anstelle des hüfthohen Lattenzauns, der seit ihrer Kindheit das Bahnareal vom angrenzenden Wald getrennt hatte, stand jenseits der Gleise eine lückenlose, drei Meter hohe Barriere aus Maschendraht. Dahinter war der Hang offenbar auf der gesamten Länge des Bahnsteigs gerodet worden. Die gut einhundert Meter weite Schneise schien bis hinab ins Tal zu reichen. Statt des alten Bahnübergangs aus Holzbohlen, der einst zur Mündung eines kleinen Waldweges geführt hatte, überspannte eine moderne Fußgängerbrücke die Gleise, und anstelle des alten Stellwerkers, mit dem sie sich damals oft unterhalten hatte, überwachten nun an Laternenmasten installierte Kameras die Bahnsteige. Das Wärterhäuschen selbst existierte zwar noch, diente aber offenbar nur noch als Materialdepot und Abstellkammer. Zoës Hoffnung, mithilfe des alten Mannes dem Tag ein halbwegs versöhnliches Ende abzutrotzen, zerschlug sich mit den in der Ferne verblassenden Triebwagenrücklichtern.
Sie wartete, bis niemand mehr in der Nähe der Station zu sehen war, dann überquerte sie die Gleise und warf einen Blick durch den Maschendraht. Jenseits der Barriere war alles überwuchert und zugewachsen. Von dem Fußpfad, der von hier aus früher einmal ins Tal geführt hatte, war nichts mehr zu erkennen. Mit versteinerter Miene blickte sie in den vom dichter werdenden Nebel getrübten Himmel. Abendrot leuchtete über den Baumwipfeln.
Es wäre für sie ein Leichtes gewesen, den Zaun zu überwinden, doch die Kameras hielten sie davon ab. So starrte sie lange in das geisterhafte Glosen jenseits der Barriere. Kilometerweit leuchtete der Nebel, als loderten zu beiden Seiten des Flusses Hunderte von blauen und orangenen Feuern. Während Zoë entlang der Umfriedung wanderte und eine Lücke im Maschendraht suchte, rechnete sie jeden Moment damit, eine verzerrte Stimme zu hören, die sie aufforderte, den ungesicherten Gleisbereich zu verlassen, aber die Lautsprecher blieben stumm.
Zurück auf dem Bahnsteig, setzte sie sich auf eine Bank unter einem der Laternenmasten und zog das Handy aus der Jacke. Unschlüssig betrachtete sie minutenlang das Display, dann deaktivierte sie den Flugmodus, scrollte durch ihre Kontaktliste und wählte Jurajs Nummer.
»Maza?«, erklang seine Stimme nach dem dritten Rufzeichen. »Himmel, warum meldest du dich denn nicht? Ist alles in Ordnung? Hast du deine Mailbox nicht abgehört? Ich versuche dich seit zwei Tagen zu erreichen.«
»Sorry«, sagte Zoë, als Juraj eine kurze Pause machte, um Luft zu holen. »Im Moment geht einfach alles drunter und drüber.«
»Das hast du neulich auch schon gesagt«, beschwerte er sich. »Ich war vorgestern am vereinbarten Treffpunkt, aber von dir keine Spur. Wo steckst du denn?«
»Über dem Fegefeuer.« Sie aktivierte die Kamera und hielt das Handy so, dass Juraj die gegenüberliegende Seite der Bahnstation sehen konnte.
»Ist das etwa die Combine-Baustelle?«, stutzte er.
»Offensichtlich.«
»Was machst du in Dolny?«
»Ich bin nicht in Dolny, sondern auf der deutschen Seite«, erklärte Zoë. »Oben am Bahnhof von St. Alban«, fügte sie hinzu, als es am anderen Ende der Leitung still blieb.
»Was um Himmels willen treibst du dort?«
Zoë starrte in den glühenden Nebel. »Familienangelegenheit«, sagte sie schließlich.
»Willst du mir nicht endlich erzählen, was eigentlich los ist?«, fragte Juraj. »Ich mache mir langsam echt Sorgen.«
Zoë schnitt eine Grimasse. »Das ist gerade wirklich kein guter Zeitpunkt«, sagte sie. »Ich … muss erst ein paar Dinge klären.«
»Auf der Baustelle?«
»Hauptsächlich in meinem Kopf.«
»Ah, jetzt kapiere ich es«, sagte Juraj nach kurzem Schweigen. »Du willst zu deinem Onkel. Mensch, warum hast du dich nicht gemeldet? Ich hätte dir sagen können, dass das gesamte Gelände inzwischen wie Fort Knox gesichert ist.«
»Ich hatte mir die Baustelle nicht so groß vorgestellt«, gestand Zoë. »Das abgesperrte Areal ist riesig. Zudem gibt es auf dem talwärts gelegenen Bahnsteig Überwachungskameras, aber sie gehören offenbar nicht der Bahn, sondern Combine. Ich hatte gehofft, dass der Waldweg hinab zu den Baracken noch existiert, aber nicht erwartet, dass das Gelände wie ein militärisches Sperrgebiet abgeriegelt und überwacht wird.«
»Die Zeiten haben sich leider geändert«, sagte Juraj. »Entlang des Flusses entsteht inzwischen nicht nur das Chemiewerk, sondern ein ganzer Industriepark mit Tochterunternehmen und Umspannwerk, Parkhäusern, einem eigenen Verladebahnhof und einem Netz aus Zufahrtsstraßen. Sogar den Fluss wollen sie gen Norden noch ausbaggern und einen kleinen Frachthafen bauen.«
»Und die Baracken?«
»Stehen über dem Areal im Niemands-Grenzland. Ist jetzt alles Sperrgebiet da unten, aber zumindest wurde noch nichts abgerissen. Kommunen und Regionalvertreter hoffen, dass die Sache früher oder später von der Natur geregelt wird.«
»Frommer Wunsch«, bemerkte Zoë. »Als gäb’s nirgendwo Ruinen, die Jahrhunderte auf dem Buckel haben …«
»Seit sie das Kraftwerk bauen und die Aktivisten auf die Barrikaden gehen, ist das Gebiet entlang des Flusses jedenfalls weiträumig abgesperrt«, erklärte Juraj. »Die Brücke von Dolny ist nur noch für den Werksverkehr freigegeben. Um die Baustelle zu umgehen und auf die andere Flussseite zu gelangen, hättest du eine Station früher oder später aussteigen müssen. In den Nachbarortschaften gibt es Brücken und Ersatzfährbetriebe. Ich fürchte also, du wirst einen Umweg machen müssen. Würden sie nur ein Einkaufszentrum bauen, wäre das nicht weiter tragisch, aber im Fall von Combine liegen die Prioritäten nun mal anders. Vor einem Jahr wärst du noch problemlos über das Gelände gelangt, doch seit die technischen Anlagen installiert werden, herrschen strengste Sicherheitsvorkehrungen.«
Zoë legte den Kopf in den Nacken und betrachtete die Kamera über ihr.
»Im angrenzenden Waldgebiet wurden Bewegungsmelder und versteckte Kameras installiert«, fuhr Juraj fort. »Offiziellen Angaben zufolge eine Präventivmaßnahme, um vorzubeugen, dass sich kein Rot- oder Schwarzwild auf das Areal verirrt. Unten am Grenzzaun patrouillieren zudem Sicherheitsleute mit Hunden. Unbemerkt kommt dort ohne Tansitcode und amtliche Genehmigung nichts und niemand durch, das größer ist als ein Eichhörnchen. Ich vermute, du hast keine Lust, dich von Schäferhunden über eine kilometergroße Industriebaustelle jagen zu lassen …«
Zoë nahm aus dem Augenwinkel heraus ein Aufleuchten wahr und blickte zu einem fernen Signalmast, dessen Lichter aussahen wie ein Paar gelb glühender Augen.
»Hallo?«, vernahm sie Jurajs Stimme. »Bist du noch dran?«
»Ja, klar«, murmelte sie. »Mich hat nur ein Licht im Wald abgelenkt.«
»Ein Bahnsignal?«
»Woher weißt du das?«
»Nur geraten. Welche Farbe hat es?«
»Gelb.«
Juraj schwieg einen Moment lang. »Es gibt eventuell eine Chance, ungesehen auf das Gelände zu gelangen«, sagte er schließlich. »Es ist riskant, aber nicht unmöglich.«
»Bin ganz Ohr.«
»Combine hat eine eigene Zweigtrasse. Mindestens zweimal pro Nacht treffen Güterzüge auf der Baustelle ein. Was du siehst, könnte das Bereitschaftssignal für den ersten davon sein. Falls du dort unten vom Werksschutz entdeckt werden solltest, sind es vom Verteiler-Stellwerk keine hundert Meter bis zum Zufahrtstor. Alles, was du dort unten machen müsstest, wenn du als blinder Passagier auffliegen solltest, wäre, die Beine in die Hand zu nehmen und das Gelände so schnell wie möglich zu verlassen, nachdem der Zug zum Stehen gekommen ist. Allerdings könnte der Werkschutz mit einer derartigen Aktion rechnen, denn in der Vergangenheit gab es immer wieder Zwischenfälle mit Aktivisten, die sich Zutritt zum Gelände verschafft hatten. Traust du dir das zu?«
Zoë zögerte einen Moment lang, dann nickte sie. »No risk, no fun, oder?«
»Ja, das ist die Maza, die ich kenne«, sagte Juraj.
Zoë blickte zum weiterhin gelb leuchtenden Signallicht, dann in die entgegengesetzte Richtung. In der Ferne war ein schwaches Lichterdreieck auszumachen.
»Ich glaube, da kommt ein Zug«, sagte sie.
»Wie weit ist er entfernt?«
»Vielleicht noch zwei Kilometer«, schätzte Zoë. »Scheint relativ langsam zu fahren.«
»Das spricht für eine schwere Beladung«, erklärte Juraj. »Es wird noch ein paar Minuten dauern, bis er den Bahnhof erreicht. Wenn du Glück hast und das Signal weiterhin gelb bleibt, bremst er auf moderates Tempo ab. Für gewöhnlich steuert Combine die Signale von einem Kontrollraum aus, sobald der Zug die Station passiert und die Kameras eine Videobestätigung liefern.«
»Würdest du mir mal verraten, woher du das alles weißt?«, fragte Zoë.
Am anderen Ende der Leitung herrschte kurz Schweigen. »Ein alter Freund von mir gehört zu den Aktivisten und hat mir so einiges über die Baustelle erzählt.«
»Wohnt er hier in der Nähe?«
»Momentan wohnt er in einer Justizvollzugsanstalt in Liberec und wartet auf seinen Prozess. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.«
Zoës kurzer Hoffnungsschimmer verblasste jäh wieder. »Na gut, dann besuche ich jetzt meinen Onkel«, murmelte sie. »Mehr oder weniger.«
»Viel Glück, Maza«, sagte Juraj. »Lass von dir hören.«
Zoë setzte zu einem Protest an, verdrängte ihren Ärger jedoch wieder. »Danke«, sagte sie stattdessen nur und beendete die Verbindung.
Als die Diesellokomotive in die Station einfuhr, hatte sie die Geschwindigkeit so weit gedrosselt, dass es möglich gewesen wäre, neben ihr her zu sprinten. Dennoch wartete Zoë, bis der erste mit blauen Frachtcontainern beladene Güterwaggon sie passiert hatte. Als er den gegenüberliegenden Laternenmast verdeckte, stieg sie auf die Bank, holte mit dem Rucksack aus und drosch ihn gegen die über ihr befestigte Kamera. Das Gerät wurde an seinem Schwenkarm herumgewirbelt und prallte gegen den Mast. Scherben der zersprungenen Linse regneten aus dem Objektiv auf den Bahnsteig herab.
Zoë sprang von der Bank und duckte sich, um nicht von der gegenüberliegenden Kamera erfasst zu werden. Dann zog sie den Rucksack auf, schloss den Spanngurt über ihrer Brust und zurrte ihn fest. Nachdem das letzte Containermodul sie passiert hatte, folgte eine Reihe langer, offener Güterwaggons. Auf jedem von ihnen ruhten drei annähernd zehn Meter lange, pyramidenförmig übereinandergelagerte Betonrohre. Als sie einen Blick in Fahrtrichtung warf, um sich zu vergewissern, dass der Lokführer den Kopf nicht aus dem Seitenfenster gestreckt hatte, sah sie, dass das Signal in der Ferne auf Grün gesprungen war. Sekunden später verstummte das nervtötende Quietschen der Bremsen, und der Zug begann wieder zu beschleunigen. Im Sichtschutz der Rohre setzte Zoë zum Spurt an, ergriff eine der Stützstreben, sprang auf den Waggon und kauerte sich hinter der aufgetürmten Ladung zusammen. Erst als der Zug den letzten Laternenmast der Station passiert hatte, erhob sie sich aus der Deckung und warf einen Blick ins Innere der etwa einen Meter breiten Rohre. Dann nahm sie den Rucksack ab, schob ihn in die oberste Betonröhre, kletterte empor und schlüpfte hinterher.
Nachdem der Zug etwa zwei Kilometer weit gerollt war, wurde er wieder langsamer und stoppte schließlich auf freier Strecke. Draußen herrschte völlige Dunkelheit. Zoë zog sich bis in die Mitte der Röhre zurück und lauschte nach sich nähernden Schritten oder Stimmen. Minutenlang verharrte sie regungslos, gequält von der Ungewissheit, ob ihre Aktion im Combine-Kontrollraum mitverfolgt und an den Zugführer weitergeleitet worden war. Glücklicherweise lagerte die Röhre, in der sie kauerte, so weit oben, dass man vom Boden aus nicht hineinblicken konnte.
Nach einer Weile des Bangens setzte der Transport sich schließlich wieder in Bewegung. Zoë atmete auf, doch ihre Erleichterung währte nur kurz, denn der Zug fuhr rückwärts und näherte sich wieder der Bahnstation. Kurz darauf vernahm sie ein schrilles Kreischen. Die Waggons rumpelten über eine Weiche und wechselten ruckartig das Gleis. Das Schleifen von Metall an Metall ging Zoë durch Mark und Bein.
Der Spurwechsel wiederholte sich ein weiteres Mal, dann passierte der Zug im Schritttempo eine Sicherheitsschleuse. Über dem geöffneten Rolltor rotierten gelbe Warnleuchten, deren Licht durch den dichter werdenden Nebel verstärkt wurde und das Innere des Rohres in gleichmäßigen Pulsen ausleuchtete.
Die Nebentrasse führte nun leicht bergab. Im Schutz der Dunkelheit kroch Zoë vor bis zur in Fahrtrichtung gelegenen Rohröffnung und spähte nach draußen. Der Zug fuhr kaum mehr als Schritttempo. Nach rund einem halben Kilometer passierte er eine zweite Sicherheitsschleuse. Erschrocken zog Zoë den Kopf ein, als der Strahl eines Handscheinwerfers sie traf. Eilig zog sie sich wieder bis in die Mitte der Röhre zurück und hoffte, dass der Sicherheitsdienst sie nicht entdeckt hatte.
Kurz hinter der Schleuse stoppte der Zug erneut, dann drangen sich nähernde Schritte an Zoës Ohren. Mit angehaltenem Atem starrte sie in die Finsternis über ihr, bildete sich ein, die Betonröhre würde das Klopfen ihres Herzens wie ein riesiges Megafon verstärken und sein Hämmern ins Freie leiten. Der gesamte Waggon schien in seinem Rhythmus zu pulsieren.
»Nicht viel los unten, was?«, vernahm sie in unmittelbarer Nähe eine männliche Stimme, die offenbar dem Zugführer gehörte.
»Liegt an der verdammten Hexenküche«, erwiderte eine zweite. »Solange alles so zuhängt, arbeiten die meisten indoor.«
Zoë robbte vorsichtig durch ihr Versteck, bis sie einen Blick auf die nur schemenhaft zu erkennenden Männer werfen konnte. Während der eine mit einer Taschenlampe unter die Waggons leuchtete und das Fahrwerk inspizierte, stand der zweite mit einem Klemmbrett neben ihm und blätterte sich durch die Frachtdokumente, wobei er immer wieder einen prüfenden Blick auf den Zug warf.
»Der hintere Teil ab dem Neuner geht auf die Vier, dort übernimmt später die KÖV«, sagte er schließlich. »Der Rest muss in Halle 2. Cargoport E an Gleis 1 ist für dich reserviert. Bis du fertig bist, ist die Strecke wieder frei.«
»Passt«, antwortete der Zugführer und schritt an Zoës Versteck vorbei. »Reichst du mir gleich noch ’ne Thermosflasche mit Kaffee rauf?«
»Klar doch.«
Als die beiden eine Viertelstunde später ihren Posten und Führerstand wieder bezogen hatten und der Zug sich erneut in Bewegung setzte, bettete Zoë erleichtert den Kopf auf ihre Armbeuge. Erst als sie den Fahrtwind fühlte, bemerkte sie, wie durchgefroren sie war.
Hinter der zweiten Schleuse endete der Wald abrupt, und der Zug fuhr auf freies Gelände. Im dichten Nebel wagte Zoë sich wieder ein Stück weiter nach vorn. Beim Blick nach draußen sah sie jedoch nur schemenhafte, hoch über dem Boden strahlende Scheinwerfer. Mindestens zwei Dutzend der Flutlichtmasten erhoben sich rund um das Areal.
Der Zug rollte im Schritttempo auf den Rohbau eines mächtigen, nahezu fensterlosen Gebäudes zu, bei dem es sich um besagte Halle 2 handeln musste. Etwa fünfzig Meter vor ihren Toren kamen die Waggons mit nervenzerreißendem Quietschen zum Stehen. Geblendet vom Flutlicht lugte Zoë aus ihrem Versteck. Wo einst Auwald gewachsen war und Wiesen geblüht hatten, erstreckte sich nun eine schlammige, planierte Mondlandschaft und Ödnis. Der Nebel verzerrte die Dimensionen der Gebäude. Sie wirkten wie riesige, verwaschene Tempel, vor denen die Arbeiter mit Baggern, Lastmaschinen und Kränen den Industriegötzen im Inneren huldigten. Links erkannte Zoë mehrere riesige Baustofftanks, daneben eine dreistöckige Wohncontainer-Burg. Zu ihrer Rechten stand kaum zwanzig Schritte vom Waggon entfernt ein einzelner Bürocontainer auf einer kniehohen Holzkonstruktion, daneben eine Reihe aus sechs blauen Toilettenkabinen.
Zoë passte einen Moment ab, in dem sich alle Arbeiter auf der linken Seite des Zuges aufzuhalten schienen, und schlüpfte aus dem Rohr. Ein schneller Kontrollblick, dann sprang sie vom Waggon, rannte auf den Container zu, stürzte ins erstbeste leere Dixi-Klo und verriegelte die Tür. Als draußen nach einigen Minuten noch immer nichts Verdächtiges zu hören war, entspannte sie sich langsam und ließ sich auf die geschlossene Toilettenschüssel sinken.
Okay, bin gelandet, simste sie an Juraj.
Tora! Tora! Tora!, erhielt sie kurz darauf als Antwort.
TEIL 5
DER ZORN DES HOMUNKULUS
Und sieh! und sieh! an weißer Wand
Da kam’s hervor wie Menschenhand;
Und schrieb, und schrieb an weißer Wand
Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.
HEINRICH HEINE, Belsazar
44
Es heißt, der Hades, in dem Tag und Nacht sich begegnen, sei in Nebel und Dämmerlicht gehüllt, und Helios würde niemals scheinen. Dort wohne in kimmerischer Finsternis Hypnos, der Sohn der Nacht, mit seinen Kindern Morpheus, Phobetor und Phantasos, den Göttern des Traums.
Laut der Lehre des Hesiod wirken die ersten Menschen eines goldenen Geschlechts nach ihrem Tod als heilige Diener des Zeus und durchwandeln in Nebel gehüllt das Erdenreich. Die Göttin Athene hüllt Odysseus in heiligen Nebel, damit er nicht erkannt wird, wenn er das Land der Phäaken betritt, und Zeus selbst bedient sich des Nebels, um sich ungesehen der schönen Hirtin Io zu nähern.
Ich für meinen Teil konnte mich nicht entscheiden, ob ich den Göttern der Gegenwart für den immer dichter werdenden Nebel, der die Kleidung klamm werden ließ und meine Haare zu durchnässen begann, danken oder sie verfluchen sollte.
Es war das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass ich auf dem Waldweg, der von der Überlandallee nach Vayhing hügelan führte, unterwegs war. Allerdings war Miriam diesmal nicht mit von der Partie, denn das Schicksal meinte es gerade nicht sonderlich gut mit ihr. Vor zwei Tagen war ihr Vater verstorben, und sie hatte sich auf unbestimmte Zeit freigenommen, um gemeinsam mit ihrer Mutter die familiären Angelegenheiten zu regeln. Insofern wusste außer Vinzenz niemand etwas von meinem neuerlichen Besuch des Saldek-Anwesens. Im Gegensatz zu meinem ersten Besuch hatte ich die Forstschranke am Fuße des Hügels diesmal geschlossen und gesichert vorgefunden. Ein Umfahren war unmöglich, ohne den Wagen in den Entwässerungsgraben zu lenken. So war ich gezwungen gewesen, ihn am Rand der Landstraße in einer kleinen Parkbucht abzustellen und die zwei Kilometer bis zum Saldek-Anwesen zu Fuß zurückzulegen.
Auch das Wetter zeigte sich heute von einer eher bescheidenen Seite. Hatte bei meinem ersten Besuch mit Miriam noch die Sonne geschienen, war das Bergland um Vayhing nun grau und nebelverhangen und der Boden feucht vom Regen der vergangenen Tage. Nach wenigen Hundert Metern waren meine Schuhe und die Hosen dermaßen verdreckt, dass es mir zunehmend peinlicher wurde, so am Herrenhaus aufzutauchen.
Im Wald selbst war es gespenstisch still. Nur selten war eine Vogelstimme oder ein Rascheln im Unterholz zu vernehmen. Lediglich das Rauschen des Baches, dem die Straße einem Großteil der Strecke folgte, begleitete mich auf dem Weg. Das lauteste Geräusch war das meiner Schritte auf der von Splitt und Schotter bedeckten Straße.
Mit dem Wagen war mir die Strecke bis zum Haus weitaus kürzer vorgekommen. Die gesamten zwei Kilometer über führte die Straße sanft, aber stetig bergauf und ließ mich immer wieder für einen Moment auf den Stämmen gefällter, neben der Straße aufgereihter Bäume ausruhen, bis der Schmerz in meinen Schienbeinen nachgelassen hatte. Vielleicht sollte ich es Vinzenz gleichtun und mit dem Joggen anfangen, um nicht vollends einzurosten.
Als ich die baumlose Hügelkuppe erreichte und der Wald sich endlich öffnete, war ich völlig außer Atem, meine Schuhe verdreckt und meine Hosen fast bis zu den Knien verschmutzt. Breite Schlammspuren, Erdklumpen und Rindenreste zeugten davon, dass jüngst Traktoren und Unimogs auf der Straße unterwegs gewesen waren. Das Herrenhaus am gegenüberliegenden Waldrand war im Nebel nicht zu erkennen. Auf dem Weg dorthin schlenderte ich sporadisch durchs feuchte Gras, um zumindest meine Schuhe zu säubern.
Diesmal parkte kein Fahrzeug vor dem Haus, sondern nur ein abgestellter Anhänger mit Brennholz. Ich ließ meinen Blick über die Fassade schweifen, doch auch heute regte sich nichts hinter den Fenstern. Nachdem ich die beiden Bronzegreife passiert hatte und die Eingangstreppe emporgestiegen war, war es erneut Thereza, die auf mein Klingeln hin die Tür öffnete. Als die Haushälterin mich erkannte, fasste sie sich an die Brust und nestelte an einem kleinen silbernen Kruzifix herum, das sie an einer Kette um den Hals trug, als hoffte sie, mich mit seinem Anblick in die Flucht schlagen zu können.
»Sie«, sagte sie nicht sonderlich erfreut. »Was wollen Sie?«
»Ihnen ebenfalls einen schönen Tag«, begrüßte ich die Frau. »Ich habe noch ein paar Fragen an Herrn Saldek.«
»Besuch jetzt nicht möglich«, erklärte Thereza.
»Informieren Sie ihn einfach nur, dass ich hier warte. Er weiß Bescheid und wird mich empfangen.«
»Herr Saldek sehr beschäftigt und wünscht, nicht gestört zu werden«, versuchte die Frau mich abzuwimmeln, wobei sie sich fast vollständig hinter der Tür verborgen hielt.
»Hätten Sie es lieber, wenn ich heute Abend mit einem Durchsuchungsbeschluss und einem halben Dutzend Polizisten wiederkomme?«, erwiderte ich. »Hören Sie auf, Ihren Dienstherrn zu bevormunden, und lassen Sie ihn selbst entscheiden, ob ich willkommen bin oder nicht.«
Thereza schüttelte entschieden den Kopf. »Sie nicht wissen, wo sind Ihre Grenzen«, sagte sie. »Herr Saldek für Sie hat keine Zeit.«
»Ach nein?« Meine Hand schnellte vor und ergriff das Handgelenk der Haushälterin. Die Bewegung überraschte mich ebenso wie mein Gegenüber, denn es war weder ein unbewusster Impuls noch eine gewollte Aktion, was mich dazu verleitet hatte. Stattdessen kam es mir vor, als würde etwas anderes meine Hand steuern. Ich fühlte einen Stich im Hinterkopf, als ich den Arm der Frau berührte, versuchte mir den Schmerz jedoch nicht anmerken zu lassen. Bilder explodierten vor meinem geistigen Auge, begleitet von einem Wirbel unzusammenhängender Gedankenfetzen. Das Ganze dauerte kaum zwei Sekunden.
»Co si dovolíte?«, fuhr die Haushälterin mich erschrocken an, wobei sie sich losriss und zurückwich. »Ich muss doch sehr bitten!« Sie versuchte die Pforte zu schließen, doch ich stellte meinen Fuß hinter die Schwelle.
»Heute Morgen, nach dem Aufstehen, haben Sie überlegt, wie Sie Laura Saldek davon überzeugen könnten, Ihren Dienstherrn in die professionelle Obhut eines Pflegeheims zu geben«, sagte ich, während sie sich gegen die Tür stemmte. »Sie haben sogar für einen Augenblick daran gedacht, in einem unbeobachteten Moment für einen kleinen Betriebsunfall zu sorgen, um ihn endlich von seinem Leiden zu erlösen. Warum geistern solche Gedanken durch Ihren Kopf, Thereza? Ist das Mitleid – oder Selbstgerechtigkeit?«
Die ohnehin schon blasse Frau war bei meinen Worten aschfahl geworden und starrte mich entsetzt an. »Dobré nebe«, stieß sie schließlich tonlos hervor und bekreuzigte sich. »Jaký ďábel tě poslal?«
»Ganz genau«, kommentierte ich ihre Reaktion, ohne ein Wort des Gesprochenen verstanden zu haben. »Wie kann ich das wissen, wo Sie doch allein im Zimmer gewesen sind und bisher niemandem etwas davon erzählt haben?« Ich ließ meinen Blick auf ihr ruhen und die Frage ein paar Sekunden lang wirken. »Sagen Sie mir also nicht, was ich weiß und was nicht und wo meine Grenzen liegen«, fügte ich hinzu. »Denn ich kann noch viel tiefer in Ihrem Kopf graben, falls es nötig ist. Also gehen Sie bitte zu Ihrem Brötchengeber und teilen Sie ihm mit, dass Alexander Crohn ihn sprechen möchte. Er weiß, worum es geht. Ich werde hier warten.«
Nachdem die Frau wieder im Haus verschwunden war, ging ich die Treppe hinab, lehnte mich an einen der Bronzegreife und atmete tief durch. Eine Weile ließ ich die Stille auf mich wirken und versuchte zur Ruhe zu kommen, dann hob ich meine Hände. Die rechte lag still in der Luft, wohingegen die linke zitterte, als würde sie von einem Tremor geschüttelt. Ich ballte sie zur Faust, doch selbst dann fühlte es sich an, als stünde sie unter Strom.
Ich konnte nicht sagen, welcher Teufel mich soeben geritten hatte. Etwas Vergleichbares war mir bisher noch nicht passiert. Sicher, meine Ausflüge in die Echo-Dimension, die Opferrückführungen und die Erlebnisse im Visionarium waren ein ums andere Mal verstörend gewesen, doch das vor wenigen Minuten erlebte Echo war anders gewesen. Es hatte sich angefühlt, als hätte etwas meinen Arm ferngesteuert und die Erinnerungen der Haushälterin geradezu aufgesaugt. Nachdenklich massierte ich mein Handgelenk und musste dabei an den Lichttentakel der Emeo-Wesenheit und an Simons Worte im Kurpark von Askenburg denken: Ich kann dich davor nicht beschützen …
Was war dieses Davor, von dem er mir nichts erzählen wollte? Besessenheit? Schleichender Kontrollverlust? Begann die Hand, die der aus Simons Tür geschnellte Lichttentakel umschlungen hatte, ein Eigenleben zu entwickeln?
Ich tastete meinen Hinterkopf ab, sträubte mich jedoch vor dem Gedanken, dass der Splitter gewandert sein könnte und nun Zerebralbereiche beeinflusste, die bisher unberührt geblieben waren. Und dass er Aktionen und Reaktionen auslöste, die ich nicht mehr kontrollieren konnte.
Ein leises Quietschen hinter der Eingangstür ließ mich aufblicken. Thereza war zurück und öffnete die Pforte, wobei es wirkte, als wollte sie sprechen, doch ihr schien die Stimme zu versagen. So zog sie lediglich die Tür auf und trat beiseite. Als ich an ihr vorüberschritt, hielt sie den Blick gesenkt. Auf mein »Danke« folgte keine Antwort. Eine Seele mehr, bei der ich für den Rest des Lebens wohl einen negativen Eindruck hinterlassen hatte.
Nachdem ich der Haushälterin durchs Haus gefolgt war und in den Wintergarten trat, wirkte Aaron Saldek auf mich, als hätte er sich in seinem Rollstuhl seit meinem ersten Besuch nicht von der Stelle bewegt. Selbst der Morgenmantel, den er trug, war noch der gleiche wie vergangene Woche. Die einzige Veränderung, die mir ins Auge stach und mich kurz die Luft anhalten ließ, war ein Arabischer Jasmin, der zu blühen begonnen hatte und mit seinem intensiven Duft den Wintergarten schwängerte.
Während ich auf dem Stuhl Platz nahm und mir von Therezas noch immer zitternden Händen die Interfacehaube aufsetzen ließ, gab ich mich entspannt und auf Deeskalation bedacht. Insgeheim befürchtete ich jedoch, dass die Haushälterin in die Küche gehen und mit einem Messer und einer Flasche Weihwasser in den Wintergarten zurückkehren könnte, sobald ich auf die virtuelle Kommunikationsebene gewechselt hatte – um mir die Kehle durchzuschneiden und den vermeintlichen Teufel auszutreiben, der ihre Gedanken gelesen hatte.
Kaum hatte sie das Headset aktiviert, veränderte sich meine Umgebung wieder. Ich hatte erwartet, mich erneut im virtuellen Jagdzimmer der alten Familienvilla wiederzufinden. Stattdessen stand ich auf einer von blühenden Laubbäumen und Holunderbüschen bestandenen Anhöhe. Hier und da erhoben sich steinerne Madonnen und Heiligenstatuen, die der Landschaft das Ambiente eines Renaissancegartens verliehen. Vier kreisrunde, von glänzenden Stein- und Metallwällen eingefasste Wasserbassins umgaben den Hügel, jedes von ihnen mit einem Durchmesser von mindestens einhundert Metern.
Die Landschaft selbst wirkte wie ein Opiumtraum Innozenz des VIII.: Berge, die aussahen wie Mitren, Seen wie Taufbecken und am Horizont ein Gebirge in katholisch violett. Die Bäume dufteten nach Myrrhe, das Gras in der Ferne glänzte wie der Samt schwerer Talare, und am Horizont glühte keine Sonne, sondern eine riesige Hostie, die aus den Weihrauchwolken einen kardinalroten Sonnenuntergang zauberte. Ich spürte den virtuellen Wind, der über den Hügel strich und das Gras zum Wogen brachte.
Im Geäst eines nahen Baumes flatterte etwas Undefinierbares, das meine Aufmerksamkeit erregte. Zuerst hielt ich es für einen korpulenten weißen Vogel, doch dann erkannte ich erstaunt ein kleines dickes Kind mit Flügeln und goldenen Locken, das frappierend jenen Wesen ähnelte, die ich auf Simons Boreas-Gemälde erblickt hatte. Als ich mich dem Baum näherte, nahm es Reißaus und verursachte dabei einen Regen aus Blütenblättern. Mit seinen lächerlich kleinen, ebenfalls goldenen Flügeln flatterte es zum nächsten Baum, wo es ein nahezu identisches Geschöpf aufschreckte. Es waren kleine weiße Putten, die sich nun um das Revier in den Ästen balgten. Als ich mich umsah, erkannte ich, dass jeder der Bäume ein derartiges Wesen in seiner Krone beherbergte. Welchem Sinn und Zweck sie dienten, war mir ein Rätsel.
Bemüht, nicht noch mehr Unruhe zu stiften, wanderte ich den Hügel hinab und hielt dabei nach Saldek Ausschau. Nach kurzer Suche erspähte ich ihn etwa zweihundert Meter entfernt am Ufer eines der Wasserbecken, das von einem glänzenden Gold- oder Messingwall umgeben war. Befreit von Körpergefängnis und Rollstuhl, schlenderte er mit hinter dem Rücken verschränkten Händen barfuß am Wasser entlang und schien die Uferstruktur zu begutachten. Kurz darauf hielt er inne, wobei es auf mich wirkte, als schaute er auf eine Armbanduhr. Dann wandte er sich um, blickte zu mir empor, hob eine Hand als Zeichen, dass er mich gesehen hatte, und kam mir entgegen. Dabei ging er leicht gebeugt, als würde er sich gegen einen Sturm stemmen. Ich lief unwillkürlich schneller, als ich ihn so sah, getrieben von der Sorge, er würde vornüberkippen, falls ich mich nicht beeilte und ihn auffing.
»Herr Crohn«, begrüßte er mich, als ich ihn erreicht hatte. »Sie erweisen sich, um es mal diplomatisch auszudrücken, langsam, aber sicher als Hämorrhoide im Arsch des Herrn!«
»Vielen Dank für das Kompliment«, gab ich zurück. »Ich weiß Ihre Ehrlichkeit zu schätzen. Bleibt zu hoffen, dass Ihre Haushälterin keinen Exorzisten ruft, während ich eingeloggt bin.«
»Was in aller Welt haben Sie Thereza erzählt?«, fragte mein Gegenüber. »Sie wirkte äußerst verstört.«
»Etwas, das nur für ihre Ohren bestimmt war und seine Wirkung offensichtlich nicht verfehlt hat.«
Saldek verzog missbilligend die Mundwinkel. »Nun, dieses Interieur hier ist in keinster Weise für Ihre Augen bestimmt«, erklärte er. »Aber da Sie dank Ihrer Impertinenz nun mal hier sind: Willkommen im Herzen meines Arbeitsplatzes.«
»Würden Sie mir verraten, was um alles in der Welt das hier ist?« Ich blickte in die Runde. »Eine sakrale Chill-out-Phantasmagorie?«
»Eine … Nun, bezeichnen wir es einfach als Dienstleistung.«
»Wer hat das in Auftrag gegeben?«, fragte ich kopfschüttelnd. »Girolamo Savonarola während einer Séance?«
»Dazu darf ich mich nicht äußern«, sagte Saldek ohne jede Spur von Ironie in der Stimme. »Es entsteht in Zusammenarbeit mit mehreren apostolischen Nuntiaturen. Et omnia ad maiorem Dei gloriam.«
»Ist das gänzlich Ihr Werk?«
»Zum Großteil. Aber es ist in seinem aktuellen Entwicklungsstadium noch nicht für externe Augen bestimmt. Insofern bitte ich Sie um äußerste Diskretion.« Jetzt wandte er sich dem künstlichen See zu und fragte: »Was halten Sie davon?«
»Ich finde es gelinde gesagt ein wenig grell.«
»Ich könnte die Farbsättigung reduzieren«, schlug Saldek vor. »Oder ganz auf Graustufen umschalten …«
»Hat dieser Irrwitz einen Namen?«
»Es ist eine Trinithek. Zweitausend Jahre christlicher Glaube als virtuelles Freilichtmuseum.«
Ich sah mich kopfschüttelnd um. »Im Kalten Krieg experimentierten die Sowjets mit Lichtreiz-Räumen«, fiel mir dazu ein. »Ihre Wände waren farblich so gemustert und strukturiert, dass jeder, der sich darin aufhielt, durch die vom Gehirn nicht zu bewältigende Fülle von Vexierbildern früher oder später wahnsinnig wurde.«
»Wir stehen in keiner Folterkammer, sondern in einem virtuell begehbaren Archiv«, erklärte Saldek. »Es bestärkt die Frommen in ihrem Glauben an die creatio ex nihilo; eine Welt aus Licht, geschaffen aus dem Nichts.«
»Zur Entspannung oder zur Abschreckung?«
»Vorerst ist es nur für den internen Gebrauch bestimmt, aber vielleicht wird die Trinithek irgendwann einmal die Bibel in ihrer jetzigen Form ersetzen. Die Kirche bemüht sich, mit der Zeit zu gehen, wenn auch äußerst träge und schwerfällig. Vergleichen Sie es mit einem Brachiosaurus im Morast. Vorn hat das walnussgroße Gehirn in seinem kleinen Kopf eine Idee, wohin es gehen soll, aber der riesige, träge Körper dahinter muss erst noch folgen. Ende des letzten Jahrtausends hat der Vatikan in Arizona sogar eine moderne Außenstelle seiner Castel-Gandolfo-Sternwarte errichtet und lässt die Astronomen des Heiligen Stuhls nun auch von dort in den Himmel schauen.«
»Auf dem Mount Graham«, sagte ich. »Einem heiligen Berg der Apachen. Der Protest der Indianer blieb bisher erfolglos.«
»Man kann es nicht allen recht machen«, räumte Saldek ein. »Dieser Sektor hier ist noch nicht ganz ausgereift«, erklärte er ein wenig besonnener. »Zudem ist die Landschaft restlos überladen. Wir sind im Vollmodus, alle Archivkomponenten sind simultan aktiv. Ich arbeite seit fast drei Jahren an dieser Simulation. In zwei Monaten soll die Software fertig sein, doch es gibt noch Unstimmigkeiten bei der Landschaftskomposition. Das hier« – er deutete auf den See – »ist eine maßstabsvergrößerte Replik des Taufbeckens von Renier de Huy aus dem Kirchenschatz von Saint-Barthélemy. Das meiste davon liegt derzeit unter der Erde und kann über Tunnel auf mehreren Etagen einer subterranen, über sechzig Meter hohen Empore besichtigt werden. Auf Wunsch kann das Becken aber auch in den Himmel emporsteigen und durch die Lüfte gleiten wie ein Zeppelin, samt darin badender Klientel.« Saldek wandte sich um und wies hinauf zum Hügel. »Wandert man ein paar Kilometer in diese Richtung, erreicht man die Allee der Päpste. Sie führt in eine Stadt, deren Gebäude aus riesigen Nachbildungen berühmter Kirchenglocken bestehen. Man kann in ihnen einkehren, schlafen, beten oder eine Kollektion weltbekannter Kirchenportale bestaunen. In anderen findet man berühmte Sakristeien mit Bildern von Ljubo Babić, Masaccio oder Michelangelo, oder Sammlungen mit Bildhauereien, Schnitzereien und kunstvollen Fensterrosetten.«
»Sie machen sich Notizen?«, wunderte ich mich, als er etwas in seine Armtastatur tippte. »Wir befinden uns in einem Computerprogramm.«
»Alles, was ich hier eingebe, wird gespeichert und ist in der Realität abrufbar«, erklärte Saldek. »Sie könnten quasi Romane schreiben, während Sie sich in der Trinithek aufhalten. Ich koordiniere von hier aus fast meine gesamte elektronische Korrespondenz mit der realen Welt. Es ist nicht schwer, das menschliche Gehirn glauben zu machen, das Irreale sei die Wirklichkeit. Der Wind, den Sie auf der Haut spüren, das vermeintliche Gewicht Ihres Körpers, Ihr Körper selbst – alles nur neuronales Blendwerk.« Er tippte erneut auf sein Armband, dann schwenkte er seine Hand ein paarmal durch meinen Oberkörper. »Sehen Sie? Alles nur Schall und Rauch. Die Elektrodenhaube auf Ihrem Kopf ist das Interface. Sie selbst können hier zwar mit dem Konstrukt und meinem Avatar interagieren, aber nicht mit der Programmsteuerung. Dass Ihr sogenannter VR-Habitus und Ihr Bewusstsein mit meinem Masterinterface verbunden sind und nicht direkt mit dem Schlafwandler, verhindert, dass Sie versehentlich den Quellcode ändern oder beschädigen. Das könnte für Sie oder sogar für mich äußerst unangenehme Folgen haben.«
»Was ist ein Schlafwandler?«
»Der Zentralrechner im Keller des Hauses.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses ganze Brimborium nur der kulturellen und spirituellen Bespaßung dienen soll …«
»Natürlich nicht. Die Trinithek ist auf zweiter Ebene auch ein Rekonvaleszenzprojekt. Es könnte ein Neuronenstimulator werden. Vielleicht sogar so etwas wie ein Genesisprogramm, das das Virtuelle ins Wirkliche transportiert und auf das Physische projiziert. Die hier gesammelten Reize, Erfahrungen und Impulse könnten im Idealfall längst verloren geglaubte neuronale oder motorische Fähigkeiten reaktivieren. Vor allem aber suggeriert es den Menschen Heilung, macht sie glauben, physisch wiederhergestellt zu sein. Hier können die Tauben wieder hören, die Blinden wieder sehen, die Stummen wieder sprechen und die Lahmen wieder gehen. Unzähligen Leidenden würde dieser Zustand neuen Lebensmut geben – so wie einst mir. Und wem ein derartiges Wunder widerfährt, der empfindet oft Dankbarkeit gegenüber höheren Mächten.«
»Eine Rattenfalle«, resümierte ich. »Für die psychisch Labilen und Gebrochenen, die sie bezahlen können.«
»Ach, Herr Crohn, wie können Sie nur so abfällig denken? Glaube war schon immer Profitsache. Geld, Seelen, Kirchenmitglieder … Sine dominico non possumus.«
»Haben Sie keine Angst, dass Sie hier drin den Bezug zur Realität verlieren?«
»Angst?«, wiederholte mein Gegenüber beinahe entrüstet. »Meine Realität besteht aus einem Gefängnis aus Fleisch und Blut, das ich nicht mehr zu fühlen vermag, einem Hightech-Rollstuhl, einer 24-Stunden-Betreuung und diversen lebenserhaltenden Systemen. Angst? Ich? Hier, in meiner Schöpfung? Das können Sie nicht ernst meinen.« Saldek ließ seinen Blick einige Sekunden auf mir ruhen, dann sah er in die virtuelle Ferne. »Ich liebe es, den Boden unter meinen Füßen zu spüren, Herr Crohn«, sagte er, wobei seine Worte fast wie ein Vorwurf klangen. »Ich sehne mich danach, endlos weit zu laufen, rastlos, ohne Taubheit der Glieder, ohne Schmerzen und ohne auf einen künstlichen Atemzug warten zu müssen, um eine Stimme zu haben.« Er machte eine wahrhaft schöpferische Pause, wobei er die Augen geschlossen hielt und sich gedanklich aus der uns umgebenden Virtualität auszuklinken schien, dann sah er mich an und fragte mit ernster Miene: »Wurde Zoë schon gefunden?«
»Nein, Herr Saldek.« Ich setzte mich vorsichtig auf die Ufermauer, in der Befürchtung, das massiv wirkende Metall könnte sich als Blendwerk entpuppen. »Bisher gibt es keine Spur von Ihrer Tochter. Leider macht sie das mit jeder Stunde und jedem Tag, den sie untergetaucht bleibt, verdächtiger und die Situation verfahrener.«
Saldek nickte unmerklich. Ich konnte aus seinem Gesicht nicht herauslesen, ob er besorgt oder erleichtert über die Nachricht war.
»Sie war nicht zufällig in den vergangenen Tagen hier?«, fragte ich. »Oder ist es womöglich noch?«
Mein Gegenüber blickte sich um. »Hier?«, fragte er schon fast amüsiert. »In der Trinithek?«
»Das Anwesen Ihres Bruders bietet ausreichend Platz, um für eine Weile von der Bildfläche zu verschwinden«, sagte ich. »Zumal es derzeit nur von Ihnen, Ihrer Haushälterin und Laura selbst bewohnt wird.«
Saldek lachte freudlos. »Da können Sie warten, bis Sie schwarz werden, Herr Crohn. Zoë hasst dieses Haus und das Nirgendwo, in dem es steht, wie sie es mir gegenüber einmal höflich formuliert hat. Sie ist ein Stadtkind, und unser Verhältnis ist nicht gerade das beste. Meine Tochter steht meinem Bruder wesentlich näher als mir. Womöglich weiß er etwas über ihren Verbleib.«
»Frau Fechner hat sich bereits um Informationen bemüht«, erklärte ich. »Bisher leider ohne Erfolg. Ihr Bruder erlaubt uns weder eine Begehung des Baustellengeländes noch steht er zeitnah für ein Gespräch oder eine Aussage zur Verfügung.«
»Dann muss Frau Fechner sich an die tschechischen Kollegen wenden.«
»Das hat sie bereits. Ihr Bruder scheint jedoch einen langen Arm zu haben. Vielleicht könnten Sie ihn ja zu ein wenig mehr Zusammenarbeit überreden – auch was ein Betreten des alten Minengeländes betrifft.«
Saldeks Miene blieb ausdruckslos. Er blickte einige Sekunden lang auf sein Armbanddisplay, dann sagte er: »Ich denke darüber nach.«
Wir schwiegen eine Weile, dann fragte ich: »Haben Sie über meine Bitte von neulich nachgedacht?«
Mein Gegenüber sah auf. »Das habe ich – mit einem äußerst flauen Gefühl in der Magengegend.«
»Und wie lautet Ihre Entscheidung?«
Saldek blickte einige Sekunden lang schweigend in die Hostiensonne. »Ich informiere Thereza, dass ich uns auslogge«, erklärte er schließlich. »Die Antwort auf Ihre Frage liegt in der realen Welt.« Erneut bediente er seine Armbandtastatur, wobei er seine Haushälterin womöglich durch ein akustisches Signal wissen ließ, dass wir die virtuelle Ebene verließen. »Schließen Sie die Augen«, forderte er mich auf. »Das vermindert die Vertigo.«
45
Nach meinem ›Erwachen‹ im Wintergarten und dem Abklingen des Schwindelgefühls half ich der Haushälterin dabei, das Beatmungsgerät vom Netz zu nehmen und an die Stromversorgung des Rollstuhls anzuschließen. Dann koppelten wir es an ein dafür vorgesehenes Modul, sodass es Saldek möglich war, sich mit dem Gefährt frei durchs Haus zu bewegen. Während der Routinen sagte Thereza nur das Nötigste und folgte uns schließlich stillschweigend, als ich hinter Saldek den Wintergarten verließ.
Ein geräumiger Lift verband sämtliche Stockwerke miteinander, inklusive des Dachstuhls und des Kellers, wie ich am Etagentableau der Kabine ablesen konnte. Mikrofone in den wichtigsten Zimmern und Fluren sorgten laut Saldek dafür, dass er vieles per Sprachbefehl oder über eine in die Rollstuhllehne integrierte Fernbedienung steuern konnte; die Intensität der Beleuchtung, das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern sowie den Lift. Wir fuhren hinab in den Keller – zu meiner Beruhigung ohne Thereza, die bis zum letzten Augenblick vor der sich schließenden Fahrstuhltür stand und mich mit unergründlichem Blick ansah.
»Ist sie ein Mensch?«, erlaubte ich mir einen Scherz, als die Kabine zu sinken begann.
Saldek sah irritiert zu mir auf. »Bitte?«
»Ihre Haushälterin«, erklärte ich. »Ist sie echt oder nur ein schreckhafter, schlecht gelaunter Haushaltsroboter?«
Das amüsierte Lachen eines künstlich beatmeten Menschen war eine traurige Erfahrung, die nicht im Geringsten zum Mitlachen animierte. »Thereza ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen«, erklärte er im Rhythmus der pumpenden Maschine. »Sehen Sie ihr daher ihre oft rüde und dogmatische Art bitte nach. Jeder Mensch ist die Summe seiner Erfahrungen.«
Als der Lift stoppte und die Tür sich öffnete, herrschte vor der Kabine Dunkelheit.
»Amina, Licht«, sagte Saldek, woraufhin eine Reihe von Deckenlampen aufleuchtete.
»Amina?«, fragte ich verwundert.
»Die Schlafwandlerin aus Bellinis Oper La sonnambula«, erklärte Saldek. »Ich lege Wert auf Stimmigkeit, auch beim Interieur.«
Ich folgte ihm aus der Kabine und sah mich um. Auf den ersten Blick schien der Fahrstuhl die einzige Möglichkeit zu sein, in den Keller zu gelangen. Zweifellos gab es irgendwo noch einen verborgenen Treppenschacht oder einen Notzugang, der ihn mit dem Erdgeschoss verband oder hinaus ins Freie führte.
Als ich mich umschaute, sah ich, dass das Computerarrangement im Wintergarten tatsächlich nur einen relativ kleinen, mobilen Arbeitsplatz bildete, der es Saldek erlaubte, beim Programmieren das Tageslicht zu genießen. Der Keller hingegen war das Refugium eines Ungetüms, das sein Dasein hinter Plexiglastüren in einem klimatisierten Serverschrank fristete. Von der Gegenwart des ›Schlafwandlers‹ zeugte auf den ersten Blick nur seine Peripherie auf einem der Arbeitstische: ein Halbkreis aus vier großen, parallel geschalteten Flachbildschirmen, mit denen sich laut Saldek bei Bedarf ein 360-Grad-Panoramabild darstellen ließ. Sie überragten ein Stillleben aus CD- und DVD-Stapeln, elektronischer Hardware und Kabelsträngen. Was sofort ins Auge sprang, war das Fehlen von handschriftlichen Notizen, Zetteln, Stiften und jedweder Art von Papier.
Nachdem ich meinen Blick von der Monitorphalanx gelöst hatte, entdeckte ich eine kleine Bibliothek, mehrere Vitrinen mit getönten Scheiben und eine kleine Gemäldesammlung, welche die wenigen freien Wände schmückte.
»Tut mir leid, ich benötige hier unten so gut wie nie Stühle«, entschuldigte Saldek den Mangel an Sitzgelegenheiten. Er steuerte seinen Rollstuhl vor eine Replik von Arnold Böcklins dritter Toteninsel und betrachtete das Bild eine Weile. »Mein Bruder und ich haben den Großteil unseres Lebens damit verbracht, die Vergangenheit totzuschweigen«, sprach er leise, ohne den Blick von dem Gemälde abzuwenden. »Aber anders als Nikolai hatte ich immer befürchtet, dass die Vergangenheit und ihre Geister nicht ruhen werden – und es auch nie tun würden, solange die Blutlinie meiner Familie sowie die aller andern Zeugen fortbesteht. Mein Unfall, aber vor allem die rapide vorangeschrittene Gemütsveränderung meiner Ex-Frau und ihr Tod haben mir das wieder schmerzlich in Erinnerung gerufen.«
»Zeugen?«, wiederholte ich. »Was meinen Sie damit?«
»Das werden Sie bald selbst herausfinden.«
»Also gibt es tatsächlich so etwas wie einen Fluch?«
»Diese Frage kann ich Ihnen nicht eindeutig beantworten, Herr Crohn. Vielleicht ja, vielleicht nein. Möglicherweise ist es auch etwas völlig anderes.«
»Was meinen Sie damit?«
»Eine Art Pakt«, erklärte Saldek. Er schien nach den richtigen Worten zu suchen, dann fragte er: »Kennen Sie die Legende vom Prager Golem?«
»Flüchtig.«
»Sie erzählt, dass der Rabbiner Judah Löw im 15. Jahrhundert ein Wesen aus Lehm geschaffen und mithilfe kabbalistischer Rituale zum Leben erweckt habe, damit es des Nachts durch die Straßen der Stadt streifte und jeden aufhielt, der eine Last mit sich führte – um zu kontrollieren, ob er womöglich ein totes Kind bei sich trug, das er zum Verderben der Prager Judenschaft in der Judengasse ablegen wollte.«
»Dann glauben Sie also an derartige Dinge?«, interpretierte ich seine Worte.
»Dinge?«, wiederholte Saldek. »Sie meinen Alchemie, Spiritismus, Okkultismus und das Wirken und Walten überirdischer Mächte? Nun, wenn Sie an das Göttliche glauben, müssen Sie zwangsläufig auch akzeptieren, dass es eine Gegenseite und eine weite Grauzone dazwischen gibt. Das Universum basiert auf einem Equilibrium. Wo Licht, da auch Schatten. Was diese Entitäten wirklich sind, welchen Daseinszweck sie haben und welche Ziele sie verfolgen, werden wir wohl nie erfahren. Darum konstruieren wir uns opulent ausgeschmückte Glaubens- und Schöpfungsgeschichten mit illuminierten und obskuren Refugien wie einem Himmel und einer Hölle.«
Ich ließ seine Worte eine Weile auf mich wirken, dann fragte ich: »Haben Sie den Namen oder die Bezeichnung Alastor schon einmal gehört?«
Saldek schien in sich zu gehen, dann schüttelte er kaum merklich und wie in Zeitlupe den Kopf. »Bedaure«, sagte er. »Was soll das sein?«
»Laut einer okkulten Nomenklatur namens Dictionnaire Infernal so etwas wie eine Blutrache-Entität«, erklärte ich. »Ein körperloser, strafender Geist, der fähig ist, von einem Menschen oder einem Tier Besitz zu ergreifen und zu agieren, ohne dass sein Umfeld oder der Betroffene selbst sich dessen bewusst ist.«
Saldek starrte gedankenverloren in eine imaginäre Ferne jenseits des Kellers. Er hob kurz den Blick und sah mich an, dann vollführte er mit dem Rollstuhl eine 180-Grad-Wende und fuhr zu einem der Arbeitstische. Mit ein wenig Mühe vollbrachte er es, die oberste Schublade mit der rechten Hand ein Stück weit zu öffnen, bevor diese kraftlos neben der Rollstuhllehne herabsank.
»Wären Sie bitte so freundlich?«, bat er mich etwas verlegen. Ich trat heran und half ihm, die Hand wieder so auf der Rollstuhllehne zu platzieren, dass sie auf dem Steuermodul lag. »Die Ledermappe«, sagte er und deutete mit einem Finger auf die geöffnete Lade. »Nehmen Sie sie heraus.«
Als ich die Mappe in der Hand hielt, fühlte ich im Inneren etwas, bei dem es sich um ein dünnes Buch, ein Fotoalbum oder ein gerahmtes Bild handeln konnte.
»Öffnen Sie sie«, forderte Saldek mich auf.
Ich zog den Reißverschluss auf und zog eine alte Kladde heraus, auf deren Vorderseite ein altersbraunes Etikett mit der Aufschrift A. S. Deník 13 klebte. Im gleichen Moment reizte ein Geruch meine Nase, der mich dezent an Simons pechbeschmierte Tür in die Anemoi-Dimension erinnerte.
»Das ist eines der Tagebücher meines Vaters, die die Zeit nach dem Krieg überdauert haben«, erklärte Saldek. »Ich könnte Ihnen in meinen eigenen Worten erzählen, was darin geschrieben steht, aber ich halte ich es für sinnvoller, wenn Sie sich Ihr eigenes Bild machen – basierend auf den persönlichen Gedanken und Erinnerungen meines Vaters, unverwässert und ungeschönt.« Er sah zu mir auf. »Können Sie Sütterlin lesen?«
»Sütterlin?«
»Bis 1945 gehörte die Region, in der die Kupfermine und die heutige Baustelle liegen, zum Sudetenland. Mein Vater musste seine offiziellen Standards und Umgangsformen nach dem Krieg und dem Putsch der Kommunisten anpassen, aber für seine Annalen und seine privaten Erinnerungen und seine Korrespondenz mit deutschsprachigen Freunden und Familienmitgliedern hat er weiterhin sein einst gelerntes Sütterlin gepflegt.«
Ich klappte den Buchdeckel auf. »1948?«, stutzte ich, als ich das Datum las. »Soll das heißen, das Lager existierte nach dem Krieg weiter?«
»Bis 1955«, sagte Saldek, nachdem der Blasebalg wieder Luft in seine Lungen gepumpt hatte. »Als sogenannte Reparationsinstitution. Darum war der westliche Talhang auf deutscher Seite bis Ende der 1950er-Jahre Sperrzone. Gewisse Dinge hatten nicht unter freiem Himmel geschehen dürfen, sondern nur innerhalb der Baracken oder in der Mine selbst, was jedoch nicht immer gelungen war. Moskau hatte die Schließung für nötig erachtet, weil es zu nah an der Grenze gelegen hatte. Nach einer Säuberung des Geländes wurde es 1956 schließlich endgültig verlassen und begann zu verfallen.«
»Wir hatten damals die Reste der Betonpfeiler und der Stacheldrahtzäune im Wald gefunden, aber uns keine Gedanken über ihre Bedeutung gemacht«, erinnerte ich mich. »Stattdessen hatten wir uns abenteuerliche Geschichten ausgedacht, wozu sie einst gedient haben könnten und warum sie bereits vor dem Abhang gestanden hatten …«
Ich blätterte bis zum ersten Tagebucheintrag, was Saldek ein leises Stöhnen entlockte.
»Nein, nicht hier!«, sagte er und hob in einem Reflex die Hand, um das Buch wieder zuzuklappen, woraufhin sein Arm erneut kraftlos herabsank. »Nehmen Sie es mit«, erklärte er, nachdem ich ihm geholfen hatte, ihn wieder auf der Stuhllehne zu platzieren. »Es ist meine Antwort auf Ihre Bitte. Möglicherweise liefert es Ihnen auch Antworten auf Ihre Fragen – sofern die Gabe, die Ihnen nachgesagt wird, nicht nur auf leerem Gerede beruht. Sütterlin zu lesen ist nicht so schwer, wie es klingt. Im Netz finden Sie bestimmt eine anschauliche und einprägsame Einführung.«
Ich steckte die Kladde zurück in die Ledermappe und schloss den Reißverschluss.
»Verzeihen Sie, falls ich Ihnen zu nahe trete, aber gab es denn während der Jahrzehnte bis zu Ihrem Unfall keine besonderen Vorkommnisse oder Unglücksfälle in Ihrer Familie?«, fragte ich. »Wie ist Ihr Vater gestorben, Ihre Eltern? Zoë ist Ihr Kind aus erster Ehe, aber ich habe bisher nirgendwo etwas über ihre leibliche Mutter gehört oder gelesen. Lebt sie noch? Was ist aus ihr geworden?«
Saldek musterte mich einige Sekunden lang, ohne zu blinzeln. »Ich denke, für heute bin ich Ihnen weit genug entgegengekommen«, befand er schließlich. »Die Bonuszeit, die Gott mir geschenkt hat, ist kostbar, und es ist wahrscheinlich nicht mehr viel davon übrig.« Er wendete seinen Rollstuhl und lenkte ihn zurück Richtung Lift. »Ich habe Ihnen einen Schlüssel anvertraut, Herr Crohn«, sprach er dabei. »Die dazu passende Tür müssen Sie nun selbst finden.«
46
Während der Rückfahrt in die Stadt ertappte ich mich immer wieder dabei, zu der auf dem Beifahrersitz liegenden Ledertasche zu blicken, in der absurden Befürchtung, irgendetwas Entsetzliches könnte aus dem Buch geschlüpft kommen und beginnen, im Inneren der Mappe umherzukriechen.
»Wie hat Saldek reagiert?«, fragte Vinzenz, nachdem ich mich über die Freisprechanlage bei ihm gemeldet hatte.
»Sonderlich begeistert war er nicht«, gestand ich. »Und für seine Haushälterin bin ich seit heute wahrscheinlich so etwas wie der Teufel und die Reinkarnation von Baba Wanga in einer Person.«
»Ja, das klingt nach einem typischen Lex-Crohn-Hausbesuch«, seufzte Vinzenz. »Wirst du es Miriam erzählen?«
»Das mit der Haushälterin?«
»Idiot.«
Ich warf einen Blick auf das Navigationsgerät. »Wenn sie oder Kuerten das Navi auswerten und sich die Route anzeigen lassen, werden sie von allein drauf kommen.«
»Du bist mit einem Wagen vom Präsidiumsfuhrpark unterwegs?«
»Solange wir in die Ermittlungen involviert sind, kann ich auch auf Soko-Spritkosten ermitteln.«
»Wie geht’s Miriam?«
»Weiß ich noch nicht. Morgen ist die Beerdigung. Falls sie das Bedürfnis hat, zu reden, wird sie sich melden. Ich lasse ihr so lange den Freiraum, den sie braucht. Sie wird gerade eh keinen Kopf dafür haben.«
Vinzenz brummte etwas Unverständliches.
»Hast du schon etwas über das Clèb-Lager herausgefunden?«, fragte ich.
»So hieß es nicht«, sagte Vinzenz. »Bis 1945 lautete der Name Internierungslager Auenthal. Nach dem Krieg hieß es Dolny Niva. Die Leute in den umliegenden Dörfern nannten es jedoch nur Dolik, das Loch, was sich möglicherweise auf das Bergwerk bezieht. Es war bis kurz vor Kriegsende ein deutsches Lager, in dem die üblichen Zustände herrschten, mit dem bekannten Terror und jeder Art von Gräuel gegenüber den Insassen. Ab 1945 diente es als Zwangsarbeitslager, in dem Sudetendeutsche und politisch unbequeme Personen, aber auch missliebige Minderheiten wie Sinti und Roma unter Tage Frondienst leisten mussten, wobei die Umstände sich kaum geändert hatten. Dreißig Mann bekamen an einem Tag zusammen gerade mal zwei Laibe Brot, und drei Mal wöchentlich gab es eine Suppe aus meist verdorbenen Zutaten. Um die durch die deutsche Okkupation verursachten Schäden auszugleichen, waren damals zudem Tausende von deutschen Kriegsgefangenen aus sowjetischem Gewahrsam zur Zwangsarbeit im böhmischen Bergbau an die Tschechoslowakei ausgeliefert worden, so auch nach Dolny Niva.«
»Kriegsgefangene für eine eher bescheidene Kupfermine?«
»Das ist nicht die ganze Wahrheit«, sagte Vinzenz. »Kupfer ist lediglich die offizielle Seite der Medaille. Die inoffizielle heißt Uran.«
»Uran«, wiederholte ich nachdenklich. »Das rückt alles in ein ganz neues Licht.«
»Seinerzeit lagerten im tschechischen Landesteil die größten Uranvorkommen Europas, das meiste davon in den Regionen um Liberec und Pilsen. Dort schürften ab 1945 hauptsächlich deutsche Zwangsarbeiter Pechblende für das sowjetische Atombombenprogramm. Es existierte quasi ein streng geheimes Bergwerk im Bergwerk.«
»Das macht es umso rätselhafter, weshalb die Mine selbst nach der Machtübernahme der Kommunisten unbehelligt blieb«, spann ich den Faden weiter. »Die meisten böhmischen Uranbergwerke hatten die Sowjets besetzt und unter ihre Kontrolle gebracht.«
»Was allerdings das Thema ›besondere oder unerklärliche Vorkommnisse‹ betrifft, muss ich leider passen«, erklärte Vinzenz. »In den bisher gesichteten Dokumenten bin ich auf keine Merkwürdigkeiten gestoßen. Entweder wurden sie erfolgreich vertuscht und die Beweise beseitigt, oder es gab einfach keine.«
»Ersteres halte ich für wahrscheinlicher.« Mein Blick wanderte zur Ledermappe mit dem Tagebuch. »Sag mal, du bist nicht zufällig des Sütterlins mächtig?«
Am anderen Ende der Leitung herrschte kurz Stille, dann fragte Vinzenz: »Wie kommst du jetzt darauf?«
»Ach, nur aus Interesse«, wich ich aus. »Ich meine, du kannst schließlich auch Lippenlesen.«
»Das ist ein erheblicher Unterschied«, erklärte er. »Sonst noch irgendwas? Braille vielleicht, oder Futhark?«
Kurz nachdem Vinzenz aufgelegt hatte, erreichte ich den einzigen Tunnel der gesamten Strecke. Ich warf einen Blick in die nur spärlich beleuchtete, in einer leichten Linkskurve verlaufende Röhre, dann kontrollierte ich die Anruferliste des Handys, um zu erfahren, ob Miriam sich gemeldet hatte, während das Telefon ausgeschaltet gewesen war. Aus dem Augenwinkel heraus nahm ich in Fahrtrichtung einen hellen Schimmer wahr und ärgerte mich darüber, dass ich seit Minuten keinen Gegenverkehr hatte, aber just in dem Moment, in dem ich in den Tunnel fuhr, ein entgegenkommendes Fahrzeug am anderen Ende genau das Gleiche tat. Viel zu spät registrierte ich, dass die Lichtquelle wesentlich höher strahlte, als dass ein entgegenkommendes Fahrzeug dafür verantwortlich sein konnte.
Irritiert blickte ich nach vorn und sah kaum zwanzig Meter vor mir ein riesiges, in Wellenbewegungen auf mich zu schwebendes Gebilde leuchten. In einem Reflex riss ich die Arme hoch, um mein Gesicht zu schützen, und trat die Bremse bis zum Anschlag nieder, wohl wissend, dass die Reaktion viel zu spät kam – doch der befürchtete Aufprall blieb aus. Mit quietschenden Pneus schleuderte der Wagen unter der Kreatur weg oder womöglich sogar durch sie hindurch. Genau konnte ich es nicht sagen, da ich Sekundenbruchteile vor dem erwarteten Aufprall die Augen geschlossen und den Kopf eingezogen hatte. Als der Wagen zum Stehen kam, ohne dass ich mit der Erscheinung oder der Tunnelwand kollidiert war, wirbelte ich herum und blickte durch die Heckscheibe. Hinter dem Fahrzeug war alles finster. Ich würgte beim Lösen des Sicherheitsgurts den Motor ab, riss die Tür auf und stieg mit flauen Knien, aber voller Adrenalin, aus dem Wagen. Von der Lichtkreatur war weit und breit kein Schimmer mehr zu sehen.
»Scheiße noch mal, was soll das?«, schrie ich in die Dunkelheit. »Findest du das etwa witzig?« Ich blickte umher. »Was bist du? Was willst du von mir?«
Mindestens fünf Minuten lang stand ich neben dem Fahrzeug, ohne dass eine Antwort erklang oder ein weiteres Auto in den Tunnel gefahren kam. Aufgewühlt und wütend starrte ich in die Finsternis und war bemüht, meine Nerven zu beruhigen. Unbewusst strich ich mir dabei mit der Hand über den Hinterkopf und fragte mich, ob ich meinen Sinnen noch trauen konnte.
Schließlich stieg ich wieder in den Wagen und startete mit zitternden Händen den Motor. Auch im Licht der Scheinwerfer war weder vor noch hinter dem Fahrzeug eine leuchtende Riesensalmonelle zu sehen. Ich wischte mir den Schweiß vom Gesicht, dann beschleunigte ich den Wagen wesentlich langsamer als üblich und rollte auf das Ende des Tunnels zu. Erst als ich den Ausgang ohne weiteren Zwischenfall passiert hatte, begann ich zu beschleunigen. Immer wieder blickte ich dabei in den Rückspiegel, in der Befürchtung, das leuchtende Emeo-Phantom könnte aus der Tunnelmündung geschossen kommen, um mich zu verfolgen – doch hinter mir blieb alles dunkel.
Zurück in der Stadt, stand ich eine Weile unschlüssig vor meiner Wohnung und hoffte, dass mich der Nachbar im Apartment gegenüber nicht ausgerechnet jetzt durch den Türspion beobachtete. Dann gab ich mir einen inneren Ruck und schob die Tür einen Spaltbreit auf, gerade einmal so weit, dass ich den Arm hindurchstrecken und den Schalter für das Flurlicht erreichen konnte. Als es wie gewohnt aufleuchtete, atmete ich durch. Kein zu schummriger Schein, kein verräterisches Flackern der Deckenlampen. Ich legte die Ledermappe auf der Kommode ab und schlüpfte aus den Schuhen, dann schlich ich über den Flur und lauschte an der Wohnzimmertür. Nachdem ich kein verdächtiges Geräusch gehört hatte, stieß ich sie auf, ohne den Raum zu betreten. Jenseits der Schwelle wirkte alles normal. Kein seltsamer Geruch schwängerte die Luft, die Häuser jenseits der Fenster hatten die korrekten Fassaden, und das Sofa war leer. Es war mein Wohnzimmer, kein dilettantischer Visionarium-Abklatsch. Beruhigt war ich jedoch erst, nachdem ich auch die übrigen Zimmer inspiziert hatte, ohne dass mir etwas Verdächtiges aufgefallen war.
Ich blockierte alle geöffneten Türen mit Keilen, Stühlen oder Wäschekörben, um zu verhindern, dass Hardbergs verrottendes Alter Ego in einem der Zimmer ein weiteres Blendwerk aus der von ihm infiltrierten Echo-Dimension entstehen ließ, in das ich nichts ahnend hineinstolperte.
Seit unserer letzten Begegnung quälte mich die Befürchtung, er könnte womöglich irgendwann unter der Dusche stehen oder nachts plötzlich neben mir im Bett liegen. Ich hatte sogar Angst davor gehabt, Schranktüren zu öffnen. Selbst vor dem Kühlschrank hatte ich für einen Moment gezögert.
Nachdem ich in jedem Raum ein kleines Licht angeknipst hatte, schlich ich fast eine Stunde lang durch die Wohnung, blickte immer wieder in die Zimmer und suchte Veränderungen oder kleine Fehler und verräterische Realitätslücken, welche das Augenscheinliche als Plagiat der Echo-Dimension entlarvten, und erwartete Brackwasser zu riechen, das mir die Anwesenheit des Alastors in seinem Hardberg-Avatar verriet.
Es war irrational.
Als ich mich sicher fühlte und zur Ruhe gekommen war, duschte ich und bereitete mir ein Instantnudelgericht zu. Dann setzte ich mich an den Küchentisch, zog das Tagebuch aus der Ledermappe und begann während des Essens darin zu blättern. Der muffig-modrige Geruch der Kladde und der billige Asia-Nudelduft waren dabei eine sehr gewöhnungsbedürftige Kombination.
Vermutlich hätte mir ein strenges Schulsütterlin gar nicht groß zu schaffen gemacht, aber Saldek hatte seiner Handschrift noch eine kalligrafische, fast schon neofeudal wirkende stilistische Note verpasst. Wahrscheinlich hatte er gehofft, dass Außenstehende beim Entziffern der Seiten die gleichen Probleme hatten wie ich, von den des Deutschen nicht mächtigen Kommunisten und den damaligen sowjetischen Besatzungtruppen ganz zu schweigen.
Das große M, das W und das Y gehören zu den verschnörkeltsten Buchstaben, die ich je gesehen hatte. Das kleingeschriebene E und das N sahen sich zum Verwechseln ähnlich, und manch einen Buchstaben gab es in drei Versionen, abhängig davon, ob er am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes stand. Dank Saldeks Schreibstil hatten manche Passagen mehr Ähnlichkeit mit Erdbebenseismogrammen als mit Sätzen. Nach zwei Stunden hatte ich es gerade mal vollbracht, den ersten Tagebucheintrag zu transkribieren. Weit nach Mitternacht strich ich schließlich entnervt und mit geröteten Augen die Segel, machte Musik an und legte mich aufs Sofa, auf dem Hardbergs Brackwasserfleck mittlerweile getrocknet war.
47
Als ich sieben Stunden später erwachte, lag das Tagebuch neben mir auf dem Boden, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, es vor dem Einschlafen noch einmal in die Hand genommen zu haben. Mit leichtem Muskelkater in den Beinen schlich ich ins Badezimmer und erledigte meine Morgentoilette. In jedem Zimmer der Wohnung brannte immer noch eine Lampe.
Während ich meinen Kaffee trank, blätterte ich wieder in der Kladde und hoffte, auf einer der mit Stockflecken übersäten Seiten etwas zu entziffern, an dem ich ansetzen konnte. Was mir schließlich ins Auge sprang, war ein Wort, das mich elektrisierte und das ich auch ohne Transkription zu lesen vermochte: Vitriol.
Da ich keine Lust verspürte, eine oder gar zwei Wochen lang nichts anderes zu tun als Wort für Wort Saldeks Handschrift zu entziffern, begann ich im Internet nach einer guten und zugleich erschwinglichen Transkriptionssoftware zu suchen – und fand schließlich ein Programm, das laut seinen Entwicklern nach einer manuellen Zeichendefinition seitens des Benutzers auch gepflegte Sütterlinschreibschrift zu übertragen vermochte.