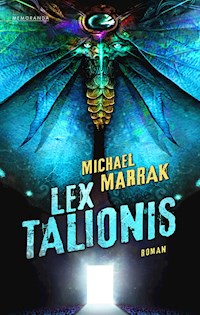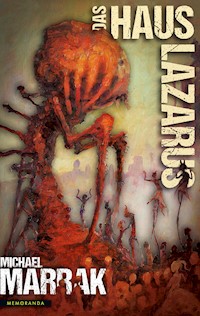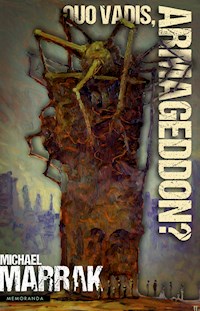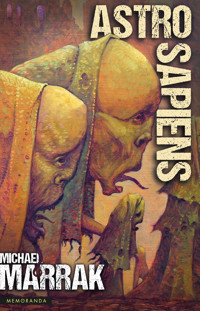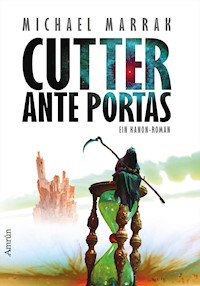Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Bei Ausgrabungen in Mexiko stößt der Archäologe Hippolyt Krispin mit seinem Team auf Hunderte menschlicher Skelette. Verscharrt über einem Uroboros-Relief, weisen viele von ihnen eine Besonderheit auf: sechs Finger und sechs Zehen. Im afrikanischen Mali begibt sich der junge Dogon Pangalé auf die Reise in die sagenumwobene Stadt der Hunde. In ihren Ruinen wird er Zeuge der Zusammenkunft zweier Wesen, die so alt sind wie die Zeit selbst – und muss feststellen, dass ihn mehr mit ihnen verbindet, als ihm lieb ist. In Peru erhält der Astronom Miguel Perea die Aufnahme eines Observatoriums aus Ecuador. Auf ihr fehlen sämtliche Sterne, die weiter entfernt sind als 150 Lichtjahre. Und das, was sie zu verdecken scheint, nähert sich der Erde mit unvorstellbarer Geschwindigkeit. Drei Begebenheiten, die auf den ersten Blick nichts miteinander gemein haben. Doch sie verbindet ein uralter Kreislauf aus Werden und Vergehen: die Apokatastasis panton. Eine fesselnde Mischung aus Indiana Jones, Die Tribute von Panem, Apocalypto und Arthur Conan Doyle – ohne Dinosaurier. Bereits bei Amrun erschienen: Der Kanon mechanischer Seelen Die Reise zum Mittelpunkt der Zeit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
© 2019 Amrûn Verlag
Jürgen Eglseer, Traunstein
Umschlaggestaltung & Illustrationen: Michael Marrak
Lektorat/Korrektorat: André Piotrowski
Alle Rechte vorbehalten
Printed in the EU
ISBN Hardcover
978-3-95869-571-9
Besuchen Sie unsere Webseite:
https://amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar
MichaelMarrak
DERGARTeN
deSUROBOROS
We’ve been sleeping in the garden
Breath of summer, breath of gold
As we turn against the sweep of hills
The sky’s aglow
We fade away
We fade away
John Foxx›The Garden‹
PROLOG
Regungslos lagChebál auf dermächtigen Astgabeleines Peyecus-Baumes und starrte in den Abgrund. Während der Wald pulsierte und zahllose Kleintiere auf der Suche nach Knollen, Früchten und Insekten den lockeren Waldboden durchwühlten, hatte er selbst seit Stunden keinen Laut von sich gegeben und kaum einen Muskel gerührt. Eins mit den Schatten und den Jägern der Nacht, war er sich bewusst, dass im Schutz der Dunkelheit auch Jaguare umherstreiften. Für sie wäre es ein Leichtes, eine Beute im Geäst zu wittern und heraufzuklettern. Das stechend riechende Öl, mit dem Chebál seinen Körper eingerieben hatte, verhinderte nicht nur, dass er Bekanntschaft mit einer hungrigen Raubkatze machte, sondern hielt ihm zudem Schwärme von Stechmücken und anderen fliegenden Blutsaugern vom Leib.
Am intensivsten spürte er jedoch die Allgegenwart der zu Tausenden über dem See jagenden Fledermäuse. Oft verfehlten die Schwingen der Tiere Chebáls Gesicht nur um Haaresbreite. Er fühlte ihren Luftzug auf der feuchten Haut, sobald die kleinen Pelzkörper auf der Jagd nach Insekten an ihm vorbeischossen, vernahm ihr KlickenunddasSirrenihrerFlügelnebenseinenOhren.AndereFledermäuseschwirrtenaufderSuchenachFrüchtenindenBaumkronen umher, mit dem Nebeneffekt, dass gelegentlich Kot und Urin herabregneten,sobaldsiesichirgendwoimGeästniedergelassenhatten.ChebálsDisziplinsorgtedafür,dasserdabeimitkeinerWimper zuckte. Zweimal war in der Dunkelheit bereits eine Baumschlange über ihn hinweggeglitten. In dieser Nacht war Chebál nur ein weiterer Teil des Peyecus – ein stummer Ast mit Augen und Armen und einem tödlichen Bogen, dessen Pfeil hinab auf die Wasseroberfläche gerichtet war.
Ihm war bewusst, dass er selbst beobachtet wurde. Irgendwo in der Finsternis hielt sich ein Taje verborgen und ließ ihn nicht aus den Augen. Stundenlang hatte Chebál vergeblich versucht, ihn zu erspähen, doch ein Taje trüge seinen Titel zu Unrecht, falls dies so einfach gelänge. Niemand vermochte ihn zu sehen, solange er nicht erlaubte, erkannt zu werden. Chebál war darüber nicht beunruhigt. DerBeobachtersorgtedafür,dassdieRegelndesOchoyo eingehalten wurden.
Ein schwacher Lichtschimmer ließ Chebál den Blick heben. DurcheinLochinderWolkendeckefunkelteeineinsamerStern.Chebál entdeckte bald einen zweiten, heller als sein Nachbar. Schließlich trieb der Sturm die Regenwolken gen Westen und entblößte den Nachthimmel in all seiner Pracht und Mächtigkeit. Pihoco und Nahuxi, die Zwillinge der heiligen Pfade, blickten nun auf die Welt herab, daneben Ixil, die Steinschlange, und Munyar, ihr gehörnter Wächter. Hoch im Norden glänzte Urenaxi mit seinen sechs Jungen – und alle Sternbilder und Himmelsgötter überstrahlend Asir, der Yaon-Stern.
Gehobenen Mutes sah Chebál hinab in den scheinbar unermesslich tiefen Abgrund, der unter ihm gähnte und von Bergflanke bis Bergflanke reichte. Etwas auf seiner Oberfläche bewegte sich, als führte sie ein gespenstisches Eigenleben. Das Licht der Sterne offenbarte, was der vermeintliche Schlund tatsächlich war: die im Nachtwind wallende Oberfläche eines Sees, eine schwarze Ebene kleiner tanzender Wellen. Er ruhte am Grund eines kraterartigen Talkessels, überragt von steilen Bergrücken, deren nordwestlich gelegenen Grat Chebál im Verlauf der Nacht ein weiteres Mal überqueren musste – sofern seine Geduld belohnt und seine Jagd von Erfolg gekrönt wurden.
Jedes Reich beheimatete einen König. In der Luft war es der Kondor, an Land der Jaguar – und im Wasser der Pirarucu. Einige Exemplare erreichten gut und gerne die doppelte Länge eines ausgewachsenen Mannes und hatten Kiefer, die einen Arm zermalmen, Muskeln zerreißen und Eingeweide zerfetzen konnten.
Beim Ochoyo ging es darum, einen Pirarucu zu erlegen und darauf zu achten, dass es nicht nur ein Jungtier war. Ob der erbeutete Fisch ein oder sogar sagenhafte zwei Zuna groß war, spielte am Endenur eine untergeordnete Rolle. Worauf es ankam,war der furchterregende Kopf. Einzig ihn musste ein erfolgreicher Wettstreiter in der Mondgrotte präsentieren. Und das nicht irgendwann im Laufe der Festwoche, sondern vor Sonnenaufgang jenes Tages, an dem der Yaon-Baum sich aus dem See des Kondors erhob.
Heute, in der Nacht des Ochoyo.
Hinzu kam, dass man zu den ersten fünfzehn Wettstreitern gehören musste, die den Hohepriestern ihre Trophäe präsentierten. Hatte der Fünfzehnte den Eingang der Mondgrotte durchschritten, wurde das Tor versperrt und blieb dies für die kommenden sechs Jahre bis zum nächsten Ochoyo. Allen, die die riskante und beschwerliche Nachtwanderung vom Mondsee zum See des Kondors mit einer eigenen Trophäe geschafft hatten, aber zu spät kamen, blieb der Zugang zur Grotte und den Kanus der Finalisten verwehrt.
Lauschte Chebál in die Nacht hinein, erschien es ihm fast schon unheimlich, dass mit ihm zugleich Dutzende anderer Jäger samt ihrer Tajema stumm und reglos und mit schussbereiten Bögen, Schleudern oder Speeren am Ufer des Sees auf der Lauer lagen, verborgen zwischen Felsen, im Dickicht, in den Baumkronen oder im Uferschlamm.
Jahrelang hatte er für das Ochoyo trainiert, hatte sich auf seine Strapazen und Entsagungen vorbereitet, war gerannt, geklettert, geschwommen, getaucht und hatte sich in Schweigen, Reglosigkeit, Gebeten und innerer Einkehr geübt. Nun kauerte er hier, in der Nacht vor dem Finale, und gehörte zu den letzten fünfzig, die nach den Ausscheidungswettkämpfen der vergangenen sechs Tage übrig geblieben waren. Alles, was ihn noch vom Triumph trennte, sich als einer der fünfzehn Finalisten zu präsentierten, war ein Pirarucukopf und ein langer Wettlauf gegen die Zeit – vom Mondsee durch den Wald zurück zur Grotte.
Während der vergangenen Stunden in vollkommener Dunkelheit hatte Chebál seine Chancen, den Rückweg rechtzeitig zu finden, gegen null gesehen. Doch nun, wo die Wolkendecke aufgerissen war, könnten das Mondlicht der zweiten Nachthälfte und die Morgendämmerung sich als wertvolle Verbündete erweisen. Zwar brannten entlang des Pfades, der die beiden Seen verband, im Abstand von jeweils fünfhundert Schritten Signalfackeln, doch der Weg war tückisch und gefährlich. Den Wettkämpfern selbst war es untersagt, eigene Lichtquellen mit sich zu tragen.
Auch die Pirarucu waren nicht unbedingt Freunde vollkommener Dunkelheit. Erst das Sternenlicht lockte sie ans Ufer, wo sie zwischen Wurzeln und Felsen ihre Beute fanden. Blieb es finster, verharrten auch die Raubfische in schützender Nachtstarre – was im schlimmsten Fall zur Folge hatte, dass sie nicht zu den auf sie lauernden Jägern geschwommen kamen, sondern Letztere gezwungen waren, ins nachtschwarze Wasser zu steigen und nach ihnen zu tauchen. Allein der Gedanke daran hatte Chebál stundenlang Bauchschmerzen bereitet.
Eine kaum merkliche Vibration des Astes sorgte dafür, dass sein Herzschlag für einen Moment aussetzte. Er hielt den Atem an und lauschte, während seine Gedanken rasten. Es gab nicht viele Gründe, weshalb ein Jaguar auf einen Baum kletterte. Chebál fühlte den Blick des unsichtbaren Jägers in seinem Rücken.
Vielleicht hätte er Pachanas Wunderöl doch nicht so vorbehaltlos vertrauen sollen …
Er schoss den eingespannten Pfeil hinab ins Wasser, hob den Bogen, hängte ihn langsam über seine Schulter und griff nach seinem Speer. Seine Hände schlossen sich um den Stab, bereit, die Spitze in jeden Angreifer zu rammen, der ihn aus der Dunkelheit ansprang.
Die Muskeln bis zum Zerreißen gespannt, wandte er sich langsam um. Einige Schritte entfernt erkannte er einen Schatten, doch kauerte dieser nicht wie ein sprungbereiter Jaguar auf dem Ast, sondern hockte vor dem Stamm, einen Arm lässig auf dem rechten Schenkel ruhend, die andere Hand an seinem Speer, den er sich an den glänzenden Nacken gelehnt hatte. Vor Chebál saß keine hungrige Raubkatze, sondern ein weiterer Wettkämpfer. Es war Tuomay.
Ausgerechnet Tuomay, der ihn abgrundtief dafür hasste, beim Werben um Pachanas Gunst das Nachsehen gehabt zu haben.
Mit einem Laut der Missbilligung stieß Chebál den angehaltenen Atem aus. »Du bist es!«, begrüßte er seinen Kontrahenten flüsternd, wobei er seine Verärgerung über dessen Auftauchen gar nicht erst zu verbergen versuchte. Er wollte nicht so recht glauben, dass Tuomays Auftauchen Zufall war. Nicht ausgerechnet jetzt, wo der Mond über dem östlichen Bergkamm auftauchte und nach Stunden der Finsternis der erste schwache Lichtschimmer das Seeufer erhellte. »Sei froh, dass kein Speer in deiner Kehle steckt«, sagte er. »Ich glaubte schon, du wärst eine rotzkranke Katze.«
»Ganz im Gegenteil«, raunte Tuomay. »Mal abgesehen davon, dass du mich sowieso verfehlt hättest. Ich wollte wissen, was hier oben so erbärmlich stinkt. Ein Wunder, dass die Blätter nicht von den Bäumen fallen.«
»Nun weißt du es, also kannst du wieder verschwinden.«
Tuomays Zähne leuchteten im Mondlicht, als er den Mund zu einem Grinsen verzog. Abwägend blickte er hinab aufs Wasser. »Das ist wirklich eine gute Stelle, um auf einen Pirarucu zu warten.«
»Such dir einen eigenen Baum!«
»Wozu? Es gefällt mir hier oben.«
»Auf diesem Ast ist nicht genug Platz für uns beide.«
Chebál sah sich um. Sein Taje musste das Geschehen beobachten. Tuomay war dabei, die Regeln zu brechen, und gab sich nicht einmal Mühe, seine Stimme zu dämpfen. Warum schritt dessen eigener Taje nicht ein und unterband dessen anmaßendes Treiben?
»Falls du nach wie vor fantasierst, morgen tatsächlich einen deiner verkrüppelten Füße auf den Yaon-Baum zu setzen, dann solltest du nun wieder runterklettern und dich zum Teufel scheren«, zischte er. Zur Bekräftigung seiner Worte hob er seinen Speer und richtete dessen Spitze auf den Schatten.
Tuomay schürzte unbeeindruckt die Unterlippe. »Jemand wird denYaon-BaumimLichtdesneuenTageserklimmen«,bestätigteer. »Aber gewiss nicht du!«
Mit einer blitzartigen, kaum erkennbaren Bewegung ließ er seine Schleuder vorschnellen. Die Lederschnur wickelte sich um Chebáls Speer, dann riss Tuomay den Arm zurück, sprang auf, war mit zwei weiteren Sprüngen heran und rammte seinem Kontrahenten den Fuß in den Bauch. Der Tritt traf Chebál völlig unvorbereitet. Er ruderte mit den Armen, rutschte auf der feuchten, moosbewachsenen Rinde ab, verlor das Gleichgewicht und stürzte durch die Astgabel hinab in die Tiefe. Einen Herzschlag später kochte um ihn herum der See. Halb betäubt von der Wucht des Aufpralls, verschluckte er Wasser, musste husten und schluckte noch mehr davon. Eingehüllt in einen Kokon aus Luftblasen, strampelte er wild mit den Beinen, dann durchstieß sein Kopf die Oberfläche. Er rang nach Luft, hustete und spuckte das verschluckte Wasser wieder heraus, wobei er immer wieder versank. Schließlich zwang er sich zur Ruhe, bis seine Konfusion sich gelegt und sein Atem sich beruhigt hatten.
»Das werde ich dir heimzahlen!«, rief er in die Dunkelheit, ohne recht zu wissen, in welcher Richtung das Ufer lag und wo der offene See.
»Nicht in diesem Leben«, vernahm er Tuomays Antwort aus der Baumkrone.
Chebál versuchte sich zu orientieren. Er trieb inmitten eines sich langsam auflösenden Schaumteppichs. Einige Schwimmzüge entfernt tanzte ein undefinierbares kleines Etwas auf den Wellen. Es wirkte wie der Kopf einer Schildkröte, die ständig aus dem Wasser lugte, um herauszufinden, was für ein komisches Ding da aus den Bäumen in ihr Revier geplumpst war. Chebál schwamm ein Stück darauf zu, bis er erkannte, dass es sich um das hölzerne Stielende seines Speers handelte.
DenGötterndankend,dasserihnausleichtemYonbara-Holzangefertigt hatte, wollte er nach ihm greifen, als in unmittelbarer Nähe eine Wasserfontäne in die Höhe schoss.
»Verzieh dich aus meinem Revier!«, rief Tuomay, der über ihm in breitbeiniger Siegerpose auf der Astgabel stand und einen neuen Stein in seine Schleuder legte. Chebál äußerte einen Fluch, packte den Speer und begann zum Ufer zu schwimmen, woraufhin nur eine halbe Armlänge neben Chebáls Kopf eine weitere Wasserfontäne aufspritzte. »Falsche Richtung«, informierte ihn Tuomay und wies mit seinem eigenen Speer hinaus auf den See. »Vertrau mir, dass der nächste Schuss trifft. Und lass dir nicht einfallen, vor Sonnenaufgang nochmal in meine Nähe zu kommen.«
Zitternd vor Wut, blickte Chebál über die schwarze Wasserfläche. Bis zum gegenüberliegenden Ufer waren es gut zweihundert Zuna, wobei ein Zuna der Länge einer Armspanne entsprach. Wohl oder übel war er gezwungen, sich auf seine Schwimmkünste zu verlassen. Noch immer hielt er das Ende des Speerschafts umklammert; der einzige Trost, der ihm geblieben war.
Er wollte die Waffe an sich ziehen, um besser schwimmen zu können, doch ihre Spitze schien sich in einer Wasserpflanze verfangen zu haben. Nur widerwillig ließ sie sich bewegen. Einige Augenblicke lang schwamm Chebál auf der Stelle, dann holte er tief Luft und tauchte unter. In der Finsternis vermochte er nichts zu erkennen, daher versuchte er, die Ursache mit der Hand zu erfühlen – und erschrak bei der ersten Berührung fast zu Tode. In seiner Panik ließ er den Speer los und entfernte sich hastig einige Schwimmzüge von der Position der Waffe. Als er auftauchte, um nach Luft zu schnappen, erwartete er bereits einen gezielten Treffer aus Tuomays Steinschleuder, doch sein missgünstiger Kontrahent hielt sich zurück. Vielleicht hatte er inzwischen begriffen, dass er mehr als nur eine Regel des Ochoyo verletzt hatte, oder wollte schlicht Munition sparen. Allerdings zweifelte er daran, dass Tuomay zu einer derartigen Einsicht fähig war.
»Ich muss den Speer befreien«, rief er hinauf ins Geäst.
Keine Antwort.
Die trügerische Ruhe ausnutzend, tauchte Chebál ein zweites MalindieTiefe.Zuerstzögerteer,eszuberühren,dannließerseineHändeüberdenstarrenKopfwandern, befühlte die ledrige Haut, den vor Muskeln strotzenden Körper und die rauen Flossen …
Was vor aller Augen verborgen am spitzen Ende des Speers trieb, war ein Pirarucu! Zwar war es nicht das größte Exemplar, mochte aber immer noch die Hälfte von Chebáls Gewicht besitzen. Der Speer musste es tödlich getroffen haben, als er aus seinen Händen geglitten und vom Baum gefallen war. Eine mehr als glückliche Fügung des Schicksals. Die Metallspitze der Waffe war knapp über dem linken Auge in den Schädel eingedrungen und ragte zur Kehle des Fisches wieder eine Fingerbreite heraus.
Die Hohepriester behaupteten gerne, ein von ihnen zum Taje geweihter Beobachter könne in die Zukunft blicken. Vielleicht hatte Tuomays Taje dessen anmaßendes Handeln nicht unterbunden, weil er gesehen hatte, wie die Sache letztlich für Chebál ausgehen würde. Dennoch war er froh, dass die Könige der Seen sich nicht gegenseitig fraßen – und konnte von Glück sagen, bei seinem blinden Tasten zuvor nicht versehentlich ins geöffnete Maul des Pirarucu gegriffen und seine Finger an den messerscharfen Zähnen aufgeschlitzt zu haben. Wenn auch das Blut des Fisches keine hungrigen Räuber anlockte, das eines Menschen tat es zweifellos.
Chebál warf einen letzten Blick hinauf in die Baumkrone, dann begann er – seinen Speer mit der aufgespießten Beute fest umklammernd – auf den offenen See hinauszuschwimmen.
»Viel Spaß auf dem Heimweg, du Versager!«, rief Tuomay, als er erkannte, dass Chebál sich endlich vom Ufer entfernte. »Lass dich im Wald auffressen, solange es noch Nacht ist und die Sonne es nicht sieht. Dann ersparst du deiner Mutter die Schmach zu erfahren, einen ewigen Verlierer gesäugt zu haben!«
Chebál ignorierte sein hämisches Gebrüll. Entkräftet, aber von Triumphgefühl, Schadenfreude und einem Rest Wut motiviert, erreichte er mit seiner Last das gegenüberliegende Ufer.
»Tuomay!«, rief er über das Wasser, nachdem er sich von den Strapazen erholt und seine Beute an Land gezogen hatte. »Ich danke dir!DeineUnverschämtheithatmirGlückbeschert!«Damitstemmte er triumphierend den Pirarucu in die Höhe, sodass sein Kontrahent – und jeder andere Wettkämpfer, der ringsum am Ufersaum auf der Lauer lag und ihn in der Dunkelheit zu erkennen vermochte – den erbeuteten Fisch sehen konnte.
VomgegenüberliegendenUferdrangeinWutschreiherüber,dann vernahm Chebál ein Sirren, dessen Verursacher jedoch über seinen Kopf hinwegzischte und raschelnd im Dickicht verschwand. Zwei weitere in seine Richtung geschossene Pfeile erreichten das Ufer nicht und versanken glucksend im Wasser.
Chebál äußerte ein hämisches Heulen, quittierte die Versuche, ihn zu treffen, mit einem lauten spöttischen Lachen, dann duckte er sichundentferntesicheinStückvomUfer,bevoreinervonTuomays blindwütig verschossenen Pfeilen ihn zufällig doch noch traf.
Aus dem Augenwinkel heraus nahm er über sich eine Bewegung wahr. Keinen Steinwurf von ihm entfernt, stand am unteren Ende einer weit ausladenden Iacoba-Baumkrone eine weibliche Taje, den gesamten Körper mit Blättern und Ranken bemalt. Chebál konnte nicht erkennen, wessen Gesicht sich hinter der Ledermaske verbarg. Der Statur nach könnte es sich bei der Beobachterin, die ihm von den Hohepriestern zugeteilt worden war, um Isoni handeln – oder um Pachana …
Während Chebál hinauf in die Baumkrone blickte, wandte die Taje sich ab, machte zwei, drei grazile Sprünge über den Ast und verschmolz mit dem Blätterdach, indes er nur einmal blinzelte. Sich der Bedeutung des Geschehenen bewusst, spitzte Chebál anerkennend die Lippen. Seine Taje hatte sich ihm zu erkennen gegeben. Es war eine mehr als nur schmeichelnde Würdigung seiner Leistung.
Er trennte den Kopf des Pirarucus ab, zog ihm eine Schnur durch die Kiemen, verknotete sie und hängte sich die Trophäe über Hals und Schulter. Anschließend schlitzte er mit einem geschickten Schnitt den Körper des Fisches auf und löste den Rogen heraus – als Wegzehrung für den langen Marsch zur Mondgrotte. Ehe Chebál sich auf den Weg machte, blickte er noch einmal hinauf zum Yaon-Stern und murmelte ein Dankgebet, dann wandte er sich gen Osten und verschwand im Unterholz.
Wir sind nicht auf Erden, um zu leben.
Wir sind gekommen, um zu schlafen und zu träumen.
Tochihuitzin Coyolchiuhqui,
aztekischer Dichter und Philosoph
Teil 1
DER BAUM DER ERSTEN STERNE
1
Sierra Tarahumara ∙ Mexiko
Der vor der Windschutzscheibe des Pick-ups hin und her schwingende Haken des Abschleppwagens erwirkte eine tiefe innere Ruhe.
Von seiner hypnotischen Kraft, dem monotonen Tuckern des Motors und den Auspuffabgasen gleichermaßen benebelt, starrte Hippolyt Krispin auf die sanft im Wind pendelnde Stahlkette. Außer ihm und dem Fahrer des Transporters warteten noch ein gutes Dutzend weiterer Vehikel darauf, ihre Fahrt fortsetzen zu können.
Vor der Kühlerschnauze des Schleppers sprangen mehrere Hütehunde auf und ab, um eine gefühlte Million Schafe über die Straße zu treiben. Die Tiere schienen bei Temperaturen von fast vierzig Grad im Schatten jedoch in ein Marschphlegma gefallen zu sein, aus dem nicht einmal die Hunde und ihre jugendlichen Viehhirten auf ihren knatternden Mofas sie zu schrecken vermochten. Seit geschlagenen fünfzehn Minuten trottete die Herde vorüber, als befände sie sich auf einem Todesmarsch. In Wirklichkeit mochten es gerade einmal dreitausend Tiere sein, die zwischen zwei beständig länger werdenden Wagenkolonnen die Straße überquerten.
Hippolyt warf einen Blick auf seine Armbanduhr, dann schloss er für eine Minute die Augen. Er stand kaum drei Kilometer hinter Obrera, einem Randbezirk der Rarámuri-Hauptstadt Guachochi. Sie ist keine der reichen und prächtigen Kolonialstädte mit pittoresken Straßenzügen, bunten Häusern und Weltkulturerbe-Prädikat, sondern ein staubiges Wüstenstädtchen mit billigen Supermärkten und ein paar hübschen begrünten Touristenflecken. Die ansässigen Rarámuri-Indianer hatten ihrer Zwanzigtausend-Seelen-Metropole den Namen Lugar de garzas gegeben, Stadt der Reiher – als Synonym für die legendäre Aztekenheimat Aztlán.
Auf der Ladefläche des Pick-ups drängten sich Einkäufe und Proviant,dasimnochgutvierzigKilometerentferntgelegenenGrabungscamp sehnlichst erwartet wurde. Obstkisten, Kekse, Wasser, Toilettenpapier, Seife, Zigaretten, Werkzeug, Tequila, Ersatzgeschirr, Benzin und Paletten mit Dosenbier schmorten in der Hitze des späten Nachmittages. Einzig die Tatsache, dass Hippolyt wahrscheinlich erst nach Anbruch der Dunkelheit im Lager eintreffen und die Fracht ihren Bestimmungsort somit nachtgekühlt erreichen würde, verschaffte ihm Trost.
Ein plötzlicher, sekundenlang anhaltender Hupton schreckte Hippolyt aus seinem Dämmerzustand. Zu faul, einen Blick über die Schulter zu werfen, sah er zum Innenspiegel und erblickte den fast das Wagenheck berührenden Kühlergrill eines Reisebusses, dessen Fahrer der Schaftrieb offenbar den letzten Nerv raubte. Schließlich erstarb der Motor des Busses. Stattdessen erklang aus dem Busfenster heraus eine Tirade mexikanischer Flüche in Richtung der Schafhirten. Hippolyt bezweifelte, dass die beiden auf ihren Mofas auch nur ein Wort davon verstanden.
Müde fuhr er sich mit der Hand über das Gesicht, dann blickte er fast schon wehmütig Richtung Osten. Hinter dem Horizont, gut achttausend Kilometer Luftlinie von Guachochi entfernt, lag seine Heimatstadt Alexandria. Das schottische Alexandria wohlgemerkt, ein schmuckloses, nordwestlich von Glasgow die Landschaft verschandelndes Industriekaff am River Leven, durch den das Wasser des ihn speisenden Loch Lomond in den kaum zehn Kilometer weiter südlich gelegenen River Clyde abfloss.
Ganze 39 Orte rund um den Globus schmücken sich mit dem geschichtsträchtigen Stadtnamen. Jenes Alexandria, in dem er aufgewachsen war, gehört zweifellos zu ihren trostlosesten. Nichtsdestotrotz wünschte Hippolyt sich in Augenblicken wie diesem, in denen er im eigenen Saft schmorte und kein Fahrtwind seine Haut trocknete, zurück in jene elegische Region, von den Einheimischen wegen ihres ständigen Nieselregens Drizzle-Alley genannt wurde. Schloss er das Seitenfenster, verwandelte die Nachmittagssonne den Pick-up in einen Brutkasten für achselschweißzersetzende Bakterienstämme. Ließ er es offen, schwängerten Abgase und der penetrante Wollwachsgestank der Schafe das Innere.
Eigentlich hatte Hippolyt sich vor sechs Jahren entschieden gehabt, keine Grabungskampagnen mehr zu leiten und der aktiven Archäologie den Rücken zuzukehren. Das war ihm bis zu einem fünf Monate zurückliegenden Symposium für Frühgeschichte in Mexiko Stadt, in dessen Rahmen er zwei Vorträge über präsumerische Kulturen gehalten hatte, auch bestens gelungen. Dann war er voneinemMitarbeiterdesmexikanischenNationalinstitutsfürAnthropologie und Geschichte um ein vertrauliches Gespräch unter vierAugengebetenworden.WasihmindessenVerlaufohneVorlage von Fakten und Bildmaterial unter die Nase gerieben worden war, hatteihnzuderAussagegenötigt,dassderinHippolytsAugenwichtigtuende INAH-Emissär das Ressort ›theoretische Archäologie‹ offenbar mit ›alternativer Geschichtsschreibung‹ verwechselt hatte.
Tags darauf war der Mann jedoch erneut vorstellig geworden, diesmal mit einer Tasche voller Dokumente um den Hals und einem grimmig schauenden Aufpasser an seiner Seite, der sein Bestes gab, um ihren Inhalt vor jedweder Art von Fremdzugriffen abzuschirmen. Und mit dem, was der INAH-Mitarbeiter Hippolyt daraufhin in einem Separee des Konferenzgebäudes präsentierte, hatte er dessen gute Vorsätze samt und sonders zunichtegemacht …
Hippolyt seufzte und drehte den Innenspiegel des Pick-ups zu sich hin. Ein müdes, vom Staub der Schafe gerötetes Paar blauer Augen erwiderte seinen Blick. Und die darin liegende stumme Frage, warum zum Teufel er eigentlich nicht einfach zurück nach Guachochi gefahren war, um irgendwo bei einem kühlen Bier zu warten, bis die verdammte Straße wieder frei war.
Seine Augen verrieten auch, dass er sich für seine 53 Jahre erstaunlich gut gehalten hatte. Derart lapidar ließe sich unterm Strich jedenfalls der Tenor zusammenfassen, sobald er in Gesprächen mit Fremden auf sein Alter zu sprechen kam. Der vermeintlich glückliche Umstand erfüllte Hippolyt jedoch nur bedingt mit Freude. Beunruhigend gut gehalten erschien ihm die treffendere Bezeichnung zu sein. Tatsächlich sah er noch immer aus wie an jenem Tag, an dem er vor vierzehn Jahren das Krankenhaus in Kairo verlassen hatte, ohne Altersfalten, ergraute Schläfen und die obligatorischen Post-Midlife-Zipperlein. Sein Haar war nach wie vor voll und dunkelbraun, seine Gesundheit – zumindest die physische – prächtig. Tatsächlich gealtert war in den vergangenen vierzehn Jahren einzig sein Intellekt. Doch das war eine andere Geschichte.
Als alle Schafe schließlich im Bezirk Obrera-Ost angekommen waren und die Fahrt endlich weiterging, stand die Sonne bereits tief am Abendhimmel. In Fahrtrichtung erhob sich die Silhouette der Kordilleren am westlichen Horizont wie ein platt gehämmerter Dornenbasilisk.
Gut vierzig Kilometer waren es von Guachochi bis hinunter nach Terriéro Alto, eine Strecke, für die Hippolyt mit dem Pick-up an guten Tagen zwei Stunden benötigte – und an schlechten Tagen wie heute mindestens vier. Ley de Murphy, sagen die Mexikaner zur Willkür des Alltags. Ein nicht unerheblicher Anteil der Zeit wurde ihm von Trucks gestohlen, welche in Kurven die gesamte Spurbreite für sich beanspruchten. Die meisten ihrer Fahrer mieden die Fernstraßen und ihre Mautstellen, weil ihnen die Gebühren zu teuer waren. Ihre exzentrische Fahrweise hielt Hippolyts ortskundige Verfolger jedoch nicht von teils waghalsigen Überholmanövern ab, da er mit dem voll beladenen Wagen für hiesige Verhältnisse viel zu besonnen über die Piste schlich.
Zwar war der mexikanische Straßenverkehr selbst unter Mexikanern gefürchtet und mitunter fuhren die Autos unter Dauergehupe statt zwei- plötzlich vierspurig, doch eines hatte Hippolyt rasch begriffen: Selbst in diesem Land folgte der Verkehr bestimmten Gesetzen.Sobald er das Systemeinmal durchschauthatte, zeigte sich,dass Mexikaner in gewisser Weise doch aufeinander achtgaben – und sei es nur, um das meist schon arg malträtierte Blech ihres Autos nicht noch weiterem Stress auszusetzen. Nahm man selbstbewusst seine Fahrspur in Besitz und ließ sich nicht an den Rand drängen, wurde man auch als für einheimische Verhältnisse fernöstlicher Gringo als vollwertiger Verkehrsteilnehmer akzeptiert. Zwar war es notwendig, den Rückspiegel als absolut lebenswichtiges Utensil zu betrachten, aber im Laufe der vergangenen Wochen hatte der Straßenverkehr für Hippolyt seine Schrecken verloren.
Eine Weile fuhr er relativ allein durch die karge Landschaft, um ihn herum nur verbrannte Erde, verdorrte Büsche und Sträucher. Der Asphalt war rau, vielerorts klafften Schlaglöcher in der Fahrbahn und die Seitenstreifen glichen Müllkippen. Neben leeren Flaschen, Tüten, Fastfood-Verpackungen und unzähligen Papiertüchern säumten auch Sofas und Stühle, alte Kühlschränke, ausgeschlachtete Fernseher und Autowracks die Straße. Zahlreiche Kreuze zeugten am Straßenrand neben dem Müll von den Gefahren der Route, da immer wieder Rinder, Esel oder Kojoten die Piste kreuzten oder Fahrer in den Gegenverkehr steuerten. Sie erschraken vor umherspringenden Geiern, die sich über die Kadaver jener Tiere hermachten, denen die Stoßstangen und Kühlergrills der Trucks zum Verhängnis geworden waren. »Cuenta con todo«, pflegten die Menschen zu sagen, die entlang der Straße lebten. »Hier kann alles passieren.«
Der Müll begleitete Hippolyt, bis er fünfzehn Kilometer hinter Obrera die asphaltierte Route verließ und auf die Schotterpiste Richtung Terriéro Alto abbog. Obwohl die Hochebene auf über zweitausend Metern lag, war es auch kurz vor Sonnenuntergang noch heiß und schwül; eine Begleiterscheinung der zahlreichen Gewitter, die um diese Jahreszeit über der Sierra Tarahumara wüteten. Oft blitzte und donnerte es dabei stundenlang, ohne dass die Unwetter sich vom Fleck bewegten. Heute verdunstete die Feuchtigkeit der Regengüsse von gestern.
Viele der Menschen, die entlang der Straße lebten, hausten in Wellblechhütten oder unter Zeltplanen. Manche Familien besaßen als einzigen Luxus lediglich einen uralten VW-Bus, in den sie bei heftigen Regenfällen eilig ihr gesamtes Hab und Gut verluden, um es vor den Fluten zu schützen.
Nachdem Hippolyt die Ausfallstraße verlassen hatte, wand die staubige Piste sich in südlicher Richtung für einige Kilometer durch Agavenfelder und lichte Kieferhaine über das Hochplateau, um am Abgrund zur gigantischen Sinforosa-Schlucht erneut die Richtung zu ändern und dem obersten Taleinschnitt folgend bergab zu führen. Die Sinforosa war die Königin unter den Canyons der Barranca del Cobre, eines mehr als achtzehnhundert Meter tiefen Schluchtensystems, viermal so groß wie der Grand Canyon.
Nach einer etwa zwei Kilometer langen, halbwegs geraden Gefällestrecke führte die Straße durch ein Bergbaugebiet, in dem Marmor und Onyx gewonnen wurden, und folgte schließlich dem Saum atemberaubender Klippen. Gegenverkehr war hier unten zum Glück selten, und falls sich doch Fahrzeuge auf die Strecke verirrten, waren es betagte VW-Busse oder sechzig Jahre alte Chevrolets, die bergauf ächzten.
Der Regen der vergangenen Tage hatte den Boden aufgeweicht und zahlreiche Bergrutsche verursacht. Es kostete Nerven, die nassen Geröllhalden zu durchfahren, ohne abzurutschen. An manchen StellenfehltegareinhalbmondförmigesStückderStraße.DieKunst bestand darin, die Abschnitte, deren Fahrbahnränder in der Tiefe verschwunden waren, in der Dunkelheit rechtzeitig zu erkennen. Streckenweise kam Hippolyt nur mit Schrittgeschwindigkeit voran, und mancherorts gab es keine andere Lösung, als den Wagen anzuhalten, die Schaufel auszupacken und die tiefsten Löcher von Hand zuzuschütten. An anderen Stellen war der aufgeweichte Hang so ins Rutschen geraten, dass Hippolyt Steine, Bäume und Erdreich beiseiteräumen musste, um weiterfahren zu können. Bei der Beseitigung einer Schlammlawine, deren Geröll hüfthoch die Straße blockierte, kam ihm der Fahrer eines Radladers zur Hilfe, der für die nahe Onyxmine arbeitete und in deren Auftrag die Straße freiräumte.
Wer einmal in einem Anfall geistiger Umnachtung versucht hatte, die Barranca del Cobre von Norden nach Süden mit dem Auto zu durchqueren, wusste danach, warum die Rarámuri zu den besten und ausdauerndsten Querfeldeinläufern der Welt gehörten.
Unterhalb der Mine schlängelte die Straße sich in immer engeren Kehren durch schier endlose Wälder aus Säulen- und Kandelaberkakteen. Helden und Schurken aus Westernklassikern begannen vor Hippolyts geistigem Auge hinter Baumschatten und Riesensukkulenten umherzuhuschen.
Es war nicht das erste Mal, dass er die Fahrt hinab auf das Terriéro-Plateau nach Einbruch der Nacht bewältigen musste. Trotz der Strapazen waren seine Sinne geschärft und ließen ihn die Strecke mit dem nötigen Gleichmut meistern. Am Grund der Schlucht rosteten zahllose deformierte Fahrzeugwracks vor sich hin. Sie mahnten jeden Reisenden davor, was ihn am Ende einer jeden Kurve erwartete, wenn er sich im entscheidenden Moment von der grandiosen Landschaft ablenken ließ …
Als Hippolyt sich endlich seinem Ziel näherte, waren die Kegel der Pick-up-Scheinwerfer die hellsten Lichtquellen weit und breit. Der von den Erbauern Terriéros vor Jahrtausenden eingeebnete Bergrücken war in der Dunkelheit nur zu erahnen. Am Ende der Straße leuchteten zwei Feuerstellen, umrahmt von zahlreichen kleinen Zelten und einem großen Basiszelt. Lachen, Gitarrenklänge und mexikanische Gesänge hallten durch die Schlucht und mussten inzwischen jedes nachtaktive Tier im Umkreis von zehn Kilometern verscheucht haben. Die einzigen lärmresistenten Geschöpfe, die sich selbst von zwei Dutzend angetrunkenen, johlenden Mexikanern nicht in ihrem Jagdtrieb beirren ließen, waren Fledermäuse, die sich ihre Beute selbst aus dem für Insekten unwiderstehlich verlockenden Scheinwerferlicht des Pick-ups schnappten.
Hippolyt drückte ein paarmal auf die Hupe, um sein Kommen anzukündigen und zu vermeiden, dass ihm einer der Arbeiter versehentlich vor den Wagen lief, und freute sich auf den Augenblick, in dem er den Motor abstellen konnte und das Rütteln und Schütteln endlich endete.
2
Arequipa ∙ Peru
»Ideen …«AdrianaFloreszieltemitderFernsteuerungaufdenDiaprojektor und drückte mehrmals erfolglos die Bildwechseltaste. »Ideen treiben den Fortschritt an, aber keinesfalls die Evolution.« Sie trat an das Gerät heran, ohne den Blick von den Hörerrängen zu lenken. »Eine hervorragende Idee wäre es beispielsweise, den Wandmonitor endlich zu reparieren, damit man in diesem Lehrsaal wieder den Computer benutzen kann und nicht mehr auf prähistorische Technik angewiesen ist.« Sie schlug mit der flachen Hand auf das heiße Metallgehäuse. Im Inneren des Projektors klapperte es, dann wechselte er in Sekundenabständen drei Dias nacheinander. Mit einem bewundernswerten Maß an Selbstbeherrschung ließ Adriana das Bildmagazin zurücklaufen, bis das richtige Diagramm an die Wand projiziert wurde, derweil aus dem Publikum amüsiertes Lachen zu hören war.
»AmAnfangstehtdieIdee«,fuhrsieinihremVortragfort,nachdem wieder Ruhe eingekehrt war. »Ein neuer Gedanke, eine bahnbrechende Entdeckung, etwas Einmaliges, nie zuvor Dagewesenes: das Novum.« Sie sah herausfordernd in die Gesichter der Studenten. Skepsis schlug ihr aus vielen davon entgegen, abschätzende, vergleichende, analysierende Blicke der weiblichen Studenten, hier und dort das Desinteresse der männlichen – zumindest an dem, worüber sie referierte. Adriana fühlte, wie Ärger in ihr hochstieg, und stellte sich in den Lichtstrahl des Projektors, damit er den eventuellen Anflug einer Zornesröte in ihrem Gesicht überblendete. Sie war zu jung, um ernst genommen zu werden, zu unverlebt für den Job, zu … weiß der Teufel was. Selbst als dicke, grauhaarige Schabracke mit Augenklappe und Papagei auf der Schulter würde man ihr mehr Respekt entgegenbringen als jetzt. »Doch kaum hat sich ein Novum durchgesetzt, sich unter zahllosen Ansichten und Gesetzen etabliert, beginnt es zu mutieren«, fuhr Adriana äußerlich unbeeindruckt fort. »Andere beginnen auf den Schultern des Riesen zu reiten, übernehmen seine Fähigkeiten, variieren das Novum, gliedern es in Bestehendes ein, modifizieren es schier unendlich. Es entsteht ein Allgemeingut. Die ehemals geniale Idee wird so lange breitgetreten, vermengt und vermischt, bis sie zur Alltäglichkeit geworden ist, jedermann sie begreift und keiner mehr sich über ihre einstige Einmaligkeit wundert. Am Ende ist das, was von ihr übrig bleibt, nur nocheingleichförmigesHintergrundrauschen,dasniemandenmehr aufhorchen lässt – der Nährboden für ein neues Novum.«
Den Blick fest auf die Zuhörer gerichtet, fuhr Adriana in gewissenhafterem Tonfall fort: »Ich weiß, dass viele von Ihnen der Ansicht sind, die Menschheit sei aus einer Idee Gottes hervorgegangen. Die Antwort, ob dies zutrifft, wird die Wissenschaft sicher niemals erbringen können. Aber …« Sie schlenderte entlang der vordersten Zuhörerreihe, wobei sie bewusst die Blicke der Studenten kreuzte. »Aber sie besagt eines: Unser Nährboden, das Hintergrundrauschen der Spezies Mensch, waren die Australopithecinen, und allen voran ihre wohl bekannteste Art, der Australopithecus afarensis.«
»Was ist mit dem Orrorin, der in Nordkenia gefunden wurde?«, drang es aus den obersten Rängen herab.
Adriana suchte den Blickkontakt des Zwischenrufers, doch keiner der Studenten erweckte den Anschein, als habe er die Frage gestellt. »Der sogenannte Millenium Man?«, hakte sie deshalb nach. Weiterhin Schweigen. »Es ist nicht eindeutig erwiesen, dass er aufrecht ging, noch dazu vor über sechs Millionen Jahren, und das im Wald, wo Klettern die sicherste Fortbewegungsmethode war. Auch Menschenaffen bewegen sich heutzutage bisweilen auf zwei Beinen. Das soll jedoch nicht heißen, jener Gott, der uns gemäß christlicher Lehre nach seinem Ebenbild geformt hat, sei ein Affe«, beschwichtigte sie das nun unvermeidlich aufkeimende Gemurmel unter den Studenten mit einem Scherz. »Beileibe nein. Die Evolutionstheorie besagt jedoch: Die Menschheit ist nicht das Resultat einer Idee, sondern das Resultat einer zufälligen, vielleicht sogar umstandsbedingten Mutation. Erst nach ihrem außerordentlich langen Feuerwerk als Novum hatte unsere Spezies Ideen. Ideen, die Fortschritt bedeuteten und die sie – falls sie sich nicht selbst ausrottet – auch in Zukunft weiterbringen wird, womöglich sogar über die Grenzen unserer Welt hinaus. Doch wie wir wissen, hat sich das menschliche Gehirn in den letzten vierzig- bis fünfzigtausend Jahren nicht nennenswert weiterentwickelt. Wir werden älter, sicher, wir werden im Durchschnitt größer und wir werden intelligenter, aber dies sind keine eindeutigen Zeichen für Evolution. Fakt ist: Unsere Entwicklung vollzieht sich seit Zehntausenden von Jahren fast nur auf rein intellektueller Basis – von kleineren Veränderungen am Kiefer oder einer zusätzlichen Armschlagader einmal abgesehen. Eine neue Stufe der Evolution ist jedoch selbst durch die genialsten Ideen nicht zu erreichen, sondern einzig durch die erneute Mutation der dominanten Spezies.«
»Aber haben menschliche Ideen nicht dazu geführt, das Erbgut zu entschlüsseln?«, kam es wieder aus den oberen Reihen. Diesmal sah Adriana den Fragesteller und ging ein paar Schritte rückwärts, um ihn im Auge zu behalten. »Sind wir inzwischen nicht fähig, unsere eigene Mutation zu erschaffen?«
»Zweifellos«, pflichtete Adriana dem jungen Mann bei. »Würden wir es heute tun, würde das Produkt sicherlich eine Weile Bestand haben und am Leben bleiben – aber es hätte garantiert keine Freude daran. Was die Zukunft betrifft, kann die Wissenschaft nur Vermutungen anstellen. Eine davon lautet: Das, was neu ist, ersetzt unmittelbar das, was alt ist. Sollten – sollten! – wir eines Tages also in der Lage sein, basierend auf unserem eigenen Erbgut eine neue, perfekte, evolutionär höher entwickelte Spezies zu erschaffen, ist es naheliegend, dass dieser Homo superior uns über kurz oder lang von diesem Planeten verdrängen wird …«
Etwas gleißend Helles leuchtete jenseits der meterhohen Hörsaalfenster auf und ließ Adriana nach draußen blicken. Am Abendhimmel schwebte eine feine Rauchspur in der Atmosphäre und leuchtete im Schein der Sonne nach. Sie musste sehr weit oben in der Atmosphäre hängen, wenn sie noch angestrahlt wurde, denn die Sonne war bereits vor einer halben Stunde untergegangen. Wahrscheinlich eine Sternschnuppe, überlegte Adriana und trat näher an die Fensterfront heran, nur um zu sehen, wie der Wind den Rauchschweif über Arequipa langsam verwischte. Der Himmel erinnerte sie daran, dass es bereits wieder viel zu spät geworden war, um sich um die privaten Dinge zu kümmern, die sie sich für heute Abend vorgenommen hatte.
Der Reiz des Außergewöhnlichen hatte Adriana während der vergangenen Jahre gänzlich für ihren Beruf leben lassen, und dieser Umstand rächte sich, sobald sie die Universität verließ: Sie hatte zu wenig Freunde. Um Freundschaften zu pflegen, fehlte ihr die Zeit, und hatte sie sie doch einmal, befand Adriana sich in der Regel am falschen Ort. Durch Telefonieren und das Schreiben von E-Mails ließ sich auf Dauer keine tiefere Freundschaft erhalten. Es gab Augenblicke, in denen sie diesen Lebenswandel bereute; so wie heute, an ihrem Geburtstag, von dem kaum jemand wusste und den sie daher wie schon so oft mit einer oder auch zwei Flaschen Wein allein feiern würde. Und es gab jene Augenblicke, in denen sie unermesslich stolz darauf war, Prioritäten gesetzt zu haben und konsequent ihren Weg gegangen zu sein. Mittlerweile hatte sie sich daran gewöhnt, von ihren Kollegen nachgesagt zu bekommen, lieber mit einem Mann mit Wasserkopf liiert zu sein als mit einem gewöhnlichen Nachfahren des Cro-Magnon-Menschen – sofern sein Hydrocephalus ein eindeutiger Beweis evolutionärer Weiterentwicklung wäre.
»Wer haftet für Pfusch in der Evolution?«, fragte eine junge Frau in der vordersten Zuhörerreihe und riss Adriana in die Wirklichkeit zurück. »Darwin oder Gott?«
Adriana atmete tief durch. »Die Schöpfung muss sich für nichts verantworten, was in ihrer Natur liegt«, antwortete sie, wobei sie weiterhin in den Himmel starrte. »Sie handelt aus reinem Selbstzweck. Mutabilität ist kein Fehler, sondern der eigentliche Motor der Evolution, die unzählige Schlupflöcher für sie offenhält. Man muss ihre versteckten Experimente nur finden, denn als Spielwiese dient ihr in den meisten Fällen die Isolation. Dabei ist die Natur keinesfalls eine Perfektionistin, sondern ein biologischer Zufallsgenerator, der Gene, Genome und Chromosomen miteinander vermengt wie ein launischer Alchemist. Danach testet sie, wie die Ergebnisse dieses Gutdünken-Prinzips funktionieren. In der Regel löscht die Umwelt die Zufallsmutationen sehr schnell wieder aus. Ob Pflanze, Tier oder Mensch spielt dabei keine Rolle. Nur selten erweisen sich die Neuschöpfungen als überlebens- und anpassungsfähig genug, um sich ihre Existenzberechtigung zu sichern. Doch selbst dann bleibt ihnen zumeist nur ein Nischendasein, ohne die Aussicht, sich in der Natur durchzusetzen.
Irgendwo auf diesem Planeten ist eine verborgene Mutation dazu erkoren, die Stellung des Homo sapiens einzunehmen. Vielleicht ist sie noch nicht ausgereift und führt ein Schattendasein, doch werden sich an ihr eindeutige genetische Tendenzen erkennen lassen. Jeder von uns ist dazu auserkoren, die evolutionären Sackgassen auszuloten – und irgendwann jene Mutation zu finden, die uns ablösen wird. Die nächste Stufe menschlicher Entwicklung. Den Quantensprung. Denn unsere Aufgabe ist nicht die Suche nach dem Woher kommen wir?, sondern stets die Suche nach der Frage: Wohin werden wir gehen?«
»Das Gehirn des Homo sapiens hat sich seit Millionen von Jahren nicht mehr weiterentwickelt«, betonte die Studentin. »Und das wird es auch nie, egal wie lange Sie suchen.« Einige ihrer Kommilitonen lachten, da sie ihre Bemerkung für einen Scherz hielten.
»Der Homo sapiens existiert erst seit rund 200.000 Jahren«, hielt Adriana ihr vor.
»Seit mehr als sieben Millionen Jahren«, entgegnete die Studentin. »Und dennoch war dem Menschen nie die Zeit gegeben, das Stadium für einen Evolutionssprung zu erreichen – und sich ohne Gottes Zutun weiterzuentwickeln.«
Über Adrianas Nasenwurzel bildete sich eine Unmutsfalte. Sie war es leid, sich mit angehenden Akademikern darüber zu streiten, ob Evolution, Stagnation oder Revolution einen höheren Stellenwert hatten. »Ihr Dogma berücksichtigt nicht den freien Willen des Menschen: Niemand auf Erden wird gezwungen, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen.«
»Alles entstammt dem Feuer und kehrt zurück ins Feuer.« Die Studentin sah sich Beifall heischend um, erntete jedoch nur Stirnrunzeln und verschämtes Grinsen. »Jedes Wesen des Mikro- und Makrokosmos, ob Einzeller oder selbst ernannte Krone der Schöpfung, entstammt dem Chaos und kehrt zurück ins Chaos. Heraklit lehrte einen zyklischen Wechsel von Feuer und identischen Welten, wobei aus dem Urfeuer alles hervorgeht, was am Ende wieder durch das Feuer zerstört wird. Mark Aurel war von einer Wiedergeburt der Seelen überzeugt. Selbst Nietzsche glaubte an eine Wiederkunft des Gleichen und eine zyklische, stets gleich ablaufende Weltperiode, die er aus der Endlichkeit der Weltkraft ableitete. Er begründet dies damit, dass die Welt weder ein Ziel noch ein Vermögen zur ewigen Neuheit habe, was die ewige Wiederkehr aller Dinge, Ereignisse und Zustände erfordere. Für die Evolution ist in diesem Zyklus weder Zeit noch Raum.«
»Nun, dann können wir diesen Studiengang ja getrost auflösen.« Adriana musterte ihre Glaubenskontrahentin herausfordernd. »Und uns – ja, was eigentlich widmen? Gott?«
»Die Natur ist keine willkürliche Abfolge von Zufällen, sondern ein göttliches Lied, das in Endlosschleife läuft. Augustinus von Thagaste vertrat die Lehre, dass die äonische Strafe wie das äonische Leben endlos sei.«
»Sie setzen ›äonisch‹ gleichbedeutend mit ›ewig‹. Doch gebietet Ihr Glauben Ihnen nicht, das äonische Leben vielmehr als zeitlich begrenzten Tod zu interpretieren?«
»Alle menschlichen Entscheidungen sind einem gottbestimmten Kausalgesetz unterworfen, das ungläubigen Menschen wie Ihnen nicht bewusst ist und sich Ihnen auch nie erschließen wird. Sie degradieren Gott zum Diener des Menschen und den Menschen zu einer Laune der Natur, wodurch die Schöpfung über dem Schöpfer steht und Gott dadurch gänzlich obsolet wird.«
»Gut gebrüllt, Löwe. Aber falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Dies ist der Studiengang Biologie, Fachgebiet Anthropologie. Sie geben sich belesen, darum frage ich mich, warum Sie dennoch hier sitzen? Falls Sie gekommen sind, um zu missionieren, sind Sie hier zweifellos am falschen Ort. Falls Ihr Interesse sich primär auf Religionslehre und Geisteswissenschaften beschränkt, würde ich Ihnen nahelegen, die Universität zu wechseln. Vielleicht nimmt das Kloster Santa Catalina Sie als Novizin auf.«
Adriana wandte sich ruckartig um, schaltete den Diaprojektor mit der Fernsteuerung aus und schritt vor zum Pult. »So viel für heute, meine Damen und Herren. Es ist spät geworden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und die rege Teilnahme und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.« Sie stockte und schwieg füreinpaarSekunden,dochjelängersieüberlegte,destowirrerwurden ihre Gedanken. Schließlich beließ sie es bei einem: »Bis nächste Woche.« Dann unhörbar leise, fast so, als flüstere sie mit dem alten Diaprojektor, vor dem sie stand: »Feiern Sie schön …«
3
Falaise de Bandiagara ∙ Mali
Seit Stunden saß der Fremde nun schon bewegungslos am Rand des Plateaus und starrte hinab auf die Ebene. Auch wenn er gelegentlich ein paar Worte sprach, seine Sitzposition auf dem harten Boden veränderte oder von den Resten der aus Huhn und Hirsebrot bereiteten Tô-Mahlzeit aß, blieb sein Blick unentwegt auf den Hof der Nommo gerichtet, einem gewaltigen Dreieck aus kniehohen, zweihundert Schritt langen Steinmauern, in dessen Zentrum sich der Altar des Amma erhob.
Pangalé wusste nicht, was der Fremde dort unten sah oder im Laufe der Nacht noch zu sehen erhoffte. Er selbst konnte außer den schwachen Umrissen der Mauern überhaupt nichts in der Dunkelheit erkennen. Vielleicht war es ja ein Zauber, den der Schwarzgekleidete von hier oben ausübte, ein stilles Kräftemessen mit der Dunkelheit.
Nicht nur Pangalé war der Fremde, der vor zwei Tagen im Dorf aufgetaucht war, unheimlich. Obwohl er ein Angehöriger seines Volkes zu sein schien, war seine Haut so hell wie Sand und sein Haar so weiß wie die Wolken. Selbst der mächtige Hogon hatte es nicht gewagt, ihn beim Sprechen anzusehen, was vermuten ließ, dass er ein heiliger Mann war – oder sein Amt zumindest über dem des Totem-Priesters stand. Außer dem Gerücht, der hellhäutige Habé sei mit einem Flugzeug angekommen, kannte Pangalé nur den Namen, mit dem er sich gegenüber den Dorfältesten vorgestellt hatte: Ambara. Ob es Zufall war, dass er einen Halbmond vor dem Sigui-Fest im Dorf aufgetaucht war, oder Absicht, wusste der Junge nicht. Die Alten munkelten, er beherrsche Nyama, die heilige Sprache der Buschgeister.
Der Hogon hatte entschieden, dem Fremden das Haus der einflussreichen Familie Imadaou zur Verfügung zu stellen. Niemand wagte ihm zu widersprechen, selbst der Sippenälteste nicht. Schweigend hatte Pangalés Familie die nötigsten Habseligkeiten gepackt und zwei kleine, seit Monaten leer stehende Häuser am Dorfrand bezogen.
Ambara selbst hielt sich während des Tages so gut wie nie im Freien auf, und ließ er sich einmal blicken, um den Priester aufzusuchen, war dennoch kaum etwas von ihm zu sehen. Gekleidet in die weiten, dunklen Gewänder der Tuareg-Nomaden, hielt er sein Gesicht von einem schwarzen Turbanschleier verhüllt. Dazu trug er eine Sonnenbrille mit dunklen Gläsern, die sein vermummtes Gesicht noch mehr im Schatten verschwinden ließ. Seine Hände versteckte er selbst für einen Gang zum Haus des Hogon – ein Marsch von gerade einmal zwanzig Schritten –in schwarzen Handschuhen.
Am Abend seiner Ankunft jedoch hatte er die Familienältesten nach Sonnenuntergang auf dem Dorfplatz zusammenrufen lassen, um sich ihnen vorzustellen und zu erklären, sich höchstens für drei Tage im Dorf aufzuhalten. Dann hatte er vor den Augen der Versammelten damit begonnen, seine Kleidung abzulegen …
Nie zuvor hatte Pangalé einen so hellhäutigen Angehörigen seines Volkes erblickt. Und die meisten der Dorfbewohner wohl ebenfalls nicht. Zwar war es keine Panik, die Ambaras leichenblasses Aussehen auslöste, doch für Unruhe, Gerüchte und gemurmelte Gebetesorgteesallenthalben.VielederSippenältestenhattenfluchtartig den Dorfplatz verlassen, derweil der Fremde sich in aller Ruhe wieder ankleidete. Danach verlangte er eine Mahlzeit und zog sich in seine Unterkunft zurück. Nach dem Essen bat er um Tabak, Proviant für die Nacht und um einen Träger. Da er das Haus der Familie Imadaou bewohnte, lag es nahe, dass der Hogon jenen von Imadaous Söhnen für die undankbare Aufgabe auswählte, der kurz vor dem Yago-Ritual stand: Pangalé.
Nun hockte er mit dem Schwarzgekleideten bereits die zweite Nacht in Folge hier oben auf dem Plateau, schweigend zumeist, bis der Morgen graute.
Pangalé beobachtete verstohlen den Fremden, wie er so da saß, in seine Decken gehüllt und Pfeife rauchend. Er vermied es, Ambara allzu offensichtlich anzustarren, obwohl dieser ihm seit Stunden den Rücken zuwandte. Der Fremde schien es zu fühlen, wenn Blicke auf ihm ruhten. Die meiste Zeit über blickte Pangalé daher hinauf ins Firmament, wo sich weitaus Interessanteres abspielte: Es regnete Sternschnuppen!
Während der vorangegangenen Nacht hatte er noch Spaß daran gefunden, für jede einzelne Himmelsträne eine Kerbe in seinen Stock zu schnitzen. Irgendwann fielen die Sternschnuppen so rasch, dass Pangalé mit dem Schnitzen nicht mehr nachkam, und am Ende war das Holz mit so vielen Einschnitten übersät, dass der Junge keinen Platz mehr für weitere Kerben fand. Heute hingegen war er schlecht gelaunt und langweilte sich zunehmend, da er kaum Schlaf gefunden hatte.
»Darf ich Euch eine Frage stellen?«, wagte Pangalé es, die Konzentration des Fremden zu stören.
»Frag.«
»Woher kommt Ihr?«
Zuerst schien es, als ignorierte Ambara ihn, dann antwortete er: »Von überallher.«
Der Junge rümpfte die Nase. »Ich meinte: Woher stammt Ihr? Wo wurdet Ihr geboren?«
»An einem Ort, der seit langer Zeit nicht mehr existiert.«
»Seid Ihr gekommen, um die Tränen des Himmels zu zählen?«
»Nein.« Ambara lachte leise, als wolle er den Jungen deutlich machen,einesehrdummeFragegestelltzuhaben.»Ichbingekommen, um zu warten.« Und besänftigend fügte er hinzu: »Die Weißen haben einen Namen für die Tränen. Sie nennen sie Cassiopeiden.«
Pangalé wunderte sich, wie leicht dem Fremden der seltsame Name über die Lippen ging. Offenbar hatte er lange genug unter den Weißen gelebt, um ihre Sprache zu erlernen. In Anbetracht seiner bleichen Haut womöglich zu lange.
»Woher stammen sie?«
»Nirgendwoher«, antwortete Ambara. »Wir sind es, die ihren Strom kreuzen.«
»Das verstehe ich nicht.«
Zum ersten Mal seit Stunden löste der Fremde seinen Blick von der Dunkelheit und schaute seinen jungen Begleiter an. Dabei schien ein spöttisches Lächeln auf seinen Lippen zu liegen, das Pangalé zutiefst verunsicherte. Mit einer ruckartigen Kopfbewegung sah Ambara hinauf zum Firmament, einer auffällig hell leuchtenden Sternschnuppe nach, dann wandte er sich wieder der Ebene zu. »Das brauchst du auch nicht«, entschied er schließlich.
Der Junge schlang die Decken, in die er seinen Körper gehüllt hatte, enger um sich und sah verärgert in eine andere Richtung. Vielleicht hatte der Fremde lange genug bei den Weißen gelebt, um sich ihr Wissen anzueignen, aber das bedeutete noch lange nicht, dass er Pangalé damit demütigen musste.
»Einst gab es einen Stern namens Sigi Tolo«, begann Ambara zu Pangalés Überraschung zu erzählen. »Er strahlte so hell, wie nur ein Himmelsgott zu strahlen vermochte. Lange hatte er einen beherrschenden Platz am Himmel und zeigte weder Hochmut noch Niedertracht. Alle anderen Sterne bewunderten seine Schönheit und alle Menschen seine Erhabenheit. Doch eines Tages fühlte Sigi Tolo sich nicht wohl. Ihm war, als schwände langsam sein Leben. Nacht für Nacht entfernte er sich weiter von seinem hohen Himmelssitz – immer näher kam er dem Horizont und damit dem sicheren Tod. Schließlich versank er hinter den Bergkämmen, jener schrecklichen Himmelsgrenze, die er so gefürchtet hatte. Es kam die Nacht, da es ihn nicht mehr gab. Tief unter der Welt ruhte er fortan, nur Erinnerungen waren an ihn geblieben.
Sigi Tolo hatte im Himmel und auf Erden viele Bewunderer besessen, die seine Schönheit gepriesen hatten und nun über sein Verschwinden trauerten. Hier unten im Erdental hausten Sterbliche, armanGlanzundAnmut.EhrfurchtsvollhattensiezuSigiToloemporgeblickt, als dieser noch ungetrübt unter seinesgleichen strahlte – und einige Menschen, so heißt es, hatten einst gar seine Geburt erlebt.Siehattengesehen,wieerseineerstenStrahlenüberdasLand streichen ließ, als wollte er mit seiner Schönheit die Erde entflammen. Allerdings währte sein Glanz nicht lange, denn gleich nach ihm erhob sich Morgen für Morgen die Sonne selbst in all ihrer Pracht. Ohne sich um Sigi Tolos Schönheit zu kümmern, wusch sie mit ihrem Glanz den Himmel weiß. Die Sterne lösten sich auf wie Nebel, so strahlend war die Sonne, so prächtig in ihrem Erscheinen. Doch Abend für Abend kehrte sie zu ihrem Ruhelager zurück, sodass des Nachts wieder Sigi Tolo die Sterblichen betören konnte; höher und höher steigend, der Sonne immer weiter voraus.
Doch wie verwaist sah der Himmel aus, als es ihn nicht mehr gab. Tag und Nacht folgten einander und die Schwingen der Zeit linderten die Schmerzen vieler; eine Zeit des Schlafens und des Vergessens. Der schöne Himmelsgott war den Blicken der Irdischen entzogen. Es vergingen viele Jahre, in denen das Volk trauerte, da ging ein Hirte vor Sonnenaufgang hinaus zu seinem Vieh. Die Morgendämmerung war hereingebrochen und es würde nicht mehr lange dauern, bis die Sonne sich erhob. Der Hirte blickte zum östlichen Ende der Welt – und sah dort den Horizont feurig aufglühen. So wurde er Zeuge der strahlenden Wiedergeburt Sigi Tolos. Kein anderer Stern war so unverkennbar, kein anderer Himmelsgott strahlte in solchem Glanz. Ergriffen blieb der Hirte stehen, die Augen wie versengt vom Feuer des neugeborenen Sterns. Als die Sonne emporstieg, um seine so schmerzlich kurze Erscheinung auszulöschen, wandte der Hirte sich um und rannte zurück in sein Dorf. ›Aufwachen!‹, rief er. ›Wacht auf! Sigi Tolo ist zurückgekehrt! Der Himmelsgott ist wiedergeboren, zurück aus dem Totenreich, unsterblich!‹
Und all seine Verehrer liefen schlaftrunken aus ihren Häusern und kamen aufgeregt zusammen, voll neuer Hoffnung. Sie hörten die Kunde, schauten am nächsten Morgen das Wunder selbst und begingen von Glück erfüllt ein großes Fest. Zahlreich sind bis heute die Tempel, zahlreich die Priester, die sich zur Zeit der Wiederkehr überall im Lande versammeln, um Zeugen der Wiedergeburt Sigi Tolos zu sein, des Himmelsgottes, der seinem irdischen Volk EintrachtundSegenbringt.ZurErinnerunganseineZeitinderUnterwelt feiern wir bis heute das Sigui-Fest für unsere eigenen Toten.«
Während Pangalé gegen den Schlaf kämpfte und über die Geschichte des Fremden nachdachte, drang von hoch oben ein eigenartiges, nie gehörtes Zischen an seine Ohren. Ein greller Lichtblitz erhellte für einen Lidschlag die Nacht, gefolgt von einem lauten Donnerknall, der Pangalé vor Schreck die Luft anhalten ließ. Instinktiv kauerte er sich zusammen, doch als er emporsah, war der Sternenhimmel so klar und friedlich wie zuvor. Lediglich ein feiner Rauchstreifen hing weit oben am Firmament.
Sekundenlang blieb alles still, dann stürzte etwas am Fuße des Plateaus zu Boden. Der Fremde, der nach dem Lichtblitz aufmerksam gelauscht hatte, sprang auf und trat an den Rand der Klippen. Neugierig kroch auch Pangalé vor zum Abgrund und meinte eine Staubwolke zu erkennen, die über den Hof der Nommo zog. In der Tiefe war ein leises Prasseln zu hören wie von unzähligen kleinen Steinen, die in der Umgebung der Mauern niederregneten.
»Meje!«, rief Ambara. »Sete kor meje!«
Pangalé hatte diese Worte irgendwann schon einmal gehört. Er verstand ihre Bedeutung nicht, wusste aber, dass es alte Worte waren – sehr alte. Der Fremde redete in der Sprache der Ahnen!
Hastig entzündete Ambara seine Lampe. »Komm!«, forderte er Pangalé auf, dann eilte er in entgegengesetzter Richtung davon, ohne ein weiteres Wort zu verlieren oder sich um ihre Decken und den Proviant zu kümmern. Ebenso ratlos wie verärgert über Ambaras Verhalten und dessen überstürztes Aufbrechen, entzündete Pangalé seine eigene Lampe. Hastig packte er alles zusammen und lief dem Fremden hinterher.
So regungslos Ambara die Stunden zuvor an der Klippe ausgeharrt hatte, so flink und behände eilte er nun durch die Dunkelheit, als hätte er die Augen eines Wüstenfuchses. Als Pangalé atemlos die Treppe erreichte, die durch die Schlucht hinab auf die Ebene führte, war der Fremde bereits auf halber Höhe zum Tunnel. Dabei bewegte er sich mit so traumwandlerischer Sicherheit, als sei er die Stufen bereits Tausende und Abertausende Male hinauf und hinab gehetzt, so oft, dass ein einziges Menschenleben dazu gar nicht ausreichte.
»Wartet!«, rief Pangalé ihm nach, doch Ambara hatte bereits den Tunnel erreicht. Der Junge sah den wild hin und her zuckenden Schein seiner Lampe durch die Finsternis geistern, dann war auch dieser verschwunden. Leise fluchend schulterte Pangalé die Decken unddenProviantbeutel,hieltdieLampeweitvorsichundfolgtedem Fremden schließlich so zügig, wie es ihm seine Last erlaubte.
Die Schlucht, durch die die Treppe führte, wirkte, als hätte vor Urzeiten das Schwert eines Riesen das Plateau gespalten. An ihrer engsten Stelle war der Durchbruch so schmal, dass Pangalé sich mit dem Deckenbündel seitlich hindurchzwängen musste, ständig darauf bedacht, auf den unzähligen losen Felsbrocken, aus denen die Stufen aufgeschichtet worden waren, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Um mehr als zweihundert Meter überragte das Plateau die Ebene und fast ebenso tief wurde der Bergeinschnitt, durch den Pangalé hinabeilte. Am Tage transportierten die Frauen Kalebassen, Wassereimer und schwere Körbe mit Wäsche und Lebensmitteln auf dem Kopf die Treppe hinauf und hinab. Unzählige Füße hatten die Stufen im Laufe der Jahrhunderte glatt geschliffen. Da und dort sickerte ein Rinnsal aus dem Fels und suchte sich ebenfalls seinen Wegüber die Treppe hinab zur Ebene.Als Pangalé zum zweitenMal ausrutschte und nur das Deckenbündel verhinderte, dass er mit voller Wucht auf den Stufen aufschlug, zog er seine Sandalen aus und rannte den Rest der Strecke barfuß. Nach drei Vierteln des Weges führte die Treppe durch einen Tunnel, den seine Vorfahren in einen riesigen Felsbrocken geschlagen hatten. Der Durchgang war dreißig Schritte lang und so niedrig, dass Pangalé nur gebückt laufen konnte. Unmittelbar hinter dem Tunnel endete die Treppe an einer Klippe, von der aus er über zwei Baumleitern senkrecht in die Tiefe klettern musste. Von dort aus führte ein sanft abfallender, von Buschwerk bestandener Abhang bis hinunter auf die Ebene. Weit entfernt entdeckte Pangalé den tanzenden Lichtschein von Ambaras Lampe. Der Fremde hatte die Ebene längst erreicht und eilte geradewegs auf den Hof der Nommo zu, ohne im Schritt innezuhalten. Ambara musste fliegen können, um inzwischen einen so großen Vorsprung zu haben, fast so, als sei er selbst ein Buschgeist, der nur für wenige Tage menschliche Gestalt angenommen hatte.
Unten im Dorf glommen noch Holzscheite in den Feuerstellen, vereinzelt drangen entfernte Männerstimmen an Pangalés Ohren. Auch die Familienältesten beobachteten den Sternschnuppenregen, wenngleich sie es lieber unter den massiven Dächern ihrer Togunas, den Ratsplätzen des Dorfes, taten. Niemand von ihnen schien sich am Schein der beiden durch die Nacht wandernden Handlampen zu stören. Wahrscheinlich hatte der Hogon Späher ausgeschickt, die Pangalé und den Fremden beobachteten und dem Totem-Priester von deren seltsamem Treiben berichteten.
DerJungesahanderSteilwandhinabaufdieLeitern.Erzögerte, einen Fuß auf die oberste Stufe zu setzen. Die an der Felswand verkeilten Treppen bestanden aus Baumstämmen, in die tiefe Kerben geschlagen waren und so für einen geübten Kletterer einen relativ sicheren Tritt boten. Sie bei Tageslicht emporzusteigen, war relativ einfach, doch sie bei Dunkelheit freihändig hinabzuklettern, mehr als nur eine Mutprobe. Rechter Hand führte ein schmaler Felssims etwa einhundert Schritte entlang der Klippe zu einem weiteren Taleinschnitt, von dem aus sich ein Pfad hinab ins Dorf schlängelte. Es war der sichere Weg hinunter auf die Ebene; der Weg, den die Frauen gingen.
Nach kurzem Abwägen nahm Pangalé das Deckenbündel von den Schultern, wickelte den Beutel mit den Lebensmitteln darin ein, zurrte alles zusammen und warf den Packen in die Tiefe. Nach zwei Herzschlägen hörte er das Bündel weit unten in ein Gebüsch fallen. Steine und Geröll klackerten, als es noch ein Stück weit den Abhang hinabrollte, dann herrschte Stille. Bedacht einen Fuß unter den anderen setzend, kletterte Pangalé schließlich die Leitern hinab, las das Deckenbündel wieder auf und folgte eilig dem Fremden.
4
Chachapoyas ∙ Peru ∙ [AD 1455]
Vor dem Eingang der Mondgrotte wartete ein Zeremonienwächter. AuchertrugeineMaske,aberChebálvermochteihnanseinerStimme zu erkennen, als er von ihm aufgefordert wurde, seinen Speer zu dessen Füßen niederzulegen.
»Ist das Tor verschlossen?«, fragte er, während er den Blick auf den Boden gerichtet hielt.
»Das Tor ist offen«, sprach der Wächter die erlösenden Worte.
Chebál war bemüht,sich die Freude und denStolz nicht anmerken zu lassen, als sein Gegenüber den Weg freigab. Mit zitternden Knien trug er seine Trophäe durch das Portal.
Zum ersten Mal in seinem Leben stand er im Inneren der Grotte. Als einer der heiligsten Orte durfte sie außerhalb der Yaon-Feste nur von den Hohepriestern betreten werden – und alle sechs Jahre für die Dauer einer einzigen Nacht und eines kurzen Morgens auch von fünfzehn Wettstreitern und ihren Taje.
Wenige Schritte hinter dem Eingang öffnete sich ein schmaler, fast haushoher und gänzlich schmuckloser Felsendom. Seine einzige Besonderheit bestand aus acht in den Fels gehauenen Nischen, vier zu jeder Seite der Passage, die auf den Trophäengang zuführte. In ihnen saßen die mit übergroßen, bemalten Tonköpfen maskierten Hohepriester. Sie schwiegen, doch Chebál fühlte, wie ihre Blicke an ihm klebten. Es wusste, dass die wenigsten von ihnen glücklich darüber waren, ihn mit einer Pirarucu-Trophäe an sich vorüberschreiten zu sehen. Dass er es dennoch tat, ließ ihn innerlich triumphieren, aber es war riskant, seine Gefühle allzu offen zu zeigen. Der Wettkampf war mit dem Übergeben der Trophäe längst nicht entschieden. Ganz im Gegenteil …
Eine Reihe von Feuerschalen erhellten den hinteren Teil der Grotte. Von der Priesterhalle führte ein schmaler, etwa dreißig Zuna langer Gang in das eigentliche Herz der Mondgrotte. Noch bevor Chebál ihn durchschritten hatte, vermochte er vom anderen Ende her das leise Klatschen der auf dem Wasser schaukelnden Bootsrümpfe zu hören.
Die relativ niedrige, aber weitläufige Halle, in die Chebál seinen Pirarucu-Kopf trug, hatte die Form eines Dreiecks. Eine seiner gut dreißig Schritte messenden Seiten wurde von den Taje-Stühlen eingenommen, eine von den Opfertischen. In der dritten Wand öffneten sich die Ykoiba-Buchten.
Elf weitere Pirarucu-Trophäen ruhten auf den an der Wand aufgereihten Opfertischen. Nach Chebál würden also noch drei weitere Wettkämpfer eintreffen und die Gruppe der Finalisten vervollständigen.
Trockenen Fußes konnten die Boote nur über den Weg erreicht werden, den Chebál beschritten hatte. Die Mondgrotte hatte einen einzigen Landeingang und fünfzehn fast bis zur Decke geflutete Ausgänge. An Bord eines Bootes erreichte man Letztere jedoch nur, indem man unter die Sitzbank schlüpfte, sich flach auf den Rücken legte – und wartete. Alles, was man von den Wettstreitern daher erkennen konnte, waren ihre Füße. Aus einem der niedrigen Kanäle drang leises Schnarchen und ließ Chebál schmunzeln. Vor jeder der Buchten saß – verborgen unter einem bienenkorbförmigen Geflecht aus Gras – der oder die jedem Anwärter zugeteilte Taje und achtete selbst hier darauf, dass die Gebote der Priester nicht gebrochen wurden. Es war untersagt, im Inneren der Grotte zu sprechen oder auf sonstige Weise miteinander zu kommunizieren. Niemand außerhalb der Grotte wusste, wer die fünfzehn Endkämpfer waren, nicht einmal sie selbst untereinander – bis sie in ihren Kanus die Stromschnellen herabgeschossen kamen.
Im herrschenden Zwielicht möglichst geräuschlos in ein Ykoiba zu klettern, ohne dabei mit Knien, Schultern oder gar dem Gesicht die Gewölbedecke zu berühren, war eine Kunst für sich. Nach etlichen Verrenkungen lag Chebál schließlich in dem schlanken, gut zwei Zuna langen Kanu und bemühte sich, seinen Herzschlag unter Kontrolle zu bringen. Ein Ykoiba bestand aus einem sehr schmalen, flachauf dem Wasser liegenden Rumpf.Es war aus demselben