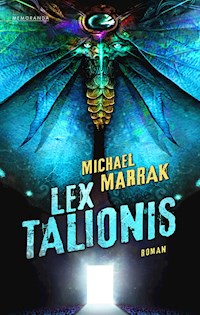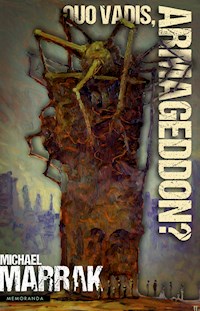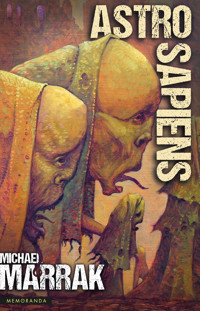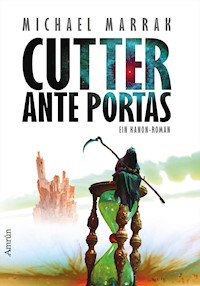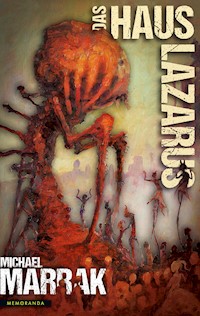
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Memoranda
- Sprache: Deutsch
In den acht Geschichten dieses zweiten Bandes der Werkschau mischt Michael Marrak erneut alle phantastischen Genres und schafft daraus seine eigenen skurrilen, wunderbar farbigen und zuweilen bedrückenden Welten, die die Atmosphäre der Werke von Samuel Beckett oder Franz Kafka ins 21. Jahrhundert transportieren. Michael Marrak schrieb bereits New Weird, bevor dieses heute äußerst beliebte Genre erfunden wurde. Seine Werke sollte man in einem Atemzug mit denen von Jeff VanderMeer und China Miéville nennen. Der in diesem Band enthaltene Kurzroman "Insomnia" sowie die titelgebende Novelle "Das Haus Lazarus" liegen in ihrer hier präsentierten und erweiterten Form als deutsche Erstveröffentlichungen vor. Die eröffnende und erstmals seit 1993 wiederveröffentlichte Vignette "Halbes Männlein und Tod" bildet die Ur-Version und Grundidee des 2017 erschienenen, mit dem SERAPH und dem Kurd Laßwitz Preis ausgezeichneten Romans "Der Kanon mechanischer Seelen".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Michael Marrak: Das Haus Lazarus
Die besten Erzählungen von Michael Marrak • Band 2
© 2020 Michael Marrak (Text)
© 2020 Michael Hutter (Titelbild)
© dieser Ausgabe 2020 by
Memoranda Verlag Hardy Kettlitz
Alle Rechte vorbehalten
Korrektur: Christian Winkelmann
Gestaltung: s.BENeš • www.benswerk.com
Satz: Hardy Kettlitz
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12 · 12053 Berlin
www.memoranda.eu
ISBN: 978-3-948616-44-1 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-948616-45-8 (E-Book)
Inhalt
Impressum
HALBES MÄNNLEIN UND TOD
DIE PARABEL VOM ZWIELICHT
EINE MORITAT AUS WOLKEN UND DUNKELHEIT
ENDEMION
DAS HAUS LAZARUS
TAGEBUCH EINES FRONTALZUSAMMENSTOSSES
RELICON
INSOMNIA
Nachbemerkungen und Quellen
Bücher bei MEMORANDA
HALBES MÄNNLEIN UND TOD
Eine Vignette
Es war an einem mit goldenen Wolken überhangenen Herbstabend, als Halbes Männlein unter den Wurzeln des Ahorns hervorkroch und seinen Arm und sein Bein streckte. Der Wald war wieder etwas lichter geworden, und bis zum nächsten Baum, einer Buche mit elf riesigen, rotbraunen Blättern, in deren Schatten sich Eintagsfliegen tummelten, waren es immerhin vierzig Schritte.
Tod lehnte an der Buche und kaute genüsslich an einem getrockneten Storchenbein.
»Hallo, Fänger!«, begrüßte ihn Halbes Männlein und hüpfte zu ihm hinüber.
»Grüß dich, Beseelter!«, antwortete Tod. »Wie geht es uns dieses Jahrzehnt, mein Freund? Wusstest du, dass die Finken und die Störche ihren Soll bereits geleistet haben?«
Halbes Männlein kicherte verschlafen. »Oh, wenn du es sagst, dann wird’s wohl so sein.«
»Ich warte schon seit Wochen, dass du endlich aus deinem Bau gekrabbelt kommst.«
»Ich hatte geträumt, mit einer alten Lokomotive durch die Sterne zu schweben«, entschuldigte sich Halbes Männlein. »Doch sie ging kaputt, und ich musste allein zurückfliegen. Hätte das nicht so lange gedauert, wäre ich schon ein paar Jahre früher aufgestanden.«
Tod grinste amüsiert. »Jaja, die Menschen-Maschinen. Hinter der Mauer soll’s noch welche geben, doch was kümmert’s mich? Ich bin nur der Tod in dieser Region.« Er griff in seinen Mantel und zog einen kleinen Kopf heraus. »Den habe ich vor einigen Jahren in einer ihrer alten Städte gefunden. Ich dachte, er gefällt dir vielleicht.«
»Ein Strohhaar!« Halbes Männlein riss den ängstlich dreinblickenden Kopf aus Tods Hand. »Ein kleiner Strohhaar!« Erfreut hob es das Geschenk in die Luft. Ein leises Wimmern drang aus dem Mund des Kopfes.
»Er gefällt dir!«, stellte Tod zufrieden fest. Erneut griff er in seinen Mantel, holte einen Raben hervor und trank ihn in einem Zug leer. Seine Federn steckte er sich mit einer andächtigen Bewegung hinter seine Kapuze. »Ich bin der Geist einer ausgestorbenen Welt«, flüsterte er Halbem Männlein ins Ohr und tanzte einen Indianertanz um die Buche.
»Ist sie wirklich ausgestorben?«
Tod hielt inne. »Wenn ich’s dir sage.« Er putzte sich mit einem Knochenfinger seine leeren Augenhöhlen und sah auf Halbes Männlein herab. »Glaubst du mir etwa nicht, Beseelter?«
»Wir sind doch noch da«, erwiderte Halbes Männlein.
Tod zog den Kopf ein und stemmte seine Hände in die Hüften. »Na und?« Er machte auf der Ferse kehrt und schritt davon.
»Ich werde den Strohhaar neben meinen Ichthyodonten hängen«, überlegte Halbes Männlein laut.
Es kratzte sich mit seiner Hand hinter dem Ohr und sah Tod nach, der auf eine Birke geklettert war und Finkenschnäbel in ihrem Gezweig versteckte. Dann warf er den kleinen Kopf übermütig in die Luft und rief: »Tod! Tod, so hör’ doch!«
»Aber ja, ich höre dich!«, riefen die Finkenschnäbel an dessen Stelle.
Tod setzte sich auf einen Ast und sah zu Halbem Männlein herab. »Was gibt es denn, mein Freund?«
»Bring mir noch ein paar Köpfe, und ich baue mir ein Mobile, das mir Geschichten erzählen kann, während ich träume!«
»Das wird nicht leicht, sage ich dir.«
»Vielleicht einen roten oder einen braunen. Wenn auch nur irgendeinen.«
Tod überlegte. »Ich müsste über die Mauer«, murmelte er. »Aber ich denke, ich werde irgendwo noch einen finden. Vielleicht einen alten, der mehr erzählen kann.«
»Mehr Geschichten über das Land!«, freute sich Halbes Männlein und lief mit dem kleinen Kopf zurück unter die Wurzeln seines Baumes.
DIE PARABEL VOM ZWIELICHT
Stets wandeln wir am Abgrund dicht,
wo Tief und Dunkel schrecken,
aus dem ein Tod und letzt’ Gericht
die Drachenhälse recken!
Carl Spitzweg
Tabula sinistra: Nathan
»Ich kenne diesen Blick.« Van de Dageraads Pupillen huschten hin und her, während er mir abwechselnd ins linke und ins rechte Auge starrte. »Er ist mir vertraut, denn ich habe ihn bereits Tausende Male gesehen.« Er schob die geöffnete Holzschatulle mit beiden Händen ein paar Zentimeter näher zu mir heran. »Dieses sehnliche Verlangen, exklusive Wahrheit zu erfahren«, sagte er dabei. »Die einmalige Chance, auf die Schultern eines Riesen klettern zu dürfen, um weiter zu blicken als alle anderen … Ja, ich kenne den Ausdruck in Ihren Augen!«
»Hoffen Sie etwa, ich wäre dem nicht gewachsen?«, fragte ich.
»Nun, van Aken hat für die Wahrheit einen nicht gerade geringen Preis gezahlt. Denken Sie nicht, der Ihre sei annehmlicher, nur weil unsere Welt ein wenig moderner und aufgeklärter geworden ist. Viele Geheimnisse verleiben sich ihre Erschauer früher oder später ein …«
Ich musterte mein Gegenüber, uneins darüber, ob er das Gesagte ernst meinte oder nur flunkerte, um den Profit zu erhöhen.
Es war eine Odyssee gewesen, das in den Altstadtgassen von Herzogenbusch versteckte Antiquariat zu finden. Mein Informant hatte mir zwar seinen Namen verraten, aber weder eine Hausnummer noch die Straße, in der ich es finden würde. Es gab keine Schaufenster mit plakativen Exponaten, welche die Aufmerksamkeit geneigter Besucher erregten. Über dem Eingang wies lediglich eine kleine, im Jugendstil gehaltene Bronzetafel auf das im Haus verborgene Geschäft hin, kaum größer als das Hinweisschild einer Arztpraxis:
D A G E R A A D
Antiquariat & Kunsthandel
Inhaber: Nathan van de Dageraad
Hinter der Eingangstür führte eine abgetretene Holztreppe in die im ersten Stockwerk gelegenen Räumlichkeiten. Kaum hatte ich sie betreten, war es, als wäre ich in ein Taschenuniversum eingedrungen. Es roch nach Firnis, Terpentin, Druckerschwärze und etwas Undefinierbarem, das ich nur im Vorübergehen wahrnahm. Für ein, zwei Schritte drang es mir unangenehm in die Nase, dann erreichte ich den bühnenartig erhöhten hinteren Ladenbereich, wo die Luft erfüllt war von einem Odeur aus altem Harz, Leim, Wachs, Pfeifentabak und modriger Vanille. Was mich umgab, waren keine Plagiate, billig reproduzierter Tand oder dekorativer Nippes, sondern jahrhundertealte Originale. Beeindruckt schritt ich entlang üppig gefüllter Sammelfächer mit Zeichnungen, Kupferstichen und Radierungen historischer Ortsansichten, Landkarten und Stadtpläne, über denen die schönsten in antike Rahmen gefasst Kante an Kante an den Wänden hingen.
»Cornelis Pronk«, erklang aus dem Hintergrund eine männliche, leicht nasale Stimme, kaum dass ich vor der Zeichnung eines historischen Stadtkerns stehen geblieben war. »Signiert 1734. Ein Original. Sind Sie interessiert?«
Ich wandte mich um. Am Ende einer Schlucht aus Glasvitrinen und Holzgestellen, die mit allen erdenklichen Arten grafischer und plastischer Miniaturen gefüllt waren, stand ein Verkaufstresen. Dahinter hockte fast unsichtbar eine greise, in einen abgetragenen Hausmantel gekleidete Gestalt, die einer Grotesque noir entsprungen zu sein schien. Das verbliebene schlohweiße Haar streng nach hinten gekämmt, ragte ihr die Nase aus dem Gesicht wie ein Burgerker. Als wäre die anatomische Kapriole nicht bereits Strafe genug, wurde sie von einer fliehenden Stirn und einem fliehenden Kinn zusätzlich auf denkbar undankbare Weise betont. Mein Gegenüber wirkte auf mich wie eine Mischung aus Cyrano de Bergerac und einem ergrauten Schopfpinguin.
»Herr van de Dageraad?«, fragte ich.
In die Züge des Händlers schlich sich ein leiser Anflug von Interesse. »Seit Anbeginn der Zeit«, bestätigte er. »Suchen Sie etwas Bestimmtes?«
»Kein Bild«, antwortete ich und trat näher. »Eine Schrift.«
»Darüber bin ich nicht im Geringsten enttäuscht – obschon ich die Malerei für die aussagekräftigere Inkarnation des Göttlichen halte. Bitte!« Der Antiquar wies auf einen der beiden Chippendale-Stühle, die vor seinem Tresen standen.
Nachdem ich mich gesetzt hatte, wirkte der Kunsthändler noch immer fast einen halben Kopf kleiner als ich – oder sein Stuhl war einfach nur lächerlich niedrig.
Ich zog einen zusammengefalteten Notizzettel aus meiner Manteltasche und schob ihn über den Tisch. »Ein Freund von Ihnen meinte, Sie könnten mir dazu etwas zeigen …«
Van de Dageraad sog seine runzlige Unterlippe in den Mund und betrachtete den Zettel, als hätte ich ihm eine geröstete Tarantel auf den Tresen gelegt. Dann ergriff er das Papier mit spitzen Fingern, faltete es auseinander und las, was darauf geschrieben stand. Seine Unterlippe tauchte wieder aus seinem Mund auf, der nun gespitzt war, als wollte er den Zettel küssen. Er roch am Papier, wedelte damit an seinem rechten Ohr und stieß schließlich ein tiefes Seufzen aus.
»Melchior«, brummte er. »Der alte Salbader. Ich sollte ihm die Zunge kürzen …«
»Bitte?«
»War nicht ernst gemeint.« Van de Dageraad roch erneut an dem Zettel wie an einem Parfüm-Duftstreifen. »Malt der grämelnde Kauz noch?«
»Das weiß ich nicht.«
»Jammerschade.« Mein Gegenüber wies in eine entfernte Ecke des Geschäfts, in der kaum Bilder an der Wand hingen. »Ich vermisse seine Visionen …«
Für eine geraume Weile saß er selbstversunken auf seinem Stuhl, dann steckte er den Zettel wie selbstverständlich in eine Tasche seines Rocks. Mich argwöhnisch im Auge behaltend, zückte er einen Schlüsselbund und öffnete damit eine Seitenschublade seines Schreibtisches. Sekundenlang betrachtete er den Inhalt, griff schließlich hinein und hob einen vom Zahn der Zeit in Mitleidenschaft gezogenen Folianten aus dem Fach, den er vor mir auf den Tresen legte. Als er den Buchdeckel aufschlug, wurde ersichtlich, dass es sich nur um eine Attrappe handelte, in der er eine flache Holzschatulle mit eingefasstem Glasdeckel aufbewahrte. In ihr lag ein dünner Foliant, gut eine halbe Elle hoch und eine viertel Elle breit.
Van de Dageraad reichte mir ein in Plastikfolie verpacktes Paar Einweg-Stoffhandschuhe. Dann zog er sich seine eigenen über, öffnete die Schatulle und entnahm ihr das Buch. Es hatte einen dunkelbraunen Ledereinband, auf den ein etwa handtellergroßer Ring aus goldenen Lettern geprägt war. Der Umfang seiner Seiten war überschaubar und schien aus einer ehemals losen Sammlung einzelner Dokumente und Schriftstücke zu bestehen. Ich schätzte ihre Anzahl auf kaum mehr als dreißig Blätter.
»Dieses Epistolarium wurde Anfang des 17. Jahrhunderts gebunden«, erklärte er. »Aber sein bescheidener Innenteil besteht aus handgeschriebenen Originalseiten, datiert auf das Jahr 1503.«
»AYGLAOE …« Ich strich mit den Fingerspitzen über die Goldprägung, wobei ich den vermeintlichen Titel ein paarmal leise wiederholte. »Was bedeutet das?«
»Es ist eine typografische Spielerei jener Person, die die Schriftstücke als Büchlein binden ließ. Man muss es lesen wie einen Siebenstern.« Der Antiquar tippte in einem bestimmten Muster auf die einzelnen Buchstaben. »A-L-E-G-O-Y-A.«
Ich verzog ratlos die Mundwinkel. »Ein altes Lehnwort für Allegorie?«
»Wohl eher ein enigmatischer Hinweis des Buchbinders auf den Verfasser.«
Ich beugte mich ein Stück näher. »Es heißt, Bosch habe keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen«, sagte ich.
»Keine Sorge, Herr Simmonis. Ich bin überzeugt, dabei bleibt es auch.«
Mein Blick traf den meines Gegenübers. »Ich kann mich nicht erinnern, Ihnen meinen Namen genannt zu haben.«
»In meinem Gewerbe ist es von Vorteil, über seine spezielle Kundschaft informiert zu sein.« Van de Dageraad lächelte.
»Woher?«
»Berufsgeheimnis.« Der Antiquar wippte vielsagend mit den Augenbrauen. »Ach kommen Sie, es ist doch nur ein Name«, sagte er, als mein Blick fordernd blieb. »Der meine prangt seit Jahrhunderten für jeden lesbar über dem Geschäftsportal.« Bevor ich zu einem Protest ansetzen konnte, lenkte er meine Aufmerksamkeit geschickt zurück auf den Tresen, indem er das Buch in der Mitte aufschlug.
Ich betrachtete die filigrane, altertümlich geschwungene und in meinen Augen sehr weibliche Handschrift. Mühsam entzifferte ich einzelne Wörter, ohne ihren Sinn und ihre Bedeutung zu verstehen. Minutenlang saß ich über das Buch gebeugt da, sah schließlich auf und fragte mein geduldig wartendes Gegenüber: »Briefe?«
»Wie ich bereits sagte: Es handelt sich um ein Epistolarium. Ursprünglich muss es mindestens dreizehn Briefe beinhaltet haben. Leider wurden die letzten Seiten herausgerissen.«
»Absichtlich?«
Van de Dageraad hob die Schultern. »Eine chemische Untersuchung der Risskanten hat ergeben, dass dies bereits vor mehr als zweihundert Jahren geschehen sein muss. Über das Motiv lässt sich insofern allenfalls spekulieren.«
»Was ist das für eine Sprache?«
»Sehr altes Niederländisch«, erklärte der Antiquar. »Sogenanntes duutsc. Genauer gesagt handelt es sich um eine der zahlreichen Varietäten des Mittelniederländischen, oost-braobans oder Ost-Brabantisch genannt.«
»Und Sie können das lesen?«
»Selbstverständlich. Jeder aus unserer Zunft pflegt seine Talente.«
»Wie viel verlangen Sie für eine Übersetzung?«
Mein Gegenüber spitzte die Lippen. »Dieses Epistolarium ist Privateigentum, Herr Simmonis. Sie können keine Übersetzung anfertigen lassen, solange es Ihnen nicht gehört.«
»Und ich werde kein historisches Dokument kaufen, dessen Inhalt und Bedeutung ich nicht kenne«, bot ich ihm Paroli. »Sie könnten auch nur versuchen, mir bäuerliche Kochrezepte unterzujubeln.«
Der Händler neigte abwägend den Kopf hin und her. »Kommen Sie heute Abend wieder«, sagte er schließlich. »Dann habe ich einen des Alters angemessenen und des Inhalts würdigen Preis für Sie.«
Während er sprach, wurde ich erneut von einem übel riechenden Lufthauch abgelenkt. Angewidert sah ich mich nach dessen Quelle um. Es stank nicht nach faulendem Essen oder verwesenden Nagern, sondern nach Teer, ungeklärten Fäkalien und Kanalisation.
»Suchen Sie vielleicht noch ein grafisches Komplement?«, missdeutete van de Dageraad meine Reaktion.
»Nein, es …« Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Es riecht gerade nur ein wenig streng«, bemühte ich mich um den richtigen Ton.
Der Antiquar verzog leidig die Mundwinkel. »Ach, das kommt von unten …«, winkte er ab. »Irgendwo unter dem Parkett oder den Dielen muss sich ein Riss oder ein alter Abfluss im Boden geöffnet haben, durch den der Geruch in den Laden steigt. Ich beknie die Hausverwaltung bereits seit Wochen, sich des Malheurs anzunehmen, aber bisher erhalte ich nur Vertröstungen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeit.« Er stand auf und schwankte davon, um ein Fenster zu öffnen. »Laufen Sie mir nicht weg!«, mahnte er halb im Scherz, als er nach vollbrachter Tat den Raum durchquerte und ein weiteres, vom anhaftenden Staub nahezu blindes Buntglasfenster auf der gegenüberliegenden Ladenseite ankippte. Verkehrslärm drang von draußen herein.
»Ich mache Ihnen ein Angebot«, sagte er, nachdem er seinen Platz hinter dem Tresen wieder eingenommen und das Epistolarium eine Weile betrachtet hatte. »Wissen Sie, was ein Sachar Neshamat ist?«
»Bedaure.«
»Gut, lassen Sie es mich so erklären: Ich bin geneigt, Ihnen diese kleine Lektüre für die Zeit, die eine Übersetzung Ihrerseits beansprucht, zu überlassen – in Form einer Leihgabe.«
»Bitte?«
»Als … nun, nennen wir es Quidproquo erhalte ich von Ihnen die Adresse der Unterkunft meines alten Freundes Melchior – und den Namen, unter dem er dort weilt. Was halten Sie davon?«
Ich ging auf Distanz zu meinem Gegenüber, soweit es die Rückenlehne des Sessels zuließ. »Sie spielen doch nicht etwa mit dem Gedanken einer Vendetta, nur weil er mir diesen Tipp gegeben hat?«
»Nichts läge mir ferner«, beteuerte van de Dageraad. »Als Schöngeist wüsste ich nur zu gerne, ob er noch seiner Berufung folgt oder sich von seiner Gabe freigesagt hat. Seinerzeit, müssen Sie wissen, war er ein Genie. Und wie ich schon sagte: Ich vermisse seine begnadeten Visionen. Sollte es sich ergeben, dass ich durch unser kleines Joint Agreement an das eine oder andere Neu-Exponat gelange, wäre ich gewillt, diesen Umstand großzügig in unsere Preisverhandlung mit einfließen zu lassen.« Er legte eine rhetorische Pause ein, ehe er hinzufügte: »Unter der Voraussetzung, dass Sie das Buch wohlbehalten zurückbringen.«
»Wieso, glauben Sie, sollte ich das tun?«
»Diese Frage werden Sie sich in den kommenden Tagen mitunter selbst beantworten – sofern Sie Ihre Arbeit adäquat verrichten und den Sinn der Worte nicht entstellen. Im Moment ist alles, was hierin geschrieben steht, für Sie noch ohne Bedeutung. Eine unerzählte Geschichte. Schall und Rauch. Doch wenn Sie Ihre Arbeit akkurat und mit dem erforderlichen Gespür vollenden, zwischen den Zeilen zu lesen, werden Sie zweifellos Fragen haben. Fragen und möglicherweise auch Wünsche.«
»Was sollte mich daran hindern, damit das Land zu verlassen?«
»Das Versprechen, dass ich Sie finden und mein Eigentum zurückfordern werde. Anderenfalls mache ich Sie zu einem Zeugen – und zeige Ihnen, wie es endet.« Van de Dageraad taxierte mich. »Ich kenne diesen Blick«, sagte er und schob die Schatulle ein Stück näher zu mir heran. »Ich habe ihn bereits Tausende Male gesehen …«
TABULA MEDIA: ALEGOYA
Vier Tage benötigte ich für die Übersetzung der zwölf Briefe. Es gelang mir mithilfe alter, meist in kaum lesbarer Frakturschrift gesetzter Almanache und Wörterbücher, wobei mich intensive Onlinerecherchen unterstützten.
Bereits nach wenigen übersetzten Zeilen hatte ich erkannt, wessen goldenes Namenskryptogramm in die Buchfrontseite geprägt und wer die Verfasserin der Briefe war: Hieronymus Boschs Frau, die betagte Patriziertochter Aleyd Goyaert van de Mervenne – ALEGOYA.
Der Maler selbst hatte als Angehöriger einer religiösen Bruderschaft namens Unserer Lieben Frau den frommen Menschen gelebt. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass seine aus vornehmem Hause stammende Gemahlin der Kirche und dem Glauben ebenfalls Respekt zollte – bis hinein in intimste Zeugnisse. So hatte sie jedem Datum ein Anno Domini Nostri Iesu Christi angefügt, das ich in meiner übersetzten Abschrift der Briefe jedoch nicht berücksichtigt habe.
Da ich kein Muttersprachler bin, werden sich zwangsläufig Übersetzungsfehler eingeschlichen haben, die das eine oder andere Wort eleusinischer wirken lassen und manch einem Satz mehr obskure Bedeutung verleihen als dem Original. Doch selbst wenn man den Wahrheitsgehalt der Briefe unter diesen Gesichtspunkten relativiert, ist das, was übrig bleibt, mehr als befremdlich und verwirrend.
Dies ist Aleyd van de Mervennes Vermächtnis.
*****
26. Oktober 1503
Ach Elya, begann der erste der zwölf erhaltenen Briefe. Könnte ich doch nur in den Kopf des Mannes blicken, auf den ich mich einst des Herzens und der Vernunft wegen eingelassen habe. Die im Laufe der vergangenen Wochen geschehene Veränderung von Jeromes Wesen macht mich sorgen, dass seine Arbeit ihm am Verstande zehrt.
»Ally«, sprach er gestern, als er bis spät in die Nacht an einer Bildtafel für den Grafen von Nassau gearbeitet hatte und sich erschöpft neben mich legte. »Hättest du gedacht, dass die verschlagene Schlange gar nicht die erste Sündenkreatur in Eden gewesen war, sondern der dreiköpfige Sargalámpech?«
Ich spürte seine warme, geschwollene Männlichkeit zwischen meine Schenkel gleiten, während er dies sagte. Sein bald schon wonnevoll erregter Atem roch nach Oleum, fast so, als hätte er über all die Stunden im Atelier immer wieder gedankenverloren am farbgesättigten Haar seiner Pinsel gesogen.
28. Oktober 1503
Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es begonnen hatte, als dieser entengesichtige Stadtverwalter des Grafen von Nassau vor einem Monat erstmals bei uns vorstellig geworden war. Ohne einen Fuß ins Haus zu setzen, hatte er Jerome von einem seiner Bediensteten eine Einladung in den Nachtigallspalast überreichen lassen, wo er ihn mit einer fürstlich entlohnten Arbeit für seinen Herrn vertraut zu machen gedachte.
Die erste Veränderung in Jeromes Gemüt war mir aufgefallen, nachdem er von seinem Besuch im Palais zurückgekehrt war und sich nicht wie gewohnt an den Kamin gesetzt hatte, um den Tag in Ruhe ausklingen zu lassen. Stattdessen hatte er sich sofort in sein Atelier zurückgezogen, getrieben von Schaffensdrang, als wollte er alles auf Pergament und Eichenholz festhalten, bevor seine Erinnerung an das Erschaute oder Ersonnene verblasste.
Ich weiß nicht, was er im Hause des Stadtverwalters gesehen oder gehört hatte, aber ich kann nicht behaupten, dass ich glücklich darüber bin, was es seither aus Jerome gemacht hat. Es ängstigt mich, zu wissen, dass er zwar unten bei seinen Tafeln und Farben ist, aber seine Gedanken so weit von mir entfernt sind, wie es nur die Phantasie eines von imaginären Engeln und Dämonen Getriebenen vollbringen kann.
Ich scheue gedeihlich dem Fremden, das meine Haut streichelt, mein Fleisch liebkost und sich feurig erregt in mich ergießt, sobald es irgendwann im Morgengrauen aus seinem Garten zurückkehrt und mich nimmt …
4. November 1503
Heute hatten wir hohen Besuch im Haus: Seine Erlaucht Graf Heinrich III. von Nassau und seine Verlobte, die Herzogin von Savoyen, gaben sich mit ihrem Kleingefolge die Ehre und ließen sich bewirten. Die halbe Speisekammer und ein viertel Fass Wein haben sie sich in die Bäuche geschlagen, als gäbe es kein Morgen mehr, und das mit einer Selbstverständlichkeit, die mich vor Ingrimm zittern ließ. Ich mag ihn nicht wirklich gut leiden, diesen feistfrömmelnden Magnificus und Herrn von Breda. Dennoch war er der Einzige, der sich für Speise und Trank bedankte.
Der Grund für den Besuch des Grafen war jedoch keinesfalls, sich von uns verköstigen zu lassen, sondern die Fortschritte des in Auftrag gegebenen Altarbildes zu begutachten. Sein Loben und Staunen ob der daraufhin von Jerome erstmals enthüllten Paradiestafel erwärmte mein Herz mit Stolz und Genugtuung. Einzig das finstere Loch im Edengarten hatte den Herrn von Breda irritiert.
Nichtsdestotrotz waren er und die Herzogin voll des Lobes ob der visionären Fülle und Detailverliebtheit. So kam es, dass der Graf Jeromes bisher geleistete Arbeit mit zwanzig Gulden vergütete. Diese Großzügigkeit ließ erahnen, dass er durchaus eine Vorstellung seines Genies und seiner Akkuratesse hatte.
9. November 1503
Meine liebe Elya, was soll ich nur tun? Auf dem Markt erzählte mir eine der Bäckersfrauen heute Morgen, der Nachwächter der Südstadt habe Jerome zu vorgerückter Stunde in einem unbeleuchteten Kahn die Diezegracht hinabstaken sehen – in Richtung des Dirnenviertels. Und den Blicken der Leute nach zu urteilen hatte dieses Klatschweib es zuvor wahrscheinlich schon jedem erzählt, der willens gewesen war, ihr zuzuhören, und offen für jedwede Art von eklatschwangerem Ondit. Ich vermochte zu lauschen, wie sie hinter meinem Rücken tuschelten und sich ihre Tratschmäuler zerrissen.
10. November 1503
Ich konnt’ mich Jerome gegenüber noch nicht dazu durchringen, die Behauptung des Nachtwächters zur Sprache zu bringen. Vielleicht ist’s die Angst vor dem Schmerz, die mich zögern lässt. Angst vor den Worten, die finsterste Befürchtungen offenbaren könnten. Vor der Erkenntnis, eine innere Bande langsam zerreißen zu wissen und meinen Mann langsam an ein urbanes Schreckgespenst aus Manie, Phantasmagorien, Lust und Irrwandelei zu verlieren.
Ehe ich nicht aus Jeromes eigenem Mund gehört habe, dass alles nur dummes Gerede und Waschweibergemunkel ist, weigere ich mich zu glauben, dass er die Eingebung für seine Visionen in den Freudenhäusern findet und nicht beim Studium der in Stein gehauenen Figuren auf Sankt Jan und der Lektüre von Tier-Enzyklopädien und Herbarien in der Bibliothek des Stadtverwalters.
11. November 1503
Sag mir, Elya, war’s Torheit oder göttliche Eingebung, die meine Schritte gelenkt hatten? In einem vermeintlich einsamen Moment, in dem ich Jerome oben in der Dachkammer wähnte, hatte ich mich ins Atelier geschlichen, um mir die seltsamen Figuren in seinem Paradiesgarten anzusehen – und hatte gerätselt, welche der beiden dreiköpfigen Kreaturen jenen Sargalámpech darstellen sollte, von dem er so geheimnisvoll gesprochen hatte; die eine ein schwarzer Salamander, die andere ein großer brauner Vogel. Dabei wollte ich gerne glauben, ihrer beider Abnormität sei Jeromes Unschlüssigkeit geschuldet, wohin mit dem Hals.
Nach wie vor grüble ich über die Bedeutung des wie ein Schandfleck wirkenden finsteren Pfuhls, an dessen Ufer der dreiköpfige Vogel sitzt. Als der Graf zu Besuch war, hatte das Wasser bereits düster geglänzt, doch nun war es voll schwarzer Unwesen und Nachtschatten, die sich darin tummelten oder ihm auf dem Bauch robbend entstiegen.
Dass Jerome hinter mir lautlos das Atelier betreten hatte, wurde mir erst gewahr, als ich seine Stimme vernahm, die fragte: »Gefällt es dir, meine Teuerste?«
Ich fühlte mich innerlich zu Stein erstarren. Glaube mir, liebste Elya, es war ein Moment, in dem ich mich so weit wegwünschte, wie meine Vorstellungskraft es nur zuließ.
Schuldbewusst wandte ich mich um, wollte etwas Scharfsinniges erwidern, das meine Neugier Jerome gegenüber rechtfertigen mochte. Mich an eine Eingebung klammernd, übte ich leise Kritik an dem, was ich sah. Auf meine Bemerkung, das schillernde Haar der Eva sei dünn wie der Flaum einer Goldmotte, reagierte Jerome fast schon mit Schrecken. Minutenlang betrachtete er sein Werk, dann ergriff er wie in Trance einen Quastenpinsel und tunkte ihn in rote Farbe. Anstatt sich damit jedoch dem Haar der Eva zuzuwenden, zog er mit der freien Hand das Oberteil meines Nachtkleides herab und drückte ihn zwischen meine entblößten Brüste. So verharrte er eine Weile, fast, als wollte er sich von der Sinnhaftigkeit seines Tuns überzeugen. Schließlich wies er mich an, den Pinsel zu halten, ohne ihn von meinem Fleisch abzusetzen. Während ich tat, wie mir geheißen, ergriff er ein Leinwandmesser und schnitt mir das Nachtkleid, wie ich es am Leibe trug, von oben nach unten entzwei.
Entgeistert, ja geradezu bestürzt gab ich mich seiner Anwandlung hin, ohne mich zu regen.
»Eine Seele, die zwischen Licht und Dunkelheit gefangen ist, teilt alle göttlichen Sinnesfreuden, ohne sich an ihnen ergötzen zu können«, sprach Jerome. Daraufhin ließ er den Pinsel kreisen und begann meine Brüste zu bemalen. »Die ersten Schatten traten nicht aus der Dunkelheit hervor ins Licht, und sie ließen sich auch nicht aus der Nacht herabsinken.« Ich fühlte die Pinselspitze an mir herabgleiten und erbebte, als ich die kalte Farbe zwischen meinen Schenkeln spürte. »Sie tauchen aus der Tiefe empor, und der Bylar wacht in ihrer Mitte.« Der Pinsel wanderte in einer Wellenlinie wieder hinauf bis zu meinem Hals. »Er gibt ihnen die Form, nennt ihnen ihre Namen und zählt ihre Zahl.«
Auf meine mit zitternder Stimme geflüsterte Frage, was denn ein Bylar sei, lächelte er und sagte: »Der Quellherr der Sünde und dunklen Verlockung …«
16. November 1503
Käm’ ich doch nur dahinter, was Jeromes ruhelose Seele in den finsteren Stunden umtreibt und ihn dort draußen auf der Dieze suchen lässt. Inzwischen bin ich so weit gegangen, dem Nachtwächter einen Goldgulden zuzustecken, mit der Bitte, ihm heimlich entlang der Kanäle nachzustellen, um herauszufinden, wohin seine Bootsfahrten ihn führen. Und bitte, bitte, bitte, meine liebe Elya, lass es nicht die Hurennester im Fischerviertel sein. Ich würde diese Schmach nicht verkraften.
19. November 1503
Ich bin inzwischen wirklich in größter Sorge. Heute Morgen fand ich Jerome in voller Montur auf dem Kanapee im Gesellschaftsraum liegend. Er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, seine feuchtklamme, nach Brackwasser stinkende Kleidung zu wechseln. Dabei muss er bereits Stunden zuvor zurückgekehrt sein und im Atelier gearbeitet haben, denn rings um den Schemel war der Boden noch feucht vom herabgetropften Wasser, und im Tümpel auf der Tafel fand sich eine neue Figur. Zuerst hatte ich sie gar nicht wahrgenommen. Erst als ich die Fensteröffnete, um den Abwassergestank auszutreiben, war sie mir aufgefallen. Verwundert war ich daraufhin stehen geblieben und hatte sie mir angeschaut.
Sie wirkt auf den Betrachter, als hätte Jerome den ursprünglichen an dieser Stelle befindlichen Kopf eines mannsgroßen schwarzen Fisches mit dem Oberkörper einer mönchartigen, in die Lektüre eines Buches vertieften Gestalt übermalt. Dabei beschreibt ihr Körper unterhalb der Wasseroberfläche einen unnatürlichen Knick, der das eine nicht zum anderen passen lassen will. Aber was mag es sein, das da aus ihrer Kapuze ragt? Ein Schnabel? Eine Pestmaske?
21. November 1503
Jerome ist seit zwei Tagen krank. Eine schlimme Erkältung hat ihn befallen, zweifelsohne die Folge seiner Eselei, des Nachts mit bis auf die Haut durchnässter Kleidung stundenlang in der Stadt umherzuirren, statt heimzukehren und mich ihm ein warmes Bad bereiten zu lassen. Nun quälen ihn Fieber, Schüttelfrost und ein heftiger Husten, der sich heiser aus seinen Lungen Bahn bricht und ihn weder Schlaf noch Erholung finden lässt.
Trotz der Sorge um sein Wohlbefinden bin ich erleichtert über seine Bettlägerigkeit, denn so kann ich ihn zu Hause und nicht rastlos in der Stadt umherwandeln wissen.
»Du kannst den Bylar nicht sehen, Ally, aber er sieht dich«, murmelte er in einem dunklen Moment aus Fieberdelir und der Wirkung der Arznei, die der Medicus ihm verordnet hat. »Versprich mir, dass er deinen Namen niemals in sein Buch schreibt und dir einen Pfuhlgeist schickt.«
23. November 1503
Der Nachtwächter, der mir von Jeromes Eskapaden berichtet hatte, ist für einen halben Gulden bereit, mich den Kanal im Fischerviertel hinaufzufahren. Ganz wohl ist mir nicht dabei, jenseits des Jorishofs einige der Atrien und Grachtenhöfe zu erkunden, deren Wasser nach Einbruch der Dunkelheit selbst vom Gesindel gemieden wird.
Ich habe ein schlechtes Gewissen dabei, Jeromes Zustand auszunutzen, und daher die Haushälterin gebeten, sich um ihn zu kümmern, aber ihn auf keinen Fall im Atelier arbeiten oder gar das Haus verlassen zu lassen.
24. November 1503
Liebe Elya, ich bin wohlbehalten aus dem Fischerviertel zurück, obgleich meine Sinne unter den dort herrschenden Verhältnissen reichlich gelitten hatten. Wo der Nachtwächter seinen Worten zufolge Jerome des Nachts aus den Augen verloren hatte, liegt verborgen hinter einem Abschnitt der Stadtmauer ein heruntergekommener, von Ruinen umgebener Grachthof, in dessen Nähe mir schauderte. Mit dem Kanal verbunden ist das gut zwanzig Meter im Karree messende Areal durch einen unter der Mauer und den angrenzendenHäusern verlaufenden Tunnel, gerade einmal breit genug, um ihn mit einem Kahn zu durchfahren. Im Brackwasser dahinter treiben Tierkadaver, deren Gestank einem den Atem verschlägt.
Während ich mich angewidert in dem Geviert umsah, kam es mir vor, als hätten Fäulnis und Verwesung sogar das Fundament der Häuser befallen, um sich an den Fassaden emporzufressen. Vom Wasser führen schmale, geländerlose Stiegen hinauf zu Türen, die seit Jahrzehnten nicht mehr geöffnet worden sein dürften. Die Läden aller Fenster von den Hochparterres bis hinauf unter die Dächer sind geschlossen, leere Fensterhöhlen mit Brettern und Latten vernagelt.
Nach meinem Besuch dieser Kloake bin ich sicher, dort die gleiche Fäulnis gerochen zu haben, wie sie jüngst Jeromes Kleidung angehaftet hatte. Was um alles in der Welt hatte er zu vorgerückter Stunde dort verloren gehabt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas mit der Bruderschaft zu tun hat. Der Orden würde sich nie und nimmer dazu herablassen, sich an diesem unwürdigen Ort zu treffen. Was also geschieht dort nach Einbruch der Dunkelheit, das Jerome verleitete, immer wieder diesen schauderhaften Pfuhl aufzusuchen? Wonach sucht er – oder was hat er gefunden, das ihn Nacht für Nacht zu sich lockt?
27. November 1503
Ich habe mich entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, solange Jerome noch das Bett hüten muss – und ich werde es allein tun. Heute Nacht. Schelte mich eine Närrin, Elya, doch sorge dich nicht. Ich weiß auf mich aufzupassen.
28. November 1503
Liebe Elya, ich bin wie durch ein Wunder wohlauf, aber mein Glaube und mein Weltbild sind in ihren Grundfesten erschüttert. Ich kann die Feder nicht halten, ohne dass meine Finger zittern. Vielleicht hätte ich nach dem Vorfall in der Passage umkehren sollen. Dann würde ich jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, im Innern sicherlich nicht noch immer vor Grausen beben.
Die nächtliche Fahrt auf dem Kanal war ruhig und ohne Aufsehen verlaufen, bis ich den Eingang des Tunnels passiert hatte. Da ich im Inneren darauf achtete, mit dem Stakholz nicht an die Decke zu stoßen, war mein Blick nach hinten gerichtet, bis aus Richtung des Grachthofes unvermittelt ein Rauschen erklang. Mit Schrecken erkannte ich ein dunkles Etwas, das unter Wasser auf mich zuschoss und dabei eine Stoßwelle vor sich hertrieb. Ich vermochte es gerade noch, mich mit einer freien Hand an die Bootswand zu klammern, ehe es unter dem Kahn hindurchglitt. Mit Wucht hob es ihn an, sodass ich gezwungen war, mich zu ducken, um nicht mit dem Kopf gegen die Decke des Tunnels zu stoßen. Ich vernahm unter dem Rumpf ein kurzes, lautes Schaben, dann war dieses Ding unter dem Kahn hindurchgetaucht. Dabei zog es eine Spur aus Blasen hinter sich her, welche die ohnehin übel riechende Luft im Tunnel nach dem Platzen mit einem abscheulichen Gestank schwängerten.
Als mein Schreck sich so weit gelegt hatte, dass ich das Stakholz wieder mit fester Hand zu führen vermochte, drang ich nach kurzem Zögern weiter bis in den Grachthof vor. Heute weiß ich, dass ich hätte kehrtmachen sollen, statt verbissen an meinem Vorhaben festzuhalten. Aber mein verhängnisvollster Fehler in dieser Nacht war nicht der Eigensinnigkeit oder gar der Dummheit geschuldet, sondern der Unwissenheit. So erreichte ich zwar wohlbehalten jene nahe der Tunnelmündung gelegene, in einer kleinen Nische des Hofs versteckte Treppe, die ich mir für mein Vorhaben ausgesucht hatte. Doch wurde mir eine Begebenheit zum Verhängnis, die mir bei meinem ersten Besuch nicht aufgefallen war: Das Wasser des Grachthofs befand sich in unmerklichem, aber beständigem Fluss, fast so, als würde es aus der Tiefe von einer Quelle gespeist. Sie war zu schwach, um die Oberfläche in Wallung zu versetzen, aber ausreichend, um für eine sanft zirkulierende Strömung zu sorgen. Ein Born, bei dem es sich angesichts des herrschenden Gestanks jedoch nie und nimmer um einen natürlichen Zustrom handeln konnte.
So ließ ich den Kahn, nachdem ich ausgestiegen war, für einen Moment ungesichert am Treppenfuß treiben. Meine Aufmerksamkeit galt ganz den Stufen, um im Dunkel nicht auszugleiten und mir die Knochen zu brechen. Dabei sah ich nicht, dass das Boot samt Stakholz schon lautlos abtrieb. Als ich mein Missgeschick bemerkte und nach dem Kahn greifen wollte, war er bereits außer Reichweite. Dabei hätte ich auf dem schmierigen Treppenabsatz sogar fast noch den Halt verloren. Hilflos musste ich mit ansehen, wie mein Kahn auf das Mundloch des Tunnels zutrieb, an der Mauerkante von der Strömung gedreht wurde und letztlich im Dunkel verschwand.
War Jerome vergangene Woche womöglich just dieses Malheur ebenfalls passiert? Ein missglückter Versuch, das seinige Boot am Abtreiben zu hindern, wobei er ausgerutscht und in diese Kloake gefallen war? Oder hatte er sich aus freien Stücken ins Brackwasser begeben, um ihm hinterherzuschwimmen?
Letzteres würde meine einzige Möglichkeit sein, diesem Ort zu entfliehen, falls die kommenden Geschehnisse mich dazu nötigen sollten. Doch ängstigte mich dabei der Gedanke an das unbekannte, aber zweifellos lebendige Ding, das den Kahn im Tunnel emporgehoben hatte. Wer konnte garantieren, dass ein zweites davon mir nicht sofort folgen würde? Es hätte mich in der engen Passage im Nu eingeholt …
Verdrossen kauerte ich mich auf halber Höhe der Treppe zusammen, versuchte so wenig helle Haut wie möglich unter meiner Kleidung hervorschauen zu lassen und harrte der Dinge, die da wohl oder übel kamen. Erst jetzt fiel mir auf, dass einige der Fensterläden nun geöffnet waren. Obwohl das Mondlicht den Hof erhellte, war jedoch nicht zu erkennen, ob sich im dahinter liegenden Dunkel der Räume jemand verborgen hielt und Zeuge meiner vermeintlich heimlichen Ankunft gewesen war.
Ich hatte noch keine zehn Minuten in meinem Versteck verbracht, da ließ mich ein leises Sprudeln aufhorchen. Vor der Zwillingstreppe an der Stirnseite des Hofes begann das Wasser zu kochen und ließ hellen Blasenschaum aufsteigen. Zumindest so lange, bis ein zäher, schwarzer, morastiger Brei emporzuquellen begann, dessen Pestilenz mich bald würgen ließ. Den Stoff meines Kleides vor Mund und Nase gepresst, verfolgte ich gebannt das Geschehen. Aus dem brodelnden Modder tauchte etwas Schauerliches auf, von dem ich zuerst glaubte, es wäre ein uralter, von sechs dicken Ästen umgebener Baumstumpf – bis das finstere Ding in der Mitte unerwartet eine Regung zeigte und sich aus seiner Kauerstellung erhob!
Meine liebe Elya, ich wünschte aus tiefster Seele, alles, was sich vor meinen Augen abspielte, wäre nur ein Produkt der Faulgase, die meinen Verstand vernebelten – aber dem war nicht so. Was ich im Mondlicht für totes, schlicktriefendes Holz gehalten hatte, war eine mönchsartig verhüllte Gestalt – und das Gebilde, auf dem sie kauerte, beileibe kein abgestorbener Baum, sondern der Handteller einer riesigen sechsfingrigen schwarzen Klaue, die den Vermummten auf den zentralen Treppenabsatz emporhob. Während sich zwischen den mächtigen Fingern Ströme der schwarzen Brühe zurück ins Wasser ergossen, wirkte das Ding, das sich in ihrer Mitte tragen ließ, in keiner Weise davon benetzt. In seinen Armen barg es einen Gegenstand, der aus der Ferne wie eine Steintafel oder eine mächtige Fibel aussah.
Nahezu gänzlich von einem Umhang verhüllt, trat die Gestalt auf den obersten Treppenabsatz, wo sie wie in tiefer Andacht verharrte. Unter der bis tief in die Stirn gezogenen Kapuze vermochte ich kaum ein Gesicht zu erkennen, nur ein seltsames längliches Gebilde, das wie ein Schnabel daraus hervorragte.
Ich weiß nicht, was mich letztlich in meinem Versteck verraten hatte. Vielleicht hatte ich unbewusst einen Laut des Entsetzens von mir gegeben, oder es war in der Kälte der Nacht mein Atem gewesen, der als Wolke im Mondlicht zu sehen gewesen war. Denn während ich die unheimliche Gestalt auf der Treppe anstarrte, wandte diese sich fast schon feierlich zu mir um, und ich vernahm eine Stimme, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Dabei war sie nur ein sanftes Raunen, so leise, als wollte ihr Träger mich nicht unnötig ängstigen. Doch es war nicht ihr Klang, der mich erschaudern ließ, sondern die wenigen Worte, die sie sprach: »Es kommt der Tag, da wird ein jeder auf Erden ein Zeuge werden, Aleyd. Aber die Erleuchtete hat keinen Anfang in der Zeit. Sie war, ist und wird immer sein.«
Kaum war die Stimme verklungen, da bemerkte ich mehrere Spuren aus aufsteigenden Luftblasen, die sich mir aus der Mitte des Grachthofes langsam näherten. Die monströse schwarze Hand indes begann sich aufzurichten, bis ihre vier mittleren Finger steil in den Nachthimmel wiesen, während die beiden äußeren wie riesige stumpfe Hörner abstanden. Im Zwielicht sah ich drei, bald schon vier Paare großer, fahlgelber Augen, die sich nahe dem tiefsten Treppenabsatz dicht unter der Wasseroberfläche versammelt hatten und zu mir heraufblickten; glänzende Schimmer ohne Gesichter und ohne Körper. Und während ich schreckensstarr vor Angst ihre Blicke erwiderte, öffnete sich im Zentrum des riesigen schwarzen Handtellers ein mächtiges, orangefarben glühendes Auge und starrte mich an.
Gott, Elya, der Anblick dieses entsetzlichen schwarzen Zyklopendinges, das da nun lautlos durch das Wasser auf mich zuglitt, schnürte mir die Kehle zu. Dabei wuchs es höher und höher empor, bis es die ——
*****
Hier endete der erhaltene Teil des Epistolariums – und ließ mich fassungslos und innerlich aufgewühlt, ja fast schon wütend ob der Ungewissheit um das Schicksal der Verfasserin zurück. Es war, als wäre ich gegen eine unsichtbare Wand gerannt, von der ich von Anfang an gewusst hatte, dass sie existierte. Eine Wand, die zwar nicht den Blick auf das Dahinter verwehrte, aber dennoch das jähe und absolute Ende markierte.
Aleyd hatte das albtraumhafte Ereignis überlebt, so viel war sicher, denn wie hätte sie sonst diesen letzten Brief an jenen geheimnisvollen Empfänger niederschreiben können? Doch die Umstände, unter denen sie dazu in der Lage gewesen sein konnte angesichts der unverhohlenen Bedrohung, der sie ausgeliefert gewesen war, blieben im Ungewissen.
Ich strich mit den Fingerkuppen über die Reste der herausgerissenen Seiten. Nur der heftige, seit Stunden andauernde Regen hielt mich an diesem Abend davon ab, mich im historischen Fischerviertel auf die Suche nach jenem Ort zu begeben, den Aleyd – sofern alles der Wahrheit entsprach – in einer für eine Frau ihrer Zeit und ihres Standes so drastischen Weise beschrieben hatte.
Gegen Vormittag des fünften Tages vermeldeten die Nachrichten, dass der angesehene Brabanter Maler und Bildhauer Isaak Melech in den Morgenstunden des gestrigen Tages tot in seinem Hotelzimmer im belgischen Genk aufgefunden worden war. Obwohl mein Informant mir nie seinen Namen genannt und sich bei unserem einzigen kurzen Treffen in Aachen hinter dickem Schal und dunkler Brille versteckt gehalten hatte, wusste ich sofort, dass er es war, dessen Dahinscheiden durch die Medien geisterte.
TABULA DEXTRA: MALEBOLGE
Ich ging den Weg, den Aleyd vor 500 Jahren genommen haben musste, vom historischen Markt aus durch die westliche Altstadt bis zum ehemaligen Jansportal, wo sie wahrscheinlich ins Boot gestiegen war. Von dort aus marschierte ich entlang des Kanals, bis dieser unweit des ehemaligen Klosters Marienburg einen Bogen von fast neunzig Grad beschrieb und unter den Reihen der ehemaligen Bordelle verschwand. Die meisten Diezegrachten waren im Laufe der Zeit aus dem Stadtbild verschwunden. Manche der noch erhaltenen schmalen Gewässer, die seinerzeit als Abwasser- und Frachtkanäle gedient hatten, wirkten, als hätte vor Jahrhunderten eine schlammig-braune Flut die Stadt heimgesucht und wäre nie wieder aus den tiefen Gassen gewichen.
Wo einst jedoch der im Süden gelegene Hauptkanal entlang der alten Stadtmauer geführt hatte, verlief heute eine rege befahrene, mit Platanen gesäumte Straße. Ich folgte ihr etwa dreihundert Meter weit in östliche Richtung, ohne auf einen offenen Überrest des Gewässers oder einen Zugang zu stoßen. Sofern im Untergrund noch Abschnitte des alten Kanals existierten, war der Grachthof, in dem sich Aleyds Schicksal erfüllt hatte, allenfalls durch die Kanalisation oder die im Untergrund fließende Altdieze erreichbar.
Als ich mich in jener Gegend wähnte, in der sich vor Jahrhunderten das in den Briefen beschriebene Areal befunden haben musste, und meinen Blick über die schmutzig grauen Häuserfassaden wandern ließ, fiel mir an einem der Gebäude ein gekipptes, vom anhaftenden Staub fast blindes Buntglasfenster auf. Es war wie die benachbarten Fenster auf die gleiche Art und Weise gefertigt wie jenes, das van de Dageraad bei meinem Besuch geöffnet hatte, um den Gestank aus seinen Räumlichkeiten zu vertreiben.
Elektrisiert suchte ich eine Passage, die in die Fußgängerzone jenseits der ehemaligen Stadtmauer führte – und stand bald darauf tatsächlich vor jenem Portal, hinter dem die geschwungene Holztreppe zu den Räumlichkeiten des Antiquariats führte.
»Herr Simmonis«, erklang van de Dageraads verzerrte Stimme und ließ mich zusammenzucken. »Es ist zwar Sonntag, aber bitte, kommen Sie doch herauf!«
Ich starrte auf den Lautsprecher der Gegensprechanlage, dann hob ich den Blick und fand in einer Ecke über der Tür eine kleine unscheinbare Videokamera. Beim Summen des Türöffners rammte ich die Pforte mit der Schulter auf und stapfte die Treppe empor.
»Es war wohl Intuition, heute zu arbeiten«, hörte ich den Antiquar aus seinem Allerheiligsten rufen, kaum dass ich die obere Ladentür geöffnet und die Räumlichkeiten betreten hatte. »Sonst hätte ich Sie glatt verpasst.«
Van de Dageraad hockte hinter seinem Arbeitstisch, als hätte er sich fünf Tage lang nicht von der Stelle bewegt.
»Intuition?«, fragte ich, als unsere Blicke sich trafen. »Tatsächlich?«
»Jeder Fluss, so steht es geschrieben, mündet in seine Quelle.« Mein Gegenüber behielt sein Lächeln bei. »Wie verlief Ihre Arbeit? Sind Sie zufrieden?«
»Das bin ich keinesfalls.« Ich trat vor ihn hin und nahm unaufgefordert Platz. »Und Sie wissen genau, warum.«
»Sagen wir, ich habe eine leise Ahnung …«
Ich schloss die Augen und atmete tief durch, dann zog ich die Schatulle mit dem Epistolarium aus meiner Tasche und legte sie vor ihm auf den Tisch, wobei ich meine Hände jedoch auf dem Deckel ruhen ließ.
»Warum?«
Van de Dageraad zog die Augenbrauen zusammen, was ihn in Kombination mit seiner Bergerac-Nase einem griesgrämigen Geier ähneln ließ. »Geht es vielleicht etwas genauer?«
»Ihr ›alter Freund‹ Melchior«, half ich ihm auf die Sprünge. »Er ist tot.«
»Oh schat«, entfuhr es dem Antiquar. »Das ist wahrlich bedauerlich. Wissen Sie vielleicht, was sich zugetragen hat?«
»Sagen Sie es mir!«
Van de Dageraad zog das Kinn an die Brust. »Sie glauben doch nicht ernsthaft, ich hätte etwas mit seinem Ableben zu tun?«, gab er sich entrüstet.
»Es ist doch ein seltsamer Zufall: Vier Tage nachdem ich Ihnen den Namen des Hotels verraten habe, segnet er just dort in seinem Zimmer das Zeitliche.«
Der Antiquar lehnte sich in seinem Sessel zurück, faltete seine Hände vor seiner Brust und sah mich lange und forschend an. »Herr Simmonis«, sagte er schließlich leise und ohne jedweden Grimm in der Stimme. »Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie alt Melchior war?« Als ich nicht antwortete, fuhr er fort: »Der Architekt Willem Molenbroek hatte sich nach der Einweihung seines berühmten Weißen Hauses in Rotterdam eines seiner Gemälde in sein Büro hängen lassen. Das war im September 1898.«
Ich verdrehte die Augen. Van de Dageraads Blick hingegen fand wieder die Buchschatulle. »Ich bin überrascht, dass Sie es bei sich haben«, gestand er. »Sie hatten doch bestimmt nicht vor, mich ausgerechnet heute mit Ihrem Besuch zu erfreuen.«
»Hotelzimmer sind ja offenbar nicht mehr sicher …«
Der Antiquar schürzte die Lippen, verbiss sich aber eine Bemerkung. Stattdessen fragte er: »Dürfte ich mich davon überzeugen, dass das Exponat in Ihren Händen nicht gelitten hat?«
Ich seufzte, dann schob ich die Schatulle zu ihm hin. »Wer war Elya?«, fragte ich, nachdem er sich seine Handschuhe übergestreift und ihr das Buch entnommen hatte.
»Die Schwester.« Van de Dageraad blätterte das Epistolarium vorsichtig durch und überprüfte den Zustand jeder einzelnen Seite. »Aleyds im Jugendalter dem Typhus anheimgefallene Zwillingsschwester.«
»Und wie endete die Geschichte?«
Mein Gegenüber hob den Blick. »Nun, ein Ende ist gewissermaßen immer auch ein Anfang«, erklärte er. »Das Ende dieses Briefes jedenfalls war ein Zeugnis, in dem streng gehütete Namen fielen und lästerliche Wahrheiten ausgesprochen wurden. Zu vieles von beidem, um ehrlich zu sein.«
»Dann hat also nie ein dreizehnter Brief existiert?«
»Nur das Ende jenes Berichts, dessen Sie so befremdenden Großteil Sie gelesen haben«, bestätigte van de Dageraad.
Wir taxierten uns wie rivalisierende Giftschlangen. »Sie waren es!«, dämmerte es mir. »Sie selbst haben die fehlenden Seiten herausgerissen!«
Der Antiquar schnitt eine Grimasse. »Herausreißen ist ein sehr unschönes Wort, Herr Simmonis«, erklärte er mit leicht tadelndem Unterton. »Sagen wir, ich habe sie der Geschichte entnommen. Aber …« Er klappte das Buch zu und musterte mich. »… ich habe Ihnen gleichermaßen versprochen, besagtes Ende zu erfahren, sofern Sie mir mein Eigentum wohlbehalten zurückbringen. Und das haben Sie, was ich Ihnen hoch anrechne.« Er verstaute das Epistolarium dort, wo er es fünf Tage zuvor entnommen hatte, dann erhob er sich mit einem leisen Seufzen. »Wenn ich Sie bitten dürfte, mir zu folgen.«
»Folgen?«, echote ich. »Wieso lesen Sie mir die restlichen Seiten nicht einfach vor?«
»Weil ich sie damals verbrannt habe.« Van de Dageraad trat hinter seinem Refugium hervor und schlurfte zu einem Wandregal.
Ich sah ihm ungläubig nach. »Was heißt damals?«
»Anno 1813. Kommen Sie nun oder nicht?«
»Wohin?«
»Wie ich bereits sagte: Ich halte das, was sich dem Verstand unvermittelt erschließt, für die reinste Inkarnation des Göttlichen. Und was das Auge sieht, glaubt bekanntlich das Herz.«
Als van de Dageraad den vor dem Regal liegenden Läufer mit dem Fuß beiseiteschob, verrieten die Schleifspuren auf dem Holzboden, dass das Möbelstück etwas Besonderes vor den Augen der Laufkundschaft schützen musste. Ich erwartete ein Schmuckseparee oder einen Wandtresor zu erblicken und war enttäuscht, als sich dahinter keine massive Stahltür verbarg, sondern eine sehr alte, ungewöhnlich schmale Holzpforte. Der mit vier rostigen Riegeln gesicherte Zugang sah aus, als läge dahinter ein uralter Abort oder allenfalls eine Besenkammer. Durch seine Ritzen strömte just jener ekelerregend-penetrante Gestank, den ich bei meinem ersten Besuch wahrgenommen hatte.
»Was bedeutet Sachar Neshamar?«, fragte ich, als der Antiquar zuerst den dritten der vier Schließriegel öffnete.
Van de Dageraad hielt für einen Moment in der Bewegung inne. »Das fragen Sie jetzt?« Er schob kopfschüttelnd den obersten Riegel auf, dann den zweiten und schließlich den untersten. »Es ist das hebräische Wort für einen Pakt«, erklärte er. »Frei übersetzt bedeutet es ›Seelenhandel‹. Ein solcher wie der unsere wird für gewöhnlich mit Blut besiegelt.«
»Ich habe nichts dergleichen besiegelt«, stellte ich klar. »Schon gar nicht mit Blut.«
»Nun, zumindest nicht mit dem Ihren …«
Ehe ich fähig war, darauf zu reagieren, zog er die Tür mit einem Ruck auf. Der Gestank, der mir entgegenschlug, raubte mir schier den Atem – und jeden Gedanken an das zuvor Gehörte und Gesagte. Hinter der Tür führte eine gemauerte Wendeltreppe in die Tiefe, die der Händler sich ohne zu zögern anschickte hinabzusteigen.
»Kommen Sie«, klang seine Stimme dumpf herauf, als das Dunkel ihn verschluckt hatte.
Meine Befürchtung, dass der Weg in einer historischen Klärgrube endete, ließ mich zögern. Schließlich zog ich mein Smartphone aus der Manteltasche und folgte dem Antiquar im Licht des Displays, wobei ich darauf achtete, den feucht glänzenden Wänden nicht zu nahe zu kommen.
Die Treppe musste sich im Verborgenen durch das Parterre des Hauses bis ins Untergeschoss winden, wo sie in einem kurzen gemauerten Korridor endete. Eine rustikale Flügeltür versperrte nach wenigen Metern den Weg. Der herrschende Gestank ließ mich befürchten, dass ein einziger Funke zu einer Explosion führen könnte, die den gesamten Häuserblock in Schutt und Asche legte.
»Die menschliche Geburt ist ein Prozess aus Blut, Schleim, Schmerz und dem Odeur eures tiefsten fleischlichen Innern«, sagte van de Dageraad, dem der Gestank offensichtlich nicht im Geringsten auf die Sinne schlug. »Jedem Fötus haftet der Duft des Schoßes an, aus dem er geboren wird – und jeder zutiefst verwerflichen Ausgeburt menschlicher Phantasie der Geruch von Sünde, Laster und Niederträchtigkeit in ihrer reinsten, archaischsten Form.«
Dann stemmte er sich gegen die Türflügel und drückte sie auf. Die warme Dunstwolke, die in den Korridor quoll, war apokalyptisch. Hinter dem Portal herrschte jedoch keinesfalls Finsternis, und auch meine Befürchtung, eine offene Flamme könnte jederzeit ein Gemisch aus Methan und Faulgasen entzünden, erwies sich als unbegründet.
Jenseits der Pforte öffnete sich ein gut vier Stockwerke hoher, fast kreisrunder Felsenkessel, der aussah wie das Innere einer Festungsrotunde. Er maß etwa zwanzig Meter im Durchmesser und reichte unterhalb der balkonartigen Konstruktion, auf der wir standen, weitere zehn bis zwölf Meter in die Tiefe bis zu einem schlammigen Tümpel, der zweifellos die Quelle des abscheulichen Gestanks war. Überwältigt vom Fäulnisgeruch und dem Anblick des Beckens wähnte ich mich in einer altertümlichen Gerberei, deren Betreiber nach Verwesung stinkende Tierhäute noch in einer Lohbrühe aus altem Urin, Kot und Alaun bleichten. Entlang der Kesselwand führte ein aus Planken, Bohlen und Stützpfeilern gefertigtes Gerüst in einer weiten Spirale hinab zu einem den Pfuhl umschließenden Rundsteg. Er war so schwarz, als hätte ein Feuer das Holz verkohlt. Vom Ufer aus ragten vier weitere Stege in die Mitte des Tümpels, wo ein zäher, dampfender Sud aus der Tiefe emporquoll.
An der gegenüberliegenden Seite der Halle war ein großes, geschlossenes Metalltor in die Wand eingelassen. Es glich einem Schleusenportal und schien mit einem Mechanismus aus Handwinden und massiven Zahnrädern auf und ab bewegt werden zu können. Obwohl ich es zum ersten Mal sah, war es mehr als nur eine Vermutung, dass es jene tunnelartige Passage verschloss, welche den Grachthof mit dem einst hinter der Stadtmauer gelegenen Diezekanal verband.
Fraglos blickte ich auf jenen Ort hinab, an dem sich Aleyd van de Mervennes Schicksal erfüllt hatte. Aber nichts war mehr so, wie es in ihren Briefen geschrieben stand. Das Zentrum des einstigen Grachthofs war im Laufe der Jahrhunderte in Form eines primitiven Kolosseums ummauert und von den benachbarten Gebäuden getrennt worden. Obwohl ich nur schätzen konnte, wie tief die Wendeltreppe in das Fundament des Hauses hinabgeführt hatte, musste der dampfende Pfuhl am Grund der Rotunde weit unterhalb des heutigen Wasserspiegels liegen. Dort herrschte im Schein zahlloser Pechfackeln ein seltsames Treiben, das sich am treffendsten mit ›phlegmatischer Betriebsamkeit‹ beschreiben ließ. Auf den Stegen verteilt standen mehr als ein Dutzend vermummter, gedrungener Gestalten, die ihre Gesichter mit Lumpen, Tüchern und altertümlichen Fliegerbrillen vor den Ausdünstungen zu schützen versuchten. Ohne van de Dageraad oder mich eines Blickes zu würdigen, rührten und stocherten sie mit langen Stangen in der sämigen Brühe. Andere waren unentwegt damit beschäftigt, die erstarrte schwarze Kruste vom Holz der Stege zu kratzen und in den Tümpel zurückzuwerfen. Ab und an glaubte ich für einen Augenblick Dinge aus der wallenden Masse ragen zu sehen, die aussahen wie Brust- oder Rückenflossen, warzenbedeckte Buckel oder gar schwarze, rudimentäre Hände mit drei oder vier plumpen, stummelartigen Fingern.
»Was um Gottes willen ist das?«, stieß ich angewidert hervor, als ich die Sprache wiedergefunden hatte.
Van de Dageraad schnaubte abfällig durch die Nase. »Ginge es nach Gott, würde dieser Ort gar nicht mehr existieren …« Er trat ans Geländer und breitete die Arme aus. »Das, Herr Simmonis, ist alles, was von der Pracht Edens übrig geblieben ist.«
»Eden?«, wiederholte ich mit schwerer Zunge. Die Dämpfe, die den riesigen Kessel schwängerten, wirkten auf fast schon widerwärtige Art berauschend und begannen meinen Verstand zu vernebeln.
»Nicht gerade eine Augenweide, ich weiß.« Die Mundwinkel des Antiquars verzogen sich zu einem gehässig-spöttischen Lächeln. »Jeder Paradiesgarten mag durch göttliche Hand erblühen und vergehen. Was ihr Idyll letztlich überdauert, sind ihre Malebolgen, die Sündenpfuhle menschlichen Sinnens und Strebens.«
»Wollen Sie mir weismachen, hier habe der Garten Eden gelegen?« Ich bemühte mich gar nicht erst, meiner Stimme einen Ausdruck zu verleihen, als würde ich van de Dageraad ernst nehmen. »In Brabant?«
»Nicht der Garten, Herr Simmonis. Ein Garten. Es existierte nicht nur ein einziges Paradies. Und keinesfalls auch nur zu einer einzigen Zeit. Das hier ist nicht die erste Menschheit. Und es wird beileibe nicht die letzte bleiben. In den Hunderten von Millionen Jahren, in denen Leben auf diesem Planeten existiert, gab es viele Edengärten. Jeder von ihnen hatte seinen lauteren Lebensquell, seinen leuchtenden Baum der Erkenntnis, einen Hain schamloser Lebensfreude, den Nimbus der Harmonie allen Seins – und seinen Uterus der Sünde, an dessen Ufern stets Zwielicht herrscht. Die Malebolgen mögen vielleicht nicht der Anfang des göttlichen Plans gewesen sein, aber sie sind stets das Ende.«
»Und welche Rolle spielen Sie in diesem sogenannten ›Plan‹?«
»Ich führe Buch über jede Ausgeburt, die dem Zwielicht entsteigt.« Van de Dageraad wandte sich zu mir um. »Ich gebe ihr den Namen und die Form und weise ihr den Weg zu dem menschlichen Ungeist, der sie ersonnen hat.« Er deutete in die Tiefe. »Sehen Sie!«
Ich blickte hinab auf den Schlammtümpel. Von den Stangen der Vermummten ans Ufer dirigiert, begann ein amorphes Ding aus dem Wasser zu kriechen, das aussah wie eine riesige, mit rudimentären Gliedmaßen ausgestattete Molluske. Und es war beileibe nicht das erste seiner Art. Unter dem Dunstschleier kaum von den rundgeschliffenen, pechbedeckten Uferfelsen zu unterscheiden, entdeckte ich vier oder fünf weitere dieser Kreaturen, welche wie Föten zusammengerollt reglos am Ufer lagen.
Entgeistert musterte ich den Antiquar. »Sie sind der Bylar aus Aleyds Briefen …«
Mein Gegenüber deutete eine Verbeugung an. »Bel Arion, um korrekt zu sein.«
»Aber – das war vor fünfhundert Jahren!«
»Fünfhundertfünfzehn.« Van de Dageraad hob lauernd seinen Pinguinkopf. »Ich erlaube Ihnen dieses eine Mal, meinen Namen laut auszusprechen, Herr Simmonis. An diesem unheiligen Ort und zu dieser unheiligen Stunde. Tun Sie es ein zweites Mal, egal wie, wo, wem gegenüber oder wann, werde ich Ihre Zunge kürzen. Tun Sie es ein weiteres Mal, werde ich dafür sorgen, dass Ihnen wie dem bedauernswerten Melchior die Augen in den Höhlen verfaulen oder jede noch so köstliche Speise, die Sie zu sich nehmen, nach warmem menschlichem Kot und jeder Trank nach Urin schmecken wird.«
Er erwiderte meinen Blick, wobei er zu ergründen schien, ob ich ihn beim Wort nahm oder alles für einen schlechten Scherz hielt. »Nichts für ungut«, fügte er schließlich hinzu. »Morgen schon werden Sie kaum noch einen Gedanken daran verschwenden. Kommen Sie, ich möchte Sie einer alten Freundin vorstellen.« Van de Dageraad ging an mir vorbei und betrat den abwärtsführenden Steg. »Können Sie zufällig mit Pinsel und Farbe oder mit spitzer Feder umgehen?«, fragte er und sah über seine Schulter. Ich trottete ihm nach, wobei ich den Kopf schüttelte, um den verdammten Nebel aus meinem Verstand zu kriegen. »Keine Sorge, Sie werden es lernen«, fügte der Antiquar hinzu, als ich nicht antwortete. »Nun, da Sie ein Zeuge sind …«
Ich fühlte, wie die stinkenden Schwaden zusehends meine Sinne betäubten. »Ein Zeuge?«, wiederholte ich mit schwerer Zunge. »Wovon?«
»Der Dämmerung, Herr Simmonis. Des Zwielichts. Der Schattenwelt.« Er blieb stehen und wandte sich um. »Und natürlich ein Zeuge meiner Existenz.«
Ich kann nicht genau beschreiben, was er im nächsten Moment tat, als er wie in festlicher Euphorie die Arme hob. Es sah aus, als würde er mit beiden Händen über sich greifen, um die vermeintliche Wirklichkeit zu packen und sie wie eine dünne Stoffkulisse vor sich niederzureißen. Was im nächsten Augenblick vor mir stand, hatte mit einem Menschen kaum noch etwas gemein. Und doch glaubte ich ein Abbild dieser in einen Kapuzenumhang gekleideten Kreatur schon einmal gesehen zu haben: auf der Paradiestafel des Lustgarten-Altargemäldes, das Bosch für den Grafen von Nassau angefertigt hatte. Aber die seinem Kopf entwachsende Anomalie war keinesfalls eine Pestmaske oder gar ein langer Schnabel, wie Aleyd dereinst beim Betrachten des halb fertigen Bildes gemutmaßt hatte. Und auch ihr Unvermögen, des Nachts im Grachthof das Gesicht des Fremden zu erkennen, hatte nicht an der Dunkelheit gelegen – es gab schlichtweg keines. Aus der amorphen Schwärze unter der Kapuze ragte ein Paar armlanger, dornenbewehrter Fangzangen, die aussahen, als könnten sie einem Menschen mühelos den Kopf abtrennen.
»Was sind Sie?«, presste ich entsetzt hervor.
»Der Herr der dunklen Musen«, antwortete die Kreatur, wobei die monströsen Mandibeln sich im Rhythmus der Worte öffneten und schlossen. »Betrachten Sie meinen weltlichen Namen als Allegorie meines wahren Ichs – sofern Sie ihn zu deuten wissen.«
Ich wollte herumwirbeln, um diesem Albtraum zu entfliehen, aber meine Beine gehorchten mir nicht. Was auch immer dampfend aus der Tiefe des Pfuhls emporquoll, betäubte meinen Verstand. Der graue Dunst, den ich einatmete, lähmte meinen Geist, erstickte jeglichen Widerstand und machte mich auf erschütternde Weise gefügig. Es fiel mir schwer, einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn mich verständlich zu artikulieren.
»Was wollen Sie von mir?«, brachte ich Wort für Wort mühsam über die Lippen.