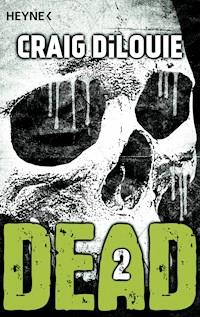
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Gejagt von den Lebenden und den Toten
Ein mysteriöses Virus hat die USA in ein Land der Toten verwandelt: Jeder, der sich infiziert, stirbt, nur um drei Tage später wieder als hungriger Leichnam zu erwachen und Jagd auf die Lebenden zu machen. Jeder – außer Ray Young. Doch auch Ray ist nicht immun gegen das Virus, vielmehr hat es ihm übermenschliche Kräfte verliehen. Ray ist nun das Zünglein an der Waage: Er kann die Menschheit retten oder sie endgültig zerstören. Und plötzlich sind ihm nicht mehr nur die Toten auf den Fersen, sondern auch das Militär ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Ein mysteriöses Virus hat die USA in ein Land der lebenden Toten verwandelt. Jeder, der sich infiziert, stirbt, nur um drei Tage später wieder als hungriger Leichnam zu erwachen. Die Infektion hat sich rasend schnell ausgebreitet und die Vereinigten Staaten ins totale Chaos gestürzt. Doch damit nicht genug: Einige der Infizierten verwandeln sich weiter und entwickeln sich zu furchterregenden Monstern. Das Militär hat den Zombies den Krieg erklärt. Erbittert wird um die Rückeroberung von Washington, DC. gekämpft. Nicht weit davon erfährt Ray Young, dass er nicht nur den Kampf gegen die Horden von Untoten überlebt hat – sondern auch die Infektion. Ihm hat das Virus übermenschliche Kräfte verliehen, und nun muss er sich entscheiden: Will er die Menschheit retten, oder sie vernichten?
Der Autor
Craig DiLouie hat zunächst zahlreiche Sachbücher veröffentlicht, bevor er mit dem Zombie-Roman Dead, der ebenfalls im Wilhelm Heyne Verlag erschienen ist, in Amerika riesige Erfolge feierte. Der Autor lebt mit seiner Familie in Kanada.
@HeyneFantasySF
CRAIG DiLOUIE
DEAD 2
Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
THE KILLING FLOOR
Deutsche Übersetzung von Ronald M. Hahn
Deutsche Erstausgabe 09/2014
Redaktion: Marcel Häußler
Copyright © 2012 by Craig DiLouie
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld
Satz: Buch-Werksatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-15113-3
Danksagung
Besonderer Dank für redaktionelle Unterstützung gebührt Renée Bennett, Jessica Brown und Elizabeth Stang. Ferner stehe ich in der Schuld von Chief Petty Officer a. D. James R. Jackson, der den größten Teil der militärischen Thematik auf Stimmigkeit geprüft hat.
Anmerkung
In diesen Roman sind, um den Hintergrund der Handlung so realistisch wie möglich zu gestalten, erhebliche Recherchen eingeflossen. Sämtliche Charaktere sind zudem frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit Lebenden oder Verstorbenen ist Zufall. Auch sind viele Handlungsschauplätze und Organisationen reine Erfindung. So habe ich z. B. Geographie, Ortschaften und Straßen zwischen Südost-Ohio und Washington D. C. stets dann frei gestaltet, wenn es für den Ablauf der Geschichte wichtig war. Erwähnte Militäreinheiten sind reine Phantasie. Das Fifth Stryker Cavalry Regiment ist eine erfundene Einheit und wurde aus verschiedenen Elementen mehrerer existierender Kampfgruppen des Heeres der Vereinigten Staaten zusammengesetzt.
Für meine großartige Familie,
der meine unaufhörliche Sorge gilt,
da sie der Treibstoff
meiner apokalyptischen Träume ist.
AUSBRUCH
Die Mittagskonferenz im ersten Stock des Westflügels im Weißen Haus war wegen des lauten Maschinengewehrfeuers vorverlegt worden.
Dr. Travis Price, der stellvertretende Leiter des Amtes für Naturwissenschaftlich-Technische Strategien, schaute durchs Fenster in den Dunst hinaus, der sich in der Stadt ausgebreitet hatte.
Draußen schoss die Marineinfanterie weiterhin Infizierte vom Zaun herunter.
Die Tür des Konferenzraums ging auf. Kellner in frisch gebügelten blauen Anzügen traten ein und schoben Servierwagen über den Teppich. Als sie das heisere Gebell der Maschinengewehre hörten, zuckten sie zusammen.
»Du lieber Gott«, sagte Sanders, der an einem anderen Fenster stand.
»Was?«, fragte jemand, in dessen Stimme leichte Panik mitschwang.
»Es ist einer der Gärtner.«
Travis blickte auf den grünen Rasen hinunter, sah aber nur eine Infizierte, die am Zaun hinaufkletterte. Sie fiel zu Boden. Das Maschinengewehr hörte auf zu schießen.
»Ist ihm etwas passiert?«
»Nein. Er ist da unten und schneidet die Rosenstöcke.«
Einige Anwesende lachten.
»Na, das nenne ich dienstbeflissen«, sagte jemand.
»Hoffentlich kriegt er den Eifer auch ordentlich bezahlt.«
Wir leben in einer erstaunlichen Welt, dachte Travis. Jetzt schockiert uns das Normale.
Die Notregierung tagte seit dem ersten Tag der Epidemie. Der Präsident wollte mehr Befugnisse, um gegen die Ausbreitung des Flächenbrandes, so die amtliche Bezeichnung für die Seuche, vorzugehen. Der Kongress musste alles billigen. Der Raum wimmelte von Bürokraten, Erbsenzählern und Kongressangestellten. Travis war der Einsatzgruppe als wissenschaftlicher Berater zugeteilt worden. Man erörterte das Posse-Comitatus-Gesetz, die Unruhenverordnung von 1807, die Lehre aus der Militäroperation Noble Eagle. Hauptsächlich stritt man sich über die Grenzen der exekutiven Autorität und die Möglichkeiten der Legalisierung von Massentötungen. Büsten George Washingtons und Benjamin Franklins, in Nischen an der Wand gegenüber, beobachteten die Verhandlungen mit leicht geringschätziger Miene.
Travis fragte sich, ob die ganze Debatte über Gesetzesinterpretationen nicht eine Art institutioneller Verweigerung war, ein Äquivalent Neros, der Harfe spielte, während Rom in Flammen stand.
Sein Magen knurrte. Er hatte in den letzten Tagen nur wenig gegessen. Sein Körper brauchte Nahrung.
Travis ging zum Esstisch, nahm ein Sandwich und begutachtete es. Thunfisch, die Brotränder von fachmännischer Hand abgeschnitten. Er wunderte sich, wie viel Sorgfalt man in die Zubereitung investierte, biss ab, kaute und zwang sich zu schlucken. Mehrere knapp über seinem Kopf in die Wand eingelassene Fernsehschirme zeigten Horden von Infizierten, die überall im Land durch die Straßen liefen. Zwei vom Notalarmsystem übernommene Sender spulten Evakuierungsinstruktionen ab.
Bisher war Travis nur selten gebeten worden, etwas zur Konferenz beizutragen, und darüber war er froh, denn er konnte der Runde ohnehin nur wenig sagen. Was er wusste, wussten auch die anderen: Vor sieben Tagen waren überall auf der Welt zwanzig Prozent der Menschen brüllend zu Boden gefallen. Vor vier Tagen waren sie aus einem Zustand der Katatonie erwacht. Sie waren auf andere Menschen losgegangen, hatten sie mit einer Art Krankheit infiziert und die Welt in den Abgrund gestürzt. Das Ergebnis konnte man nun auf dem Fernschirm verfolgen.
Die große Frage lautete: Warum? Beantworten konnte sie niemand.
CNN zeigte einen Mob, der ein Aufgebot der Chicagoer Bereitschaftspolizei in Stücke riss. Jemand schnappte nach Luft. Die Gewalttätigkeit war kaum zu ertragen. Die Infizierten waren wie Tiere. Die Cops wehrten sich verzweifelt, drängten sie zurück und schlugen mit Knüppeln auf sie ein.
»Nein, nein, nein …« Jemand schluchzte.
»He …«, zischte Travis zwei Männern zu, die in seiner Nähe standen. Fielding und Roberts waren adrette Kerle mit harten Gesichtszügen und wie Astronauten gebaut. Sie arbeiteten für das Büro des Beraters für Nationale Sicherheit. »Müssen wir zulassen, dass das da gesendet wird?« Seiner Ansicht nach hätte die Regierung sich bemühen müssen, den Informationsfluss in einer Krise wie dieser zu steuern. Zensur war natürlich falsch, aber sie konnte auch dazu dienen, Panik zu verhindern.
Fielding und Roberts tauschten einen Blick.
»Warum sollten wir etwas verschleiern oder bestreiten, das überall passiert?«, meinte Roberts.
»Bleiben Sie bei der Wissenschaft, Doc«, sagte Fielding.
Travis wandte sich mit rotem Gesicht um. Die Sache war ihm peinlich. Warum hatte er sich überhaupt geäußert? Wenn es nicht um den Bereich der Naturwissenschaften ging, in dem er glänzen konnte, tat er sich oft schwer mit anderen Menschen. Er sagte immer das Falsche.
Auf dem Bildschirm rappelten sich gerade drei der fünf Polizisten auf. Während die Brüller noch drei Tage gebraucht hatten, um aus ihrer Ohnmacht zu erwachen und das Pflegepersonal anzugreifen, dauerte es bei Gebissenen nur einige Minuten. Die Cops liefen kopfwackelnd los, um sich zur Meute der Infizierten zu gesellen.
»Die wichtigste Frage ist, wieso sie so schnell laufen.«
»Wie bitte, Dr. Price?«, fragte Roberts.
Travis stutzte. Ihm war nicht bewusst gewesen, dass er den Gedanken ausgesprochen hatte. »Ähm … die Frage, die uns telefonisch am meisten gestellt wird«, sagte er, »ist, wieso die Infizierten rennen können.«
Die Männer schauten ihn verständnislos an. Travis trat beiseite, damit auch die anderen an die Sandwichs herankamen. Der überfüllte Raum summte vor Tratsch und Diskussionen.
»Viele Leute sehen in den Infizierten so etwas wie Zombies«, fuhr er fort. »Wie die in den alten Filmen. Tote, die jemand wieder zum Leben erweckt hat. Zombies sind langsam, oder? Die Menschen verstehen das nicht.«
»Das ist wahrscheinlich auch gut so, Doc«, sagte Fielding. »Wenn die Leute glauben, dass ihre Verwandten schon tot sind, werden sie bestimmt nicht lange zögern. Wer eine Waffe hat, wird sie töten, sobald sie auftauchen.«
»Aber wir fordern die Leute doch nicht auf, Infizierte zu töten«, sagte Travis.
»Natürlich fordern wir sie nicht auf«, sagte Fielding.
»Ich schätze, wenn sie Zombies wären, wären sie auch tot und hätten keine Rechte mehr«, sagte Travis. »Und dann wäre es doch in Ordnung, die Leute aufzufordern, sie zu töten. Schade, dass es nicht so ist.«
»Interessant«, sagte Fielding gepresst. Sein harter Blick verriet seine Geringschätzung.
»Könnte ich mal kurz unter vier Augen mit Ihnen sprechen, Dr. Price?«, fragte Roberts.
»Sicher«, sagte Travis in der Hoffnung, dass er nicht so erleichtert klang, wie er sich fühlte.
Roberts deutete auf ein Fenster, und sie trennten sich von den anderen. Als Travis den von endloser Anspannung sauren Atem des Mannes roch, wich er zurück.
»Meine Frau ist auch umgefallen«, sagte Roberts.
»AEG?«, erkundigte sich Travis. Abruptes epileptisches Gehirngrippensyndrom – auch AEG genannt – war der amtliche, wenn auch etwas weit gefasste Terminus, den die Wissenschaft verwendete, um die mysteriöse Krankheit zu beschreiben, die mehr als eine Milliarde Menschen brüllend hatte zusammenbrechen lassen und den Lauf der Welt angehalten hatte.
»Ja.« Roberts fuhr sich mit der Hand über das kurz geschnittene Haar. »Ich habe sie ins Krankenhaus gebracht. Nun ist sie eine der Wahnsinnigen da draußen.«
»Tut mir leid«, sagte Travis mechanisch.
»Hören Sie … sie ist schwanger. Im achten Monat.«
»Oh.«
»Mein Sohn … Ist er einer von denen oder einer von uns?«
Travis öffnete den Mund und schüttelte den Kopf. Theorien fluteten sein Hirn, wollten unbedingt ausgesprochen werden, doch er hielt sie zurück. Roberts wollte etwas Ermutigendes hören, doch Travis fielen die richtigen Worte nicht ein. In der Verbreitung von Plattitüden war er noch schlechter als in oberflächlichem Geplauder.
»Der Präsident«, rief Fielding Roberts zu und deutete auf die Bildschirme.
Präsident Walker hatte den größten Teil der Krise im Lagezentrum unter der Erde verbracht. Seit Beginn der Epidemie war er nur noch auf dem Bildschirm zu sehen. Jemand drehte die Lautstärke hoch. Die Stimme des Präsidenten, der sich von seinem Schreibtisch im Oval Office aus an die Nation wandte, erfüllte den Raum.
»…funktionen unserer Regierung ohne Unterbrechungen fortgesetzt.«
Roberts drehte sich um und schaute zu. Travis stieß einen erleichterten Seufzer aus.
»Die Bundesagenturen in Washington werden derzeit evakuiert und in den nächsten Tagen an sicheren Orten ihren Dienst fortsetzen. Um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten, was für das kontinuierliche Funktionieren der Regierung wichtig ist, befehle ich außerdem die sofortige Evakuierung des Weißen Hauses.«
Überall im Raum wurde nach Luft geschnappt und gemurmelt. Gleichzeitig stießen mehrere Leute »Pssst!« hervor.
»Ruhe!«, rief jemand.
»Entschuldigung.« Travis wich durch die Menge zurück. »Mir ist schlecht.«
Die Leute machten bereitwillig Platz und sahen zu den Bildschirmen auf. Travis’ List wäre nicht mal nötig gewesen: Sie waren wie Schafe.
»… grässliche Untaten, begangen von Menschen, die einst unsere Familienangehörigen, Freunde und Nachbarn waren.«
Travis schloss die Tür hinter sich.
Eine Menschenschlange schob sich an ihm vorbei und schubste ihn beiseite. Aus den Augenwinkeln sah er den von stoischen Secret-Service-Männern flankierten Generalstaatsanwalt, dem bleiche Angestellte folgten, die Aktentaschen und Ordner an ihre Brust drückten.
Travis schloss sich ihnen an und warf einen Blick zurück zur Konferenzraumtür. Fielding, Roberts und die anderen lauschten offenbar weiterhin der Präsidentenrede. Er selbst brauchte sie nicht zu hören. Er hatte die Botschaft längst laut und deutlich vernommen: Macht euch vom Acker. Wir ziehen ab. Sechstausend Menschen waren für das Weiße Haus tätig. Travis hatte zwar keine Ahnung, wie viele sich nun im Gebäude aufhielten, aber es war eine Menge. Er wollte das Risiko nicht eingehen, hier zurückgelassen zu werden.
Ein großer Mann im Anzug mit einem Stöpsel im Ohr tauchte am Ende des Korridors auf und gab ihnen mit einem Wink zu verstehen, dass sie näherkommen sollten. »Die Treppe ist sauber«, bellte er. »Also los!«
Die Einheit lief schneller, doch plötzlich wurde sie von Leuten aus dem Tritt gebracht, die aus mehreren Büros in den Gang strömten. Alle hatten die gleiche Nachricht erhalten: Es wird evakuiert!
»Weiter«, sagte einer der Agenten und schob sich durch die Menge. »Macht Platz für den Generalstaatsanwalt, Leute.«
Travis versuchte, sich an ihn ranzuhängen, aber er wurde abgeblockt. Er stand nun am Ende einer langen Schlange, die den Gang füllte und langsam das Treppenhaus hinunterging. Hinter ihm kamen etwa dreißig Leute aus seiner Arbeitsgruppe. Ein großes Porträt Andrew Jacksons blickte ihn mit gerunzelter Stirn von der Wand herab an.
Die Schlange kam zum Halten. Die Angestellten klappten Laptops auf und telefonierten mit Mobiltelefonen. Menschen saßen auf Treppenstufen und brachten sich auf den neuesten Stand. Gerüchte machten die Runde.
Wir werden mit Hubschraubern ausgeflogen. Die Marine One ist schon in der Luft.
Der Präsident war schon weg.
Die Schlange bewegte sich weiter und hielt wieder an. Travis scharrte mit den Füßen. Er kam sich vor wie in einer Falle. Hinsichtlich der Evakuierung hatte er ein ungutes Gefühl. Er schaute sich die besorgten Mienen in seiner Umgebung an und fragte sich, ob die anderen dasselbe empfanden. Er löste seine Krawatte und bemühte sich, die in ihm aufkeimende Panik zu beherrschen.
Schließlich erreichten sie das Parterre und verließen das Gebäude. Erschöpft, weil sie Tag und Nacht an den mühseligen Entscheidungsfindungsprozessen des Weißen Hauses mitgearbeitet hatten, blinzelten Beamte, Bürokraten und Sekretärinnen den grauen Himmel an und hielten Ausschau nach der Sonne. Vor ihnen strömten weitere Menschen unter den wachsamen Blicken der mit automatischen Waffen ausgestatteten Marines zwischen den Bäumen her. Ein Scharfschütze auf dem Dach feuerte sein Gewehr mit einem plötzlichen Peng ab, was dazu führte, dass die Menge wie ein erschrockener Hirsch zusammenzuckte. Travis eilte hinter den anderen her und hustete in der heißen, rauchigen Luft, die nach verbrannten Chemikalien schmeckte. Er hatte sich die Apokalypse seit Tagen im Fernsehen angeschaut. Jetzt war er auf dem schnellsten Weg mitten hinein. Es war seltsam, aber er hatte angenommen, sich im sichersten Gebäude der Welt zu befinden.
Als die Bäume hinter ihm lagen, wurde er vom beruhigenden Anblick eines gewaltigen Chinook-Hubschraubers begrüßt, der auf dem großen Südrasen stand. Das metallische Schlagen der Rotoren konkurrierte mit dem Krachen von Schüssen. Die Luke war dicht. Travis blickte durch den am Himmel entlangtreibenden schwarzen Dunst. Hinter dem vertrauten Anblick des Washington-Monuments sah er die schwarzen Punkte eines fliehenden Hubschraubers. Ein anderer näherte sich.
Der Hubschrauber am Boden stieg in die feuchte Luft auf und setzte den Mob am Boden einem heißen Wind aus, der einen öligen Geruch mit sich brachte. Ein Aktenkoffer ging auf und ließ mehrere hundert Blatt Papier durch die Luft davonfliegen. Dies ist keine Evakuierung, dachte Travis. Es ist ein Zusammenbruch.
Der Secret Service winkte die Menge zurück. Die Lippen der Männer bewegten sich. Schon landete der nächste Hubschrauber – schwer und schnell. Travis drängte sich nach vorn und duckte sich unter den krachenden Schüssen der Scharfschützengewehre. Er war nun ziemlich nah dran. Wenn er jetzt nicht mitkam, dann halt beim nächsten Flug. Doch statt ihn zu beruhigen versetzte der Gedanke ihn noch mehr in Panik. Die Menschen in seiner Umgebung schrien fortwährend gegen das Brüllen der Rotoren und das Krachen der Uzis an und deuteten auf die Infizierten, die niedergeschossen wurden, sobald sie den Behelfszaun zu übersteigen versuchten, der die Landezone umgab.
»Macht schon!«, schrie er in den Lärm hinein.
Die Leute setzten sich erneut in Bewegung und bestiegen den Hubschrauber. Dann schlossen sich die Männer vom Secret Service zusammen und blockierten den Weg. Die Agenten riefen, der Hubschrauber sei voll. Wartet auf den nächsten.
Es hätte fast geklappt, dachte Travis. Er schaute zum Himmel hinter dem Washington-Monument auf und sah einen Hubschrauber verschwinden, ohne dass ein anderer zurückkam.
Jemand hat’s vermasselt. Es sind nicht genug Maschinen da, um alle auszufliegen.
Die lassen uns hier zurück, damit wir krepieren.
Von diesem Grauen angespornt, drängte er sich nach vorn, bis er genau vor einem Secret-Service-Mann stand. Die Menge wogte heran. Travis blickte plötzlich in die Mündung einer großen Pistole. Er war nur noch einen knappen Fingerdruck von seinem Ableben entfernt. Er suchte einen festen Stand, widersetzte sich dem Druck der sich gegen ihn pressenden Leiber und sah wütend auf die Waffe in der Hand des Agenten.
»Schießen Sie bloß nicht«, sagte er.
»Zurück«, sagte der Agent.
»Hören Sie«, sagte Travis. »Sie müssen mich in diesen Hubschrauber lassen.«
Der Gesichtsausdruck des großen Mannes blieb hinter dem Spiegelglas seiner Brille weiterhin unlesbar.
»Ich bin wissenschaftlicher Berater«, fügte Travis hinzu. »Der Präsident braucht mich. Verstehen Sie? Wenn Sie wollen, dass diese Sache aufhört, wird der Präsident mich an seiner Seite brauchen. Ich bin Wissenschaftler.«
Der Agent sagte nichts.
»Glauben Sie wirklich, mit Kugeln könnte man das aufhalten?«, sagte Travis verärgert und resigniert.
Der Agent runzelte die Stirn. Travis, der schon dachte, nun würde er erschossen, zuckte zusammen. Doch stattdessen drehte der Mann sich um, sprang in den Hubschrauber hinein, packte den Arm einer an der Tür sitzenden jungen Frau und zog sie von ihrem Sitz. Sie brach in Tränen aus, gehorchte aber brav und schaute, während die Mascara über ihre Wangen lief und sich Strähnen aus ihrem Haarknoten lösten, wie benommen auf die Menge. Die hin und her wogende Menge erwiderte ihren Blick in verzweifelter Panik. Der Agent sagte etwas. Die junge Frau schrie auf und wollte ihm ins Gesicht schlagen, doch er stieß sie hinaus. Die Menschen umschwärmten sie und versuchten, ihr zu helfen. Sie heulte weiter. Die Geräusche, die sie dabei machte, hätten Travis fast zum Kotzen gebracht.
Dann erst wurde ihm klar, was hier ablief.
»He, Moment mal«, sagte er.
Der Agent ließ seine Hand in Travis’ Achselhöhle gleiten und schob ihn der offenen Luke des Hubschraubers entgegen.
»Das können Sie doch nicht machen«, sagte Travis. »Sie müssen die Frau mitfliegen lassen!«
»Stellen Sie meine Geduld nicht auf die Probe«, sagte der Agent dicht an seinem Ohr.
Wenn du leben willst, lebe, schien er zu sagen. Wenn du sterben willst, stirb. Geh mir nicht auf den Senkel. Ich muss hier bleiben. Ich bin ohnehin tot, ich tue jetzt nur noch meine Pflicht.
Mit rotem Gesicht, da er sich zu Tode schämte, stieg Travis in den Hubschrauber und nahm den Platz der Frau ein. Er wich den Blicken der anderen Passagiere aus. Er spürte, dass ihn jemand anstarrte. Als er aufschaute, sah er John Fielding in die Augen.
Der Hubschrauber schwang sich in die Luft.
Travis schaute weg. Er spürte, dass Fieldings kalte graue Augen ihn eingehend musterten und kämpfte erneut gegen die Übelkeit an. Die Maschine legte sich während ihres langen Aufstiegs in die Kurve, sodass er durchs Fenster die von wirbelnden Trümmerstücken umgebene Menge sehen konnte. Ein Schluchzen durchfuhr ihn.
Ich will doch nur leben.
Der Hubschrauber wendete noch immer. Travis sah unter sich einen glänzend schwarzen Lincoln Town Car, auf dessen Motorhaube kleine Flaggen flatterten. Der Wagen wurde von einer Horde rennender Menschen verfolgt und näherte sich mit hoher Geschwindigkeit dem Südrasen. Irgendein hochrangiger Beamter oder Diplomat suchte eine Zuflucht. Kurz vor dem Zaun beschleunigte das Fahrzeug und bog, als die Secret-Service-Agenten das Feuer auf es eröffneten, scharf ab. Augenblicke später brach es durch den Zaun und hielt mit qualmenden Reifen zwischen den Bäumen an.
Die Infizierten strömten über den Rasen ins Feuer der Secret-Service-Männer hinein. Der Hubschrauber beendete das Wendemanöver und schnitt alles Weitere von Travis’ Blickfeld ab.
Erster Teil
Drei Wochen später,Typhus-Jody
RAY
Die Schlacht ist beendet. Die Masse der Sterbenden zuckt und schnauft.
Der Mann sitzt auf dem schartigen Rand der zerstörten sechsspurigen Brücke, die West Virginia und Ohio verbindet. Seine Beine baumeln in der Luft. Die alten Arbeitsstiefel fühlen sich an seinen schmerzenden Füßen schwer und heiß an. Ein warmer Wind ächzt über das Loch hinweg, reinigt die Luft vom Rauch und trocknet das geronnene Blut, das seinen Körper wie eine Kruste bedeckt. Zwanzig Meter unter ihm ist das Flussbett noch immer voller Leichen. Niemand wird diese Brücke je wieder überqueren. Vor einer knappen Stunde haben der Mann und sein Team mit mehreren Tonnen TNT ein riesiges Loch in den Boden gesprengt, um die Horden, die weiterhin aus den brennenden Ruinen Pittsburghs strömen, daran zu hindern, sich nach Westen zu ergießen, wo das FEMA-Flüchtlingslager 41 liegt, auch bekannt unter dem Namen Camp Defiance.
Genau wie die dreihundert Spartaner, denkt er mit einem heiseren Lachen und schirmt sein Metallfeuerzeug mit den Händen ab, um sich eine Zigarette anzuzünden. Camp Defiance ist gerettet. Später wird man Legenden über uns schreiben. Eine unglaubliche Sache, aber insgesamt betrachtet möchte ich lieber überleben.
Ray inhaliert und hustet. Seine Ohren klingeln noch von der Explosion. Zwölf Meter entfernt, auf der anderen Seite der zerstörten Brücke, schlagen die Infizierten mit Krallenhänden in die Luft und fauchen. Sie wollen ihm noch immer an den Hals. Früher waren sie Menschen, doch dann haben sie sich in Monstrositäten verwandelt, die von einer viralen Programmierung angetrieben werden, Menschen zu suchen, sie anzugreifen, zu überwältigen und zu infizieren. Ein übergewichtiger Mann im Anzug verliert den Halt und fällt mit einem Aufschrei in den Fluss. Ray blickt nach unten und denkt: Schon wieder einer vom Vorstand abgekratzt. Sein Blick verharrt auf dem Glitzern des Sonnenlichts auf der lehmigen Strömung, und er empfindet den Drang zu springen. Hinten auf der Brücke nimmt ein klotziger heulender Grobian in einer blutbefleckten Latzhose den Platz des Geschäftsmannes ein.
Irgendetwas verdeckt die Sonne. Trotz der Julihitze spürt Ray eine leichte Kälte im Rücken. Er zieht noch mal an seiner Zigarette und wirft sie dann in den Wind, bevor er die Augen zusammenkneift und die Frau anschaut, die vor ihm aufragt. Die Sonne umgibt sie mit einer Art Heiligenschein. Rays Rippen schmerzen. Eine Folge seiner Verletzung.
»Du bist bestimmt Anne«, sagt er und krümmt sich. »Oder?«
Die Frau nickt. Sie ist etwa eins fünfundsechzig groß und trägt ein schwarzes T-Shirt, das in ihrer dunkelblauen Jeans steckt. Zwei große Pistolen schmiegen sich in Holstern an ihre Rippen. Die schwarze Baseballkappe hat sie tief in die Stirn gezogen. Ihre Augen glitzern wie kalter Stahl. Ihr Gesicht ist von frischen Narben entstellt, die wie verschorfte Wunden über ihre Wangen laufen. An der rechten Schulter ihres T-Shirts befindet sich ein Aufnäher, der den Zweck hat, den Rückstoß ihres Scharfschützengewehrs zu absorbieren. Sie bewegt sich zwar wie ein Soldat, aber er kennt die Wahrheit, die besagt, dass Anne Leary noch vor knapp drei Wochen eine typische Vorstadt-Hausfrau mit drei kleinen Kindern war. Sie und ihre Leute sind am Ende der Schlacht aufgetaucht und haben genug Zeit für ihn und die seinen geschunden, um die Sprengung der Brücke durchzuführen.
Wäre der Lehrer-Eltern-Ausschuss ein Banditenheer, denkt Ray, würde sie da gut reinpassen. Und zwar als Anführer. »Todd hat dich erwähnt. Was macht der kleine Sack überhaupt?«
»Todd packt das schon«, sagt Anne.
»Wo ist er?«
»Im Bus. Schläft. Er weiß nichts.«
Ray nickt, dann fährt er mit der Hand über seinen Schnauzbart und seine Stoppeln. Ist auch besser so. »Er ist ein …« Beinahe hätte er gesagt, Todd sei ein besserer Mensch als er. Wahrscheinlich hätte er das sagen sollen. Der Bengel hat während der Schlacht wie ein Besessener gekämpft. »Er ist halt nur ’n dummer Junge. Kümmere dich um ihn.«
Anne zieht eine ihrer Waffen und klopft mit dem Lauf gegen ihren Oberschenkel. Ray runzelt die Stirn.
»So geht’s also aus«, sagt er.
»Es ist nur ’n Angebot.«
»Welcher Art genau?«
»Der Gnade.«
Ray lacht schnaubend. Anne kommt ihm gar nicht wie der gnädige Typ vor. Die Frau sieht ihn an, als wäre er nur ein Stück Holz. Sie weiß, dass er sich infiziert hat. Für sie ist er kein normales Lebewesen mehr. Sie sieht nur noch den Organismus in seinem Blut. Und er sieht in ihr nur ein kaltherziges Luder, das es kaum abwarten kann, ihm eine Kugel in den Kopf zu jagen.
Was andererseits aber wirklich eine Gnade wäre. Ray hat bestenfalls noch einige Stunden zu leben, die aber gewiss wahnsinnig schmerzhaft ausfallen und damit enden, dass das in seinem Inneren wachsende Ding ihn auffrisst.
Verglichen mit dem, was mir bevorsteht, wäre Knochenkrebs ein schöner Tod. Aber ein paar Stunden Schmerz sind auch ein Leben. Und leben ist noch immer besser als sterben.
»Das krieg ich also für das, was ich heute geleistet habe?«
Es ist ungerecht.
Anne zuckt die Achseln. Es spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Die einzige Heilung des Erregers ist der Tod. Die einzige Wahl, die man hat, wenn man überhaupt eine bekommt, ist die Frage, wie man abtritt.
»Ich möchte nicht sterben«, sagt Ray zu Anne.
»Du bist schon tot.«
In seinem Brustkorb brennt die Wut. Anne erinnert ihn an den Nachbarn, der seine Nase in alles reingesteckt hat und seiner Mutter immer wegen ihres bellenden Hundes auf den Keks gegangen ist. Der anständige Bürger, der ihm die Bullen auf den Hals gehetzt hat, weil er mal an einer Bushaltestelle auf einer Bank eingeschlafen ist. Ein Leben lang hat die Welt hinter ihm her genörgelt, und nun dies – die finale Beleidigung.
»Ja? Was ist mit Ethan? War er auch schon tot, als du ihn erschossen hast?«
Die Frau zuckt zusammen.
Ray empfindet einen kurzen Moment des Triumphs. Stimmt doch: Wenn es um einen Freund geht, erklärt man ihn weniger schnell für tot, Miss Hochnäsig. Der Augenblick vergeht, und Ray merkt, dass es ihn eigentlich nicht mehr kümmert. Er dreht sich um, nimmt den weiten blauen Himmel in Augenschein und erinnert sich an etwas, das Paul gesagt hat, der kettenrauchende Geistliche: Die Erde bleibt. Der Gedanke ruft eine angenehme Gleichgültigkeit in ihm hervor.
»Tu es, wenn du willst«, sagt er. »Ich kann dich nicht dran hindern. Und außerdem bin ich auch zu müde, um mich auch nur einen Dreck darum zu scheren.«
Tu es jetzt, betet er. Tu es, bevor mein verdammter Verstand sich verwandelt.
Ray spannt sich an und wartet auf den Schuss, der seinen Schädel zertrümmert. Der Himmel hat nie zuvor so blau ausgesehen. Der schlammige Fluss fließt tief unter seinen Füßen dahin. Vögel zirpen in fernen Bäumen. Die Erde bleibt: Er möchte den Gedanken halten und ihn zu seinem letzten machen, aber seine Kopfhaut fängt an zu jucken. Er kann das Metall der Kugel fast schmecken, die vorn aus seinem Gesicht austritt und seine Zähne mitreißt. Je mehr er daran denkt, umso mehr erfüllt es ihn mit sinnlos brüllendem Grauen. Gleich wird er ins Nichts eintreten.
Die Toten träumen nicht. Sie wissen nicht mal, dass sie tot sind. Zuerst sind sie Lebewesen, dann sind sie nichts. Nur noch Fleisch.
»Nein«, stöhnt er schluchzend.
Hinter ihm patschen Stiefel zwischen den Toten dahin. Anne verschwindet ohne ein Wort.
Ray atmet aus. Ihm wird bewusst, dass er gar nicht geatmet hat. Gnade, wie wahr. Er fragt sich, warum sie es nicht zu Ende gebracht hat, aber der Grund spielt keine Rolle mehr. Jetzt ist nur noch wichtig, dass er kaum noch Zeit hat. Zeit? Wofür? Er zieht noch eine Zigarette aus der zerknüllten Packung und steckt sie hustend an. Zeit genug für eine letzte Kippe. Komisch, früher hat er sich immer vor Lungenkrebs gefürchtet.
Schüsse werfen auf der Brücke Echos und lassen sein Herz in seinen Hals hinaufspringen. Die anderen, die sich infiziert haben, nehmen Annes Gnadenangebot an. Er hört, dass die restlichen Überlebenden ihren Kram und die Gefallenen auf die Laster laden. Sie lassen nicht zu, dass die Ungeheuer ihre Toten kriegen. Man wird sie an einem besonderen Ort bestatten, an dem sie niemand ausgraben und fressen kann.
Bald wird Ray allein mit den Hunderten von Infizierten sein, die sich noch immer am Rand der zerstörten Brücke sammeln und mit ausgestreckten Händen knurrend nach ihm greifen. Hinter ihnen ist der Horizont rauchgeschwärzt. Hitzewellen wogen zum Himmel auf, wo Pittsburgh langsam zu Grunde geht.
Alles befindet sich im Wandel.
Auch er wird bald zu etwas anderem werden.
Der Konvoi der schweren Fahrzeuge fährt ab. Ray wollte zwar, dass sie gehen, doch nun ist er müde und einsam. Um ihn herum haben die Sterbenden aufgehört sich zu bewegen und erstarren zu einer festen Masse. Es ist schwierig, in den Haufen aus zerrissenen und zerfleischten Leibern einzelne Menschen auszumachen. Ray sieht einen behaarten Unterarm mit einer teuren Armbanduhr und unterdrückt das Verlangen, sie einzustecken. Sie hat für ihn nun keinen Wert mehr, wenn man davon absieht, dass sie ihn daran erinnert, wie knapp seine Zeit ist.
Die Sonne steht niedrig. Heute Abend werden echte Ungeheuer eintreffen, die Nase in die Luft recken und die Toten fressen. Wenn sie kommen, möchte er anderswo sein. Sein Instinkt sagt ihm, dass er sich einen Platz suchen soll, um sich zusammenzurollen und zu sterben.
Ray arbeitet sich auf Händen und Füßen voran und keucht aufgrund der Schmerzen in seiner Seite. Die Einstichstelle ist so dick angeschwollen wie eine Pampelmuse, und etwas wartet dort geduldig darauf, geboren zu werden. Hinter ihm, auf der anderen Seite der zerrissenen Brücke, hören die Infizierten auf, zu zischen und mit den Händen durch die Luft zu fahren, und beginnen stattdessen zu stöhnen. Ray rappelt sich mit reiner Willenskraft auf, legt die Arme um seine pulsierenden Rippen und sieht, dass sie die Hände wie bittend nach ihm ausstrecken.
»Leckt mich doch«, sagt er. Er findet die maßlose Zurschaustellung ihrer Gier ebenso schlimm wie ihre ständige Wut.
In der Ferne trötet ein Ungeheuer wie ein Nebelhorn und erinnert ihn daran, dass nicht alle Kinder dieser Krankheit mit dem Gesicht eines Menschen herumlaufen.
Hau ab, warnen ihn seine Instinkte. Sogar jetzt gehorcht er seinem Überlebenswillen. Wenn der Moloch ihn findet, stampft er ihn zu Brei und saugt seinen Überresten das Blut aus.
Ray taumelt zwischen den Leichen umher und bemüht sich, auf den Beinen zu bleiben. Er findet ein am Boden liegendes Gewehr, hebt es auf, lugt durch das Zielfernrohr und zielt auf eine Frau, die mit den Fetzen eines Nachthemdes bekleidet ist. Ob es wohl noch funktioniert?
Gibt nur eine Möglichkeit, es rauszukriegen…
Das Gewehr erzeugt ein metallisches Krack. Der Hinterkopf der Frau explodiert und bespritzt die hinter ihr stehenden Infizierten mit rauchenden Knochenstückchen und Hirnmasse. Die Patronenhülse landet scheppernd auf dem Asphalt. Die Frau schlägt auf dem Boden auf, rollt mit verknoteten Gliedmaßen dahin und fällt in den Fluss.
»Das war für Ethan«, sagt Ray, der nun ganz sicher ist, das Gewehr des Lehrers gefunden zu haben. Er kannte den Mann zwar kaum, aber sie haben zusammen auf der Brücke gekämpft. Ethan ist infiziert worden, als er Ray und anderen Deckung gab, während sie sich zurückzogen, um die Ladungen hochgehen zu lassen, die die Brücke zerstörten.
Ray zieht das Magazin heraus und zählt drei Kugeln. Er hofft, dass sie ausreichen, um ihn nach Steubenville und in ein hübsches, weiches, sauberes Bett zu bringen, in das er sich legen kann, um zu sterben. Der Pulverdampf lässt ihn niesen, und er flucht, weil nun ein rasender Schmerz durch seinen Brustkorb zuckt.
»Ich mach euch alle kalt, ihr Sauhunde«, murmelt er.
Die Stimme seiner Mutter: Tu, was du für richtig hältst, Ray.
»Darauf kannste dich verlassen.«
Die Infizierten strecken die Hände nach ihm aus, sie stöhnend und jammern, und ihre Augen glitzern in der hereinbrechenden Dämmerung. Komm zurück, scheinen sie zu sagen. Geh noch nicht. Ray hustet und spuckt einen schwarzen Klumpen aus. Manchmal kann er ganz leicht vergessen, dass sie früher Durchschnittsmenschen waren. Dass sie geliebt wurden.
Der Ruf des Nebelhorns dröhnt, nun näher, über die tote Landschaft und schickt einen Adrenalinstoß durch seinen Kreislauf. Es wird Zeit. Abmarsch.
Ray geht los. Es ist nicht einfach, sich zu bewegen. Die rechte Seite seines Brustkorbes fühlt sich an, als steckte ein riesiger Angelhaken darin und jemand holte nun die Schnur ein. Das pampelmusengroße Krebsgeschwür pocht heiß und unbarmherzig und wächst weiter.
Ray trägt einen besonderen Stamm des Erregers in sich. Er ist nicht gebissen, sondern gestochen worden.
Einige Infizierte sehen nicht wie Menschen aus. Man kann sie nur als Ungeheuer bezeichnen. Eine besonders grässliche Form dieser Dinger, die wegen ihrer eigenartig geformten Beine, mit denen sie hohe Sprünge vollführen können, von den meisten Menschen Hopser genannt werden – oder auch Springer, Kobold, Troll und Buckelkäfer – hat ihn während der Schlacht um die Brücke gestochen. Ray malt sich aus, es Tyler Jones daheim im Camp Defiance zu erklären, wo er als Sergeant der Einheit 12 gearbeitet hat.
Tja, Tyler, stell dir mal ’n jaulenden haarlosen Affen von der Größe eines Schäferhundes vor, der ein neues Arschloch in dich reinreißt und es dann mit ’ner Spritze voller Säure fickt.
Und das war nur der Anfang. Das injizierte Zeug hat sofort angefangen, seine Zellen umzubauen, um einen neuen Hopser aus seiner Rippe herauswachsen zu lassen. Wie Adam damals Eva gemacht hat.
Herzlichen Glückwunsch, Ray. Du wirst Papa! Und wenn es dann geboren ist, frisst es das auf, was noch von dir übrig ist. Wenn es so weit ist, wirst du so ausgelaugt sein, dass du nur noch eins kannst: Zugucken.
Ist es wirklich wert, dafür zu überleben?
Ray taumelt schwer atmend von der Brücke und stiert mit leerem Blick zum Stadtrand von Steubenville: Mehrere weiße Gebäude, Häuser, Tankstellen, ferne Rauchsäulen und Kirchtürme unter einem sich verdunkelnden Himmel. Von hier aus zeigt die Stadt keine sichtbaren Narben der Epidemie. Keine rußgeschwärzten halb abgebrannten Eigenheime. Keine herrenlosen Fahrzeugwracks. Keine Leichenhaufen, die in der Hitze die Fliegen anziehen. Das einzig Seltsame ist die geisterhafte Stille und das Nichtvorhandensein lebendiger Menschen. Trotzdem fühlt Ray sich beobachtet. Die an Kraft verlierende Sommersonne wirft lange Schatten über das Antlitz der Geisterstadt. Ray humpelt die Straße entlang und passiert erloschene Verkehrsampeln. Tränen strömen über seine Wangen, da er sich von einem Überlebensdrang angetrieben fühlt, den er gar nicht mehr verstehen kann.
Mach’s gut, Sonne.
Das blaue Haus ruft ihn. Es erinnert ihn an das Haus seiner Mutter in Cashtown. Das Haus da, sagt er sich, ist ein guter Ort zum Sterben.
Ray versucht es an der Haustür. Abgeschlossen. Die Garage ist offen, doch die Tür, die von dort ins Haus führt, ist ebenfalls verschlossen. Er hinkt an die Seite des Hauses, stolpert über einen Gartenschlauch, der wie eine geduldige Schlange im hohen Gras liegt, und findet über einem verwilderten Blumenbeet ein offenes Fenster. Er braucht nur das Fliegengitter abzureißen und sich hinauf und hinein zu ziehen – was er in seiner langen Laufbahn als Arschloch mehr als einmal gemacht hat –, doch er fragt sich, ob er noch die Kraft dazu hat. Und als spürte es seinen Ehrgeiz, zerrt das Ungeheuer in seiner Seite an seinem Brustkorb und ermahnt ihn, bloß stehen zu bleiben.
Treib’s bloß nicht zu doll, Alter, glaubt er es sagen zu hören. Sonst saug ich einen deiner Lungenflügel durch deine Rippen.
»Halt doch deine doofe Schnauze«, erwidert Ray.
Er kehrt zur Garage zurück und schleift eine kurze Leiter heran, die er ans Fenster stellt. Doch selbst mit diesem Hilfsmittel kommt er nur langsam und unter Schmerzen voran. Als er sich vorsichtig auf den Küchenboden hinablässt, ist er schweißgebadet und hat dem Gewächs in seiner Seite eine eigenständige bösartige Persönlichkeit verliehen – mit der man im Gegensatz zu Gott nicht handeln kann.
Ray braucht Wasser. Aus dem Hahn an der Spüle kommt aber nur ein kurzes verstopftes Ächzen. Er beäugt argwöhnisch den Kühlschrank und beschließt, ihn nicht zu öffnen. Die Kühlschranktür ist mit Kinderzeichnungen, einem Einkaufszettel und einem Kalender bepflastert, auf den Termine und Kreuzchen gekritzelt sind, die bis zum Epidemieausbruch zurückreichen. Von diesem Tag an hat niemand mehr einen Terminkalender geführt.
»Verdammt noch mal.« Ray reibt sich die Augen. Er hat sein Gewehr draußen gelassen. Es lehnt an der Hauswand. Er hat sich wie der Idiot in einem Horrorfilm verhalten, bei dem die Zuschauer die Hände vors Gesicht schlagen. Seine Selbstmordoption ist hin. Sein Gesicht fühlt sich heiß an. Fieber. Sein Körper zittert, als die Energie ihn verlässt. Es ermüdet ihn schon, aufrecht zu stehen.
»Ray?«, ruft eine Stimme hinter der Wand. »Bist du nach Hause gekommen?«
»Wer ist da?«, flüstert Ray.
»Ray?«
»Wer du auch bist, mach keinen Scheiß.«
Ein geisterhafter Umriss schwebt aus dem düsteren Esszimmer heraus. Eine riesige Frau in einem weißen Nachthemd, ihr kurzes Haar vom Schlaf zerzaust.
Ray blinzelt. »Mama? Was machst du denn hier?«
»Ich bin ja so froh, dass du heimgekommen bist, Schätzchen.«
»Bist du ein Geist?«
Seine Mutter lacht. »Natürlich bin ich kein Geist.«
»Mama, was ich getan hab, errätst du nie.«
Seine Mutter sieht sich in der Küche um, ihre Stirn ist traurig gerunzelt. »Riecht es nicht staubig hier? Der Laden muss mal gereinigt werden. Ist ja alles verstaubt!«
»Ich bin jetzt bei der Polizei. Ein echter Cop.«
»Da hab ich ja wohl einiges zu tun. Hast du gerade gesagt, du bist Polizist?«
»Stimmt, Mama. Im Flüchtlingslager.«
»Ach«, sagt sie mit besorgter Miene. »Tja, tu, was du für richtig hältst.«
Rays Lächeln flaut ab. »Nee, Mama, hör mal: Wir haben gerade die Veterans Bridge in die Luft gejagt. Die Infizierten haben Pittsburgh wegen der Brände verlassen, und wir mussten die Brücke sprengen, damit sie nicht über den Fluss kommen und sich auf das Lager stürzen. Ich hab mich freiwillig gemeldet. Ich bin nur einer von wenigen, die es überlebt haben.«
»Ach«, sagt seine Mutter noch mal und streichelt seine Wange. »Tu, was du für richtig hältst, Ray.«
»Sag das doch nicht immer!«, brüllt Ray. Die Kreatur in seinem Inneren erwacht, dreht sich um und zerrt an seinen Organen. Der Schreck trifft ihn wie ein Blitzschlag. Ray erwacht auf dem Boden, er hat sich zu einem Ball zusammengerollt und schreit weiter. »Sag das bloß nicht noch mal!«
Mehrere monströse Nebelhörner blöken gleichzeitig draußen auf. Eins ist ziemlich nahe. Das Haus bebt unter den Vibrationen. Die Fensterscheiben wackeln in den Rahmen. Gläser und Teller rattern in den Küchenschränken. In der Ferne jault die Alarmanlage eines Autos auf.
Das Geschrei hat ihn zwar seine letzten Kräfte gekostet, aber auch das plötzliche Delirium beendet. Mama ist nicht hier. Sie wurde doch vor der Stadt in einem Massengrab beigesetzt. Mrs. Leona Young ist während der Brüllerei gestorben. Sie ertrank in der Badewanne, während Ray in seiner Bude im Souterrain schlief. Bei der Brüllerei kamen so viele Menschen um, dass niemand ihr ein ordentliches Begräbnis zuteil werden lassen konnte. Das Gesundheitsamt holte ihren Leichnam zur Entsorgung in einem Massengrab ab. Der Regierungsbezirk ließ die Gräber vor der Stadt ausheben. Die eingesetzten Arbeiter schafften es nicht, ihre drei Zentner zu heben, deswegen schleifte man sie auf ihrer Matratze aus dem Haus. Für die brauchen wir ’n tieferes Loch, ha, ha. Nicht mal im Tod war Leona Würde vergönnt.
»Gib mich nicht auf, Mama«, sagt Ray und verlässt kriechend die Küche.
Was immer er für das Beste gehalten hat, es war nie gut genug. Aber sie liebte ihn trotzdem. Und ihre Mutterliebe war vorbehaltlos, überbordend und vergeudet.
Das Sofa im Wohnzimmer sieht niedrig und einladend aus. Ray beginnt zähneknirschend seine Reise über den nach Staub riechenden Teppich, wobei er oft pausiert, um sich auszuruhen. Er versucht auszuspucken, doch sein Mund ist trocken. Vielleicht sollte ich einfach aufgeben. Was macht es schon aus, wo ich sterbe? Aber er schafft es. Auch wenn er vielleicht wie ein Hund gelebt hat: Er hat nicht die Absicht, wie ein Hund zu sterben. Er zieht seinen Leib auf das Sofa hinauf und setzt sich keuchend hin. Sein Gesicht brennt fiebrig, denn das Immunsystem führt Krieg gegen die Invasoren in seinem Blut. Draußen wird es nun schnell dunkel. Die Nacht senkt sich zum letzten Mal über Rays Welt. Zeit genug für ’ne letzte Kippe, und dann Gute Nacht und Alles Gute. Er klemmt die zerknitterte Zigarette zwischen seine Lippen, zündet sie an und schaut durchs Panoramafenster auf die leere Straße vor dem Haus.
Ray sieht sich um. Es überrascht ihn, dass er keinen Fernseher erblickt. Er bemerkt eine ungeöffnete Bierdose auf dem Beistelltisch, so offensichtlich, dass er sie zunächst nicht wahrgenommen hat, und blinzelt eine Träne fort.
»Fröhliche beschissene Weihnachten«, sagt er.
Er öffnet die Dose und riecht das Bier. Trinkt einen Schluck. Kippt ein wenig auf die Beule unter seinem Hemd.
»Schmeckt’s, du Drecksack?«
Als Antwort nur ein Pulsieren.
Das Gebräu ist warm, schmeckt leicht schal und ist zudem nicht seine Marke, aber es ist das beste Bier, das er im Leben je getrunken hat. Eine ungeöffnete Bierdose zu finden reicht fast aus, um ihn glauben zu lassen, dass es wirklich einen lieben und gnädigen Gott gibt. Nachdem er einige Schlucke getrunken hat, kippt er die Hälfte in sich hinein und rülpst.
Die Dose rutscht ihm aus der Hand und entleert sich schäumend auf den Teppich.
»Haut ab«, winselt er und schwenkt seinen unverletzten Arm. »Haut ab, verdammte Arschlöcher.«
An den Panoramafenstern stehen Scharen von Infizierten. Sie rühren sich nicht. Sie schauen mit dunklen Augen hinein, und ihr Atem beschlägt das Glas.
Warum greifen sie nicht an?
»Lasst mich in Ruhe«, schreit Ray. »Lasst mich einfach nur in Frieden sterben!«
Sind die überhaupt da oder hab ich wieder Halluzinationen?
Ray rollt sich auf dem Sofa zu einem Ball zusammen, schließt die Augen und drückt ein Kissen auf sein Gesicht.
Gott, sei mir gnädig, betet er. Lass sie mich nicht fressen.
Als er die Besinnung verliert, setzt die Veränderung ein.
Draußen in der Finsternis schreien die Infizierten und schlagen mit den Händen gegen die Fensterscheibe.
TODD
Der Konvoi plagt sich ohne Licht über die US Route 22 nach Westen und navigiert im Mondschein. Vorn im ramponierten gelben Schulbus, der die Kolonne anführt, schmiegt der Junge sich an Annes Schulter. Ihre Lederjacke hüllt ihn ein. Das Dröhnen des Motors lässt ihn vor sich hin dösen. Vor drei Wochen hat er auf der High School noch Arbeiten geschrieben und ist Schlägern aus dem Weg gegangen; jetzt ist er als Kämpfer schon ein Veteran in einem Krieg, der zwar gerade erst angefangen, ihn aber schon verändert hat. Einige andere Überlebende jammern in der Dunkelheit. Draußen erleiden die Infizierten ihre eigenen Schmerzen. Er kann sie zwischen den Bäumen heulen und ihre verlorene Welt beklagen hören, bis einer nach dem anderen vom Schlaf überwältigt wird.
An die Wärme von Annes Körper gedrückt, fühlt Todd sich sicher.
»Woher kommst du?«, flüstert er ihr zu.
Anne antwortet nicht. Todd fragt sich, ob er wirklich gesprochen oder seine Frage nur gedacht hat.
»Vom Umherstreifen auf der Erde und vom Umherwandeln auf ihr«, erwiderte Anne schließlich.
»Klingt wie ein Zitat. Von wem ist es?«
»Satan«, sagt Anne. Der Engel des Lichts, den man wegen Selbstüberschätzung aus dem Himmel geworfen hat.
Früher hat Todd gesagt, die Apokalypse hat mehr drauf als die High School, doch nun wird ihm klar, wie doof es ist, Menschen, die alles verloren haben, mit so einem Spruch zu kommen. Den größten Teil seines Lebens konnte er zwar mit Grips, aber wenig Erfahrung protzen; er hat die Erwachsenen um ihre natürliche Würde beneidet, weil die Zeit sie immer selbstbewusster werden ließ. Nun versteht er. Er spürt den Schmerz hinter Annes Antwort. Sie ist für ihn nun nicht mehr nur eine Mutterfigur. Sie ist eine Frau, die mit ihren eigenen Dämonen ringt.
»Warum hast du uns verlassen?«
Anne hat hart gekämpft, um Todd und die anderen zum Flüchtlingslager zu bringen und Pittsburgh im hinteren Teil eines Bradley-Kampfpanzers zu verlassen, um dann so schnell wieder zu verschwinden, wie sie es gefunden hatten.
»Meine Familie ist ums Leben gekommen«, sagt sie. »Und zwar meinetwegen. Ich schaff es nicht zurückzukommen.«
»Du bist doch zurückgekommen. Du hast uns an der Brücke gefunden.«
»Das war Zufall«, erwidert sie. »Ich bin da nur mit ein paar anderen Überlebenden vorbeigekommen. Ich bin jetzt ihr Schutzengel. Aber das meinte ich nicht.«
»Ich weiß, was du meinst«, haucht Todd.
Irgendetwas Großes kollidiert mit einem metallischen Rums mit dem Bus. Danach ertönen Schreie. Todd klammert sich mit großen Augen an Anne und schnappt nach Luft; seine Adern verwandeln sich in Drähte, die statt Blut elektrischen Strom transportieren. Das Ungeheuer schnaubt so grotesk laut wie ein Riesenschwein, und seine Hufe schlagen auf den Asphalt. Der Fahrer brüllt und tritt aufs Gas. Todd spürt das jähe Zerren der Schwerkraft, als der Bus einen Satz nach links macht. Die Hufe treffen den Bus seitlich und lassen das Fahrzeug beben. Der Junge vergräbt sein Gesicht in Annes Schulter und beißt in ihre Jacke. Dann bleibt das Ding zurück, die Hufe klappern, es kreischt in der Dunkelheit.
»Was ist mit mir?«, ruft er. »Schaff ich es zurückzukehren?«
Anne macht »Pssst« und streichelt ihm übers Haar, bis sein Atem sich beruhigt hat und das Herz nicht mehr in seinem Brustkorb hämmert. Alles in Ordnung, rufen die Stimmen im Dunkeln. Wir sind aus dem Schneider. Was ist mit den anderen? Die sind Gott sei Dank noch hinter uns. Jemand fragt: Was war das für ein Ding? Was war das? Niemand antwortet. Niemand spricht über die Ungeheuer. Wenn man über sie redet, verleiht man ihnen Kraft. Man fängt ein Gespräch an, wenn man zum Überlebenskampf bereit ist und beendet es, wenn man bereit ist aufzugeben. Als die Überlebenden im Finstern Zigaretten anzünden, riecht Todd Tabak. Während die anderen in ein unbehagliches Schweigen verfallen, erzählt Anne ihm in einem warmen Flüsterton dicht an seinem Ohr die Geschichte einer Frau, die eine einfache Hausfrau war – eine liebende Mutter, eine treue Ehefrau, eine respektierte Nachbarin –, die anfangs alles und dann plötzlich nichts mehr hatte. Als die Seuche zuschlug, weigerte sie sich anzuerkennen, was passierte. Sie schickte ihren Mann zu einem Botengang in den Sturm der Gewalt hinaus. Sie ließ ihre Kinder in der Obhut einer Nachbarin, um ihren Gatten zu suchen, bis ihr – zu spät – klar wurde, dass sie ihn dem Tod ausgeliefert hatte. Die Frau wollte dann selbst sterben, aber sie konnte ihren Überlebensinstinkt nicht besiegen. Und so hatte sie ihr Überleben zu einer Mission gemacht – einer Mission der Vergeltung.
Todd hört ihr genau zu und entspannt sich langsam. Doch er sagt nichts. Er fragt sie nicht, ob sie sich die Narben in ihrem Gesicht so zugezogen hat. Ihre Geschichte erscheint ihm logisch. Er hat zwei Wochen mit ihr im Heck eines Bradley-Kampfpanzers verbracht. Wäre der Virus Moby Dick, hätte sie die Wut eines Captain Ahab. Die meisten Menschen versuchen heutzutage nur durchzukommen, nur zu überleben. Anne jedoch führt Krieg. Ihr Gegner ist eine der winzigsten Lebensformen auf diesem Planeten.
»Hasst du sie deswegen so sehr?«, fragt Todd.
»Wen?«
»Na, die Infizierten.«
»Ich hasse sie nicht, Todd.«
»Na schön«, sagt er mit gerunzelter Stirn.
»Diese armen Leute, brauchen nur eins, Todd: Unser Mitgefühl.«
»Und warum bringst du sie dann so gern um?«
»Denkst du wirklich so?«
»Hm«, sagt er.
»Es ist nicht so, dass ich es genieße. Aber sie sind schon tot. In der Sekunde, in der der Bazillus sie übernimmt, hören sie auf Menschen zu sein. All das, was sie zum Menschen macht, stirbt. Wenn du mich fragst, sind sie nur noch wandelnde Tote. Ich töte keine Menschen. Ich töte den Virus, der sie steuert. Er ist mein Feind.«
Todd versteht nicht. Die Infizierten sind bösartig, ja, denkt er. Aber sie haben noch immer das Gesicht der Menschen, die wir lieben. Vielleicht ist in ihrem Inneren noch immer etwas von diesen Menschen erhalten. Selbst wenn sie sich nur noch im Traum an sich erinnern, macht sie das nicht trotzdem menschlich?
Als er Sheena X am Abend des Seuchenausbruchs in den Kopf geschossen hat, hat er keinen Virus getötet, sondern seine Freundin. Als Anne am Ende der Schlacht auf der Brücke Ethan exekutiert hat, wie konnte sie da den Menschen in ihm nicht sehen, sondern nur das ihn steuernde Virus?
»Gott sei Dank«, ruft der Fahrer den restlichen Überlebenden zu und schaltet die Scheinwerfer an. »Da ist das Lager! Wir haben es geschafft!«
Todd klammert sich noch fester an Anne. »Kommst du diesmal mit?«
»Für eine Weile«, erwidert sie.
»Kann ich bei dir bleiben?«
»Todd, sobald ich ein paar Dinge erledigt habe, bin ich wieder auf der Straße. Du weißt ja, wie es draußen ist. Da gibt es kein Leben. Es ist nichts für dich.«
Ich möchte in Sicherheit sein, möchte er ihr gern sagen, aber er weiß nicht, wie er seine Gefühle ausdrücken soll. Er weiß, dass er im Lager sicherer ist. Aber auf der Straße, in der Nähe seiner Ängste, fühlt er sich sicherer.
Auch nach allem, was er durchgemacht hat, spürt er schon jetzt, dass er hier draußen bleiben soll, zwischen den Ungeheuern.
Geh auf die Straße und bleib in Bewegung, dann kriegen sie dich nie.
Sarge fällt ihm ein, der kampfgestählte Kommandant des Bradley-Panzers, der bei der Einweisung in die Lagerordnung ausgerastet ist. Er hatte aufgehört sich zu bewegen, und das hat ihn fertig gemacht.
Sogar die Stärksten sind manchmal nicht stark genug, um gegen sich selbst zu bestehen.
Anne schüttelt den Kopf. »Na schön, Todd. Wenn du dich morgen noch immer nicht gut fühlst, such mich, und dann unterhalten wir uns.«
Todd nickt und setzt sich aufrecht hin. Er zieht die Nase hoch und wischt sich mit dem Handrücken über die Augen.
»Camp Defiance«, sagt der Fahrer und deutet nach vorn.
Das weit verzweigte Flüchtlingslager breitet sich vor ihnen aus. Die gezackten Behelfsmauern und Wachttürme werden vom warmen Licht der Suchscheinwerfer und vielen tausend Kochfeuern beleuchtet. Die milde Brise bringt die Geräusche einer jubelnden Menge mit sich. Da und dort hört man auch das Krachen von MG-Feuer. Der Geruch von Holzfeuern hängt in der Luft. Über ihnen dröhnen Hubschrauber am Abendhimmel.
Nach Hause, denkt Todd. Ich will nach Hause. Wo ist mein Zuhause?
Der Konvoi hält am Tor an und wirbelt Staub auf, der wie ein wütender Geist im Licht der Frontscheinwerfer tanzt. Auf der Mauer rattert ein Maschinengewehr. Leuchtspurmunition fegt auf ein fernes Wäldchen zu. Der Jubel wird lauter, er reagiert auf eine Stimme, die durch ein Megaphon quäkt. Der Basslauf eines Popsongs vibriert durch das Fahrzeug. Trotz der festlichen Atmosphäre strahlt das Lager abends die Atmosphäre einer Belagerung aus, die man nicht mehr lange durchhalten kann. Grelles weißes Licht überflutet den Bus und wird dann abgeblendet. Das Tor öffnet sich mit ratterndem Getriebe.
»Die Show geht los«, sagt Anne zu Todd und zwinkert ihm zu.
Todd lacht über den Insiderwitz. Das hat Sarge immer gesagt, bevor sie auf einen Raubzug gegangen sind.
»Willkommen in FEMAville, Anne«, sagt er.
Hier ist der Ort, für dessen Erhalt sie gerade gekämpft haben. Der Ort, für den Paul und Ethan gestorben sind.
Das Fahrzeug rollt aufs Gelände und hält an. Der Rest des Konvois bleibt hinter ihm stehen. Der Fahrer schaltet den Motor aus, öffnet die Tür und lässt die allgegenwärtigen Küchen- und Abwasserdüfte des Lagers ins Innere wehen. Von Mücken umschwärmte Glühbirnen, die an hölzernen Pfählen hängen, beleuchten die Umgebung. Ein an einem Pfahl befestigter, von einem Kabelgewirr umgebener Lautsprecher überträgt blecherne Musik: »We Will Rock You« von Queen. Todd lugt durchs Fenster hinaus und stutzt überrascht beim Anblick der jubelnden Menschen. Heilige Scheiße! Die jubeln ja unseretwegen!
Ein Offizier steigt in den Bus ein und unterhält sich mit dem Fahrer, der sich auf dem Sitz umdreht und auf Anne deutet. Der Offizier nähert sich ihr, stellt sich als Captain Mattis vor und bombardiert sie mit Fragen, obwohl man seine Stimme bei dem Tohuwabohu im Freien kaum verstehen kann: Lieutenant Patterson? Sergeant Hackett? Sergeant Wilson?
Tot, tot und am anderen Flussufer festgesetzt, erwidert Anne.
»Schade um Wilson.«
»Der schlägt sich schon durch«, sagt Anne. Sie weiß, dass Mattis den Verlust des Bradley-Kampfpanzers mehr bedauert als den seines Kommandanten.
»Und wer sind Sie?«
»War mit ein paar Leuten auf der Durchreise. Wir haben die Schießerei gehört und mitgemacht.« Sie deutet mit dem Kopf auf Todd. »Er hat’s geschafft. Dazu noch ein paar Ingenieure und Nationalgardisten. Das sind alle.«
»Das Unternehmen war aber ein Erfolg«, sagt Mattis.
Anne nickt. »Die Infizierten können die Brücke nicht mehr überqueren.«
»Hervorragend.«
»Ist man deswegen hier so aufgedreht?«
Der Captain seufzt. »Nicht nur. Die braven Bürger feiern, weil das Militär eingetroffen ist. Rings um die Flüchtlingslager an der Ostküste wurden Heereseinheiten abgesetzt. Da ist eine einzige Kompanie aufgetaucht, und jetzt glaubt alle Welt, in ein paar Tagen ist alles zu Ende und man kann nach Hause gehen.«
»Wird aber auch höchste Zeit, dass das Militär sich mal in die Bresche wirft«, sagt Anne.
Mattis lächelt und zuckt die Achseln. Mehr kann er als Soldat nicht sagen.
»Die Menschen im Lager wissen aber, was ihr geleistet habt«, fährt er fort. »Hier spricht man den ganzen Abend über von nichts anderem. Heute ist ein wunderbarer Tag.«
»Es ist der schlimmste Tag meines Lebens«, sagt Todd.
»Ihr habt uns alle gerettet«, sagt Mattis und hält ihnen eine Schachtel hin. »Ihr gebt den Menschen Hoffnung, junger Mann. Das ist eine wichtige Sache. Auf jeden Fall steht euch eine Bandschnalle zu.«
Anne hebt die Auszeichnung hoch und lacht, was Todd erschreckt, da er sie, seit sie sich kennen, noch nie hat lachen hören.
»Die gehört zu einer Hundeausstellung«, sagt sie.
»Für den besten in der jeweiligen Rasse, um genau zu sein«, gibt Mattis lächelnd zu.
Todd mustert die violettgoldenen Bänder, die er in der Hand hält. Er kriegt kaum ein Wort heraus; es ist aberwitzig. »Was ist das, verdammt noch mal?«, sagte er schließlich.
»Wir können euch nicht bezahlen. Wir haben überhaupt nichts, womit wir euch bezahlen können. Wir können nur eins tun: Euch Ehre erweisen. Jeder hier im Lager weiß, was ihr geleistet habt und dass ihr diese Bandschnallen tragt. Hier werden euch in den nächsten Wochen hundertdreißigtausend Menschen wie Helden behandeln. Ihr kriegt höhere Proviantrationen, dürft öfter duschen, und so weiter und so weiter.«
Anne nimmt ihm die Auszeichnung aus der Hand und heftet sie an Todds Hemd. Mattis tritt zurück und salutiert.
»Willkommen daheim, mein Sohn.«
Ein Überlebender nach dem anderen wankt aus dem Bus und wird von der jubelnden Menge willkommen geheißen. Sie drängen sich gerührt aneinander. Je lauter die Menschen applaudieren, umso mehr Überlebende fangen an zu weinen. Jemand pfeift. Todd zuckt zusammen. Er sieht fortwährend graue Gesichter aus der Menge hervorspringen. Gesichter von Infizierten, die nach seiner Kehle gieren und ihm virenverseuchte Spucke entgegenrotzen.
Nein, nein, nein, Todd, du bist viel zu jung, um so verkorkst zu sein, redet er sich ein. Und doch erfordert es seine gesamte Geisteskraft, nicht die Pistole zu zücken und um sich zu schießen.
»Wenn es dir morgen noch nicht besser geht, such mich«, sagt Anne. »Ich bin für dich da.«
»Warte mal«, sagt Todd und begutachtet die Menge. »Wo ist denn Ray Young?«
Er dreht sich um, doch Anne ist schon weg. Und Ray ist in dem Meer aus leer grinsenden Gesichtern nirgendwo zu finden. Jemand drückt Todd eine warme Bierdose in die Hand und sagt, er solle sie austrinken.
»Ray!«, ruft Todd.
Eine junge Frau löst sich aus der Menge. Todd erhascht einen Blick auf ihre blauen Augen und ihre zerzauste rote Mähne, dann nimmt sie sein Gesicht in die Hände und küsst ihn. Die Menge applaudiert und pfeift voller Herzlichkeit, und das Geräusch mischt sich mit dem Rauschen des Blutes in seinen Ohren.
»Erin«, keucht er. »Du?«
»Komm mit. Wir hauen ab.«
Sie nimmt seine Hand und führt ihn durch die tobende Menge. Leute klopfen Todd auf den Rücken und wollen ihm die Hand schütteln. Die Bierdose gibt er an jemanden weiter. Als sie das Ende der Menge erreicht haben, verschwinden sie in der Dunkelheit und orientieren sich am matten Licht der Feuerstellen. Erin scheint sich in diesem Irrgarten bestens auszukennen.
Todd kann sie beim Spaziergang riechen. Seine Hand wird in der ihren ganz heiß. Als sie durch die warme, feuchte Nacht spazieren, lehnt sie sich an ihn, und er spürt, dass ihre Brust sich an seinen Arm drückt. Ihm fällt ein, dass sie nie Büstenhalter trägt.
»Wohin gehen wir?«
»Ich bring dich nach Hause, Schätzchen.«
Todd fragt sich, ob er halluziniert. Er fühlt sich, als könnte er tagelang schlafen. Vor ein paar Stunden hat er noch im Sonnenschein auf der Brücke gestanden und nach seinen Freunden gerufen, als sie in einem grellweißen Blitz explodiert ist. Das Ungeheuer ist auf sie losgegangen: Ein Riesenbiest mit um sich schlagenden Tentakeln, das wie ein Nebelhorn geblökt hat. Ray und er standen zwischen zahllosen Toten und haben ihre Waffen auf das Mistvieh abgefeuert, bis es durch den Boden der Welt gefallen ist.
»Was ist denn, Schätzchen?«
Nun ist er wieder in Camp Defiance und wandert mit einem wunderschönen Geschöpf, von dem er geglaubt hat, er werde es nie wiedersehen, zwischen den Hütten umher.
Sie fragt noch mal, was mit ihm los ist.
»Ich weiß auch nicht«, sagt er.
»Du bist doch nicht verletzt, oder?«
»Ich glaub nicht.«
»Ich muss dich fragen, weil … es ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber du bist voller Blut.«
»Ach«, sagt Todd und berührt seinen Brustkorb. Sein Hemd ist so steif wie Pappe. Zwar schmerzt sein gesamter Körper, aber er glaubt nicht, dass er sich etwas gebrochen hat. »Ist mir wirklich nicht aufgefallen.«
»Außerdem riechst du nach Rauch und saurer Milch«, sagt Erin lachend. »Komm mit.«
Sie bringt ihn zu der kleinen Hütte und zündet zwei Kerzen an, in deren Licht er einen Eimer Wasser und einen Stapel Handtücher auf einer Decke sieht.
»Raus aus den Klamotten«, sagt sie.
»Außer denen hab ich nichts mehr«, sagt Todd. »Alles andere, was mir gehört hat, hast du doch schon.«
»Tu, was ich sage, Alter.«
Todd gehorcht. Er schält sich aus seinem schmutzigen Hemd und wirft es in die Ecke. Dann folgen Stiefel, Socken, Hosen. Nichts davon hat ein Weiterleben verdient. Er wird alles verbrennen und sich was anderes suchen müssen. Zuletzt legt er seinen Waffengurt und die Pistole auf den Stapel.
»Jetzt leg dich hin.«
Todd streckt seinen langen sehnigen Körper auf der Decke aus. Erin taucht einen Schwamm in den schaumigen Eimer, wringt ihn aus und reibt Todd sanft ab. Welch göttliches Gefühl.
»Wieso bist du wieder zu mir gekommen?«, fragt er sie. »Du hast mir wirklich wehgetan.«
Todd ist mit einem Sack voller gleichstrombetriebener Elektrogeräte im Lager angekommen und hat gehofft, er könne sie als Kapital einsetzen, um sich als Kaufmann zu etablieren. Erin hat ihn verführt, reingelegt und beklaut. Weil ihm nach diesem Vertrauensbruch ganz übel war, hat er Sarge und Wendy aufgesucht und sich freiwillig zum Unternehmen Brückensprengung gemeldet.
»Was ich dir angetan habe, tut mir leid«, sagt Erin. Tränen zeigen sich in ihren Augen. »Ich wusste es nicht. Was du getan hast … Dass du zu der Brücke gefahren bist … Du bist ein toller Junge. Ich habe wirklich gehofft, dass du lebendig zurückkehrst.«
»Meine Freunde sind tot«, sagt Todd.
»Erzähl mir davon.« Erin zieht sich ihr Hemd über den Kopf. »Erzähl mir alles.«
Die Infizierten kreischen auf ihn herab und treten und kratzen ihn mit wutverzerrten Gesichtern. Das Gewehr brüllt auf, und sie explodieren in einem Schauer aus Blut und qualmenden Gedärmen.
Die tiefe Stimme dröhnt: »Fasst den Jungen nicht an!«
Er öffnet die Augen. Paul, der alte Pastor, ragt über ihm auf, lädt nach und feuert erneut. Die Infizierten quieken und sacken einer nach dem anderen unter den Schüssen zusammen.
»Ich hab gesagt, ihr sollt den Jungen nicht anfassen!«
WUMM. Nachladen. WUMM. Körper fallen stapelweise auf die blutverschmierte Fahrbahn.
Der Junge schaut durch einen heißen Tränenschleier zu dem Pastor auf. Das graue Gesicht des Mannes wirkt finster und riesengroß. Er nimmt die Hand des Jungen in die seine, und in seinem Blick brennen Besorgnis und Liebe.
»Du bist jetzt in Sicherheit, Junge. Ich bring dich hier raus.«
Ein Grollen erfüllt die Luft. Das Ungeheuer erzeugt es tief in seiner Kehle. Der Junge spürt es in seinem Brustkorb. Der Pastor keucht auf, in seinen Augen: plötzliches Wissen.
»Alles in Ordnung, Pastor?«
Der Geistliche lächelt traurig.
»Gott segne dich, Kleiner…«
Paul wird zehn Meter hoch in die Luft und in ein kauendes Maul gerissen.
Todd schreit auf.
»Ist ja gut, ist ja gut«, sagt die junge Frau und zieht ihn von hinten an sich.
Todd sitzt nackt auf dem Boden seiner Hütte, schlingt die Arme um die Knie und schreit.
»Du hast nur geträumt«, sagt Erin. »Es war nur ein Traum. Es ist nichts passiert. Schau dich um. Es ist alles in Ordnung.«
Todd hält inne, schnappt nach Luft. Rotz und Tränen laufen über sein Gesicht. Seine Haut ist glitschig, weil er so schwitzt, und Erins Leib an seinem Rücken fühlt sich an wie Feuer. Sonnenlicht fällt durch Wandritzen und erhellt den Staub. In der kleinen Hütte ist es wie in einem Backofen.
»Was hast du geträumt?«, fragt Erin.
»Jemand hat mich gerettet«, sagt Todd heiser. Er erkennt kaum seine eigene Stimme und wischt sich den Schweiß mit der Hand vom Gesicht.
»Das klingt doch nach einem guten Traum.«
Todds Gesichtsmuskeln zucken. Es fällt ihm auf.
»Nicht für den, der mich gerettet hat.«
Todd versucht aufzustehen, setzt sich aber mit grimmiger Miene wieder hin. Sämtliche Muskeln seines Körpers sind steif und schmerzen. Seine Lunge verkrampft sich von dem Rauch, den er während der Schlacht auf der Brücke eingeatmet hat. Als er atmen will, hustet er laut und fest in die hohle Hand. Seine Kehle fühlt sich an, als wäre sie vom Rauch und vom Geschrei wund.





























