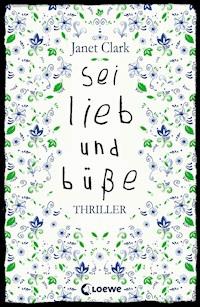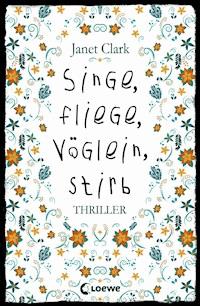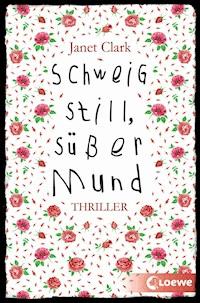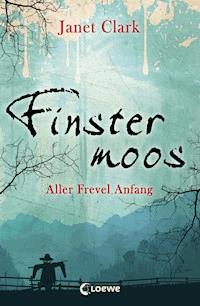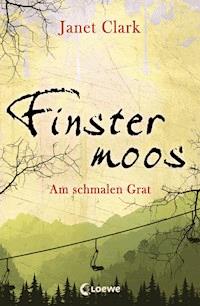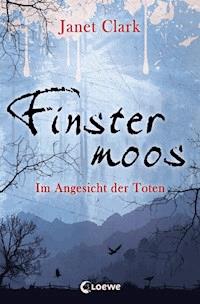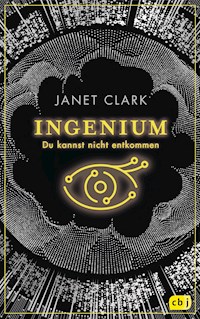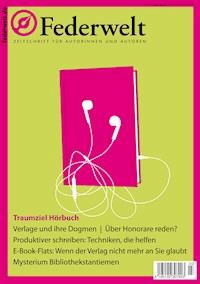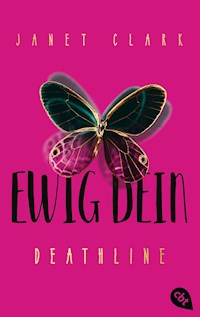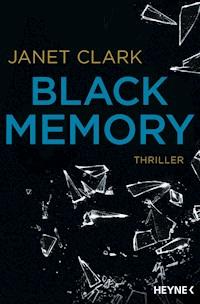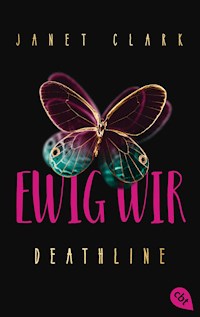
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Deathline-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe so unendlich wie das Universum
Nachdem die 16-jährige Josie einen schicksalhaften Sommer lang ihre große Liebe in dem faszinierenden jungen Indianer Ray finden durfte, muss sie nun herausfinden, ob ihre Liebe wirklich stärker ist als der Tod. Denn Ray ist über die magische Deathline gegangen, um seinen Stamm und Josies Welt vor dem Verderben zu retten. Doch die mysteriösen Ereignisse in Josies Heimatstädtchen reißen nicht ab und sie versucht verzweifelt, Kontakt zu Ray aufzunehmen. Denn wenn ihr dies nicht gelingt, ist nicht nur ihr Zuhause dem Untergang geweiht, sondern auch ihre Liebe zu Ray ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Für Hanni,weltbeste Schwägerin und treueste Testleserin, mit der besonderen Gabe, genau zu erspüren, wann eine Autorin eine Runde Joggen und wann ein gemeinsames Glas Wein benötigt.
UNGLAUBLICH. SO HAT MEINE FREUNDIN Dana unsere letzten Wochen beschrieben. Das stimmt zwar, aber ich würde noch einige Worte hinzufügen. Lebensverändernd. Augenöffnend. Erschütternd. Gefährlich.
Oder wie würdet ihr es beschreiben, wenn ihr euch Hals über Kopf in einen geheimnisvollen Typen verliebt und dann herausfindet, dass er bereits tot ist und langsam zum Dämon wird?
Denn genau so war es mit Ray. Liebe auf den ersten Blick. Auch, wenn ich zuerst natürlich noch nicht wusste, dass er meine große Liebe ist.
Zunächst war ich einfach nur glücklich, als mein Bruder Patrick Ray als Sommeraushilfe auf der Ranch eingestellt hatte, obwohl Dad seit Mums Tod eigentlich keine Yowama, zu deren Stamm Ray gehörte, auf der Ranch duldete.
Klar, dass ich so viel Zeit wie möglich mit Ray verbrachte, zumal er, wie alle Yowama, extrem gut mit Pferden umgehen kann und mir unglaubliche Dinge beigebracht hat. Kurz: Es hätte der Sommer aller Sommer werden können …
Wurde es aber nicht.
Denn plötzlich geschahen seltsame Dinge in meinem Heimatort. Mysteriöse Schatten tauchten auf und ständig spielten elektrische Geräte verrückt. Und niemand, nicht einmal unser Freund Gabriel, der sonst für alles eine Erklärung parat hatte, konnte erklären, warum.
Bis zu dem Moment, als im wahrsten Sinne des Wortes die Bombe hochging, Ray mein Leben rettete und ich herausfand, was hinter den seltsamen Vorkommnissen steckte: Ray war ermordet worden, und sein magisches Amulett geraubt, mit dem er nach seinem Tod die Deathline hätte überschreiten sollen. Ihm blieben nur 24 Tage, um sein Amulett zu finden und die Deathline zu überqueren. Oder er würde für immer zum Dämon werden, so wie die Schatten, die in der Gegend ihr Unwesen trieben.
Erst war ich total geschockt. Dann unfassbar wütend. Ich musste Ray einfach helfen, seinen Mörder und das Amulett zu finden – was allerdings Dana und mich fast das Leben gekostet hätte. Wäre nicht Mike, unser Hufschmied, rechtzeitig auf der verlassenen Farroway Farm aufgetaucht, wo er in letzter Sekunde Rays Mörder, Marcus Dowby, erschoss, um uns zu retten.
Kurz darauf habe ich Rays Amulett gefunden und durfte ihn zum Abschiednehmen ins Reservat begleiten.
Es war wunderschön. Sogar der Abschied. Ray versprach mir, dass unsere Liebe über den Tod hinaus bestehen bleibt. Ich wusste zuerst nicht, was er damit meinte, aber kaum war er über die Deathline verschwunden, konnte ich Ray so intensiv spüren, als wäre er bei mir. So wie er es versprochen hatte: Ewig dein.
Und deshalb IST unsere Geschichte noch lange nicht zu Ende …
RAYS GRÜN-GRÜNE AUGEN strahlten mich an, sein Mund öffnete sich zu einem breiten Lächeln und offenbarte die winzige Zahnlücke zwischen seinen Schneidezähnen. »Ewig dein, sage es, Josie.«
»Ewig dein«, flüsterte ich, und trat einen Schritt näher. Ray streckte den Arm nach mir aus, nahm meine Hand und zog mich an sich. Langsam senkte er sein Gesicht, seine Lippen an meinem Ohr. »Ich liebe dich, Rodeo Girl. Wir sind zwei Hälften eines Ganzen. Vergiss das nie.« Ich nickte, so zaghaft wie das Spiel der Blätter im sachten Wind. Seine Lippen suchten meinen Mund. Mein Herz schlug unregelmäßig. Schnell. Ich spürte jeden einzelnen Schlag …
… doch es war das Einzige was ich spürte. Ich wartete. So wie gestern. Und vorgestern. Und den Tag davor. Doch ich spürte Ray nicht.
Nur mein Herz, das langsam wieder zu seinem normalen Rhythmus zurückfand.
Verdammt! Was war nur los?
Das Bild von Ray verflog wie eine Fata Morgana und ich schlug den tief herabhängenden Ast neben mir frustriert zur Seite.
Warum spürte ich ihn nicht mehr so, wie in den ersten zwölf Tagen, nachdem er die Deathline überquert hatte? Lag es daran, dass ich mit Dana, Gabriel und Patrick auf einer Insel Urlaub machte, die zu weit vom Reservat entfernt war? Durfte ich einen bestimmten Umkreis nicht für länger als ein paar Tage verlassen?
Ich zupfte ein von feinen Äderchen durchzogenes Blatt von dem Baum neben mir. Eine Woche Sand und Meer. Es war Gabriels Vorschlag gewesen, um die Ereignisse in Angels Keep hinter uns zu lassen. Um auf andere Gedanken zu kommen. Was auch funktioniert hatte – für Dana und Patrick, die jetzt ein Paar waren, für Gabriel, der uns von morgens bis abends mit seinem minutiös durchgeplanten Ferienprogramm auf Trab hielt, und am Anfang auch für mich. Solange Ray mir jeden kleinsten Anflug von Einsamkeit oder Verzweiflung spürbar aus dem Gesicht gestreichelt hatte.
Natürlich wusste ich, dass Ray nicht wirklich hier war. Aber damit konnte ich umgehen, solange ich seine Anwesenheit so intensiv gespürt hatte, als stünde er direkt neben mir. Jetzt dagegen erschien er nur noch vor meinem inneren Auge – wie ein Ausschnitt aus einem vertrauten Film.
Warum?
Ich zerfetzte das Blatt in winzige grüne Teilchen und ließ sie vor mir auf den Boden rieseln. Mit einem Mal hatte ich das dringende Bedürfnis, zur Ranch zurückzufahren. Jetzt. Sofort. Zu den Kwaohibäumen mit ihrer einzigartigen Magie. Zu meinem Kwaohibaum, der Rays und meine Haarsträhnen in seiner Rinde verborgen hielt. Abrupt tauchte ich im Schatten der Bäume unter und bahnte mir einen Weg durch das kräftige Grün des dichten Geästs.
Blätter strichen mir übers Gesicht, und wie sehr ich auch aufpasste, die Dornen der wild wachsenden Büsche kratzten über meine nackten Beine und hinterließen rote, pochende Striemen. Trotzdem ging ich weiter und weiter, immer bergauf, folgte dem Licht, das schwach durch die Baumkronen schien. Nur ein einziges Mal noch blieb ich stehen und ließ meinen Blick über die Bäume um mich herum wandern. Dicht und dunkel beherrschten sie den Großteil der Insel und waren doch bloß gewöhnlich, ohne den geringsten Hauch der Magie, die unsere Kwaohibäume so besonders machte.
Dann lief ich weiter. Ohne Ziel, ohne Plan, einfach geradeaus durch das wilde, grüne, lichtarme Baummeer. Mit jedem Schritt veränderte sich das Licht, wurde heller und heller, bis ich schließlich aus dem Wald heraustrat und vor mir das Hochplateau lag.
Außer Atem setzte ich mich auf einen Felsbrocken. Die noch milde Morgensonne schien mir ins Gesicht und ich genoss die Wärme nach dem sonnenlosen Marsch durch den deutlich kühleren Wald. Ich beugte mich vor und fuhr über die roten Striemen an meinen Beinen. Sie brannten, aber nicht so sehr, dass ich meinen Marsch durch den Wald bereut hätte. Einfach, weil es hier oben so unglaublich friedlich war. Ich lauschte dem gleichmäßigen Schwappen der Wellen, die sich am Fuß der Klippen brachen. Und je länger ich lauschte, desto klarer hörte ich es.
Jo-sie.
Wieder und wieder, im Rhythmus der Brandung. Als riefe sie mich.
Jo-sie. Jo-sie. Jo-sie.
Eigentlich hätte der Ruf der Brandung mich ängstigen müssen. Zumindest verwundern. Aber ich hörte nur meinen Namen. Wie verzaubert stand ich von dem Felsbrocken auf und wischte mechanisch die winzigen Steinchen weg, die an meinen Shorts hängen geblieben waren. Der Boden war uneben, mal Fels, mal Stein, mal Gras, doch ich achtete nicht auf die unzähligen Stolperfallen. Ich starrte aufs Meer und steuerte die Klippen an. Langsam. Als dirigierte nicht ich, sondern der Ruf der Wellen meine Bewegungen.
Jo-sie. Jo-sie.
Dann stand ich am äußersten Rand. Mein Blick wanderte über das Wasser, über die verschiedenen Schattierungen, die die Tiefe des Meeres verrieten. Vom dunkelsten Blau bis zum hellsten Türkis, kleine und große Flecken, die zu einem bunten Muster verschmolzen.
Nur ein Fleck hob sich deutlich von dem Farbteppich ab.
Ich sah genauer hin. Verengte die Augen, fixierte ungläubig die besonders silbrig schillernde Stelle. Es gab keinen Zweifel.
Vor mir, etwa dreißig Meter vom Ufer entfernt, schimmerte ein grünblaues Herz durch die Wasseroberfläche.
Ein Herz.
War das Ray?
Schickte er mir ein Zeichen?
Mein Puls schoss in die Höhe. Ich blickte mich um, sah wieder hinab aufs Meer. Das Herz war immer noch da.
Hatte Ray mich zu den Klippen gelockt, um es mir zu zeigen? Vom Strand aus hätte ich das Herz nicht sehen können.
»Ray?«, rief ich, die Hände wie einen Trichter um den Mund gelegt.
»Josie!«, gellte da Patricks Stimme hinter mir. »Nein! Tu’s nicht!«
Irritiert drehte ich mich um, doch die Bewegung war zu hastig und ich zu nah am Abgrund. Ich verlor das Gleichgewicht, rutschte mit einem Fuß ab, ruderte wild mit den Armen.
Scheiße, schoss es mir durch den Kopf, was sicher keine Chance in den Top Ten der Famous Last Words haben würde.
Dann spürte ich einen Ruck, hörte ein Ratschen und stolperte Patrick entgegen. Er war kreidebleich. Seine Hand, die sich in den Stoff meines T-Shirts krallte, zitterte unkontrolliert, ebenso seine Lippen. Er umschlang mich mit beiden Armen, drückte mich kurz an sich und trat gleich darauf einen Schritt zurück. »Mach das nie, nie wieder«, sagte er rau. »Ray ist weg, und so schwer es jetzt für dich ist, du wirst genauso darüber hinwegkommen, wie wir über Mums Tod.«
»Sag mal, spinnst du?!« Eine Welle der Empörung spülte den Schock hinweg, der mich hatte erstarren lassen. Mein Bruder dachte, ich wollte mich in die Tiefe stürzen! »Wie kannst du glauben, dass ich Dad und dir das antun würde? Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben!«
»Aber …« Er sah betreten zu Boden.
Ich stemmte meine Arme in die Hüften. »Was machst du überhaupt hier oben?«
»Ich hab dich gerufen und du bist einfach in den Wald gelaufen! Da bin ich dir gefolgt.«
»Ich auch.« Dana trat auf das Plateau und ließ sich schnaufend auf dem Felsbrocken nieder.
»Du auch?« Ich starrte sie mit großen Augen an. Dass mein Bruder zu Überreaktionen neigte, war ich gewohnt, aber Dana …
»Du benimmst dich wie dein Vater letztes Jahr«, fuhr Dana fort. »Ziehst dich zurück und redest mehr mit dir selbst als mit uns!«
»Ich rede mit Ray, nicht mit mir selbst –«
»Sorry, aber dass du dir einbildest, Ray könnte dich hören, macht es nicht besser«, beharrte Dana.
Dass du dir einbildest, Ray könnte dich hören …
Ich schluckte. Ohne es zu wissen, hatte Dana genau den Punkt getroffen, an dem ich gerade am verwundbarsten war. Einbilden. War das so? Bildete ich mir nur ein, dass Ray und mich noch immer etwas Besonderes verband?
Nein!
Ray hatte mich an diesen Ort geführt und mir das Herz gezeigt. Damit ich wusste, dass er bei mir war. Und ich konnte es Dana und Patrick beweisen. Hier und jetzt.
»Josie«, sagte Patrick in diesem vorsichtig-sanften Ton, den ich so gut bei ihm kannte. Der gleiche, mit dem er an den schlimmsten Tagen unseren Vater zu überzeugen versucht hatte, die Flasche stehen zu lassen und wieder am Leben teilzunehmen. Ich hasste diesen Ton, weil ich alles hasste, was damit an Erinnerungen zusammenhing, und ärgerte mich, dass er ihn jetzt mir gegenüber anschlug. Ich hatte nicht vorgehabt, mich umzubringen. Nicht einmal eine Tausendstel Sekunde lang war mir dieser Gedanke gekommen.
»Josie«, sagte Patrick noch einmal. »Wir wissen beide, dass Ray nicht zurückkommen wird. Und egal, was du tust, du wirst auch niemals zu ihm gelangen.«
BANG.
Als hätten Dana und er sich abgesprochen. Noch ein Treffer auf denselben wunden Punkt. Es war genau das, was ich nicht hören wollte. Kurz verfluchte ich mich dafür, Patrick in Rays Geheimnis eingeweiht zu haben. Ich hätte es bei der offiziellen Version belassen sollen, die ich meinem Vater aufgetischt hatte: Ray war zurück ins Reservat gegangen. Hätte. Hatte ich aber nicht. Patrick wusste alles, und jetzt stand er vor mir und trampelte auf meiner eh schon schmerzhaft komplizierten Beziehung zu Ray herum.
»Ich weiß nicht, ob es diese Deathline gibt, über die Ray gegangen ist«, sagte Patrick und warf mir einen unsicheren Blick zu, gerade so als befürchte er, ich würde bei einem falschen Wort mit Anlauf von der Klippe springen. »Aber, wenn es … sie gibt, dann ist das für ihn eine … eine Einbahnstraße und für dich, äh … für dich … Sperrgebiet.«
»Du kannst nicht zu ihm und er nicht zu dir«, fasste Dana Patricks Gestammel zusammen.
»Sag ich doch.« Patrick warf ihr einen irritierten Blick zu. »Du musst loslassen. Du kannst nicht den Rest deines Lebens einen … einen …«
»… Geist lieben.« Dana erhob sich von dem Felsbrocken. »Sorry, Sweety, aber Patrick hat recht. Du bist ein Mensch, er ein Geist. Passt nicht. Funktioniert nicht. Und, mal ehrlich, so gut kann niemand küssen, dass die Erinnerung daran für die Ewigkeit reicht.«
Autsch. Ich wusste, sie wollten mich nicht verletzten. Sie glaubten, mir zu helfen, weil sie nicht verstanden, was Ray und mich verband. Weil sie nicht begriffen, dass meine Gespräche mit Ray keine Wahnvorstellungen waren, sondern mir das Gefühl gaben, ihm nah zu sein – auch wenn er mir nicht antwortete.
»Okay.« Ich winkte Dana zu mir. »Ich war hier oben, weil Ray mich hierher geführt hat …« Dana schüttelte den Kopf, doch ich fuhr unbeirrt fort. »Ich bin ohne jeden Plan hier hoch und dann habe ich dieses Herz im Meer gesehen. Es ist ein Zeichen von Ray!«
Dana zog ungläubig die Brauen hoch. »Das Herz …«
»Schau selbst. Vom Strand aus kann man es nicht sehen.« Ich nahm ihre Hand und ging mit ihr zur Klippe zurück. »Das blaugrüne –« Das Wort Herz schaffte es nicht mehr über meine Lippen – denn es war weit und breit kein Herz mehr zu sehen. Eine Verfärbung. Ja. Ein blaugrüner Fleck. Ja. Aber er hatte definitiv keine Herzform. Nicht einmal annähernd. Doch das konnte nicht sein. Diese Farben hatten etwas mit der Beschaffenheit und Tiefe des Meeresbodens zu tun, und der veränderte sich nicht innerhalb weniger Minuten. Unverwandt starrte ich aufs Meer. Auf den Fleck.
Kein Herz.
Dana und Patrick mussten nichts sagen. Ich wusste genau, was sie dachten: Josie verkraftet Rays Tod nicht. Josie sieht Gespenster. Und, wenn ich ganz ehrlich bin, dachte ich genau das in dem Moment auch. Ich zweifelte an mir und meinem Verstand.
Wie sollte ich noch wissen, was echt war und was nicht?
»WEISST DU, WO DIE TURTELTÄUBCHEN hin sind?« Gabriel steckte den Kopf in mein Zelt. »Mal ganz ehrlich, soooo lange kann man doch nicht brauchen, um Feuerholz zu sammeln, oder?«
Ich sah von meinem Rucksack hoch.
»Du packst?« Nun krabbelte er ganz ins Zelt und setzte sich auf meine Isomatte. »Wir fahren doch erst morgen Nachmittag!«
Ich senkte meinen Kopf, um Gabriel nicht ansehen zu müssen und rollte das nächste T-Shirt zusammen wie eine Presswurst.
»Gefällt es dir hier nicht?«
»Doch, klar.« Ich hielt meinen Kopf gesenkt, denn ich wusste nicht, wie ich Gabriel erklären sollte, was ich selbst nicht verstand. Ich wusste nur, dass in mir der Wunsch, zur Ranch zurückzufahren, mit jeder Minute drängender wurde.
»Hat es was mit diesem Herz zu tun, das es gar nicht gab?«
Ich nickte und sah von dem T-Shirt hoch in Gabriels forschende Augen. Er schob den Rucksack zur Seite und rutschte näher zu mir. Dann spürte ich seinen Arm um meine Schultern.
»Ich glaube dir, dass dort ein Herz gewesen ist.«
»Wirklich?« Ich sah ihm in die Augen.
Gabriel lächelte. »Klar. Ich könnte mir vorstellen, dass so was eine relativ leichte Übung ist für jemanden, der von den Toten auferstehen kann.«
»Dann … du glaubst also an Ray und mich?«
Gabriel nahm seinen Arm von meiner Schulter und starrte nachdenklich auf meinen Rucksack. »Ich …« Er seufzte. »Ich weiß nicht, was ich glaube, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie das mit Ray und dir funktionieren soll.«
Mechanisch rollte ich das T-Shirt, das sich im Zeitlupentempo entfaltete, erneut zusammen. Gabriel dachte also das Gleiche wie Dana und Patrick.
»Du bist meine liebste Freundin«, sagte Gabriel sanft, »und ich habe keinen Zweifel daran, dass Ray Dinge tun kann, die uns wie Zauberei vorkommen. Aber …« Er seufzte erneut. »Du kannst das nicht, Josie. Und solange du an Ray festhältst, verschließt du dich dem echten Leben.«
»Tue ich nicht.« Ich zog den Rucksack zu mir heran und stopfte die T-Shirt-Wurst in eine Lücke. »Waren die sechs Tage hier mit euch kein echtes Leben? Ich habe doch alles mitgemacht und hatte genauso viel Spaß wie ihr.«
Gabriel griff nach meiner Hand. »Ja, aber was glaubst du, wie der Urlaub für Dana und Patrick gewesen ist?«
Ich antwortete nicht. Das war auch nicht nötig, denn wir beide wussten, dass dieser Urlaub für sie mit dem Glitzerstaub der frisch Verliebten überzogen sein musste. Dass jeder Sonnenuntergang, jedes Lagerfeuer, einfach alles heller leuchtete, allein deshalb, weil Dana und Patrick es gemeinsam erlebten. Ich hatte es gespürt, und Gabriel offenbar auch, obwohl die beiden in unserer Gegenwart nicht einmal Händchen hielten und sich nur dann verstohlen berührten, wenn sie dachten, ich würde es nicht bemerken. Als wäre es für mich unerträglich, sie glücklich zu sehen. Was nicht stimmte. Ich freute mich für sie. Es war nur … manchmal schwierig. Wie gestern, als Dana mit Gabriel zum Festland getuckert war. Patricks Blick, als das Brummen des zurückkehrenden Motorboots zu uns drang. Wie seine Augen zu leuchten begannen, so stark, dass aus mattem Stahlblau ein strahlendes Himmelblau geworden war. Und erst sein Lächeln, nicht das zurückhaltende Patricklächeln, nein, sein ganzes Gesicht hatte gestrahlt.
So wie bei Ray, nachdem ich mir das Tattoo hatte stechen lassen.
Unvermittelt stand ich auf.
»Ich sehe mal nach, wo die beiden sind, okay?«
In meine Gedanken verloren, schlenderte ich den schmalen Waldweg zum Strand hinunter. Die Sonne stand schon sehr tief, wahrscheinlich hatten sich Dana und Patrick ein romantisches Plätzchen am Meer gesucht, um den letzten Sonnenuntergang vor unserer Abreise gemeinsam zu genießen. Am Strand angelangt, hielt ich kurz inne. Sollte ich sie wirklich dabei stören? Was spielte es schon für eine Rolle, ob Gabriel das Lagerfeuer eine halbe Stunde früher oder später anzündete? Unschlüssig stand ich am Ende des Wegs, die Arme vor dem Oberkörper verschränkt. Ich spürte das Tattoo unter meinen Fingern und strich unwillkürlich darüber.
Plötzlich war ich auf der Ranch. – Natürlich stand ich allein am Strand von Clark’s Island, aber ich nahm ihn nicht mehr wahr, sondern lief den Weg zu unseren Koppeln hinunter. Roch den Klee, sah die Pferde, wie sie, die Köpfe über die Wiese gebeugt, die saftigsten Gräser ausrupften. Und dort war Ray. Er stand auf der Koppel und trieb die Mustangs zusammen. Er grinste, warf das Lasso und malte damit ein Herz in die Luft. Sekunden später stand er vor mir. »Hi, Josie.« Seine Stimme ein so freudiges Schnurren, dass es wie ein Streicheln mein Ohr streifte.
Nein, es war Danas Lachen, das meine Ohren streifte. Mehr noch, es kam näher und verscheuchte Ray. Und genau da, in diesem Moment, stellte ich mir zum ersten Mal die Frage, ob es wirklich Ray war, der sich ständig in meinen Kopf schlich und wieder davonstahl, oder ob es nur meine Gedanken an ihn waren.
Hinter mir hörte ich mittlerweile Dana kreischen und kichern, dann Patrick lachen, laut und meckernd. Ein Lächeln huschte über mein Gesicht. So lange hatte ich seine schräge Lache nicht mehr gehört, und hätte mir früher mal jemand gesagt, dass ich sie je vermissen könnte, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Das Lachen entfernte sich Richtung Zeltplatz, und ich drehte mich um, wollte ihnen folgen, blieb dann jedoch stehen.
Wenn meine Selbstgespräche mit Ray, die Bilder in meinem Kopf und seine streichelnde Hand bloß in meiner Vorstellung waren, hatten Gabriel, Dana und Patrick dann vielleicht recht?
Langsam ging ich zum Meer, das kurz davor war, die zum roten Feuerball entflammte Sonne zu verschlucken. Die Wellen rollten sanft den Strand hinauf und hinterließen beim Rückzug ins Meer helle Schaumränder, die kaum genug Zeit hatten, im Boden zu versickern, bevor die nächste Welle sie überspülte. Der weiche, trockene Sand unter meinen Füßen wurde feucht und fest, dann matschig und dann stand ich mitten drin im ewigen Wellenschlag des Meeres.
Ewig.
In meinem Kopf hörte ich Rays Stimme. Du bist meine andere Hälfte, Rodeo-Girl. Wir werden nie, nie wieder allein sein. Ewig dein, sage es.
»Ewig dein«, flüsterte ich und wartete auf Rays Antwort. Stattdessen schwemmte die nächste Welle ein Stück Holz an, das im Takt der Wellen vor meinen Beinen tänzelte. Ich bückte mich und hob es auf. Knorriges Treibholz. Neugierig drehte und wendete ich den Stock und suchte nach einer möglichen versteckten Nachricht darauf.
»So ein Unsinn«, murmelte ich schließlich, »hör auf, in allem ein Zeichen von Ray zu suchen!« Doch ich warf den Stock nicht weg, sondern zeichnete damit die Frage in den feuchten Sand, die in mir so lichterloh brannte wie die Sonne über dem Horizont.
RAY, WO BIST DU?
Natürlich kannte ich die Antwort. Er war schließlich vor meinen Augen über die Deathline gegangen. Ich hatte gesehen, wie er zu weißem Nebel verblasste, um ein Teil des magischen Zaubers zu werden, der das Reservat der Yowama beschützte. Doch wenn ich an Ray dachte, wollte ich nicht an weißen Nebel denken. Ich wollte an seine grün-grünen Augen denken. An sein Lächeln mit der Minilücke zwischen den oberen Schneidezähnen. An seine Arme, die ich mehr als alles in der Welt um mich spüren wollte.
Aber genau das würde nicht passieren. Ray würde nie wieder vor mir stehen und mich an sich ziehen.
Nie wieder.
Ich setzte mich neben das Fragezeichen, bohrte meinen Finger in den Sand und malte ein Ausrufezeichen dahinter.
Die harten Sandkörnchen schoben sich unter meinen Fingernagel, und ich zog die Hand zurück, den Blick fordernd auf die Buchstaben gerichtet.
RAY, WOBISTDU?!
Keine Ahnung, wie lange ich so am Strand saß. Nur ich und die Buchstaben und die Ausläufer der Wellen, die rhythmisch meine ausgestreckten Beine umspülten und auf dem Weg zurück ins Meer den Sand unter ihnen wegzogen. Das Wasser kam, das Wasser ging. Immer der gleiche Ton, das gleiche Gefühl unter meinen Beinen. Inzwischen hatten die Wellen auch meine Frage erreicht. Ich beobachtete, wie das Wasser in die Kuhlen lief, sie mehr und mehr ausfüllte und einen Buchstaben nach dem anderen auslöschte. Schließlich schob ich meine Beine vor die Schrift und versuchte das Wasser aufzuhalten. Doch es fand seinen Weg zu den Buchstaben, egal wie sehr ich meine Beine streckte.
»Josie!« Danas Stimme wehte über den Strand.
Ich stand auf und stapfte ihr entgegen. Sie war in den Dünen stehen geblieben und hob sich in der hereinbrechenden Dämmerung kaum von den Büschen hinter ihr ab.
»Wo bleibst du denn?«
»Ich habe mir den Sonnenuntergang angesehen.«
Ihre Brauen zogen sich kurz zusammen, dann nickte sie und hakte sich bei mir unter. »Nimm mir das, was ich heute früh über Ray und dich gesagt habe nicht übel, ja?« Dana kräuselte die Nase. »Ich kann’s mir halt nicht vorstellen und … jetzt, mit Patrick … du weißt schon …«
»Du bist verliebt und genießt jede Sekunde, die ihr zusammen seid und kapierst nicht, wie ich damit zurechtkomme, dass Ray nicht da ist.«
»So ungefähr.« Sie zuckte entschuldigend die Schultern.
»Dann geht es uns ja ähnlich.«
Dana sah mich fragend an.
»Na ja, ich kapier nicht, wie du dich in jemanden wie meinen Bruder verknallen kannst.«
Danas Mund klappte entgeistert auf und ich verkniff mir mein Grinsen. »Ich mein, diese Lache! Und dann dieser Hundeblick, sobald er dich sieht … Au!« Theatralisch rieb ich mir die Schulter, obwohl Danas kleiner Boxhieb kaum spürbar gewesen war.
»Du bist echt doof!«
»Klar!«, grinste ich.
»Da versuch ich mal ernst zu sein und du reißt Witze.«
Ich blieb stehen und nahm ihre Hände in meine. »Ich weiß, dass ihr es gut meint, aber mir zu sagen, dass ich einen Geist liebe und mir etwas vormache, hilft mir nicht.«
Dana sagte nichts, was bei ihr ziemlich ungewöhnlich war. Sie legte nur den Kopf schief und sah mich prüfend an. Dann spürte ich den Druck ihrer Hände, fest und liebevoll, bevor sie wortlos nickte. Ein warmes Gefühl durchströmte mich. Ich hatte Dana. Und Gabriel. Und Patrick und Dad und Bo. Und wenn ich erst auf der Ranch zurück war, würde sich das mit Ray auch wieder einrenken. Ich war wirklich zuversichtlich.
Wie hätte ich auch ahnen können, dass jenseits unserer idyllischen Insel die Zeichen bereits auf Sturm standen?
»ICH FAND DEN KLIPPENSPRUNG am besten.« Dana drehte das Radio leiser, wandte den Kopf zur Rückbank und zwinkerte Gabriel und mir zu.
»Was?« Patrick sah sie entgeistert an. »Das war das Allerschlimmste! Dass so ein Sprung überhaupt angeboten werden darf! Total unverantwortlich!«
»Deine Fahrweise auch, wenn du nicht auf die Straße schaust«, konterte Dana grinsend, was Patrick mit einem unverständlichen Grummeln kommentierte, dann seinen Blick jedoch schnell wieder auf die Straße richtete.
Ich lehnte den Kopf an die Scheibe, ließ mich von Adeles warmer Stimme einlullen, und hörte mit halbem Ohr Gabriel, Patrick und Dana zu, wie sie alles, was wir die letzten Tage unternommen hatten, mit einer Punkteskala von eins bis fünf bewerteten.
»Und du?« Gabriel stupste mich an.
»Ich fand alles gut, aber am besten hat mir gefallen, dass du dir so viel Mühe damit gemacht hast, alles für uns zu organisieren. Danke.«
»Oh …« Gabriel errötete.
»Klar, Mann! Danke, Gabe«, quietschte Dana.
»Schließe mich an«, sagte Patrick. »Das mit dem Planen hast du echt drauf. Apropos, weißt du, ob die Brücke wieder offen ist?«
Geschäftig zog Gabriel sein Handy aus der Tasche. Er schaltete es an, das erste Mal seit sechs Tagen – und ein nicht enden wollender Strom an Piepsen, Klings und Plöngs tönte durchs Auto.
»Krass.« Gabriel schüttelte den Kopf und klickte sich eilig durch seine Mitteilungen. »Echt krass.«
Patrick und Dana wandten zeitgleich ihre Köpfe nach hinten zu ihm. Wie so vieles, was sie seit Neuestem taten. Ob die Liebe Menschen synchronisierte?
»Sag schon«, forderte Dana Gabriel auf. »Was ist krass?«
»Euer Dome ist in den Nachrichten.«
»Was?« Dana schaltete das Radio aus.
Gabriel klickte weiter. »Und die Eisdiele von meiner Tante. Und –«
Dana riss ihm das Handy aus den Fingern. »Tatsache«, murmelte sie nach ein paar Sekunden. »Sind die bescheuert?« Sie schüttelte mehrmals den Kopf, dann las sie laut und mit ungläubigem Ton vor: »In Angels Keep geht ein Poltergeist um – so jedenfalls erklärt sich die Besitzerin des Virtual Reality Domes, Mrs Wang, die seltsamen Vorfälle in ihrem Spielsalon. Angeblich verursache der Poltergeist die seltsamen Bildstörungen und Flüstergeräusche, um den Spielern etwas mitzuteilen. Aber nicht nur Mrs Wang vermutet übernatürliche Gründe hinter den Störungen und Stromausfällen. Auch Theorien über extraterrestrische Einflüsse und den Weltuntergang erfreuen sich großer Beliebtheit …« Noch immer kopfschüttelnd gab Dana Gabriel sein Handy zurück. »Ich fasse es nicht, dass meine Mutter so was gesagt hat. Öffentlich! Ein Poltergeist im Dome! Die tickt doch nicht mehr richtig!«
Ich sah, wie Patricks Hand zu ihrer wanderte und sie drückte.
»Ist doch wahr«, schimpfte Dana. »Das kann sie ja meinetwegen denken, aber so was sagt man doch nicht öffentlich.«
Gabriel vertiefte sich wieder ins Display des Handys, sein Finger wischte unablässig nach unten. »Mann, Mann, Mann«, stöhnte er. »Wenn man dem glauben soll, ist die halbe Stadt inzwischen in irgendeiner Form betroffen.« Er stupste mich an. »Kannst du dir das erklären?«
»Ich?« Warum sollte ich das erklären können? Ich wusste genauso viel wie Dana, Patrick und Gabriel – schließlich hatte ich ihnen nach meinem Besuch im Reservat alles erzählt. Mit hochoffizieller Erlaubnis von Sam. Unwillkürlich wanderten meine Finger über meinen Oberarm. Über das Schutztattoo, das Sam mir ohne die Erlaubnis meines Vaters gestochen hatte. Ich wünschte so, Sam wäre jetzt hier und könnte uns erklären, was sich da in Angels Keep gerade abspielte.
»Josie?«, riss Gabriel mich aus meinen Gedanken. »Hast du eine Erklärung?«
»Nein, absolut nicht.« Aus den Augenwinkeln registrierte ich ein Straßenschild, das wir gerade passierten. Wir waren mittlerweile auf halbem Weg zwischen Bellingham und Angels Keep, und ich konnte es kaum noch erwarten, endlich zurück auf der Ranch zu sein.
Gabriel pfiff laut durch die Zähne und wedelte mit seinem Handy rum. »Wahnsinn. Die schicken das FBI. Nach Angels Keep. Eine Sonderermittlungseinheit.«
»FBI?« Fieberhaft überlegte ich, was das für die Yowama bedeuten könnte. Was, wenn die FBI-Agenten herausfanden, dass manche von ihnen unsterblich waren? Dass ihre Amulette magische Kräfte hatten? Und Amulettträger ohne ihr Amulett zu Dämonen wurden? Zu genau den Schatten, die, wie wir annahmen, in Angels Keep die Störungen verursachten.
»Und das ist sicher nur der Anfang«, ereiferte sich Gabriel. »Dann kommen CIA, NSA, Army …« Seine Finger flogen inzwischen regelrecht über das Handy.
Ich erstarrte in meinem Sitz. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis die Bundesagenten ebenfalls eine Verbindung zwischen den ermordeten Yowama und den Schatten herstellten. So wie wir – und wir waren keine topausgebildeten Agenten. Allerdings warenwir den Schatten schon begegnet. Im Dome bei dem Virtual Reality Spiel. Und auf der Farroway Farm. Ich erinnerte mich an den Moment, als der Schatten an der Scheunenecke der Farm durch mich hindurchgerannt war … so kalt und … Ich schauderte. Wenn ein Schatten so einfach durch mich hindurchlief – warum sollte er das nicht auch bei einem FBI-Agenten tun?
Und dann würden sie ihre Ermittlungen auf das Reservat ausweiten und feststellen, dass der Wald sie nicht dorthin durchließ. Dass alle Wege zurück zur Staatsstraße führten und man nur mit Hilfe eines Amuletts ins Reservat gelangen konnte. Was dann? Würde sich das FBI zurückziehen? Nein. Ganz sicher nicht. Sie würden es über die Luft versuchen. Kampfhubschrauber. Drohnen.
»Wir müssen dem FBI von den vermissten Yowama erzählen«, sagte Patrick, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Wenn ihr Verschwinden wirklich etwas mit den Geschehnissen in Angels Keep zu tun hat, dann sollte das FBI es wissen.« Patrick ließ Danas Hand los. »Das nimmt Ausmaße an, die wir nicht mehr verantworten können.«
Patricks Worte rumorten in meinem Kopf. Ausmaße …verantworten … Waren wirklich wir dafür zuständig, das FBI auf die Yowama zu stoßen? Und was war mit meiner Verantwortung gegenüber den Yowama?
»Was willst du dem FBI sagen?«, frage ich schließlich. »Dass die ermordeten Yowama zu bösen Schatten geworden sind, weil Dowby ihre Amulette gestohlen hat und sie die Deathline nicht überqueren konnten? Glaubst du im Ernst, dass dir jemand so etwas glaubt?«
»Darum geht es doch gar nicht!« Patricks Stimme klang ungeduldig. »Ich will nur, dass wir das FBI auf die verschwundenen Yowama hinweisen, damit sie nicht irgendeiner bescheuerten Poltergeist- oder Alientheorie nachrennen. Die verschwundenen Yowama sind nie als vermisst gemeldet worden. Es gibt keine Leichen. Mensch Josie, wenn Ray dir nicht erzählt hätte, dass er ermordet worden ist und jemand sein Amulett geklaut hat, wären wir nie darauf gekommen, dass die Schatten tote Yowama sein könnten. Wie soll das FBI es rausfinden, wenn wir nichts sagen?«
Ich hatte keine Antwort. Auch Dana und Gabriel nicht, jedenfalls äußerten sie keine. Stattdessen füllte sich das Auto mit unausgesprochenen Gedanken, die sich bleiern zwischen uns auftürmten.
»Und dann?«, brach ich als Erste das Schweigen. »Was, wenn das FBI checkt, dass die Yowama anders sind? Was meinst du, was dann mit ihnen passiert? Das können wir auch nicht verantworten. Lass die Yowama sich darum kümmern!«
Patrick wurde langsamer, fuhr an den Straßenrand und hielt an. Ohne den Motor abzustellen, drehte er sich zu Gabriel und mir um. »Leute, bitte. Ich weiß, dass es keine einfache Entscheidung ist, aber wenn das FBI in die falsche Richtung ermittelt, müssen wir sie auf die Greenies hinweisen.«
»Nein.« Ich lehnte mich vor und schüttelte den Kopf. Hatte ich eben noch Zweifel daran gehabt, was zu tun war, wusste ich mit einem Mal instinktiv, dass wir auf jeden Fall das Geheimnis des Stammes wahren mussten.
Patrick seufzte. »Und wenn noch jemand stirbt?« Sein Blick wanderte kurz zu Dana.
Ich biss mir auf die Lippe. Was sollte ich darauf auch antworten? Es waren bereits genug Menschen zu Tode gekommen – wenn wir richtig lagen, und Dowby die vermissten Yowama tatsächlich alle ermordet hatte. So kaltblütig wie er auch Dana und mich in den Sümpfen hatte entsorgen wollen, nachdem wir ihm auf die Spur gekommen waren. Ich schauderte.
»Ist dir kalt?«, fragte Gabriel und schob seine Jacke zu mir hinüber.
Dankbar nahm ich sie und presste sie gegen meine Brust. Dowby ist tot, vergiss ihn. Allerdings war genau das unser Problem: Mit Dowbys Tod war auch unsere Chance gestorben, den Drahtzieher aufzustöbern, den wir hinter den Morden vermuteten.
»Du weißt, dass ich recht habe«, sagte Patrick sanft.
»Hast du nicht.« Wir starrten uns in unsere so ähnlichen Augen. »Du weißt, was die mit den Yowama machen werden, wenn sie erfahren, dass sie unsterblich sind.«
»Nein, das weiß ich genauso wenig wie du.« Sein Blick wich keinen Millimeter zur Seite. »Du nimmstan, dass sie die Yowama wie Versuchskaninchen in ein Labor einsperren. Und du nimmstan, das FBI werde die Probleme in Angels Keep nicht lösen können. Aber nichts davon wissen wir mit Sicherheit.«
Das Problem war – wir hatten beide recht. Die Schatten waren ein Yowamaproblem, das meiner Meinung nach nur die Yowama lösen konnten. Ich war überzeugt gewesen, dass die Yowama die Situation unter Kontrolle bekommen würden – allein schon deshalb, weil ich annahm, Ray werde von jenseits der Deathline gegen die Schatten vorgehen. Doch nun war die Situation eskaliert und unsere Welt war betroffen. Und in der holte man das FBI, wenn eine Situation aus dem Ruder lief.
»Wir wissen von der Besonderheit der Yowama nur, weil Ray mein Leben gerettet hat«, sagte ich leise. »Hätte er mich sterben lassen sollen, um sein Geheimnis zu wahren? Wir können es jetzt nicht verraten.«
Darauf erwiderte Patrick nichts. Aber ich sah ihm an, dass ihn meine Antwort ins Schleudern gebracht hatte.
»Ich finde, Josie hat recht«, meldete sich Gabriel zögernd. »Ray hat ihr das Leben gerettet. Das jetzt gegen ihn zu verwenden, ist nicht in Ordnung. Wir sollten mit Sam reden und ihm die Entscheidung überlassen, was er dem FBI offenbaren will. Und abgesehen davon … das FBI wird uns kaum glauben, dass die Yowama von den Toten auferstehen, um die Gegend zu beschützen. Wir wissen ja nicht einmal, was sie schützen.«
Patricks Blick wanderte von mir zu Gabriel. Meiner ebenfalls und ich lächelte ihn dankbar an.
»Wir haben keine Beweise«, fuhr Gabriel mit etwas kräftigerer Stimme fort, »für das FBI ist unsere Story genauso unglaubwürdig wie der Poltergeistwahn von Danas Mutter.«
Selbst darauf reagierte Dana nicht, und ich fragte mich, ob es daran lag, dass sie zum ersten Mal nicht sicher war, ob sie zu Patrick oder mir halten sollte, oder daran, dass der Laden ihrer Eltern bisher mit am stärksten betroffen war.
»Okay«, sagte Patrick nach gefühlten fünf Minuten Schweigen. »Wir stimmen ab. Wer ist dagegen, dass wir was sagen?«
Meine Hand schoss hoch, gefolgt von Gabriels. Ich warf Dana einen fragenden Blick zu.
»Gut. Wer ist dafür?« Patrick hob seine Hand und nickte Dana aufmunternd zu, doch ihre Hand blieb unten. »Dana?«
»Ich enthalte mich.«
»Und der Dome?«, fragte Patrick perplex. »Willst du nicht, dass der Laden endlich wieder läuft?«
»Kannst du mir garantieren, das FBI kriegt es wieder hin?«
Patrick starrte sie mit offenem Mund an.
»Kannst du das?«
»Ich … nein«, stammelte er, »natürlich nicht.«
»Dann enthalte ich mich.« Dana drehte sich nach vorne und verschränkte die Arme vor der Brust. Patrick holte tief Luft und legte ohne ein weiteres Wort den Gang ein.
Erleichtert lehnte ich mich in den Sitz. Dana hatte sich weder gegen mich noch gegen Patrick entschieden – sie war sich nur selbst treu geblieben.
»CNN IST AUCH DA.« Gabriel klopfte an die Scheibe. Ich drehte den Kopf. Tatsächlich. Ein Übertragungswagen des internationalen Nachrichtensenders. Mitten in Angels Keep! Das war ein anderes Kaliber als die drei regionalen Fernsehteams, an denen wir bereits vorbeigefahren waren.
»Verdammt«, murmelte ich. So viel Publicity war definitiv nicht gut, wenn wir das Geheimnis der Yowama schützen wollten.
»Angels Keep bei CNN in den Nachrichten.« Dana schnalzte mit der Zunge. »Leute, bereitet euch auf eine Invasion der Neugierigen vor.«
Patrick bog in den Kirkpatrick Boulevard ein und stoppte. Auf dem Bürgersteig hatte sich eine lange Menschenschlange gebildet, die vor dem Virtual Reality Dome anstand. Er war voll. So voll wie nie zuvor.
»Zum …« Dana riss die Tür auf. »Was sag ich? Invasion! Und ich war nicht da!«
»Fährst du weiter?« Patrick drehte sich zu mir, die Hand bereits an der Türklinke. »Ich check, ob Dana Hilfe braucht.«
Und weg war er. Ich sah noch, wie er Dana nachlief und ihre Hand nahm, bevor sie sich durch die Schlange vor dem Eingang des Domes quetschten. Es war seltsam, dass Patrick bei Dana blieb und nicht ich. Normalerweise hätte ich aus dem Auto springen müssen. Aber jetzt war ich eher erleichtert, dass Patrick hierblieb und ich zur Ranch konnte.
Ich kletterte auf den Fahrersitz und fuhr weiter zu Gabriels Haus. Im Gegensatz zu den Menschenmassen vor dem Dome war es hier gespenstisch leer. Und ruhig. Das einzige Anzeichen für Leben im Haus war das Flackern des bläulichen Fernsehlichts aus dem Wohnzimmer.
»Hilfst du mir, das Zeug in die Garage zu bringen?«, fragte Gabriel.
»Klar.« Ich stieg aus und packte mit an. Es war eine Menge Zeug, wie immer von einem von Gabriels Verwandten geliehen und deutlich mehr, als wir tatsächlich zum Zelten gebraucht hatten. Wir mussten drei Mal laufen, bis alles verstaut war.
Mit jedem Gang wurde ich unruhiger. Ich wollte endlich zu meinem Kwaohibaum, um Ray wieder nahe zu sein.
»Also … dann«, sagte Gabriel, als ich mich gerade auf den Fahrersitz schwingen wollte. Weiter kam er nicht.
Ein gewaltiges Krachen ertönte aus dem Haus – eine Explosion? Jemand schrie.
»Das ist Bernie!«, rief Gabriel und sprintete los. Ich rannte hinterher. Versuchte zu verstehen, was Gabriels jüngerer Bruder brüllte. Wir erreichten das Haus. Wieder knallte etwas. Dann ein Kreischen. Eindeutig von Billy, Gabriels jüngstem Bruder.
Der Lärm kam aus dem Wohnzimmer. Gabriel riss die Tür auf.
Billy und Bernie hockten hinter dem Sofa und starrten entsetzt den Fernseher an. Der Bildschirm war schwarz, nur ein leiser, sirrender Ton war zu hören.
»Was zum Teufel ist hier los?« Gabriel stürmte auf seine Brüder zu.
Billy zeigte auf Bernie. »Er war’s. Er hat den Fernseher kaputt gemacht!«
Nun kam Leben in Bernie. Mit einem Satz sprang er auf Billy zu und schubste ihn gegen Gabriel.
»Lügner! Ich hab nichts gemacht!«
»Du hast immer umgeschaltet!«, keifte Billy.
»Hab ich nicht!«, kreischte Bernie und schlug nach Billy.
»Es reicht!« Gabriel ging zwischen seine Brüder. »Gibst du mir mal die Fernbedienung?«, wandte er sich an mich.
Ich fischte sie vom Couchtisch und reichte sie ihm. Er schaltete den Fernseher ein. Zunächst passierte nichts. Der Bildschirm blieb schwarz, kein Laut, nicht einmal ein Knistern ertönte.
»Ihr habt die Kiste echt kaputt gemacht«, sagte Gabriel ungläubig und drückte wahllos eine Taste nach der anderen. Da blitzte es hell auf, nur den Bruchteil einer Sekunde, gefolgt von sonorem Rauschen.
»Was war das?«, fragte Billy und trat halb hinter Gabriel. Ich blickte gebannt auf den Fernseher. Sah, wie der Bildschirm sich veränderte, wie dunkelrote Streifen sich durch das Schwarz zogen, mehr und mehr und immer schneller.
»Was ist das?« Bernies Stimme war eine halbe Oktave nach oben gerutscht. Ängstlich drängte auch er sich an Gabriel.
Ich starrte mit angehaltenem Atem auf das sich wie eine Blutlache ausbreitende Rot. Ein lähmendes Gefühl befiel mich. Das Rot wurde heller, intensiver, es schien sich nach vorne auszudehnen, als würde der Bildschirm aufgebläht. Auch Gabriel hatte es bemerkt. Er hämmerte auf den Ausknopf, doch der Bildschirm wölbte sich immer weiter nach vorne.
»Gabe!«, quietschte Billy, »was …«
»RAUS«, brüllte Gabriel.
Er packte seine Brüder und zerrte sie im Laufschritt Richtung Flur. Ich stolperte ihnen hinterher, den Blick wie hypnotisiert auf den rot glühenden Fernseher gerichtet. Nun schrillte ein gellender, anschwellender Ton durch den Raum.
Panisch rannten wir, Gabriel schubste seine Brüder in den Flur, packte mich am Arm und riss mich mit sich, als der schrille Ton abrupt stoppte.
Instinktiv war ich stehen geblieben und hatte mich umgedreht.
»Josie!«, brüllte Gabriel. Ich sah noch, wie die Blase sich blitzartig zusammenzog. Ein Ruck an meinem Arm, Gabriel knallte die Tür hinter mir zu und eine gewaltige Explosion ließ das Haus erbeben.
Dann war es totenstill.
In meinen Ohren surrte und pfiff es, und soweit ich Billys und Bernies entsetzte Gesichter und die auf die Ohren gepressten Hände deuten konnte, ging es ihnen genauso. Ich sah mich nach Gabriel um. Wo war er hingegangen?
»Gabe«, rief ich durch das Ohrenpfeifen. »Gabe? Wo bist du?«
»Hier.« Er lief vom Ende des Flurs zu uns zurück. »Ich hab die Hauptsicherung lahmgelegt.« Zielstrebig steuerte er auf die Wohnzimmertür zu.
»Halt! Du kannst da nicht wieder rein!«, protestierte Billy.
»Geh da ja nicht rein …«, murmelte auch Bernie. Leichenblass griff er nach Billys Hand.
»Das war nur ein Kurzschluss«, beruhigte Gabriel seine Brüder. An den nervösen Flecken auf seinem Gesicht erkannte ich jedoch, dass er selbst keineswegs daran glaubte. Er zögerte kurz, dann legte er die Hand auf die Klinke. Vorsichtig lehnte er den Kopf an die Tür und lauschte.
Ich stellte mich zu ihm, horchte ebenfalls. Kein Mucks drang aus dem Zimmer. Wir sahen uns an, nickten, dann öffnete Gabriel die Tür und streckte den Kopf um den Türrahmen.
»Ach du Scheiße …«, entfuhr es ihm.
Ich schob ihn zur Seite. Schlug die Hand vor den Mund. Der Raum war überzogen mit einer schwarzen Schicht, die aussah wie grobe Rußpartikel. Was immer das war, es musste aus dem Fernseher gekommen sein, von dem nur noch ein rauchender, hohler, erbärmlicher Rest übrig war. Es musste ihn regelrecht zerfetzt haben.
Gabriel tastete nach meiner Hand. »Bist du dir sicher, dass du das FBI nicht einweihen willst?«, fragte er leise.
Ich nickte und zuckte zugleich die Schultern, den Blick fest auf die traurige Ruine des Fernsehers gerichtet. Er war völlig zerstört, aber irgendwie erwartete ich, dass er jeden Moment wieder anspringen würde.
Etwas stimmte nicht in Angels Keep und jemand musste das wieder geraderücken. Aber wie? Und wer? Die Yowama oder das FBI? Ich hatte etwas in diesem Raum gespürt.
Und es war nichts Gutes gewesen.
IM LAUFSCHRITT BETRAT ICH den schmalen Trampelpfad, der zu meinem Kwaohibaum führte. Schon Hunderte von Malen war ich diesen Weg entlanggelaufen, den Weg zu meinem Baum, der die Grenze zu dem verbotenen Wald markierte. Doch heute kam er mir das erste Mal dunkel und bedrohlich vor.
Ich verlangsamte meinen Schritt, sah mich ängstlich um. Die Bäume und Sträucher um mich herum waren dieselben wie immer, und doch wirkte der Waldrand anders. Dunkler. Feindselig. Als wollte er nicht, dass ich ihm nahekomme.
Der zerstörte Fernseher schoss mir vor Augen, die roten Streifen, wie sie den Bildschirm aufgebläht hatten. Was immer zu der Explosion geführt hatte, ein Kurzschluss war es nicht gewesen. Dessen war ich mir sicher.
Ich heftete meine Augen auf den Trampelpfad und zwang mich weiterzugehen. Ein Schritt nach dem anderen, ohne auch nur ein einziges Mal aufzuschauen.
»Komm schon«, murmelte ich verbissen. »Ray wartet dort auf dich.«
Kaum hatte ich seinen Namen ausgesprochen, fühlte ich mich besser. Ray würde wieder bei mir sein. Er würde mich halten, mich küssen, mir sagen, was wir tun könnten, um die Gefahr abzuwenden.
Ich lief weiter und dachte nur noch an eines: Gleich werde ich Ray wieder spüren.
Die Angst verschwand, dafür begann es in meinem Bauch zu kribbeln und meine Knie zitterten vor Aufregung.
Dann stand ich vor meinem, vor unserem Baum. Behutsam legte ich die Hand auf die Kerbe, die Rays und meine Haarsträhnen verbarg und wartete.
Ray trat unvermittelt aus dem Baum heraus. »Josie. Liebes.« Seine Finger strichen über meine Wange.
»Ray«, flüsterte ich, »kannst du mich hören?«
Er lächelte, doch er antwortete nicht. Seine Finger strichen weiter über mein Gesicht, in seinem Blick lag so viel Liebe und Schmerz, dass mir Tränen in die Augen schossen. Komm zu mir, sagten seine Augen, ich vermisse dich.
»Sag mir, wie!«, rief ich. »Verrat mir, wie ich dich wieder spüren kann!«
Doch er blieb stumm. Stumm das Flehen in seinen Augen, stumm das Streicheln seiner Hand.
»Ray!« Ich schlug gegen den Baum, als wäre der eine Maschine, die nicht so funktionierte, wie ich wollte.
Doch es änderte sich nichts. Ich sah Ray. Aber ich spürte ihn nicht. Wie auf Clark’s Island. Die Nähe zu meinem Kwaohibaum änderte nichts daran.
»Was ist nur los, verdammt noch mal?«, murmelte ich. Warum funktionierte nicht einmal das Wenige noch, was mir von Ray geblieben war?
Ewig dein.
Das hatten wir uns geschworen. Allerdings fragte ich mich nun, ob Patrick recht hatte. Ray steckte in einer Einbahnstraße fest, und unser Schwur offenbar ebenso.
»Ray!«, rief ich. »Ich brauche dich, verdammt noch mal! Weißt du, was in Angels Keep gerade passiert? Weißt du, dass FBI-Agenten herkommen werden? Patrick will ihnen die Wahrheit über euch sagen. Und Gabriel jetzt wohl auch. Und ich kann Sam nicht erreichen, er ist nicht in seinem Studio. Ich muss wissen, wie du dazu stehst!«
Ich wartete. Ray – oder besser gesagt das Bild in meinem Kopf – verschwand, und ich hoffte, dass ein anderes erscheinen würde, oder eine Nachricht oder … keine Ahnung, irgendein Zeichen, das mir den richtigen Weg zeigen würde. »Bekommt ihr das mit den Schatten in den Griff?«, fragte ich.
Nichts.
»Soll ich dem FBI die Wahrheit sagen?« Ich wartete. »Ray? Bitte …«
Nicht einmal ein Rascheln der Blätter.
Oder ein Windstoß.
Oder ein Käuzchen.
Einfach nichts.
Ich lehnte mich wieder an den Stamm. Plötzlich fühlte ich mich unglaublich müde. Tränen füllten meine Augen. Ray fehlte mir so sehr. Zum ersten Mal fühlte ich seinen Verlust so schmerzhaft, wie man den Verlust eines geliebten Menschen eben spürt. Es tat weh. Physisch weh. Ich presste meine Hand aufs Herz, spürte die Tränen über meine Wangen strömen und schluchzte so haltlos, wie ich nach dem Tod meiner Mutter wieder und wieder geschluchzt hatte, um dem Schmerz ein Ventil zu geben. Ich weinte. Um die Liebe und Geborgenheit, die ich zwei Mal verloren hatte. Erst meine Mutter, dann Ray. Meine große Liebe. Schließlich verebbte mein Schluchzen und ich schloss die Augen. Lauschte der Stille. Merkte, wie sie mich umhüllte, in meinen Kopf drang, die Gedanken zum Schweigen brachte und geduldig die Bilder darin löschte, die meine innigsten Wünsche widerspiegelten.
Warme, feuchte Luft kitzelte mich an der Nase. Ich riss die Augen auf.
Bo!
Überrascht sprang ich auf.
»Bo! Was machst du denn hier?« Ich streichelte über ihre samtweichen Nüstern. »Hast du mich vermisst, meine Wilde?« Erst da bemerkte ich, dass sich das Licht verändert hatte. Es musste inzwischen früher Abend sein, und das bedeutete, ich hatte mindestens zwei Stunden geschlafen. Was die Frage, wie und warum Bo zum Kwaohibaum gekommen war, jedoch nicht beantwortete.
Ein Zeichen von Ray? Hatte er sie geschickt? Ich schüttelte den Kopf. Was für ein Zeichen sollte das sein? Ich hatte Ray eine Frage gestellt: FBI involvieren – ja oder nein. Falls Bo die Antwort darauf sein sollte, verstand ich sie nicht.
Ich griff in ihre Mähne und schwang mich auf ihren Rücken.
Wir ritten aus dem Wald und an den Arbeiterhütten vorbei Richtung Stall, doch dann überlegte ich es mir anders. Ich wendete Bo und ritt längs der Koppeln ins Gelände hinaus.
»Lauf, Süße«, rief ich und schnalzte mit der Zunge. Bo flog regelrecht über die Weiden. Wie sehr hatte ich den Wind im Gesicht und ihre kraftvollen, geschmeidigen Bewegungen vermisst! Das erste Mal seit Tagen atmete ich wieder richtig durch. Ich dachte an nichts, nicht einmal an Ray. Ich roch einfach nur die blühenden Wiesen, begrüßte jede Koppel, jeden Hügel, jeden Bachlauf, den wir durchquerten, und lauschte dem Aufschlag von Bos Hufen auf dem Reitweg. Mit jedem Meter fühlte ich mich freier und besser, als würde Bo meinen Akku neu aufladen.
Ich drosselte das Tempo erst, als die Stallungen in Sichtweite kamen. Atemlos verfiel ich in einen gemäßigten Trab und ließ sie dann die letzten hundert Meter Schritt gehen. Und schon wanderten meine Gedanken wieder zu Ray. Vielleicht hatte doch er Bo zu mir geschickt. Nicht um meine Frage nach dem FBI zu beantworten, sondern um mich von meinem Selbstmitleid zu befreien. Vielleicht wollte er mir zeigen, dass mein Leben auch ohne ihn schön sein konnte.
Vielleicht.
Vielleicht hatte Bo mich aber auch ganz allein gefunden.
Ich wusste es nicht.
Vor dem Stall stieg ich ab und führte Bo zum Waschplatz. Ich spritzte sie ab und rubbelte mit frischen Handtüchern ihr Fell trocken. Rays Schutzzeichen waren noch immer auf der Kruppe zu erkennen. Das Rot begann zu verbleichen und wahrscheinlich war in ein paar Wochen nichts mehr davon übrig. Meine Hand strich über die wellenförmigen Streifen, über die seltsamen Schriftzeichen, das Herz und die Sonne auf dem feuchten Fell. Ich stockte. Meine Hand wanderte zurück zu dem Herz. Strich darüber, ganz langsam, während mein Gehirn auf Hochtouren lief.
Ein Herz?
Wo kam das Herz her? Hier sollte ein Totenkopf sein! Ganz sicher. Ich erinnerte mich genau, wie ich die Zeichen das erste Mal auf Bos Fell entdeckt hatte. Wie wütend ich gewesen war, dass jemand ihr die Zeichen, und ganz besonders einen Totenkopf auf die Kruppe gesprüht hatte. Den gleichen Totenkopf, den Sam später in mein Tattoo eingearbeitet hatte.
Hastig schob ich den Ärmel meines T-Shirts nach oben, drehte meinen Arm und starrte auf das Tattoo.
Ein überraschter Laut entfuhr mir. Dann durchströmte es mich heiß: Das kann doch nicht sein!
Ich brachte das Tattoo so nah an mein Gesicht, bis ich den Arm fast mit der Nase berührte. Versuchte zu begreifen, was ich sah: Der Totenkopf war noch da.
Aber Rays Halbkreis war heller als meiner.
Als würden die Farben verblassen wie auf Bos Kruppe. Mir wurde schwindlig. Obwohl ich keine Ahnung hatte, was es bedeuten konnte, war mir eines völlig klar: Es war ein Zeichen. Und es war kein gutes.
Das musste ich näher untersuchen. Eilig raffte ich die Handtücher zusammen, mit denen ich Bo trocken gerubbelt hatte und lief in den Stall – direkt meinem Vater in die Arme.
»Josie!«, riss er mich aus meinen Gedanken, und drückte mich an sich. »Na so was, wann seid ihr denn zurückgekommen?«
»Hi, Dad.«
Er ließ mich los und nahm mir die nassen Lappen ab. »Komm, ich helf dir, erzähl, wie war’s?«
»Toll. Gabriel hat sich mal wieder übertroffen.« Ich hängte die Tücher auf, die er mir reichte, und vermied seinen abwartenden Blick. Ich wusste, dass er auf mehr Details hoffte, aber ich konnte an nichts anderes denken als an das verblassende Tattoo auf meinem Arm.
»Das freut mich«, sagte er schließlich, und lächelte mich schuldbewusst an. »Ihr habt euch die Auszeit wirklich verdient.«
»Und hier? War irgendwas?«, fragte ich schnell, denn ich wollte nicht, dass er glaubte, ich würde ihn ausschließen wollen.
Er nahm meine Hand. »Ich weiß, was Patrick und du für mich … für die Ranch getan habt«, sagte er und hielt mich an der Tür zur Stalltrasse zurück. »Ich möchte, dass du dir wieder mehr Zeit nimmst für die Dinge, die … Mädchen in deinem Alter so tun.«
»Dad …« Ich war verwirrt und hatte damit gerechnet, dass er mich sogleich mit Jobs überhäufen würde. »Ist etwas passiert?«
»Alles im Griff.« Er zwinkerte mir zu. »Martha scheucht uns rum wie die Hühner und die neuen Aushilfen machen ihren Job gut.« Dad löschte das Licht und schloss die Tür hinter uns. »Ich habe euch das letzte Jahr viel zugemutet«, sagte er, wieder ernst, »das wird nicht mehr vorkommen. Lass es die nächsten Tage ruhig angehen, okay?« Dann winkte er unserem Stallmeister zu, der gerade aus der Futterkammer kam. »Larry, hast du eine Minute?«
Verwundert sah ich ihm nach. Was war mit meinem Vater los? Kopfschüttelnd, aber auch froh über sein Lob ging ich zum Waschplatz zurück, um Bo zu holen. Und stoppte abrupt.
Neben Bo stand ein Mädchen mit bunten Haaren in einem dunklen Wallegewand aus Pluderhose und Top mit Fledermausärmeln. Sie hielt ihre Hand an Bos Nüstern. Und meine misstrauische, wilde Bo war so zutraulich, als gehörte das Mädchen zur Familie.
ICH LIEF AUF DIE BEIDEN ZU. »Hi, ich bin Josie.«
»Ist das deins?«, begrüßte mich das Mädchen und strahlte mich an. Sie hatte die weißesten Zähne, die ich je gesehen hatte und eine wunderschöne haselnussbraune Haut. Ich beäugte sie unauffällig. Ihre schwarz, rot, lila und blau gesträhnten Haare, ihre auffällige Kleidung, die mit schwarzem Kajal umrahmten Augen. Von all den Gästen, die wir je auf der Ranch gehabt hatten – ein Mädchen wie dieses war hier noch nie gestrandet. Sie wirkte wie ein Paradiesvogel, der sich verflogen hatte.
»Ja, sie heißt Bo.« Ich löste den Führstrick von der Stange. Da bemerkte ich, warum Bo so zutraulich zu ihr gewesen war. Ich zeigte auf den Klee in der Hand des Mädchens. »Das nascht Bo am liebsten.«
Sie grinste. »Ich auch.« Bo schleckte die letzten Blätter auf und das Mädchen streckte mir die Hand hin. Aus den überweiten Fledermausärmeln schauten verschiedenfarbige Totenkopf-Armreifen heraus. »Ich bin Serena.«
»Seit wann bist du hier?«
»Bin gestern angekommen. Für eine Woche.« Sie zeigte auf Bos Kruppe. »Was bedeuten die Zeichen auf Bos Hintern?«
»Äh … Das war nur für eine Parade«, log ich und marschierte mit Bo los.
»Cooler Totenkopf«, sagte sie und folgte mir. »Ich mag Totenköpfe.«
Totenkopf?!? Wieso war dort jetzt wieder ein Totenkopf? Eben noch hatte ein Herz das Fell geziert! Oder hatte ich mir das nur eingebildet? Das konnte doch nicht sein. Ich riss mich zusammen, um nicht sofort stehen zu bleiben und die Zeichen auf Bos Kruppe anzusehen.
»Also, ich bring Bo dann mal in ihre Box«, sagte ich und ging etwas schneller, doch Serena ließ sich davon nicht abhalten, mir weiter zu folgen. Was mir normalerweise nichts ausgemacht hätte, sie schien nett zu sein und irgendwie auch interessant, aber ich wollte nichts dringender, als nachsehen, ob auf Bos Kruppe nun ein Herz oder ein Totenkopf war.
Da kam uns mein Vater entgegen. »Ach, du hast Serena schon kennengelernt. Ich habe ihr versprochen, dass du ihr nach deiner Rückkehr ein paar Reitstunden gibst.«
»Oh, ja, das wäre wirklich wunderbar«, sagte Serena strahlend.
»Klar«, brummelte ich und lief mit Bo zu ihrer Box, nach wie vor Serena und Dad im Schlepptau. Ich prüfte Bos Salzstein und die Tränke und warf einen verstohlenen Blick auf ihre Kruppe. Tatsächlich. Das Herz war weg, der Totenkopf wieder da. Was zum Teufel geschah gerade mit mir? Erst sah ich auf Clark’s Island ein Herz, wo keines war, und nun schon wieder. Das war doch nicht normal! Plötzlich erwachte ein Hoffnungsstrahl in mir – wenn Bos Schutzzeichen sich erneut geändert hatte, vielleicht war dann auch Rays Tattoo auf meinem Arm wieder normal!
Ich wollte nur noch auf mein Zimmer, um das zu überprüfen. So schnell wie möglich. Die Ungeduld war kaum zu ertragen. Ich streichelte Bo zum Abschied und verschloss die Boxentür. Dann wandte ich mich an Serena und meinen Vater.