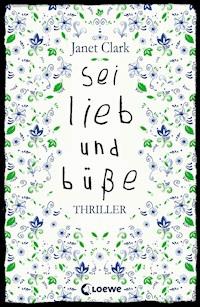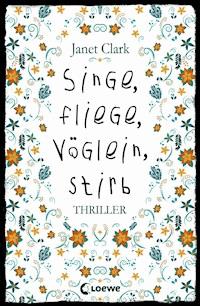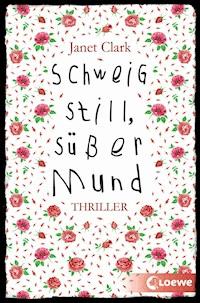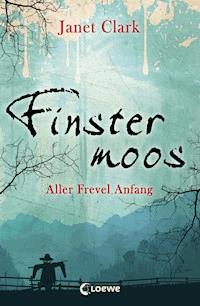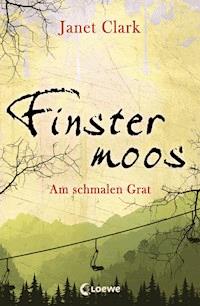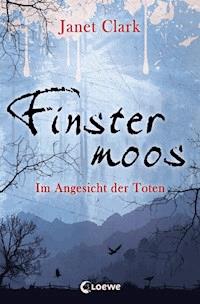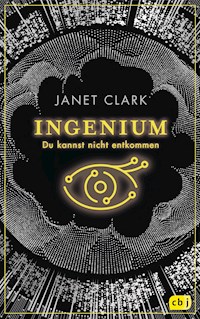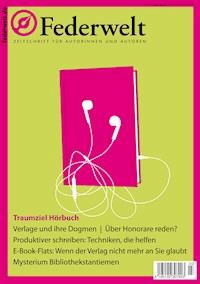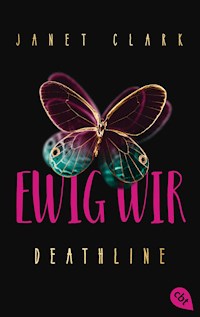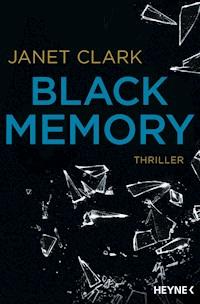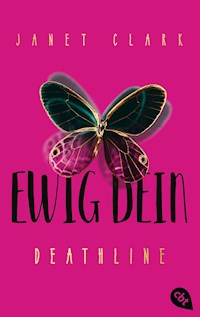
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Deathline-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe wie der Anbeginn der Welt
Josie hat sich schon immer gewünscht, dass ihr Leben einmal große Gefühle, dramatische Leidenschaften und spannende Wendungen für sie bereithält.
Als sie sich im Jahr nach ihrem 16. Geburtstag in die langen Ferien stürzt, ahnt Josie noch nicht, dass eben jener Sommer vor ihr liegt, der ihr Schicksal bestimmen wird. Niemand würde schließlich vermuten, dass die idyllische Pferderanch ihrer Familie einmal Schauplatz mysteriöser Ereignisse werden könnte. Doch Josie muss erkennen, dass dieser Schein trügt, als sie den faszinierenden Ray kennenlernt. Denn ihre große Liebe trägt ein Geheimnis mit sich herum, das Josies Welt in große Gefahr bringen könnte.
Und so muss Josie sich entscheiden. Auch wenn der Preis dafür vielleicht ihre Liebe ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
JANET CLARK
DEATHLINE
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2017 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Geviert GbR, Grafik & Typografie
Covermotiv: © Trevillion Images / Cristina Mitchell
Lektorat: Sabine Franz
MP · Herstellung: UK
Satz und Reproduktion: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18876-4V003www.cbj-verlag.de
Für Lisa-Marie DickreiterDanke!!!
HABT IHR AUCH SCHON MAL von einer besonderen Bestimmung geträumt? Von einer Bestimmung, so gefährlich und aufregend wie die Eurer liebsten Romanheldinnen, die, beflügelt von ihrer großen Liebe, eine zum Untergang verdammte Welt retten müssen?
Ja?
Ich auch. Ich war vierzehn und schwer verliebt in den Schwarm aller Mädchen aus meiner Klassenstufe. Sogar einen Kuss habe ich von ihm bekommen.
Einen.
Am nächsten Tag hat er mich nicht einmal mehr gegrüßt. Als wäre ich Luft für ihn.
Und genauso fühlte ich mich damals auch: unscheinbar und langweilig wie eine graue Maus. Zumindest für die Jungs um mich herum.
Es war höchste Zeit, mein Leben zu ändern.
Nur wie?
Denn egal, wie ausgefeilt meine Pläne auch waren, meine Möglichkeiten waren begrenzt.
Also tat ich das Einzige, was weder einen Führerschein noch einen Schulabschluss, Geld oder Volljährigkeit voraussetzte, und befolgte die Riten einer alten Yowama-Legende: Ich schnitzte eine tiefe Kerbe in den Stamm eines indianischen Kwaohibaumes und eine weniger tiefe in meinen Finger, beschmierte meinen goldenen Taufanhänger mit Blut und versenkte ihn im Tausch gegen eine aufregende Bestimmung und natürlich eine große Liebe in der Kerbe.
Ich erinnere mich an jedes Detail dieses Moments. Und ich frage mich, ob mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich meinen Taufanhänger in seiner Schatulle gelassen und dem Baum eine Kerbe erspart hätte.
Ich werde es nie wissen.
Aber ich gebe Euch einen Rat: Finger weg von Euren Taufanhängern. Ein Leben als graue Maus ist eine verdammt gute Bestimmung!
ALS DANA MICH BAT, die Geschichte für Euch aufzuschreiben, musste ich nicht lange überlegen, wo ich beginnen sollte. Genau genommen musste ich gar nicht überlegen, denn es ist völlig klar, wann mein Leben endgültig aus den Fugen geriet.
Es war der Tag vor den großen Ferien.
Der letzte Schultag in Angels Keep ist ein besonderer Tag. Nicht nur weil zweieinhalb Monate ohne Mathe und ähnlich üble Fächer vor einem liegen, sondern weil er jedes Jahr mit einem Straßenfest gefeiert wird. Einem Straßenfest, das inzwischen so berühmt ist, dass ganze Busladungen aus den nahe gelegenen Städten und Dörfern zu uns gekarrt werden. Und das ist für Angels Keep ziemlich ungewöhnlich, denn der Reisestrom ist in der Regel recht überschaubar: Abgesehen von einigen gestressten Städtern, die am Wawaicha Lake beim Angeln vor sich hin dösen oder auf unserer Ranch ein paar Tage Cowboy spielen, verirren sich nicht so viele Leute in unsere Gegend. Was schlicht und ergreifend daran liegt, dass es hier vor allem eines gibt: Wald, Wald und … genau: Wald. Wald bis hoch zur kanadischen Grenze und darüber hinaus. Die einzige Siedlung nördlich von Angels Keep ist das Yowama-Reservat, aber außer den Greenies, wie die Menschen des Yowama-Stammes genannt werden, fährt nie jemand dorthin. Und das ist von den Greenies auch so gewünscht: Warum sonst bemühen sie sich seit Jahrhunderten, die Einwohner von Angels Keep mit gruseligen Legenden und Schauermärchen fernzuhalten?
Die Greenies bleiben lieber unter sich, sie kommen auch selten nach Angels Keep – außer eben am letzten Schultag.
Kaum waren also die Zeugnisse verteilt, stürmten alle 634 Schüler aus dem Schulgebäude, um sich die besten Plätze in den zwei Cafés und der Eisdiele am Kirkpatrick Boulevard zu sichern. Fast alle, denn Dana, Gabriel und ich hatten es nicht eilig. Die Eisdiele gehörte Gabriels Tante und unsere Plätze waren fest reserviert. Und da Dana später noch im Laden ihrer Eltern arbeiten musste und nicht mit zum Straßenfest konnte, nutzten wir lieber den leeren Schulhof, um unsere Pläne für die Ferien zu besprechen.
Dana, Gabriel und ich. Ein perfektes Dreierteam. Dana, selbst erschaffener Manga-Klon und Tochter koreanischer Einwanderer, deren Virtual Reality Dome nicht nur einen Hauch von Zukunft nach Angels Keep brachte, sondern auch eine wachsende Zahl von Fans, die inzwischen bis zu dreißig Meilen fuhren, um nicht-existente Monster zu jagen. Gabriel, der große, sanftmütige Science-Fiction-Fan, der, seit ich ihn kannte, bei jeder Halloween-Party als Obi-Wan Kenobi auftauchte. Er war der Einzige von uns, der seinen siebzehnten Geburtstag schon hinter sich hatte und den – abgesehen von seinen drei jüngeren Brüdern – nichts aus der Ruhe brachte. Und ich, Josephine, genannt Josie, die Dana und Gabriel das ganze Jahr über mit hausgemachten Müsliriegeln bestach, damit sie mir morgens die fehlenden Hausaufgaben diktierten.
»Okay, Leute«, sagte Dana, nachdem sie sich quer über unsere Lieblingsbank im Hof gelegt und die Arme unter den Hinterkopf geschoben hatte. »Was ist der Plan?«
Ich setzte mich zu Gabriel auf den ausgebleichten Holztisch und warf ihm einen fragenden Blick zu. Gabriel war Großmeister im Planen. Er liebte es, im gleichen Maße für uns Pläne zu schmieden, wie Dana und ich uns einen Spaß daraus machten, sie über den Haufen zu werfen.
»Wir fahren ans Meer.« Er sah uns erwartungsvoll an. »Vier Tage. Ich habe den perfekten Campingplatz rausgesucht und mein Onkel leiht uns seine Ausrüstung.«
Das Besondere an Gabriels Familie war, dass sie praktisch unendlich groß zu sein schien. Egal was man brauchte, Gabriel hatte immer einen Onkel, Cousin oder eine Großtante dritten Grades, die aushelfen konnten. Im Gegensatz zu Danas Familie, die ausschließlich aus ihren Eltern bestand, und meiner, in der es nur meinen Bruder und meinen Vater gab.
»Meer. Hmm«, brummelte Dana mit geschlossenen Augen.
»Wann?«, fragte ich vorsichtig, denn Ferienzeit bedeutete für mich vor allem eins: besonders viel Arbeit auf der Ranch.
»Heute in …« Er warf einen prüfenden Blick auf sein Smartphone. »… siebzehn Tagen. Meinst du, das kriegst du hin?«
Ich zuckte die Schultern. Mit viel Überredungsgeschick würde ich meinem Vater vier Tage aus den Rippen leiern können – vorausgesetzt, die neuen Aushilfen machten ihren Job gut. »Ich versuch’s.«
»Und du?«, wandte sich Gabriel an Dana.
Ohne ihre Augen zu öffnen, brummelte sie ein weiteres »Hmm«.
Ich verkniff mir ein Grinsen. Ich wusste genau, was in Dana vorging. Hätte Gabriel New York, Los Angeles oder meinetwegen auch San Francisco gesagt, hätte sie bereits einen Urlaubsantrag per SMS an ihre Mutter geschickt. Aber wir lebten nun mal im Staat Washington, und ein Campingausflug an unsere Pazifikküste war für sie genauso verlockend wie der gratis dazu gelieferte Sonnenbrand auf ihrer empfindlichen Haut. Eigentlich sollte Gabriel inzwischen wissen, dass er Dana mit einsamen Outdoor-Trips nicht ködern konnte. Und eigentlich wusste er das auch, er verstand es nur nicht. Wie jemand einen Schaufensterbummel durch eine richtige Stadt einer Runde Surfen und einem Lagerfeuer vorziehen konnte, blieb ihm unbegreiflich. Und mit richtiger Stadt meine ich eine mit deutlich mehr Einwohnern als Angels Keep mit seinen 4378.
»Das wird echt cool. Abgelegen, perfekte Brandungswellen, Kajakverleih …«, pries Gabriel seinen Campingausflug an – und wählte exakt die falschen Wörter, um Danas Skepsis zu zerstreuen.
»Hör auf!« Dana öffnete ihre schwarzbraunen Mandelaugen und kräuselte ihre Nase. »Willst du mich umbringen? Wir sind in Amerika, da wird es doch einen Strand geben, der nicht abgelegen ist. Abgelegen hab ich jeden Tag.«
Gabriel verzog beleidigt den Mund, doch das beunruhigte weder Dana noch mich. Es lag einfach nicht in seiner Natur, länger als drei Minuten zu schmollen, bevor er sich mit ungebrochenem Eifer auf den nächsten Plan stürzte.
Dana sah auf ihre Uhr. »Ätz. Ich muss.« Während sie aufstand, zerwuselte sie ihre schwarzen Igelhaare, bis sie nach allen Seiten abstanden. Dann zupfte sie ihre bunten Overknees und den Minifaltenrock zurecht und beugte sich zu Gabriel. Der schmollte noch immer – was Dana allerdings nicht davon abhielt, ihm seine Locken zu zerzausen und einen freundschaftlichen Kuss auf die Nasenspitze zu knallen. »Du findest was, Gabe, und das wird der Hammer, ich habe vollstes Vertrauen.« Schon hellte sich Gabriels Miene wieder auf. Dana wandte sich an mich. »Ab morgen seid ihr fest eingetragen, nicht vergessen, ja? Meine Eltern verlassen sich auf uns.«
Ich nickte. Danas Opa wurde siebzig und ihre Eltern flogen zur großen Feier nach Korea – obwohl Ferien waren und damit für den Dome Hochsaison. Es hatte Dana monatelange Überzeugungsarbeit gekostet, allein hierbleiben zu dürfen, und sie fieberte seit Wochen darauf hin, mit Gabriel und mir den Laden zu schmeißen. Von elf bis siebzehn Uhr unterstützte Gabriel sie, danach half ich mit aus. Selbst wenn es nur zwei Wochen waren, freute ich mich fast so sehr wie Dana darauf, und das nicht nur, weil ich mir so das nötige Kleingeld für unseren Trip verdienen konnte. Nein. Damit hatte ich auch jeden Tag eine Entschuldigung, mich von der Ranch zu entfernen und ein paar Stunden mit Leuten zu verbringen, die das Lachen noch nicht verlernt hatten.
Als Gabriel und ich den Kirkpatrick Boulevard erreichten, war das Straßenfest bereits in vollem Gange. Aus Boomboxen und Ghettoblastern bekämpften sich Hip-Hop-Beats und Rap-Songs, während sich auf der breiten Straße Gruppen von Skatern und Freerunnern gebildet hatten, die auf waghalsig konzipierten Parcours ihre neuesten Stunts vorführten. Vor der Eisdiele hatten sie einen Bullriding-Automaten aufgebaut und dazwischen tummelten sich Mädchen in ihren grün-goldenen Cheerleader-Kostümen und warteten auf ihren Einsatz. Es versprach ein großartiger Abend zu werden.
Zunächst kassierten wir allerdings einen Anschiss von der gestressten Bedienung der Eisdiele. Sie war gerade drauf und dran, unseren reservierten Fensterplatz im ersten Stock einer aufgeregt kichernden Gruppe Mädchen zu geben. Gabriel schritt ein, hörte sich geduldig an, dass seine Tante nicht aus Gold gemacht sei und es absolut unverschämt wäre, an so einem Tag einen Platz so lange frei halten zu lassen, und bestellte schließlich zwei Limos.
Wir nahmen unsere Plätze ein und verfolgten das Schauspiel auf der Straße, besonders das Bullriding, das direkt vor unserer Nase stattfand. Jedes Mal bevor ein neuer Reiter aufstieg, schlossen wir eine Wette ab, wie lange er sich auf dem als Bullen verkleideten Wackelautomaten halten würde, und ich gewann ausnahmslos. Ich sah einfach, ob sich jemand im Sattel halten würde oder nicht. Ich erkannte es daran, wie jemand auf den mechanischen Plastikbullen zulief, aufstieg und das Halteseil griff. Zögern, auch nur eine Sekunde, aber auch zu forsches Auftreten gab Zeitabzug bei meiner Einschätzung. Wer Angst hatte, versteifte zu schnell, wer zu siegessicher war, konzentrierte sich nicht genug. Inzwischen hatte sich eine johlende Zuschauergruppe um den luftgepolsterten Ring gebildet.
»Du könntest locker mithalten«, sagte Gabriel und zeigte abschätzig auf die Tafel mit dem bisherigen Rekordergebnis.
»Wozu?«, fragte ich und wandte mich der Eiskarte zu.
»Um den Angebern da unten einen Dämpfer zu verpassen. Das wäre spaßig.« Er plusterte sich gorillamäßig auf, und wenn es seine Art wäre, hätte er sich wahrscheinlich noch genauso machomäßig an den Schritt gegriffen, wie der Typ, der gerade über das Luftpolster zu dem Plastikbullen stapfte.
Ich kicherte. »Vier Sekunden«, sagte ich und vertiefte mich wieder in die Eiskarte. Auf einer Extraseite boten sie den Jahresabschlusstraum an, einen Eisbecher gigantomanischen Ausmaßes, bestehend aus all meinen Lieblingssorten und verziert mit einem Beerenmix, bunten Streuseln, Himbeersoße und Sahne. Mir lief das Wasser im Mund zusammen – allerdings nur, bis ich den Preis sah, der ebenso gigantomanisch war wie die Eiskreation selbst.
»Verdammt! Wie machst du das?«, rief Gabriel und zeigte auf die Anzeigetafel. Vier Sekunden.
Ich zuckte grinsend die Schultern, dann wandte ich mich wieder der Karte zu. Doch nachdem ich den Giganten-Becher gesehen hatte, wirkten alle anderen schäbig.
Gabriel legte seinen Finger auf die Eiskarte. »Ich wette mit dir um den Jahresabschlusstraum, dass du dich länger hältst als fünf Typen vor dir.«
Ich dachte kurz nach. »Das heißt, wenn ich schlechter bin, habe ich gewonnen und bekomme das Eis?«
Gabriel blinzelte. »Anders: Wenn du dich länger hältst als fünf Typen vor dir, bekommst du den Becher.«
Ich schielte auf die Hochglanzabbildung, dachte an die notorische Ebbe in meinem Geldbeutel und schob den Stuhl zurück. Mehr als ihn nicht zu gewinnen, konnte nicht passieren – dachte ich zumindest.
An der Bullriding-Kasse hatte sich eine kleine Schlange gebildet. Ich reihte mich ein und beobachtete meine Gegner. Es ging schließlich um einen sehr großen und sehr teuren Eisbecher, also sollte ich möglichst darauf achten, dass die fünf Reiter vor mir keinen allzu guten Eindruck machten. Ich zählte ab und schätzte die Kandidaten ein. Der erste wirkte schon beim Anstellen nervös, um ihn musste ich mir keine Sorgen machen. Dahinter scherzte ein Muskelprotz breitbeinig mit seinem Kumpel. Typ »Mir kann keiner was«. Gut, die flogen meist bei der ersten Vollkehre aus dem Sattel. Der dritte war schmächtig, aber durchtrainiert und hatte einen ernsten Gesichtsausdruck. Einen Touch zu ernst, er würde zu steif auf dem Bullen sitzen. Der vierte Kandidat war ein Schüler aus meiner Jahrgangsstufe, Jake, ein Spaßvogel, der mich mindestens einmal täglich zum Lachen brachte, aber völlig ungeeignet war, sich länger als zwei Sekunden oben zu halten. Der letzte vor mir machte mir allerdings Sorgen.
Ein Greeny.
Das Gesicht unbeweglich, als existierte der Rummel um ihn herum gar nicht. Die entblößten Arme sehnig und muskulös. Das war schlecht. Greenies waren dafür bekannt, einen ganz eigenen Zugang zu Tieren zu haben. Sie waren die besten Zureiter und die besten Tierhüter in der Gegend, und es kam nicht von ungefähr, dass wir früher auf der Ranch bevorzugt Greenies eingestellt hatten, wenn sich welche bewarben. Allerdings war dies ein mechanischer Bulle, und bislang war mir nicht zu Ohren gekommen, dass sich der besondere Zugang zu Tieren auch auf deren Plastikversion erstreckte.
Trotzdem nahm ich den Greeny genau unter die Lupe. Ich schätzte ihn auf Ende vierzig. Er bewegte sich mit der Warteschlange weiter und ich bemerkte ein leichtes Humpeln auf der linken Seite. Gut, dachte ich und blieb dicht hinter ihm.
Das Startticket fest in der Hand wurde ich mir plötzlich der Blicke, Handschläge und halblaut geflüsterten Kommentare bewusst. Ich war das einzige Mädchen auf dieser Seite der Absperrung – und mutierte gerade zum Gegenstand von zig Wetten. Ich stellte mir vor, wie sie wohl ausfielen, was angesichts der Überzahl an auswärtigen Besuchern weder schwer noch schmeichelhaft war. Die grinsenden Zuschauer sahen ein Schulmädchen, knapp einen Meter fünfundsechzig groß und nicht gerade kräftig gebaut, die aschblonden Haare zu einem bereits zerfleddernden Zopf geflochten. Ich war nicht so ein auffälliger Typ wie Dana, nach der sich die Menschen im Vorbeigehen oft umdrehten. Das einzig Besondere an mir war auf den ersten Blick nicht sichtbar: die unter den Jeans und dem locker sitzenden Langarmshirt verborgenen Muskeln vom jahrelangen Schuften auf der Ranch. Es war eindeutig: Die meisten von ihnen würden mir keine zwei Sekunden geben.
Schließlich kam der Erste der fünf an die Reihe. Doch nicht ihm galt mein Interesse. Vielmehr beobachtete ich den Bewegungsablauf des mechanischen Bullen. Merkte mir, wann er nach links, rechts, oben und unten ausschlug. Anders als im echten Rodeo lief hier der Ritt immer gleich ab. Der erste Reiter hielt sich drei Sekunden, zu nervös, wie ich mir gedacht hatte. Dann kam der Muskelprotz, er blieb etwas länger oben, scheiterte jedoch wie erwartet an der ersten Vollkehre. Nun waren fünf Sekunden zu schlagen. Ich konzentrierte mich auf Nummer drei, er machte seine Sache gut, erst nach acht Sekunden war Schluss, nur eine Sekunde unter der heutigen Bestzeit. Als Nächster war Jake an der Reihe. Unter riesigem Gejohle und Gepfeife stieg er in den Ring und verneigte sich wie ein spanischer Torero.
Und da bemerkte ich ihn.
Ich kann nicht sagen, wann er den Platz mit dem humpelnden Greeny vor mir getauscht hatte. Von einer Sekunde auf die andere war er einfach da und der andere weg. All die Siegesgewissheit, die mich bis dahin das Spektakel mit einer gewissen Lässigkeit hatte beobachten lassen, verpuffte mit einem Schlag. Dieser Greeny war ein anderes Kaliber als alle, die bislang den Ring betreten hatten. Ich schätzte ihn auf achtzehn, maximal neunzehn Jahre. Er war einen Kopf größer als ich, was ziemlich groß für einen Greeny war. Durch das enge T-Shirt und an seinen Armen sah ich, dass er genau die Art von Muskeln besaß, die man für den Ritt benötigte – nicht die aufgepeitschten Muckibudenstränge, sondern die feinen, unaufdringlichen Muskeln, die man nur durch bestimmte körperliche Arbeiten bekam. Am meisten beunruhigte mich aber seine Ruhe. Jake schien kurz vor einem Herzkasper, bevor er in den Ring tänzelte, selbst der Muskelprotz hatte nervös mit seinen Fingern gespielt, während er das Fiasko seines Vorreiters beobachtet hatte. Dieser Greeny jedoch schien überhaupt keinen Herzschlag zu haben, so reglos und ruhig stand er vor mir. Er hielt seine Arme vor der Brust verschränkt und den Kopf mit den rabenschwarzen, zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren stolz erhoben wie der Klischeeindianer aus den alten Westernfilmen, die mein Vater auf DVD hortete. Mit einem Mal flackerte Nervosität in mir hoch. Sie wanderte vom Magen in die Brust und dann dummerweise in die Beine und ließ sie schwach und zittrig werden. Ich musste ein Geräusch von mir gegeben haben, vielleicht hatte ich auch einfach nur »verdammt« gemurmelt, ohne es zu merken, denn plötzlich drehte er sich um.
»Bist du okay?«, fragte er mit einer Stimme, die mich an das Grollen eines Panthers und das Schnurren einer Katze denken ließ.
Ich sagte nichts. Starrte ihn nur an und hoffte …
Nein, ich muss mich korrigieren. In dem Moment hoffte ich nichts und dachte nichts. Ich sah ihn nur an. Sah in seine leuchtend grünen Augen, versank regelrecht in diesem Grün und schaffte es nicht, meinen Blick wieder abzuwenden. Zum Glück ertönte in dem Moment der Startpfiff. Der Greeny drehte sich um und erlöste mich aus diesem unfassbar peinlichen Zustand. Blitzschnell wandte ich mich dem Ring zu, doch es war bereits zu spät; Jake hatte sich kaum zwei Sekunden auf dem Plastikbullen gehalten und humpelte nun unter dem Johlen der halben Jahrgangsstufe wie ein Sieger durch den Ring. Erst da hoffte ich, dass der Greeny mein seltsames Starren für eine Art Angstreaktion vor dem unaufhaltsam näher kommenden Ritt gehalten hatte.
Jake humpelte an mir vorbei und klatschte mich ab. »Mach sie alle, Josie.« Er grinste breit. »An dir hängt die Ehre der Angels High!«
Ich hatte plötzlich das dringende Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen. Aber jetzt aus der Reihe auszutreten war komplett undenkbar. Alle würden denken, dass ich vor dem dämlichen Plastikbullen kniff. Also presste ich stattdessen die Beine zusammen und atmete tief in den Bauch, um den ärgerlichen Blasendrang zu vertreiben. Der Greeny kletterte in den Ring und ging so entspannt auf den Plastikbullen zu, als hätte ihn seine Mutter zum Essen gerufen. Mit einem Satz schwang er sich auf den Rücken, der Pfiff schrillte und der Greeny hielt sich mit unverschämter Leichtigkeit auf dem bockenden Automaten. Acht Sekunden. Neun. Zehn. Der Blasendrang wurde unerträglich. Dreizehn Sekunden, dann lag er endlich unten. Die Zuschauer tobten. Dreizehn Sekunden! Wie sollte ich das toppen? Ich erwog, mich aus dem Staub zu machen, die Wette hatte ich sowieso schon verloren, doch dann hörte ich meinen Namen.
»Jo-sie! Jo-sie!« Die Gruppe um Jake skandierte die Silben in schnellem Rhythmus und immer mehr Zuschauer fielen ein. Ich warf Jake einen bitterbösen Blick zu, doch der hielt beide Daumen hoch und strahlte mich an.
»Jo-sie! Jo-sie!« Der ganze Platz rief meinen Namen, dazu ohrenbetäubendes Johlen und Pfeifen. Meine Beine zitterten inzwischen so sehr, dass ich nicht einmal mehr wusste, wie ich in den Ring steigen sollte. Der Greeny sprang über die Gummibrüstung und blieb kurz vor mir stehen. Erneut zogen mich seine grünen Augen magisch an. Rasch senkte ich den Blick und blieb wieder an etwas Grünem hängen. Einem Amulett, das an einem Lederband um seinen Hals hing.
»Zeig’s ihnen«, sagte er. Ich sah auf und er zwinkerte mir zu – oder bildete ich mir das nur ein, weil ich auf einmal selbst hektisch zu zwinkern begann?
Nun gab es definitiv kein Zurück mehr. Ich holte tief Luft, kletterte in den Ring und eierte über die Luftpolster zu dem dämlichen Bullen. Wie hatte der Greeny auf diesem Wackeluntergrund eben noch so entspannt gehen können? Aus den Zuschauerreihen hörte ich einzelne Lacher, und ich wusste genau, was in den Köpfen vorging – sie sahen mich bereits vor dem Startpfiff am Boden.
Dann saß ich oben. Eine Hand am Seil, eine zur Balance in der Luft, die Oberschenkel fest an den Plastikkörper gepresst. Der Pfiff gellte, der Bulle bockte und ich saß mit einem Mal nicht mehr auf dem Bullen, sondern auf Bo, meiner Stute. Nur dass ich im Gegensatz zu Bos unberechenbaren Sprüngen bei diesem Ritt genau wusste, welche Bewegung mich als Nächstes abwerfen sollte – und wie ich es ausgleichen konnte. Bis es zu dem Manöver kam, das ich noch nie gesehen hatte. Es war eine Drehung unten rechts aus der Hüfte mit gleichzeitigem Doppelbocken. Damit hatte ich nicht gerechnet. Noch ehe ich reagieren konnte, flog ich in hohem Bogen auf das weiche Luftkissen und hörte, wie die Menge meinen Namen grölte. Es war unfassbar peinlich, aber auch irgendwie gut, vor allem, als ich atemlos zur Zeitsäule schielte.
Dreizehn Sekunden.
Das war phänomenal, und es war mir in dem Moment ziemlich egal, dass es nur Gleichstand war und damit für das Eis nicht reichte. Ich rappelte mich auf und lief mit Beinen, die mehr aus Glibber als aus Muskeln zu bestehen schienen, aus dem Ring. Verstohlen blickte ich mich nach dem Greeny um und war enttäuscht, dass er nirgends zu sehen war – mein Ritt hatte ihn offenbar nicht interessiert.
Zurück in der Eisdiele wartete bereits der Giganten-Becher auf mich. Gabriel hatte beschlossen, dass ich ihn mir auf jeden Fall verdient hatte. Ich konnte ihm ansehen, wie extrem stolz er auf mich war. Und irgendwie war ich das auch. Diesen Triumph wollte ich mit meiner besten Freundin teilen, also nahm ich mein Smartphone, um ihr ein Video zu schicken. »Hi, Dana«, rief ich und winkte mit der Hand durch das Bild. »Stell dir vor, Gabriel hat mich zu einem Rodeo-Ritt gezwungen und …«
»Sie ist die Rodeo-Queen!«, brüllte Gabriel über den Tisch, und ich richtete die Kamera auf ihn, zoomte auf sein grinsendes Gesicht, bis Mund, Nase, Brille und die hellbraunen Locken zu groben Pixeln wurden. Dann zoomte ich ihn wieder klein und schaltete zurück in den Selfie-Modus.
»Ich hab ihn bluten lassen«, sagte ich mit tiefer Monsterstimme und schnitt eine Grimasse. »Hier ist die Hölle los, sweety pie, schade, dass du nicht dabei bist! Warte, ich dreh mal eine Runde mit dir.« Die Kamera weiter auf mich gerichtet lief ich rückwärts und versuchte so viel wie möglich von dem bunten, fröhlichen Treiben um mich herum einzufangen.
»Josie! Treppe!«, hörte ich Gabriel noch schreien, doch es war bereits zu spät. Dort, wo Boden unter meinem Fuß sein sollte, war – nichts. Ich verlor das Gleichgewicht und ruderte wild mit den Armen.
Doch ich stürzte nicht.
Stattdessen spürte ich einen festen Griff um meinen Oberkörper, und eine sanfte Raubtierstimme, die ich seitdem unter tausenden wiedererkennen würde, sagte: »Noch nicht genug geflogen, Rodeo-Girl?«
Grüne Augen, nur Zentimeter von mir entfernt, hefteten sich auf mein Gesicht und ich verfiel zum zweiten Mal an diesem Tag in Schockstarre. Die Menschen, das Lachen, das Gläserklirren, die Musik von der Straße und das Gegröle des Rodeos – alles verschwand. Ich war wie gefangen in diesem unergründlichen Grün seiner Augen, tief wie ein Bergsee mit giftgrünen Flummiflecken. Um mich herum herrschte völlige Stille. Als hätte jemand beschlossen, die Welt anzuhalten, bis Josephine O’Leary lange genug in ein Paar grüne Augen gestarrt hatte, damit sie sich unauslöschlich in ihr Gehirn brennen konnten. Den Rest des Gesichtes habe ich nur am Rande wahrgenommen. Ein belustigtes Lächeln und eine kräftige Nase, aber es sind die Augen gewesen, die mich wie ein Dartpfeil durchbohrt und ein Loch in meinem Verstand hinterlassen haben.
Und dann war der Moment vorbei. Der Lärm kehrte zurück wie ein Tsunami, die Menschen bewegten sich wieder, ich spürte, dass die kräftigen Arme mich auf die Treppe stellten und losließen. Mein Herz schlug unregelmäßig, als sein schwarzer Pferdeschwanz in der Menge verschwand. Schnell griff ich nach dem Geländer. Ich stand zwar mit beiden Beinen auf den Stufen, aber es fühlte sich keineswegs an, als würde ich irgendwo sicher stehen. Es fühlte sich eher an wie vorhin im Ring – als wären meine Beine aus dem glibberigen Himbeerjelly gemacht, das meine Mutter uns früher gern zum Nachtisch serviert hatte. Ich hasste Himbeerjelly. Egal ob im Dessertschälchen oder in den Beinen.
»He, hast du dir wehgetan?« Gabriel war herübergeeilt und legte mir den Arm um die Schulter.
»Nur erschreckt«, murmelte ich und sah mich nach dem Greeny um, der sich zum zweiten Mal in Luft aufgelöst hatte.
»Nimmst du immer noch auf?«
Erst jetzt merkte ich, dass meine rechte Hand weiterhin das Smartphone umklammert hielt. Gabriel löste es aus meinem Griff und stoppte die Aufnahme.
»Das Eis schmilzt«, sagte er und führte mich zurück zu unserem Tisch.
Der Tag hätte nun einfach weiterlaufen können. Die Ferien lagen vor uns, eine Rekordleistung beim Rodeo hinter mir, auf der Straße tobte eine grandiose Party, vor mir tropfte Fudge-Eis auf den Unterteller und trotzdem war der Tag für mich vorbei. Nicht im wörtlichen Sinn. Ich blieb mit Gabriel noch eine ganze Weile in der Eisdiele und schlenderte dann mit ihm im Schneckentempo über den Boulevard. Aber es war nur mein Körper anwesend. Meine Gedanken kreisten unaufhörlich um den Jungen mit den grünen Augen.
Ich verstand nicht, was gerade mit mir geschah. Ich hielt heimlich nach ihm Ausschau und fragte mich im Sekundentakt, ob er mich überhaupt wahrgenommen hatte, während ich in dem Bergsee seiner Augen ertrunken war. Aber noch mehr fragte ich mich, wer er war und ob ich ihn je wiedersehen würde. Und vor allem: ob er mich erkennen würde.
KAUM WACHTE ICH AUF, waren die grünen Augen wieder da. Es war zum Verrücktwerden. Sie waren das Letzte, was mir vor dem Einschlafen im Kopf herumgespukt war, und nun das Erste, was mich am Morgen begrüßte. Energisch zwang ich mich, meine Gedanken auf die vor mir liegende Arbeit zu richten. Es würde hektisch werden, wie jedes Jahr am ersten Tag der großen Ferien, wenn die Hausgäste kamen. Ich streckte mich ausgiebig und wühlte mich stöhnend aus der Decke. Der gestrige Rodeo-Ritt hatte seine Spuren hinterlassen. Meine Oberschenkelinnenseiten waren genauso von blauen Flecken übersät wie meine Knie, mein rechter Oberarm war gezerrt und die Schulter schmerzte von dem Sturz.
»Josie!« Die Stimme meines Vaters drang fordernd durch die geschlossene Tür.
»Komme!«, rief ich und schlüpfte hastig in Jeans, T-Shirt und Sweatjacke. Ein Blick auf den Wecker zeigte mir, dass ich spät dran war.
In der Küche saßen mein älterer Bruder und mein Vater am Frühstückstisch. Ihre Teller waren vollgebröselt und ihre Tassen halb leer. Die Haare meines Bruders waren noch feucht vom Duschen und auf seinem T-Shirt klebte ein Marmeladentoastkrümel. Wenn Patrick neben meinem Vater saß, war die Familienähnlichkeit unverkennbar. Das gleiche aschblonde Haar, die gleichen blauen Augen, der gleiche Mund mit der etwas kräftigeren Unterlippe. Die O’Leary-Gene hatten sich zu hundert Prozent in Patricks und meinem Äußeren durchgesetzt. Und bei Patrick auch in seiner ruhigen, vernünftigen Art, ganz im Gegensatz zu mir – ich kam voll und ganz nach meiner Mutter, die gerne mal die Vernunft außen vor gelassen hatte, wenn die Sache es erforderte.
»Guten Morgen«, sagte ich gähnend und setzte mich auf meinen Platz.
Patrick nickte gnädig, ohne von dem Arbeitsplan vor ihm aufzusehen.
»Was soll ich als Erstes tun?«, fragte ich, während ich Zucker in meinen Kaffee rührte. Er schob mir den Plan zu. Ich überflog meine Aufgaben – und hätte beinahe den Kaffee zurück in die Tasse gespuckt.
»Bist du irre? Ich muss um fünf bei Dana sein«, protestierte ich. »Wie soll ich das denn schaffen?«
»Martha ist krank«, sagte Patrick nur, als würde die Tatsache, dass unsere gutmütige Haushaltshilfe ausfiel, mein Problem lösen.
Mein Vater griff nach der Liste und strich drei Posten durch. »Das kann ich noch übernehmen.«
Ich lächelte ihn dankbar an, Patrick hingegen warf ich einen strafenden Blick zu. Zwar wusste ich nicht, warum er seit Wochen mit Sturmwolken im Gesicht herumlief, aber was immer ihn umtrieb, ich hatte es satt, dass er mich wie seine persönliche Angestellte behandelte. Grimmig nahm ich mir einen Toast und beschmierte ihn fett mit Butter und Honig.
»Stimmt es, dass du gestern beim Bullriding mitgemacht hast?«, fragte mein Vater. Der leise Vorwurf in seiner Stimme war nicht zu überhören.
»Ja.« Es zu leugnen wäre bei der Menge an Zeugen völlig unsinnig gewesen. Ich hätte mir denken können, dass mein Auftritt sich in Lichtgeschwindigkeit bis zur Ranch herumsprechen würde.
»Du weißt, dass ich dir das nie erlaubt hätte.«
»Es war ein mechanischer Bulle auf einem Luftkissenpolster. Was soll da bitte passieren?«
»Echt?«, mischte Patrick sich ein. »Du bist auf so einem dämlichen Plastikbullen geritten? Ist dir eigentlich gar nichts peinlich?«
»Ich traue mich wenigstens, bei so was mitzumachen«, gab ich zurück und biss verärgert in meinen Toast. Diese Spaßbremse. Früher hätte Patrick ganz vorne gestanden und mich angefeuert. Er wäre stolz auf mich gewesen. Stolz auf die kleine Schwester, die ihm so ähnlich sah und doch so anders war. Aber das war früher gewesen.
Sein Handy piepte. Er nahm es, las die Nachricht, die er erhalten hatte, zog die Brauen hoch und kurz darauf schallte mein Name durch die Küche. »Jo-sie, Jo-sie«, Johlen und Pfeifen und wieder und wieder mein Name, bis die Rufe in tosendem Applaus endeten. Auf dem Bullen waren mir die dreizehn Sekunden deutlich kürzer vorgekommen, aber da musste ich auch nicht den Gesichtsausdruck meines Bruders ertragen. Er wechselte von peinlich berührt über verwundert zu ungläubig.
»Dreizehn Sekunden?« Er reichte das Handy meinem Vater, doch der schüttelte den Kopf. Klar, dass er nicht sehen wollte, wie ich von einem Bullen abgeworfen wurde. »Das ist … echt krass.« Er nickte anerkennend, und für einen Moment sah ich den alten Stolz auf seine furchtlose kleine Schwester aufflammen. »Aber glaub nicht, dass du dich aus Jobs rausreden kannst, nur weil dir jetzt der Hintern wehtut.«
Der Moment war vorbei und Patrick fiel wieder in seine neue »Ich bin hier der Boss«-Rolle zurück.
Ich griff nach der Liste. »Keine Angst. Ich habe weder vor die Gästezimmer noch das Abendessen mit meinem Hintern vorzubereiten.«
Trotz der Zerrung und der leichten Prellung in der Schulter kam ich gut voran. Allerdings hätte ich die Aufgaben auch im Schlaf erledigen können, selbst die Jobs, die normalerweise Martha übernahm. Ich fing im Gästehaus an. Es hatte zehn Zimmer. Ich weiß, das klingt nicht besonders viel, wenn man sie jedoch alle herrichten muss, sind es eindeutig zu viele. Es kostete mich trotz der zügigen Arbeitsgeschwindigkeit gut drei Stunden. Als Nächstes nahm ich den Küchenjob in Angriff und bereitete den Eintopf für den Abend vor, in Gedanken immer bei den grünen Augen des Greenys.
Wenn ich wenigstens seinen Namen wüsste! Ich überlegte, wen ich fragen, auf welchem Weg ich ihn erfahren könnte. Bei der letzten Kartoffel war das Herausfinden seines Namens zu einer fixen Idee geworden. Wobei es mir heute unbegreiflich ist, warum mir das so wichtig erschien – was hätte mir sein Name gebracht?
Gegen eins kam eine Nachricht von Dana. Cooles Video! Wer ist Yummy-Man? Zuerst begriff ich nicht, was sie meinte, dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Gabriel musste das Video mit meinem verhinderten Treppensturz gestern an Dana geschickt haben. Natürlich. Das Programm fragte einen automatisch, ob man das Video versenden wollte. Er musste auf Senden gedrückt haben, nachdem er die Aufnahme gestoppt hatte. Mit zittrigen Fingern suchte ich die Datei und spielte sie ab. Ich sah mich, Gabriel, das bunte Treiben in der Eisdiele, ich hörte Lachen, Reden und Musik, dann kam der viel zu schnelle Schwenk, als ich ins Leere getreten war, ich sah die Decke, den Boden, Beine, Rücken, Köpfe – und dann sah ich ihn. Mein Herz stockte. Da war sein Gesicht, halb von vorn, halb von der Seite, schräg von oben aufgenommen. Bei jedem anderen Menschen wäre die Aufnahme unvorteilhaft gewesen, die Nase hätte absurd groß, der Mund absurd klein gewirkt, doch sein Gesicht war perfekt im Fokus der Kamera. Ich drückte auf Pause und vertiefte mich in das Standbild. Prägte mir jedes Detail seines Gesichtes ein. Die hohen Wangenknochen, die dunklen Brauen über den grünen Augen, deren Grün noch intensiver und heller war als in meiner Erinnerung. Die gerade, etwas breite Nase, den leicht geöffneten Mund, als wollte er Hoppla! sagen, die winzige Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen, das eckige Kinn.
Wie lange ich auf das Standbild gestarrt hatte, kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen, aber es muss ziemlich ausgiebig gewesen sein, denn irgendwann rief mein Vater nach mir, verwundert, warum ich noch immer nicht zum Ausmisten erschienen war.
Ertappt steckte ich das Handy weg und lief zum Stall. In Windeseile mistete ich die Boxen aus und versorgte die Pferde mit frischem Stroh. Ich hoffte, die Arbeit würde mich etwas ablenken, doch das Gegenteil war der Fall. Nun waren es nicht mehr nur die grünen Augen, die mich verfolgten, es war sein ganzes Gesicht, das sich im Sekundentakt vor meine Augen schob. Anstatt den geheimnisvollen Greeny zu vergessen, stellte ich mir vor, dass er auf der Ranch als Sommerjobber anheuerte und mit mir gemeinsam die Pferde versorgte. Ich stellte mir vor, mit ihm die ein- und zweijährigen Jungpferde anzuleiten sowie die Dreijährigen und die Mustangs zuzureiten. Und ich war überzeugt, dass er der perfekte Kandidat für den Job war, besonders bei den wilden Mustangs, denen in den nächsten Tagen das erste Satteltraining bevorstand.
»Josie!« Mein Vater eilte auf mich zu und riss mich aus meinen Tagträumen. »Bist du von allen guten Geistern verlassen?«
»Warum?«, fragte ich und überlegte panisch, was ich angestellt haben könnte.
»Du kannst doch nicht den Eintopf unbeaufsichtigt auf dem Herd lassen! Der ist völlig verkocht!«
Ich Idiot! Siedend heiß fiel mir ein, dass ich beim Verlassen der Küche vergessen hatte, den Herd abzustellen.
»Tut … tut mir leid«, stammelte ich, doch mein Vater hatte sich schon kopfschüttelnd umgedreht und ging zur Küche zurück, wahrscheinlich um zu retten, was noch zu retten war.
Schuldbewusst wandte ich mich wieder der Stallarbeit zu, darauf bedacht, keine weiteren Fehler zu machen. Ich brachte die Pferde, die heute nicht bewegt werden würden, in die Führanlage und sattelte Bo, um mit ihr auf die Koppeln zu reiten und dort nach dem Rechten zu sehen. Da vibrierte mein Handy. Eine weitere Nachricht von Dana. WER ist denn nun Yummy-Man? Ich glaube, er steht gerade vor dem Laden.
WAS??? Bist du dir sicher?, antwortete ich mit zitternden Fingern, während ich vor lauter Schreck kaum noch Luft bekam.
Nicht 100%. Warte.
Ich wartete – obwohl es mir extrem schwerfiel. Und auch Bo hielt es kaum aus. Ich spürte, wie sie immer nervöser wurde und nicht begriff, warum ich mit ihr im Stall stand, anstatt endlich loszureiten. Aber ich konnte nicht. Sobald ich mich weiter als ein paar Hundert Yards von der Ranch entfernte, gab es kein Netz mehr. Gebannt starrte ich auf mein Handy, dann endlich vibrierte es erneut.
Ist weitergelaufen, als ich raus bin. Steht wohl nicht so auf Koreanerinnen mit Igel-Look Wann kommst du? Gabe muss heute früher weg.
Enttäuscht, aber irgendwie auch erleichtert tippte ich: So bald, wie’s geht, spätestens 5.
Dann ritt ich los. Ein paar Minuten zügelte ich Bos Drang zu galoppieren, während ich über meine Reaktion auf Danas Antwort nachgrübelte. Warum war ich erleichtert, dass sie ihn nicht mehr angetroffen hatte? Wo ich mir doch den ganzen Tag nichts anderes gewünscht hatte, als ihm zu begegnen. War ich nicht mehr ganz richtig im Kopf?
Ich schnalzte mit der Zunge und trieb Bo mit einem ultraleichten Druck meiner Unterschenkel in den Galopp. Es freute mich immer wieder, wie gut sie reagierte. Sie war perfekt zugeritten, und das war allein mein Werk. Nachdem wir regelrecht über die Felder geflogen waren, hielt ich zuerst bei der Koppel mit den Jungpferden, dann bei den Trekkingpferden, prüfte die Tränken und verteilte ein paar Leckerlis. Auf dem Rückweg hatte ich schließlich die Antwort auf meine Frage gefunden: Ich hatte Angst. Ich wollte ihn wiedersehen, das ja, aber allein der Gedanke, dass das wirklich passieren könnte, löste einen Schweißausbruch allererster Güte bei mir aus. Denn ich sah nur zwei Möglichkeiten, wie die Sache ausgehen konnte, und keine davon gefiel mir besonders.
Wenn er mich nicht wiedererkannte, würde ich vor Scham zerfließen und als Pfütze seine Erheiterung spiegeln.
Und falls er mich wiedererkannte, würde ich vor ihm stehen und nicht wissen, was ich sagen sollte. Hi, ich bin Josie, und wer bist du? Wahrscheinlich könnte ich ohnehin gar nichts sagen, weil mir vor Aufregung schlecht werden würde und ich zur nächsten Toilette rennen müsste. Und wie peinlich wäre das denn?
Nein, es gab einen guten Grund, warum ich erleichtert war, dass Dana ihn nicht angetroffen hatte, und der Grund war meine eigene Unzulänglichkeit in genau diesen Dingen. So tough und angstfrei ich war, wenn es darum ging, einem wilden, wütenden, bockenden Pferd zu zeigen, wer der Boss war, so sehr versagte ich in der Disziplin Coolness gegenüber Jungs, ganz besonders, wenn ein Junge mich irgendwie interessierte.
Trotzdem zog es mich mit aller Macht zum Virtual Reality Dome – vielleicht kam er ja zurück? Mein Benehmen war, aus heutiger Sicht gesehen, so rational wie das eines Kleinkindes vor dem Süßigkeitenregal. Ich brachte Bo schnell in ihre Box, vergewisserte mich, dass alle Türen ordentlich verschlossen waren, verpasste mir eine Speed-Dusche und stand um zwanzig vor fünf bei Dana im Laden.
Er war einfach eingerichtet, ein halbes Dutzend Tische mit je vier Stühlen, eine Getränke- und Essenstheke, eine separate Kasse mit Ausgabe der Brillen und Spiele, die man in speziellen Kabinen im ersten Stock benutzte. Die Wände allerdings waren extrem lässig: 3-D-Fototapeten mit Filmszenen aus Dead Man Walking, Iron Man und Speedster.
Natürlich wollte Dana alles über Yummy-Man, wie sie ihn beharrlich nannte, wissen. Also erzählte ich ihr alles – was erstaunlich wenig war angesichts der Tatsache, dass ich den ganzen Tag an nichts anderes gedacht hatte. Es war niederschmetternd. Und natürlich begann Dana sofort, hirnrissige Pläne zu schmieden, wie ich Yummy-Man finden und rumkriegen könnte – die ich allesamt vehement ablehnte. Zum einen waren fast alle Aktionen todpeinlich, zum anderen störte mich das mit dem »Rumkriegen«.
»Wozu dann der Aufwand?«, fragte Dana mich, inzwischen leicht genervt von meinem »Geziere«, wie sie es nannte.
»Welcher Aufwand?« Ich verstand wirklich nicht, was sie mit ihrer Frage meinte. Dass sie vorhin für mich auf die Straße gerannt war, um nachzusehen, ob der Typ am Fenster wirklich der Greeny aus dem Video war? Noch hatte ich schließlich nichts getan, außer meine Gedanken an ihn zu verschwenden. Doch sie ignorierte meine Gegenfrage.
»Ob du willst oder nicht, Babe, wenn er hier reinkommt, spreche ich ihn an.«
Irgendwie hatte ich das befürchtet. Gerade als ich ihr den Plan ausreden wollte, kam ein Pulk Gäste durch die Tür, und die nächste Stunde hatten wir alle Hände voll zu tun. Es war nicht das erste Mal, dass ich bei Dana im Laden aushalf. Die Arbeit erforderte keine nennenswerte Denkleistung. Dennoch musste ich mich heute besonders konzentrieren, denn ich merkte, wie sehr ich mich von jedem Schatten, der an den Ladenfenstern vorbeihuschte, ablenken ließ. Irgendwo in meinem Hinterkopf saß ein kleiner Teufel, der andauernd meinen Kopf Richtung Straße drehte.
»Dich hat es wirklich erwischt.« Dana kam zu mir, als der Besucherstrom abriss und ich mich mit einer Cola an einen der Fenstertische – klar, wo sonst – setzte.
Gedankenverloren nuckelte ich am Strohhalm und sah hinaus auf die Straße. Und plötzlich war da ein Gefühl der Leere in mir. Den ganzen Tag war ich aufgepeitscht gewesen, getragen von unsinnigen Träumen, die mir mit einem Mal nur noch albern erschienen.
»Kann sein«, murmelte ich und zwang mich, nicht zum Fenster zu schielen, sondern meine Augen auf Dana zu richten. »Aber ich will mich nicht zum Clown machen, klar?«
Dana kicherte. »Du und Clown? Ganz sicher nicht. Ich habe das Video von deinem Ritt gesehen. Du bist so cool …«
Ich stöhnte. Mein Bruder hatte das Video, Dana hatte es und wahrscheinlich die Hälfte der Einwohner von Angels Keep. Ich war heilfroh, dass Ferien waren. Mir graute vor der Vorstellung, was mir heute in der Schule geblüht hätte – im Mittelpunkt zu stehen gehörte nicht zu meinen Stärken, deshalb war ich auch froh, dass Dana immer die Aufmerksamkeit auf sich zog, wenn wir gemeinsam unterwegs waren. In diesem Moment kam ein Junge auf uns zu. Ich schätzte ihn etwa so alt wie Dana und mich, und da ich ihn nicht kannte, nahm ich an, dass er nicht aus Angels Keep war. Er tippte mir auf die Schulter und ich sah fragend zu ihm hoch.
»Möchtest du etwas trinken?«
»Bist du das Bullriding-Mädchen?«, fragte er schüchtern.
Ich spürte, wie ich augenblicklich errötete.
»Sie ist es«, sagte Dana. »Rodeo-Josie live im Virtual Reality Dome. Ist heute im Preis inbegriffen.«
»Das war … echt Wahnsinn«, stotterte der Junge. »Wo kann man das lernen?«
Ich lächelte ihn freundlich an. »Man wächst auf einer Ranch auf und fängt mit vier Jahren an zu reiten.«
»Oh. Ach so«, sagte er, offenbar enttäuscht, dass ich ihm keinen Crash-Kurs in totaler Körperbeherrschung anbieten konnte. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Dana mühsam gegen einen Lachanfall kämpfte.
»Vielleicht nehme ich mal einen Bullriding-Kurs in unser Ferienprogramm auf«, sagte ich, noch immer lächelnd. »Ich mach dann hier einen Aushang.«
»Oh, cool. Dann …« Hilflos starrte er auf seine Hände.
»Vielleicht doch eine Cola?«, fragte Dana.
»Nee, ich … muss … äh, los«, stammelte er mit einem unsicheren Seitenblick auf mich und verließ eilig den Laden.
Dana lachte, doch ich konnte nicht einstimmen. Würde ich erneut vor dem Greeny stehen, ich würde genauso stotternd und hilflos auf meine Hände starren.
Wie nicht anders zu erwarten, war der Greeny auch den Rest des Abends nicht mehr aufgetaucht. Um zehn war meine Schicht vorbei und ich fuhr gleich nach Hause, trotz Danas Versuchen, mich noch zu einer Spritztour in Billy’s Diner zu überreden. Ich war müde und hatte keine Lust, noch weiter über den geheimnisvollen Unbekannten zu reden.
Zu Hause meldete ich mich nur kurz zurück und schlich sofort auf mein Zimmer. Kaum lag ich im Bett, zog ich mein Handy hervor und spielte erneut das Video ab. An der Stelle mit dem Sturz schaltete ich auf Pause. Wie hypnotisiert glotzte ich das Standbild an. Ich war definitiv in einem Zustand völliger geistiger Verwirrung.
Je länger ich auf sein Gesicht starrte, desto mehr ärgerte ich mich über mich selbst. Ich benahm mich wie all die Mädchen, für die ich sonst nur ein müdes Lächeln übrighatte. Solche, die das Poster eines Popstars anhimmelten und sich stundenlang für ein Autogramm in eine Schlange stellten und dann vor lauter Aufregung in Ohnmacht fielen, wenn der Star endlich auftauchte. Ich stand mit meinem Verhalten auf genau dieser Stufe des Irrsinns und das gefiel mir nicht.
Also entschied ich, es auf der Stelle zu beenden. Ich schloss das Video, um es zu löschen, als mein Handy vibrierte.
Dana.
Ich öffnete die Nachricht. Ein Foto, aufgenommen in Billy’s Diner, im Fokus des Bildes ein Mann, so verschwommen, dass er wie ein Schatten wirkte. Darunter Danas Kommentar: Ist er das?
Ich schüttelte den Kopf, unsicher, ob ich mich ärgern oder lachen sollte über ihren Versuch, mich aufzuziehen: mein geheimnisvoller Unbekannter als Schattenmann. Typisch Dana. Schließlich musste ich grinsen und fragte mich, welchen Fotoeffekt sie wohl verwendet hatte, um den Schatten so gut hinzubekommen.
ALS ICH AM NÄCHSTEN MORGEN erwachte, war die Macht der grünen Augen zum Glück verblasst. Der Greeny schwirrte zwar lästig wie eine surrende Fliege in meinen Kopf herum, aber ich konnte ihn schnell vertreiben. Es war sechs Uhr und meine Schulter schmerzte noch ein wenig, die Zerrung im Arm hatte jedoch bereits deutlich nachgelassen. Ich zog mich an und gesellte mich zu meinem Bruder in die Küche, um das Frühstücksbuffet für die Feriengäste vorzubereiten – auch das war normalerweise Marthas Job, und ich hoffte, dass ihre Sommergrippe bald vorbei war.
»Auch schon da«, begrüßte mich Patrick und ich verkniff mir eine sarkastische Antwort. Schweigend widmeten wir uns unseren Aufgaben; wir waren perfekt aufeinander eingespielt, und es brauchte keine Worte, um dem anderen zu sagen, was noch zu tun war. Als das Buffet aufgebaut und die Tische eingedeckt waren, schenkte Patrick mir einen Kaffee ein.
»Ich hab mal nachgedacht.«
Fragend sah ich ihn über den Rand meiner Kaffeetasse an.
»Das mit dem Bullriding«, sagte er zögernd. »Wir könnten daraus Kapital schlagen.« Er zog ein Blatt Papier aus der Hosentasche. »Du bist jetzt so was wie eine Berühmtheit, du könntest Kurse anbieten, wie man sich auf dem Ding halten kann. Ich hab mal ausgerechnet, was wir an Leihgebühren und Werbung investieren müssten und was unterm Strich für uns hängen bleiben würde.« Er reichte mir den Zettel und ich überflog seine Zahlen. Zugegeben, sie waren vielversprechend, allerdings schätzte ich sein veranschlagtes Interesse an dieser Art von Vergnügen als zu optimistisch ein. So viel Zulauf Bullriding bei Festen auch hatte, es war nur ein Spaß, ein paar Sekunden Adrenalin. Wer würde sich außerhalb eines Festes ernsthaft damit beschäftigen wollen?
»Ich hab auch schon einen Slogan: Bodytraining für stahlharte Kerle.«
Ich musste grinsen. »Superidee. Und dann kommen sie und treffen auf mich. Was bin ich dann? Die stahlharte halbe Portion?«
Er schürzte die Lippen. Ein Zeichen, dass er darüber nachdachte, wie er den Makel an seiner Verkaufsstrategie beseitigen könnte. »Überlegst du es dir?«
Ich verdrehte die Augen.
»Bitte, Josie«, sagte er drängend. »Das könnte echt was abwerfen. Wir können es uns nicht leisten, solche Chancen zu ignorieren.«
Ich hob verwundert die Brauen. Was meinte er damit? So schlecht konnte es um die Ranch doch nicht stehen, dass wir auf irgendwelchen Jahrmarktfirlefanz zurückgreifen mussten. Vor allem jetzt, wo die Mustang-Saison begann und wir bereits sieben feste Bestellungen für Wildpferde hatten, die von mir zugeritten waren.
Ein Klopfen an der Küchentür unterbrach meine Gedanken. Ein großer, hagerer Mann mit schütterem braunen Haar steckte den Kopf durch die Tür.
»Entschuldigung«, sagte er, »ich bin Eli Brown. Ich bin gestern zu spät für die Einweisung gekommen, wo ist denn der Frühstücksraum?«
Automatisch setzte ich mein Pensionswirtinnenlächeln auf. »Die nächste Tür rechts. Aber Frühstück gibt es erst in zwanzig Minuten. Soll ich Ihnen in der Zwischenzeit den Rest der Ranch zeigen?«
Sein Gesicht hellte sich auf, als hätte ich ihm gerade eine Gratismahlzeit versprochen. »Sehr gerne.«
Da wir bereits im Hauptgebäude waren, begann ich dort die Sondertour für Eli Brown. Ich führte ihn von der Küche in das geräumige Esszimmer mit Zugang zu der überdachten Veranda, auf der im Sommer die Mahlzeiten eingenommen wurden – außer es regnete oder die Mücken waren zu lästig. Von dort ging ich zu dem im Westernstil eingerichteten Aufenthaltsraum, dessen wild zusammengeschusterte Sitzgruppen inzwischen schäbig wirkten, doch ich verkaufte das bunte Chaos immer als Flair der frühen Pionierzeit. Als ich seinen skeptischen Gesichtsausdruck bemerkte, erklärte ich ihm schnell, wo das Büro und die Gästetoiletten waren.
»Und wo geht es dort hin?«, fragte er und deutete auf die Treppe, als ich ihm im Flur den Durchgang zum Gästehaus zeigte.
»Das ist unser Privatbereich. Wir bitten alle Gäste, das zu respektieren.«
»Ihr wohnt dort oben?«
»Ja.«
Er sah mich nachdenklich an. »Stört euch das nicht, wenn hier immerzu Gäste durch das Haus laufen?«
Ich lachte den Funken Wahrheit in seiner Annahme weg. Es störte nicht nur, sondern nervte manchmal sogar gewaltig, wenn unten das Lachen bis in die Morgenstunden nicht enden wollte und die Toiletten- und Durchgangstüren permanent auf- und zugeschlagen wurden. »Viel störender wäre es, wenn keine Gäste durch das Haus laufen würden.«
Er runzelte kurz die Stirn, dann lächelte er. »Ich verstehe.«
Da er das Gästehaus schon gesehen hatte, setzte ich die Tour draußen fort und führte ihn zum Hauptstall. Dort wanderte er von Box zu Box und studierte jede einzelne der zwanzig Tafeln. »Das sind alles eure Pferde?«
»Nein.« Ich zeigte auf die zehn Boxen auf der linken Seite. »Die ersten sieben sind unsere Zuchtstuten, in Box acht und neun werden die Pferde eingestellt, die zu uns zur Schulung gebracht werden, und in der letzten Box ist mein Pferd.« Mein Arm wanderte zur rechten Seite des Stalls. »Box eins bis neun sind vermietet, dort sind die Einstellpferde, die von uns versorgt werden. Und –«
»Zur Schulung?«, unterbrach Eli Brown mich.
»Ja. Wenn Pferde Befehle nicht verstehen oder zu schnell scheuen oder zum Springen oder für die Dressur ausgebildet werden müssen.«
»Und dafür habt ihr spezielle Trainer?«
Ich zögerte kurz und versuchte abzuschätzen, was er mit seinen Fragen bezweckte: War es reine Neugier? Oder hatte er Pferde, die geschult werden mussten, und war auf der Suche nach einem guten Trainer? Ich war gut, dennoch schreckte es potenzielle Kunden zunächst oft ab, wenn sie erfuhren, dass ihre wertvollen Pferde bei uns von einem Schulmädchen auf Vordermann gebracht wurden. Schließlich entschied ich mich, bei der Wahrheit zu bleiben.
»So oft es geht, mache ich das, sonst holen wir einen externen Trainer.«
»Du?« Er sah mich erstaunt an und ich erriet seine nächste Frage.
»Ich bin sechzehn«, kam ich ihm zuvor. »Früher hat das meine Mutter gemacht. Vielleicht haben Sie von ihr gehört? Emily O’Leary. Sie war die beste Dressurreiterin im Staat Washington«, sagte ich stolz. »Die Leute sind über dreihundert Meilen zu uns gefahren, um ihre Pferde von ihr ausbilden zu lassen.«
»Ah«, sagte er nur, und ich wunderte mich, dass er keine weiteren Fragen zu meiner Mutter stellte. Warum sie zum Beispiel heute keine Schulungen mehr machte. Aber da sprach er schon weiter.
»In aller Herrgottsfrühe aufstehen, um das Frühstück herzurichten, Pferde zureiten – und da kommt sicher noch das ein oder andere dazu … Ist das nicht hart?«
Hart. Bilder, die ich nie wieder in meinen Kopf lassen wollte, schossen mir vor Augen, und ich schluckte schwer gegen den Kloß an, der sich in meiner Kehle festzusetzen drohte. Eli Brown hatte keine Ahnung, was hart war. Um sechs Uhr aufzustehen, Wurst- und Käseplatten zu belegen und Pferde zuzureiten gehörte jedenfalls nicht in diese Kategorie.
»Ich habe damit kein Problem«, sagte ich leichthin und hoffte, dass das Thema damit für ihn erledigt war.
»Und dein Bruder?«, bohrte er weiter, und ich frage mich heute, ob ich in dem Moment nicht hätte merken müssen, dass hinter Eli Browns freundlichem Interesse nicht einfach nur Neugier steckte.
»Was ist mit meinem Bruder?«
»Ist er auch so fleißig?«
»Wir tun beide, was getan werden muss. So funktioniert eine Ranch. Jeder hilft mit«, antwortete ich ausweichend. Eli Brown musste nicht wissen, dass Patrick inzwischen den Hauptteil der Verwaltungsarbeiten übernommen hatte und seine Ausbildung zum Pferdefachwirt nur deshalb nicht abbrechen musste, weil die Schule ihm eine Sondererlaubnis für ein Fernstudium erteilt hatte.
Doch Brown gab nicht so leicht auf. »Verdienst du wenigstens ordentlich?«
Ich erstickte den Lacher, der mir entschlüpfen wollte, und nickte. »Ich habe alles, was ich brauche.« Es war nicht einmal eine Lüge. Bis vor Kurzem zumindest, bevor mein Bruder auch den Part mit den Finanzen übernommen und den von meinem Vater großzügig geöffneten Geldhahn rigoros zugedreht hatte. Aber auch das musste Eli Brown nicht wissen. Überhaupt wurde mir seine Fragerei langsam zu viel, also zeigte ich demonstrativ auf zwei Türen im hinteren Bereich des Stalls und sagte schnell: »Dort sind Sattel- und Futterkammer und da drüben …« Ich führte ihn hinaus und ging mit ihm zu dem halb offenen Unterstand neben dem Heuschober. »Hier sind die Trekkingpferde im Winter untergebracht.«
Sein Blick wanderte zu den Baracken, die am Waldrand standen. »Und was ist das?«
»Unterkünfte für die Rancharbeiter«, erklärte ich knapp und blickte hastig auf meine Uhr. »Oh! Schon fast acht! Tut mir wirklich leid, aber ich muss Patrick mit dem Frühstück helfen.«
»Natürlich.« Brown lächelte schuldbewusst. »Wie unaufmerksam von mir. Ich habe schon viel zu viel von deiner Zeit in Anspruch genommen.«
Ich lächelte zurück und eilte in die Küche, wo Patrick das Rührei und die Würstchen zubereitete. Die ersten Gäste eroberten gerade ihre Plätze. Ich nahm den Kaffee und ging hinaus, gespannt, mit wem ich nächste Woche die Ranch teilen würde.
Der Tag war wie im Flug vergangen und zu meiner großen Erleichterung waren die meisten Gäste nett und unkompliziert. Nur einer schien von der Ranch und dem Programm enttäuscht zu sein. Sein Name war Marcus Dowby, und er hatte keine Gelegenheit ausgelassen, sich über Nichtigkeiten zu ereifern und die anderen Gäste auf Unzulänglichkeiten im Service hinzuweisen. Glücklicherweise waren Patrick und mein Vater außer Hörweite, als er geschlagene zehn Minuten über das ungenießbare Abendessen wetterte und sich und den anderen Gästen ausmalte, aus welcher Tonne wir wohl die Zutaten für den heutigen Fraß wühlen würden. Ich presste schuldbewusst die Lippen zusammen und tat so, als würde ich seine Gemeinheiten nicht hören. Zugegeben, das gestrige Essen hatte ich gründlich verhunzt, heute Abend jedoch würde sich niemand beschweren können. Mein Vater hatte sich selbst zum Küchendienst eingeteilt und ich war ehrlich gesagt froh darüber. Kochen gehörte nicht gerade zu den Dingen, in denen ich brillierte.
Patrick hatte ich seit dem Frühstück nicht mehr gesehen. Während ich zielstrebig meine Aufgaben abarbeitete und mir in den Pausen stoisch verbat, das Video mit dem Greeny anzuschauen oder allzu intensiv die Möglichkeiten auszuloten, ihm heute Abend bei Dana über den Weg zu laufen, war er damit beschäftigt, die zwei neuen Sommeraushilfen einzuweisen. Je näher das Ende meiner Arbeitszeit rückte, desto sorgfältiger vermied ich es, ihm vor die Füße zu laufen und so die Chance zu geben, mich erneut auf sein Bullriding-Projekt anzusprechen. Dann endlich konnte ich in mein altes Auto steigen und mit fünfzehn Minuten Verspätung zu Dana in den Virtual Reality Dome fahren.
Kaum betrat ich den Laden, winkte sie mich aufgeregt hinter die Theke. Auf der anderen Seite diskutierte eine Gruppe Jungs, und ich hörte an ihrer Stimmlage, dass sie verärgert waren.
»Was ist los?«, flüsterte ich Dana zu.
»Irgendein Problem mit den Brillen«, erklärte sie. »Ich habe Gabriel angerufen. Er kommt gleich noch mal her.«
Einer der Jungen, ein großer Blonder, den die anderen offenbar zum Wortführer auserkoren hatten, wandte sich nun an Dana. »Wir wollen unser Geld zurück.«
»Geht’s noch? Ihr habt fast eine Stunde gespielt«, konterte sie.
»Ja, und es gab die ganze Stunde Aussetzer.«
»Warum habt ihr euch dann nicht früher beschwert?« Dana stemmte ihre Arme in die Hüften.
»Wir dachten, es gehört zum Spiel.«
»Vielleicht gehört es das.« Sie zog die Brauen zusammen. »Was ist eigentlich das Problem?«
Inzwischen waren zwei weitere Spieler aus dem ersten Stock dazugestoßen und knallten ihre Brillen auf den Tresen. »Was ist das denn für ein Dreck? Habt ihr die Billigware von zu Hause mitgebracht?«
»Chinesischer Schrott, eindeutig«, fügte der andere hinzu.
Ich linste zu Dana. Auf ihrer Stirn zeichneten sich bei der Anspielung auf ihre Herkunft Gewitterwolken ab. Nicht, dass sie sich für ihre koreanischen Wurzeln schämte. Aber es ärgerte sie, wenn jemand sie aufgrund ihrer schwarzen Haare und ihrer asiatischen Gesichtszüge in die Schublade Chinesin steckte.
»Kannst du genau erklären, was das Problem ist?«, mischte ich mich ein, bevor Dana einen ihrer berüchtigten Ausraster bekam.
»Die Bilder sind gestört«, sagte der Typ, der die Brillen als chinesischen Schrott bezeichnet hatte. »Erst ist alles normal und plötzlich rauscht es und die Bilder sind zerhackt oder ganz weg. Dann sind sie wieder da, aber total verwackelt, und dann ist wieder alles normal, bis die Scheiße von vorne losgeht.«
»Und manchmal sind Schatten in den Bildern«, fügte der Blonde hinzu.
»Zerhackte Bilder und Rauschen?«
Ich sah auf, als ich Gabriels Stimme vernahm. In dem ganzen Hin und Her hatte ich nicht gehört, wie er den Laden betreten hatte. Er machte sein »Lass mich mal sehen«-Gesicht, stellte sich neben den Blonden und nahm ihm die Brille aus der Hand. »Läuft das Spiel noch?«
Der Typ nickte.
Gabriel setzte sich die Brille auf und schaltete auf Funkmodus. Er drehte ein paarmal den Kopf von links nach rechts, dann setzte er die Brille wieder ab. »Scheint alles normal zu sein.«
Als lautstarker Protest folgte, hob Gabriel die Hand. »Ich habe nicht gesagt, dass alles gut ist, es scheint nur auf den ersten Blick alles in Ordnung zu sein. Wir müssen prüfen, was das Problem ist.«
»Wir wollen unser Geld zurück«, forderte der Blonde erneut für seine Gruppe.
»Das Problem sind die Brillen«, blökte der andere Typ und wiederholte seine abfällige Bemerkung von vorhin: »Die sind chinesischer Schrott.«
»Sind sie nicht!«, fuhr Dana ihn an. »Bis eben haben sie hervorragend funktioniert. Und übrigens«, sie zeigte auf die Herstellerangabe auf der Innenseite der Brille, »kommt der chinesische Schrottoriginal aus Wyoming und ist das mit Abstand beste Modell, das zurzeit auf dem Markt ist.«
Wie auf Kommando prüften alle ihre Brillen.
»Ist es nicht sehr ungewöhnlich, dass alle Brillen gleichzeitig einen Aussetzer haben?«, fragte ich nachdenklich. Dass mal das ein oder andere nicht funktionierte, konnte vorkommen. Aber vor uns standen acht Kunden, und das hieß, acht Brillen oder, falls das Problem in der Übertragung lag, acht Stationen waren gleichzeitig kaputt.
»Ist es«, stimmte Gabriel mir zu. Auch er sah jetzt sehr nachdenklich aus. »Ich glaube nicht, dass es an den Brillen liegt.«
»Ist mir doch egal, was das Problem ist, wir wollen unser Geld zurück«, forderte der Blonde gereizt und erntete zustimmendes Nicken.
»Kann ich verstehen«, sagte Gabriel, worauf Dana ihm prompt einen warnenden Blick zuwarf. »Nur wird das heute nicht möglich sein.«
Protestgemurmel erhob sich und Gabriel beeilte sich, die Kunden zu beschwichtigen. »Mr und Mrs Wang sind nicht da und Dana hat keinen Stornoschlüssel. Also, ich schlage Folgendes vor: Ihr trinkt jetzt eine Gratiscola, Josie und ich testen die Brillen. Falls wir das Problem beheben können, spielt ihr nachher weiter, falls nicht, bekommt ihr einen Gutschein.«
Ich sah ihn an. Glaubte er wirklich, das alles ließ sich so einfach beheben, oder war es nur eine Taktik, um die Gemüter zu beruhigen?
Während sich die verärgerten Jungs mit ihren Gratisgetränken an die Tische setzten und Dana die neu eintrudelnden Kunden vertröstete, gingen Gabriel und ich mit zwei der Brillen in eine der Spielkabinen. Gabriel prüfte das Spiel.
»Zombie 4 – Das letzte Versteck. Gute Wahl«, murmelte er, streifte die Schuhe ab, befestigte die Klettgurte der Spielstation an seinem Körper und nahm seine Waffe auf. Ich verzog das Gesicht. Eine gute Wahl hätte bei mir anders ausgesehen, aber wir taten das ja nicht zu unserem Vergnügen, sondern erledigten einen Job. Also ging ich zu meiner Station, stellte mich auf das Pad, das meine Schritte in das Spiel übertrug, und schnallte mir ebenfalls den Gurt um, der mich beim Laufen in meiner Station hielt. Der Vorspann verlief reibungslos, dann kamen die Wahl des Levels und die Frage nach der Anzahl der Spieler. Bevor ich reagieren konnte, hatte Gabriel die Antworten bereits eingeloggt und das Spiel begann.
Ich hasste Zombie 4 – Das letzte Versteck. Ich hasste es, wenn ich durch die Straßen hetzte und plötzlich einer oder gleich mehrere der gruseligen Zombies mit ihren absurd eckigen Bewegungen und blutverschmierten Gesichtern vor mir auftauchten. Dana und Gabriel war es unbegreiflich, warum mir diese Kreaturen mit ihren toten Augen Angst machten. Schließlich sei es nur ein Spiel, es gäbe ja keine Zombies, wie Dana jedes Mal betonte. Dennoch bekam ich regelrecht Panik, wenn ich in einer Sackgasse landete und ein Mob Untoter knurrend auf mich zuwankte, die ekligen Klauen gierig nach mir ausgestreckt.
Auch an diesem Tag flößte es mir Angst ein; mehr als einmal musste ich dem Drang widerstehen, mir die Brille herunterzureißen, um den virtuellen Monstern zu entkommen. Und das bereits in den ersten zehn Minuten. Es gab eine Menge Grusel, aber kein Rauschen, keine zerhackten Bilder oder Schatten, die uns gestört hätten.
»Können wir aufhören?«, fragte ich Gabriel.