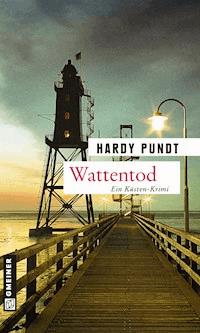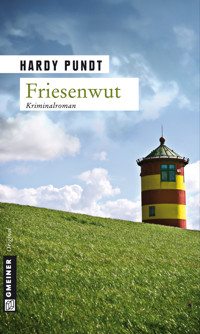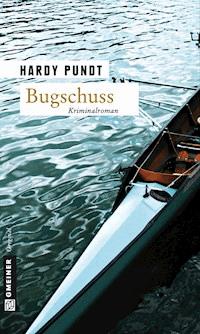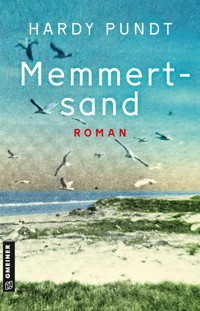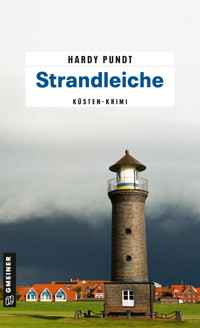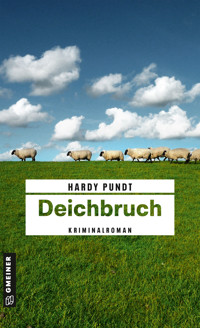
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Wiard Lüpkes lebt in einem kleinen Landhaus hinter dem neu errichteten Deich. Doch die Idylle in der ostfriesischen Leybucht ist trügerisch. Schon während der ersten höheren Flut entdeckt Wiard, dass ungewöhnlich viel Wasser den Deichfuß durchdringt. Kurz darauf scheint sich sein Verdacht, beim Deichbau könne nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein, zu bestätigen: Als er sich an einem stürmischen Herbsttag zusammen mit seinen Freunden August Saathoff und Lübbert Sieken aufmacht, um nach Beweisen für den Pfusch am Bau zu suchen, peitscht ein tödlicher Schuss durch die Dämmerung …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hardy Pundt
Deichbruch
Kriminalroman
Zum Buch
TÖDLICHE Flut Wiard Lüpkes lebt in einem kleinen Landhaus hinter dem neu errichteten Deich. Doch die Idylle in der ostfriesischen Leybucht ist trügerisch. Schon während der ersten höheren Flut entdeckt Wiard, der selbst als Leiharbeiter am Bau des Deichs beteiligt war, dass ungewöhnlich viel Wasser den Deichfuß durchdringt. Die Gefahr ist groß, dass der Deich den Naturgewalten nicht standhalten wird – eine Katastrophe für die Polder-Bewohner. Kurz darauf scheint sich der Verdacht, beim Deichbau könne nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein, zu bestätigen: Durch das Fenster von Wiards Wohnhaus wird ein Stein geworfen, versehen mit einer Drohung. An einem stürmischen Herbsttag macht er sich zusammen mit seinen Freunden August Saathoff und Lübbert Sieken auf, um nach Beweisen für den Pfusch am Bau zu suchen, doch plötzlich peitscht ein tödlicher Schuss durch die Dämmerung …
Dr. Hardy Pundt wurde 1964 geboren. Er wuchs mit seinen Geschwistern auf der Insel Memmert auf, wo die Großeltern und sein Vater Inselvogte waren. Seine Schulzeit verbrachte er auf der Insel Juist sowie dem ostfriesischen Festland. Es folgten Studium, Promotion und Habilitation an der Universität Münster. Sein Lebensmittelpunkt liegt seit Längerem in Schleswig-Holstein. Lehre und Forschung im Bereich Geoinformatik ziehen ihn jedoch regelmäßig an die Hochschule Harz in Wernigerode. Er veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Beiträge in deutscher und englischer Sprache. Außerdem sind bereits sechs Kriminalromane von ihm erschienen, in fünf davon ermitteln Tanja Itzenga und Ulfert Ulferts.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Neuausgabe 2024
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Hans / Pixabay
ISBN 978-3-8392-3062-6
Vorab …
Meldung, Sommer 2006
Pfusch beim Deichbau nach ›hause‹
Kein Experte bezweifelt, dass die Dämme auf der Strecke von 270 Kilometern pünktlich zum Beginn der neuen Hurrikan-Saison am 1. Juni fertig sind. Doch im Wettlauf mit der Zeit zählt Quantität anscheinend mehr als Qualität. So würden die von der Regierung eingesetzten Pioniere die Dämme in der Eile nur notdürftig reparieren. Hauptkritikpunkt der Experten: Die rund 500 Ingenieure würden minderwertiges Baumaterial benutzen, das dem neuen Deich alles andere als Stabilität gebe. »Die Regierung täuscht den Bewohnern der Stadt eine Sicherheit vor, die es nicht gibt«, schimpft Ivor van Heerden von der Universität Louisiana in der ›Washington Post‹.
Prolog
Die Abenddämmerung brach herein, und von Westen peitschte eine Bö nach der anderen über die Deichkrone. Der Regen schien von Minute zu Minute stärker zu werden, die Bäume im Polder beugten sich ehrfürchtig vor dem Sturm, der dort über die See und, hinter dem Deich, über das Marschland fegte.
Lübbert Sieken lag oben auf der Deichkrone, durchnässt und den wilden Gebärden des Sturmes schutzlos ausgesetzt. Er war einfach zusammengesackt, als hätte ihn der Wind umgeworfen, was, wenn man hier oben nicht aufpasste, durchaus geschehen konnte. Aber einen wie Lübbert Sieken, der zeit seines Lebens hinter dem Deich gelebt hatte und nichts besser kannte als das Land dahinter und das Wattenmeer davor, den haute kein Wind um, auch kein Orkan. Selbst nach obligaten Besäufnissen im Dorfkrug – bei Feuerwehr- oder Sportfesten oder aus welchem Grund auch immer –, Lübbert hatte stets den Weg nach Hause gefunden, auf eigenen Füßen. Da musste schon etwas anderes passieren, dass er umfiel.
Durch das nasse Gras des Deiches quoll hier und da aufgeweichtes Erdreich, was das Ganze zu einer dreckigen, schmuddligen Pampe aufweichte, die in großen Klumpen an den Stiefeln kleben blieb, wenn man hineintrat. Dort, wo Lübbert jetzt lag, mischte sich Blut in den wasserdurchtränkten Schlamm.
Wieder erfasste eine Orkanbö die beiden Männer, die fassungslos über dem Körper von Lübbert Sieken knieten und für einige Zeit nicht wussten, was sie denken oder tun sollten. Instinktiv hatte August sein Taschentuch aus der Hose gerissen und es auf die Wunde gedrückt, aus der Blut schoss. Doch es troff daran vorbei, färbte Augusts Taschentuch, seine Hand, den Ärmelanfang seiner Jacke und den Boden rötlich – schnell wurde das Blut durch den starken Regen weggespült. Doch neues quoll nach.
Wiard hielt Lübberts Kopf: »Lübbert, Mann, Lübbert, was ist los? Sag doch was!« Aber Lübbert schwieg, die Augen geschlossen.
»Er lebt noch«, meinte Wiard, »ich spüre seine Halsschlagader.« August sah in die Gesichter. »Dann los, keine Zeit verlieren, wer auch immer hier herumgeballert hat – erst mal müssen wir Lübbert helfen.«
In der hereinbrechenden Dunkelheit und bei tosendem Sturm versuchten die beiden Männer, Lübbert Sieken hinunter zum Deichfuß und dann zu ihrem Auto zu tragen. Das hatten sie glücklicherweise auf dem gepflasterten Parkplatz abgestellt, sonst wäre es im Modder versunken.
1
August Saathoff war kaum zu sehen, ganz unten in seinem neuen Melkstand. Sein Vater, längst auf dem Altenteil, aber noch immer erstaunlich agil und bei guter Gesundheit, half ihm nach wie vor fast jeden Tag im Stall.
»Was habt ihr das heute gut«, rief er seinem Sohn zu, »früher haben wir das alles mit der Hand gemacht und heute, Knopfdruck, Kuh in den Melkstand, Sauger ran an die Zitzen, melken und wieder ab in den Stall, wo sie laufen können nach Herzenslust«, er lächelte.
August entgegnete: »Ihr hattet zu den Zeiten auch nur acht Kühe, ich habe jetzt über 60.« In seinem Melkstand konnten mehrere Kühe gleichzeitig gemolken werden. Beide, Vater und Sohn, waren mächtig stolz auf die Anlage. Der neue Laufstall war schon im vorigen Jahr fertig geworden, und nun auch der Melkstand mit allem neuen technischen Pipapo, was Vater Saathoff gerade dann gerne erwähnte, wenn andere dabei waren.
Der Saathoff’sche Hof lag unweit des Deiches; er war nur knapp anderthalb Kilometer entfernt. Etwa acht Kilometer betrug die Entfernung nach Norden, vor langer Zeit noch Kreisstadt, bis diese Rolle von Aurich übernommen worden war; Kreisreform, wieder einmal. Im Nachbardorf machten August oder seine Frau den Großeinkauf, gab es in ihrem engeren Umkreis doch weit und breit keinen Supermarkt. Augusts Vater hatte kurz nach dem Krieg ein stattliches Stück Land vererbt bekommen, von einem Großonkel, mit dem er eigentlich gar nicht viel zu tun gehabt hatte, immerhin einige Hektar bester Acker, Marschboden. Im Laufe der Zeit hatte er sich aber zunehmend auf die Milchwirtschaft konzentriert, die Herde war gewachsen, und nun führte sein Sohn den Hof sehr professionell weiter. Die Milch brachte den Löwenanteil des Einkommens, das Getreide – je nach weltwirtschaftlicher Preislage und EU-Politik – einen zusätzlichen Beitrag, der mal mehr, mal weniger hoch war. »Hauptsache, man zahlt nicht drauf«, waren Augusts Worte, wenn das Gespräch darauf kam, und mitunter musste man sich Gedanken machen, ob sich der immens hohe Aufwand der Bodenbearbeitung, der Unkraut- und Schädlingsbekämpfung, des Säens und Spritzens lohnte, wenn der Erlös gerade mal die investierten Kosten ausglich. Und da die Milchpreise in den letzten Jahren zunehmend unter Druck geraten waren, hatte es August manch schlaflose Nacht gekostet, in der er darüber nachdachte, wie hoch der Kredit sein musste, um den neuen Laufstall zu errichten und den zugehörigen Melkstand zu kaufen. Aber Landwirte, die nicht investierten, wären in wenigen Jahren am Ende, so hatten die Banker und Berater ihm immer wieder in den Ohren gelegen. Schließlich hatte er es getan. Ein nagelneuer Kuhstall, in dem die Kühe sich weitgehend frei bewegten, ein ultramoderner Melkstand, alles neu, glänzend, »eben einfach schön«. Das hatte er gestern noch Jakobus de Ruyter erzählt, der beeindruckt mit dem Kopf genickt hatte. De Ruyter hatte einen anderen Hof im Polder. Hier kannte jeder jeden. Nun zwang sich August also, mehr an die Vorzüge der Hochtechnologie und den schmucken Stall zu denken und weniger an das Geld, das dabei Monat für Monat von seinem Konto verschwand – auch wenn die Zinsen für den Kredit vergleichsweise gering waren. Er war sich nicht sicher gewesen, ob er überhaupt bewilligt werden würde – die Banken stellten sich in den letzten Jahren sehr an, wenn es um Kredite für Landwirte ging.
»Ich muss jetzt gehen«, rief Augusts Vater seinem Sohn zu. »Du weißt ja, Mutter und ich gehen heute Abend ins Theater, da muss ich mich noch stadtfein machen. Ich habe man noch gerade eine Stunde Zeit, sie wird wohl schon auf heißen Kohlen sitzen.«
Sein Sohn grüßte nur kurz mit der Hand und bedeutete ihm damit gleichzeitig, dass er den Rest ohne Probleme schaffen würde. Sein Vater verließ den Melkstand über die schmale Treppe gerade in einem Augenblick, in dem alle Boxen besetzt waren und die Kühe mit großen, aber – da sie alle an der Melkmaschine hingen – zufriedenen Augen hinter ihm her glotzten. August machte sich mit großem Eifer daran, auch die letzten Kühe zu melken, und durchdachte dabei schon den nächsten Tag. Als auch er fertig war, ging er nochmals voller Zufriedenheit durch die neuen Anlagen. Neben dem Laufstall hatte er eine große Halle gebaut. Nun präsentierte sich der Hof im Bestzustand. Gebäude, Maschinen, Anlagen, fast alles war neu oder fast neu, funktionierte jedenfalls tadellos und vereinfachte die Arbeit erheblich. Ausnahmen waren lediglich der alte John-Deere-Mähdrescher, der zwar schon eine Kabine hatte, die aber für heutige Standards ziemlich komfortlos gebaut war. Und der gute, alte McCormick-Schlepper, 70 PS, im Moment nicht angemeldet. Was sich aber bald ändern sollte, da der Trecker, obwohl 35 Jahre alt, nach wie vor problemlos lief, auch im Winter immer ansprang und August ihn für den Straßenverkehr nutzen wollte, um ein neu gepachtetes Stück Ackerland, das etwas entfernt vom Hof lag, erreichen zu können.
Was die Technik auf der einen Seite an Arbeitszeit einsparte, wurde allerdings an anderer Stelle wieder ausgeglichen. Zum einen war der unnachgiebige Konkurrenzkampf dafür verantwortlich, der im Rahmen der EU-Agrarpolitik die Landwirte zwang, immer größere Vieheinheiten und Ländereien zu bewirtschaften, zum anderen war es die Bürokratie, die August Saathoff immer öfter und für längere Zeit an Schreibtisch und Computer zwang, um Formulare auszufüllen, Ausgleichszahlungen zu beantragen oder genaue Flurstückmaße an die Landwirtschaftskammer zu schicken. ›Freund Computer‹ half zwar mehr und mehr bei der digitalen Abarbeitung all dieser Dinge, auch wurden dadurch die Gänge zu den Ämtern oder zur Kammer immer seltener, doch die jeweils neuen Regeln und Richtlinien überhaupt zu begreifen und richtig zu interpretieren, kostete eine Menge Zeit. Zudem war das eine Arbeit, die nicht unbedingt jedem Landwirt schmeckte, August schon gar nicht.
»Ich muss auf’m Schlepper sitzen, Vier-Schar-Volldrehpflug dahinter, oder Stroh packen, von mir aus melken … aber Formulare ausfüllen, ob am Computer oder nicht, nee, ich weiß nicht, wenn das so weitergeht … holl mi up«, meinte August gegenüber Freunden, wenn sie beim Bier – was selten vorkam, denn August war nicht nur Landwirt sondern auch Vater von vier Kindern – über diese Dinge sprachen.
August verließ die große Halle und zog das Tor hinter sich zu. Nagelneu, wie es war, schloss es ebenso gut wie seine gerade erneuerte Haustür. Nachdem der Holm nach etwa 30 Jahren Betrieb seinen Dienst quittiert hatte −Holz hielt eben nicht ewig in diesem rauen Seeklima hinter’m Deich − war auch die Tür fällig gewesen. »Gewesen«, fügte August hinzu, denn die neue Tür war aus Kunststoff, zwar prima isoliert, aber erheblich billiger als eine Holztür. August verhehlte nicht, dass ihm eine ordentliche Holztür lieber gewesen wäre, aber »wir haben’s nicht mehr so dicke«, bemerkte er dazu und: »Landwirtschaft lohnt sich doch mitunter kaum noch …«
Das Haus von Augusts Eltern lag etwas entfernt von den Wirtschaftsgebäuden, aber auch von demjenigen, in dem August mit seiner Familie lebte. Es war ein weiß verputzter Flachdachbungalow, passte eigentlich gar nicht in diese Gegend, war aber damals hochmodern gewesen. Augusts Eltern hatten ihn seinerzeit als Altenwohnsitz gebaut. Jetzt, im Herbst, lag das Haus bereits in der Dunkelheit, die sich früh im Polder breitmachte. Die Fenster leuchteten ihm indes hell entgegen, und als er das Haus passierte, hörte er aus einem dem Wirtschaftsweg zugewandten Fenster die Dusche brausen – Vorbereitungen seines Vaters für den Besuch der Heimatbühne in Norden. Seine Mutter würde wohl schon fix und fertig in der Küche auf und ab gehen, die Blumen auf dem Tisch bald hier-, bald dorthin rücken und immer nervöser werden aus Furcht, sie könnten den Beginn des Stückes doch noch verpassen, nur weil ihr Mann die Kühe wieder einmal wichtiger gefunden hatte. Dieser Vorwurf würde nicht zum ersten Mal über ihre Lippen kommen. August hörte, als er auf den kleinen gepflasterten Weg zu seiner Haustür einbog, wie das nur noch ganz leise wahrnehmbare Rauschen der Dusche verstummte – gute Chancen also, rechtzeitig in der Stadt und in der Aula der Realschule zu sein, in der das Stück aufgeführt wurde.
Als August seine Haustür öffnete, stieß er fast mit Henrike zusammen, die gerade die Treppe herunterkam, auf dem Weg in die Küche. Henrike und August waren jetzt schon viele Jahre verheiratet, August musste immer wieder neu nachrechnen. Knapp 20 Jahre waren es (»unglaublich«). Sie hatten sich auf einem Schulfest in Norden kennengelernt und waren schon mehr als 25 Jahre (»kann doch gar nicht wahr sein«) das, was man als Paar bezeichnete. Das Fangeisen sei aber eben erst einige Jahre später an seinen Finger geraten, wie August es anderen erklärte.
»Das war knapp«, sagte seine Frau, »eben bin ich hier mit mehreren Gläsern und wohl sechs Bechern vorbeigekommen. Die Kinder können nichts, was sie einmal mit nach oben nehmen, wieder runterbringen.« Und schon war Henrike in der Küche verschwunden. August folgte ihr, nachdem er sich seiner Stiefel entledigt hatte.
»Schlafen die Kinder schon?«, fragte er.
»Die Kleinen ja, die beiden Großen hören noch Radio, Kassette, CD, was weiß ich.«
»Na, dann gehe ich noch mal kurz nach oben.« August wandte sich wieder dem Flur zu.
»Hast du die …«, aber Henrike brach ab, denn sie sah auch so, dass August nicht etwa vergessen hatte, seine Stiefel auszuziehen. Sie selbst war trotz zweier erneut gefüllter Wäschekörbe und des lange Zeit schier aussichtslos scheinenden Kampfes mit ihrem Mann, dem sie das Bügeln beibringen wollte (der sich dabei zunächst ausgesprochen dämlich anstellte), recht guter Dinge. Zum einen hatte sie es irgendwann geschafft, und August nahm sich tatsächlich ab und an die Bügelwäsche vor, zum anderen war es kurz vor 8 Uhr, und um Viertel nach acht wollte sie einen Film sehen – was angesichts der derzeitigen Sachlage (Kinder im Bett, Wäsche zumindest für den kommenden Tag vorhanden, außerdem Mann im Haus, der in Notfällen einspringen konnte) möglich erschien. Wäsche hin, Wäsche her, sie hatte es in den letzten zwei, drei Monaten nicht einmal geschafft, pünktlich um Viertel nach acht vor dem Fernseher zu sitzen, und diese Chance wollte sie sich heute nicht entgehen lassen, die Vorzeichen standen schließlich gut.
»Was gibt’s denn in der Glotze?«, wollte August wissen, nachdem er seinen beiden älteren Kindern gute Nacht gesagt hatte und wieder in der Küche stand.
»›Notting Hill‹, mit Hugh Grant und Julia Roberts, habe ich vor Jahren schon gesehen, nicht gerade anspruchsvoll, aber auch nicht schlecht und für einen stürmischen, dunklen Herbstabend genau das Richtige.«
»Ist das nicht die mit dem breiten Mund?«, fragte August beiläufig, während er schon mit einem Auge auf der zufällig offen liegenden Sportseite der Tageszeitung war.
»Ja, genau. Die mit dem breiten Lächeln. Die findest du doch so schön. Wichtiger ist mir aber Hugh Grant«, gestand Henrike und fügte hinzu: »Wie wäre es, wenn ich heute mal fernsehe, und du machst wenigstens einen Teil der Wäsche, die deine Kinder tagtäglich produzieren?«
»Du«, August dachte offenbar nach, »… ich muss noch unbedingt an den Computer, die wollen bald die genauen Flurstücksgrößen haben, und ich will die Luftbilder, die uns zugeschickt wurden, mit den alten Plänen vergleichen, nicht dass am Ende falsche Werte vorliegen, die dann zur Berechnung der Ausgleichszahlungen für die Brachflächen herangezogen werden.«
»Aber mit dreckiger Unterhose willst du ja wahrscheinlich auch nicht über deine Brachfläche gehen, oder?« Henrike funkelte ihn, fast wütend wirkend, an.
Dann mal ran an die Wäsche, dachte August und wollte mit einem »Nee, wohl nicht« den Raum verlassen.
»Na, denk mal drüber nach, wenn du Zeit hast, das mit den Luftbildern wird schon nicht so lange dauern. Du kennst doch dein Land besser als jedes Luftbild … Trinken wir heute noch ein Glas Wein? Das würde prima in meinen Plan passen.«
»Mal sehen, wie lange ich für die Pläne und Luftbilder brauche, das ist eine komplexe Materie«, August lächelte, »aber dann, warum nicht, ein Pils wäre zwar auch nicht schlecht, aber man muss ja flexibel sein. Aber erst mal muss ich jetzt duschen.« Mit diesen Worten nahm er sich die Sportseite vollständig vor.
Henrike machte es sich auf dem Sofa im Wohnzimmer gemütlich, der Fernseher lief, es war genau 20.15 Uhr, die Titelmusik des Erzeugnisses aus Hollywood begann.
»Du kannst mir ruhig schon ein Glas vorbeibringen«, rief sie in die Küche, was August aus seinem leichten Ärger über die erneute Niederlage des HSV herausriss und zu einem geistesabwesenden »Mach ich« veranlasste. Bevor er ins Bad ging, suchte er eine Flasche Wein im Keller, fand einen roten, französischen, aus dem Roussillon, entkorkte ihn und brachte Henrike ein Glas. Sie quittierte mit einem kurzen »Danke«, und als August ansetzte, etwas zu sagen, schickte sie vorsorglich ein »Psst« hinterher, um dieser Gefahr gleich zu begegnen. Er merkte, dass es kaum Sinn hatte, gegen Hugh Grant auf der Mattscheibe anzureden, raunte nur, als dieser zufällig im Bild erschien: »Na so toll sieht der nun auch wieder nicht aus«, worauf Henrike noch entschiedener »Psst« machte und »Ruhig« hinzufügte. August drehte kurzerhand um, wollte nun endlich unter die Dusche, als Henrike ihm ihrerseits nachrief: »Ach, August, Wiard hat noch angerufen. Er will mit dir über irgendetwas am neuen Deich sprechen. Ob du morgen mal Zeit hast?«
»Vielleicht lag am Deichfuß eine alte Plastikplane oder eine verölte Möwe? Darüber kann er sich ja aufregen wie sonst kaum einer. In letzter Zeit ist er wieder ganz auf dem Umwelt-Trip …«, rief August zurück und murmelte noch, mehr zu sich: »… die grüne Socke.«
»Weiß ich nicht, hat er auch nicht gesagt, sprich außerdem nicht so über ihn, er ist ein feiner Kerl. Und nun sei mal still.« Henrike wusste zwar nicht immer, was sie wollte, heute Abend wusste sie es aber ziemlich genau.
»Na, so wichtig wird’s schon nicht sein. Ich fahr aber morgen sowieso zu dem neuen Stück Land, das wir gepachtet haben, da komm ich bei Wiard vorbei. Werde mal kurz bei ihm reinschauen.«
»Dann mach das mal«, kam, leicht genervt, zurück, und August nahm sich vor, bis zum Ende des Films nichts mehr zu sagen. Er erhaschte noch einen Blick auf Julia Roberts, fand den Mund tatsächlich breit, die Frau insgesamt aber sehr ansehnlich und verschwand unter der Dusche mit dem Gedanken, dass die den neuen Laufstall mal eben aus ihrer Haushaltskasse hätte bezahlen können. Aber was sollte Julia Roberts mit einem Kuhstall.
2
Wiard Lüpkes war das, was man eigenbrötlerisch nennt. Er wohnte nicht allzu weit entfernt des Saathoff’schen Hofes. August verstand sich ganz gut mit ihm, sie hatten öfter mal miteinander zu tun, und wenn es nur das zufällige Treffen irgendwo in den umliegenden Poldern oder wie neulich in Norden war, bei dem man ein paar Worte wechselte. Dabei kebbelten sie sich immer, denn die politischen Ansichten von Wiard und August gingen durchaus nicht immer konform, manchmal diametral auseinander, aber sie akzeptierten sich. Früher hatte Wiard beim Finanzamt in Emden gearbeitet, bis ihm »das Amt und alles, was damit zu tun hatte, zum Halse raus hing«, und hatte seitdem keine feste Anstellung mehr gehabt. Die Leute hatten es kaum nachvollziehen können: »So eine Stelle auf’m Amt, Mensch, beim Staat, also, die gibt man doch nicht auf, heutzutage, bei mehr als fünf Millionen Arbeitslosen …«, »So gut wie verbeamtet.«, »Füße hoch, ein paar Einkommensteuererklärungen bearbeiten, und dann noch Gehalt dafür kriegen.« Wiard hatte das anders gesehen, und mit den paar Einkommensteuererklärungen war es auch nicht einfach so getan, er hatte es aufgegeben, mit den Leuten darüber zu diskutieren. Aber vor allem war ihm irgendwann, aus heiterem Himmel (oder doch nicht?) der Gedanke gekommen, warum er eigentlich acht Stunden täglich in dieser vermufften Bude saß und darüber gutachtete, ob jemand ein paar Euro Steuer zurückbekam oder nicht. Acht Stunden seines einzigartigen, einmaligen Lebens, von dem nun schon allerhand Jahre rum waren. Schließlich hatte er die Kündigung eingereicht, sogar den Betriebspsychologen des Kreises hatten sie ihm noch aufgehalst: »Herr Lüpkes, es ist aber sonst alles in Ordnung mit Ihnen?« Und: »In Ihrem Alter – also, da finden Sie keinen Job mehr, in der Wirtschaft sowieso nicht, aber im öffentlichen Dienst geht das auch nicht mehr …«
»Ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder«, hatte er geantwortet, »und das, was ich für mich brauche, das kriege ich schon irgendwie zusammen, bin ja für sonst niemanden verantwortlich, nur für mich, na, das wird schon hinhauen.«
Am letzten Tag beim Finanzamt hatte er sich bei den Kolleginnen und Kollegen verabschiedet, bei all denen, die er schätzte, und den anderen. Dann hatte er sich, nachdem er das Gebäude durch die Außentür verlassen hatte, noch einmal umgedreht und ein, zwei Minuten nachgedacht, dabei auf die Gemäuer des Amtes blickend: Das war’s, ab sofort wird gelebt, war es ihm durch den Kopf gegangen. Und gleichzeitig: Na, ich kann das so machen, andere nicht …
Jetzt half Wiard im Sommer bei verschiedenen Landwirten aus, er kannte ja fast alle hier und in den Nachbarpoldern, und mit einigen verstand er sich gut. Bei August hatte er ebenso hier und da geholfen. Auch beim Bau des neuen Laufstalles, schließlich hatte August zusammen mit dem Bankberater so viel Muskelhypothek veranschlagt, dass er es allein kaum schaffte. Im Winter ging Wiard tageweise Beschäftigungen nach, war bei einer Jobvermittlung gemeldet, und immer, wenn das Geld zur Neige ging, suchte er sich Arbeit. Die Rente reichte »allenfalls fürs Klopapier und ein Stück Butter«, obwohl er mehr als 18 Jahre im Finanzamt gearbeitet hatte, aber er hatte ein Haus – seine Altersvorsorge, vielleicht die sicherste. Das war auch so ein Zufall in seinem Leben gewesen, hatte aber seinen Entschluss, dem Amtmannsleben Ade zu sagen, maßgeblich beeinflusst. Ein Onkel vererbte ihm das Haus, als der mit über 85 Jahren plötzlich verstarb. Der Postbote hatte irgendwann mit einer Einladung zur Testamentseröffnung beim Notar vor ihm gestanden, und Wiard hatte keinerlei Idee, worum es sich handeln könnte. Nach dem Notartermin war er Besitzer eines kleinen Hauses im Polder. Handschriftlich hatte sein Onkel auf das Testament gesetzt: ›Und dat du mi dat Huus in Ordnung hollst.‹
Im letzten Sommer hatte er über eine Zeitarbeitsvermittlung einen Job als Helfer beim Bau des neuen Deiches bekommen. Vier Monate ordentlich gerackert, dabei aber ganz gut verdient.
»Das reicht locker, um den Herbst und den Winter zu überstehen und ein paar Wünsche zu erfüllen, die ich so habe …«, hatte er zu August gesagt. »Da kann ich mal wieder meinen Hobbys nachgehen.« Zu seinen Hobbys gehörten ein Schaf, eine Ziege, zahlreiche Katzen, Hühner und ein Schäferhund. Außerdem fertigte er Kunstgegenständen aus Holz an. Die wollte er in einem kleinen Laden, den er in seinem Haus auszubauen gedachte, zum Verkauf anbieten, »gerade, wenn die Badegäste aus dem Binnenland kommen«, von denen er sich einen Nebenverdienst erhoffte (»die kaufen doch alles, was halbwegs nach Küste und Meer aussieht«). Und er war technisch up to date, hatte einen Laptop zu Hause stehen, DSL-6000-Anschluss, wusste über alle neuen Trends Bescheid.
»Das passt doch alles nicht zusammen«, behaupteten seine Zweifler im Polder.
»Und wieso nicht«, hatte August gegengefragt …
Jedenfalls war Wiard dieses Leben offenbar lieber als das mit Ärmelschützern vor immer wieder denselben Formularen.
»Verdienst unsicher, Lebensqualität aber wesentlich besser geworden – das wiederum sicher«, so verteidigte Wiard seinen Schritt gegenüber besagten Kritikern.
August hatte keine Ahnung, was Wiard mit ihm besprechen wollte und was das mit dem Deich zu tun haben könnte. Seine Gedanken drehten sich um die Zukunft des HSV, als er eine mehr als daumendicke, dabei aber schnell zerfließende Wurst eines hellblauen Shampoos in seine Hand drückte, um das Zeug auf dem Kopf in reichlich Schaum zu verwandeln, damit Dreck und Kuhstallgeruch verschwanden.
»Sonst kannst du gleich im Stall bleiben und bei deinen Kühen übernachten«, hatte Henrike schon des Öfteren bemerkt. August lächelte, als er an diese Worte dachte, und wusch die Haare umso gründlicher.
3
An diesem Abend saß Wiard Lüpkes über einem Haufen Papiere, den er intensiv studierte. Seit Wochen ging ihm der neue Deich nicht mehr aus dem Kopf. Das Land und private Investoren waren gemeinsam die Deichbauarbeiten angegangen – Klimawandel und daraus resultierender Meeresspiegelanstieg forderten ihren Tribut. Gut sah er aus, der neue Deich, mächtig und stabil, und jeden Abend zeichnete sich die gerade Linie der Deichkrone gegen den Horizont ab – vorausgesetzt sie hatten nicht mal wieder Sauwetter. Doch Wiard war eher beunruhigt. Und das, wie er meinte, aus gutem Grund. Er hatte selbst am Deich mitgearbeitet und später bei allerhand Stellen und vielen Personen Informationen eingeholt. Einem inneren Gefühl folgend, war er mehr und mehr dem Gedanken verfallen, dass mit dem Deich etwas nicht in Ordnung war. Die gerade Linie der Deichkrone kam ihm manchmal gar nicht so gerade vor. Er war diesem Gefühl nachgegangen und hatte aufgrund seiner Recherchen so seine Vermutungen. Doch was dieses Gefühl des ›Nicht-in-Ordnung-Seins‹ nährte, konnte er noch nicht in eine schlüssige, nachvollziehbare und vor allem glaubwürdige Erklärung umsetzen. So behielt er das Ganze erst einmal für sich. Tag für Tag war er zum Deich gegangen, hatte ihn gründlich in Augenschein genommen und den Eindruck gewonnen, dass nicht immer mit der Sorgfalt vorgegangen worden war, die man bei guter Deichbaupraxis hätte erwarten können. Hier und da Schludrigkeiten bei Pflasterungen am Deichfuß, kahle Stellen in der Grasnarbe (oder waren das Schafe gewesen? Nein, die machen die Grasnarbe ja eben nicht kaputt), insbesondere aber der Eindruck, dass es Stellen gab, an denen der Deich ›weich‹ war, machte ihm zu schaffen. Dieses Gefühl versuchte er mit seinen Recherchen und den Erfahrungen während der Zeit, die er selbst am Deich mitgearbeitet hatte (einige Monate sozusagen als ›Mann für alles‹), in Einklang zu bringen. Er wusste, so dachte er, ein paar Dinge, die andere nicht wussten und die er bislang als unwichtig abgetan hatte. Jetzt wurde er diesen Gedanken nicht mehr los. Und neulich hatte er beim Feuerwehrfest im Polder einen über den Durst getrunken und Georg Redenius (»hohes Tier bei der Küstenschutzbehörde«; was hatte der da eigentlich verloren?) erzählt, der Deich sei doch »qualitativ eine Katastrophe, einfach scheiße gebaut«, das hätte doch nur mit »Bestechung und Korruption« zugehen können, dass diese Pfuscherei durch die beaufsichtigenden Behörden nicht geahndet worden sei. Klar, am nächsten Morgen hatte er sich sehr über diese Äußerungen geärgert (sofern er noch von ihnen wusste), aber ihm war im Kopf geblieben, dass Redenius, den er rein zufällig bei einigen Runden Schnaps kennengelernt hatte, plötzlich sehr ernst geworden und etwas rötlich im Gesicht angelaufen war und, als Wiard weitersprach, ihn angefahren hatte, er solle jetzt aufhören mit dem Deich, sonst bekomme er eins auf die Nase … So reagierte man doch nicht, zumal Wiard gleich beschwichtigt hatte, es wäre doch nur ein Spaß gewesen (obwohl er es eigentlich ernst gemeint hatte).
Der Vorfall lag nun aber schon einige Zeit zurück, und Wiard kramte wieder in seinen Deichunterlagen, in Plänen, Karten, Notizen, sah sich Fotos an, analoge und digitale, alle vom Deichbau und vom Deich jetzt, wie er dort stand. Wiard dachte nach. Immer wieder betrachtete er die Bilder der Stellen, an denen die achtkantigen Steine unten, am Außendeich auf der Asphaltabdeckung, ein wenig eingesackt waren. Es fiel dem Laien sicher nicht gleich auf, doch Wiard kannte den Neubau und den jetzigen Zustand, nur wenige Monate später. Wie konnte das sein? Und – durfte das sein?
Wiard wollte gerade einen Schluck aus der Tasse dampfenden Tees nehmen, die neben ihm auf dem Schreibtisch stand. Plötzlich ein lauter Knall. Die vorherige Stille und Gemütlichkeit des kleinen Landhauses wurde von einem Klirren und Splittern durchbrochen. Glasscherben flogen umher. Sich zur Seite drehend, sah Wiard einen Gegenstand durch das Fenster fliegen, duckte sich instinktiv, was nichts nutzte, denn ein harter Schlag traf ihn am Kopf. Der Treffer saß – etwas unterhalb der linken Schläfe. Wiard kippte seitlich vom Stuhl, einem alten, vierrädrigen Schreibtischstuhl, der sich jetzt unter ihm wegdrehte. Auf dem Boden liegend, fühlte er noch mit der rechten Hand an die pochende Stelle. An seinen Fingern klebte Blut. Sein Kopf dröhnte, es war kaum auszuhalten. Dann wurde es dunkel um ihn.
4
August und Henrike hatten es tatsächlich noch zu dem gemeinsamen Glas Wein geschafft. Er war gut gewesen (der Wein), und am nächsten Morgen stand August gegen 6 Uhr wieder im Melkstand. Er hatte seinem Vater gesagt, er solle liegen bleiben, da es am Abend vorher sicher spät werden würde. Die Vorstellung der Heimatbühne hatte, Pause eingerechnet, bis weit nach zehn gedauert, und meistens trifft man in einer kleinen Stadt ja noch den ein oder anderen Bekannten. Augusts Eltern lagen in der Regel zwischen neun und halb zehn im Bett, jetzt im dunklen Herbst sowieso, da war ein Nachhausekommen kurz vor Mitternacht die absolute Ausnahme, über die man noch lange würde reden können. Er war sich dennoch sicher, dass sein Vater früher oder später auftauchen würde. Nach so vielen Jahrzehnten des Daseins als Bauer war ihm das morgendliche Melken in Fleisch und Blut übergegangen. Augusts Vater konnte nicht anders – und hätte es als bedrohliche Alterserscheinung empfunden, morgens das Melken zu versäumen. Warum auch, dachte er, sollte er sich – obwohl er noch mit anpacken konnte – hinsetzen und Däumchen drehen? August und Henrike versuchten ihm immer wieder klarzumachen, dass er sich vielleicht am Ende doch ärgern würde, wenn er immer nur gearbeitet und nicht auch noch ein wenig den Lebensabend genossen hätte. Dazu meinte der alte Saathoff, die Arbeit auf dem Hof sei »sein Leben« und nichts genösse er mehr als diese. Aber er unternahm nun gelegentlich Dinge mit seiner Frau, die er früher nie gemacht hatte, eben – wie am Abend zuvor – mal zur Heimatbühne gehen (»dat word laat, dat word laat« – seine Sorge über den langen Abend war gegen die Vorfreude auf das Theaterstück in der Stadt kaum aufzuwiegen).
Nach dem Melken wollte August zu seinem neu gepachteten Ackerland fahren. Wieder hatte ein Bauer im Polder aufgegeben – auch eine Folge der Politik, die immer noch auf zunehmend größere Einheiten setzte, wobei die Kleinen kaputtgingen, wenn sie sich nicht ganz besonders spezialisierten. Einige Biohöfe fristeten ihr Dasein, nur wenigen ging es finanziell wirklich gut. Die konnten es sich leisten, die Kühe, Schweine und Hühner frei rumlaufen zu lassen und damit zu werben – aber dementsprechend waren die Erzeugnisse für den Durchschnittsbürger auch kaum bezahlbar, wie August immer wieder betonte, wenn es sich um dieses Thema drehte. Er selbst war konventioneller Landwirt mit der festen Überzeugung, ökologischer zu sein als mancher, der sich so bezeichnete. Das war seine Meinung. Da hatte Wiard andere Ansichten. Aber diese Gedanken flogen ihm während des Melkens nur so zeitweise durch den Kopf. Wie sie eben kommen und gehen, wenn man gerade etwas ganz anderes macht. Eigentlich wollte er überlegen, was er zu seinem neuen Pachtland mitnehmen sollte, schließlich musste es für das Frühjahr so fit gemacht werden, dass er darauf aussäen konnte, und da war noch einiges vorzubereiten.
Auf dem Weg dorthin würde er kurz bei Wiard vorbeischauen, der nicht viele Leute im Polder hatte, mit denen er ernsthaft reden konnte. Und das tatsächlich besonders, seitdem er nicht mehr beim Finanzamt arbeitete. (»Da kannst mal sehen, worauf viele Leute ihre Urteile über andere gründen«, hatte er zu August gesagt. Dem war dabei ein Licht aufgegangen.) Aber Wiard hatte natürlich damals auch den Lohn- oder Einkommensteuerantrag einiger Polderbewohner auf den Tisch bekommen, was für fast alle der Anlass war, sich zwar mit ihm gut zu stellen, aber dennoch sehr zurückhaltend zu sein. Sie wussten nicht, für welche Buchstaben im Alphabet er zuständig war, und wenn er vielleicht nicht direkt ihre Anträge bekam, so kannte er ja doch die Kollegin oder den Kollegen (»Also, der Lüpkes weiß doch, dass das Zimmer, dass ich jedes Jahr als Arbeitszimmer absetze, nichts anderes ist als unsere Wäschekammer …«). Wiard hatte zwar öfter erklärt, dass er ohnehin über keinerlei Handhabe verfüge angesichts strenger Richtlinien und Maßstäbe der Finanzverwaltung (auch wenn immer wieder welche gekommen waren, etwa beim Sportfest, und Wiard einen ausgaben mit den nur wenig später folgenden Worten: »Du Wiard, du büst doch bi’t Finanzamt, kannst du neet so ’n bittje doran dreihen, dat ick neet jümmers so vööl Stüern betalen mutt, ik hebb da ’n Idee …«). Auch das hatte er schließlich aufgegeben. Den Leuten zu erklären, dass das eben doch kein Selbstbedienungsladen sei, der für die, die Beziehungen haben, mehr Kohle lockermache als für andere, dazu hatte er einfach keine Lust mehr. Gleichwohl wusste Wiard tatsächlich über die finanziellen Verhältnisse einiger Polderbewohner ganz gut Bescheid, hatte zwar Stillschweigen darüber zu bewahren, aber einige trauten ihm eben bis heute nicht. Seitdem er nun nicht mehr Amtmann war (nach den Sportfesten war er tatsächlich ein ums andere Mal voll wie ein Amtmann gewesen …), sondern freien Tätigkeiten mehr oder weniger nach Lust und Laune nachging, er außerdem besagte Hobbys weiterentwickelte, die in der Allgemeinheit des Polders und darüber hinaus eher als ›spinnert‹ abgetan wurden (»wat kann man dor mit denn anfangen?«), steckte er nun in einer Schublade. Und aus einer solchen kam er für die meisten Polderbewohner nicht mehr raus. Dazu beigetragen hatte wohl auch sein wachsendes Interesse an fernöstlichen Religionen, das wiederum auf sein Äußeres Einfluss nahm. Das kam nicht bei jedem gut an im Polder (»Kiek, Bhagwan ist weer unnerwegens …«, spottete manch einer), andere ignorierten es.
August und Henrike hatten den Kontakt nicht einschlafen lassen. Sie hatten sich mit Wiard während seiner Amtszeit gut verstanden, und das sollte sich nicht ändern – schließlich hatte jeder das Recht, sich für andere Wege zu entscheiden. Wiard war vielleicht kein Freund, aber ein guter Bekannter, der, solange er es umgekehrt genauso hielt, nicht einfach links liegen gelassen werden sollte. Außerdem hatte er immer eine Menge interessanter Dinge zu erzählen. Er war stets auf dem neuesten Stand der Politik und hatte auch sonst »viel Ahnung«, wie August betonte (»der hat ja auch die Zeit dazu, Zeitungen und Bücher zu lesen …«). Augusts Kinder mochten Wiard. Freerk meinte, der, ja, der hätte wenigstens mal Ahnung. August beeindruckte diese sich völlig von der Sichtweise vieler Polderbewohner unterscheidende Haltung seines Sohnes.
August Saathoff stieg gegen 10 Uhr auf seinen Deutz-Schlepper und startete den Motor. Er schaltete auf der gut ausgebauten Zuwegung zur Hauptstraße schnell in den dritten Straßengang, stellte das Radio an, wippte ein paar Mal in dem gefederten Sitz auf und ab und dachte: Tolle Maschine. Ihm fiel der alte Witz ein, in dem ein Autofahrer mehrfach seinen Händler aufsucht, weil sein Motor immer schon nach der ersten Fahrt kaputtgeht. Nachdem dieser ihm das dritte Auto mitgibt (»sie haben ja noch Garantie …«), will er dann doch wissen, wie der Mann denn fahre. Da erklärt der andere, dass er ganz normal anfahre, dann hoch schalte, erster, zweiter, dritter Gang. Dann in den vierten und wenn das Auto dann richtig schnell wäre, dann würde er auf ›R‹ – den Ralleygang – schalten. Mann, hatte der ’n Bart, aber August musste immer wieder darüber lachen. Auf Plattdeutsch machte er sich allerdings am besten, etwa, wenn Hannes Flesner ihn erzählte, auf einer dieser alten Platten.
Auch den Schlepper hatte August vor nicht allzu langer Zeit angeschafft. Günstige Konditionen bei der Bank, da er trotz der schon erheblichen Investitionen in den Hof und den neuen Kuhstall nebst Melkstand bereits ordentlich gezahlt hatte. Nun war er optimal ausgerüstet, und auf diesbezügliche Bemerkungen erwiderte er nur: »Und bis ans Lebensende verschuldet bis über beide Ohren …« (»Ach, macht dir doch nichts, Landwirte verdienen doch mindestens 135.000 netto«, ärgerte ihn sein Nachbar immer wieder, wenn sie im Dorf oder auch über die Hecke hinweg sprachen. Das Ganze endete meistens bei einem Bier im Garten und einem »Mit der Hälfte bräuchte ich mir schon keine Sorgen mehr machen« von August.)
Nach knapp zehn Minuten kam er an Wiard Lüpkes’ Haus vorbei. Er verlangsamte die Fahrt und hielt schließlich am Straßenrand. Das Haus verfügte über eine breite, stabile Zufahrt, aber August wollte sich nicht lange aufhalten und sparte sich ein Ein- und Ausfahrtmanöver. Kurz überlegte er sogar, ob er den Motor laufen lassen sollte, aber die Zeiten waren nun endgültig vorbei, der Klimawandel ließ grüßen, und es war auch nicht mehr notwendig, zumindest nicht aus Gründen des Nicht-wieder-Anspringens. Der Deutz lief immer an, auch bei extremen Minusgraden, wenn es die denn mal gab (»wor’t doch immer warmer bi de Treibhauseffekt …«).
Wiard hatte Augusts Ankunft bemerkt und stand schon vor der Tür, als Letzterer sie erreichte. Das kleine Landhaus war knapp 80 Jahre alt, von der Form her wie ein alter, großer friesischer Hof gebaut, aber eben in sehr kleiner Ausführung: vorne das Wohn-, hinten das Stallgebäude, roter Klinker, rote Dachziegel, weiße Fenster, »alles Thermopane, eingesetzt, als ich noch Amtmann war«, wie Wiard zu betonen pflegte. Dabei sprach er das ›Thermopane‹ wie sein verstorbener Onkel aus: Täär-mo-paaane.
»Moin Wiard«, grüßte August und riss gleich die Augen auf, als er den Verband um dessen Kopf gewahrte.
»Moin.«
»Was ist denn das?«
»Ein Verband, was sonst?«
»Bist du duhn gegen ’ne Laterne gelaufen, oder was?«
»Schön wär’s«, entgegnete Wiard mit etwas Bitterkeit in der Stimme, »nee, ich fürchte, das ist etwas Ernstes …«
»Wie, was Ernstes, was meinst du?« August verstand nicht. Wie auch.
»Hast du ein bisschen Zeit? 15, 20 Minuten? Ich möchte dir gerne etwas Vertrauliches sagen, aber so zwischen Tür und Angel geht das nicht, dann lieber etwas später.«
»Hm, eigentlich wollte ich noch vor Mittag mein neues Stück abschreiten und gucken, was noch so in diesem Herbst gemacht werden muss, heute Nachmittag komme ich da nicht zu, und wenn ich jetzt zu lange warte, klappt’s auch nicht mehr vor Mittag, und …«
»Lass man gut sein, ich bin nicht böse, wenn’s nicht gleich klappt. Hat Zeit, dann warten wir eben. Wenn du es drock hast, kann ich das verstehen. Ich find’s gut, dass du gleich vorbeigekommen bist – und dass Henrike nicht vergessen hat, es dir zu sagen. Außerdem bin ich froh, dass ich wieder zu Hause bin. Die Nacht im Krankenhaus war nicht so prickelnd, zumal es reiner Zufall war, dass Jan Peters mich gefunden hat. Der wollte nur noch auf ein Pils und einen Kurzen zu mir rüberkommen. Es war Licht, aber ich kam nicht an die Tür. Da offen war, kam er einfach rein und hat mich am Boden liegend gefunden …«
»Am Boden liegend?«, fuhr August dazwischen.
»Ja, am Boden liegend, verletzt, am Kopf eben. Der Blutfleck in meinem schönen Teppich ist nicht ohne …«
»Mann, was ist denn nun passiert, Wiard?«
»Habe einen auf den Deez bekommen. Erkläre ich dir heute Abend, das geht nicht so mal eben. Ich muss dir sowieso eine ganze Menge erzählen, deshalb habe ich Henrike Bescheid gesagt, und die hat ja dran gedacht.«
»Ja, Henrike, nee, die vergisst nicht so leicht etwas, ganz im Gegensatz zu mir. Also, gut, wenn du jetzt nicht erzählen willst … Wenn’s geht, würde ich heute Abend so um halb neun eben vorbeischauen, wenn die Kinder im Bett sind. Dann haben wir ’ne Stunde, ich bring zwei Jever mit.«
»Lass man, ich hab selbst ’ne Kiste da, obwohl’s noch ganz schön wummert, im Kopf, wenn der Blutdruck steigt«, lachte Wiard und streckte ihm schon die Hand zum Abschied entgegen.
»Prima, oder, was heißt prima, sieht echt böse aus. Also bis heute Abend!« August bestieg seinen Trecker und setzte die Fahrt voller Gedanken und mit schlechten Vorahnungen fort. Woher die kamen, wusste er allerdings nicht, doch erhaschte er noch einen Blick auf Wiard mit verbundenem Kopf.
August fuhr an verschiedenen Höfen, alten, kleinen und neuen, größeren Häusern vorbei, an der kleinen Kirche und am Feuerwehrhaus, bei dessen Anblick ihm einfiel, dass diese oder nächste Woche wieder ein Übungsabend ins Haus stand. Doch wohl nicht heute Abend?, dachte er, dann müsste er Wiard wiederum versetzen. Er ärgerte sich kurz über sein miserables Gedächtnis, sah dann aber schon von Weitem sein Stück Land und lenkte seinen Trecker an den Stacheldrahtzaun heran, der sich hier leicht öffnen ließ. Mit geübtem Blick schätzte er die Fläche auf knapp vier Hektar ein – nicht schlecht, und die jährliche Pacht war angesichts des guten, fruchtbaren Bodens durchaus angemessen. Leider zahlte er sie nicht dem ehemaligen Besitzer, der hatte alles verkaufen müssen, sondern einem Dr. Kümmermann in Düsseldorf, der das Hofgebäude zu Ferienwohnungen ausbauen wollte und mit dem Land ›nichts anfangen konnte‹. August ging konform mit vielen Polderbewohnern, die es nicht gut fanden, dass sich mehr und mehr Binnenländer die Höfe und Landstellen zu eigen machten, deren vormalige Eigentümer diese aus finanziellen Gründen oder mangels Nachkommen (oder deren Desinteresse am Polderleben) verlassen hatten und jetzt mitunter in kleinen Mietwohnungen in der Stadt lebten. So tummelten sich hier im Sommer zusehends mehr Touristen, was auf die ›gute, alte Dorfgemeinschaft‹ durchaus Auswirkungen hatte. Im Winter jedoch wurde es immer einsamer in diesem Landstrich. Das Geld saß eben in anderen Regionen der Republik. So war der Lauf der Dinge, was sollte man schon dagegen tun. Nutzte ja eh nichts.