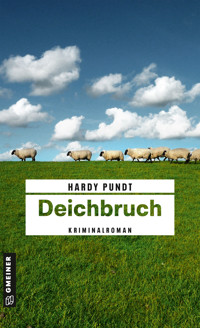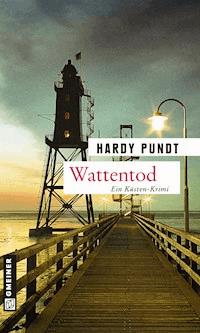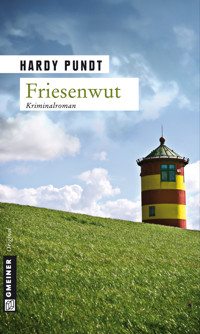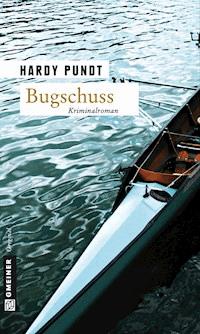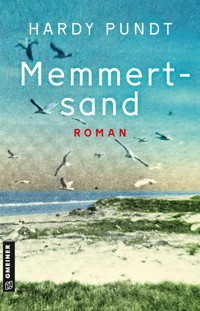
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Volksschullehrer Otto Leege 1888 die Juist vorgelagerte Sandbank Memmertsand betritt, ahnt er noch nicht, dass ihn dieser Ort sein Leben lang begleiten wird. Fasziniert von der Ruhe und Weite fasst er den Plan, Memmertsand dem Vogelschutz zu widmen. Jede freie Minute opfern er und seine Familie der Entwicklung der Dünen mit dem Ziel, die entstehende Insel gegen alle Widerstände unter Schutz zu stellen. Ein Roman über den Vorreiter des Nationalparks Wattenmeer und seinen Weg vom Lehrer auf Juist zum engagierten Naturschützer und international anerkannten Wissenschaftler.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hardy Pundt
Memmertsand
Roman
Impressum
Dieser Roman ist eine fiktionale Darstellung und enthält sowohl
erfundene Elemente und Dialoge als auch reale historische Persönlichkeiten
und Ereignisse. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen, die über die bewusst verwendeten historischen Figuren hinausgehen,
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes von: © Reproduktion aus: Otto Leege, »Werdendes Land in der Nordsee«, erschienen im »Verlag Hohenlohesche Buchhandlung Ferd. Rau«, Oehringen, 1935, Foto Prof. Dr. Georg Wagner, Stuttgart
ISBN 978-3-7349-3072-0
Widmung
Für Antje (1960–2024)
Karte
Memmertsand, 1891
1586 nehmen holländische Geografen »de Meem«, den Memmert, auf eine Seekarte auf. Eine Karte von 1720 nennt ihn »Memer Sandt«, um 1828 heißt er bereits »Memmert«, wird jedoch noch lange Zeit meistens als »Memmertsand« bezeichnet. 1650 wird Memmert in einer amtlichen Beschreibung der ostfriesischen Inseln als Sandbank erwähnt, »die nicht mehr bei einer gemeinen Flut unterläuft und stellenweise Bewuchs trägt«.
Vorbemerkung des Autors
Dieses Buch enthält zahlreiche Dialoge. Natürlich sprach man zwischen dem 19. zum 20. Jahrhundert in anderer Weise und verwendete vielfach Worte, insbesondere in den sogenannten höheren Bildungskreisen, die heute nicht mehr gebräuchlich sind. Des besseren Verständnisses und der einfacheren Lesbarkeit wegen orientiert sich der Roman an der Sprache der Gegenwart.
Prolog
»Connors, habe ich mich nicht unmissverständlich ausgedrückt?«, donnerte Kapitän Turley.
»Sir«, konterte Connors, »bei aller Ehrerbietung, aber die Mannschaft ist unzufrieden. Sie wird sich auflehnen. Es ist …«
»Halten Sie den Mund! Auflehnen? Dass ich nicht lache!«, schrie der Kapitän. »Wenn wir am Ziel sind, bekommt die Mannschaft ihre Heuer. So lange gibt es zu essen, was auf den Tisch kommt, und die Männer tun gefälligst ihre Arbeit. Schluss jetzt.« Turley wandte sich zum Gehen, doch der Zweite Offizier gab nicht auf.
»Ich glaube, Sir«, er machte eine Pause, denn er wusste, was es bedeutete auszusprechen, was aus seiner Sicht ausgesprochen werden musste, »es wird Ärger geben, wenn Sie diesen Befehl nicht revidieren.«
»Was faseln Sie da?«, Turley hielt sich sichtlich im Zaum. Bei einem Choleriker wie ihm musste man aufpassen, was man sagte. »Schenken Sie Rum aus. Wenn die Männer saufen, sind sie zufrieden.«
»Nicht einmal Rum wird helfen, Sir«, insistierte Connors. »Es gibt einen Beschluss innerhalb der Mannschaft …« Connors wurde jäh unterbrochen.
»Beschluss?« Kapitän Turley trat nah an seinen Zweiten Offizier heran. »Sind Sie wahnsinnig, Connors? Seit wann beschließt die Mannschaft irgendetwas? Sie wagen es doch wohl nicht …« Turley atmete tief durch, dann presste er durch die Lippen: »Hören Sie, auf der Braganza beschließt nur eine Person etwas. Und die bin ich. Auf einem Schiff«, wieder musste der Kapitän an sich halten, um nicht vollends in Raserei zu geraten, »ist der Kommandant derjenige, der die Befehle gibt. Daher die Bezeichnung.« Er lächelte hämisch.
Connors schwieg.
»Bitte verlassen Sie jetzt meine Kajüte. Ich will darüber hinwegsehen, dass Sie sich tatsächlich beinahe hätten hinreißen lassen, zum Spielball der Mannschaft zu werden. Schwach, Connors, schwach. Wären wir auf einem Kriegsschiff … ach … die Handelsmarine ist eben viel zu nachlässig. Sorgen Sie lieber für Ordnung auf diesem Schiff. Es geht zu lasch zu. Nehmen Sie sich ein Beispiel am Ersten Offizier, Mister Smith. Der greift durch, wenn es sein muss. Wenn Kapitän und Offiziere nicht an einem Strang ziehen, verkommt die Disziplin! Und nun raus hier.«
»Herr Kommandant …« Connors nahm Haltung an.
»Raus, verdammt noch mal, das Gespräch ist beendet.«
Connors hatte sich bereits umgedreht, als der Kommandant nochmals ansetzte.
»Ach, beinahe hätte ich es vergessen. Der Kurs wird gehalten. In einer halben Stunde bin ich an Deck.« Er brummelte noch etwas Unverständliches, schloss dann: »Noch etwas. Sollte Ihnen die Bestrafung von Mister Deweys nicht behagen, lassen Sie sich gesagt sein, dass ich Deweys seit jeher für einen Nichtsnutz halte. Er ist faul, andere übernehmen seine Arbeit. Ich habe das selbst gesehen. Er säuft und liegt uns allen auf der Tasche, anstatt ordentlich Dienst zu tun.«
»Deweys ist krank, Herr Kommandant.«
»Natürlich ist er krank!«, schrie Turley. »Er trinkt zu viel. Er ist krank vom Suff. Und er hat, abgesehen von der Rumgammelei, mir, dem Kommandanten, vor versammelter Mannschaft widersprochen.«
»Das war …«
»Widerspruch, genau. Das ist es, Connors: Sie wollen einem solchen Hallodri auch noch recht geben. Ihre Autorität wird auf immer und ewig verebben, wenn Sie so weitermachen. Deweys wird bestraft.«
Connors dachte an Smith. Der Erste Offizier griff durch. Ha! Der Erste Offizier war ein treuer Vasall des Kapitäns. Er profitierte von seiner Loyalität zu Turley. Die Mannschaft kochte, hatte nichts Ordentliches zu beißen und musste gammeliges Wasser trinken. Aber Smith saß bei Turley in der Kajüte und trank mit dem Kommandanten und dessen Gästen französischen Cognac.
Der Zweite Offizier verließ das Oberdeck, das nur die Offiziere und Turleys Gäste, darunter dessen Ehefrau, betreten durften. Connors ließ sich für einen Augenblick den frischen Nordseewind um die Nase wehen. Doch schon stand Moir vor ihm, der zweite Steuermann. Er hatte Wache.
»Sir, was hat er gesagt? Wird sich etwas ändern?«, flüsterte er.
Connors zuckte die Schultern.
»Er muss doch etwas gesagt haben, Sir?«
»Moir, verdammt noch einmal, gehen Sie auf Ihren Platz und lassen Sie mich zufrieden. Sind Sie nicht zur Wache eingeteilt?«
Moir trat erschrocken einen Schritt zurück. »Jawohl, Sir.«
Die Braganza, eine ansehnliche Brigg, hatte gute Segeleigenschaften. Sie war nicht groß, ein stabiler Zweimaster, den Unbilden des Meeres jedoch stets gewachsen. Kapitän Joseph Turley war ein erfahrener Seemann. Seinen Aufstieg hatte er bei der königlichen Marine erlebt, weshalb er sich nach wie vor gerne als »Kommandant« bezeichnete. Jahrzehnte hatte er die Weltmeere befahren, hatte manchen Sturm erlebt und seine Schiffe immer sicher zurück in die britischen Häfen gelenkt. Er war als harter Knochen bekannt. Sagte man alternden Männer mitunter nach, sie würden ruhiger und weiser, so entwickelte sich Turley auf dieser Fahrt zum Ekel. Miserable Windverhältnisse hatten über weite Strecken das Vorankommen verzögert. Die Verpflegung war minderwertiger und karger geworden. Der Smutje hatte mit vergammelten Lebensmitteln versucht, Essen zuzubereiten – die Mannschaft hatte es ihm vor die Füße geworfen.
Turley hatte getobt, als Connors ihm davon berichtet hatte. »Wenn ihr das nicht fresst, fresst ihr eben gar nichts.« Er hatte Anweisung gegeben, nichts über Bord zu werfen, ahnend, dass die Vorräte knapp werden würden. Keiner wusste, dass Turley dieses Risiko bewusst eingegangen war, als er Platz für Ware bereitstellte, wo sonst Wasser, Brot und andere Lebensmittel hätten lagern sollen. Das Angebot seiner Auftraggeber war zu verlockend gewesen. Mehr Geld für mehr Laderaumkapazitäten. Bei günstigen Winden hätte die Verpflegung trotzdem gereicht, aber die Flauten zwischendurch … Mit den kaum schmeckenden, immer armseliger werdenden Rationen wuchs der Unmut unter den Männern der Besatzung. Seitdem durchgesickert war, dass Kapitän Turley Deweys, ausgerechnet den alten Deweys, der schon länger unter starken Brust- und Rückenschmerzen litt, bestrafen wollte, weil er einige Nahrungsmittel und eine Flasche Rum aus der Vorratskammer unter Deck stibitzt hatte, kochte es gewaltig zwischen den Schiffsplanken der Brigg. Natürlich war es verboten zu stehlen, aber Deweys hatte nicht eigennützig gehandelt. Er hatte sein »Verbrechen« für andere begangen, die ihn beim Kartenspielen betrunken gemacht und dann überredet hatten, für Nachschub zu sorgen.
Turley rief während eines Wutanfalles sein Urteil laut heraus und setzte hinzu, um Deweys sei es nicht schade, er sei alt, gebrechlich, ein Drückeberger. Er hätte ihn gar nicht anheuern sollen, aber jetzt sei es eben zu spät.
Deweys hatte vor Wut gebebt. Dann war es passiert.
»Mister Turley, Entschuldigung, aber Sie sind ungerecht und ohne Erbarmen! Die Mannschaft ist Ihnen egal, Ihnen geht es nur um die hochwohlgeborenen Gäste in Ihrer Kajüte. Ein guter Kommandant handelt nicht so«, hatte der alte Seemann laut ausgerufen.
Da war es mit einem Schlag mucksmäuschenstill geworden. Jeremy Connors wusste, dass sich Deweys mit diesen Worten sein Grab geschaufelt hatte. Der Erste Offizier Smith lächelte indessen in sich hinein.
Turley sah ein paar ewig scheinende Sekunden grimmig von Mann zu Mann. Schließlich blieben seine Augen auf Deweys haften.
»Was Sie da gerade gesagt haben«, verkündete der Kapitän ruhig, »war Meuterei. Und wie Sie wissen, Mister Deweys, steht auf Meuterei eine Strafe.« Für einen Moment schwieg er. Wie gebannt sahen alle Augen auf den Kommandanten der Braganza, der die Aufmerksamkeit zu genießen schien.
»Die Höhe der Strafe«, setzte Turley wieder an, »liegt, wie Sie ebenfalls wissen, im Ermessen des Kommandanten.«
Ein Raunen ging durch die Mannschaft.
»Ich spreche wohl für uns alle, wenn ich sage, dass es für einen Seemann nichts Schöneres gibt, als auf See zu sterben.« Alles hielt den Atem an. Was bedeutete das? »Und falls Ihnen das Kielholen, das ich als passende Disziplinarmaßnahme bezüglich Ihres Vergehens und der Beleidigung eines Kommandanten der britischen Handelsmarine ansehe, wider Erwarten nicht das Leben kosten sollte … dann … ja, dann werde ich dies als eine Art Gottesbeweis betrachten, dass Sie eine Daseinsberechtigung auf dem Schiff haben.«
Turley hatte soeben das Todesurteil über Deweys gesprochen. Kielholen würde der kranke Mann niemals überstehen. Einmal vom Heck bis zum Bug unter einem großen Schiff wie der Braganza gezogen zu werden, das war allenfalls etwas für junge, starke Männer, aber nicht für einen wie den alten Deweys.
George Deweys verzweifelte an dem Urteilsspruch. Er besaß ein winziges Häuschen in Blackpool. Was gab es Schöneres, als an einem solchen Ort seinen Lebensabend zu verbringen mit der Aussicht, jeden Tag das Meer sehen zu können? Diese Fahrt sollte seine letzte sein, er hatte Geld angespart, würde in den Ruhestand gehen, sein Rücken machte die schwere Arbeit auf dem Schiff jetzt schon nicht mehr mit. Ja, seine Kameraden halfen, wo sie konnten. Doch wenn er in seinem Zustand mit dem Kielholen bestraft wurde, würde er sein Haus niemals wiedersehen, seine Frau würde in die nicht eben kleine Zunft britischer Seefahrerwitwen wechseln. Es wäre dann seine letzte Fahrt, doch anders, als er es sich vorgestellt hatte.
Die Braganza befand sich mittlerweile längst in nordwestdeutschen Küstengewässern. In diesen schwer navigierbaren Seen galt es, alle Konzentration darauf zu richten, den Kurs zu halten. Inseln, Untiefen und Sandbänke mussten umfahren werden. Das Verlassen der Posten und eine langatmige Bestrafungszeremonie an Deck waren fehl am Platze. Doch das kümmerte Turley nicht.
Seit dem Aufbruch in Philadelphia waren mehrere Monate vergangen. Die aufkommenden Anzeichen von Ungehorsam hatten für Turley eine einzige Konsequenz: Es war an der Zeit, hart durchzugreifen. Deweys’ Bestrafung kam ihm gerade recht. Danach würde Ruhe herrschen, bis sie in oder vor einem niederländischen Hafen, vielleicht Harlingen, ankern und die Leute endlich mal wieder Land unter ihren Füßen spüren, sich vollfressen und -saufen konnten. Das würde die Gemüter abkühlen, bevor es zurück an Bord der Braganza ging.
Etliche Seemeilen nordwestlich der Nordseeinsel Borkum rief Turley die Mannschaft frühmorgens zum Appell. Deweys stand festgebunden am Großmast – die Offiziere in Paradeuniform in Aufstellung. Jeremy Connors schien sich unwohl zu fühlen, seine Wangen färbten sich rot, während der Kommandant und der Erste Offizier Smith Genugtuung ausstrahlten.
»Männer«, rief Turley mit seiner durchdringenden Stimme, die die Brise aus Nordwest übertönte. Er machte eine wohlbedachte Pause. Er sah blitzende und funkelnde, hasserfüllte, aber auch nichtssagende Blicke auf sich gerichtet. »Männer«, wiederholte er, »ihr wisst, George Deweys hat Mannschaftskameraden bestohlen, aus purer Eigensucht. Diebstahl an Bord kann nicht geduldet und muss geahndet werden«, begann er mit zusammengekniffenen Augen.
Stille. Außer dem stetigen Rauschen des Windes und dem Plätschern des Wassers unter dem Rumpf der Braganza war nichts zu hören.
»Deweys hat öffentlich dem Kommandanten widersprochen, was bei der ohnehin schon zu verhängenden Strafe wegen Diebstahls zu berücksichtigen ist. Er ist verurteilt, und das Offizierskorps, das dieses Schiff befehligt, hat mehrheitlich entschieden.«
»Da siehst du, was Connors für einer ist, letzten Endes hält er doch zu Turley«, flüsterte der Holländer Martens dem Nebenmann ins Ohr. Er wusste nicht, dass sich Jeremy Connors gegen eine Auspeitschung Deweys ausgesprochen hatte, woraufhin Turley seine und die Stimme Smiths als Mehrheit festgestellt und das Urteil in Abwesenheit des Angeklagten gesprochen hatte.
»Doch ich bin kein Unmensch, Männer. Ich sehe mich veranlasst, Mister Deweys zu begnadigen. Er sieht seine Verfehlungen ein und rät der Mannschaft, weiter getreu Dienst zu tun, nicht wahr, Mister Deweys?« Alle Blicke richteten sich auf den grauhaarigen Mann, der mit dicken Tampen gefesselt am Mast stand. Es war ein schauriges Bild, das er abgab. Er sah den Kapitän verächtlich an und schwieg. Turley trieb ein zynisches Schauspiel. Oder wollte er tatsächlich Milde walten lassen?
»Die Schwere des Vergehens von Mister Deweys macht es mir jedoch unmöglich, gänzlich von einer Bestrafung abzusehen. Die Begnadigung bedeutet, dass ich vom Kielholen absehe. Es wäre bei seiner schwächlichen Konstitution einem Todesurteil gleichgekommen, wir schleppen hier ja einen Kranken durch. Anstelle dessen wird Deweys zwanzig Hiebe bekommen, auszuführen sofort, hier und jetzt.«
Turley setzte ein spöttisches Lächeln auf und richtete den Blick auf den Mann mit der Lederpeitsche. Der erste Steuermann schien sich nicht wohl in seiner Haut zu fühlen, aber Befehl war Befehl. Was konnte er schon tun?
»Mister Moir, bitte.«
»So ein … ein mieses Schwein«, flüsterte Persson, der Schwede, Johnson zu, der neben ihm stand.
Der entgegnete leise: »Vielleicht rettet es Deweys das Leben.«
»Sieh ihn dir doch an, der kann jetzt schon nicht mehr, nach zwanzig Hieben ist er genauso tot, als wenn Turley ihn über die Planke hätte gehen lassen.«
In diesem Moment vollzog Steve Moir den ersten Hieb. Von Deweys war nichts zu hören – er zuckte und wand sich stumm unter dem Schmerz. So ging es weiter, Turley zählte laut jeden Peitschenschlag. Nach zehn Hieben verhinderten nur die Seile, mit denen er am Hauptmast festgezurrt worden war, dass Deweys regloser Körper auf dem Schiffsdeck zusammensackte. Mit jedem Peitschenhieb wuchs die Wut bei denjenigen, die zum Zusehen verurteilt waren. Der Zweite Offizier Connors kniff die Augen zusammen. Er hatte den Kapitän von der Milderung der Strafe überzeugt. Dennoch war es unerträglich, und doch konnte er nichts weiter tun. Nicht in diesem Moment.
»Stopp!«, rief Turley, nachdem Moir den neunzehnten Schlag ausgeführt hatte. »Es reicht. Genug, Mister Moir, die Bestrafung ist vollzogen.«
Aufatmen. Turley lächelte und fügte hinzu: »Ich bin ja kein Unmensch.«
Das grausige Schauspiel war beendet. Deweys hing bewegungslos und mit blutendem Rücken vornüber in den Seilen. Doch er atmete. Zwei Männer lösten seine Fesseln und schleppten ihn in die Mannschaftskabinen, um ihn zu versorgen.
Als Turley davon erfuhr, befahl er die Verlegung Deweys in das Gefangenenverlies.
»Ohne Verpflegung, für zwei Tage!«
Doch zwei Männer brachten dem Bestraften heimlich Brot und Wasser. In einem Moment, als sie gerade wieder an Deck gelangen wollten, stand Turley wie aus dem Nichts vor ihnen.
»Sieh an … Hatte ich nicht verordnet, dass Mister Deweys für zwei Tage weder zu essen noch zu trinken bekommt?« Er lachte spöttisch. »Und wollen Sie mir bitte erklären, was Sie dort unten bei ihm gemacht haben?« Er wusste Bescheid. Smith hatte die Aktion mitbekommen und den Kommandanten umgehend informiert. Connors hatte den Offizier bekniet, nichts zu sagen, doch Smith hatte ihn ohne Antwort stehen lassen. Er war Erster Offizier, brauchte sich nur vom Kapitän etwas sagen lassen. Und mit dem war er sich ohnehin einig.
»Nun, was haben Sie dazu …«, mehr konnte Turley nicht sagen, bevor er laut aufschrie. Das blanke Metall eines langen Messers hatte sich seitlich in seinen Bauch gebohrt. Er hielt die Wunde und sah das Blut zwischen seinen Fingern hervorquellen. Die beiden Männer, die Deweys Nahrung gebracht hatten, verschwanden unter Deck.
Turley schwankte über die Planken, eine tiefrote Blutspur hinter sich lassend. Er blickte umher, eine Welle ergriff das Schiff, warf es auf die andere Seite. Turley brach zusammen, ächzend. Smith eilte zum Kapitän.
»Wo ist der Sanitäter, verdammt noch mal? Der Kommandant ist schwer verletzt!«, brüllte er. Doch niemand wollte helfen.
Es war Turleys Frau, die herbeieilte und hysterisch um Hilfe rief. Auch Mister Diehl, der Schiffseigner, der sich gerade mit einer der letzten Flaschen guten Weines beschäftigt hatte, kam herbei und ahnte Böses. Beide versuchten, Turley aufzuhelfen. Langsam, ohne besondere Eile, kamen immer mehr Männer dazu. Niemand schien sonderlich Lust zu verspüren, den Gästen des Kapitäns und seiner Frau unter die Arme zu greifen. Als plötzlich der Obermatrose Verbrügge für alle hörbar rief: »Über Bord mit Ihnen. Wer quält uns und wer lebt wie die Made im Speck? Sie haben es nicht besser verdient.«
»Jawoll, über Bord … über Bord!«
Die Mannschaft verwandelte sich in eine wilde Meute, packte den verwundeten Kapitän und zog ihn an die Reling. Das Schreien des Opfers, sich vor Schmerz krümmend, wurde durch das aufbrausende Johlen der anderen übertönt. Der Aufprall des Körpers auf die kalte Nordsee war kaum hörbar. Es war so schnell gegangen, dass weder Smith noch Connors hätten eingreifen können. Smith gab mehrere Schüsse in die Luft ab, doch es half nichts. Connors schrie: »Halt, Männer! Tut das nicht …«, doch ihm wurde der Weg versperrt.
»Mister Connors, Sir, ausgerechnet Sie wollen uns hindern?« Verbrügge grinste ihn an.
»Es ist meine Pflicht, Sie gefährden die Sicherheit auf der Braganza!«, gab Connors unwirsch zurück.
»Wer in Harlingen, in Genua oder irgendwann wieder in Blackpool ankommt und wer nicht, bestimmen jetzt wir, Herr Offizier«, ließ Verbrügge laut vernehmen und ein begeistertes Gebrüll unterstrich die Zustimmung der Mannschaft.
»Aber nicht die Frauen«, sagte Connors, noch einen Versuch unternehmend, letzte Funken moralischen Anstands in der wütenden Mannschaft zu entfachen.
»Damit bin ich einverstanden«, sagte Verbrügge, der sofort die Rolle des Verhandlungsführers übernommen hatte. »Wir sind ja auch keine Unmenschen«, rief er, das Wort des Kommandanten aufgreifend, der damit seine Gnade, Deweys nur neunzehn und nicht zwanzig Peitschenhiebe zu geben, untermauert hatte. Verbrügge hatte sich auf eine Kiste gestellt, überragte mit seiner großen Gestalt alle anderen und brüllte: »Leute, holt das erste Beiboot runter. Wir schicken die hochwohlgeborenen Damen und Herren auf eine neue Seereise.« Als das Boot zu Wasser gelassen war, packte Verbrügge Diehl am Kragen, zerrte ihn an das Fallreep und verkündete: »Runter mit Ihnen, edler Herr! Sie bekommen jetzt schon Ihr neues Schiff, nicht erst in Genua.« Gelächter begleitete die Szene. »Und nehmen Sie Mrs Turley und die anderen ehrbaren Herrschaften mit. Vielleicht erreichen Sie die Niederlande, Borkum oder irgendeine Sandbank, mir ist es völlig egal. Ihr habt doch kein Mitleid, Leute?« Wieder zustimmende Rufe. »Wir peitschen niemanden aus, mit dem Boot haben Sie eine reelle Chance, Land zu erreichen. Sandbänke gibt es hier genug. Es soll sogar solche geben, die selbst bei Flut nicht mehr überspült werden. Also, Männer, holt die vornehmen Pfeifen aus Turleys Gemächern – die machen jetzt eine Bootspartie! Die Ruder bekommen sie aber nicht mit. Die Nordseeströmungen und die Wellen werden Sie schon irgendwohin führen. Und ich bestimme, dass Mister Smith, der ehemalige Erste Offizier auf der Braganza, ab sofort Ihr Kommandant ist«, höhnte Verbrügge, »er ist ein erfahrener Seemann und hat sehr viel bei Käpt’n Turley gelernt.« Erneut setzte allgemeines Gelächter ein. Kurze Zeit später trieb das Boot ab. Es war schnell aus dem Sichtfeld und in die nebelige Ferne der Nordsee verschwunden, den Unbilden des Meeres schutzlos ausgeliefert.
»Sie machen einen sehr großen Fehler«, sagte Connors und wurde von einem kräftigen Matrosen abgeführt. »Hier gibt es zwischen Festland und Inselkette Sandbänke, Platen und Untiefen. Es ist ablaufend Wasser. Da sollten wir nicht weiter diesem Kurs folgen. Wir haben viel zu viel Zeit verloren. Ihre ganzen Sperenzchen hier …«
»Wer, Sir, hat denn jetzt hier das Kommando?«, wollte Moir wissen.
»Ich bin der Zweite Offizier. Nachdem der Kapitän und der Erste Offizier widerrechtlich auf der Nordsee ausgesetzt wurden, habe ich natürlich das Kommando. Wir müssen den Kurs ändern.«
»Wir sollten ankern und die Lage besprechen«, sagte der Steuermann, der wusste, dass Connors recht hatte, sich aber zu den neuen Machthabern auf dem Schiff zugehörig fühlte.
»Ankern? Hier? Unmöglich! Zu große Strömung und viel zu tief«, erwiderte Connors. Er sah sich um, es dämmerte bereits. »Wir sind an Borkum vorbei.«
»Dann eben …«
»Gibt’s Probleme mit Mister Connors?« Plötzlich stand Verbrügge neben den beiden. »Wenn Sie nicht die richtigen Befehle geben, Connors, dann übernehme ich jetzt: Mister Moir, Sie nehmen nur noch Befehle von mir entgegen.«
»Mister Verbrügge, wir müssen den Kurs ändern. Die Braganza läuft …« Doch Verbrügge unterbrach ihn. Seine Augen verrieten, dass er reichlich dem Single Malt zugesprochen hatte, den er sicherlich in Turleys Kajüte gefunden hatte.
»Mister Verbrügge, wir segeln Kurs Osterems … Wir wollen aber doch …«
»Ich bestimme jetzt«, lallte Verbrügge. »Sie mischen sich nicht ein, Connors. Kurs halten, Moir!«
Die Brigg pflügte durch das Wasser, die Segel waren voll gesetzt, sie lief Kurs Südost. Doch es lauerten Untiefen, so wurde auf Nordost gedreht. Irgendwo musste sich der Memmertsand befinden, eine angeblich höher gelegene Sandplate und eine große Gefahr für die Schifffahrt.
»Sir …« Connors sprach den betrunkenen Verbrügge an, der per Selbstaklamation zum Kommandanten geworden war.
»Schnauze, Pack!«, schrie Verbrügge und zog einen Revolver aus dem Gürtel. Turleys Waffe. Die hatte er sich also auch zugelegt. Er zielte auf Moir und nahm einen Schluck aus einer Whiskypulle, die er in der großen Tasche seiner wetterfesten Jacke verstaut hatte.
»Ich erschieße Sie, wenn Sie meine Befehle nicht befolgen.«
»Wir müssen auf Südwest ändern, sonst …«
Der Schuss durchschnitt die Luft. Moir brach zusammen, Verbrügge hatte ihn in den linken Fuß geschossen, der Steuermann wälzte sich vor Schmerz über die Schiffsplanken.
»Ich dulde keine Widerrede. Holen Sie Knutsen, er soll das Steuer übernehmen«, raunte Verbrügge Connors zu. »Knutsen weiß, wie man ein Schiff steuert.«
Verbrügge war im Ausnahmezustand. Doch Knutsen kam nicht, Jeremy Connors brachte sich schnellstens hinter einem großen Haufen Tampen in Sicherheit.
Verbrügge versuchte, das Steuer zu übernehmen, doch der Whisky übermannte ihn. Das Schiff neigte sich stark zur Seite, er taumelte. Eine Querwelle ließ die Braganza krängen, er verlor den Halt, rutschte auf dem Oberdeck bis an die Reling, raffte sich auf.
»Knutsen, wo bleiben Sie?«, schrie er, doch Knutsen kam nicht.
»Wir müssen hier weg!«, zeigte Verbrügge Einsicht, dann schlug er mit dem Kopf an die harte Kante eines Pfeilers, der die Reling trug. Er sackte in sich zusammen.
Connors raffte sich auf, griff das Steuer, aber seine böse Vorahnung wurde rasch zur Gewissheit. Die Braganza war zu lange falschen Kurs gelaufen. Jetzt hatte sie beigedreht, die Segel flatterten, sie trieb ungesteuert im Meer. Connors übergab das Steuer an einen der Matrosen, die an Deck kamen, ohne ihm genau sagen zu können, was er eigentlich tun sollte. Er musste eine Peilung vornehmen. Kaum in der Kajüte des Kommandanten stand er vor der Seekarte und spürte in demselben Augenblick … Grundberührung. Connors starrte auf die Seekarte vor ihm. Wo waren sie?
Es war der Moment, in dem die Braganza ächzend und knirschend vor Memmertsand strandete.
»Wassereinbruch am Bug«, schrie der Matrose Wilhelm Hamburger, als er den Kopf durch ein Luk steckte.
Wassereinbruch, Sturm, Strandung, Chaos auf dem Schiff. Das Schiff zu verlassen, war lebensgefährlich. Selbst wenn man es auf die Sandplate schaffte, auf Memmertsand gab es nichts. Eine öde Sandbank. Die Strandung bedeutete das Ende der Brigg Braganza. Das Schiff würde in den tosenden Seen nach und nach zerschlagen, für die Mannschaft gab es keine Rettung. Der Sturm hielt mehrere Tage an. Durch das Leck hatte es einen Wassereinbruch gegeben, die umgekippten Trinkwasserfässer waren ausgelaufen. Ohne Wasser und ohne Aussicht auf Rettung starben die Besatzungsmitglieder vor Memmertsand einen quälenden Tod. Einige versuchten, sich mit einem Beiboot zu retten, doch sie kenterten in der brodelnden See der Osterems und ertranken. Verbrügge, in den letzten Tagen nur noch betrunken, erschoss jeden, der sich ihm widersetzte. Jeremy Connors war der Letzte, der versuchte, irgendetwas zu retten. Doch in einem Gerangel mit Verbrügge stürzte er über die Reling der Braganza und konnte sich, womöglich weil er sich etwas gebrochen hatte, nicht mehr aus den Fluten retten. Wie Verbrügge den Tod fand, ist nicht bekannt.
Kapitän Turley, seine Frau, Schiffseigner Diehl nebst Gattin und dem befreundeten Ehepaar sowie der Erste Offizier Smith und der Koch der Braganza, Scutthers, wurden indes von Kapitän Towler, der mit seinem Schiff, der Hebden, zufällig auf die im Beiboot der Braganza Ausgesetzten traf, aus Seenot gerettet.
*
Volksschullehrer Otto Leege sah die Schülerinnen und Schüler der Schule zu Ostermarsch aufmerksam an, der Reihe nach. Er strich mit der rechten Hand durch seinen Bart, rückte die Nickelbrille zurecht.
»So oder so ähnlich muss es sich damals zugetragen haben, als die Braganza auf dem Memmertsand strandete«, beendete er die Geschichte, der seine Schülerinnen und Schüler begeistert gelauscht hatten. Na ja, er hatte schon das eine oder andere hinzugesponnen, um Spannung zu erzeugen. Es gab verschiedene Versionen, die die legendäre Strandung der Braganza auf dem Memmertsand nach einer Meuterei beschrieben. Wer musste schon wissen, welche die richtige war?
Anna streckte zunächst ein wenig zögernd, dann entschlossen den Finger nach oben. Leeges Augen richteten sich auf sie.
»Ja, Anna?«
Die kleinen Fältchen in seinem Gesicht, die sein unverkennbares Schmunzeln begleiteten, kamen zum Vorschein. Diese Fältchen unterschieden sich von den Altersfalten, die das Gesicht des Lehrers übersäten, jetzt, wo seine Pensionierung in sichtbare Nähe rückte. Doch davor fürchtete er sich keineswegs. Im Gegenteil. Er hatte sogar gefordert, noch vor Erreichen des entsprechenden Dienstalters in Rente zu gehen. Geld war nie ein Ansporn zur Arbeit für ihn gewesen, und auch wenn das Monatseinkommen zukünftig etwas geringer ausfiel, würde es für ihn und seine Frau Engeline reichen. Sie brauchten nicht viel. Mein Gott, mit welch kläglichem Gehalt hatte er damals, 1882, seine Lehrerstelle auf Juist angetreten. Die Poststation mit dem Morsegerät musste er gleich mitbetreuen, damit ein wenig mehr Lohn heraussprang. Immerfort waren hungrige Kindermäuler zu stopfen gewesen. Sieben Söhne, eine Tochter – die musste man erst einmal ernähren! Zum Glück war Luxus ihm und seiner Frau Engeline seit jeher fremd. Am liebsten aßen und tranken sie alles, was die Natur hergab. Viele Leute wussten ja gar nicht, was man alles essen konnte und was selbst in den kargen Dünen der Insel Juist wuchs. Schon seine Mutter hatte Otto Leege, als er noch als Knirps durch die Grafschaft Bentheim tollte, mitgegeben, welche Pflanzen essbar, welche ungenießbar waren und welche besondere Heilkräfte hatten. Sie hatte ihm die notwendige Ehrfurcht und das Wissen über die Natur und ihre Zusammenhänge sowie die Tatsache beigebracht, dass die Menschen ohne eine intakte Natur nicht leben könnten.
»Ist die Geschichte wirklich wahr?«, fragte Anna. »Oder ist es ein Märchen, das Sie sich ausgedacht haben?«, riss sie den Lehrer aus seinen Gedanken.
»Die Wahrheit, Anna.« Leege legte seinen Kopf ein wenig zur Seite. »Tja …« Er räusperte sich und sah das Mädchen mit den strohblonden, zu Zöpfen geflochtenen Haaren wohlwollend an. »Ob es sich genauso abgespielt hat, weiß ich natürlich nicht. Es ist ja ewig her. Und auch wenn ich nicht mehr der Jüngste bin, hat sich das alles lange vor meiner Zeit zugetragen. Vermutlich ist es überwiegend eine Mär, eine Art Märchen, und da wird oft viel hineingedichtet. Allerdings gibt es einen wahren Kern. Dass das Schiff auf dem Memmertsand gestrandet ist, entspricht der Wahrheit. Es gibt da zum Beispiel eine Bildergeschichte zur Strandung der Braganza. Irgendein Zeitzeuge mag sie aufgemalt haben. Und es gibt noch weitere Hinweise, die darauf hindeuten, dass das Schiff tatsächlich vor dem Memmert verunglückte. Die Bildergeschichte dazu hängt bei uns im Flur, hier, im Schulhaus. Ihr seid aber wahrscheinlich immer unachtsam daran vorbeigelaufen. Sie erzählt in kurzen Worten, wie es zu der Meuterei kam.«
»Haben Sie etwas hinzugedichtet, Herr Lehrer, sodass es ein spannendes Abenteuer wird?«, wollte Anna wissen.
»Wer weiß, wer weiß …« Leege schmunzelte wieder. Er fügte an: »Die Tragödie der Braganza ist die eine Sache. Aber wovon ich euch eigentlich erzählen will in der nächsten Stunde, das ist die Geschichte darüber, wie aus einer Sandbank – oder aus dem Meer – eine Insel entsteht. So wie die kleine Insel südwestlich von Juist, der Memmertsand. Dort, wo die Braganza strandete.«
»Da wohnt doch niemand, da gibt’s nur Möwen und Seehunde«, quakte der kleine Jan dazwischen.
»Seit wann meldet man sich nicht, bevor man spricht?«, ranzte Leege ihn an und Jan verstummte. Leege schenkte dem Jungen einen strengen Blick.
»So lernen wir am Beispiel des Memmertsandes, wie unsere ostfriesische Inselkette entstand. Die Braganza-Strandung ist wohl erst die zweite Erwähnung des Memmerts, nachdem die Sandbank – mehr war es ja zunächst nicht – im 17. Jahrhundert bereits einmal in dem Bericht eines holländischen Seefahrers genannt wurde.«
Leege erzählte weiter, obwohl er merkte, dass er seine Schüler in diesem Augenblick doch ein wenig überforderte. Er heftete eine Karte an die Tafel.
»1586 findet sich auf einer alten Seekarte der Name ›de Meem‹ für den Memmertsand«, Leege holte Luft, »und eine andere Seekarte zeigt den Namen ›Memer Sandt‹ im Jahre 1750. Es existiert übrigens auch eine amtlicheBeschreibung der ostfriesischen Inseln und hier erscheint Memmert ebenfalls. 1828 wird die Sandbank schon als ›Memmertsand‹ bezeichnet. Damals gab es noch keine Dünen auf Memmert«, setzte Leege fort, »vor allem sind es Schiffstrandungen, die den Memmertsand im 17. und 18. Jahrhundert zu Bekanntheit verhalfen. Er war eine Sandbank wie viele andere auch, irgendwo im Wattenmeer. Zwischen all den Sandbänken und bei dem stetigen Wechsel von Ebbe und Flut das Meer zu passieren, war für die Seefahrer schwierig. Mit einem großen Schiff aber, insbesondere einem richtigen Segelschiff und keinem kleinen Boot, war man oft verloren. Wie die Braganza. Die Seekarten von damals waren sehr ungenau. Man begann, Baken zu errichten, die hoch genug waren, um von Weitem als Warnung erkannt zu werden. Und wisst ihr, dass wohl auch schon Wale in der Nähe des Memmertsandes gestrandet sind?«
»Hier gibt es doch keine Wale!«
»Vielleicht doch, vielleicht ist es mal geschehen. Wie ich jetzt darauf komme? Nun, die Kachelotplate, hier …«, Leege streckte sich und zeigte auf die Sandbank nordwestlich von Memmert, »hat ihren Namen von einem Wal. So jedenfalls die Erklärung für ihren Namen, auf Französisch heißt der Pottwal Cachalot. Mag sein, dass sich einmal ein solcher verirrt hat und ebenfalls nicht mit den Irrungen und Wirrungen der komplizierten Strömungsverhältnisse zwischen Osterems, Memmert und Juist zurechtgekommen ist. Für Wale ist das Wattenmeer der sichere Tod, es ist viel zu flach. Vielleicht heißt die Plate aber auch so, weil irgendjemand sie einmal umrundete und die Form eines Wales darin entdeckte. Beides ist nicht sehr wahrscheinlich, aber irgendwoher muss der Name ja kommen.«
Ein Junge meldete sich.
»Johann?«
»Sie, Herr Leege, Sie haben doch aus dieser Sandbank erst eine Insel gemacht«, sagte der rotschopfige Schuljunge.
»Na ja …«, zögerte der Lehrer, »so kann man es nicht sagen. Ich habe nachgeholfen, ja. Seht, man macht aus einer Sandbank nicht einfach eine Insel. Das muss schon die Natur selbst machen. Was man jedoch tun kann, ist, genau zu beobachten, was die Natur anstellt. Und dann kann man den Sand bepflanzen. Das festigt den Sand, die Pflanzen halten ihn fest. So können Dünen entstehen, Zentimeter um Zentimeter wachsen sie. Und wenn die Seevögel kommen, dann … nun ja, dann müssen die ja auch ihr Geschäft machen. Das düngt den unfruchtbaren Sand. Gut für die Pflanzen. Ihr seht: Wir Menschen können die Natur unterstützen, damit sich so etwas wie eine Insel entwickelt, aber sie braucht Raum, um selbst ihre Arbeit zu tun. Meine Frau, die ihr ja alle kennt, und meine Söhne haben mir geholfen und später habe ich auch Arbeiter auf Memmert bekommen, die mich unterstützt haben, Strandhafer zu pflanzen.«
»Wieso werden Sie eigentlich der Memmertvater genannt?«, wollte Anna wissen.
Leege überlegte. »Memmertvater? Ja, das klingt sonderbar, nicht? Man ist doch Vater von Kindern, nicht einer Insel.«
Die Schüler kicherten.
»Das hat sich ergeben … im Laufe der Zeit. Den Namen Memmertvater habe ich mir jedenfalls nicht ausgedacht«, sagte er, »eine lange Geschichte steckt dahinter.« Wieder blinzelte Leege in die Klasse. »Vielleicht sollte ich sie einmal aufschreiben.«
Es klingelte, und die Stunde war zu Ende. Als die Schüler das enge Klassenzimmer verließen und sich ihren Schulbroten oder dem Spiel auf dem kleinen Schulhof zuwendeten, verweilte Leege noch ein wenig, sah auf die Karte an der grauen Wand und dachte: »Ja, vielleicht sollte ich das alles endlich einmal aufschreiben.«
Immerhin war er mittlerweile sechzig. Wie viele Jahre ihm der Herrgott dort oben noch geben würde – wer konnte das wissen?
Er verließ das Klassenzimmer und ging ins Wohnhaus nebenan, hoffend, dass seine Frau Engeline Tee aufgebrüht hatte.
1862–1914
1
Das schreiende Kind beruhigte sich erst, als es von der Mutter auf den Arm genommen und sein Verlangen nach ihrer Milch endlich gestillt wurde. Es war 1862 in einem bitterkalten Februar. Der ernst dreinblickende Mann an der Seite der Frau lächelte.
»Ein feiner Kerl«, sagte Friedrich-Andreas Leege und seine Frau Leonore antwortete: »Er hat ständig Hunger. Ich hoffe, ich kann ihm genug bieten!«
»Schlafen die Kinder?«, erkundigte sich Friedrich-Andreas nach den Geschwistern des Säuglings. Während Carl, mit dreiundzwanzig Jahren der Älteste, und der neunzehnjährige Friedrich-Wilhelm, der als Zweiter das Licht der Welt im Hause Leege erblickt hatte, ihrer Arbeit im Nachbardorf nachgingen, lagen Mathilde und Lisette, zwölf und vier Jahre alt, in einer kleinen Kammer neben der Küche friedlich in ihren Betten. Friedrich-Andreas Leege hatte Elisabeth Dorothea Leonore Rudolphi 1842 geheiratet. Das Paar war schon bei der Geburt der beiden Mädchen nicht mehr ganz jung gewesen. Fast hatten sie sich gewundert, dass nun doch noch ein Kind hinterherkam, war Friedrich-Andreas doch mittlerweile zweiundfünfzig und Leonore sechsundvierzig Jahre alt. Doch das kleine Kerlchen in den Armen seiner Mutter störte das nicht.
Carl war in Bad Bentheim bei einem Schreiner untergekommen, während Friedrich-Wilhelm im weiter entfernten Groß Hesepe die zweite Hand eines wohlhabenden Bauern geworden war. Friedrich-Andreas war froh, dass die Söhne Arbeit hatten. Das war in diesen Zeiten und in dieser Gegend, die vor allem von den sich weit ausbreitenden Mooren geprägt war, nicht selbstverständlich. Torfabbau und Landwirtschaft warfen nicht viel ab, und Landarbeiter zu bezahlen, konnten sich die meisten nicht leisten, weil es kaum für sie selbst und ihre Familien reichte.
»Es sind tüchtige Burschen«, hörte man Vater Leege häufig über seine Söhne sagen. Leonore lächelte dann und dachte an Mathilde, die ihr schon kräftig in der Küche und im Garten half, und daran, dass sie nun neben all ihren Tätigkeiten nicht nur für Lisette, sondern auch für das kleine Neugeborene sorgen musste. Aber das würde sie tun, so wie sie es für all ihre Kinder getan hatte.
Nachdem der Kleine von der Brust seiner Mutter abgelassen hatte, wiegte sie ihn in ihren Armen sachte hin und her und Karl, der als weitere Vornamen Georg und Otto mit auf seinen Lebensweg bekommen hatte, schlief friedlich ein. Der Tag ging seinem Ende entgegen. Friedrich-Andreas nahm seiner Frau dankend einen Becher Tee aus der Hand, den sie aus Pfefferminzblättern aus dem kleinen Hausgarten bereitet hatte. Die kalten Wintertage mit früher Dunkelheit, Regen und manchmal Schnee verleiteten zu frühem Schlaf. Im Frühjahr und Sommer gab es im Garten allerhand zu tun und Leonore suchte in der Heide oder dem Wald nach Kräutern und Heilpflanzen für ihre Hausapotheke, mit der sie die Heilsuchenden aus dem Dorf Uelsen versorgte, an dessen Rand ihr Häuschen stand. Nicht selten kamen kranke Dorfbewohner zu ihr, die ihren Rat suchten. Ihre umfassenden Kenntnisse um die heilenden Kräfte der Natur hatten sich herumgesprochen. Für jede und jeden hatte sie ein Kräutlein parat.
Dunkle Wolken zogen an diesem Abend über die westlich gelegenen Niederlande und die auf deutscher Seite liegende Bentheimer Grafschaft. Der frischgebackene Vater war erst vor Kurzem von seinem täglichen Dienst als Beamter der Zollbehörden im Grenzraum zu den Niederlanden nach Hause gekommen. Die Stelle sicherte den Leeges ein Einkommen und für ihn, die junge Mutter und die nun vergrößerte Familie den Unterhalt. Für ihre Gesundheitsdienste bekam Leonore Leege oftmals nur ein gut gemeintes Dankeschön, doch schon dafür half sie gerne. Manchmal gab es aber auch ein paar Eier, einige Strunken Grünkohl oder, wenn sie häufig oder in schwierigen Fällen geholfen hatte, ein Huhn. Das füllte die Vorräte auf und die Leeges nahmen es dankbar entgegen.
»Und, was hast du sonst noch gemacht an diesem trüben Wintertag?«, fragte Friedrich-Andreas, dem schlafenden Sohn vorsichtig über den kleinen Kopf streichend.
»Der kleine Wurm hält mich auf Trab. Und es waren Nachbarn da. Du weißt ja, die alte Burmann hat arge Schmerzen im Unterleib. Sie sagt, was der Arzt verschreibt, hilft nicht, und ob es nicht irgendeine Pflanze gäbe, die die Schmerzen lindern könne.«
»Die alte Burmann, ja … Sie ist zäh, schon über siebzig und doch noch ganz gut zu Fuß«, dachte ihr Mann laut nach, schien aber mit den Gedanken woanders zu sein. Daher überhörte er fast die Frage seiner Frau: »Und bei dir?«
»Ach, das Übliche«, erwiderte er, »der Schmuggel nimmt wieder zu. Wein, Lederwaren, Tabak, alles Mögliche kommt von Rotterdam und Amsterdam herein und soll über die Grenze geschafft werden. Wir haben alle Hände voll zu tun, die vielen Fuhrwerke zu kontrollieren und Waren aufzuspüren, die verzollt werden müssen. Die Regelungen des Zollvereins machen ja auch nicht alles einfacher. Und der Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen den Niederlanden und Preußen hat sicher sein Gutes, aber der Schmuggel illegaler Waren hört deswegen ja nicht auf. Im Gegenteil. Aber …«
»… das gehört eben zu deinem Beruf, darüber kannst du dich nicht beklagen«, fiel ihm Leonore ins Wort. Sie war erschöpft und wollte den Feierabend genießen.
»Man muss auf so viel achten … Aber ja, du hast recht, ich sollte nicht jammern«, schloss Friedrich-Andreas seinen Tagesbericht vorzeitig.
Er genoss einen guten Ruf als Beamter des Staates. Doch große Achtung hatten die Uelsener auch vor Leonore. Sie galt in dem kleinen, unscheinbaren Dorf in der weiten, ungestümen Landschaft des westlichen Emslandes, als fleißige, freundliche und gebildete Frau. Ihr Wissen über die Pflanzenwelt gab sie in einfachen, verständlichen Worten weiter, sodass kaum jemand sich scheute, sie anzusprechen.
»Der Holunder«, so erzählte sie gern, »ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie nützlich eine Pflanze sein kann. Die Blüten sind essbar und sie lassen sich zu gesundem Tee, Saft, Likör oder auch Küchlein verarbeiten. Seine Rinde und selbst die Wurzeln sind für allerhand wohltuende und heilende Zwecke brauchbar.«
»Ga man nach Fro Leege – se weet dat woll. De kennt de Planten. Se deit verschkeden Bladen tosamen, kippt kokend Water darto, denn gifft dat een Gesöff, dat schmeckt as … Na, dat segg ich lever nich. Aberst, an de nächste Dag, da geit di dat vööl beter«, hörte man in der Dorfstraße. Dass sie aber nur verschiedene Blätter nahm, kochendes Wasser darüberschüttete und es einem am nächsten Tag besser ging, so einfach war es meistens nicht.
Das Schreien des kleinen Karl Georg Otto – sein letzter Vorname sollte schon bald zu seinem Rufnamen werden – brachte neue Aufregung in das Haus. Während Leonore sich geduldig um Otto kümmerte, sobald er nach Nahrung oder Zuneigung verlangte, und sich, wenn eines der anderen Kinder krank war, dessen Leidensgeschichte anhörte und ein, zwei Kräutlein zur Heilung empfahl, war Friedrich-Andreas die Unruhe nach einem langen Arbeitstag manchmal schon zu viel.
»Wozu gibt es in Uelsen einen Arzt, du nimmst ihm die Kundschaft«, sagte Friedrich-Andreas grummelig, und Leonore antwortete gelassen: »Der Arzt ist überlastet, bis nach Bentheim gibt es keinen weiteren, seitdem Doktor Schomaker in Neuenhaus verstorben ist. Er freut sich, dass ich ihm ein wenig Arbeit abnehme und seine Heilkunst mit der meinen unterstütze. Auch wenn er nicht immer von der Heilkraft der Pflanzen überzeugt ist. Und doch schickt er mir sogar manchmal Kranke, wenn seine Medizin nicht hilft. Und ich sage Patienten, sie sollen sich an ihn wenden, wenn ich mit den Heilpflanzen bei ihnen nicht weiterkomme. So helfen wir uns gegenseitig.« Brummelnd zog sich Friedrich-Andreas an den Ofen in der kleinen Küche zurück.
*
»Komm mit in den Garten!«, rief Leonore Leege, als der kleine Otto laufen konnte. Dort hielt er sich gern auf und sie war froh, die Arbeit erledigen zu können, während der Sohn sich mit allem Möglichen beschäftigte. Er buddelte Löcher, wenn auch nicht immer da, wo er es hätte tun dürfen, half aber auch beim Unkrautzupfen, soweit es überhaupt welches gab. Denn Leonore Leege konnte allerlei Kräutern etwas abgewinnen, die andernorts ohne Bedenken aus dem Boden gerupft wurden. Er legte kleine Wasserläufe an, die er mit Hilfe einer angerosteten Blechgießkanne mit Wasser füllte, das die Mutter ihm mit der Pumpe heraufbeförderte. Er beobachtete gerne, wohin das Wasser floss und wie schnell es in sandigem Boden versickerte, während es länger dauerte, wenn der Boden, wie im hinteren Garten, lehmiger wurde. Deshalb bevorzugte er diesen Teil des Gartens, weil dort seine imaginären Schiffe, teils handelte es sich lediglich um alte, kurze Holzbretter, länger im Wasser lagen. Leonore nahm den kleinen Otto mit auf ihre Erkundungsgänge und Wanderungen in das Umland, wenn sie ihre heilsamen Kräuter sammelte. Sie erklärte ihm die Getreidearten auf den Feldern, nannte ihm die Namen von Pflanzen und Tieren, und schon bald konnte er die wichtigsten Baumarten unterscheiden. Am besten gefiel es beiden auf den Heideflächen, die zu dieser Zeit großen Raum in der Grafschaft Bentheim einnahmen. Die spätsommerliche bläulich-lila Blütenpracht der Heide sollte Otto in guter Erinnerung behalten ebenso wie das frische Grün entlang kleiner, plätschernder Bachläufe.
Karl Georg Otto Leege wuchs heran. Er begann, allerlei Getier zu fangen, das er zu seiner Mutter in die Küche trug, um zu fragen, worum es sich handeln könnte. Zum Glück erlaubte sie, dass er die krabbelnden Lebewesen ins Haus brachte. Manchmal setzte sie sich zu ihm, schaute ebenso interessiert die Tiere an und bestimmte die meisten von ihnen fehlerlos. Dann bestand sie jedoch darauf, dass Otto dafür sorgte, dass alle Käfer, Würmer, Raupen, Spinnen und sonstiges Getier wieder in einem Behältnis landeten, in dem er sie zurück in die Natur brachte. Es musste ja nicht sein, dass sie die Küche mehr und mehr besiedelten. Das eine oder andere entkam natürlich erfolgreich. Aber angesichts undichter Fenster und einer schlecht schließenden Haustür waren derartige Gäste nichts Ungewöhnliches. Otto setzte die Tiere vorsichtig wieder aus. Verletzen mochte er die kleinen Lebewesen nicht.
»Auch Tiere können Krankheiten heilen«, erläuterte Leonore Leege, »stell dir vor, die Blutegel, die so viele für ekelig halten, können ältere Menschen vor Krampfadern bewahren.«
Otto fragte: »Was sind Krampfadern?« Er saugte ihre Erklärungen auf wie die Egel das Blut und schaute am Ende enttäuscht drein, als sie sagte: »Und nun raus damit, ich möchte Abendbrot machen und wenn Vater heimkommt, will er kein Ungeziefer hier haben!«
*
Als Otto das fünfte Lebensjahr erreichte, endete seine unbekümmerte Kindheit. Er kam in die Schule.
»Ein fleißiger Junge«, befand der Uelsener Grundschullehrer Meinertz, als er eines Nachmittags Leonore und Friedrich-Andreas auf der Uelsener Dorfstraße begegnete, »wissbegierig und gehorsam.« Der Vater nahm es wohlwollend zur Kenntnis, lobte seine Frau Leonore, da sie dem Sohn den Lohn des Lernens schon früh vermittelt hatte.
»Ich habe ihm nie befohlen, etwas zu lernen«, entgegnete sie, wissend, dass sie durch die Wanderungen, die sie mit dem Sohn unternommen, und die Erklärungen, die sie ihm währenddessen gegeben hatte, seine Wissbegierigkeit und sein Interesse für die Pflanzen und Tiere geweckt hatte.
»Die Kinder lernen nur«, sagte sie, »wenn man ihnen erklärt, warum es gut und wichtig ist, dieses Wissen zu haben.«
Lehrer Meinertz nahm das zur Kenntnis, aber viel hielt er nicht von den neumodischen pädagogischen Ideen, die Frau Leege ihm gegenüber manchmal äußerte. Sie behandelte Kranke ja auch mit Kräutern aus dem Wald, da hielt er sich doch lieber an den Rat eines richtigen Arztes.
Und tatsächlich glaubte Leonore Leege nicht an den Rohrstock, um Geschichtsdaten, Grammatik, mathematische Formeln oder die richtige Zuordnung von Städten, Ländern und Flüssen auf grauen Landkarten in die jungen Köpfe hineinzuschlagen. Friedrich-Andreas war da nicht immer ihrer Meinung. Er fand, dass ab und an eine ordentliche Tracht Prügel einen erzieherischen Sinn erfüllte.
Dem Grundschüler Otto gefiel nicht alles, was er in der Schule lernen musste. Aber er bewältigte es ohne größere Schwierigkeiten. So blieb Zeit, am Nachmittag mit Freunden die ihm schon gut bekannten Heideflächen der Grafschaft zu durchkreuzen, Kaninchen und Eidechsen, Molche und Ringelnattern zu fangen und zu versuchen, sie zu domestizieren, was bei Schlangen und Molchen zu seinem Bedauern nicht gelang.
»Bah, nimm die Schlange nicht in die Hand!«, rief sein Freund Bernhard, als Otto eine Ringelnatter gepackt hatte.
»Die sind gefährlich! Wenn die zubeißen, tötet dich das Gift«, meinte Hermann zu wissen. Otto zeigte ihnen, wie man ein solches Tier anfasste, ohne dass es zubeißen konnte.
»Außerdem«, fügte er hinzu, »sind die nicht giftig, das ist ein Märchen.«
In der Schule wurde Otto wegen seiner ungewöhnlichen Interessen manchmal gehänselt, dennoch gewann er bei vielen Anerkennung, wenn er ohne Scheu jedes Getier einfach in die Hände nahm, neben Schlangen auch Echsen, Wasserkäfer, Würmer, ganz abgesehen von Insekten und großen Spinnen, vor denen sich viele Mädchen und Jungen ekelten. Es war Otto ein Riesenspaß, mit geschlossenen Handflächen auf seine Freunde zuzugehen und zu sagen: »Wisst ihr, was ich hier in meinen Händen habe? Eine richtig schöne, große schwarze Hausspinne!« Dann öffnete er die Hände nur leicht, schaute in die Höhle, die sie bildeten, schloss sie wieder und fügte hinzu: »Mann, hat die lange Beine! Acht Stück. Wusstet ihr, dass Spinnen auch acht Augen haben?«
Die Kinder traten dann einige Schritte zurück.
»Tu das Ding weg!«
»Mach sie tot!«
Otto lachte, öffnete die Hände und meistens war gar nichts drin. Meistens, denn hin und wieder entwischte tatsächlich ein besonders schönes Spinnenexemplar aus der kurzzeitigen Falle, ein fetter Frosch hüpfte auf den Boden oder eine grünblaue Libelle flog zurück in die Freiheit.
Er beeindruckte seine Klassenkameraden auch, wenn er Wespen oder Bienen über seinen Unterarm oder die Handfläche laufen ließ. »Ganz ruhig muss man bleiben, dann spüren sie, dass gar keine Gefahr für sie besteht. Warum sollten sie mich stechen, wenn ich ihnen nichts tue? Nach dem Stechen sterben sie, wozu sollten sie das riskieren, wenn ihnen doch gar nichts geschieht?«
In der idyllischen Grafschaft in der Umgebung Uelsens begeisterten sich Otto und seine Freunde vor allem für die Bachläufe.
»Komm, wir sammeln Wassermilben und Larven von Köcher- und Eintagsfliegen. Ich habe Gläser in meiner Tasche, die füllen wir mit Wasser, setzen die Larven hinein und bringen sie nach Hause. Mal sehen, was daraus wird.« Meistens landeten auch noch ein paar Wanzen und Wasserspinnen in den Behältnissen.
»Wir können eine Sammlung aller Wassertiere erstellen«, versuchte er, seine Freunde anzuspornen, weiteres Getier zu suchen.
»Wenn wir alle zusammen haben, die es hier gibt, übergeben wir die Sammlung der Schule«, warb er für seine Idee.
»Du bist ein Spinner«, entgegneten seine Freunde. Aber dort draußen in der Natur herumzutollen, daran hatten sie Spaß.
*
»Du kommst in die Schule nach Neuenhaus, außerdem wirst du Latein lernen, beim dortigen Dorfpfarrer«, verkündete Ottos Vater, als sein Sohn mit zehn Jahren die Uelsener Dorfschule verlassen musste. Dass er nicht ewig auf der kleinen Dorfschule bleiben konnte, hatten seine Eltern ihm schon erklärt. Doch dass der Moment dann so plötzlich kam, das musste er erst einmal verdauen. Eine Wahl gab es indes nicht.
Latein? War das wichtig? Seine Mutter bestätigte das, und sie würde schon recht haben.
»Viele botanische Begriffe und Pflanzennamen stammen aus dem Lateinischen. Wenn du sie verstehen willst, ist es gut, die Sprache zu lernen.«
Das leuchtete Otto ein. Er hatte oft gehört, wie seine Mutter lateinische Namen genuschelt hatte, wenn sie unterwegs gewesen waren.
»Taraxacum officinale«, sagte sie dann mehr zu sich selbst, wenn Otto mit einem kleinen Strauß gelb blühenden Löwenzahns daherkam, um ihn seiner Mutter zu schenken.
*
»Die Dinkel gefällt mir«, erzählte Otto seiner Mutter, nachdem er wieder einmal draußen herumgestreift war. Das kleine Flüsschen, das in seinem weiteren Verlauf die Grenze zu den Niederlanden querte, war mit Ufer, Kiesgrund, Strudel und Untiefen Heimat von diversen Klein- und Kleinstlebewesen und Fischen. Otto verbrachte dort viel Zeit mit Schulkameraden und setzte dabei die Arbeit an seinem Inventar fort.
»Was willst du denn mit all den Tieren?«, fragte Ottos Freund Reemt Huisenkamp, als er erstmals mit Otto die Dinkelniederung erkundete.
»Eine Sammlung. Ich will alle Tiere sammeln, die hier leben«, entgegnete Otto und der junge Huisenkamp zuckte die Schultern.
»Auch Rehe und Wildschweine?«
»Nein, natürlich nicht. Nur die kleinen. Insekten, Schmetterlinge, Spinnen, so etwas.«
»Und woher willst du wissen, dass du alle in deiner Sammlung hast?«
»Wenn ich keine mehr finde, die ich noch nicht kenne, gibt es auch keine mehr. Dann ist meine Sammlung vollständig.«
Wieder zuckte Huisenkamp mit den Schultern. Verständnis hatte er für Ottos Tun wenig. Aber ihm machte es, genauso wie Hermann, Spaß, Wasserwanzen oder Laufkäfer zu fangen.
»Immer noch besser als Lateinvokabeln zu büffeln«, sagte er sich.
Dann bauten sie aus Holzstämmen, Ästen und Steinen einen Staudamm an einer flachen Stelle der Dinkel. Es sollte ein Stausee entstehen. Doch der Damm war so undicht, dass das Wasser einfach weiter seinen Weg in die Zuiderzee nahm. Als er den Flusslauf verfolgte, fielen Otto Abtragungen von Sand und Grassoden an den Prallhängen auf. Manchmal stürzten Bäume in den Fluss. An den Gleithängen gab es hingegen Anlagerungen von Sand und Kies. Hier zerstörte das Wasser etwas, an anderer Stelle baute es etwas auf. Ohne dass irgendjemand etwas dafür tun musste. Diese Erkenntnis würde später einmal sehr wichtig werden.
2
»Ich möchte etwas mit Tieren oder Pflanzen machen, wenn ich erwachsen bin«, sagte Otto eines Abends spontan, als er mit seinen Eltern und den kleinen Geschwistern das Abendessen einnahm.
Hinweise seines Vaters, ein solcher Berufswunsch sei eine »brotlose Kunst«, ignorierte Otto. »Was willst du damit anfangen? Wo willst du eine Arbeit finden? Nenne mir einen Beruf außer dem des Bauern, in dem Pflanzen und Tiere eine Rolle spielen«, kommentierte Ottos Vater dessen Pläne. »Oder willst du Bauer werden?«
Otto zuckte mit den Schultern. »Vielleicht«, sagte er leise. So ungewöhnlich kam ihm das gar nicht vor und er dachte daran, dass ein Bauer viel an der frischen Luft arbeitete.
»Wir haben keinen Hof. Du könntest dich höchstens als Tagelöhner durchschlagen. Ich glaube kaum, dass du das erstrebenswert findest«, sagte sein Vater.
Otto antwortete nicht. Was dann? »Vielleicht Gärtner, jemand, der die Gärten schön macht«, sagte er leise.