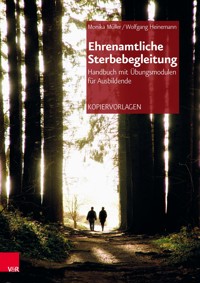17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Tiefe, menschliche Einsichten, die jedem offenstehen.« (Monika Müller)
Überarbeitung und inhaltliche Ergänzung des Longsellers.
In der Begleitung sterbender und trauernder Menschen entwickelt sich eine besondere Form der Spiritualität. Der Begleitende begibt sich in einen intensiven persönlichen Prozess. Wenn trennende Grenzen verschwinden, ein gegenseitiges »Sich öffnen« geschieht, werden Erlebnisse möglich, die außerhalb aller Alltagserfahrungen liegen. Monika Müller erzählt und reflektiert eine Vielzahl selbst erlebter Beispiele und spürt dem nach, was trägt, wenn uns »das Unausweichliche« trifft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Monika Müller
Dem Sterben Leben geben
Die Begleitung sterbender und
trauernder Menschen
als spiritueller Weg
Ergänzte und überarbeitete Neuausgabe
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
1. Auflage
Copyright © 2018 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Umschlagmotiv: © anamad – Fotolia.com
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-22540-7V002
www.gtvh.de
Dedicated to:
Guruji Mohan
who was not only my teacher,
but my master,
who was not only my master
but my model.
Geschrieben:
in Erinnerung an Steven,
der 21-jährig sterbend, mein erster Lehrer war,
an Alan, seinen Vater,
Liz, seine Schwester und beider Schmerz.
Gewidmet:
den beiden wunderbaren jungen Frauen,
die meine Töchter sind,
mit Dank für deine aufrüttelnden Fragen und unsere nahen Gespräche am Sonntagmorgenfrühstückstisch, deine weibliche Kraft und dein Sprachvermögen, Karola,
und deine tiefen Weisheitsergänzungen und Bilder und dein therapeutisches Verständnis, Sigi,
und mit großem Respekt für euren Weg und eure je eigene Art, sich dem Leben zu stellen und mit mir zu sein.
Und den beiden bezauberndsten Enkeltöchtern der Welt.
Und dir mit Dank für nun schon lange Gefährtenschaft
und das staunende und achtungsvolle Zuschauen, wie du manchmal die Geister lebst, die ich nur beschreibe.
INHALT
VORWORTWarum und für wen schreibe ich dieses Buch?
Zur Neuausgabe 2018
GELEITWORT (Lukas Radbruch)
EINLEITUNG Dieses Buch ist eine Einladung
Spiritualität – Ein eigener und gemeinsamer Weg
Spiritualität – Eine Geisthaltung
VOM GEIST, SICH DAS LEBEN ZU NEHMEN
VOM GEIST DER ERGÄNZUNG
VOM GEIST DES GEHEIMNISSES
VOM GEIST DER ABSICHTSLOSIGKEIT
Absichtslose Geistes-Gegenwart
VOM GEIST DER HILFLOSIGKEIT
Nach Paris übersiedeln
Fische vor dem Ertrinken retten
Wachstumshilfe für Setzlinge
Alles weghauen, was nicht nach Löwe aussieht
VOM GEIST DES FRAGENS UND DES AUSHALTENS VON FRAGEN
VOM GEIST DES VERTRAUENS
Dem Sterben trauen?
Sich anvertrauen
Den anderen betrauen
Sich vertraut machen
Sich getrauen
Dem Selbst trauen
VOM GEIST DER NIEDERLAGE
VOM GEIST DES (BEI)LEIDENS
Mitleid als Geisthaltung
Mitgefühl als Solidarität des Menschseins
Sich aus der Ich-Besetzung lösen
Mitleid in Abwehr und Annäherung
Mitleid braucht die Öffnung zum eigenen Schmerz
Mitleiden – Jemandem Bedeutung geben
Mitleid ist kein Einzelkind
Herzliches Bei-Leid
VOM GEIST DES (FEST)-HALTENS
VOM GEIST DER (ENT)-SCHEIDUNG
VOM GEIST DES UNTERWEGSSEINS
Wenn erst, dann …
VOM GEIST DER BEFEUCHTUNG
Humor als Abstandhalter zur Betroffenheit
Befeuchtung?
Humor als den Menschen auszeichnende Fähigkeit
Humor als Akt der Demut und Erhabenheit
VOM GEIST DES UNAUFHÖRLICHEN
Ein Mensch stirbt und lebt als Erinnerung weiter
Unaufhörlichkeit – Eine andere Daseinsform?
Unaufhörlichkeit als Gegenwart des Abwesenden
Unaufhörlichkeit als sammelndes Schaffen
VOM GEIST DER UNMÖGLICHKEIT, DIE GEISTER ZU BESITZEN UND DURCHGEHEND ZU LEBEN
Wenn eine tragende Spiritualität ins Wanken kommt
Die Wertschätzung des Gefühls als Hilfe zur Geisthaltung
Die Unmöglichkeit als Anlass zur Einsicht
Freundschaft als Hilfe zur Selbst-Erträglickeit
Von der Würde des Scheiterns
Vom Spaß daran, ein geistliches Wesen zu sein
VOM GEIST DES TROSTES
Sich selber Trost sein
Um einen Guru von innen bittend
Die Spiele der Unerlösten
NACHWORT (Matthias Schnegg)Haltung, um zu halten
DANKSAGUNG
ANMERKUNGEN
VORWORTWarum und für wen schreibe ich dieses Buch?
Alles Schreiben ist ein Vorstoß gegen die Sprachlosigkeit.
SAMUEL BECKETT
Auf der Suche nach einer spirituellen Praxis in meinem Leben habe ich so manches ausprobiert und eingeübt: Sitzen, Beten, Meditieren, wahrnehmendes Gehen – alles hat mich nicht länger gefesselt und sich nicht dauerhaft in mein Alltagsleben eingeprägt. Als ich eines Sommerabends bei einer bewusstlosen Frau saß und auf ihr mühsames Atmen hörte, wurde mir sehr plötzlich bewusst, dass die Art und Weise, wie ich in mir geschenkter Anteilnahme bei dieser Frau war, eine eigene spirituelle Praxis sein könnte. Einige Wochen später erlebte ich bei einer Klientin, dass ich sie in intuitiver Eingabe vorsichtig auf ihr Lebensgeheimnis ansprechen und dies in behutsame, unterstützende Worte kleiden konnte. Im Bewusstsein, dass dies nicht aus mir alleine kam, sondern mir gegeben wurde, war es mir möglich, in einem besonderen Geist mit ihr weiterhin zu arbeiten, und dies eröffnete ihr wiederum einen tiefen Zugang zu ihrer eigenen Rückbezogenheit auf etwas Höheres und Größeres.
Vielleicht können wir lernen, dieses Beim-Anderen-Sein als spirituelle Praxis anzuerkennen und uns in ihr regelhaft zu üben.
Vielleicht können die dargestellten Gedanken auch Angehörigen eine Hilfestellung sein. Für sie ist es manchmal sehr schwer, die Unterstützung eines Hospizdienstes oder von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzunehmen. Sie glauben vielfach, sich diese Begleitung verdienen zu müssen oder auch, ihrer einfach nicht wert zu sein. Vielleicht kann der Gedanke hilfreich sein, dass diese dienstbaren Geister ihre Begleitung nicht nur aus Selbstlosigkeit, sondern auch um ihrer selbst willen und der tiefen, auch spirituellen Erfahrungen wegen tun. Es mag auch sein, dass die Familienangehörigen und Freunde ihr oft auszehrendes Dasein mit dem Sterbenden oder Trauernden unter spirituellen Gesichtspunkten vorübergehend in einer anderen Dimension und als eine Wachstumsmöglichkeit ansehen können.
Wenn wir die Welt der Spiritualität persönlich erkunden, können wir eine Erfahrung immer wieder aufs Neue machen: das Auftreten spontaner mystischer Erlebnisse. Solche Erlebnisse bleiben nicht nur Weisen, Heiligen oder anderen besonderen Menschen vorbehalten, sonst könnte ich nicht darüber berichten. Sie sind vielmehr normale, wenn auch sehr tiefe menschliche Einsichten, die jedem offenstehen. Ich hoffe, dass dieses Buch auch den elitären Anspruch in Frage stellt, dass die direkte Erfahrung der Wahrheit – und wenn sie auch nur ganz kurz aufblitzt –, ob man sie nun Gott, Tao, höheres Selbst, Erleuchtung oder wie auch immer nennt, nur Menschen möglich sei, die im religiösen oder kirchlichen Sinn fromm oder diszipliniert praktizierend seien. Nicht der Charakter, seine Religionszugehörigkeit oder die Intensität seines Übens macht einen Menschen empfänglich für mystische Erfahrungen, sondern nur sein Sich-Öffnen zur transzendenten Wirklichkeit jenseits der Grenzen unserer individuellen Persönlichkeit selbst. Mystik und Spiritualität sind also nicht ein hoher Turm, den nur wenige Auserwählte besteigen können, sondern die eigentliche Essenz des menschlichen Abenteuers. Die in dem Buch erzählten Beispiele sollten nicht als »harte Fakten« gelesen werden und gelten, sondern möchten als eine Art Gedichte betrachtet werden, die uns durch Analogie und Schönheit Inspiration und Orientierung schenken. Walt Whitman schrieb:
Ich finde Briefe von Gott auf der Straße,
und jeder ist mit Gottes Namen unterschrieben,
und ich lasse sie, wo sie sind, denn ich weiß,
dass immer wieder neue kommen werden.
Nicht zuletzt schreibe ich diese Gedanken auch für mich selber auf, um das in Therapien und Begegnungen oft Gefühlte und Erlebte »gegenständlich« werden zu lassen und benennend zu begreifen. Es geht mir hier wie so häufig in Seminaren und Vorträgen, dass ich, indem ich etwas anderen zu erklären gezwungen bin, es so erst klarer für mich verstehe und dann erst verinnerlichen kann. Dieses in Worte gekleidete Verinnerlichte kann ich dann verfügbar halten für all die vielen Situationen in meinem Leben, wo dies, was ich meine Spiritualität nenne, im Kontakt mit Geltung, Macht, Haben, Wirken und Wollen verloren zu gehen droht.
So ist dieses Buch mir Verpflichtung, die in ihm dargestellten Geisthaltungen auch immer mal wieder und häufiger zu erinnern und zu leben, wohl wissend, dass dieses Leben bestenfalls Annäherungen an die Geisthaltungen bedeutet und immer ein Versuch bleibt.
So wünsche ich Ihnen geist-volles Lesen!
Im Sommer 2004
Zur Neuausgabe 2018
Seit Erscheinen dieses Buches haben Matthias Schnegg und ich zahlreiche, so genannte Spiritual Care Kurse in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt und die Geisthaltungen auf vielen Kongressen und Symposien vorgestellt. Es war für mich sehr eindrücklich, dass auch Menschen, die keinerlei bewussten Zugang zum Thema Religion oder Konfession bekannten, mit diesen Haltungen etwas anfangen, ja sogar nachvollziehen konnten, dass diese möglicherweise mit Spiritualität zusammenhängen könnten.
So fühlte ich mich ermutigt, weitere Geisthaltungen zu bedenken, bzw. sie aus dem Verhalten von Menschen herauszulesen und zu beschreiben.
Ich wünsche mir, dass viele Patienten, Klienten, Angehörige und Hinterbliebene seitens ihrer Behandelnden und Begleitenden diese Geisthaltungen an sich erfahren dürfen, darin Unterstützung erleben und sie für ihre eigene Kräftigung und Heilung nutzen können.
Im Winter 2017
Monika Müller
GELEITWORT
Ich arbeite als Arzt in der Palliativversorgung. Dazu gehört immer wieder die Begegnung mit Menschen, die nur noch kurze Zeit zu leben haben und dies vielleicht erst vor kurzer Zeit erfahren haben. Wie kann ich diesen Menschen gegenübertreten, und kann ich ihnen vielleicht ein bisschen Trost und Hilfe bieten?
Zu meinen Aufgaben gehört aber nicht nur die Versorgung von schwerstkranken und sterbenden Patienten, sondern auch Unterricht für Medizin-Studierende, Ärzte und andere Berufsgruppen. Dabei müssen Kenntnisse (z. B.: Welche Medikamente gegen Luftnot?), Fähigkeiten (z. B.: Wie führe ich ein Gespräch zur Aufklärung über begrenzte Lebenserwartung?) und Haltung vermittelt werden (Wie trete ich Patienten und Angehörigen gegenüber?). Kenntnisse kann ich unterrichten, Fähigkeiten können die Teilnehmer einüben, aber wie vermittle ich Haltung?
Bei all diesen Fragen ist das vorliegende Buch eine wertvolle Hilfe. Monika Müller beschreibt die Begleitung sterbender und trauernder Menschen als spirituellen Weg. Eigentlich veranschaulicht sie aber nicht einen Weg, sondern eine ganze Landkarte mit vielen unterschiedlichen Wegen. Für sie ist Spiritualität eine Geisthaltung, und Monika Müller berichtet über viele verschiedene Geisthaltungen, die ihr im Lauf ihrer langen, erfahrungsreichen Arbeit begegnet sind.
Sie liefert mit ihrem Buch die vielleicht beste Antwort auf die Frage, was eigentlich Spiritualität ist. Diese Frage wird in der Hospiz- und Palliativversorgung gerne diskutiert, aber meist ohne Ergebnis. Wenn ich sie in einer Weiterbildung für Ärzte stelle, hat jeder eine Antwort, aber kaum jemand eine klare Vorstellung davon. Und Ärzte haben oft andere Auffassungen von Spiritualität als zum Beispiel ehrenamtliche Mitarbeiter oder Seelsorger. Und welche Ansichten von ihrer eigenen Spiritualität haben die betroffenen Patienten und deren Angehörige?
In diesem Buch werden dazu keine festen und ausschließlichen Antworten und keine engen Definitionen vorgegeben. Vielmehr zeigen die erzählten Geschichten die vielen Möglichkeiten, wie sich Spiritualität ausdrücken kann, und damit auch die unzähligen Wege, wie Behandelnde auch Begleiter und für eine begrenzte Zeit sogar Weggefährten werden können, wenn unsere eigene Geisthaltung dafür offen ist.
Vor allem aber sind die Geschichten, die Monika Müller hier erzählt, sehr instruktiv. Beim Lesen habe ich immer wieder über meine eigene Einstellung zum Leben und Sterben nachgedacht; und diese Selbstreflexion ist unbedingt nötig in der Hospiz- und Palliativversorgung. Wir sollten doch die Betroffenen so lassen, wie sie sind. Selbst in erfahrenen Teams erlebe ich leider immer wieder, dass wir genau das nicht tun, zum Beispiel wenn die fehlende Krankheitsverarbeitung (oder sogar »Krankheitseinsicht«) bei einem Patienten auf der Palliativstation als behandlungsbedürftiges Problem wahrgenommen wird, ohne zu überlegen, ob es vielleicht für den Betroffenen durchaus Sinn machen kann, seine Zeit und Kraft jetzt nicht mit der Krankheitsverarbeitung aufzubrauchen. Was ist normal, was ist nicht mehr normal, und wie unterschiedlich reagieren Menschen? Konsequenterweise müssen wir bei den Teambesprechungen in der Palliativversorgung immer fragen: Wer hat eigentlich das Problem? Der Patient, seine Angehörigen oder wir als Behandelnde?
Monika Müller zeigt mit diesem Buch, wie unterschiedlich Menschen mit Krisen und existenzbedrohenden Erfahrungen umgehen. Sie macht verständlich und fast fühlbar, warum all diese Wege richtig sein können. Meine Meinung ist, dass dieses Buch jeder lesen sollte, der Schwerstkranke, Sterbende oder Menschen in Krisensituationen begleitet, um diese Menschen in ihrer unterschiedlichen Art akzeptieren zu lernen und sie so anzunehmen, wie sie sind. Nur in dieser Weise kann die Begleitung zu einem gemeinsamen spirituellen Weg werden.
Und über all dieses hinaus ist das Buch sehr lesenswert, in Anekdoten und Geschichten aus einer reichhaltigen spirituellen Praxis heraus verpackt, sehr menschlich geschrieben und spannend. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen, und dass Sie als Leser gar nicht merken, wieviel Sie gerade lernen.
Bonn, im Herbst 2017
Professor Dr. Lukas Radbruch
(Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin)
EINLEITUNG Dieses Buch ist eine Einladung
Spiritualität – Ein eigener und gemeinsamer Weg
Oft wird die Frage gestellt, ob es gläubigen Menschen leichter fällt zu sterben als anderen, und genauso oft müssen die Befragten die Antwort schuldig bleiben, weil die Erfahrung sowohl das Ja als auch das Gegenteil lehrt. Es geschieht, dass Menschen in einer großen Krise oder Leiderfahrung von ihrem Glauben getragen werden, darin Trost und Mut finden; es geschieht aber genauso, dass andere Menschen ihren vordem tiefen Glauben während einer solchen Krise verlieren, keinen Kontakt mehr dazu haben und in Verzweiflung geraten. Das Wort Glauben ist so unterschiedlich besetzt und gefüllt für den je Einzelnen, dass Verallgemeinerungen dieser Frage nicht gerecht werden.
In der Begleitung sterbender und trauernder Menschen ist das, was wir landläufig Spiritualität nennen, die Frage nach dem Woher und Wohin, dem Warum und Wozu, oft ein großes Thema, für den Sterbenden selbst, für die Angehörigen und Freunde, und für uns, die so genannten Begleiter.
Auch in der Darstellung von Hospizarbeit und Palliativmedizin taucht regelmäßig – meist am Schluss einer Aufzählung – das Wort Spiritualität oder spirituelle Dimension auf. In Supervisionen und Fortbildungsveranstaltungen ist die Frage nach der Spiritualität in dieser Arbeit immer wieder ein Thema. Meist erschöpft es sich darin, dass nach den Möglichkeiten gelebter oder auch nur besprochener Spiritualität der sterbenden Menschen gefragt wird und dass man sich einig ist, dass ein Mensch in der letzten Lebenszeit ein Anrecht darauf hat, seine Religion oder Weltanschauung zu thematisieren und nicht zu etwas anderem »missioniert« werden darf, sei dieses andere auch noch so sinnhaft für das eigene Leben des Begleitenden.
Die Beschäftigung mit Leiden, mit dem Dahingehen von Leben, mit Verzweiflung, Wut, Angst, aber auch mit heldenhaftem Aushalten und stiller Hingabe in all den vielen uns begegnenden Biografien und Schicksalen stellt oft genug aber auch die Frage nach dem, was den Behandelnden oder Begleitenden selber trägt oder tragen könnte, wenn das Unausweichliche auf ihn trifft. Hält sein Wertesystem stand, wenn sein Leben zusammenbricht? Wird der Glaube, der in guten Tagen so unverrückbar seinen Platz im Alltag hatte, seine Kraft behalten? Oder wird der Nichtglaube seine Sicherheit, vielleicht seinen Trotz und Stolz durchhalten können, wenn die Enge des nahen Endes spürbar wird?
Dieses Buch hat beileibe nicht den Anspruch, Antworten geben zu wollen oder zu können. Ein Buch kann nicht den inneren Weg und die eigenen Erfahrungen ersetzen. Aber es möchte einladen, den eigenen Weg zu suchen, zu gehen und die dort gemachten Erfahrungen unter dem Gesichtspunkt von Spiritualität anzusehen und zu befragen. Dann können wir als Fragende selber womöglich in unsere Antwort hineinwachsen, auch in diese, indem wir sie immer wieder an uns selber richten. Als ein solches Hineinwachsen ist auch dieses Buch gedacht. Es möchte gemeinsam mit Fragenden der Frage nachgehen, was Spiritualität in unserer Arbeit sein könnte, wie sie gelebt und ausgedrückt werden könnte, wie sie uns Halt und Rahmen im Leben bedeuten könnte und wie wir letztlich mit ihr auch – vielleicht sogar mit Zuversicht – in unser eigenes Sterben hineinreifen können, um es möglicherweise nicht nur zu erleiden, sondern zu erleben (und sogar in gewisser und begrenzter Weise zu gestalten).
In diesem Hineinwachsen wird es geschehen können, dass wir trauernden und sterbenden Menschen unerschrockener begegnen, weil sich die trennenden Grenzen zwischen ihnen und uns ausweiten und verschieben und wir einander in einem gemeinsamen Wachstumsprozess begreifen. Unterschiedlich sind dann vielleicht nur noch die Zeitpunkte der Begegnung mit dem Letztgültigen, aber wir stehen im gleichen Strom der Auseinandersetzung. Es kann sein, dass dieses Begreifen zu einer Partnerschaftlichkeit miteinander führt, die viele Probleme, die in der Begleitung auftauchen, gegenstandslos werden lässt. Dies kann zu einer gerechteren und sogar freundschaftlichen Begegnung mit sterbenden und trauernden Menschen führen und sie in ganz neuer Weise unterstützen helfen, da es kein Innen und Außen mehr gibt, kein Oben und kein Unten, kein Jetzt und Später, eigentlich keinen Begleiter und keinen zu Begleitenden, sondern ein Umeinander – Wissen und Miteinander – Gehen.1
Spiritualität – Eine Geisthaltung
In den ersten Überlegungen zu einem Vortrag über Spiritualität, den ich auf einem Kongress in Göttingen zu halten hatte, habe ich zunächst nach Definitionen gesucht, die mir den Einstieg in das Thema erleichtern sollten und auf denen ich meine Gedanken entwickeln konnte. Ich wurde enttäuscht, weil ich das, was ich vorfand, für viel zu theoretisch – abstrakt oder aber zu eingeengt hielt. Dass für Henri Bergson zum Beispiel Spiritualität eine Geistigkeit ist, die in der reinen Dauer liegt, dass theologische und/oder religionspsychologische Lexika Spiritualität als einen »empirisch beobachtbaren Frömmigkeitsstil«, eine Übung in reiner Innerlichkeit bezeichnen und in eine Spiritualität nach Meister Eckhart oder eine franziskanische oder liberal-evangelische oder tibetische unterscheiden, war für mich nicht hilfreich, da ich spirituelles Denken und Handeln auch außerhalb von Religiosität oder gar Konfessionalität vermute.
Als ich dann im Freundes-/Kollegenkreis darüber sprach, wurde ich mit zahlreichen, nicht immer ernst gemeinten Assoziationen zu diesem Begriff konfrontiert. Spiritistisch, meinten die einen, welch fortgeschrittenes, esoterisches Thema für einen Kongress. Andere brachten den pikanten Zusammenhang zu Spirituosen und ergingen sich in Betrachtungen über die Wechselwirkung von Tätigkeit im palliativmedizinischen Feld und Alkoholabusus. Und mein Computer fragte mich nach dem Eintippen der ersten drei Buchstaben: Spiritual? So falsch sie alle lagen – oder besser liegen wollten –, so war doch an allem ein Funken Richtigkeit, zumindest was den Wortstamm betrifft: Mit Geistigkeit und Geist haben alle Begriffe zu tun, auch wenn es in einem Fall eher der Weingeist ist. An diesem Bezug Geist wollte ich gerne weiterarbeiten, da er mir eine sinnvolle Möglichkeit bot, den Spiritualitätsbegriff aus dem Bereich des Diffusen und Verschwommenen herauszulösen und ihn von dem Vorwurf zu entlasten, er sei mit der Rationalität und Wissenschaftlichkeit nicht vereinbar.
Der Leser wird vielleicht erwarten, dass ich zunächst einmal sage, was ich unter Spiritualität verstehe. Ich möchte jedoch nicht, von einer von mir vorgegebenen Definition abgeleitet, bestimmte Erfahrungen, die ich in meiner Lebens- und Arbeitspraxis kennen gelernt habe, von vornherein als spirituelle klassifizieren. Ich möchte den Leser lieber einige von den Wegen mitgehen lassen, auf denen ich selbst mehr und mehr zu der Überzeugung gelange, es handle sich bei den gemachten Erfahrungen und erlebten Geisteshaltungen um spirituelle.
»Eine besondere Gnade Gottes – erhaben ist er – gegenüber den Menschen besteht darin, dass er ihnen zwei Straßen gewiesen hat, damit sie zum Haus seines Wohlgefallens und zum inneren Frieden gelangen: Denken und Leben.« Entweder beide und nur einen zu beschreiten, beides führe zur Erkenntnis, hat Abu Sulaiman, der islamische Mystiker, bereits im 10. Jahrhundert gesagt. Die Begleitung sterbender Menschen ist ein Bereich, wo diese beiden Straßen, das Leben und die denkerische Auseinandersetzung mit dem Leben, zusammentreffen wie an kaum einem anderen Ort.
Die verschiedenen Geister, die ich auf diesen Wegen traf und von denen ich annehmen mag, dass sie auch den Geist der Hospizarbeit und Palliativmedizin wiedergeben, möchte ich nun einzeln betrachten, sie sozusagen anrufen, und anders als bei Goethe hoffen, dass wir sie nicht mehr loswerden.
VOM GEIST, SICH DAS LEBEN ZU NEHMEN
Erst zu dem, dem auch der Abgrund ein Wohnort war, kehren die vorausgeschickten Himmel um, und alles tief und innig Hiesige … kommt zurück
RAINER MARIA RILKE
Dieser Ausdruck mag Sie, die Leserin oder den Leser, zunächst erschrecken.
Ich will hier aber nicht von Selbstmord sprechen oder euthanasistisches Gedankengut beschwören, vielmehr einer Art »Euzoesie« das Wort reden, der Idee vom glücklichen Leben. Es soll lediglich der wörtliche Ausdruck der schlichten Haltung sein, dieses unser Leben nicht nur zu betrachten, sondern es in einem neuerlichen, diesmal eigenständigen Entscheidungsakt anzuerkennen und anzunehmen.
Im August schrieb mir ein Freund eine Postkarte:
»Bin in Norwegen und nehme mir das Leben – reichlich. Dein Johannes.« Die auf den ersten Blick makaber klingende Aussage kann nur verstehen, wer weiß, dass ich vier Wochen vorher anlässlich seiner Verabschiedung als Geschäftsführer eines Krankenhauses einen ihm gewidmeten Vortrag zur Spiritualität und zu eben dieser Geisthaltung gehalten habe. Der Zusatz »reichlich« macht deutlich, dass er diesen Aspekt besonders aufgenommen hat.
Weltanschauung heißt ja nicht nur die Welt anzuschauen, sie passiv zu betrachten, sondern aus dieser Anschauung heraus zu werten, zu leben und aktiv zu handeln.
Die Welt, die uns umgibt, lehrt uns nicht, zu sterben. Es wird alles getan, um den Tod aus unserem Bewusstsein zu verbannen, als ginge es nur darum, Ziele zu erreichen, als wäre Leistung der einzig gültige Wert. Aber so lehrt sie uns ebenfalls auch nicht, zu leben, bestenfalls mit dem Leben zurechtzukommen, was beileibe nicht das Gleiche ist. Wir sind immer mehr bemüht zu machen und laufen immer heftiger dem Haben nach.
Auch in Palliativmedizin und Hospizbewegung gibt es einige Haltungen dem Leben gegenüber, die sich im besten Fall mit Lebensscheu umschreiben lassen. Während wir bei allen Zielbestimmungen und Therapieplänen eifrigst die Lebensqualität der uns anvertrauten Patienten diskutieren und uns in ethischen Konsilen vehement um so genannte Lebenswertanamnesen bemühen, vernachlässigen wir häufig genug die eigene Lebensqualität, ja wissen manchmal gar nicht mehr, woraus sie bestehen könnte. So wirkt das Kümmern um fremde Lebensqualität gelegentlich wie ein trauriger Ersatz.
In den Supervisionsrunden höre ich immer wieder davon, auch ab und zu von Lebenshemmungen, die sich aus Respekt vor dem großen Leid der Patienten einstellen.
Ein Arzt berichtete davon, wie schwer es ihm gefallen sei, nach seinem Surfurlaub braun gebrannt den Patienten auf der Palliativstation zu begegnen und dass ihn diese Vorstellung schon während des gesamten Urlaubs belastet und sein Wohlgefühl beeinträchtigt habe. Dass er sich vorgestellt habe, wie schmerzlich lebendig und gesund sein erholter Anblick nach seiner Rückkehr in den Krankenhausalltag auf einen Schwerkranken wirken könne und dass er sich deshalb in gewisser Weise schon die gesamte Dauer der Ferien Freude und Spaß verboten, ja manchmal spürbar verkniffen habe. Mit welchem Recht, habe er sich gedacht, sei er denn überhaupt erholungsbedürftig und in einem so sorglosen und unbeschwerten Ferienleben, während andere um ein wesentlich eingeschränkteres Leben verzweifelt kämpften.
Eine Krankenschwester im Hospiz teilte ihre Überlegung mit, sich ihr volles, langes, rotes Haar, das wie eine flammende Aureole ihren Kopf umstand, abzuschneiden, um die kahlköpfigen Patientinnen nicht unnötig damit zu konfrontieren und sie dadurch nicht zu kränken. Sie stellte sich fast jeden Morgen beim Blick in den Spiegel die Frage, ob und von wem sie eigentlich die Erlaubnis habe, sich an ihrer Schönheit und Jugend zu freuen, wenn andere sich gerade so betrübt mit ihrem veränderten Körperbild und ihrem Verblühen und Verblassen auseinandersetzten. Sie fragte sich, ob es nicht ein Akt der Solidarität sein könne und müsse, die Freude an sich und an ihrem Im-Leben-Sein abzustellen und in Sack und Asche zu gehen.
Solche Gedanken gehen von der Vorstellung aus, als gäbe es auf der einen Seite die Sterbenden und auf der anderen die Lebenden. Als trügen wir nicht schon heute den Keim des Seitenwechsels in uns, als ob das Sterben kein Bestandteil des Lebens wäre, als ob wir uns nicht alle miteinander noch in diesem Lebensstrom befänden, der da besteht aus Nichtigem und Wichtigem, Freudigem und zu Betrauerndem, Helligkeit und Schatten. Und dass sich das Leben zu nehmen in diesem Falle heißt: sich all diesem nicht zu verschließen, sondern es zu er-leben, zu er-fahren, in Gänze und Fülle in sich aufzunehmen, bevor wir es nicht mehr können.
Es gibt die indische Geschichte von einer Frau, die von Tigern gejagt wird.
Sie rennt und rennt, und die Tiger rücken immer näher. Am Rand einer Klippe angekommen, sieht sie ein paar Schlingpflanzen, so klettert sie hinunter und hält sich an den Pflanzen fest. Beim Hinunterschauen sieht sie, dass die Tiger genau unter ihr warten. Dann stellt sie beim Blick nach oben fest, dass ein Nagetier genau an dem Trieb frisst, an dem sie sich hält. Gleichzeitig sieht sie auch eine wunderschöne kleine Erdbeerpflanze, die ganz in ihrer Nähe aus einem Büschel Gras wächst. Sie schaut hinunter, sie schaut hinauf, wieder hinunter; dann langt sie nach der Erdbeere und steckt sie sich in den Mund.
Es ist sicher kein Zufall, dass sowohl in der lateinischen wie auch der hebräischen Sprache die Worte für »Weisheit« und »Schmecken« identisch sind. »Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist!«, ruft der Psalmist (Psalm 34, 9). Die Schönheiten der Schöpfung zu kosten, führt zu einer vertieften Weltsicht.
Nach nunmehr fast zwölf Jahren Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase und im Trauerprozess scheint mir die Beobachtung wichtig, dass die Möglichkeit, mit seinem Leben etwas nachsichtiger abzuschließen und dem Tode ein wenig sachter entgegenzublicken, weniger eine Frage des Alters ist als eine Frage des gelebten Lebens. Eine der erschütterndsten, häufigen Erfahrungen in der Hospizarbeit ist sicher die Tatsache, dass Menschen, die ihr Leben immer wieder nach hinten verschoben haben, um es dann möglicherweise eines bestimmten Tages zu leben und zu genießen beginnen wollen, sich just zu diesem gesetzten Zeitpunkt mit einer Krankheit konfrontiert sehen, die dieses geplante Leben auf das Äußerste bedroht. Unsagbar schwer ist mir im Ohr das tiefe Seufzen eines 65-jährigen tumorkranken Mannes: »Ach, hätte ich mir das Leben doch nicht aufgespart. Jetzt ist es zinslos verloren!« Er hatte sich früher immerzu das Leben und die Freude daran versagt, stets mühsam gearbeitet und gespart und das »wirkliche Leben dann endlich« nach seiner Pensionierung beginnen wollen. Und das Paradoxe war, dass es genau dann endete, weithin ungelebt, noch nicht einmal unterbrochen, weil es noch gar nicht begonnen worden war. Diese »Hätte ich doch …« und »Wäre ich doch …« sind Aussagen tiefer Enttäuschung über sich selber, das verfügbare Leben vergeudet und mit den Füßen getreten zu haben. Leben ist etwas, das sich unmittelbar gibt, das sich im Moment anbietet, das nicht den Verweis auf morgen oder den Rückblick auf gestern braucht, das nicht in der Planung sich vollzieht, sondern im Hier und Jetzt sich anbietend ergibt. Das Leben ist etwas, das sich nach eigenen Gesetzen und Rhythmen verteilt, aber es braucht auch Annehmer, offene Herzen und offene Hände, in die hinein es sich verschenken kann.
Ich habe einen 20-jährigen amerikanischen Jungen sterben sehen, der mir einige Wochen vor seinem Tode am Telefon sagte:
My pockets are full. I didn’t miss anything, neither right nor wrong. Of course I’d like to try this or that, and taste some more of life. But that would only be a kind of variation. I think I’m pretty ready to leave.« (»Meine Taschen sind voll. Ich habe nichts ausgelassen, weder an Richtigem noch an Falschem. Natürlich würde ich gern noch Weiteres ausprobieren und mehr Leben kosten, aber es wären nur Variationen. Ich glaube, ich kann gehen.«)
Und wir, die wir noch mitten im Leben stehen oder zu stehen glauben, wann kosten wir von diesem Leben? Reagieren wir nicht manches Mal bereits im Vorfeld mit Lebensüberdrusssodbrennen oder Lebensabwehrblähungen oder Lebensdiätplänen, um es nicht zu tun? Lassen wir uns nicht allzu oft von einer Idee leiten, die uns einflüstert, wir hätten kein Recht auf das Lebendigsein mit all seinen Wünschen, Trieben und lustvollen Anteilen? Treten wir dieses Leben nicht manchmal mit den Füßen, indem wir sagen, wir würden im Prinzip zwar gerne leben wollen, aber anders, unter neuen Umständen und besonderen Bedingungen und nicht einfach so.
Wir stellen Bedingungen an das Leben, treten es manchmal fast mit den Füßen. Ein solcherart abgewehrtes Leben aber wehrt sich seinerseits, es »bildet Reste«, wie Sloterdijk sagt.
»Das Leben bildet Reste – ein ungeheures, brennendes Noch-Nicht … Das träumt über sich hinaus und stirbt voller Weigerung. Darum vibriert die Geschichte höherer Zivilisationen von zahllosen und maßlosen Noch-Nicht-Schreien – von einem millionenstimmigen Nein zu einem Tod, der nicht das Verhauchen des ausgeglühten Lebens ist …«2 Und weiter beschreibt Sloterdijk: »Was wissen der Angstmensch, der Sicherheitsmensch, der Lohnarbeitsmensch, der Verteidigungsmensch, der Sorgenmensch, …, der Planungsmensch vom Leben?
Wenn wir aufzählen, was unsere Lebensinhalte ausmacht, so ergibt sich in der Summe viel Versäumnis und wenig Erfüllung, viel dumpfer Traum und wenig Gegenwart.«3
Die gewaltige Kakofonie von Verneinung und Ablehnung kann das tickende Metronom des Lebens nicht zum Schweigen bringen, das jeden Tag die Unausweichlichkeit des Todes näher bringt. Jedes einzelne rhythmische Ticken bestätigt das Ablaufen der Uhr.
Eine weise Formulierung aus alter Zeit begleitet uns bis heute: Media vita in morte sumus, mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Sie ist uns steter Appell auf Besinnung, vor lauter Lebenszugewandtheit den Tod nicht zu vergessen. Aber mir scheint auch, gerade in Verbindung mit Hospizarbeit und Palliativmedizin, die gelegentliche Umdrehung der Formel angebracht. Sie könnte dann heißen: Media morte in vita sumus, mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen. Mitten in all den kleinen und großen Toden dürfen wir das Leben, seine Würdigung und seine Feier nicht aus den Augen verlieren.
Seit Jahren hegte ich den Wunsch, Lissabon zu besuchen, sein viel gerühmtes Licht zu sehen und den Fado im Original zu hören. Im Vorbereiten dieses Kapitels habe ich beschlossen, den Wunsch umzusetzen. Im Mai reiste ich nach Portugal und genoss die Stadt, die nach Erdbeben und Bränden selber ein Mahnmal der Lebenswürdigung ist, ihr Treiben und ihre allgegenwärtige melancholisch-heitere Musik. Wieder einmal musste ich selbst erfahren und lernen, was ich in Fortbildungen lehre: das Leben nicht aufzuschieben.
Oftmals lehren uns auch gerade die sterbenden Menschen, mit denen wir täglich umgehen, diesen Geist, sich das Leben zu nehmen. Mir fällt in diesem Zusammenhang Walter F. ein, der im Alter von 94 Jahren nach dem Tod seiner zweiten Frau in ein Altenheim am Rande von Santa Cruz in Kalifornien übersiedelte.
Zwischen der Sozialarbeiterin und ihm entspann sich eines Tages folgender Dialog:
»Walt?«
»Ja«, antwortete er, »was ist?«
»Walt, wer war die Frau, die gestern beim Fernsehen an deiner Seite saß? Wer ist diese neue Freundin?«
»Ja, das stimmt«, sagte er.
»Was stimmt, Walt?«
»Dass sie meine neue Freundin ist!«
»Freundin? Walt, du warst zwei Mal verheiratet, und du bist Mitte neunzig, und die Frau ist mindestens drei Jahrzehnte jünger als du …«
»Nun«, antwortete er, »ich habe herausgefunden, dass es nicht gut ist für einen Mann, alleine zu sein.«
»Das kann ich gut verstehen. Du hast wahrscheinlich einen Menschen vermisst, mit dem du sprechen kannst nach all den Jahren der Zweisamkeit.«
Ohne Zögern sagte Walter: »Ja, das habe ich unter anderem auch vermisst.«
»Unter anderem auch? Heißt das, dass du romantische Gedanken hegst?«
»Das könnte man so sagen.«
»Walt?«
»Was?«
»Ich dachte immer, es gibt ein Alter, wo diese Sachen aufhören …«
»Meinst du, Sex?«, gab er zurück.
»Ja, das meine ich.«
»Warum sollte das aufhören?«
»Nun, weil diese Art von körperlicher Anstrengung gefährlich sein könnte für die Gesundheit, ein großes Risiko …«
Walt schaute längere Zeit in die Ferne.
Dann antwortete er: »Nun, das wäre zwar sehr, sehr traurig, aber wenn sie stirbt, dann stirbt sie …«
Walter nahm sich trotz oder wegen seines fortgeschrittenen Alters das Leben in einer großen Selbstverständlichkeit und auch Dankbarkeit, was nicht heißt mit Rücksichtslosigkeit. Er empfand es als ein großes Geschenk, das ihm gegeben war und ihm somit zustand. Dieses Geschenk zurückzuweisen, wäre ihm ein Vergehen gewesen. Auch ging die Annahme dieses Geschenkes nicht auf Kosten anderer, die ihre eigene Verantwortung für das Entgegennehmen oder Ablehnen des Geschenkes Leben selbst tragen. Jedes Lebensangebot ist ein persönliches und unmittelbar direktes; es zurückzuweisen würde einem anderen Menschen, dem es zurzeit nicht in der Fülle zugeeignet ist, in nichts nützen.
Eine zweite Lehrmeisterin kommt mir in den Sinn:
Frau von Stetten war eine alte Dame von gut und gerne Mitte achtzig. Sie lebte mit ihrem alleinstehenden Sohn, einem Professor, der kurz vor der Emeritierung stand, in einem Gründerzeithaus in der Südstadt. Obschon der Pflegedienst einmal täglich zu ihr kam und sie auch die Mahlzeiten von Essen auf Rädern erhielt, ging sie noch ausgesprochen gerne in die Stadt, um Besorgungen zu machen und einzukaufen. Wenn sie dann zurückkehrte, war der Korb ihres Rollators mit zahlreichen Päckchen gefüllt, meist Kosmetik und Kleidung. Sie legte großen Wert auf ihr Äußeres, und der wöchentliche Freitagsbesuch bei ihrem Friseur war seit Jahren nicht ausgefallen. Nur mit der Mitteilung ihres Alters war sie heikel. Als ich ihr eines Tages ein Kompliment machen wollte und sie danach fragte, antwortete sie geschickt, dass sie das im Moment gar nicht so genau wisse, denn in ihrer katholischen Familie habe man nie Geburtstage, sondern die Namenstage gefeiert, und so habe sie das Alter nicht recht nachhalten können. Beeindruckt von der Kunst des Ausweichens und ihrem Charme, habe ich sie nie mehr auf ihr Alter hin befragt. Aber es gab noch eine Steigerung: Die neue Schwester des Pflegedienstes kannte das Tabuthema noch nicht und stellte ihr naiv dieselbe Frage. Beim ersten Mal wurde sie überhört, bei der Nachfrage murmelte Frau von Stetten, dass sie so Anfang sechzig sei. Das sei nicht gut möglich, setzte ihr die junge Frau zu, denn ihr Sohn sei ja bereits schon vierundsechzig Jahre. »Nun«, antwortete die alte Dame hoheitsvoll, »mein Sohn lebt eben sein Leben, und ich lebe meins!«
Sie dachte ja gar nicht daran, sich in ihrer Lebendigkeit und Lebenszugewandtheit beschneiden zu lassen, indem sie sich der von außen an sie herangetragenen Forderung gefügt hätte, ihr fortgeschrittenes Alter nicht nur zu akzeptieren, sondern auch noch zu veröffentlichen. Sie hatte ihr Recht auf ihre Eitelkeit und ihre Verleugnung, wenn dies die Gründe für ihre bezaubernde Sturheit gewesen sein sollten. Jeder von uns besitzt einen Winkel, in dem er nicht altert, jung und lebendig, ja vielleicht kindlich bleibt und bleiben darf. In dem er ausgelassen und hingerissen das Leben spielt, wie es sich ihm bietet, ohne Rücksicht auf sein Alter, seine Krankheit, sein Sterben. Und hat ein Recht darauf (und im Niederschreiben bin ich mir der Utopie dieser Forderung durchaus bewusst, kann sie mir aber nicht verkneifen), dass sich der letzte Wohnort diesem Lebensspiel unterordnet und nicht eine Atmosphäre gekünstelter Reife, erzwungener Weltabkehr oder Pseudo-Kontemplation anbietet.
In der Hospizbewegung gilt das Wort vom Leben bis zuletzt, gilt die Vorstellung, dass Hospize Orte des Lebens sind. Manchmal aber sind es Orte von gewollter Pietät, von dramatischer Stille, von stilisierter Ehrfurcht, von leiser, steriler Sterblichkeit, Sterbeorte erster Klasse, inmitten farblich abgestufter Tapeten, symbolträchtigen Wandbildern und Trockenblumen, auf dicken Teppichen oder edlem Parkett, architektonische Glanzleistungen für ein Sterben wie bei Hilton statt für ein Sterben wie zu Hause.
In einem kleinen Hospizhaus in Irland, in seiner Vororteinfamilienhausart sehr bescheiden und von eher schäbigem Charme, erlebte ich die ergreifendsten Abschiedsfeiern, denen ich je beigewohnt habe. Wenn das Sterben eines Bewohners näher rückte, versammelte sich das Team wie jeden Morgen statt im Gemeinschaftsraum in diesem Zimmer und hielt seine Tagesanfangsandacht. Die Türe zum Flur und damit für die anderen Bewohner stand sowieso immer offen, so auch jetzt. Man sang, machte Musik mit Flöten und Gitarren, beileibe nicht nur leise und getragene, und sprach im Chor gemeinsam eine Art Lobpreis auf das Leben. Dann setzten Einzelne ihren persönlichen Dank an diesen Tag fort: Man dankte für die Sonne oder den Regen, dass man gut aus dem Bett gekommen oder nicht, dass der Abend zuvor gesellig oder ruhig verlaufen war, dass man einen Vogel hatte singen hören oder einer Spinne im Netz begegnet war, dass der Verkehr nervenaufreibend dicht oder fließend gewesen war, und man endete damit, dass man dem Gast, in dessen Zimmer man sich befand, einen lebendigen Tag wünschte (and a lively day for you). Wenn der Bewohner gestorben war, hielt man am nächsten Morgen mit allen, die wollten, auch mit den Angehörigen, eine solche Andacht einschließlich des Guten-Tages-Wunsches (and again a lively day for you) wieder ab. Mich hat die gelebte Gewissheit von der Kontinuität des Lebens über die Grenze des Versterbens hinaus und die Selbstverständlichkeit der gemeinsamen Lebenshuldigung tief berührt.
Jahre später entdeckte ich zufällig in einer Bibliothek, dass der Haupttext dieser Morgenandacht den Tagebüchern von Gerard Manley Hopkins entstammte, einem lebendigen Zeugnis irdischer Kontemplation. Dieser Dichter hat mit spiritueller Zartheit den Erscheinungen der sichtbaren Welt eine leidenschaftliche Aufmerksamkeit zugewandt. So spricht er von der Flamme, »heller und glatter als Glas, Wasser und Seide«, von der »in Metall getriebenen Himmelsstirn über dem Sonnenuntergang«, von der Zeder, deren Zweige »wie die waagerechte Zeichnung einer Krähenfeder mit feinen Wellen und Schwingungen gegen das Licht stehen«, von dem »schmalen Streifen eines wie flüssig aussehenden Gerstenfeldes«, von den Rhone-Gletschern, vom Flug des Reihers, vom jungen Ulmenlaub, von der wechselnden Gestalt der Wolken … Sein Blick ist geradewegs auf das Herz der Dinge gerichtet und überspringt nicht die Realität des Sichtbaren in vorschneller Symbolik. In dieser Tiefe wird ein bislang verborgener, unendlicher Bezug sichtbar. Jene glühende Genauigkeit der sinnlichen Schilderung beweist, wie sehr der dem Leben zugewandte und zugleich kontemplative Blick das Sichtbare der Welt respektiert und zu bewahren sucht. Diese Texte sind eine Zustimmung zum Leben und zur Welt, und sie wurden, indem sie in einem Hospiz gefeiert wurden, auch eine Zustimmung zum Sinn des Lebens und der Welt.
Jean-Jacques, ein junger Aids-Patient, war schon Monate im Lebenshaus, einem der ersten Hospize in der Schweiz. In den letzten Wochen seines Lebens lag er gekrümmt, in eine fötale Position zusammengerollt, in seinem Bett, das er nicht mehr verlassen konnte. Die Krankheit hatte seine Sehnerven zerstört, eine Nahrungsaufnahme war durch schlimmen Pilzbefall der Mundschleimhaut nicht mehr möglich. Jean-Jacques dämmerte dahin, und das Team, das ihn sehr mochte und viel mit ihm unternommen hatte, als er noch nicht sterbend war, wartete auf seinen Tod. Man sprach in der Umgebung nur noch gedämpft, ging auf Zehenspitzen, um seine Ruhe nicht zu stören. Man glaubte, dass man ihm das schuldig war, schränkte sich in den eigenen Lebensäußerungen sehr ein und nahm kollektiv Rücksicht. Eines Abends vertraute Jean-Jacques seine Not und Traurigkeit seinem Lieblingspfleger Yves an: »Ich bitte euch sehr, mit dieser fürchterlichen Ruhe aufzuhören. Ich kann nun fast nicht mehr aus mir alleine leben, aber ihr könnt es doch für mich tun, sozusagen stellvertretend. Ich kann es nun nur noch durch euch tun, am Leben teilzunehmen. Also lasst mich nicht vor der Zeit in die Stille und Leblosigkeit fallen. Macht Lärm, ich will euer Lachen und eure Schimpfworte hören, will hören, wenn euch etwas hinfällt und das Geschirr aneinanderstößt, eure Schritte, die ich unterscheiden kann, und macht das Fenster auf zur Straße, um Gottes Willen, lasst Leben herein!«
Dann kann es geschehen, dass sich Welt auftut für einen anderen Menschen, mitten durch uns hindurch, dass Leben einem anderen zuwächst, weil wir uns ihm nicht verschließen. Lebens-Mittel zu sein für einen anderen, welch höchste Form von Rücksicht und Liebe.
VOM GEIST DER ERGÄNZUNG
Ich schlief und träumte, dass Leben Freude ist.