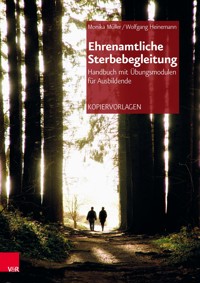Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Palliativmedizin und Hospizarbeit haben sich in den vergangenen Jahren in vielfältiger Weise entwickelt. Das hat auch dazu geführt, dass Sterben, Tod und Trauer in der Gesellschaft intensiver wahrgenommen und diskutiert werden. In der Begegnung und Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen einschließlich ihres Umfelds sind Themen wie Schmerz, körperliche Symptome, psychosoziale Probleme, Erfahrungen von Leid, Abschied, Tod und Trauer allgegenwärtig. Eine wesentliche Aufgabe der im palliativen und hospizlichen Bereich Tätigen ist der Umgang mit Trauer. Das Handbuch klärt auf über die Möglichkeiten und Grenzen von Trauerbegegnung und Trauerbegleitung und gibt Antworten auf die zahlreichen Fragen zum Phänomen Trauer. Neben der Vermittlung theoretischen Grundwissens zum Verständnis von Trauer werden praktische Wege und Strategien zum Umgang mit Trauer gezeigt wie auch immer wieder auftauchende Fragen von Schuld, Verzweiflung, Sinnsuche und Sehnsucht besprochen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Monika Müller / Sylvia Brathuhn / Matthias Schnegg
Handbuch Trauerbegegnung und -begleitung
Theorie und Praxis in Hospizarbeit und Palliative Care
Unter Mitarbeit von Thorsten Adelt, Theo Breidbach,Christine Fleck-Bohaumilitzky, Felix Grützner, Martina Kern,Dennis Klass, Bianca Papendell, David Pfister, Rita Rosner,Martin Weber, Sabine Zwierlein-Rockenfeller
Mit einem Geleitwort von Friedemann Nauck
Mit 3 Abbildungen und einer Tabelle
4., bearbeitete Auflage
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2021, 2018, 2013, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 GöttingenAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällenbedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Umschlagabbildung: tilla eulenspiegel / photocase.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99428-4
Inhalt
Geleitwort
Einleitung
Teil I: Theoretisches Grundlagenwissen
1Das Phänomen Trauer
1.1Ein allgemeines Verständnis von Trauer
1.2Unser Verständnis von Trauer
1.3Werdeschritte – Trauerarbeit und Traueraufgaben
1.4Die Gesichter der Trauer – eine Ausstellung (Martina Kernund Thorsten Adelt)
2Trauer im Kontext von palliativen und hospizlichen Versorgungsstrukturen
2.1Die drei Felder der Trauer
2.2Trauer angesichts Diagnose und infauster Prognose – Vom Denkwissen zum Erfahrungswissen
2.3Die Ungleichartigkeit und Ungleichzeitigkeit der Trauer
2.4Sterbebegleitung und ihre Auswirkung auf die Trauer
2.5Komplizierte Trauer – Definition und Behandlungsmöglichkeiten eines erschwerten Umgangs mit Verlusten (Rita Rosner)
2.6Trauer oder Betroffenheit? Was Mitarbeiter erleben und brauchen
Teil II: Praxisrelevanz und Umsetzungsmöglichkeiten
3Haltung und Kommunikation
3.1Wahrnehmen, Raum schenken und achtsam sein
3.2Tiefer Kummer und Trost (Dennis Klass)
3.3Trauer auslösen
3.4Trauer und Sprache – Wenn Worte einfrieren(Sylvia Brathuhn und Sabine Zwierlein-Rockenfeller)
3.5Trauer und Demenz – Wenn Sprache nicht mehr berührt
3.6Trauer und Spiritualität
3.7Trauer und Rituale – Ordnende Kraft in Krisenzeiten(Felix Grützner)
3.8Fremd- und Selbstsorge (Martina Kern)
4Begegnung mit und Begleitung von Trauer im palliativ-hospizlichen Kontext
4.1Trauerwege eröffnen – eine entscheidende Funktion der palliativen und hospizlichen Arbeit
4.2Begleitansätze (Haltungen) in der Vielfalt der Trauer
4.3Trauerschuld und ihre Vieldeutigkeit
4.4Hemmnisse in der Begleitung am Beispiel von Verzweiflung
4.5Trauer erwärmen
4.6Focusing-unterstütze Trauerbegleitung(Sabine Zwierlein-Rockenfeller)
4.7Die vier B in der Begleitung im (physio-)therapeutischen Tun – Begegnung, Bewusstheit, Berührung, Bewegung(Sylvia Brathuhn und Sabine Zwierlein-Rockenfeller)
4.8Begegnung und Begleitung im stationären Kontext – Ein-Sichten eines Arztes (Martin Weber)
4.9Der Trauer begegnen – Was Pflegende tun können(Bianca Papendell)
4.10Möglichkeiten hausärztlicher Trauerbegleitung(Theo Breidbach)
4.11Trauerbegleitung durch ehrenamtlich Mitarbeitende – erklärt an einem Märchen
4.12Setting von Trauerbegleitung
4.13Wie wirkt Trauerbegleitung? Ein erstes Forschungsergebnis(Monika Müller und David Pfister)
4.14Qualifizierung in Trauerbegleitung(Christine Fleck-Bohaumilitzky)
5Trauerbegleitung: etwas für mich? – Ein Nachwort
Literatur
Die Autorinnen und Autoren
Sachwortregister
Geleitwort
In der hospizlichen und palliativen Versorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren Zugehörigen1 sind für die dort tätigen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie für die Ehrenamtlichen Themen wie Schmerz, weitere körperliche und psychosoziale Symptome, aber auch Erfahrungen von Leid, Abschied, Tod und Trauer allgegenwärtig. Palliativmedizin und hospizliche Arbeit haben sich in den vergangenen Jahren in vielfältiger Weise entwickelt. Das hat nicht zuletzt dazu geführt, dass die Themen Sterben, Tod und Trauer in der Gesellschaft intensiver wahrgenommen und diskutiert werden. In der Palliativmedizin haben sich die Strukturen der ambulanten und stationären Palliativversorgung zunehmend etabliert und es stehen im medizinischen, pflegerischen und psychosozialen Bereich Behandlungskonzepte zur Verfügung, die den Betroffenen auf vielfältige Weise bis zu ihrem Lebensende zugutekommen. Eine wesentliche Aufgabe dieser Arbeit ist jedoch auch der Umgang mit Trauer. Trauer beginnt nicht erst, wenn ein Mensch verstorben ist, sondern bereits in dem Moment, in dem die Diagnose einer vielleicht unheilbaren Erkrankung gestellt wird.
Die Autoren haben sich in diesem Handbuch dem auch im palliativen und hospizlichen Kontext immer noch unzureichend beachteten Gebiet der Trauer zugewendet. Das Handbuch soll Hilfestellung für die Mitarbeitenden bieten, über die Möglichkeiten und Grenzen von Trauerbegegnung und Trauerbegleitung zu reflektieren, und Antworten auf die zahlreichen Fragen zum Phänomen Trauer geben. Neben der Vermittlung theoretischen Grundwissens zum Verständnis von Trauer wird in mehreren Kapiteln Trauer im Kontext von palliativen und hospizlichen Versorgungsstrukturen einschließlich der Möglichkeiten und Grenzen in der Behandlung der erschwerten Trauer thematisiert.
Im zweiten Teil folgt das praxisrelevante Grundwissen im Kontext von Trauer. Themen wie Wahrnehmung und Achtsamkeit, Kummer und Trost, Trauer und Spiritualität sowie Trauer und Rituale sind wesentlich für die besondere Haltung und Kommunikation mit Betroffenen. Durch die Vielfalt der Themen werden die Fragen aus der täglichen Praxis im Umgang mit Trauer aufgegriffen. Praktische Wege und Strategien zum Umgang mit Trauer werden ebenso aufgezeigt wie auch zur Auseinandersetzung mit immer wieder auftauchenden Fragen von Schuld, Verzweiflung oder Sinnsuche und Sehnsucht angeleitet wird. Begegnungen mit und Begleitungen von trauernden Menschen sind in unserer täglichen Arbeit nicht nur herausfordernd, sondern immer wieder belastend.
Ich möchte mich bei Monika Müller, Sylvia Brathuhn und Matthias Schnegg bedanken, dass sie dieses Handbuch zur Begegnung mit und Begleitung von Trauer im palliativen und hospizlichen Kontext herausgeben. Es wird dazu beitragen, dass wir uns alle intensiver mit dem Thema Trauer befassen. Möge dieses praktische Handbuch außerdem daran mitwirken, dass der Umgang mit Trauer nicht nur in unserer täglichen Arbeit, sondern auch in unserer Gesellschaft mehr Beachtung findet.
Prof. Dr. Friedemann Nauck
Lehrstuhl für Palliativmedizin an der Universitätsmedizin Göttingen
1Der von Kerstin Lammer geprägte Terminus »Zugehörige«, der häufig auch in diesem Buch verwendet wird, umfasst sowohl die Angehörigen als auch alle diejenigen, die dem Sterbenden nahestehen, also Verwandte, Freunde, Kollegen, Nachbarn und ehrenamtliche Begleiter. Der Begriff drückt stärker die Teilhabe aus. Zugehörige sind Teil vom Bezugssystem und nehmen am Patientenschicksal in besonderer Weise Anteil. Sie stehen in direkter Nähe und Beziehung. Die Bezeichnung »Angehörige« läuft Gefahr, im Sinne von Anhängsel des Patienten verstanden zu werden.
Einleitung
Palliativstationen und Hospize bzw. Hospizdienste sind Orte, an denen einschneidende Verlusterfahrungen geschehen. Somit sind sie Orte der Begegnung mit Trauer, Orte der Beratung und Begleitung von Trauernden. In diesem Bereich werden Menschen vor dem Sterben, während des Sterbeprozesses und ihre Angehörigen unmittelbar nach dem Sterben in ihren individuellen Trauerprozessen behutsam begleitet. Trauer hat hier zum Teil andere und weitere Gesichter als bei plötzlichem oder gewaltsamem Tod, als bei dem Sterben im Altenheim und im Akutkrankenhaus.
Im palliativen und hospizlichen Kontext bilden der Patient, seine Familie und Freunde eine Fürsorgeeinheit. Somit gehört die Begleitung von Zugehörigen über den Tod hinaus zu den Grundaufgaben palliativer und hospizlicher Versorgungskonzepte. Herausragend ist die Bedeutung für die Zugehörigen bei der Lösung – einer der ersten und schmerzlichsten Traueraufgaben, die Wirklichkeit des Todes und des Verlustes durch das Abschiednehmen von dem Verstorbenen, das auf Wunsch in Begleitung geschieht, zu realisieren. Wenn dies unter angemessenen Rahmenbedingungen, insbesondere unter Wahrung von Respekt, Mündigkeit und Mitbestimmung geschehen kann, ist ein wichtiger Risikofaktor für erschwerte Trauerprozesse umgangen.
Gleichzeitig werden den Zugehörigen hierdurch das sinnlich-begreifende und kognitiv-erfassende Erfahren der Realität von Verlust, Sterben und Tod sowie Grundhaltungen des Respekts, der Menschenwürde, der Wahlfreiheit und der Mündigkeit im Trauerprozess ermöglicht.
Die palliative/hospizliche Begleitung stellt trauernden Zugehörigen Informationen über weiterführende Angebote zur Trauerbegleitung im Rahmen der jeweiligen Einrichtung oder darüber hinaus unter Berücksichtigung möglicher Risikofaktoren für einen erschwerten Trauerprozess zur Verfügung. Durch ihre individuellen Angebote zum Beispiel von kleinen Abschiedsritualen oder regelmäßigen Gedenkfeiern trägt eine Einrichtung maßgeblich zu einem selbstverständlicheren Umgang mit Trauerprozessen bei – sowohl beim Hinterbliebenen selbst als auch institutionell und gesellschaftlich.
Die Bereitstellung weitergehender Angebote für Trauernde in Form von Einzelbegleitung, Trauergruppen oder Trauercafés gehört ebenfalls zum originären Aufgabenbereich der Mitarbeitenden. Nachgehende Trauerbegleitung im Rahmen eines Betreuungskonzepts setzt eine Zusatzqualifikation der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden voraus. Für die Trauerbegleitung im palliativen Auftrag gelten dabei Qualitätsstandards wie für die Sterbebegleitung. Qualifizierte Trauerbegleitung findet im Netzwerk mit anderen Anbietern von Trauerbegleitung einen Platz.
Dieses Buch will einen Beitrag leisten,
–Trauerprozesse als normal und zum menschlichen Leben gehörend zu verstehen;
–die verschiedenen Trauergesichter und -prozesse im Feld Palliative Care und Hospiz zu identifizieren;
–Trauerprozesse begrifflich zu fassen, theoretisch einzuordnen und zu kommunizieren;
–die Möglichkeiten palliativer Betreuung und hospizlicher Versorgung im Trauerprozess zu skizzieren;
–die Grenzen palliativer Betreuung und hospizlicher Versorgung im Trauerprozess zu sehen;
–Netzwerke zur weiteren Unterstützung trauernder Angehöriger zu kennen;
–die Unterschiede zwischen der eigenen Trauergeschichte und den darin entwickelten Strategien des Umgangs mit Verlust und Schmerz sowie den Trauergeschichten und Umgangsstrategien der Angehörigen und Sterbenden deutlicher zu sehen und individuell positiv zu werten;
–eine wertschätzende und unterstützende Haltung gegenüber Trauer und Trauernden (fort) zu entwickeln;
–das Bewusstsein für Trauerleiden und Trauererleben zu schärfen und palliativen Versorgungsdiensten und Einrichtungen sowie Hospiz(diensten) Handwerkszeug anzubieten, diesem Thema kompetent zu begegnen.
Tod, Sterben und Trauer sind einerseits noch Grenzbereich und Tabu; andererseits werden gerade hier wegen tiefer Betroffenheit und teilweiser Sprachunfähigkeit etliche Begriffe inflationär benutzt (zum Beispiel »Bewältigung«, »Begleitung« oder »Loslassen«), so dass wir hier versuchen, diesen Bereich sprachlich anders, manchmal fremd und ungewohnt zu fassen, um wieder Berührung, Zögern, zweifaches Lesen, Hinterfragen und damit eine neue Annäherung herzustellen. Die Fragen nach Leben und Tod sind so gewichtig und unerfasslich wie die Fragen nach Gott und dem Sinn des Lebens. Im Sinne der Nicht-Verfügbarkeit von Antworten bleiben sie ein Tabu und sind auch sprachlich der dauernden, immer wieder neuen Annäherung durch uns und die Leser überlassen.
Das Hand-Buch ist in zwei große Bereiche gegliedert: Teil I: Theoretisches Grundlagenwissen und Teil 2: Praxisrelevanz und Umsetzungsmöglichkeiten. Die dahinterstehende Überlegung ist, dass wir zwei Hände haben: Mit der einen be-greifen wir Theorien und Konzepte und mit der anderen wenden wir sie an, setzen sie konkret in die Praxis und den Alltag um. Wir handeln unter dem Einfluss des Erlernten und Verstandenen, nur im Zusammenspiel ergibt sich ein sinnvolles Ganzes. Blindes spontanes Handeln im Umgang mit trauernden Menschen ist genauso unpassend und wenig wirksam wie untätiges Verstehen irgendwelcher Trauertheorien oder Phasendarstellungen.
Zielführendes Handeln ist immer – wenn auch oft genug unbewusst – von Annahmen über Ursache und Wirkung geleitet. Wir sehen es als wichtig an, dass diese Annahmen bewusst reflektiert werden, und wollen mit beiden Teilen des Buches sowohl ein grundlegendes Verständnis für die Hintergründe als auch eine Handlungssicherheit für die Praxis bieten.
Das Handbuch will den Umgang mit Menschen in tiefem Verlustkummer handhabbar machen, indem hauptamtlich und freiwillig Tätige dem Kontakt nicht ausweichen, ihn nicht scheuen, sondern sich ihm überlegt und tätig stellen.
Mit den dargelegten Methoden, wie etwa dem Focusing oder dem Erwärmen, wollen wir konkrete Methoden an die Hand geben, sich dem Phänomen der Trauer unerschrocken anzunähern und sich in der Begegnung und Begleitung trauernder Menschen zu üben. Üben meint, in aller Vorsicht und Behutsamkeit einzelne Schritte auszuprobieren und sich zu eigen zu machen. Irgendwann werden diese Methoden dann in Fleisch und Blut der Begleitenden übergehen, in den Prozess der Begegnung und des Verständnisses integriert sein und nicht mehr als reine Anwendung durchgeführt werden. Trauerbegleitung wird dann kein unwägbares Tun mehr sein, sondern den Charakter der Handfestigkeit bekommen, wie andere palliative Maßnahmen auch. Die Begleitung sterbender Menschen, der Zugehörigen und Hinterbliebenen in ihrem Verlusterleben wird innerhalb der Palliative-Care-Behandlungen eine gleichwertige Handlungsoption werden.
Das Hand-Buch umfasst fünf Kapitel und symbolisiert die menschliche Hand mit ihren fünf Fingern, die, jeder für sich, eine eigene Aufgabe haben.
Der Daumen als der zugreifende und haltende Finger mag Begreifen und daraus resultierendes (Selbst-)Vertrauen des manchmal diffus erscheinenden Phänomens der Trauer ermöglichen.
Mit dem Zeigefinger geben wir Hinweise auf das, was besonders wichtig ist und worauf zu achten ist.
Der Mittelfinger soll symbolisieren, wer und was im Mittelpunkt unserer Handlungen steht: immer und einzig die trauernde Person. Sie allein steht im Mittelpunkt des gesamten Buches und sie allein ist Orientierungspunkt allen Handelns.
Der Ringfinger wiederum steht für die Treue, den Halt, die Verlässlichkeit und ist somit entscheidend für die Haltung des Begleiters.
Der kleine Finger der menschlichen Hand ist sozusagen der Spielfinger. Mit ihm ergeben sich die Themen Experiment und Wagnis, Intuition und Kreativität. Begleiter dürfen auch in diesem leidbesetzten Themenbereich mit Achtsamkeit probieren, versuchen, kreativ sein und Freude an ihrem Tun haben. In allem, was vorgegeben werden kann an Wissen und Hintergrund, bleibt der Mensch, der uns begegnet, doch ein Geheimnis, und so werden wir immer wieder den Weg des »kleinsten Wissens« gehen.
Alle fünf Finger sind notwendig, mit nur einem Teil der Hand oder einzelnen Fingern kommt man nicht weit. Besonders deutlich wird das beim Bild des Klavierspiels, wo sie sich virtuos im Zusammenspiel üben und ergänzen. Nicht minder virtuos will von uns die Begleitung trauernder Menschen verstanden sein.
Es war ein intensiver Prozess, sich mit den am Buch mitwirkenden, multiprofessionellen Verfassern einzelner Artikel abzustimmen. Bei gleicher Grundhaltung gab es durchaus gedankliche Abweichungen und ein Ringen um Worte und Sätze. Doch immer war das gemeinsame, kollegiale Denken und Schreiben eine große Bereicherung, für die wir von Herzen danken.
Monika Müller, Sylvia Brathuhn, Matthias Schnegg
Teil I: Theoretisches Grundlagenwissen
1Das Phänomen Trauer
1.1Ein allgemeines Verständnis von Trauer
Trauer ist im Raum
Die Familie sitzt zusammen. Eine Schwere liegt über allem. Nach einer sprachlosen Zeit der Beklemmung sagt der Ehemann: »Darauf ist man doch nicht vorbereitet, auf Krankheit und schon gar nicht auf … auf das … Er schaut zu seiner kranken Frau, die nur auf der Kante eines Sessels sitzt, die Berührung mit der Armlehne meidend, um nicht vom Schmerz in ihrem linken Arm gepeinigt zu werden. Er fährt fort: »Letztlich muss das jeder allein durchstehen. Wir werden dir zur Seite sein.« Die Frau schaut aus einem Augenwinkel auf ihn, bewegt ihren Körper mit kleinen, ihrem mageren Körper Entlastung bieten wollenden Bewegungen und entgegnet leise: »Ja, das muss ich.« Dann kehrt für eine Zeit wieder Stille ein. Es fehlt an Worten, mit denen zu beschreiben wäre, was die im Raum Anwesenden bewegt. Es ist die Trauer, die sprachhindernd wirkt. Stille und Stummheit kehren in irgendeiner Form immer ein, das ist eine unausweichliche Wirklichkeit, denn Trauer ist manchmal so überwältigend, dass die Sprache sich hilflos verschreckt zurücknimmt und nichts anderes als Schweigen möglich ist.
Oft machen erst Szenen grundlegender Lebensbedrohung bewusst, dass uns Menschen Trauern kein unbekanntes Phänomen ist, dass wir oft in Trauer sind und darin leben. Meist billigen wir in noch nicht so existenziell bedrohlichen Situationen den damit verbundenen Gefühlen nicht den großen Namen Trauer zu, in dem oben beschriebenen Beispiel dagegen schon. Trauer scheint da angemessen, wo der Tod das letzte Wort nehmen wird oder es bereits genommen hat. Trauer empfinden viele im globalen Erschrecken bei Katastrophen; ehe das Wort Trauer berechtigt scheint, muss einiges Erschütterndes geschehen sein. Dabei ist Trauern ein zutiefst menschlicher innerer und oft auch äußerer Vorgang.
Jeder Mensch kennt Trauer
Trauern ist etwas, was jeder Mensch kennt. Trauern kommt in jedem Leben vor. Es ist nicht erst da, wenn ein uns naher Mensch gestorben ist. Es ist immer dann in uns, wenn wir Verluste schmerzhaft erfahren: Kinder, die nicht genügend Antwort auf ihre Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit finden, trauern; Jugendliche, die bestimmten Maßstäben der Erwachsenen nicht genügen oder im Trend ihrer Generation nicht mitkommen, trauern; Menschen, die ihre Arbeit verlieren, Menschen, die sich durch Erreichen der Altersgrenze gezwungen erleben, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, trauern; Kranke, die durch ihre Krankheit bleibend gezeichnet sein werden, die ein Organ verloren haben, die auf Medikamente oder Maschinen dauerhaft angewiesen sind, die auf keine heilende Befreiung aus der Krankheit mehr hoffen dürfen, trauern; Alte, deren Körperschönheit erschlafft, deren Gedächtnis sie im Stich lässt, trauern; Menschen, die plötzlich mit körperlichen oder seelischen Behinderungen leben müssen, trauern; Frauen und Männer, deren Liebe keine Kraft mehr hat, die über Missachtungen, Verletzungen, Demütigungen und Selbstverleugnung sich zum gegenseitigen Verlassen entschieden haben, trauern; Leute, deren Lebenswerk und Zukunftspläne, deren Heimat, Ansehen, Hoffnungen – durch welche Gründe auch immer – aufzugeben sind, trauern; Sterbende und ihre Angehörigen trauern längst vor dem Tod, denn der absehbare Abschied, die Ahnung des Verlustes bekommt die Trauer als Patin zugestellt.
Trauer als Verlustreaktion
Trauer ist die Rückwirkung eines eingetretenen oder drohenden Verlustes auf den betreffenden Menschen und die schrittweise Anpassung an ein Leben mit dem bevorstehenden oder erlittenen Verlust. Der Umgang mit einem Verlust ist davon abhängig, wie tiefgreifend und lebensverändernd dieser Verlust erlebt wird. Zu den Faktoren, die auf dieses vielfältige Erleben einwirken und es prägen, gehören auch der erlernte Umgang mit Krisen und die Persönlichkeitsstruktur des betreffenden Menschen. Menschen sind grundsätzlich in der Lage, ihre Trauer zu leben und auszudrücken – wenn ihnen der Anlass nicht aberkannt wird oder sie an ihren Gefühlen gehindert werden. Der Verlust kann mehr oder weniger einschneidend für den Lebensweg eines Menschen sein. Immer geht mit der Widerfahrnis eines Verlustes der Wunsch einher, mit diesem Verlust irgendwie zurechtzukommen, ihn zu integrieren, um weiterleben zu können. Der Urimpuls Leben scheint so kraftvoll, dass Menschen den Verlust in der Regel meistern möchten, um – wenn auch als Verwandelte – im veränderten Leben bleiben zu können.
Verlust und Trauer – Existenzielle Erfahrungen des Lebens
Die Menschen in historischen und mythologischen Überlieferungen haben sich Geschichten von Verlust, von Trauer, von Neubeginn erzählt: Geschichten vom Verlust des glückseligen Lebens, vom Einklang mit dem Leben an sich, mit den Göttern oder mit dem einen Gott. Sie haben Geschichten von der Vertreibung aus dem Paradies erzählt, haben von der ungeheuren Kraft mitgeteilt, dass die Menschen »trotz allem« neues Leben gebären, wenn auch unter Schmerzen, und »trotz allem« ihren Lebensunterhalt schaffen, wenn auch im Schweiße ihres Angesichts. Wieder und wieder werden solche Geschichten mit ähnlichem Tenor aufgegriffen – Geschichten von heilvollem Erwarten, Geschichten vom schmerzlichen Verlieren, Geschichten von der Mühsal, sich unter den neuen Lebensbedingungen zurechtzufinden. Das Gemeinsame ist der Verlust von etwas, das das Leben getragen hat. Das Gemeinsame ist auch oft das Verharren im Schmerz des Verlustes und später die neue Kraft, die zuwächst oder bewusst ergriffen wird, um hinter dem Verlust ein Neues Gestalt werden zu lassen.
Das Bedrückende und oftmals Empörende an der Trauer kann eine Ent-Täuschung sein, nämlich die Enttarnung der Vorstellung, dass es ein verlustloses Leben geben könne, einen Anspruch auf Schmerzfreiheit und Glück; das Beruhigende an der Trauer ist das Wissen um die Kraft, die durch die Trauer hindurch neuen Lebensraum möglich machen und das Leben selbst vertiefen kann. Ehe eine solche Perspektive des Neuen sich öffnen mag, sind viele Abgründe und Zweifel hinzunehmen. Nicht selten halten Trauernde ein Neues nicht nur für undenkbar, sondern auch für bedrohlich. Es klingt ihnen dann so, als sei allein mit der Hoffnung schon der Verlust bejaht. Oft ist mit der Hoffnung auf ein gutes Leben oder gar mit dem Erreichen die Selbstzuschreibung einer Schuld verbunden, das Verlorene oder den Verstorbenen schon vergessen und nicht wirklich oder genug geliebt zu haben.
Trauer als Abgleich mit den Erfordernissen des Lebens
Trauer kommt in jedes Leben. Trauer geht bereits im Verlassen des Mutterschoßes mit. Trauer zeigt sich in unzähligen Abgleichungen mit der Wirklichkeit. Das Maß der Trauer ist der Verlust, der erlitten wird, bzw. die subjektive Einschätzung dieses Verlustes. Dieses Maß ist eben kein objektiv für alle Trauernden ablesbares. Es ist geprägt von vielen Faktoren, die das Menschenleben einzig und unverwechselbar machen. Daher sind auch die Ausdrucksformen der Reaktion auf Verlust, also die Ausdrucksformen der Trauer, individuell und einzigartig. Es ließe sich in jedem Leben eine nicht endende Kette an Verlusterfahrungen aufzählen: der Verlust des Spielzeuges, das aus dem Bettchen fällt und durch den Wut- oder Angstschrei des Säuglings wieder zurück ins Bettchen findet, der erste Kindergartentag, an dem das vielleicht erschrockene Kind der Mutter oder dem Vater lange nachschaut, weil das Neuland es so verlassen zurücklässt, die verlorene Puppe, dramatisch beendete erste Liebebeziehungen, die Ohnmacht des Kindes, das die Trennung der Eltern hinnehmen muss, Wohnort- und Schulwechsel, der unerfüllte Berufswunsch und unzählige andere Verlusterfahrungen.
Der »Trauerfall«
In der eingangs beschriebenen Situation sitzt die Familie zusammen. Die Diagnose der metastasierten Brustkrebserkrankung lässt keine Heilung mehr erwarten. Da sitzt die sprachentleerte Familie beisammen und denkt, jetzt beginne der »Trauerfall« einzusetzen. Dieser »Fall« hat unterschiedliche Gesichter: Für die dem eigenen Sterben nahe Frau sieht das Antlitz der Trauer anders aus als für ihren Mann oder ihre Kinder. Die Verluste sind je eigene, daher sind auch die Gestalten und Erlebens- und Ausdrucksformen der Trauer je eigene. In jenem beschriebenen Wohnzimmer, in dem die Familie zusammensitzt und das kommende Sterben der Mutter begreifen lernen muss, sitzen verschiedene, verborgene und offensichtliche, Verlusterfahrungen zusammen. Verluste, die sich über jede Lebensgeschichte hin angesammelt haben. Verluste, die leicht zu verkraften waren. Verluste, die existenziell bedrohliche Beängstigungen ausgelöst und hinterlassen haben. Verluste, die panische Reaktionen entbinden, wenn ein weiterer Verlust zugemutet wird.
Noch ist es nicht soweit
»Noch ist es ja nicht soweit«, sagt der Ehemann der vom Tod gezeichneten Ehefrau. Sie sitzen im Wohnzimmer und warten auf den Palliativpflegedienst. Sie wissen nicht genau, was da auf sie zukommt. Aus Erzählungen anderer haben sie Vertrauen gewonnen, dass dieser Dienst hilfreich ist. Die Frauen und Männer dort verstehen etwas von schwerer Krankheit, auch vom Sterben. Das gibt Sicherheit. Sie wissen auch, was zu tun ist – wie das mit der Pflege geht, wie Schmerzen beherrscht werden können. Sie haben keine Scham vor dem, was an Pflegehandreichungen vermutet wird. Darüber ist man sich in der Familie selbst nicht so sicher. Alle ahnen etwas von peinlich empfundenen Irregularitäten wie: nicht mehr ohne Hilfe aufstehen zu können, nicht mehr zur Toilette gehen zu können, der Brecheimer neben dem Bett, die Pampers, der Geruch … Die meisten haben so etwas noch nicht erlebt, sie haben nur davon gehört, und das reicht schon, um Angst zu haben. Der Vater aber steht auf, holt eine Flasche Wein und ermuntert: »Noch ist es ja nicht soweit!«
Normalität ist vorbei
Aber die unschuldige, lebensfrohe Normalität ist längst vorbei. Schon mit der Diagnose des Brustkrebses ist sie vorbei gewesen. Viel Energie und Aufmunterung waren nötig, um so gut wie möglich die als Stütze und Halt empfundene Normalität beizubehalten. Die Familienangehörigen haben alles dafür getan, dem Leben und dem Weitergehen mehr zu trauen als der Bedrohung durch den Verlust. Mit dem Verlust der Normalität setzt der »Trauerfall« ein. Das Herausfallen aus der Normalität, aus dem, was einst sicher und Sinn gebend war, kann Menschen neugierig machen, kann spannender Aufbruch sein, kann aber – wie es in diesem Fall sichtbar wird – ebenso Trauer auslösenden Verlust darstellen, der als Bruch von allem, was selbstverständlich und sinnhaft schien, erfahren wird.
Unterschiedliches Trauern
Menschen scheint innezuwohnen, dass sie mit diesen vielen alltäglich zugemuteten Verlusten fast wie im Vorübergehen umgehen können. Die erwähnten Beispiele vom aus dem Kinderbett gefallenen Spielzeug bis zur Gewissheit des eigenen Todes oder dem Verlust eines geliebten Menschen lassen vermuten, dass das Maß der Trauer sich an der individuell gewerteten Dichte der Verlusterfahrung misst. Das muss unvermeidlich sehr subjektiv bleiben. Was den einen überhaupt nicht nachhaltig bewegt, wird für den anderen zum Tropfen, der das Fass der hinzunehmenden Verluste überquellen lässt. Es geschieht sogar, dass der Anlass zum Einbruch in eine verzweifelte Trauer von außen betrachtet ziemlich nichtig ist. In der Summe der vielen Verlusterfahrungen dieses konkreten Menschen kann aber dieser vermeintlich nichtige Anlass die ganze Flutwelle bisher zurückgehaltener Lebenstrauer heranbranden lassen. Oft stehen die Betroffenen selbst fassungslos davor, wie ein so minderer Anlass eine solche Verzweiflung und Trauer auslösen kann. Wir wissen, dass es Trauer auch als Ausdruck einer tiefen Lebenserschütterung gibt – Trauer, die anscheinend ohne Grund einen Menschen am weiteren Leben hindert. Da wirken Verlusterfahrungen mit, die wir oft nur erahnen können, auch dem Trauernden selbst sind sie mitunter gar nicht zugänglich. Manchmal kommt Trauer auch als konturloses Etwas daher – bis hin zur Angst, in diesem Leben gänzlich und auf Dauer verlassen zu sein.
1.2Unser Verständnis von Trauer
Es ist nicht ungewöhnlich, dass vielen Menschen in der Unaushaltbarkeit des schmerzlichen Trauererlebens und Trauerweges nur der eine Wunsch aufkommt: der Trauer auszuweichen, sie aufzulösen, sie »wegzumachen« (wegmachen zu lassen). Dieses das Leben erschwerende und beschwerende Trauern, das Trauernden oft wie ein »Nicht-Leben« vorkommt, glaubt kein Mensch aushalten zu können. Es scheint Leib und Seele zu zerstören. Manchen ist die Öffnung zum Schmerz der Trauer so unerträglich, dass sie sich mit den Fragen nach dem Sinn der Trauer nicht abgeben möchten. Sie äußern vielmehr den Wunsch, möglichst bald befreit zu sein, indem die Trauer aufgelöst, aus dem Weg geräumt, nicht mehr spürbar wird.
Es gibt viele Angebote, die dieses Verdrängen begünstigen. Die Flucht in eine baldmöglichste neue Partnerschaft oder in einen Ersatz ist nur einer der rein menschlich verständlichen Wünsche, dem Abgrund des Verlustdurchlebens zu entgehen. Andere fordern medikamentöse Hilfe, um aus dem Kreislauf des Schmerzes und der Trostlosigkeit herauszukommen. Es ist anzuerkennen, dass es zweifellos Menschen gibt, die auf diesem Weg des Wegschauens und Wegdrängens ihre Art zum Weiterleben finden. Die meisten Menschen allerdings täuschen sich, wenn sie die Trauer auflösen wollen, um darin den Verlust und seine Wirkung auf das eigene Lebensgefüge zu übersehen, um nicht zu sagen: auf Dauer zu verleugnen.
Trauer ist nicht »wegzumachen«; sie folgt nicht eindeutig bestimmten Regeln, denen man mit geschickt ausgeklügelten Rezepten, Trostworten, Sinnsprüchen und Medikamenten zu Leibe rücken könnte. Viele Trauernde haben schmerzlich erlernen müssen, dass es weder ein anzuwendendes, sicher wirkendes Rezept aus Büchern noch aus Vorträgen oder den Lebensschicksalen anderer gibt. Auch Ratschläge und Tipps von Begleitern oder anderen Betroffenen sind letztlich keine Hilfe. Die Trauer ist bei aller Vergleichbarkeit im Prozess der Auseinandersetzung doch ein sehr eigenes, für den Einzelnen einmaliges Ereignis. Ein zurück ins Leben führender Trauerweg ist in der Regel nicht das Vernichten oder Außer-Acht-Lassen eines unangenehmen Gefühls, um dann möglichst schnell wieder einen geregelten Alltag weiterführen zu können und so zu tun, als sei durch den Verlust letztlich nichts Einschneidendes passiert. Es gibt kein Vorbeikommen an der Trauer, sondern nur ein Hindurchkommen.
Es ist nachvollziehbar, dass, wenn der Trauer nicht ausgewichen werden kann, Menschen nach einem Verlust möglichst einen verlässlichen Verlaufsweg lernen und begehen wollen. Aber die so eigenwillige Trauer lässt sich nicht einer scheinbar im Griff zu haltenden Phasenordnung oder Aufgabenlehre unterordnen. Sie ist eine individuelle und gemeinschaftliche, eine körperliche, geistliche, soziale, vor allem eine dynamische, prozesshafte Aufgabe, die den ganzen Menschen durchtönt und durchprägt.
Das Märchen von der Trauerverarbeitung2
An eine endgültige Verarbeitung von Trauer im Sinne einer Erledigung eines schweren Geschäftes glauben wir nicht, wohl aber an die Möglichkeit und Fähigkeit von trauernden Menschen, einen Umgang mit ihr zu finden, der seelisches Gleichgewicht, Lebensqualität und -perspektive, vertieftes Verständnis für sich und andere und Sinnfindung zeitigt. Wenn wir trotzdem beispielhaft von Hilfestellungen in der Begegnung, Beratung und Begleitung trauernder Menschen sprechen, so, um darzulegen, dass diese Menschen Möglichkeiten im Umgang mit ihrer Trauer zur Verfügung haben und dass es Wege gibt, die sie aus der alles besetzenden akuten Trauer im Verlauf ihrer Zeit finden können. Wir vertrauen aus Erfahrung darauf, dass eine durchlebte Trauer, ein durchlittener Prozess zu einem vertieften Lebensgefühl, zu Reife, zu Sinn – zur Selbstwerdung führen kann.
Weil Trauer in jedem Menschenleben vorkommt, ist sie zunächst etwas ganz Normales, auch wenn ihr Erscheinen mit einem Herausfallen aus der Normalität verbunden ist. Sie ist nicht der Ausnahmefall von Leben, sie ist nicht die Katastrophe, die grundsätzlich mit einem bösartigen Schicksal verbunden ist, sie ist kein Abweichen von Gesundheit, also keine Krankheit. Die Trauer ist normal, ein Bestandteil und eine Aufgabe des Lebens. Sie ist Leiden im Gesunden. Trauer ist in ihrer Macht und Gewalt nicht zu unterschätzen, aber die meisten Menschen lernen mit dieser ganz normalen Trauer irgendwann umzugehen, durchleben sie – nicht selten über mehrere Jahre – und üben sich darin ein, mit ihr neu und oftmals auch wieder lustvoll zu leben. Meist genügt ein geringes Maß an Stütze und Begleitung, um diese Herausforderung sinnerneuernd zu meistern.
Trauer arbeitet mit und am Verlust, arbeitet am Abschied, und ist darin im Grunde ein überaus lebendiges Geschehen. Trauer lässt sich nicht in einem vorher auslegbaren Plan festmachen. Sie folgt zwar bestimmten Gesetzmäßigkeiten des Prozesses, in aller Individualität finden sich grundlegende Gemeinsamkeiten, die den Trauerweg kennzeichnen, und doch wird sie von jedem/jeder aus der Wurzel der eigenen Geschichte, der eigenen Entwicklung, der ganz konkreten Lebensumstände jeweils anders gestaltet. Trauer verläuft daher auch nicht gradlinig in einer vorbestimmten Entwicklung zu einem Ziel hin. Viele Trauernde leiden unter dem Erleben, immer wieder zurückzufallen: Es gab Zeiten, da glaubte der Trauernde, endlich wieder etwas mehr Halt im Leben gefunden zu haben – und fällt gerade nach dieser so sehnsüchtig erwarteten Erleichterung und Rückkehr ins Leben in ein – möglicherweise noch tiefer empfundenes – Loch zurück. Und er äußert seine Sorge, wieder ganz neu mit dem Trauerweg beginnen zu müssen und keinen Zentimeter vorangekommen zu sein. Da haben sich Trauernde mühevoll eingerichtet, sich mit bestimmten Haltungen gegen unsensible Äußerungen der Umwelt weniger verletzbar zu machen – und plötzlich reicht eine kleine Andeutung, um die anfänglich geschlossene Wunde wieder aufzureißen. Und dann geht das herzzerreißende Herumirren auf dem Trauerweg vermeintlich gänzlich unverändert von neuem los. Und doch geht der Prozess nicht von neuem los, sondern er geht weiter. Das bereits Erlebte und in der Trauer mühsam Erarbeitete geht mit, zeigt sich jedoch in diesem Moment nicht, hat sich zurückgezogen und hält sich verborgen. Und dennoch hat es dem trauernden Menschen wieder etwas Kontur zurückgegeben, ihm wieder etwas Eigen-Sinn verliehen.
Diese Gedanken- und Gefühlseinbrüche werden von Mal zu Mal seltener und von Mal zu Mal weniger heftig. Dem immer wieder neuen Eintauchen in die Niederung der Trauer mit ihrer Gewalt auf diese Weise ausgesetzt zu sein, ist ein Prozess der Seele, die vom ersten Moment der Trauer an auf schöpferischen Neubeginn setzt. Jedoch erst im Nachhinein, oft nach Jahren durchlittener sowie durch- und überlebter Trauer, können Menschen ihr Trauererleben als einen schöpferischen Prozess des Neubeginns und der Selbstwerdung erkennen. So betrachtet wird das Trauern im Durchleiden und Durchleben wie eine Art lange Geburt. Die Phantasie ist schnell beflügelt, Vergleiche zwischen Trauer- und Geburtsvorgang zu ziehen im Erleben der Anstrengung »auf Leben und Tod« bis hin zu neuem, eigenständigem Atmen, Bewegen, Leben.
Dass sich der Mensch am liebsten diesen Werde-Gang mit seinem unausweichlichen Schmerz, der zuweilen auch den Tod herbeisehnt, ersparen möchte, ist mehr als verständlich. Daher gibt es keinen Grund, sich Trauerprozesse verherrlichend zu ersehnen, um neue Lebenseinsichten gewinnen zu dürfen. Das Trauern ist ein Teil unserer Natur, wie der Verlust auch. Wir scheinen dem aber nicht nur ausgeliefert und passiv überlassen zu bleiben. Es geschieht Schöpfung – mehr als »nur« am Anfang des Lebens und in kreativen Phasen aufbauenden Lebens.
Eines kann der Prozess eines Trauerweges, der nicht im Tod endet, mit ziemlicher Sicherheit verheißen: Das Leben geht weiter; es geht anders weiter, nicht nur schlechter, nicht nur schwerer, aber deutlich anders und wird manchmal auch als eröffnend neu erlebt.
Trauer als Entdeckung anderer Lebenswirklichkeiten
Wer am Anfang der Trauer steht, hat kaum einen Blick auf das Gute, das Neue, das sich aus der Trauer ergeben kann. Viel zu sehr stehen Abbruch, Abschied, Verlust, Verlassenheit und Angst im Vordergrund. Es ist gut und wichtig, der Trauer viel Zeit zu geben, auch Zeiten des Untergehens im Verlust, auch Zeiten, in denen jedes Wort schmerzt und provoziert, das von neuen Möglichkeiten sprechen möchte, die durch die Trauer hindurch sich öffnen. Es ist eine Frage des achtsamen Ernstnehmens, wenn der Trauer nicht gleich zu Beginn das Ziel der »Neu-Werdung« aufgezwungen wird. Es ist auch angezeigt, den mit dem Verstand schnell zur Hilfe geholten »Wert der Trauer« nicht zu früh zu preisen, weil dies dann leicht zur Fluchtbrücke wird für jene, die so vieles mit dem Kopf im Griff halten – und auch die Trauer mit dem Verstand im Griff halten zu können glauben. Dies ist gesagt in aller Wertschätzung, wissend, dass auch die abstrahierende Leistung des Verstandes hilfreich ist, um den Mächten des Zerstörerischen in der Trauer Einhalt zu gebieten.
Wenn die Trauer fließen darf, in Bewegung verläuft, dann öffnet sich irgendwann von selbst der Horizont, melden sich neue Lebensgeister. Die können umso klarer werden, je mehr der Trauernde den Weg davor bewusst beschritten hat. Es stimmt tatsächlich, dass die Trauer nicht nur abbaut, nicht nur Verlusteingeständnisse abfordert. Trauer kann irgendwann auch neue Perspektiven auf das Leben eröffnen, neue Erfahrungen mit dem Leben erschließen. Viele Beispiele bezeugen, wie Menschen durch die Trauer ihre eigene Persönlichkeit wieder oder neu entdeckten, wie sie einen feinfühligeren Umgang mit anderen Menschen, vor allem mit Verlusterleben, neuen Zugang zur Natur, zur Kultur, zur eigenen Kreativität fanden. Nicht selten sind Trauermenschen stiller geworden, aber oft auch lebensvoller.
Ein Trauerprozess kann alte Lebensfragen in besonderer Weise aufrufen. Ein Mittfünfziger, der durch körperliche Erkrankung seinen sicheren Arbeitsplatz verliert, glaubt sich am Ende seines Lebens – und gewinnt durch die Trauererfahrung viel an Wärme, an Freude an Musik und Kultur dazu. Seine Arbeitsstelle gab diesem »Luxus« keine Lebenschance. Eine junge Frau entdeckt nach der langen, zwischen Leben und Nicht-mehr-leben-Wollen stehenden Trauer um den qualvoll gestorbenen Mann ihre besondere Fähigkeit, Menschen zuzuhören, ihnen Beistand sein zu können. Eine 60-Jährige, die ihren Mann durch plötzlichen Herztod verlor und kurz danach mit dem Ausbruch der eigenen Krebserkrankung in Trauer um ihr Leben stand, spürte die kostbare Nähe ihrer echten Freunde und Bekannten. Eine über 70 Jahre alte Frau nutzte die Chance, ihre verdrängte, unter Schweigegebot stehende eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten und danach zufriedener und sozial lebendiger leben zu können. Wie viele Künstler haben ihren Auslöser in einer Trauer gefunden. Manchmal ist es eine Trauer, die in Kindertagen quälte und erst im Erwachsenen ihren Ausbruch, Ausdruck und Umbruch fand (Ortheil, 2009).
Im gelingenden Trauerprozess lernen Menschen die Kostbarkeit des Lebens trotz oder in aller klaren Begrenzung zu lieben. Neben allen greifbaren Wandlungen in oder nach einem Trauerweg gibt es oft kostbare Wandlungen der inneren Einstellung zum Leben. Die Langsamkeit, die während der Trauer oft als so bremsend, hindernd, den Unterschied zum früher so lebendigen Leben deutlich und quälend zu erfahren gab, wird als lebensrettende Hilfe erkannt. Der Trauernde hat gelernt, dass die Seele Zeit braucht und sich diese Zeit durch das Angebot der Verlangsamung des Lebensrhythmus auch nimmt. War früher das Leben geprägt von dem Empfinden, dass es eigentlich kaum eine Grenze, nichts letztlich Unkontrollierbares gibt, so lehrt die Trauer niederdrückend die Demut vor dem Leben, die Entmachtung des Machbaren aus eigener Kraft. Es bietet sich ein neues Gespür für den Genuss am Leben in seiner Vielfältigkeit und Begrenztheit zugleich. Die Grenzerfahrung ist dann nicht mehr wie die Mauer, an der sich die Seele und der Leib wund wetzen, sondern die Mauer, an der ranken und sich entfalten kann, was gerade Lebenswille hat.
Am Ende eines auch bewusst mit viel Einsamkeit gesuchten Trauerweges steht nicht selten ein freies, in seinen Grenzen klar gesetztes Engagement im sozialen Umfeld. Palliativmedizin und Hospizbewegung verdanken dieser Erfahrung viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, doch muss gerade hier der Motivation ein genaues Augenmerk geschenkt werden. Wenn ein soziales Engagement nur gesucht würde, um der Wucht der eigenen Trauer auszuweichen oder sie an einem Gegenüber stellvertretend abzuarbeiten, wird es leicht schädlich für alle Beteiligten. Da werden die Helfer schnell ausgebrannte hilflose Helfer. Sozialengagement ist kein Trauerauflöser! Soziale Verantwortung nach Auslösung der Trauer und durchschrittenem Trauerweg hingegen kann eine Bereicherung für die Einrichtungen und Dienste sowie eine große Quelle der eigenen Energie sein.
Das Beziehungsumfeld
Durch das Wissen, dass Trauer ein Bestandteil jeden Lebens ist, wird sie nicht weniger gewichtig. Der Schmerz des Verlustes wird nicht entwertet, indem gesagt wird, dass Verlusterfahrungen – und damit Trauer – ein Lebenselement sind, dem niemand entgehen kann. Das eher grundsätzliche, »nüchterne« Wissen um die Gegenwärtigkeit der Trauer macht den jeweils aktuell sich meldenden Schmerz der Trauer weder unangemessen noch schmälert es ihn.
Dennoch kann die Kenntnis von Trauer als grundsätzlicher Lebenserfahrung für die Umwelt und die Begleitenden sehr hilfreich sein: Sie verstehen, dass sie vor der Trauer an sich keine Angst haben müssen – als sei sie ein widernatürliches Gespenst, das man möglichst schnell verschwinden lassen sollte, oder eine Krankheit, die therapiert werden müsste. Manches Drängen, Trauer bald hinter sich zu bringen, hat vielleicht hier seine Wurzeln. Die Einsicht, dass Trauer eine natürliche Sinn- und Wertantwort auf die Erfahrung von Verlust ist, mag eine gewisse Unerschrockenheit, ja sogar Gelassenheit in der Begegnung mit Trauernden vermitteln. Diese grundsätzliche Bejahung, dass Trauer im Leben ist und dort sein darf, schafft einen weiten Raum möglicher Einfühlung in die Trauer, wie sie ganz individuell im gerade zu begleitenden Menschen hilfreich ist.
Trauer hat ein je eigenes Gesicht – dem gilt es, nach Möglichkeit ungeteiltes An-Sehen zu geben. Manche Trauerwege gestalten sich jedoch so dornig und verworren und Atem raubend, dass Zugehörige, Freunde, Nachbarn und Kollegen sich aus dem Mitleiden befreien wollen und oft schnell, zu schnell auf dieses zu erwartende Neue verweisen. Wenn das zu früh geschieht, verklumpt es die mögliche Bewegung der Trauer, entsteht Skepsis gegenüber der Umwelt.
»Wird meine Trauer überhaupt ernst genommen? Darf ich meinen eigenen Weg wirklich gehen? Hält die Umwelt mich aus, hält sie die Trostlosigkeit in mir aus? Oder muss ich das Neue sehen wollen, damit sie mit ihrer Begleitaufgabe und Trösterrolle zufrieden ist?« Solche möglichen Gedankensplitter in der Verwirrung eines trauernden Lebens sind denkbar und müssen bedacht werden. Dass hinter dem Weg der Trauer ein Neues, ein Anderes stehen kann, ist vorerst nur Hoffnung der Begleitenden. Diese Hoffnung kann den Begleitenden helfen, in schweren Trauerwegen dennoch Halt und Stütze sein zu wollen. Gewiss ist aber auch, dass das Neue und Andere nicht zwangsläufig am Ende des Trauerns stehen. Die Begleitenden sind immer wieder aufs Neue aufgerufen, diese Spannung in sich auszuhalten.
1.3Werdeschritte – Trauerarbeit und Traueraufgaben
Trauer ist kein statischer, unveränderbarer durch das Leid festgeschriebener Zustand, der mit den Flügeln der Zeit davonfliegt, wie der Dichter Theodor Fontane sein eigenes Trauererleben beschreibt. Trauer ist ein individuelles Geschehen, ein dynamischer Prozess, der sowohl lähmende als auch kraftvolle Dimensionen aufweist, der viele Gesichter hat und für den Trauernden harte innere Arbeit bedeutet, die ihn nicht selten bis an den Rand physischer und geistiger Erschöpfung führt: »Manchmal sitze ich abends im Wohnzimmer, ich weiß, dass ich mir was zu essen machen sollte, doch ich kann nicht. Ich bin so erschöpft, so fertig, so erledigt. Dabei habe ich kaum was getan heute. Die Zeit hat sich einfach nur still fortbewegt und ich habe versucht nicht aus ihr herauszufallen. Es ist mir offensichtlich gelungen. Ich sitze hier. Ja, erschöpft und erledigt und weiß gar nicht, wovon« (Susanne F., 16 Monate nach dem Tod ihres 22-jährigen Sohnes).
Einen nahestehenden Menschen durch den Tod zu verlieren, bedeutet für den Hinterbliebenen einerseits das passive Erdulden eines unabänderlichen Schicksals und andererseits verlangt ihm der Trauerprozess ein hohes Maß an Entscheidungen und aktivem Handeln ab. Das heißt, der Trauernde ist dem Geschehen selbst passiv ausgesetzt und muss gleichzeitig aktiv darauf reagieren: »Am liebsten wäre ich einfach nur im Bett liegen geblieben. Was sollte ich auch da draußen. Da ging das Leben weiter, während meins mit ihm untergegangen war. Und doch spürte ich, dass ich leben musste. Ob ich es wollte oder nicht. Etwas in mir entschied sich dafür. Was das genau war, konnte ich nicht benennen« (Susanne F.). Begleiter müssen verstehen, dass sich Realität und Selbstverständnis des Hinterbliebenen grundlegend verändern und neu definiert werden müssen. Das bisherige Dasein gerät aus den Fugen, der Lebensweg scheint ziellos und die Ablösung vom Verstorbenen wird als eine Verflüchtigung der eigenen Identität ins Nichts empfunden. Die Aussagen vieler Trauernder – »Wer bin ich eigentlich? Ich kenne mich selbst nicht mehr« – oder der Verzicht auf das Wörtchen »ich« und anstelle davon der häufige Gebrauch des Pronomens »man« sind Ausdruck dieser Verflüchtigung.
Die mit dem Verlust einhergehende seelische Erschütterung zwingt den Hinterbliebenen über kurz oder lang zu einer unabweisbaren Auseinandersetzung mit seiner Trauer. Sie zwingt ihn zur Trauerarbeit3. Dabei begegnen dem Trauernden immer wieder Aufgaben, die ihm oft im Gewand einer Prüfung erscheinen und denen er sich stellen muss. Diese Aufgaben werden nicht etwa als Anforderungen anderer von außen an den Trauernden herangetragen, sind also nicht zu verwechseln mit den unzähligen »du musst« und »du solltest«, die ein Zurückgebliebener tagtäglich zu hören bekommt. Diese Aufgaben entsprechen in der Regel dem verzweifelten Wunsch, einen eigenen Umgang mit dem erlittenen Verlust zu finden, um in dieser fremden Welt mit dem Verlust und ohne den anderen überhaupt verweilen und auch wieder Fuß fassen zu können:»Eine Woche, ein Monat, ein Jahr nach dem Tod von Sven, stand ich wieder und wieder in seinem Zimmer. Ich sollte seine Sachen wegräumen? Ich? Das war nicht vorstellbar. Ich kam mir vor wie eine Frevlerin. Wir hatten doch ein Abkommen getroffen. Ich durfte sein Zimmer nur auf seine Einladung hin betreten. Sollte ich diese Abmachung jetzt brechen? Dann die Uni. Ich musste ihn dort exmatrikulieren. Doch wie sollte ich das tun? Sven hatte sich so gefreut über den Studienplatz und sich nichts sehnlicher gewünscht, als dort wieder hingehen zu können. Sechs Tage nach seinem Tod bekam Sven eine Einladung zum Klassentreffen. Wie sollte ich die absagen? ›Sven kann nicht. Er ist tot.‹ Jeder Tag brachte neue, für mich fast unlösbare Aufgaben. Es war, als ob mich Gott in einer ungeheuren Grausamkeit immer wieder prüfen wollte« (Susanne F.).
Sich immer wieder aufs Neue den unzähligen, kräftezehrenden Aufgaben zu stellen, bedeutet, Schritt für Schritt einen neuen (Lebens-)Weg entstehen zu lassen. Dieser Weg ist nicht vorgezeichnet und soll nur aufgefunden werden, sondern der Trauernde selbst ist Autor und Gestalter seines eigenen Trauerweges. Einem solchen Wegbild liegt zwangsläufig das Verständnis zugrunde, dass der Trauernde die Neuschaffung von Struktur, Ordnung und Sinn, die aufgrund dieses Verlustes notwendig geworden ist, niemals auf einen Schlag, sondern immer nur schrittweise leisten kann. Dies besagt keinesfalls, dass der Weg, den der Trauernde beschreitet, linear ist bzw. im einmaligen Durchlaufen von Stufen abgearbeitet werden kann. Der Trauerprozess ist ein dynamisches, vielgesichtiges und wiederkehrendes Geschehen in der Zeit, der spezifische, ineinander verzahnte Aufgaben enthält, im großen Sinnzusammenhang der Selbstwerdung steht und es dem Trauernden ermöglicht, sich und sein Lebensgefüge neu zu gestalten.
Während der ganzen Auseinandersetzung dürfen Begleitende nicht davon ausgehen, dass Trauer entweder anwesend oder abwesend ist. Trauer ist mal mehr da und Trauer ist mal weniger da. Trauer ist mal sicht- und fühlbar und mal unsichtbar und stumm. Und in dieser ganzen Unbeständigkeit ist sie auch noch völlig unberechenbar: »Es gab Tage, da dachte ich: ›Heute geht es.‹ Ich fühlte mich irgendwie dem Leben etwas mehr gewachsen. Dann – meist völlig unvorhergesehen – schreit meine Sehnsucht auf und will zu Sven, will ihn wiederhaben, kann sich ein Leben ohne ihn nicht mal andenken. Dann stürze ich wieder in diese Bodenlosigkeit aus Schmerz, Finsternis und Nichtverstehen. Das ist auch heute noch so. Und vielleicht bleibt das auch. Vielleicht muss es auch bleiben, damit ich ihn nicht vergesse« (Susanne F.).
Trauerarbeit zu leisten heißt auch, dass sich der Zurückbleibende oft vor eine unlösbare Aufgabe gestellt sehen: Das, was war, will er (be)halten, er will es wiederhaben, das, was noch nicht ist, kann er sich kaum vorstellen. Er ist ein Zwischenwesen in einem unbekannten Land. In diesem Zwischenland findet eine sogenannte innere Zerrüttung statt: »Vielleicht werden Sie dies als merkwürdig empfinden. Als ich jedoch von dem Erdbeben in Haiti erfuhr, die Darstellungen der Zerrüttung betrachtete, hatte ich plötzlich ein Bild. Ich wusste, dass es in meinem Inneren genauso aussieht. Der Tod meines Sohnes hat in mir ein Seelenbeben ausgelöst, das keinen Stein meiner Identität auf dem anderen gelassen hat. Ich werde Aufbauarbeit leisten müssen. Doch die dauert und was schließlich dabei herauskommt, weiß ich noch immer nicht« (Susanne F.).
Die Werdeschritte des trauernden Menschen
Für Begleitende ist es wichtig zu wissen, dass Trauerarbeit letztlich bedeutet, dass der Trauernde im Angesicht des erlittenen Verlustes schrittweise zu sich selbst erwacht, wenn auch nur zu einem noch unbestimmten, nur möglichen – noch in der verdunkelten Zukunft liegenden – Selbst. Die Schritte, die auf diesem Werdeweg gegangen werden, sind die des Wahrnehmens, Erkennens, Annehmens und Gestaltens. Diese vier Werdeschritte können auch als wiederkehrende Aufgaben, die dem Trauerprozess innewohnen, bezeichnet werden. Sie enthalten die implizite Forderung, das Geschehene wahrzunehmen, es zu realisieren, den erlittenen Verlust, die daraus hervorquellende Trauer sowie die damit einhergehenden Veränderungen zu erkennen, sie anzunehmen, um schließlich sowohl sich selbst als auch das eigene Leben neu zu gestalten.
»Am Anfang wollte – konnte – ich es einfach nicht glauben. Sven, mein Sven sollte tot sein? Das konnte nicht sein. Ich habe alles getan, um mich dieser Wahrheit nicht stellen zu müssen. Auf Dauer schaffte ich es nicht. Immer wieder blitzte die unbarmherzige Erkenntnis in mir auf: Er ist tot. Ich musste mich entscheiden. Seinen Tod annehmen – und damit irgendwie nach vorne zu leben. Oder mich der furchtbaren Erkenntnis verweigern und gewissermaßen mit ihm weiter zu sterben. Ich habe mich für das Leben entschieden. Jeden Tag versuche ich aufs Neue zu (über-)leben. Versuche mir selbst und dem Tag eine neue Gestalt zu geben. Das ist manchmal unmöglich und manchmal möglich. Aber immer ist es ein Kraftakt« (Susanne F.).
Im Folgenden werden die vier Werdeschritte der Trauerarbeit einzeln betrachtet. Bei dieser schrittweisen Betrachtung ist es erstens wichtig zu wissen, dass diese zu keinem Zeitpunkt rein oder isoliert vorkommen, und zweitens muss deutlich sein, dass beim Fokussieren auf einen dieser Schritte die anderen sich nicht auflösen, sondern sie gewissermaßen aus dem Betrachtungshorizont zurücktreten. Durch die Fokussierung auf die einzelnen Schritte wird der komplexe Prozess der Trauerarbeit als Werdeprozess für den Begleitenden transparenter und damit besser begleitbar. Es wird deutlich, dass wir Menschen diese Werdeschritte unser ganzes Leben lang durchlaufen. Immer wieder in unzähligen Situationen. In der existenziellen Krise jedoch gelangen sie dem Menschen in ihrer fordernden Intensität zur Bewusstheit.
Wahrnehmen und Sehen-Lernen
Jeder Mensch nimmt in jedem Moment seines Lebens unzählige Dinge wahr. Was wahrgenommen wird und worauf dann schließlich reagiert wird, hängt immer davon ab, was gerade wichtig ist. Dies wird dann sozusagen aus dem Fluss der Gleich-Gültigkeit herausgefiltert. Das unwichtig Erscheinende erzeugt keine Resonanz, keinen Anklang und erzeugt auch keinen Widerhall, bleibt im Gleich-Gültigkeitsfluss unbemerkt und gelangt nicht ins Bewusstsein bzw. in die Erkenntnis.
Angesichts eines erlittenen Verlustes durch den Tod ist es Aufgabe der Wahrnehmung, sowohl das Verlorengegangene als auch sich selbst angesichts des erlittenen Verlustes in den Blick zu nehmen. Wahrnehmen bedeutet, den Blick nach außen auf das veränderte Leben und nach innen auf das eigene verletzte und verflüchtigte Ich zu richten. Eine fast unlösbar anmutende Aufgabe: Es soll etwas in den Blick genommen werden, das gerade jetzt, gerade in diesem Moment des großen Verlustes, gar nicht mehr zu existieren scheint. Andersartigkeit, Fremdheit, Unbekanntheit und Rätselhaftigkeit sind vorherrschende Gefühle. Nicht nur in Bezug auf das, was dem Trauernden widerfahren ist, sondern vor allem auch in Bezug auf die eigenen Reaktionen und darauf, dass er es selbst ist, dem dieser Verlust geschehen ist. Trauernde haben Angst vor der Leere, die sie angähnt, und oftmals verfügen sie auch gar nicht über die Kraft, sich selbst anzuschauen und ihr verletztes Selbst wahrzunehmen, das wie eine große Wunde erscheint. Wenn hier von Wahrnehmung gesprochen wird, ist es notwendig, zunächst mit einem Paradoxon zu beginnen, nämlich damit, dass der Trauernde sich erst einmal gar nicht selbst wahrnehmen kann.
Sich nicht selbst wahrnehmen können
Ein Mensch, der (s)ein Du durch den Tod verloren hat, kann diesen unwiderruflichen Verlust im ersten Augenblick gar nicht mit sich selbst in Verbindung bringen. Es ist für ihn unvorstellbar, dass der, mit dem er in Liebe verbunden ist, nicht mehr ist, dass er niemals mehr wiederkehrt. So kann der Zurückbleibende angesichts der Nachricht vom Tod des geliebten Menschen oder angesichts seines Leichnams das Geschehen zunächst nur negieren: »Das kann doch nicht wahr sein. Das glaube ich nicht. Da muss ein Irrtum vorliegen. Wie kann das wahr sein, ich habe doch heute Morgen noch mit ihm gesprochen.« In diesen Empfindungen des Zurückbleibenden offenbart sich eine tiefe Furcht, die unaussprechlichen Worte »er ist tot«, »er lebt nicht mehr«, »er kommt nie mehr wieder« wirklich zuzulassen. Erst wenn der Zurückbleibende diese schreckliche Wahrheit selbst formuliert und ihr mit Hilfe seiner Sprache eine zumutbare Gestalt verleiht, kann er in einem ersten Schritt die unfassbare Tatsache wahrnehmen und zumindest für diesen ersten Moment realisieren, dass der geliebte Mensch wirklich und wahrhaftig gestorben ist: dass er nicht mehr lebt, nicht mehr lacht, nicht mehr weint, nicht mehr atmet, nicht mehr spricht. Wobei hier deutlich sein muss, dass diese Wahrnehmung jederzeit wieder in Frage gestellt werden kann. Die Seele kann das Unmögliche nur in ihrem eigenen Tempo möglich werden lassen. So sagt Frau Maria B., 88 Jahre, 18 Monate nach dem Tod ihres Mannes: »Am Anfang dachte ich immer. Gut, er ist nicht mehr da. Er war ja in den 60 Jahren unserer Ehe oft nicht da. War viel unterwegs. Langsam begreife ich aber, dass er gar nicht mehr wiederkommt. Dass ich umsonst warte. Das ist schrecklich. Er fehlt mir so.«
Die extrinsische, auf den äußeren Verlust gerichtete Wahrnehmung
Bevor die Wahrnehmung des Trauernden mit dem eigenen Selbst in Beziehung gebracht wird, ist sie also erst einmal auf den äußeren Verlust, auf das Verlorengegangene gerichtet. Es ist ein extrinsisches, ein nach außen gerichtetes Wahrnehmen, in dessen Vordergrund das Nichts, die Leere als eine Art objektiver Nihilismus steht. Objektiver Nihilismus bedeutet hier, dass der Trauernde nur das sieht (sehen kann), was nicht mehr ist. Er sieht nur das Entzogene, das, was durch den Tod verloren gegangen ist. Da ist zuallererst der geliebte Mensch, den es in der äußeren Realität nicht mehr gibt: Er ist nicht mehr da. Sein Nichtmehr-Dasein wird deutlich in der Konfrontation mit dem leeren Platz am Tisch, dem leeren Bett, dem Auto, das nicht mehr gefahren wird, das angelesene Buch, das der Verstorbene nicht mehr zu Ende lesen kann, mit Handreichungen, die plötzlich ungetan bleiben, und auch mit einer Zukunft, die arm und leer und verschlossen erscheint, weil Pläne ohne den Verstorbenen unmöglich erscheinen.
Äußere Abwesenheit des Verstorbenen versus innere Anwesenheit
Die Realisierung der äußeren Abwesenheit des Verstorbenen wird häufig durch eine empfundene innere Anwesenheit erschwert. Der Verstorbene begegnet in Träumen, Berührungen und Stimmungen. In dieser (un)heimlichen Präsenz des Verstorbenen erlebt der Trauernde auf schmerzhafte Weise den Widerspruch zwischen der realen und totalen Abwesenheit des geliebten Menschen im alltäglichen Leben und seiner gefühlten Anwesenheit im eigenen Inneren. Es entsteht eine qualvolle Bewusstheit vom Fehlen dieses Menschen in der realen Außenwelt, die auf eine von nun an und für immer existierende Leerstelle verweist.
Der Trauernde kann die heimliche Präsenz als beruhigend und tröstlich, aber auch als unheimlich, anstrengend, aufwühlend und verunsichernd erfahren. Sehr oft berichten Trauernde, dass sie in der Nacht den Atem des Verstorbenen gefühlt haben, seine Stimme gehört haben, seinen Geruch wahrgenommen haben. Dies führt nicht selten dazu, dass sich Trauernde als verrückt und unnormal empfinden. Begleiter, die dies als eine durchaus normale Reaktion benennen, können oftmals Entlastung schaffen.
Erst wenn die beiden Dimensionen – reales Außen (Nicht-mehr-Dasein) und inneres Außen (heimliche Präsenz) – sich beruhigen, gibt es die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen und sich selbst in seinem ganzen Schmerz ansichtig zu werden. Den Trauergang weiterzugehen bedeutet, nun die Blickrichtung zu ändern und den Wahrnehmungsmodus nach innen gerichtet zu erweitern.
Die intrinsische Wahrnehmung – Das bin ja ich, dem dies widerfahren ist
Susanne F. berichtete in einem Begleitgespräch über diese Seite der Wahrnehmung: »Irgendwann dämmerte es mir, dass dies kein Film ist. Dass es harte und unabänderliche Wirklichkeit ist. Sven kommt nicht wieder. Da wurde mir auf grauenvolle Weise bewusst, dass ich nie mehr Mutter sein würde. Nie mehr würden mich seine Augen anleuchten und nie mehr würde er mich mit seinem unbekümmerten Lachen in die Arme schließen. Ich würde nie mehr die Mutter sein können, die ich ihm war und sein wollte und hätte sein können. War ich überhaupt jetzt noch eine Mutter? Eine Frau, die ihren Mann verliert, nennt man eine Witwe. Wie nennt man eine Mutter, die ihr Kind verliert? Heute weiß ich, es gibt den Begriff ›verwaiste Eltern‹. Ich habe aber doch noch meine Tochter Imme. Bin ich jetzt eine halbverwaiste Mutter?«
Ein Trauernder, der sich dem Fremden, dem anderen in sich öffnet, drängen sich mit fortschreitender Zeit unzählige Fragen auf: Bist du es wirklich selbst, dem dies zugestoßen ist? Wie konnte mir das zustoßen? Was für einer bin ich denn, dass mir das zustoßen konnte? Wie kann ich hälftig weiterleben? – Es steht nicht mehr nur das Verlorengegangene im Vordergrund, sondern der Trauernde richtet den Blick zunehmend auf sein zerschlagenes und verwundetes Selbst und nimmt dabei wahr: »Das ist nicht irgendjemandem widerfahren und ich kann betroffen daneben stehen. Ich bin es ja selbst, die diesen Verlust erlitten hat.« »Er wird mich nie mehr in den Arm nehmen.« »Nie mehr werde ich mich an ihn schmiegen können.« »Ich bin allein.« Der geliebte Mensch, mit dem er ein Wir bildete, ist nicht nur für die Welt und in der Welt verloren, sondern er ist für ihn selbst verloren.
Die Liebe des Zurückbleibenden, seine Bejahung zum Leben des anderen läuft ins Leere, läuft ins Nichts. Es kann hier von einer inneren Leere, einem subjektiven Nihilismus gesprochen werden. Eine Aufgabe, die die Trauer jetzt an den Zurückbleibenden stellt, ist es, äußere und innere Realität nicht mehr als voneinander geschiedene zu betrachten, sondern sie zueinander in Beziehung zu setzen. In dieser Aufgabe kommt der Trauernde im eigentlichen Sinne zu sich selbst. Er richtet den Blick nach innen, nimmt sich in seiner eigenen Verletztheit, seinem eigenen Schmerz und in seiner eigenen Einsamkeit wahr.
Zu sich selbst erwachen und sehen lernen
Das Verlorene und sich selbst angesichts dieses Verlustes wahrzunehmen ist schmerzhafte innere Arbeit. Sie fordert den Trauernden auf, sich zu entscheiden, sich zu öffnen, aufmerksam und sensibel für die Wirklichkeit zu werden: zu erwachen und sehen zu lernen. Dieses Sehen-Lernen erzwingt keine Sichtbarkeit, will nicht zwanghaft aufdecken oder aufklären, sondern schärft den Blick und befähigt den Sehenden zu einem aufrichtigen Wahrnehmen dessen, was ist. Es ermöglicht dem Trauernden, nicht auszuweichen, nicht wegzulaufen, sondern inne zu bleiben und auszuhalten, das Erfahrene anzuschauen und sich dabei selbst als einen Verletzten und Vermissenden wahrzunehmen.
Es scheint, als würde der Trauernde sich hier an einer Wegscheide befinden: (sich selbst) sehen lernen oder in Trugbildern verharren sind die beiden Eckmöglichkeiten, zwischen denen der Trauernde seine Wahl entfalten kann. Wenn hier von einer Wahl zwischen diesen zwei Wegen gesprochen wird, so muss natürlich deutlich sein, dass beide Möglichkeiten in ihrer Reinheit nicht anzutreffen sind: Immer wird dem Trauernden in seinem Sehen etwas dunkel und verborgen bleiben. Nie kann er sich komplett dem Sehen verschließen.
Trifft der Trauernde die Entscheidung zugunsten des (Sich-selbst-)Sehen-Lernens, so wählt er sich gewissermaßen selbst. Er erfasst sich selbst in seiner zerbrochenen und verwandelten Individualität und versucht sich verstehend – mal mehr, mal weniger – mit dem Wahrgenommenen auseinanderzusetzen. So können wir hier sagen, dass sich in den Prozess der Wahrnehmung zunehmend Spuren von Reflexivität hineindrängen, die den Werdeschritt des Erkennens vorbereiten und einleiten.
Erkennen und Verstehen
Der Schritt des Erkennens ist gekennzeichnet durch eine bewusste Betrachtung des veränderten Lebens und geht mit einer aktiven Innenschau einher. Dieser Werdeschritt fordert den Trauernden dazu auf, zu erkennen, dass sich vieles verändert hat und dass er nicht (mehr) der ist, der er einst in der lebendigen und gelebten Verbindung mit dem Verstorbenen war. Gleichzeitig muss der Zurückbleibende erkennen, dass er in gewisser Weise (noch) nicht der ist, der er sein kann (und will). Er ist ein Zwischenwesen, das in einem Zwischenland wohnt. »In den ersten Wochen nach Svens Tod lebte ich wie im Nebel. Einerseits waren die Dinge um mich herum bekannt und vertraut, andererseits war es, als hätte ich sie noch nie gesehen. Mir war auch vieles so gleichgültig. Nichts schien mehr einen Wert zu haben. Meine Tochter, mein Mann versuchten mich immer wieder aus diesem Nebel herauszuholen. Ich wollte es nicht. Hatte zu viel Angst, was sich dann zeigen würde. Ich lebte in dieser Welt, wie ein Zombie in der Zwischenwelt« (Susanne F.).
Ein Aspekt der Wendung nach innen ist, dass der Zurückbleibende sich selbst als Vermissenden erfährt. Er nimmt wahr und erkennt, dass das Geschehene nicht irgendjemandem zugestoßen ist, sondern dass er selbst derjenige ist, den der Verlust dieses einen geliebten Menschen unwiderruflich getroffen hat. Angesichts seines verwundeten Selbst und dem Gefühl, nur noch hälftig zu leben, erkennt er nicht nur den erlittenen Verlust, sondern auch sich selbst und alle anderen als Sterbliche. Diese existenzielle Erkenntnis irritiert, löst ängstliche Unsicherheit aus und wirft unzählige Fragen auf: »Was bedeutet das für mich, dass ich (jetzt und in Zukunft) allein bin? Was heißt es, eine Witwe zu sein? Habe ich jetzt trotzdem noch zwei Kinder, wenn eines gestorben ist? Wie kann es sein, dass ich weiterleben muss, obwohl meine Frau tot ist? Was bedeutet es, nicht mehr die zu sein, die ich war? Was bedeutet es sterblich zu sein? Wie soll ein Leben als Sterbliche gestaltet werden? Wieso lebe ich weiter, wenn der, den ich so liebte, tot ist?«
Der Erkennensprozess ist schmerzhaft und quälend. Einerseits sind da viele Fragen und wenig Antworten, andererseits eröffnet sich dem Zurückbleibenden im Prozess des Erkennens die Möglichkeit, ein reflexives Verhalten zu sich selbst und zur eigenen Trauer zu entwickeln, das in der Frage gipfelt: Wer bin ich (eigentlich noch)? Im Werdeschritt des Erkennens entzieht sich der Hierbleibende der Verhaftetheit an die lähmende Situation und beginnt sich verstehend mit sich und seiner Trauer auseinanderzusetzen.
Existenzielles Erkennen
In diesem Verstehen begreift er sich als Wesen, das, eingespannt in die Widersprüchlichkeiten des Lebens, zu jeder Zeit dem Spiel des Unberechenbaren ausgesetzt ist. Der Trauernde erkennt, und sei es nur für einen Moment, dass er sich selbst immer wieder aufs Neue in diesem nicht aufzulösenden Widerstreit erringen muss. An dieser Stelle findet so etwas wie ein innerer Umbruch statt. Der Trauernde beginnt zu deuten, er stellt Fragen nach Zusammenhängen, will Muster erkennen, Sinnthemen herausschälen. Letztlich lässt sich aus allen Reflexionen die Frage ableiten: Was bedeutet das Erkannte für mich? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, probiert der Hinterbliebene sich aus, er versucht sich, er experimentiert mit sich, um (wieder) einen Weg zu finden, der ihn trägt und den er leben kann.
Das hier vorgestellte Erkennen geht über das rationale hinaus. Es ist mehr als ein bloßes objektivierendes Wissen, das feststellt, was das Erkannte ist, es dann begrifflich fasst und einordnet. Es erschöpft sich auch nicht darin, dass sich im Erkennensprozess die Zusammenhänge, Bedingungen und Folgen erschließen. Erkennen im hier gemeinten Sinne ist ein erfahrendes Wissen, das im Hinterbliebenen als ein »Wissen von und um« aktiv ist, das den Blick auf die grundsätzliche Unplanbarkeit des Lebens und auf die eigene Wandelbarkeit richtet. Es ist ein transformierendes Wissen, mit dem der Trauernde lebt und aus dem heraus er lebt.
Der Umgang mit dem, was im Trauerschmerz erkannt wird
Im Prozess des Erwachens wird der Trauernde ein Erkennender. Das Erkennen ist jedoch nicht zwingend von Dauer. Der Schmerz, der dieses Erkennen begleitet, kann so heftig sein, dass der Trauernde ihn nicht aushalten kann. In der Unsicherheit, seiner Bestimmung nicht gewachsen zu sein, wird er versuchen, den Schmerz zu verdrängen, zu unterdrücken, ihm mit Aktionismus zu begegnen oder ihn zu betäuben.
Zum Schutz der Trauernden, die ihre Trauer (noch) nicht zulassen (können), sei ein Verständnis für das Verdrängen bekundet. Es hat Sinn für den, der die Verdrängung gebraucht. Damit ist nicht gesagt, dass sie sich auf lange Dauer hilfreich oder gar heilsam auswirkt. Aber die Würdigung der Verdrängung als ein momentanes Mittel, mit sich und dem unbekannten Leben umzugehen, eröffnet weit mehr die Chance, dass der Trauernde sich seinem Trauerschmerz zuzuwenden lernt.
Unterstützend für den Prozess des Erkennens sind Trauerräume. Räume der Trauer sind sowohl Räumlichkeiten im physischen Sinn (z. B. Abschiedszimmer, Aufbahrungsraum, Friedhof, Trauerbegleitung, Trauergruppe, Trauercafé) wie auch Räume im psychischen Sinn (z. B. mitmenschliche Zuwendung, Zeit für Gespräche – also Begleitung). Sind diese Räumlichkeiten gegeben, kann es dem Trauernden möglich werden, sich dem Chaos seiner Ängste und Zweifel zu stellen, aus dem bisherigen Konstrukt seiner Lebensperspektiven herauszutreten und abständig von diesem werden.
Im Lichte der (neu) gewonnenen Erkenntnisse sieht er sich auch dazu aufgefordert, seine Lebensweise sowie seine Beziehung zu dem verstorbenen Menschen und zu sich selbst neu zu deuten, zu ordnen und zu werten: »Manchmal schaue ich in den Spiegel. Ich sehe mich an und frage mich: ›Wer ist das?‹ Alles hat sich verändert. Und ich weiß, es darf sein. Alles hat sich verändert mit dem Tod von Sven. Also warum nicht auch mein Gesicht, meine Augen, meine Haltung. Ich war manchmal schrecklich zu Sven. Ja, das war ich. Und gleichzeitig war es für die Situation, in der es geschah, in Ordnung. Ich will, dass auch dies sein darf« (Susanne F.).