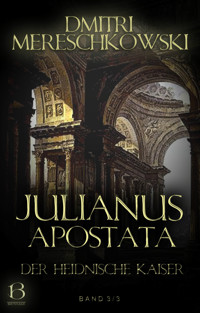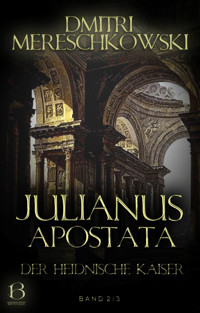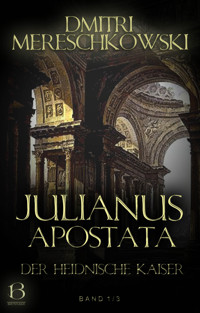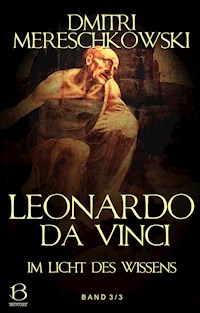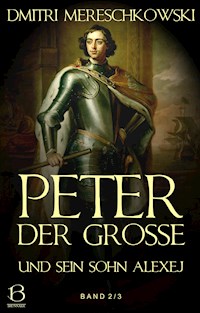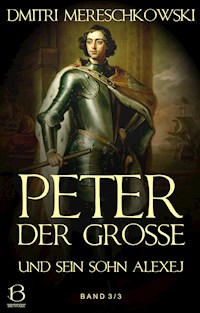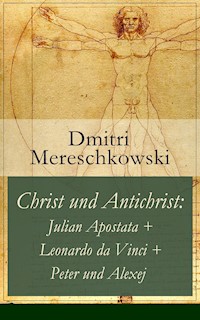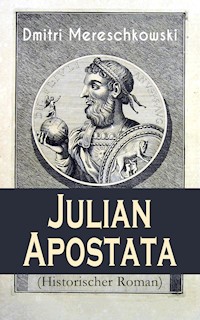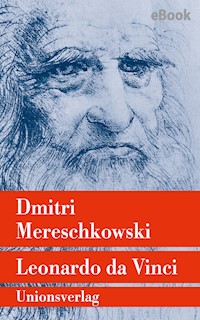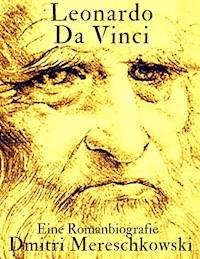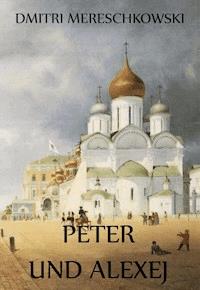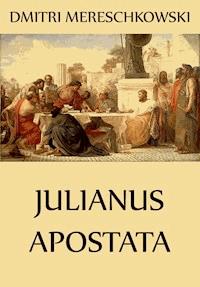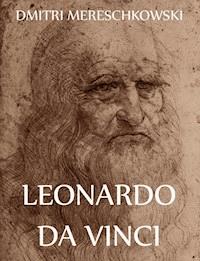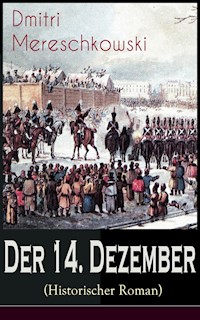
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Der 14. Dezember (Historischer Roman)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski (1865-1941) war ein russischer Schriftsteller. Bekannt wurde Mereschkowski durch eine Reihe historischer Romane und Novellen. Mereschkowski war für den Literatur-Nobelpreis nominiert. Mereschkowskis Werke sind "geprägt von der Idee eines epochenbildenden Widerstreits zwischen Christ und Antichrist und einer Vermischung dekabristischer Traditionen mit mystisch-orthodoxen Elementen". Eine wichtige Rolle in diesem Denken spielte für ihn dabei Dostojewski. Aus dem Buch: "Im Saale des Reichsrates im Winterpalais, zwischen dem Generaladjutantenzimmer und den provisorischen Gemächern des Großfürsten Nikolai Pawlowitsch, war es um acht Uhr früh noch so finster wie in der Nacht. Die hohen, auf den Hof hinausgehenden Fenster gähnten schwarz und undurchdringlich. Der schwarzgelbe Nebel schien wie ein beißender, erstickender Rauch durch die Fenster und Mauern einzudringen. Die Wachskerzen, die in schweren Kandelabern auf dem langen, mit grünem Tuch bedeckten Tische mit trüben Flammen brannten, beleuchteten nur die Mitte des Saales, während die Winkel im Dunkel verschwanden; zwei große einander gegenüberhängende Bildnisse von Katharina II. und Alexander I. traten geheimnisvoll und durchsichtig aus dem Dunkel hervor, und Großmutter und Enkel schienen sich mit dem gleichen schelmischen und spöttischen Ausdruck zuzulächeln."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der 14. Dezember (Historischer Roman)
Dekabristenaufstand - Revolutionäre Bewegung gegen das Regime von Nikolaus I.
Inhaltsverzeichnis
Erstes BuchDer Vierzehnte
Erster Teil
Erstes Kapitel
»Die Erde lieben ist Sünde, man muß das Himmlische lieben. Ich kann es aber nicht, – mehr als alles auf der Welt liebe ich unser Gut Tscherjomuschki! Solange ich da lebte, wußte ich es nicht. Kaum bin ich aber von dort fort, als ich es zu lieben anfing und mich danach so sehne, daß ich vor Sehnsucht sterben könnte.«
»Lieben Sie Ihre Erde wie etwas Lebendiges, Marja Pawlowna?«
»Natürlich ist sie lebendig! Wenn ich ins Gehölz komme, stehen die jungen Birken wie dünne Wachskerzen da, ihre Haut ist so warm, weich, von der Sonne durchwärmt, ganz wie lebendig. Ich umarme sie, schmiege meine Wange an sie, liebkose sie: mein liebes trautes Schwesterchen!«
Im bläulichen Scheine der Winterdämmerung, der ganz schwach durch das vereiste Fensterchen des Reiseschlittens drang, betrachtete Fürst Valerian Michailowitsch Golizyn Golizyn1 das liebliche Gesicht des jungen Mädchens und dachte bei sich: ›Bist selbst wie eine Birke im Frühling!‹
Marja Pawlowna sah ganz wie ein gewöhnliches Provinzfräulein aus, wie eines, von denen es heißt:
Geteilt sind ihre Mußestunden Zwischen Klavier und Stickerei.
Sie ist gekleidet nach dem Modebild im ›Telegraph‹; sie trägt einen mit dauerhaftem dunkelgrünem Gros-de-Tours aus Großmutters Zeiten gedeckten Pelzmantel und einen Kapotthut mit rosa Bändern; der dicke schwarze Zopf ist zu einem Körbchen geflochten, aus dem leichte Locken auf die Wange herabfallen; dazu trägt sie altertümliche Granatohrringe, wahrscheinlich auch ein Geschenk der Großmutter. Ist gut erzogen und spricht französisch. Dabei hat sie das Gesicht eines Dorfmädels, das auf einer Bank vor dem Tore sitzt, ein gelbes Kopftuch mit roten Tupfen aufhat, mit den Burschen scherzt und Sonnenblumenkerne knackt.
Vielleicht liebt sie noch niemand, aber sie ist vom Dufte der Liebe umhaucht wie blühender Flieder von der Frische des Taues. Und alle fühlen es: die Postmeister, die an den Schlagbäumen stehenden Invaliden, die dickbäuchigen Kaufleute, die im Schweiße ihres Angesichts Tee trinken, die Postkutscher mit den roten Gesichtern, – alle denken sich beim Anblick Marja Pawlownas: ›Ach, ist das ein nettes Mädel!‹
Golizyn machte auf der Reise von Wassiljkow nach Petersburg Station in Moskau, um das Mitglied der Geheimen Gesellschaft Iwan Iwanowitsch Puschtschin Puschtschin2 zu besuchen. Puschtschin diente am Strafsenat des Moskauer Hofgerichts und wohnte bei seiner Tante, einer vornehmen Dame aus der guten alten Zeit, im Pfarrbezirk von Pjatniza-Boschedomskaja, in der Alten Konjuschennaja-Straße. In diesem Hause war auch auf der Reise nach Petersburg eine entfernte Verwandte der Puschtschins, die Sserpuchower Gutsbesitzerin Nina Ljwowna Tolytschowa, mit ihrer neunzehnjährigen Tochter Marja Pawlowna abgestiegen. Golizyn hatte sich auf Puschtschins Bitte bereit erklärt, die Damen zu begleiten.
Um jene Zeit fing zwischen Petersburg und Moskau gerade die Postdiligence an zu verkehren; es war ein niedriges, langgestrecktes, mit Leder überzogenes Fuhrwerk mit zwei kleinen Fensterchen, das eine vorn, das andere hinten. Liegen konnte man darin nicht: Die vier durch eine Scheidewand voneinander getrennten Fahrgäste saßen mit den Rücken zueinander und blickten zwei nach vorn und zwei nach hinten. Da man in den früheren Reisewagen bequem liegen konnte, nannten die Postkutscher diese neue Erfindung ›Neleschanze‹.3 Golizyn fuhr nun mit den beiden Damen und deren leibeigenem Dienstmädchen Palaschka in einer solchen ›Neleschance‹.
Frau Tolytschowa, die aus einer begüterten Familie stammte, war gewohnt, nicht anders zu reisen als nach adliger Sitte mit eigenen Pferden, recht gemächlich, mit einer kleinen Küche, mit großem Gepäck und vielen leibeigenen Dienstboten. Die Postdiligencen fürchtete sie als eine unerhörte Neueinführung und freute sich über den verläßlichen Reisebegleiter.
Sie erzählte ihm sofort ihre ganze Geschichte. Ihre Erziehung hatte sie im Smolnyj-Institut genossen. Sie heiratete fast direkt aus dem Institut und lebte mit ihrem Manne knapp fünfundzwanzig Jahre. Pawel Pawlowitsch Tolytschow hatte in der Armee gedient; im italienischen Feldzuge wurde er von Ssuworow zum Leutnant befördert; im Jahre 1812 wurde er verwundet und mit dem Range eines Oberstleutnants verabschiedet. Er war ein Mann von großem Verstande und sogar Schriftsteller: Im ›Ziosboten‹ wurde ein Artikel von ihm veröffentlicht; mit dem Herrn Labsin4 war er befreundet gewesen, und als man diesen wegen seiner Freigeistigkeit verschickte, hätte man beinahe auch Pawel Pawlowitsch erwischt. Er litt Verfolgungen, denn er liebte die Wahrheit und klagte die bösen Menschen – die bestechlichen Beamten und die grausamen Gutsbesitzer – an. Er erklärte selbst dem Bischof, daß es keine Leibeigenen geben dürfe, weder Herren noch Knechte. Seine eigenen Bauern wollte er freilassen, aber die Obrigkeit erlaubte es ihm nicht. Man erklärte ihn für einen Freimaurer, Gottlosen und Aufrührer. Der Gouverneur wollte ihn ins Gefängnis sperren. Pawel Pawlowitsch wurde vor vielem Kummer krank und starb eines plötzlichen Todes. Nina Ljwowna blieb mit dem kleinen Töchterchen mutterseelenallein. Drei Kinder hatte sie bei Lebzeiten des Mannes verloren; Marinjka war ihr letztes. Die Gutswirtschaft war zerrüttet; die Bauern, diese Sklavenseelen, gerieten, als sie die Güte des verstorbenen Herrn sahen, dessen edle Gefühle sie nicht verstanden, außer Rand und Band; die Hälfte war davongelaufen, die andere Hälfte soff; sie zahlten weder den Zins noch die Kopfsteuer. Frau Tolytschowa selbst verstand nichts von der Wirtschaft; die Damen ihrer Bekanntschaft machten sich über sie lustig, weil sie ihre Leute niemals schlug: Sie fürchtet wohl, ihre Hand an den Wangen eines Leibeigenen zu beschmutzen. Der Verwalter ist aber ein Gauner. Das Gut ist beim Vormundschaftsgericht verpfändet, die Schuld beträgt fünfundzwanzigtausend Rubel, die Zinsen kann sie aber nicht bezahlen; wenn man das Gut verkauft, muß sie betteln gehen.
Aber der Herr selbst erbarmte sich der armen Waisen und schickte ihnen einen guten Menschen. Nach Sserpuchow kam aus Petersburg auf Besuch zu seinen Verwandten der Staatsrat Porfirij Nikodimytsch Aquilonow, Beamter im Departement für auswärtigen Handel; er sah auf einem Ball im Provinzklub Marinjka und war so bezaubert, daß er nach einigen Tagen den Antrag machte! Ein nicht mehr junger Mann von über fünfzig Jahren, aber respektabel, von bester Gesinnung, angesehen bei den Vorgesetzten und, wie man sagt, mit einem großen Vermögen. In Marinjka ist er sterblich verliebt. »Wenn Sie mich durch Ihre Einwilligung beglücken«, sagte er, »so werde ich kein Opfer scheuen, um Ihre Tochter glücklich zu machen: Ich nehme meinen Abschied, übernehme die Bewirtschaftung von Tscherjomuschki und bringe Ihre Verhältnisse in Ordnung.« Marinjka sagte nicht nein, erbat sich aber Bedenkzeit. Nina Ljwowna will ihre Tochter nicht zwingen: Sie versteht selbst, daß ein so junges Ding nach Liebe, nach einem Herzensbunde strebt. Porfirij Nikodimytsch paßt aber gar nicht zu ihr, er könnte ihr Vater sein. So war nun ein Jahr vergangen, sie überlegte es sich noch immer, und schließlich kam ein Brief vom Herrn Aquilonow: Er bittet respektvollst, über sein Schicksal zu beschließen und, falls es noch eine, wenn auch geringe Hoffnung gibt, zu einer persönlichen Aussprache nach Petersburg zu kommen; Nina Ljwowna mußte auch selbst in eigenen dringenden Geschäften hin, da sie mit den Zinsen für das Gut im Rückstand war: Wie leicht konnte man das Gut mit Beschlag belegen und öffentlich versteigern.
Sie hatten noch die Hoffnung auf die entfernte Großtante Natalja Kirillowna Rschewskaja. Die Alte war reich, aber geizig und launisch. Sie hatte sich darauf versteift, daß sie ihr Gut verkaufen und zu ihr nach Petersburg ziehen, und wollte nicht nachgeben. »Sonst kriegt ihr von mir keinen Dreier.« Marinjka will aber davon nichts hören. »Lieber heirate ich schon den Aquilonow, werde aber Tscherjomuschki nicht verlassen. Hier bin ich geboren, hier will ich auch sterben.«
Als Nina Ljwowna mit diesem Bericht zu Ende war, brach sie in Tränen aus: So sehr sie den Freier lobte, die Tochter tat ihr doch leid.
Golizyn saß in seiner Abteilung nachts mit der Palaschka, und bei Tage mit Nina Ljwowna. Aber am zweiten Tag bekam sie Kopfschmerzen; damit sie sich ein wenig hinlegen könne, setzte man die Palaschka auf den Bock zum Kutscher, und Marja Pawlowna siedelte zu Golizyn über.
Die Neleschance kroch wie eine Schildkröte. Der Schlittenweg war noch nicht gut; es gab wenig Schnee, und die Kufen knirschten auf den nackten Steinen; der Wagen rüttelte ordentlich. Hinter der Scheidewand atmete schlaftrunken Nina Ljwowna. Das Glöckchen bimmelte einschläfernd. Im eingefrorenen Fensterchen verdichtete sich das bläuliche Dämmerlicht; es glich dem Licht, das man im Traume sieht. Und den beiden war es, als träumten sie einen uralten, oft gesehenen Traum.
»Mir scheint immer, daß ich Sie schon mal gesehen habe, Marja Pawlowna. Ich kann mich nur nicht erinnern, wann,« sagte Golizyn, noch immer das liebliche Gesicht des jungen Mädchens betrachtend.
»Auch ich ...« begann sie und kam nicht weiter.
»Was denn?«
»Nein, es ist nichts. Dummheiten.« Sie wandte sich weg und errötete. Sie errötete überhaupt leicht, heftig und plötzlich, über das ganze Gesicht, wie ein kleines Mädchen, und dann war sie noch hübscher. Sie beugte sich zum Fenster vor und fuhr mit ihrem feinen rosigen Fingerchen über die Eisblumen.
Sie betrachtete Golizyn verstohlen, doch aufmerksam, und sein Gesicht veränderte sich seltsam in ihren Augen; er hatte gleichsam zwei Gesichter: bald ein trockenes, hartes, galliges, mit einer bösen, ewig höhnenden Falte um den Mund, mit einem durchdringend klugen und schweren Blick unter den blindfunkelnden Brillengläsern hervor – sie liebte die Brille nicht und glaubte, daß nur Greise und gelehrte Deutsche Brillen tragen, – ein ihr fremdes, beinahe schreckliches Gesicht; und dann wieder plötzlich ein einfaches, kindliches, liebes und so unglückliches, daß ihr Herz sich zusammenkrampfte, als ahnte es ein Unheil, eine Todesgefahr, die diesem Menschen drohte. Aber das alles fühlte sie so dunkel und verschwommen wie in einem ahnungsvollen Traume.
»Ich habe ja vor Ihnen ein wenig Angst«, sagte sie, ihn noch immer verstohlen, doch aufmerksam musternd. »Wer weiß, vielleicht sind Sie auch so ein Spötter wie Iwan Iwanowitsch Puschtschin!«
»Puschtschin ist ein seelenguter Mensch, und man braucht vor ihm keine Angst zu haben. Auch vor mir nicht.«
»Sind Sie auch ein guter Mensch?«
»Und wie glauben Sie, Marinjka ... Marja Pawlowna?«
»Es tut nichts! Alle nennen mich Marinjka. Den Namen Marja Pawlowna mag ich auch selbst nicht.« Sie blickte ihm gerade in die Augen und lächelte; auch er lächelte. Sie sahen einander an, lächelten stumm, und beide fühlten, wie dieses Lächeln sie einer unaufhaltsam anwachsenden Vertrautheit nahebrachte, einer etwas schwindelnden und freudigen Vertrautheit, als erkennten sie einander und besännen sich aufeinander nach einer langen, langen Trennung.
Plötzlich wandte sie sich wieder weg, errötete und schlug die Augen nieder. Aber er fing noch den durch die langen Wimpern verschämt leuchtenden liebkosenden Blick auf, der vielleicht gar nicht ihm galt, sondern niemand bestimmtem und allen: So liebkost auch der Sonnenstrahl alles, was er trifft.
»Sie müssen mich schon entschuldigen, Fürst«, sagte sie, noch immer mit gesenkten Augen. »Ich bin furchtbar scheu und wild. Ich lebte ja immer allein in Tscherjomuschki und bin darum verwildert. Habe verlernt, mit Menschen zu sprechen. Ich fürchte mich vor allem.«
»Es lohnt sich nicht, die Menschen zu fürchten, Marinjka. Die Menschen fürchten, heißt: sie verziehen.«
»Ich fürchte ja nicht die Menschen, sondern ich weiß selbst nicht, was. In Tscherjomuschki fürchtete ich nichts, dort war ich tapfer, kaum bin ich aber von dort fort, als mir alles so fremd und schrecklich vorkommt. Als ich klein war, pflegte die Kinderfrau, nachdem sie mich zu Bett gebracht und bekreuzigt und den Vorhang zugezogen hatte, zu sagen: »Schlaf, Kindchen, mit Gott! Schlaf, schlaf, am Bettchen steht ein Schaf, öffne aber die Äuglein nicht und schau nicht durch die Vorhänge, sonst holt dich das Cho – da liegt es unter dem Bettchen.« Später dachte ich mir, daß nicht nur unter dem Bettchen sondern überall das ›Cho‹ liege. Das ganze Leben ist Cho ....«
»Suchen Sie es zu bannen, dann wird es Sie nicht anrühren.«
»Wie kann man es bannen?«
»Wissen Sie es denn nicht?«
»Ich weiß es nicht .... Nein, ich weiß wirklich nicht«, sagte sie langsam, wie nachdenklich den Kopf schüttelnd, und die langen Locken an den Schläfen schwankten wie zwei leichte Trauben. Der Wagen fuhr in diesem Augenblick über einen hartgefrorenen Schneehaufen und rüttelte, ihre beiden Gesichter kamen einander unwillkürlich nahe, und eine zarte Locke berührte sein Gesicht wie ein brennender Kuß.
»Und Sie wissen es? Sagen Sie es doch!«
»Ich darf es nicht sagen.«
»Warum nicht?«
»Weil jeder es selbst wissen muß. Auch Sie werden es einmal erfahren.«
»Wann denn?«
»Wenn Sie jemand lieben werden.«
»Ach so, die Liebe!« sagte sie und schüttelte wieder zweifelnd den Kopf. »Man sagt aber, es gäbe gar keine wahre Liebe, sondern nur Treulosigkeit und Tücke!«
»Wer sagt das?«
»Alle!«
Le plus charmant amour Est celui, qui commence et finit en un jour
Das hat mir neulich Puschtschin gesagt. Auch Tantchen sagt: ›Ach, Marinjka, du weißt noch gar nicht, was die Liebe für ein Vogel ist: Kaum kommt sie geflogen, so fliegt sie schon gleich wieder weg.‹ Auch die Großmutter ....«
»Wieviel Tanten und Großmütter haben Sie doch!«
»Ja, furchtbar viel.«
»Und Sie glauben ihnen allen?«
»Aber natürlich!«
Sie hatte die Gewohnheit, diese beiden Worte »Aber natürlich« bei jeder Gelegenheit zu gebrauchen, und machte es so reizend, daß er immer darauf wartete, daß sie sie wieder sage.
»Wie soll man ihnen nicht glauben? Man muß doch den Älteren glauben. Ich selbst bin ja ein dummes Gänschen, also glaube ich den klugen Menschen. Ich bestehe ganz aus fremden Worten, wie eine Bettdecke aus bunten Flicken.«
»Wer hält sich aber unter der Bettdecke verborgen?« fragte er lächelnd.
»Nun, raten Sie mal, wer!« Sie kniff die Augen zusammen und sah ihn mit krauser Stirne, mit einem schelmisch neckenden Lächeln an. Und wieder leuchtete der Sonnenstrahl auf, der alles liebkost, was er trifft.
Sie schwieg eine Weile, seufzte und ihr Gesicht wurde von einem gar nicht kindlichen Gedanken verdüstert.
»Ja, so ist es, Fürst. Die Liebe fliegt davon, und das ›Cho‹ bleibt zurück: Es hat ja keine Flügel und kann nur kriechen wie ein Wurm oder wie eine große, abscheuliche, schreckliche Spinne.«
Beide verstummten und fühlten, wie das Schweigen sie unaufhaltsam näher brachte.
»Nun, gut«, sagte Golizyn, »sollen die Großmütter und die Tanten sagen, was ihnen beliebt. Wollen Sie auch selbst, daß die Liebe davonfliegt?«
»Aber natürlich nicht! Ich liebe es, stark zu lieben, ich verstehe nicht, ein wenig zu lieben. Der Mantel darf nicht von einer Schulter herunterrutschen, er muß an beiden Schultern festsitzen.«
»So, so, Marinjka!« Golizyn sah sie so an, als hätte er sich ihrer plötzlich erinnert, als hätte er sie endlich wieder erkannt: Das bist du also! –
»Wie gut Sie sind!« versetzte er mit veränderter, leiser Stimme.
»Da haben Sie eine Gute gefunden! Sie kennen mich noch nicht. Fragen Sie mal Mama: Sie wird Ihnen sagen, was für ein abscheuliches, böses und eigensinniges Mädchen ich bin.«
»Hören Sie mal, Marinjka, darf man mit Ihnen ganz einfach sprechen?«
»Aber natürlich. Ich liebe selbst nur das Einfache. Alle diese Zeremonien kann ich nicht ausstehen!«
»Also hören Sie, Marja Pawlowna«, begann er und hielt plötzlich inne; er wandte sich, wie vorhin Marinjka, weg, errötete und schlug die Augen nieder. Sie blickte ihn neugierig an.
»Heiraten Sie nicht den Herrn Aquilonow«, sagte er mit einem plötzlichen Entschluß.
»Was fällt Ihnen ein? Warum?«
»Weil Sie ihn nicht lieben.«
»Wieso liebe ich ihn nicht? Er ist doch mein Bräutigam, also liebe ich ihn.«
»Nein, Sie lieben ihn nicht. Er ist für Sie Cho.«
»Was für Dummheiten! Ein vortrefflicher, ehrenwerter und wohlgesinnter Mensch. Er kann jedes Mädchen glücklich machen. Das sagen alle – Mama, Tantchen und Großmutter ...«
»Heiraten Sie ihn dennoch nicht.«
»Aber was geht das Sie an? Wie komisch sind Sie! Und wie unterstehen Sie sich? Ich müßte Ihnen böse werden, aber ich kann es nicht, ich dumme Gans ...«
»Nun, verzeihen Sie. Ich sage nichts mehr. Seien Sie nicht böse, Sie mein gutes, liebes, liebes Mädchen ...«
Plötzlich verstummte er. Er sah sie verstohlen an. Sie saß wie vorhin, zum vereisten Fensterchen vorgebeugt, und hauchte es an, die beiden Handflächen rechts und links vor dem Mund haltend. Dann fing sie an, mit dem Fingerchen in dem aufgetauten Kreise herumzufahren.
»W. Sehen Sie? ein W.? Der Name Ihrer Braut beginnt doch mit einem W?«
»Was für einer Braut?
»Da haben wir es! Ein netter Bräutigam, hat seine Braut vergessen! Ach, darf man denn das? Und warum verheimlichen Sie es vor mir? Ich weiß es, Puschtschin hat es mir gesagt: Sie haben in Petersburg eine wunderhübsche Braut; ihr Name beginnt mit einem W ... Vielleicht Wassilissa? Valerian und Wassilissa. Das ist ja schön; Beide Namen beginnen mit dem gleichen Buchstaben!« Sie lachte hell, scheinbar lustig, ihre Augen blickten aber traurig.
– Warum mit einem W? Ach, ja, die Freiheit,5 – erriet Golizyn und erinnerte sich der Verse:
Wir warten, Hoffnung brennt im Blute, Wann kommst du, Freiheit, hoch und hehr? So wartet nur ein Liebender Auf der Zusammenkunft Minute.
»Wissen Sie, Fürst, es kann ja auch nicht stimmen?« Sie hörte plötzlich zu lachen auf und sah ihn streng, beinahe hart an.
»Was kann auch nicht stimmen?«
»Das von der Liebe. Es ist nicht die Liebe, was vor dem ›Cho‹ retten wird.«
»Was denn?«
»Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht zu sagen. Es gibt so ein Gedicht, mein seliger Papa liebte es sehr:
Demüt'gen Herzens muß man glauben Und bis zum Tod geduldig sein...«
sagte sie leise, aber in diesem leisen Ton lag eine solche Kraft, daß Golizyn sie erstaunt ansah: Erst eben war sie ein Kind gewesen, nun war sie ein Weib ...
In diesem Augenblick fuhr der Wagen einen Abhang hinab, neigte sich auf die eine Seite und fiel beinahe um. Marinjka schrie erschrocken auf, griff nach der Armlehne ihres Sitzes und legte unwillkürlich ihre Hand auf die Golizyns. Er drückte sie fest und beugte sich dicht zu ihrem Gesicht vor. Sie rückte ein wenig weg, wollte ihre Hand zurückziehen, er ließ sie aber nicht los.
»Marie!« erklang hinter der Scheidewand die undeutliche Stimme Nina Ljwownas.
Marinjka horchte auf, gab aber keine Antwort. Und beide duckten sich im Finstern wie Kinder, die etwas anstellen.
»Sie haben über der Braue ein Schönheitspflästerchen«, flüsterte er lachend.
»Es ist kein Schönheitspflästerchen, sondern ein Muttermal«, antwortete sie mit dem gleichen lustigen Geflüster. »Als ich klein war, neckten mich alle Kinder damit: Marinjka hat ein Muttermal, Marinjka ist ein Scheusal!«
Er beugte sich noch näher vor, und sie rückte noch mehr zurück.
»Meine Liebe, Liebe!« flüsterte er so leise, daß sie es auch nicht hätte hören können, wenn sie es nicht wollte.
»Marie, où es tu donc, mon enfant?« fragte Nina Ljwowna mit schon vernehmlicher, wacher Stimme.
»Hier, Mamachen! Gleich will ich ... Da ist gerade eine Station!«
Der Wagen hielt. Im Fenster huschten rote Lichter und schwarze Schatten. Marinjka erhob sich.
»Gehen Sie nicht fort«, flüsterte Golizyn.
»Es geht nicht. Mamachen wird böse sein.«
Er hielt noch immer ihre Hand. Plötzlich führte er sie an seine Lippen und küßte sie dort, wo sonst niemand küßt: auf die innere Handfläche, die so warm, frisch und zart war, wie ein von der Sonne durchwärmter Blütenkelch.
Für die Nacht setzte sich zu ihm wie immer Palaschka, und am nächsten Morgen wieder Marinjka. Frau Tolytschowa machte keine Schwierigkeiten und erlaubte ihrer Tochter, bei ihm zu sitzen, soviel sie wollte.
Kam es daher, daß Nina Ljwowna nicht schlief und alles hören konnte, oder daher, daß Marinjka sich nach dem Gestrigen in ihr Schneckenhaus verkroch und auf der Lauer lag, – ihr Gespräch war gezwungen und unbedeutend. Sie erzählte von ihrem Leben in Tscherjomuschki. In ihrer Erzählung war alles einfach und alltäglich, aber sie mutete ihn wie ein uraltes, liebes Märchen an.
Am Ende der Lindenallee mit den Krähennestern, dicht am Rande des Abhanges über dem stillen Flüßchen Kaschirka, steht Großvaters Laube mit der halbausgelöschten Inschrift auf dem Giebel: ›Hier will ich Ruhe finden.‹ In dieser Laube las Marinjka die ›Geheimnisse von Udolpho‹ der Frau Radcliffe und die ›Leiden der Familie Ortenberg‹ des Herrn von Kotzebue. Sie las überhaupt gerne ›Gruseliges und Empfindsames‹. Aber an Winterabenden, wenn im halbfinstern Wohnzimmer das durch die vereisten Fenster dringende blaue Mondlicht sich mit dem rötlichen Schein des Lämpchens aus Mamas Schlafzimmer vermischte, sang ihre Kusine Adele zur Spinettbegleitung alte, so dumme und so zärtliche Lieder:
Klagetöne des Klavieres Drücken meinen Kummer aus...
oder:
Die Stunde schlug, wir müssen scheiden, Auf immer voneinander gehn! So laß mich weinen, laß mich leiden, Gott weiß, wann wir uns wiedersehn ... usf.
Und Marinjka weinte beim Zuhören.
Sie glaubte an alle Wahrsagekünste und Vorbedeutungen, die ihr die alte Kinderfrau Petrowna beibrachte: Wenn sie auf dem Fußboden einen Faden liegen sah oder auf dem Sande einen Kreis von der Gießkanne, so trat sie um nichts in der Welt hin. Sie wußte, daß, wenn aus dem brennenden Ofen Funken fliegen, Gäste kommen werden; wenn aber der Hahn zu einer ungewohnten Zeit kräht, so muß man ihn aus der Steige nehmen und seine Beine betasten: Sind sie warm, so kommt eine Botschaft, sind sie kalt, so gibt es eine Leiche.
Sie war eine gute Hausfrau, viel besser als die Mama. Bei ihnen in Sserpuchow ist alles billig: Das Fleisch kostet fünf Kopeken das Pfund, junge Hühner fünfzig Kopeken das Paar, Gurken – vierzig Kopeken der Scheffel. Sie verstand die Gurken so gut einzulegen, wie sonst niemand im ganzen Landkreise. Sie verstand sich auch gut auf allerlei Handarbeiten. Einmal brachte man ihnen frisch gekämmte und gewaschene feinste Schafwolle, von der, die die Schafe unten am Halse und an der Brust haben. Pelageja versteht ausgezeichnet zu spinnen, und es gab herrliche weiche Wolle, aber nur weiße, und ohne Farben kann man doch nicht sticken. Und was glauben Sie? Sie färbte die Wolle selbst, und sogar nicht einmal schlecht; einen wunderschönen Fußteppich stickte sie mit ihr.
»Tun Sie das absichtlich, Marinjka?« fragte schließlich Golizyn lachend: Er konnte sich nicht länger beherrschen.
»Was absichtlich?«
»Ich rede von der Liebe, und Sie kommen mit den eingelegten Gurken und der Schafwolle!«
Sie antwortete nichts, sie biß sich nur in die Lippe, führte einen Finger an den Mund und zeigte mit dem Kopfe dorthin, wo die Mutter saß, als hätten sie schon ein gemeinsames Geheimnis.
Worüber sie auch sprachen, in jedem Worte lag ein anderer, geheimer, wichtiger Sinn. Zuweilen verstummten sie und lächelten einander mit freudigem Erstaunen zu, wie bei einem seligen Wiedersehen nach einer langen Trennung. Und die beiden fühlten wieder wie gestern, daß sie, ob sie wollten oder nicht, einander unaufhaltsam immer näher kamen. Sie fürchtete ihn noch immer und mißtraute ihm; aber wenn er den durch die langen Wimpern ihrer gesenkten Augen schamhaft hindurchleuchtenden liebevollen Blick auffing, glaubte er, daß diese Liebkosung nicht mehr, so wie gestern, allen gelte, sondern ihm allein.
– »Was tue ich? Warum mache ich das arme junge Mädchen so verlegen?« sagte er sich zuweilen; gleich darauf vergaß er aber wieder alles, berauscht vom Duft der Liebe, der dieses liebe Mädchen umhauchte, wie die Frische des Taus den blühenden Flieder.
»Sie sollten doch Marinjka heiraten, Golizyn«, hatte ihm Puschtschin gesagt; damals hatte er es als einen Scherz aufgefaßt. »Wir wollen doch aufs Schafott, und Sie reden vom Heiraten, Puschtschin?« – »Für den Verheirateten ist es sogar lustiger, aufs Schafott zu gehen: Ihn wird wenigstens jemand beweinen. Nein, heiraten Sie doch wirklich: So erlösen Sie das Mädchen von diesem alten Gauner und Spitzbuben, dem Herrn Aquilonow.«
Der Gedanke, daß Marinjka den Aquilonow heiraten wird, war ihm selbst unangenehm. Wenn man einen Falter in einem Spinnennetz sieht, will man ihn doch vor der Spinne retten. Wie ist das aber zu machen? In Petersburg wird er doch keine Zeit für Marinjka haben: Dort erwartet ihn die Verschwörung, die Erhebung, der Sturz des Tyrannen, die Befreiung des Vaterlandes. Vielleicht wiegen aber die Schicksale der Reiche und Völker auf der Waage Gottes nicht mehr als das Schicksal einer einzelnen Menschenseele?
Was ist ihre Begegnung – ein Wink des Schicksals oder ein Zufall? Wenn sie bloß ein Zufall ist, warum dann dieses Gefühl des Wiedererkennens, des ahnungsvollen Sichbesinnens, wie in einem alten Traume? Und wenn es das Schicksal ist, warum ist er dann so fest davon überzeugt oder will davon überzeugt sein, daß er sie wohl liebgewinnen könnte, sie aber niemals liebgewinnen werde, daß er in diesem unerfüllbaren Traume von Liebe und letzter Lebensfreude für alle Ewigkeit vom Leben Abschied nehme? So geht es dem Wanderer, der in der Wüste auf der Flucht vor einem wilden Tier in einen Brunnen gesprungen ist: Er hängt an einem Ast, pflückt vom Strauche Himbeeren und verzehrt sie, ohne an das drohende Ende zu denken.
Während er ihr so lebendiges Gesicht betrachtete, gedachte er eines andern, toten Gesichtes; beim Scheine der bei Tageslicht so düster leuchtenden Kerzen, im weißen Brautkleid, die feine, schlanke, wie ein abgeschossener Pfeil davonfliegende sechzehnjährige Ssofja Naryschkina6 im Sarge.
Wo ich sei, und wo mich hingewendet, Als mein flücht'ger Schatten dir entschwebt? Hab ich nicht beschlossen und geendet, Hab ich nicht geliebet und gelebt? Ob ich den Verlorenen gefunden? Glaube mir, ich bin mit ihm vereint, Wo sich nicht mehr trennt, was sich verbunden, Dort, wo keine Träne wird geweint. Wort gehalten wird in jenen Räumen Jedem schönen, gläubigen Gefühl...
Sie hatte Wort gehalten und wird auch jetzt Wort halten. Jene erste Liebe ist auch die letzte. Selbst wenn er Marinjka liebte, würde er Ssofja nicht untreu werden. Beide zusammen, die irdische und die himmlische. Wie Himmel und Erde an ihrer letzten Grenze eins sind, so sind es auch Ssofja und Marinjka.
Am Morgen des dritten Tages näherte sich der Wagen Petersburg. Als sie die letzte Station Pulkowo hinter sich hatten, wehte vom Meere her ein warmer Hauch; das vereiste Fensterchen taute auf, es fing gleichsam zu weinen an, und durch die Tränen hindurch schimmerte eine traurige schneeverwehte Ebene, übersät mit sumpfigen Hügeln, wie mit Gräbern eines Riesenfriedhofs. Und am Rande der weißen Ebene lagen schwarze Punkte – das war Petersburg.
»Nun, leben Sie wohl, Fürst«, sagte Marinjka. »Wir sind gleich da. Ich fahre zum Bräutigam, und Sie zur Braut ... Werden Sie sich meiner erinnern?«
Er küßte ihr stumm die Hand, wieder auf die Handfläche, die so warm, frisch und zart war, wie ein von der Sonne durchwärmter Blütenkelch.
»Werden Sie uns in Petersburg aufsuchen?« fragte sie leise.
»Ja.«
»Und wenn die Braut Sie nicht fortläßt?«
»Ich habe ja gar keine Braut.«
»Wirklich?«
»Wirklich.«
»Ihr Ehrenwort?«
»Mein Ehrenwort. Und Sie, Marinjka, haben keinen Bräutigam?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch keinen.«
Und sie lächelten wieder stumm einander zu, – sie besannen sich aufeinander und erkannten einander. ›Ich könnte dich lieben‹, sprach sein tiefer Blick. ›Auch ich könnte es!‹ antwortete sie mit einem gleichen Blick.
»Marie, was ist denn? Mach dich fertig, es ist Zeit. Palaschka, wo sind die Reisepässe? Wo hast du sie wieder hingetan? Ach, du abscheuliches Mädel!« brummte die Mama.
Nun kamen lange Zäune, Gemüsegärten, Hütten, Läden und Herbergen. Endlich hielt der Wagen vor einem kleinen niederen Gebäude mit gelbgetünchten, noch mit dem Sommerschmutz bespritzten Wänden und zwei gestreiften Schilderhäuschen zu beiden Enden des Schlagbaumes.
Der Wagenschlag wurde aufgemacht, und ein schnurrbärtiger Invalide blickte hinein. Der Wachoffizier visierte die Reisepässe und kommandierte dem Posten: »Heb den Schlagbaum!« Der Schlagbaum ging in die Höhe, und die ›Neleschance‹ hielt ihren Einzug in Petersburg.
1. Golizyn, Fürst Valerian Michailowitsch, Kammerjunker, Neffe des Fürsten Alexander Nikolajewitsch (1774-1844), wurde nach Sibirien verschickt, kam dann nach dem Kaukasus, starb 1859 amnestiert zu Petersburg. Anm. d. Übers.
2. Puschtschin, Iwan Iwanowitsch (1789-1859), Dichter, Freund und Studiengenosse Puschkins, wurde nach Sibirien verschickt und 1856 amnestiert. Anm. d. Übers.
3. Vom russischen ›ne leschat‹ (nicht liegen) abgeleitet. Anm. d. Übers.
4. Labsin, Alexander Fjodorowitsch (1766-1825), Mystiker und Herausgeber des ›Zionsboten‹. Anm. d. Übers.
5. Das russische Wort für Freiheit beginnt mit einem W. Die Verse sind von Puschkin. Anm. d. Übers.
6. Naryschkina, Ssofja, natürliche Tochter Alexanders I. und seiner Geliebten Maria Naryschkina; starb jung als Braut Valerian Golizyns. Anm. d. Übers.
Zweites Kapitel
Vom 27. November 1825 an, als man vom Ableben des Kaisers Alexander I.7 erfuhr, wurde es in Petersburg ungewöhnlich still. Alles verstummte und erstarb, hielt gleichsam den Atem an. Die Theater waren geschlossen; bei den Wachtparaden durfte keine Musik spielen; die Damen legten Trauer an; in den Kirchen wurden Seelengottesdienste abgehalten, das traurige Glockengeläute schwebte von früh bis spät über der Stadt.
Rußland leistete den Treueid Konstantin I. Die Ukase wurden mit seinem Namen gezeichnet; in der Münze prägte man Rubel mit seinem Bildnisse; in den Kirchen wurde für ihn gebetet. Man erwartete ihn von Tag zu Tag, aber er kam nicht, und in der Stadt gingen allerlei Gerüchte. Die einen sagten, er hätte auf den Thron verzichtet die andern, er hätte eingewilligt; aber die Wahrheit blieb unbekannt.
Zur Beruhigung der Hauptstadt wurde bekanntgegeben, daß die Kaiserin-Witwe einen Brief bekommen hätte, in dem seine Majestät seine baldige Ankunft in Aussicht stellte; dann, daß der Großfürst Michail Pawlowitsch8 ihm schon entgegengefahren sei. Aber die beiden Nachrichten erwiesen sich als falsch.
Die Kuriere rasten aus Petersburg nach Warschau und aus Warschau nach Petersburg; die Brüder tauschten Briefe aus, aber die Lage klärte sich nicht.
»Es wäre Zeit, diesem Austausch von Liebenswürdigkeiten ein Ende zu machen«, brummten die Würdenträger.
»Wann werden wir endlich erfahren, wer bei uns Kaiser ist?« entrüstete sich Kaiserin Maria Fjodorowna,9 der die Geduld riß.
»Wir haben auf dem Throne einen Sarg stehen«, tuschelten die treuen Untertanen mit stillem Entsetzen.
Am Tage nach der Vereidigung erschienen in den Schaufenstern der Läden auf dem Newskij-Prospekt Bildnisse des neuen Kaisers Die Leute drängten sich vor den Fenstern. Auf den Bildern sah er häßlich aus, in Wirklichkeit war er aber noch häßlicher. Er war stutznäsig wie Paul I.; hatte große, trübblaue, hervorquellende Augen, gerunzelte Brauen aus dichten Büscheln hellblonder Haare; die gleichen Haarbüschel über dem Nasenrücken; in Augenblicken des Zornes sträubten sie sich wie Borsten; lange Arme, die wie bei einem Affen bis unter die Knie reichten; man hatte den Eindruck, daß er auch auf allen Vieren gehen könne. Er glich ganz einem großen menschenähnlichen Affen. Man erinnerte sich, wie sich die Großmutter, Kaiserin Katharina die Große, über das zügellose und ehrlose Benehmen des Enkels beklagte: »Überall, sogar auf der Straße benimmt er sich so unanständig, daß ich immer erwarte, jemand werde ihn verprügeln. Ich begreife gar nicht, wie er zu diesem gemeinen Sansculotismus kommt, der ihn vor allen erniedrigt.«
Seine Briefe an seinen Lehrer, den Franzosen de Laharpe unterschrieb er mit »L'âne Constantin«. Aber er war gar nicht dumm; er stellte sich nur närrisch, damit man ihn mit der Krone in Ruhe lasse. »Despotischer Sturmwind« nannte man ihn in seiner Umgebung. Bei einer Truppenparade scheute einmal sein Pferd. Er zog seinen Pallasch und richtete damit das Tier so zu, daß es beinahe verendete. So ein Pferd sollte nun Rußland sein, Konstantin aber sein rasender Reiter. Man hoffte übrigens, daß er »aus angeborenem Ekel« auf die Regierung verzichten werde.
»Man wird mich erdrosseln, wie man meinen Vater erdrosselt hat«, pflegte er mit einem gehässigen Lächeln zu sagen. »Ich kenne euch, Kanaillen: Jetzt schreit ihr Hurra, wenn man mich aber auf die Richtstätte führt und euch fragt, ob man mich hinrichten soll, werdet ihr alle schreien: ›Ja!‹«
Man erzählte sich, daß es ihm, als er das Manifest von seiner Thronbesteigung las, so schlecht wurde, daß man ihn zur Ader lassen mußte.
»Wollen die Narren mich vielleicht zum Zaren anwerben, wie man Rekruten anwirbt?« schrie er in seiner Wut. »Ich will nicht! Ihr habt euch selbst die Suppe eingebrockt, löffelt sie auch selbst aus.«
Als man es in Petersburg hörte, entrüstete man sich allgemein.
»Man darf doch nicht mit der Thronfolge wie mit einem Privateigentum spielen«, sagten die einen.
»Warum denn nicht?« entgegneten die andern. »In Rußland darf man alles. Wir sind ja feig. Wenn man uns nur mit Arrest auf der Hauptwache droht, so fügen wir uns gleich.«
»Wollen wir wetten, wem die Hammel zufallen?« fragten die Witzlinge.
»Was für Hammel?« »Wir. Treibt man uns denn nicht von einem Treueid zum andern wie eine Hammelherde?«
Man diskutierte auch die Frage, wer besser sei: Konstantin10 oder Nikolai.
Kaiser Paul I.11 hatte Nikolai im Alter von fünf Monaten zum Chef der Leibgarde-Kavallerie mit dem Range eines General-Leutnants ernannt. Der Junge schlug, noch ehe er gehen lernte, die Trommel und fuchtelte mit seinem kleinen Säbel. Als er größer wurde, sprang er oft nachts aus dem Bett, um mit dem Gewehr Posten zu stehen. Er hatte außer für Soldaten für nichts Interesse. Der Erzieher der Großfürsten, Lamsdorff,12 schlug die Jungen mit einem Ladestock auf die Köpfe, so daß sie bewußtlos wurden. »Gott verzeihe ihm die dürftige Erziehung, die wir erhalten haben«, pflegte später Nikolai selbst zu sagen.
Niemals hatte er an die Thronfolge gedacht; bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahre übte er auch gar keine Amtstätigkeit aus, und seine ganze Weltkenntnis stammte aus den Antichambres und dem Sekretärzimmer im Schlosse. ›Rasend wie Pawel und rachsüchtig wie Alexander.‹ Allerdings klug; aber seine Klugheit fürchtete man noch mehr: je klüger, umso bösartiger.
Er war im preußischen Militärstatut vollkommen bewandert und überhaupt ein Deutscher. Man prophezeite, daß nach seiner Thronbesteigung die Deutschen Rußland, das schon ohnehin ein ›beinahe erobertes Land‹ war, gänzlich überschwemmen würden.
Konstantin ist ein Tier, Nikolai eine Maschine. Was ist besser: Tier oder Maschine?
7. Alexander I. (1777-1825), nach dem gewaltsamen Tode seines Vaters Paul I. (am 11. März 1801) Kaiser von Rußland. Da er nach seinem am 1. Dezember 1825 zu Taganrog erfolgten Tode keinen Erben hinterließ, sollte der Thron an seinen ältesten Bruder Konstantin übergehen, der jedoch zugunsten des folgenden Bruders Nikolai, ohne Wissen des letzteren, verzichtet hatte. Die aus diesem Umstände in den ersten Dezembertagen 1825 entstandene Verwirrung wurde von einem Fähnlein Freiheitsschwärmer – später Dekabristen (Dezembermänner) genannt – zu einem Aufstand ausgenützt. Anm. d. Übers.
8. Michail Pawlowitsch (1798-1849) Großfürst, jüngster Sohn Pauls I., Oberbefehlshaber der Artillerie. Anm. d. Übers.
9. Maria Fjodorowna (1759-1829), Kaiserin-Witwe, Mutter Alexanders. Anm. d. Übers.
10. Konstantin, Großfürst, zweiter Sohn Pauls I. (1779-1831), galt bei Lebzeiten Alexanders I. als Thronfolger; Statthalter in Polen; floh 1831 während des Aufstandes aus Warschau und starb zu Witebsk an der Cholera. Anm. d. Übers.
11. Paul I., geb. 1745, Sohn Katharina der Großen und (angeblich) Peters III., Kaiser 1796-1801 (wohl die traurigste Periode der russischen Geschichte); wurde in der Nacht auf den 11. März 1801, wohl mit Wissen der Familie, ermordet. Anm. d. Übers.
12. Lamsdorf, Graf Matwej Iwanowitsch (1745-1828), Gouverneur von Kurland, später Erzieher der Großfürsten Konstantin und Nikolai. Anm. d. Übers.
Drittes Kapitel
Im Saale des Reichsrates im Winterpalais, zwischen dem Generaladjutantenzimmer und den provisorischen Gemächern des Großfürsten Nikolai Pawlowitsch, war es um acht Uhr früh noch so finster wie in der Nacht. Die hohen, auf den Hof hinausgehenden Fenster gähnten schwarz und undurchdringlich. Der schwarzgelbe Nebel schien wie ein beißender, erstickender Rauch durch die Fenster und Mauern einzudringen. Die Wachskerzen, die in schweren Kandelabern auf dem langen, mit grünem Tuch bedeckten Tische mit trüben Flammen brannten, beleuchteten nur die Mitte des Saales, während die Winkel im Dunkel verschwanden; zwei große einander gegenüberhängende Bildnisse von Katharina II. und Alexander I. traten geheimnisvoll und durchsichtig aus dem Dunkel hervor, und Großmutter und Enkel schienen sich mit dem gleichen schelmischen und spöttischen Ausdruck zuzulächeln.
Die alten Würdenträger in Puderperücken, Escarpins und goldgestickten Uniformen irrten wie Schatten umher, traten zueinander, tuschelten und flüsterten. In der finstersten Ecke saßen aber stumm und unbeweglich wie drei leblose Statuen drei dem Grabe entstiegene Tote: der siebzigjährige Minister des Innern Lanskoi,13 der achtzigjährige Minister für Volksaufklärung Schischkow14 und der General Araktschejew,15 der unsterblich und ohne Alter schien. Nach der Ermordung der Nastasja Minkina war er heute zum ersten Male bei Hofe erschienen.
»Der Tod des Mädels nahm ihm jede Fähigkeit, sich mit Staatsgeschäften zu befassen, aber das Hinscheiden des Kaisers gab ihm diese Fähigkeit wieder«, sagte man von ihm.
Alle wußten schon, daß aus Warschau ein Kurier mit dem endgültigen Verzicht des Thronfolgers angekommen war und daß heute das Manifest von der Thronbesteigung Nikolais I. unterzeichnet werden sollte. Man erwartete von Minute zu Minute den Fürsten Alexander Nikolajewitsch Golizyn16 mit der Reinschrift des Manifestes. Sooft die Tür aufging, blickten alle hin, ob er es schon sei.
Ein schlanker, ehrwürdiger, schöner Greis mit ergrauten Haaren, die heraufgekämmt waren, um die Glatze zu verdecken, mit einem länglichen, feinen, blassen Gesicht und zwei schmerzlichen Falten am Munde, in denen Melancholie und Empfindsamkeit lagen, – ganz still, sanft, herbstlich und abendlich – Nikolai Michailowitsch Karamsin,17 stand am Kamin und wärmte sich. Alle diese Tage war er krank. »Meine Nerven beben furchtbar. Alles ermüdet mich wie ein kleines Kind«, klagte er. Der Tod des Kaisers hatte ihn wie der Tod eines Freundes, eines geliebten Bruders, getroffen; noch schmerzlicher berührte ihn die Gleichgültigkeit aller gegen diesen Tod. »Alle denken nur an sich, an Rußland denkt niemand.« Alles verletzte, quälte und beleidigte ihn; er wollte grundlos weinen. Er kam sich wie die alte »Arme Lisa« vor. Nikolai beauftragte ihn, das Manifest von seiner Thronbesteigung zu verfassen. Sein Entwurf gefiel aber nicht. »Möge Rußland die Glückseligkeit friedlicher Bürgerfreiheit und der Ruhe unschuldiger Herzen genießen«, – diese Worte gefielen nicht; er mußte sie ändern; er änderte den Satz ab, aber auch die neue Fassung gefiel nicht. Mit der Abfassung des Manifestes wurde nun Speranskij18 betraut.
Karamsin fühlte sich gekränkt, blieb aber dennoch im Palais. Er sprach von den Gründen der allgemeinen Unzufriedenheit und von den Maßregeln, die man zum Wohle des Vaterlandes ergreifen sollte.
Niemand aber hörte auf ihn, und er verstummte und trat zur Seite. »Das Leben ist zu Ende, zu Ende! Es ist Zeit zu sterben!« So lachte und weinte er über die alte »Arme Lisa«.
Am Kamin stehend, beobachtete er alles mit traurigen und nachdenklichen Blicken. »Ich sehe auf alles wie auf fliehende Schatten«, pflegte er zu sagen.
In der Nähe flüsterten zwei greise Würdenträger.
»Wir werden Sie doch hoffentlich nicht verlieren?« fragte der eine.
»Gott allein weiß, was mit uns sein wird«, antwortete der andere achselzuckend. »Neulich setzte uns Pjotr Petrowitsch beim Souper Champagner vor. ›Trinken wir‹, sagte er, ›man weiß nicht, ob wir morgen noch leben.‹«
»Euer Exzellenz trauern noch immer?« wandte sich an Karamsin der Ober-Kammerherr Alexej Ljwowitsch Naryschkin;19 er strahlte in Gold und Brillanten und hatte ein majestätisch freundliches und unbedeutendes Gesicht mit dem gezierten Lächeln der alten Würdenträger vom Hofe Katharinas. Er war ein lustiger Patron und scherzte selbst dann, wenn es den andern gar nicht zum Scherzen war.
»Nicht ich allein, ganz Rußland...« begann Karamsin.
»Lassen wir lieber Rußland aus dem Spiel«, unterbrach ihn Naryschkin mit einem feinen Lächeln. »Vorhin, während des Trauergottesdienst waren die Droschkenkutscher auf dem Schloßplatz gar zu übermütig geworden. Man schickte jemand hinaus, um ihnen zu sagen, sie sollten sich doch schämen zu lachen, wo alle den Verstorbenen beweinen. »Was sollen wir ihn beweinen?« sagten sie darauf: »Er hat lange genug regiert, nun ist's genug!« Da haben Sie Ihr Rußland!« – Das bleiche Gesicht Karamsins flammte auf.
»Ich wage zu hoffen, Exzellenz, daß sich in Rußland noch Menschen finden, die die Schuld des Dankes bezahlen...« »Hören Sie auf, mein Lieber, wer zahlt heute seine Schulden? Was mich betrifft, so werde ich erst auf dem Sterbebette sagen: C'est la première dette, que je paye à la nature!« antwortete Naryschkin lachend.
»Macht man denn so eine so wichtige Sache? Sie haben alle Papiere durcheinandergebracht! Sie haben keinen Zaren im Kopfe«20 schrie ein böser Zwerg mit einem Kalmückengesicht – der Justizminister Iobanow-Rostowskij – den stellvertretenden Staatssekretär Olenin an, der an eine altersgraue Ratte erinnerte.
»Was sagt er: Man hat keinen Zaren?« fragte Fürst Lopuchin, Präsident des Reichsrates und des Ministerkomitees, Ritter des Großkreuzes des Malteserordens, der sich verhört hatte. Er war ein schlanker, großer und majestätischer Greis, geschminkt und gepudert, mit einem künstlichen Gebiß und dem Lächeln eines Satyrs. Er litt an Schwerhörigkeit, die in den letzten Tagen infolge der Aufregung noch stärker geworden war.
»Er hat gesagt, Olenin hätte keinen Zaren im Kopf!« schrie ihm Naryschkijn ins Ohr. »Was haben Sie denn geglaubt?«
»Ich glaubte, Rußland hätte keinen Zaren.«
»Ja, vielleicht hat auch Rußland keinen«, versetzte Naryschkin mit dem gleichen feinen Lächeln. »Am erstaunlichsten ist aber dieses, meine Herren: Es ist wohl schon einen Monat her, daß wir ohne einen Zaren sind, und dabei geht alles doch ebenso gut oder schlecht seinen Gang wie früher.«
»Immer noch dieser Unsinn! Man spielt noch immer Ball!« fuhr Lobanow21 zu schreien fort.
»Was für ein Ball?« fragte Lopuchin, der wieder nichts verstanden hatte.
»Na, das kann man ihm nicht ins Ohr schreien«, bemerkte Naryschkin abwehrend. Dann wandte er sich leise an Karamsin: »Haben Sie das vom Ball schon gehört?«
»Nein.«
»Pendant quinze jours on joue la couronne de Russie au ballon en se la renvoyant mutuellement, – diesen Witz machte neulich der französische Gesandte Laferonnais. Der Witz ist gar nicht übel, wird aber wohl kaum in die Geschichte des Russischen Reiches aufgenommen werden!«
Lopuchin lauschte gespannt hin; als er den Namen Laferonnais hörte, begriff er wohl, wovon die Rede war, und fing ebenfalls zu lachen an, wobei die gleichmäßigen weißen Zähne seines künstlichen Gebisses sichtbar wurden und aus seinem Munde ein Hauch von Moder kam wie aus dem einer Leiche.
»Nun, was macht Ihr Rheumatismus, Nikolai Michailowitsch?« fragte mit angenehmer, heiserer Stimme ein etwa sechzigjähriger Mann in einem ziemlich abgetragenen Frack mit zwei Ordenssternen, mit einem Kranz grauer Locken um den kahlen Schädel, einem fast milchweißen Gesicht und blauen, feuchten, sich langsam bewegenden Augen. Es war Michail Michailowitsch Speranskij. »Mir aber setzen die Hämorrhoiden furchtbar zu!« fuhr er fort, ohne eine Antwort abzuwarten. Darauf holte er aus seiner Dose mit zwei langen Fingern seiner ungewöhnlich vornehmen Hand eine Prise Laferme-Tabak, stopfte sie in die Nase, wischte diese mit einem rotseidenen Tuch von zweifelhafter Sauberkeit ab – in bezug auf saubere Wäsche war er etwas geizig – und sprach mit einem selbstzufriedenen Lächeln: »Was wäre ich für ein Kerl, wenn ich nicht Tabak schnupfte!«
»Nun, ist das Manifest fertig, Exzellenz?« fragte Karamsin, der ihm zu verstehen geben wollte, daß er sich nicht verletzt fühle und ihn nicht beneide.
Speranskij richtete auf ihn langsam seine Augen und antwortete mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln auf den feinen Lippen:
»Ach, sprechen Sie nicht davon! Das Manifest wächst mir schon zum Halse heraus! Wie soll man das Notwendige sagen, wie soll man dem Volke die Familienabmachungen erklären? Nikolai verzichtet zugunsten Konstantins, und Konstantin zugunsten Nikolais.22 Nicht hin und nicht her.«
»Was sollte man denn machen?«
»Das Testament nicht öffnen, und die ganze Suppe nicht einbrocken.«
»Sich über den Willen des Toten hinwegsetzen?«
»Tote haben keinen Willen.«
»Es sind grausame Worte, Exzellenz!«
»Grausame Worte sind besser als grausame Taten. Man darf nicht mit der legitimen Thronfolge wie mit einem Privateigentum spielen. Wenn der verstorbene Kaiser sein Vaterland, das ihm im Jahre 1812 so unwiderlegbare Beweise seiner Ergebenheit geliefert hat, nur einigermaßen liebte, wie konnte er dann Rußland in eine solche Lage versetzen... Aber was soll man noch reden! Die letzten zehn Jahre übertreffen alles, was wir vom eisernen Zeitalter gehört haben... Vielleicht ist aber auch »alles zum Besten«, wie Euer Exzellenz zu sagen belieben.«
Karamsin schwieg. Die Kränkung für seinen Freund, seinen geliebten Bruder, brannte ihm auf dem Herzen, und er hielt nur mit Mühe die Tränen zurück. Er lehnte sich gegen den Marmor des Kamins, ließ den Kopf sinken und bedeckte die Augen mit der Hand.
»Ist Ihnen nicht ganz wohl, Exzellenz?« fragte Speranskij.
»Ja, ich habe Kopfweh. Wahrscheinlich sind es die Nerven. Meine Nerven sind immer erregt...«
»Das haben heute alle. Es kommt vom Wetter«, versetzte Speranskij. »Kennen Sie übrigens ein ausgezeichnetes Mittel zur Kräftigung der Nerven? Statt Tee eine kalte Abkochung aus Millefolium mit bitteren Kamillen.«
»Millefolium, Millefolium...« wiederholte Karamsin mit einem schmerzlichen Lächeln; in diesem Worte lag etwas unangenehm süßliches, ekelerregendes, und es blieb ihm wie ein nicht heruntergeschlucktes Klümpchen in der Kehle stecken. Und es schien ihm, daß auch Speranskij selbst, mit seinem erstaunlich weißen, fast milchweißen, Gesicht und den feuchten, blaßblauen Augen, den »Augen eines verendenden Kalbes« ganz wie Millefolium sei.
Er machte eine Anstrengung, schluckte das Klümpchen hinunter und nahm die Hände von den Augen.
»Ja, alles ist zum Besten, Exzellenz, wenn auch nicht im Sinne dieser Welt«, versetzte er mit einem stillen Lächeln. »Es gibt einen Gott, also können wir ruhig sein.«
»Sie haben recht, Nikolai Michailowitsch, wir können ruhig sein«, entgegnete Speranskij lächelnd. »Ich habe immer gesagt: Dei providentia et hominum confusione Ruthenia ducitur.«
»Wie? Was haben Sie gesagt?«
»Rußland wird durch Gottes Vorsehung und menschliche Dummheit geleitet.«
Karamsin schloß wieder die Augen. Er wollte weinen und zugleich lachen.
»Wir sind beide nett«, dachte er sich, »in einem solchen Augenblick, wo sich das Schicksal des Vaterlandes entscheiden soll, weiß der russische Gesetzgeber nichts anderes zu tun, als zu lachen, und der russische Historiker nichts anderes – als zu weinen. Das Leben ist zu Ende! Es ist Zeit zu sterben, alte »Arme Lisa«!«
Die Türe zum Generaladjutantenzimmer ging auf, und alle sahen wieder hin. Mit einem großen Portefeuille in der Hand, kam der kleine, dicke, kugelrunde Fürst Alexander Nikolajewitsch Golizyn ins Zimmer gerollt.
»Nun, ist das Manifest fertig?« wandten sich alle an ihn.
»Was für ein Manifest?« fragte er, als verstünde er nichts.
»Aber, Durchlaucht, die ganze Stadt weiß es!«
»Um Gottes Willen, meine Herren, es ist ein Staatsgeheimnis!«
»Schon recht, wir werden es nicht verraten. Sagen Sie nur das eine: Ist es fertig?«
»Es ist fertig. Kommt gleich zur Unterschrift.«
»Gott sei Dank!« Alle atmeten erleichtert auf.
In der dunklen Ecke regten sich die drei gebrechlichen Schatten. Araktschejew schlug langsam ein Kreuz.
Aber am gegenüberliegenden Ende des Saales ging eine andere Tür auf, die zu den provisorischen Gemächern des Großfürsten Nikolai Pawlowitsch führte, und der Generaladjutant Benkendorf23 glitt sporenklirrend über das Parkett wie über Eis, leicht, beschwingt, flatternd; man hätte glauben können, daß er an Händen und Füßen kleine Flügel habe wie Gott Merkur. Glatt, adrett, sorgfältig gewaschen und rasiert, funkelnd wie eine neue Münze. Jung unter den Alten, lebendig unter den Toten. Bei seinem Anblick begriffen alle, daß das Alte zu Ende sei und daß etwas Neues beginne.
Der Morgen kam. Der erste Tag der neuen Regierung, ein schrecklicher, finsterer, nächtlicher Tag brach an. In den schwarzen Fensteröffnungen dämmerte allmählich ein fahles Licht, und auch die Gesichter erschienen fahl wie bei Leichen. Es war, als müßten die gebrechlichen Schatten zu Staub zerfallen, wie Rauch verschwinden, so daß nichts zurückbliebe.
13. Lanskoi, Graf Ssergej Stepanowitsch (1787-1862), Minister des Innern, nahm großen Anteil an den liberalen Bestrebungen Alexanders I. in der ersten Periode seiner Regierung. Anm. d. Übers.
14. Schischkow, Alexander Ssemjonowitsch (1753-1841 ), Admiral, Präsident der Akademie, Minister für Unterricht. Dichter und Philologe, äußerst reaktionär. Anm. d. Übers.
15. Araktschejew, Graf Alexej Andrejewitsch (1769-1834), Jugendfreund und Kriegsminister Alexanders I., war in der zweiten Regierungshälfte des letzteren der eigentliche Beherrscher Rußlands. Wurde von Nikolai I. entlassen. Anm. d. Übers.
16. Golizyn, Fürst Alexander Nikolajewitsch (1774-1844), Jugendfreund Alexanders I., Oberprokurator des Synods, 1817-24 Minister für Kultus und Unterricht. Anm. d. Übers.
17. Karamsin, Nikolai Michailowitsch (1766-1826), bedeutender Historiker und Dichter, kaiserlicher Hof-Historiograph, extrem-konservativ. Berühmt war seine Novelle ›Die arme Lisa‹. Anm. d. Übers.
18. Speranskij, Michail Michailowitsch (1772-1839), Freund Alexander I. und bedeutender Staatsmann, nahm großen Anteil an den Reformbestrebungen dieses Kaisers, geriet 1812 in Ungnade und wurde verbannt; 1816 wieder begnadigt. Wurde von Nikolai I. mit der Schaffung eines Gesetzbuches betraut und bekam von ihm den Grafentitel. Anm. d. Übers.
19. Naryschkin, Alexander Ljwowitsch (1760-1826), Oberhofmarschall, Direktor der kaiserlichen Theater. Seine Frau, Maria Antonowna, war Geliebte Alexanders I. Anm. d. Übers.
20. Russische Redensart, soviel wie: nicht bei Trost sein. Anm. d. Übers.
21. Lobanow-Rostowskij, Fürst Dmitrij Iwanowitsch (1758-1838), General, war 1817-27 Justizminister. Anm. d. Übers.
22. Konstantins, Nikolais usw., geborene Prinzessin von Württemberg, 1776 mit Paul I. vermählt. Anm. d. Übers.
23. Benkendorf, Graf Alexander Christoforowitsch (1783-1844), Generaladjutant Alexanders I., unter Nikolai I. allgewaltiger Chef der Gendarmerie. Anm. d. Übers.
Viertes Kapitel
»Stabshauptmann in der Adelskompagnie der Leibgarde, Romanow III – Schmatz!« so pflegte der Großfürst Nikolai Pawlowitsch in seiner Jugend scherzweise die Billets an seine Freunde und auch Regimentsbefehle zu unterschreiben; dasselbe pflegte er manchmal zu sagen, wenn er allein im Zimmer vor dem Spiegel stand.
Am finsteren Morgen des 13. Dezember saß er am Rasiertischchen vor dem von zwei Wachskerzen flankierten Spiegel; er warf einen Blick auf sein Spiegelbild und sprach den gewohnten Gruß:
»Stabshauptmann Romanow III, untertänigsten Respekt Eurem Wohlgeboren – Schmatz!«
Er wollte noch hinzufügen: ›Braver Kerl‹ sagte es aber nicht, sondern dachte sich: ›So mager und blaß bin ich geworden. Der arme Nixe! Armer Kerl! Pauvre diable, je deviens transparent!‹
Mit seinem Äußeren war er überhaupt zufrieden. ›Apollo von Belvedere‹ nannten ihn die Damen. Trotz seiner siebenundzwanzig Jahre war er noch immer so schmächtig wie ein Knabe. Lang, biegsam und schlank wie eine Weidenrute. Ein schmales Gesicht, ganz Profil. Ungewöhnlich regelmäßige, wie aus Marmor gemeißelte, aber unbewegliche und starre Züge. »Wenn er ins Zimmer tritt, so sinkt im Thermometer das Quecksilber«, hatte von ihm jemand gesagt. Dünne, leicht gelockte, rotblonde Haare; ebensolche Koteletts an den eingefallenen Wangen; tiefliegende, dunkle, große Augen; eine geschwungene Nase; eine steil abfallende, gleichsam abgeschnittene Stirn; vorstehender Unterkiefer. Sein Gesichtsausdruck war so, als ob er immer schlechter Laune wäre: als sei er gegen jemand aufgebracht, oder als hätte er Zahnschmerzen. »Ein Apollo, der Zahnweh hat« – dieser Scherz der Kaiserin Jelisaweta Alexejewna fiel ihm ein, als er sein mürrisches Gesicht im Spiegel erblickte; es fiel ihm auch ein, daß er diese ganze Nacht vor Zahnweh nicht hatte schlafen können. Er befühlte den Zahn mit dem Finger – er tut weh; daß nur die Backe nicht anschwillt. Soll er denn den Thron mit einer geschwollenen Backe besteigen? Er ärgerte sich noch mehr und wurde ganz böse.
»Dummkopf, wie oft hab ich dir schon gesagt, daß du den Seifenschaum ordentlich schlagen sollst!« schrie er den Generaladjutanten Wladimir Fjodorowitsch Adlerberg, oder einfach ›Fjodorytsch‹ an, der bei ihm auch das Amt eines Kammerdieners versah. »Auch das Wasser ist kalt! Das Messer ist stumpf!« Er schob den Napf weg und warf das Rasiermesser auf den Tisch.
Fjodorytsch machte sich stumm mit dem Rasierzeug zu schaffen. Schwarz, voll und weich wie Watte, erweckte er den Eindruck eines plumpen Bären, war aber in Wirklichkeit flink und geschickt.
»Nun, wie hat Saschka geschlafen?« fragte Nikolai, als er sich ein wenig beruhigt hatte.
»Seine Hoheit der Thronfolger haben ausgezeichnet geschlafen«, antwortete Adlerberg. »Seit heute früh weint er aber, weil er nicht mehr im Anitschkin-Palais ist und seine Pferdchen nicht mehr hat.«
»Was für Pferdchen?«
»Die Holzpferdchen; sie sind im Anitschkin-Palais geblieben.«
»Nein, er beweint nicht die Pferdchen, sondern seinen unglücklichen Vater. Er ahnt wohl Unheil«, dachte sich Nikolai.
»Wo geruhen Hoheit heute das Diner einzunehmen?« fragte Adlerberg.
»Im Anitschkin-Palais, Fjodorytsch, zum letzten Male im Anitschkin-Palais!« antwortete Nikolai mit einem Seufzer.
Es fiel ihm ein, wie er sich einst danach sehnte, »sich ins Privatleben zurückzuziehen« und in der Einsamkeit die Freuden des Familienlebens zu genießen. »Wenn dich jemand fragt, in welchem Winkel der Welt das wahre Glück wohnt, so tue ihm den Gefallen und schicke ihn ins Anitschkinsche Paradies«, pflegte er seinem Freund Benkendorf mit der gefühlvollen Miene zu sagen, die er von seiner Mutter, der Kaiserin Maria Fjodorowna, geerbt hatte.
Nach dem Tode seines Bruders Alexander war er aus dem Anitschkin-Palais ins Winterpalais gezogen und wohnte hier in strenger Abgeschlossenheit, wie unter Arrest, da er es für »unpassend« hielt, sich öffentlich zu zeigen. Er richtete sich ein Arbeits- und Schlafzimmer in der neben dem Saale des Reichsrates gelegenen Bibliothek ein, in den einstigen Gemächern des Königs von Preußen, in einem Zimmer, das durch einen dunklen Korridor mit dem Reichsratssaale verbunden war.
Er wohnte hier wie auf einem Biwak. Das Zimmer war rund, ganz ohne Ecken. Das schmale Feldbett stand ungemütlich neben einem der Glasschränke; die Ledermatratze war mit Heu gefüllt: An dieses spartanische Lager hatte ihn die Großmutter gewöhnt. Auf dem Boden lag der offene Reisekoffer mit noch nicht ausgepackten Kleidern und Wäsche. Der einzige Luxusgegenstand in diesem Zimmer war ein Toilettentisch aus Mahagoni. Auf den Fächern vor dem Spiegel lagen Bürsten und Kämme und stand ein Fläschchen Parfüm de la Cour; gleich daneben waren auf einem eigenen Gestell Gewehre, Pistolen, Säbel, Degen und ein Cornet-à-pistons untergebracht.
Als er mit dem Rasieren fertig war, zog er den alten Uniformmantel, der ihm als Morgenrock diente, aus und legte die dunkelgrüne Generalsuniform des Ismailowschen Regiments mit rotem Unterfutter und goldgesticktem Eichenlaub an.
Vor dem Spiegel stehend, zog er sich so lange, langsam und sorgfältig an wie eine junge Schöne für den ersten Ball. Er betrachtete und ordnete jedes Fältchen; mit Adlerbergs Hilfe knöpfte er alle Knöpfe zu und schloß alle Haken und Ösen. In der Uniform wurde er noch länger und schlanker und bekam eine gewölbte Brust und eine Wespentaille – ganz wie ein preußischer Korporal –: Er könnte gleich zur Potsdamer Wachtparade gehen.
Nach dem Ankleiden verließ Fjodorytsch das Zimmer, und Nikolai kniete vor dem Heiligenbilde nieder. Er bekreuzigte sich schnell, nur wenig mit der Hand ausholend, und verneigte sich so, daß seine Stirne den Boden berührte. Nachdem er die festgesetzten Gebete gesprochen hatte, wollte er auch etwas aus dem eigenen hinzufügen. Aber es fiel ihm nichts ein: Er hatte keine eigenen Worte. Er glaubte an Gott; wenn er aber an ihn dachte, stellte er sich nur ein schwarzes Loch vor, wo es »streng und etwas unheimlich« ist, wie Kaiser Paul I. von der Disziplin in der russischen Armee zu sprechen pflegte. Man mag beten und rufen, soviel man will, – aus dem Loche wird doch niemand antworten.
Er erhob sich und setzte sich in einen Sessel. Er fühlte sich krank und zerschlagen. In der Nacht hatte er schlecht geschlafen und einen unangenehmen Traum gehabt. Es träumte ihm, daß ihm ein großer, krummer Zahn gewachsen sei. Die Großmutter sagte, man müsse den Zahn ziehen; er fürchtet sich, weint, läuft weg und versteckt sich. Aber sein Erzieher Lamsdorff verfolgt ihn mit einer großen Rute in der Hand; gleich wird er ihn erwischen und ihm die Rute geben. Plötzlich ist Lamsdorff nicht mehr Lamsdorff, sondern sein Bruder Konstantin. Er flieht vor ihm zu der alten Wärterin, der Engländerin Lion, und bittet sie, sie möchte ihm die Rute geben; er weiß, daß er der Strafe sowieso nicht entgehen wird; ihre Schläge tun aber weniger weh. Plötzlich ist die Wärterin nicht mehr die Wärterin, sondern ... wer? Er hat es schon vergessen. Er wußte nur noch, daß der Traum ein übles Ende gehabt hatte.
– Der Traum kann prophetisch sein! – ging es ihm durch den Sinn. Nicht umsonst hatte er den Bruder Konstantin immer so gefürchtet, als hätte er geahnt, daß jener soviel Unheil anstellen wird; nicht umsonst hatte ihn jener noch im Mutterleibe verhöhnt: »Niemals hab ich einen solchen Bauch gesehen, da ist für Viere Platz!« hatte das Söhnchen über die Mutter gespottet, als sie mit Nikolai schwanger war. Er verhöhnte ihn auch später sein ganzes Leben lang. Er nannte ihn mit dem Beinamen des heiligen Nikolaus – »Zarewitsch von Myra in Lykien«. – Er pflegte zu sagen: »Um nichts in der Welt will ich regieren, denn ich fürchte die Revolution. Und du, Zarewitsch von Myra in Lykien, fürchtest du sie nicht? Revolution ist dasselbe wie ein Gewitter.« Und er erinnerte ihn daran, wie er als Kind, wenn es donnerte, den Kopf unter das Kissen zu stecken pflegte. »Ich bin feig und weiß, daß ich feig bin; du tust zwar sehr tapfer, bist aber noch feiger als ich.« So hat er ihn auch jetzt auf den Thron gestoßen und macht sich über ihn noch lustig: »Wollen wir mal sehen, wie du dich aus dieser dummen Affäre ziehst, du Parvenu von einem Kaiser!«
Nikolai schrieb ihm freundliche Briefe, nannte ihn seinen Wohltäter, flehte ihn an und erniedrigte sich vor ihm: »Ich falle dir zu Füßen, teurer Konstantin, und flehe dich an: Erbarme dich des Unglücklichen!« Dabei dachte er sich aber zähneknirschend: »Gemeiner Hanswurst! Verdammter Sansculotte! Was macht er mit mir! Dafür müßte man ihn mindestens erschlagen!«
Jeden Morgen nach dem Gebet pflegte er auf dem Cornet-à-pistons den Zapfenstreich zu blasen. Er hielt sich für einen Musiker und komponierte gerne Militärmärsche. Beim Potsdamer Manöver hatte er meisterhaft alle Signale geblasen, während die Kompagnie seiner Hoheit, des Kronprinzen von Preußen, exerzierte.
Er nahm das Cornet-à-pistons, führte es an die Lippen, blähte die Backen, brachte aber nur einen schwachen, klagenden Ton hervor und legte das Instrument zur Seite. Nein, es ist genug, jetzt hat er an anderes zu denken. Er seufzte schwer und fühlte wieder Mitleid mit sich selbst: ›Pauvre Diable! Armer Kerl! Armer Nixe!‹
»Fjodorytsch, Tee!«
»Augenblicklich, Hoheit!«
Morgens trank er sonst immer Tee mit Sahne und Semmeln aus Butterteig. Diesmal nahm er aber nichts dazu: Er hatte keinen Appetit.
Benkendorf meldete Golizyn.
»Mit dem Manifest?«
»Zu Befehl, ja, Hoheit.«
»Ich lasse bitten.«
Golizyn kam in Begleitung Lopuchins und Speranskijs.
»Fertig?«
»Fertig, Hoheit.«
Golizyn reichte ihm die Reinschrift des Manifestes.
»Ich bitte die Herren Platz zu nehmen«, sagte Nikolai und fing an, das Manifest laut zu lesen.
»Wir verkünden allen unseren treuen Untertanen ... Mit wehmütigem Herzen, den unerforschlichen Ratschlüssen des Höchsten gehorsam ...«
Er sah Speranskij nicht an, fühlte aber auf sich seinen Blick. Dieser allzu klare und durchdringende Blick macht ihn immer verlegen.
Er hielt Speranskij für einen abgefeimten Jakobiner. Nicht umsonst hatte ihn der verstorbene Kaiser verbannt und beinahe als Staatsverräter hinrichten lassen. ›Dem darf man keinen Finger in den Mund legen‹, dachte von ihm Nikolai, und wie unterwürfig und respektvoll sich jener auch benahm, hatte er doch immer das Gefühl, daß er über ihn wie über einen kleinen Jungen lache. Einmal nannte jemand Speranskij in seiner Gegenwart einen ›großen Philosophen‹; Nikolai sagte nichts, lächelte aber giftig. Die Philosophie haßte er über alles in der Welt. Und doch fühlte er, daß er Speranskij nicht so anschreien dürfe, wie die Offiziere in der Reitschule: »Meine Herren Offiziere, tun Sie Ihren Dienst und lassen Sie die Philosophie. Ich kann die Philosophen nicht ausstehen! Bei mir werden alle Philosophen die Schwindsucht kriegen!«
»Durch das Hinscheiden des in Gott ruhenden Kaisers Alexander Pawlowitsch, Unseres geliebtesten Bruders«, las er weiter, »verloren wir unsern Vater und Herrscher, der Rußland fünfundzwanzig Jahre lang seine Wohltaten erwies. Als die Nachricht von diesem beklagenswerten Ereignis Uns am 27. November erreichte, hielten wir in der ersten Stunde den Schmerz und die Tränen zurück und leisteten, der heiligen Pflicht und Unserer Herzensregung folgend, Unserm älteren Bruder, dem Zessarewitsch und Großfürsten Konstantin Pawlowitsch, als dem nach dem Rechte der Erstgeburt gesetzlichen Erben des russischen Thrones, den Treueid ...«
Des ferneren wurde ›das Unerklärliche erklärt‹: das geheime Testament des verstorbenen Kaisers, der Verzicht Konstantins zugunsten Nikolais, – alle diese ›Familienabmachungen‹, ›das Spiel mit der Thronfolge wie mit einem Privateigentum‹.
»... Wir wußten von der bei Lebzeiten des verstorbenen Kaisers abgegebenen und durch das Einverständnis Seiner Majestät bestätigten Verzichterklärung Seiner Hoheit; wir hatten aber weder den Willen noch das Recht, diese Verzichterklärung, die seinerzeit unveröffentlicht blieb, als unwiderruflich anzusehen. Damit wollten Wir Unsere Ehrfurcht vor dem ersten Grundgesetz des Vaterlandes von der Unabänderlichkeit der Thronfolge bezeugen. Darum bestanden Wir, dem von Uns geleisteten Eid treu, darauf, daß auch das ganze Reich Unserem Beispiele folge; dies taten Wir aber nicht aus Mißachtung vor dem von Seiner Hoheit ausgesprochenen Willen und noch weniger vor dem Uns immer heiligen Willen des hochseligen Kaisers, Unseres Vaters und Wohltäters, sondern einzig, um das Grundgesetz von der Thronfolge vor jeder Verletzung zu schützen und jeden Schatten eines Zweifels über die Reinheit unserer Absichten zurückzuweisen ...«
»Es ist unverständlich. Das von der Thronfolge ist unklar und unverständlich«, sagte Nikolai. Sein Gewissen war nicht ganz ruhig.
»Befehlen Majestät es abzuändern?«
Leicht gesagt: abändern; er müßte doch wissen, wie; das wußte er aber nicht.
»Nein, soll es schon so bleiben«, sagte er und machte ein unzufriedenes Gesicht.