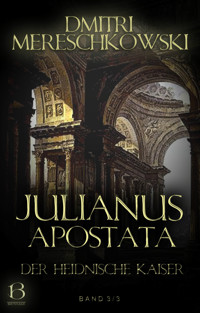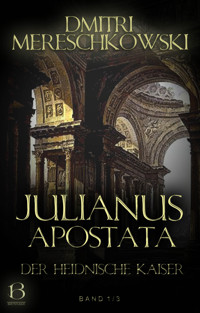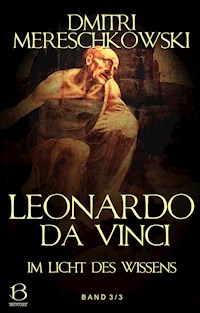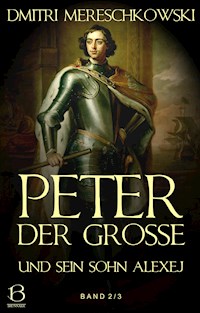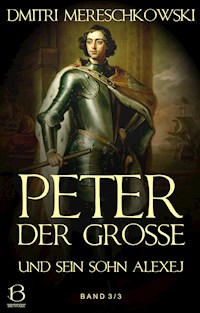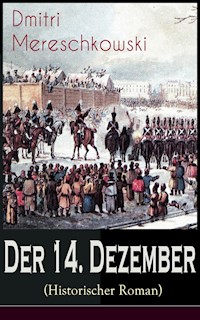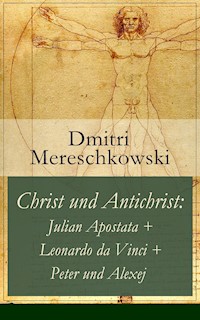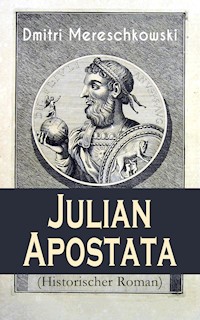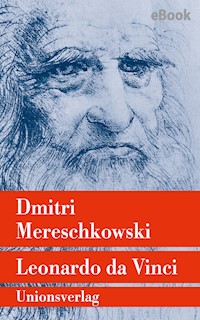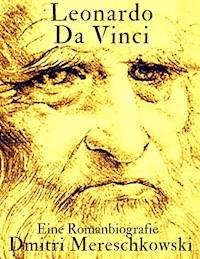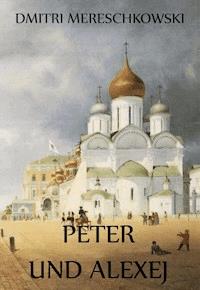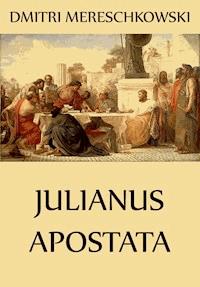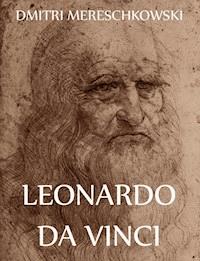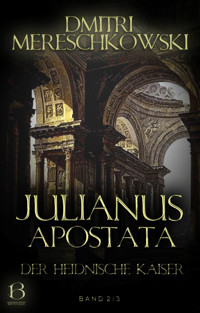
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
“JULIANUS APOSTATA” Anno 360 n. Chr.: Der römische Kaiser Julianus möchte während seiner Regierungszeit den Kult der alten olympischen Götter wieder aufleben lassen und bekämpft das privilegierte Christentum. Das Christentum betrachtet er als Kult einer absonderlichen Tugend, die auf Erden unerreichbar ist und die in der Verleugnung aller irdischen Dinge besteht. Asketisch bis zur Grenze des Unmenschlichen, lehnen die frühen Christen in seinen Augen die Realität und die menschliche Natur als solche ab. Dem setzt Julianus seinen unbändigen Willen zum Leben und zum Wissen entgegen. Doch selbst er, der Kaiser, kann sich nicht gegen den Zeitgeist stellen… Als historische Romanbiographie meisterhaft herausgearbeitet, bildet die Handlung den Hintergrund für die Auseinandersetzung mit der Natur des Menschen. Der Roman offenbart menschlich-moralische Abgründe und Widersprüchlichkeiten. Falsche Dinge werden für wahr erklärt. Wahre Dinge werden als falsch entlarvt. Die Norm ist pervers, Perversion ist normal. Es gibt ein christliches Mädchen, das sich – aus reiner Freundlichkeit – dem Stallburschen hingibt, um sich verderben zu lassen. Es gibt einen christlichen Altarpriester, der Wimperntusche aufträgt, um wie eine Hure auszusehen, und schmutzige erotische Abenteuer im Zirkus genießt. Es gibt eine Kreuzigung, den Leib Christi, den Kopf eines Esels. Es gibt einen heiligen Märtyrer, der seinen Vollstreckern in die Augen spuckt und unheilige Schwüre spricht. Christen, die nur daran denken, wie sie die Nichtchristen abschlachten können. Christus kommt dem heidnischen Gott Dionysos gleich, Hexerei ähnelt dem christlichen Gebet, und ein Gebet klingt nach einem Zauberspruch. Dies ist der zweite Band der Trilogie “Julianus Apostata”. Der Umfang des zweiten Bandes entspricht ca. 300 Buchseiten. Der “CHRIST UND ANTICHRIST”-Zyklus “Julianus Apostata” ist die erste Roman-Trilogie aus dem “Christ und Antichrist”-Zyklus von Dmitri Mereschkowski. Die beiden anderen Trilogien sind “Leonardo da Vinci” und “Peter der Große”. Jede der drei Trilogien des “Christ und Antichrist”-Zyklus ist eine in sich geschlossene Geschichte und lässt sich unabhängig von den übrigen Trilogien als eigenständige historische Romanbiographie lesen. Zugleich sind die Trilogien aufgrund motivischer Zusammenhänge miteinander verknüpft. Der Autor wurde durch dieses Werk sowohl in Russland als auch in Westeuropa bekannt und insgesamt neunmal für den Nobelpreis für Literatur nominiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
JULIANUS APOSTATA
von
DMITRI MERESCHKOWSKI
Historische Roman-Trilogie
Übersetzt vonAlexander Eliasberg
BAND 2
Dieses Buch ist Teil der BRUNNAKR Edition: Fantasy, Historische Romane, Legenden & Mythen.
BRUNNAKR ist ein Imprint des apebook Verlags.
Nähere Informationen am Ende des Buches oder auf:
www.apebook.de
1. Auflage 2020
V 1.0
ISBN 978-3-96130-338-0
Buchgestaltung/Coverdesign: SKRIPTART
www.skriptart.de
Alle Rechte vorbehalten.
© BRUNNAKR/apebook 2020
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Erhalte zwei eBook-Klassiker gratis als Willkommensgeschenk!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Der
“CHRIST UND ANTICHRIST”-Zyklus
von Dmitri Mereschkowski
JULIANUS APOSTATA(3 Bände)
LEONARDO DA VINCI(3 Bände)
PETER DER GROSSE(3 Bände)
Der erste Band der drei Trilogien ist jeweils kostenlos!
Inhaltsverzeichnis
Julianus Apostata. Band 2
Impressum
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Eine kleine Bitte
"Christ und Antichrist" Gesamtüberblick
BRUNNAKR Edition
Buchtipps für dich
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
L i n k s
Zu guter Letzt
I
In Athen sollte Julianus Mönch werden.
Es war ein Frühlingsmorgen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Er war bei der Frühmesse gewesen und ging gleich aus der Kirche einige Stadien längs des mit Platanen und wildem Wein bewachsenen Ufers des Illissos.
Er liebte diesen einsamen Platz, am Ufer des Stromes, der auf dem steinigen Boden wie Seide rauschte. Von hier konnte er durch den Nebel die rötlichen, sonnenverbrannten Felsen der Akropolis und die Umrisse des noch kaum vom Morgenlicht berührten Parthenons erkennen.
Julianus band seine Sandalen ab und ging barfuß in das seichte Wasser des Flusses. Es roch nach den aufgehenden Blüten der Reben; in diesem Dufte lag schon der Vorgeschmack des Weines, wie in den ersten Gedanken der Kindheit schon eine Vorahnung der Liebe liegt.
Ohne die Füße aus dem Wasser zu nehmen, setzte er sich auf die Wurzeln einer Platane und begann in dem Buche »Phädrus«, das er mitgebracht hatte, zu lesen.
Sokrates sagt im Dialog zu Phädrus:
»Wenden wir unsere Schritte zum Ufer des Illissos. Wir wollen einen einsamen Platz wählen und uns da niedersetzen. Scheint es dir nicht auch, Phädrus, dass die Luft hier besonders zart und duftend ist, und dass selbst im Zirpen der Zikaden etwas Süßes liegt, das an den Sommer erinnert? Am besten gefällt mir hier aber dieses hohe Gras.«
Julianus blickte um sich: alles war noch so, wie es vor acht Jahrhunderten gewesen war; die Zikaden begannen soeben im hohen Grase ihren Gesang. Er dachte:
»Diesen Boden hatten die Füße des Sokrates berührt.« Er steckte seinen Kopf in das dichte Gras und küsste die Erde.
»Ich begrüße dich, Julianus! Du hast dir ein schönes Plätzchen zum Lesen ausgesucht. Darf ich dir Gesellschaft leisten?«
»Setze dich her. Es freut mich. Ein Dichter stört nie die Einsamkeit.«
Julianus blickte den hageren, mit einem viel zu langen Mantel bekleideten Dichter Publius Optatianus Porphyrius an und musste lächeln: er war so klein, blutarm und mager, dass man annehmen konnte, er werde sich bald aus einem Menschen in eine Zikade verwandeln, wie es in der Sage Platos von den Poeten erzählt wird.
Publius verstand es, wie eine Zikade beinahe ohne Speise zu leben; doch hatten ihm die Götter die Fähigkeit, Hunger und Durst nicht als solche zu empfinden, versagt: sein aschgraues, unrasiertes Gesicht und seine blutleeren Lippen drückten Hunger und Kummer aus.
»Publius, warum trägst du einen so langen Mantel?«, fragte Julianus.
»Er gehört nicht mir«, erwiderte der Dichter mit philosophischer Ruhe, »das heißt, er gehört auch mir, aber nur vorübergehend. Du musst wissen, dass ich mein Zimmer mit dem jungen Hephästion, der in Athen die Redekunst studiert, teile; einmal wird er sicher ein ausgezeichneter Advokat werden; heute ist er aber noch arm, wie ich, arm, wie ein lyrischer Dichter – damit ist alles gesagt! Unsere Kleider, Essgeschirr und selbst das Tintenfass haben wir längst versetzt. Uns ist nur dieser eine Mantel geblieben. In den Morgenstunden gehe ich aus, während Hephästion seinen Demosthenes studiert; in den Abendstunden nimmt er den Mantel, ich aber bleibe zuhause und dichte. Leider ist Hephästion groß, während ich klein bin. Da ist nichts zu machen: ich gehe ›langen Gewandes‹, wie die alten Trojanerinnen.«
Publius Optatianus lachte, und sein aschfahles Gesicht gemahnte an das einer lustig gewordenen Klagefrau.
»Siehst du, Julianus«, fuhr der Dichter fort, »ich spekuliere auf den Tod einer steinreichen Witwe eines römischen Pächters: die glücklichen Erben werden bei mir die Grabinschrift bestellen und ein ordentliches Honorar bezahlen. Leider ist aber die Witwe eigensinnig und gesund: trotz aller Anstrengungen der Ärzte und der Erben will sie nicht sterben. Ich hätte mir schon längst einen Mantel angeschafft. – Höre einmal, Julianus, komm mit mir.«
»Wohin denn?«
»Vertraue mir. Du wirst mir dankbar sein ...«
»Was sind das für Geheimnisse?« »Sei nicht faul und lass das Fragen. Ein Dichter wird dem Freunde der Dichter nichts Böses tun. Du sollst eine Göttin sehen ...«
»Welche Göttin?«
»Artemis, die Jägerin ...«
»Ist es ein Bild oder eine Statue?«
»Sie ist schöner als alle Bilder und Statuen. Wenn du die Schönheit liebst, so nimm deinen Mantel und komm mit!«
Der Dichter tat so geheimnisvoll, dass Julianus neugierig wurde. Er erhob sich, nahm seinen Mantel und folgte ihm.
»Ich mache dir zur Bedingung, dass du kein Wort sprichst und nicht staunst. Sonst verschwindet der Zauber. Im Namen Kalliopes und Eratos, vertraue dich mir an! ... Es sind nur wenige Schritte. Um dir unterwegs die Zeit zu vertreiben, will ich dir den Anfang meiner Grabinschrift auf die Pächterswitwe vorlesen.«
Sie gelangten auf die staubige Landstraße. Über der rosigen Akropolis funkelte in den ersten Sonnenstrahlen der kupferne Schild der Athene Promachos; die Spitze ihres feinen Speeres leuchtete wie eine brennende Kerze.
Längs der steinernen Mauern, hinter denen im Schatten der Feigenbäume Quellen rieselten, zirpten die Zikaden so laut, als ob sie den Dichter übertönen wollten, der mit heiserer, doch begeisterter Stimme seine Verse vortrug.
Publius Optatianus Porphyrius war nicht unbegabt; sein Leben hatte sich aber höchst seltsam gefügt. Noch vor einigen Jahren besaß er in Konstantinopel, in der Nähe der Chalkedonischen Vorstadt ein schönes Häuschen, »einen wahren Tempel des Hermes«, wie er es nannte; sein Vater hatte einst mit Olivenöl gehandelt und ihm ein kleines Vermögen hinterlassen, das zu einer sorglosen Existenz vollkommen ausreichte. Sein unbändiges Temperament gab ihm aber keine Ruhe. Er schwärmte für das alte Hellenentum und empörte sich über das, was er den »Triumph der christlichen Sklaverei« nannte. Einmal schrieb er ein freigeistiges Gedicht, das dem Kaiser Constantius missfiel. Constantius hätte dem Gedicht wohl nicht die geringste Bedeutung zugemessen, wenn darin nicht eine Anspielung auf die Person des Kaisers enthalten gewesen wäre; diese konnte er ihm aber nicht verzeihen. Den Dichter traf die gebührende Strafe: sein Häuschen und sein ganzes Vermögen wurden konfisziert, er selbst aber auf eine kleine, einsame Insel des Archipelagus verbannt. Auf dieser Insel gab es nichts als Felsen, Ziegen und Fieber. Optatianus war dieser Prüfung nicht gewachsen; er verdammte alle seine Gedanken an die alte Römerfreiheit und beschloss, was es auch koste, sein Vergehen wiedergutzumachen.
Während ihn in den schlaflosen Nächten auf der Insel Fieber plagte, schrieb er eine Lobhymne, die aus einzelnen Verszeilen des Vergils bestand: die einzelnen Verse des alten Dichters waren so aneinander gefügt, dass sie ein neues Gedicht bildeten. Dieses schwere Kunststück fand bei Hofe Beifall: Optatianus hatte den wahren Geist seiner Zeit erraten.
Nun versuchte er noch schwierigere Kunststücke: so schrieb er einen Dithyrambus auf Constantius, der aus Versen verschiedener Länge bestand; die Verszeilen bildeten darin ganze Figuren, wie z.B. eine vielläufige Hirtenschalmei, eine Wasserorgel und einen Altar, dessen Rauch aus einigen ungleichen, kurzen Zeilen bestand. Ein Wunder der Geschicklichkeit waren seine quadratischen Gedichte, die aus zwanzig und vierzig Hexametern bestanden; einzelne Buchstaben waren darin mit roter Tinte geschrieben: wenn man die roten Buchstaben innerhalb der Quadrate untereinander verband, erhielt man bald das Monogramm Christi, bald eine Blume, bald ein kompliziertes Ornament; die sich hierbei bildenden Zeilen enthielten neue Komplimente; schließlich konnte man die vier letzten Hexameter des Gedichtes auf achtzehn verschiedene Arten lesen: von vorne, von hinten, aus der Mitte, von der Seite, von oben herunter, von unten herauf und so weiter; wie man es auch las, immer erhielt man neue Lobpreisungen.
Diese wahnsinnige Arbeit kostete dem armen Dichter beinahe seinen Verstand. Um so vollständiger war sein Sieg. Constantius geriet in Entzücken. Er glaubte, dass Optalianus alle Dichter des Altertums in den Schatten gestellt habe. Er schrieb ihm einen eigenhändigen Brief, in dem er behauptete, dass er immer bereit sei, die Musen zu beschirmen. »In unserem Zeitalter«, schloss das in hochtrabendem Stil gehaltene Schreiben, »folgt meine wohlwollende Aufmerksamkeit einem jeden, der da dichtet, wie der leise Hauch des Zephyrs.« Der Dichter erhielt jedoch sein konfisziertes Eigentum nicht zurück; man gab ihm nur etwas Geld und die Erlaubnis, die verfluchte Insel zu verlassen und sich in Athen anzusiedeln. Sein Leben in Athen war wenig erfreulich: der Gehilfe des jüngsten Stallknechtes am Zirkus lebte im Vergleich zu ihm in Herrlichkeit und Freuden. Der Dichter musste ganze Tage lang bei ehrgeizigen Würdenträgern, in Gesellschaft von Sargtischlern, jüdischen Händlern und Veranstaltern von Hochzeitszügen antichambrieren, ehe er einen Auftrag auf ein Epitalam, ein Epitaph, oder eine Liebesepistel erhielt. Die Bezahlung war elend. Porphyrius verlor aber nicht den Mut und hoffte noch immer, dem Kaiser einmal ein solches Kunststück zu überreichen, dass dieser ihm gänzlich verzeihen würde.
Julianus sah, dass trotz aller Erniedrigungen, die Porphyrius erfahren musste, in ihm die Liebe zu Hellas noch nicht erloschen war. Er war ein feiner Kenner der alten Dichter, und Julianus unterhielt sich sehr gerne mit ihm.
Sie verließen die Landstraße und näherten sich einer hohen Mauer, die eine Palästra umschloss.
Ringsherum war es einsam. Zwei schwarze Lämmer weideten auf der Wiese. Vor den verschlossenen Toren, wo aus den Fugen in den steinernen Stufen wilder Mohn und Löwenzahn hervorwuchsen, stand ein mit zwei weißen Pferden bespannter Wagen; die Mähnen der Pferde waren wie bei den Pferden auf alten Bildwerken zugestutzt.
»Ein alter Sklave mit einem eiförmigen, kahlen Schädel, der kaum von einem weißen Flaum bedeckt war, beaufsichtigte das Gespann. Der Alte war taubstumm, doch sehr höflich. Er hatte Optatianus erkannt und nickte ihm freundlich zu, auf das verschlossene Tor der Palästra zeigend.
»Gib mir für einen Augenblick deinen Geldbeutel«, sagte Optatianus zu seinem Begleiter. »Ich will diesem alten Narren einen oder zwei Dinare Trinkgeld geben.«
Er warf dem Taubstummen eine Münze zu und dieser öffnete mit sklavischer Dienstfertigkeit, unartikulierte Laute von sich gebend, das Tor.
Sie betraten das lange, halbdunkle Peristyl.
Zwischen den Säulen sah man gedeckte Gänge, die sogenannten »Xystoi«, die für die Übungen der Athleten bestimmt waren; in diesen Gängen gab es keinen Sand, und sie waren ganz mit Gras überwuchert. Die beiden Freunde traten in den breiten inneren Hof. Julianus' Neugier war durch all das Geheimnisvolle aufs höchste erregt. Optatianus führte ihn schweigend an der Hand.
In den zweiten Hof gingen die Türen der »Exedras«, der marmornen Hallen, die einst den athenischen Weisen und Rednern als Hörsäle gedient hatten. Dort zirpten die Zikaden, hier klangen die wohlgesetzten Reden hervorragender Männer; über den saftigen Gräsern, die üppig wie auf Gräbern wucherten, schwärmten Bienen; es war eine stille, traurige Stimmung. Plötzlich hörten sie eine weibliche Stimme, das Klirren eines auf den Marmorfußboden anschlagenden Kupferdiskus und Lachen.
Sie schlichen wie Diebe heran und versteckten sich im Halbschatten zwischen den Säulen des »Elaiothesion«, wo sich einst die Ringkämpfer vor den Kämpfen mit Öl eingerieben hatten.
Zwischen den Säulen hindurch konnten sie einen länglichen, viereckigen Platz unter freiem Himmel überblicken, der zum Ballspiel und Diskuswerfen bestimmt war; der Platz war wohl erst vor kurzem gleichmäßig mit frischem Sand bestreut worden.
Julianus blickte hin und taumelte einige Schritte zurück.
Zwanzig Schritte vor ihm stand ein junges Mädchen, vollkommen nackt. Sie hielt in der Hand einen kupfernen Diskus.
Julianus machte eine rasche Bewegung, um fortzugehen; doch sah er in den aufrichtigen Augen und in dem blassen Gesicht des Optatianus eine so tiefe Andacht, dass er sofort begriff, warum ihn dieser Verehrer des Hellas hergeführt hatte; er fühlte, dass in der Seele des Dichters kein einziger sündiger Gedanke aufkommen könne und dass sein Entzücken heilig sei. Optatianus hatte seinen Freund bei der Hand erfasst und flüsterte ihm ins Ohr:
»Julianus, wir befinden uns jetzt im alten Lakonien. Weißt du noch die Verse des Properz: Ludi Laconum?«
Und er flüsterte ihm ganz leise, doch begeistert zu:
»Multa tuae, Sparte, miramur iura palaestrae,Sed mage virginei tot bona gymnasii;Quod non infames exerceret corpore ludos,Inter luctantes nuda puella viros.«
(Viele Gesetz', o Sparta, bewundern wir deiner Palästra;Aber das Gute der jungfräulichen Übung zumeist;Dass nicht unehrbar zur Behändigkeit bilden die GliederUnter den Jünglingen nackt ringende Mädchen im Kampf.)
»Wer ist das?«, fragte Julianus.
»Ich weiß nicht, ich wollte es nicht erfahren ...«
»Es ist gut. Sei still.«
Nun sah er gierig auf die Diskuswerferin, ganz ohne Schamgefühl; er fühlte, dass hier jedes Schamgefühl unnötig und unweise sei.
Das Mädchen trat einige Schritte zurück, beugte sich, setzte den linken Fuß vor und warf mit der Rechten den Diskus so hoch empor, dass der kupferne Kreis in den Strahlen der aufgehenden Sonne aufleuchtete und klirrend am Fuß einer weit entfernten Säule niederfiel. Julianus glaubte vor sich ein Marmorbildwerk des Phidias zu sehen.
»Dein bester Wurf!«, sagte ein etwa zwölfjähriges Mädchen, das, mit einer glänzenden Tunika bekleidet, bei einer der Säulen stand.
»Myrrha, reich mir den Diskus!«, sagte die Diskuswerferin. »Ich kann ihn noch höher schleudern, du wirst es bald sehen! Meroe, geh etwas zur Seite, sonst verwunde ich dich, wie Apollo den Hyacinthos.«
Die alte Sklavin Meroe, ihrer bunten Kleidung und ihrer braunen Gesichtsfarbe nach zu schließen eine Ägypterin, bereitete in Alabastergefäßen wohlriechende Essenzen zum Bade. Julianus dachte sich, dass der taubstumme Sklave und der Wagen mit den weißen Pferden dieser Liebhaberin der alten Spiele gehörten.
Als das Mädchen mit dem Diskuswerfen fertig war, ließ sie sich von der schwarzäugigen, blassen Myrrha einen geschwungenen Bogen und einen Köcher reichen, und entnahm diesem einen gefiederten Pfeil. Das Mädchen zielte nach einem schwarzen Kreis, der an dem entgegengesetzten Ende des Ephebeon hingemalt war. Die Bogensehne erklang, der Pfeil flog pfeifend auf und traf das Ziel; ihm folgte ein zweiter und ein dritter.
»Artemis, die Jägerin!«, flüsterte Optatianus.
Der zartrosa Strahl der aufgehenden Sonne drang plötzlich zwischen den Säulen hindurch und traf das Gesicht und den fast knabenhaften Busen des Mädchens.
Sie warf Bogen und Köcher fort und bedeckte mit den Händen ihre von der Sonne geblendeten Augen.
Einige Schwalben flogen schreiend über der Palästra und verschwanden im Himmel.
Sie nahm ihre Hände vom Gesicht und verschränkte sie über dem Kopf. Ihre Haare waren an den Enden von heller Goldfarbe, wie gelber Honig in der Sonne; an den Wurzeln waren sie etwas dunkler und rötlich, sie hatte ihre Lippen zu einem Lächeln kindlicher Freude geöffnet; die Sonne glitt an ihrem nackten Körper herab immer tiefer und tiefer. So stand sie rein und nackt da, vom Sonnenlicht wie von einem keuschen Gewand umhüllt.
»Myrrha«, sagte das Mädchen nachdenklich und langsam, »sieh dir nur den Himmel an! Man möchte sich in ihn hineinstürzen und mit einem Schrei wie die Schwalben in ihm ertrinken, weißt du noch, wir sprachen neulich davon, dass die Menschen nie glücklich sein könnten, weil sie keine Flügel hätten? Wenn wir den Vögeln nachblicken, beneiden wir sie ... Man muss ganz leicht, ganz nackt sein, Myrrha, wie ich es jetzt bin, sich ganz hoch und tief im Himmel fühlen und wissen, dass es ewig so bleiben wird, dass es in der Welt nichts gibt und nichts geben kann als den Himmel und die Sonne um den leichten, nackten Körper! ...«
Sie richtete sich ganz auf, streckte ihre Arme zum Himmel, seufzte auf, wie man über etwas seufzt, das man auf ewig und unwiederbringlich verloren hat.
Die Sonnenstrahlen glitten immer tiefer und tiefer herab; sie umfingen bereits mit glühender Liebkosung ihre Hüften. Das Mädchen zuckte, von Scham ergriffen, zusammen, als ob irgendein Lebender und Leidenschaftlicher ihre Nacktheit gesehen hätte. Mit der ewigen, schamhaften Gebärde der Aphrodite von Knidos verdeckte sie mit der einen Hand ihre Brüste und mit der anderen ihre Lenden.
»Meroe, gib schnell meine Kleider her!«, schrie sie auf, mit erschrockenen, großen Augen um sich blickend.
Julianus wusste nicht mehr, wie er die Palästra verlassen hatte; sein Herz glühte. Der Dichter schien feierlich und traurig gestimmt, wie einer, der eben aus einem Tempel kommt.
»Du zürnst mir doch nicht?«, fragte er Julianus.
»O nein! Weshalb?«
»Vielleicht war es für den Christen ein Ärgernis? ...«
»Nein, es war kein Ärgernis.«
»Ja. Ich habe es mir auch so gedacht.«
Sie kamen wieder auf die staubige Landstraße, auf der es inzwischen recht heiß geworden war, und gingen nach Athen.
Optatianus sagte leise, wie vor sich hin: »Wie sind wir jetzt schamhaft und hässlich! Wir fürchten unsre eigene, traurige und armselige Nacktheit, wir verbergen sie, denn wir fühlen uns unrein. Wie anders war es früher! – Einst war es doch wirklich so, Julianus, dass die spartanischen Mädchen ganz nackt und stolz in der Palästra vor das Volk traten. Niemand fürchtete sich vor Versuchung. Die Reinen sahen auf Reine. Sie waren wie die Kinder, wie die Götter. – Wenn ich aber bedenke, dass dies nie wiederkehren wird, dass es mit dieser Freiheit, Reinheit und Lebensfreude für immer vorbei ist ...«
Er ließ seinen Kopf sinken und seufzte tief auf. Sie gingen durch die Straße der Dreifüße. In der Nähe der Akropolis nahmen die Freunde stumm voneinander Abschied.
Julianus trat in den Schatten der Propyläen. Er ging an der Stoa Poikile mit den Bildern des Parrhasius, die die Schlachten bei Marathon und Salamis darstellten, dann an dem kleinen Tempel der Flügellosen Nike vorbei und näherte sich dem Parthenon.
Sooft er die Augen schloss, sah er den nackten, herrlichen Leib der Jägerin Artemis vor sich; und wenn er sie wieder öffnete, schien ihm der sonnenlichtüberflutete Marmor des Parthenons goldig und beseelt, wie der Leib der Göttin.
Er war bereit, vor aller Augen diesen von der Sonne durchwärmten Marmor zu umarmen und ihn, wie einen lebendigen Leib, zu küssen, und wenn es ihm auch das Leben kostete.
In der Nähe standen zwei schwarzgekleidete junge Männer mit blassen, strengen Gesichtern; es waren Gregorius von Nazianz und Basilius von Caesarea. Die Hellenen fürchteten sie wie ihre ärgsten Feinde; die Christen hofften, in diesen beiden Freunden einst große Kirchenlehrer zu sehen. Sie beobachteten Julianus.
»Was hat er nur heute?«, sagte Gregorius. »Sieht denn ein Mönch so aus? Diese Bewegungen! Und wie er die Augen schließt! Dieses Lächeln! Glaubst du denn wirklich an seine Frömmigkeit, Basilius?«
»Ich habe es ja doch selbst gesehen, wie er in der Kirche betete und weinte ...«
»Es ist nur Heuchelei!«
»Warum kommt er dann zu uns, warum sucht er unsere Gesellschaft und beschäftigt sich mit der Auslegung der heiligen Schrift?« »Er treibt seinen Spott mit uns oder will uns verführen. Traue ihm nicht! Er ist der Versucher! Wisse, mein Bruder, dass das Römische Reich sich in der Person dieses Jünglings ein großes Übel heranzieht. Er ist der Feind!«
Die Freunde gingen mit gesenkten Blicken weiter. Sie beachteten weder die strengen, jungfräulichen Karyatiden des Erechtheions, noch die Propyläen, den im blauen Himmel leuchtenden, weißen Tempel der Nike Apteros und das Parthenon. Ihre Gesichter waren finster, denn sie hatten nur den einen Wunsch, alle diese teuflischen Götzentempel zu zerstören.
Die Sonne warf auf den weißen Marmor zwei lange, schwarze Schatten der beiden Mönche Gregorius von Nazianz und Basilius von Caesarea.
»Ich will sie sehen«, sagte sich Julianus, ich muss erfahren, wer sie ist!«
II
»Die Götter haben die Sterblichen in die Welt gesandt, damit sie schön redeten.«
»Herrlich! Das hast du herrlich gesagt, Mamertinus!, wiederhole es noch einmal, ehe du es vergisst! Ich will es mir aufschreiben!« So bat den berühmten athenischen Advokaten Mamertinus sein Freund und aufrichtiger Verehrer, der Lehrer der Beredsamkeit, Lampridius. Er holte aus seiner Tasche eine wächserne Doppeltafel und einen spitzen Stahlstift hervor und schickte sich an zu schreiben.
»Ich sage«, fing Mamertinus von Neuem an, mit einem gezierten Lächeln seine Tischgenossen an der Abendtafel musternd, »ich sage: die Menschen sind von den Göttern gesandt ...«
»Nein, nicht so! Du hast es anders gesagt, Mamertinus!«, unterbrach ihn Lampridius; »du hast es viel besser gesagt: die Götter haben die Sterblichen in die Welt gesandt.«
»Nun, ich habe gesagt: die Götter haben die Sterblichen in die Welt gesandt, nur damit sie schön redeten.«
»Jetzt hast du noch die Silbe ›nur‹; hinzugefügt, und es klingt noch besser.«
Lampridius notierte sich mit großer Andacht die Worte des Advokaten, wie einen Ausspruch des Orakels. Es war bei einem Abendessen, das der römische Senator Hortensius seinen Freunden auf der in der Nähe von Piräus gelegenen Villa, die seiner jungen und schönen Pflegetochter Arsinoe gehörte, gab.
Mamertinus hatte an diesem Tag seine berühmte Rede zur Verteidigung des Bankiers Barnabas gehalten. Niemand zweifelte, dass der Jude Barnabas ein abgefeimter Schwindler sei. Abgesehen von seiner Beredsamkeit, verfügte der Advokat über eine Stimme, von der eine seiner zahllosen in ihn verliebten Verehrerinnen behauptete: »Ich höre niemals auf seine Worte; mich interessiert weder was, noch worüber er spricht; ich berausche mich allein an seiner Stimme; in den Schlusssilben der Worte klingt sie ganz außergewöhnlich. Es ist keine Menschenstimme, sondern göttlicher Nektar, das Seufzen einer Äolsharfe!«
Obwohl das gemeine Volk den Wucherer Barnabas »einen Blutsauger, der sich von der Habe der Witwen und Waisen nährt« nannte, waren die Richter von Athen so sehr von der Verteidigungsrede des Mamertinus entzückt, dass sie seinen Klienten freisprachen. Der Advokat hatte vom Juden fünfzigtausend Sesterzen erhalten und war daher während des kleinen Festmahles, das Hortensius ihm zu Ehren gab, bei bester Laune. Er hatte die Gewohnheit, sich immer krank zu stellen und beanspruchte die sorgsamste Behandlung.
»Ich bin heute so müde, meine Freunde«, sprach er jammernd. »Ganz krank bin ich. – Wo bleibt aber Arsinoe?«
»Sie muss gleich kommen. Arsinoe bekam soeben aus dem Museum von Alexandria einen neuen physikalischen Apparat zugeschickt und ist mit ihm sehr beschäftigt. Ich will sie aber gleich rufen lassen«, schlug Hortensius vor.
»Nein, es ist nicht nötig«, sprach der Advokat nachlässig. »Es ist nicht nötig. – Dieser Unsinn! Ein junges Mädchen und Physik! Wie soll sich das nur reimen? Schon Aristophanes und Euripides haben die gelehrten Frauen verlacht. Und mit Recht! Was deine Arsinoe für Launen hat, Hortensius! Wenn sie nicht so schön wäre, könnte man glauben, dass sie mit ihrer Bildhauerei und Mathematik ...«
Er sprach den Satz nicht zu Ende und blickte zum offenen Fenster.
»Was kann ich dagegen tun?«, erwiderte Hortensius. »Es ist ein verzogenes Mädchen. Ein Waisenkind, hat weder Vater noch Mutter. Ich bin ja nur der Vormund und will sie an nichts hindern!«
»Ja, ja ...«
Der Advokat hörte nicht mehr zu.
»Meine Freunde, ich fühle ...«
»Was denn?«, riefen gleichzeitig einige besorgte Stimmen.
»Ich fühle ... es scheint mir, dass es hier zieht! ...«
»Willst du, dass wir die Fensterläden schließen?«, schlug der Hausherr vor.
»Nein, lieber nicht: es wird zu heiß werden. Ich habe meine Kehle zu sehr angestrengt. Übermorgen muss ich wieder eine Verteidigungsrede halten. Gebt mir meinen Lungenschützer und einen Teppich für die Füße. Ich fürchte, dass ich in dieser nächtlichen Frische heiser werde.«
Hephästion, jener junge Mann, mit dem der Dichter Optatianus sein Zimmer teilte, ein Schüler des Lampridius, und Lampridius selbst beeilten sich, dem Mamertinus seinen Lungenschützer zu holen.
Es war ein schöngesticktes Stück weißer, weicher Wolle, das der Advokat immer bei sich hatte, um damit bei der geringsten Gefahr einer Erkältung seine kostbare Lunge zu schützen.
Mamertinus machte sich selbst den Hof, wie der Liebhaber einem verwöhnten Frauenzimmer. Alle waren daran gewöhnt. Er liebte sich so naiv und zärtlich, dass er die gleiche Liebe auch von den anderen beanspruchte.
»Diesen Lungenschützer hat mir Matrone Fabiola gestickt«, teilte er schmunzelnd mit.
»Die Gattin des Senators?«, fragte Hortensius.
»Ja. Ich will euch eine Anekdote von ihr zum Besten geben. Einst hatte ich einen ganz kurzen Brief – ich muss zugeben, dass er schon sehr schön war, aber immerhin eine Bagatelle von etwa fünf griechischen Zeilen – an eine andere Dame geschrieben, die gleichfalls meine Verehrerin ist, und die mir einen Korb Kirschen geschickt hatte. Ich dankte ihr für das Geschenk in scherzhaften Wendungen, wobei ich den Plinius imitierte. Denkt euch nur, meine Freunde: Fabiola, die meinen Brief so schnell als möglich lesen und für ihre Sammlung berühmter Briefe abschreiben wollte, sandte zwei Sklaven aus, die auf der Landstraße meinem Boten auflauerten. Und nun wird dieser plötzlich nachts in einer hohlen Gasse überfallen: er glaubt, es seien Räuber; doch sie krümmen ihm kein Haar, schenken ihm Geld, nehmen ihm den Brief ab und lassen ihn laufen. So las Fabiola meinen Brief zuerst; sie lernte ihn sogar auswendig.«
»O gewiss, ich kenne sie ja! Es ist eine wirklich ausgezeichnete Frau!«, fiel Lampridius ein. »Ich sah mit eigenen Augen, dass sie alle deine Briefe in einer geschnitzten Schatulle aus Zitronenholz, wie wahre Kostbarkeiten, verwahrt. Sie lernt sie auswendig und behauptet, sie seien besser als alle Verse. Fabiola sagt mit Recht: ›Wenn Alexander der Große die Werke Homers in einem Kästchen aus Zedernholz verwahrte, warum soll ich dann nicht die Briefe des Mamertinus in einer Schatulle aus Zitronenholz aufbewahren?‹«