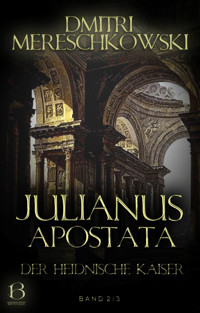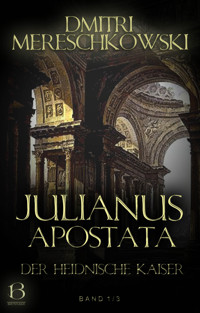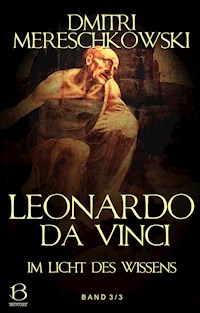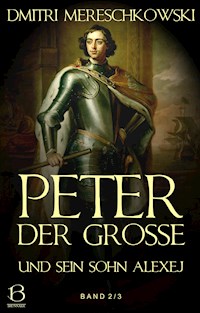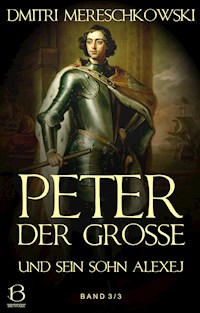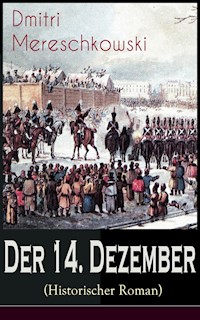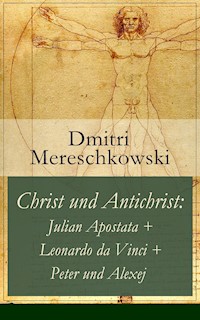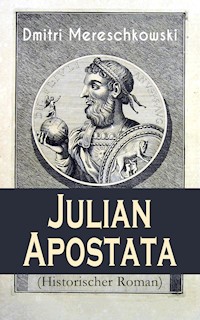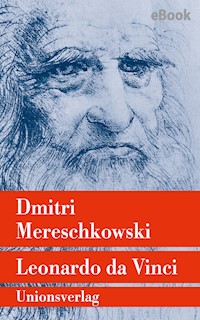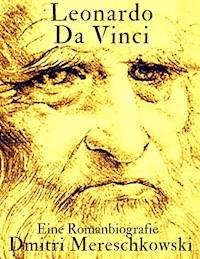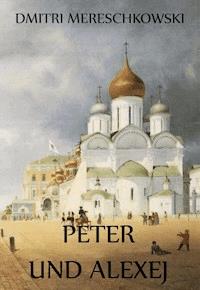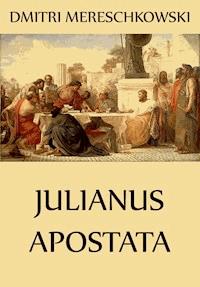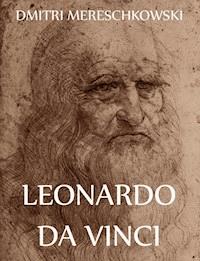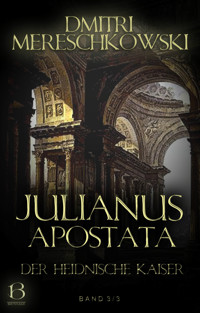
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
“JULIANUS APOSTATA” Anno 360 n. Chr.: Der römische Kaiser Julianus möchte während seiner Regierungszeit den Kult der alten olympischen Götter wieder aufleben lassen und bekämpft das privilegierte Christentum. Das Christentum betrachtet er als Kult einer absonderlichen Tugend, die auf Erden unerreichbar ist und die in der Verleugnung aller irdischen Dinge besteht. Asketisch bis zur Grenze des Unmenschlichen, lehnen die frühen Christen in seinen Augen die Realität und die menschliche Natur als solche ab. Dem setzt Julianus seinen unbändigen Willen zum Leben und zum Wissen entgegen. Doch selbst er, der Kaiser, kann sich nicht gegen den Zeitgeist stellen… Als historische Romanbiographie meisterhaft herausgearbeitet, bildet die Handlung den Hintergrund für die Auseinandersetzung mit der Natur des Menschen. Der Roman offenbart menschlich-moralische Abgründe und Widersprüchlichkeiten. Falsche Dinge werden für wahr erklärt. Wahre Dinge werden als falsch entlarvt. Die Norm ist pervers, Perversion ist normal. Es gibt ein christliches Mädchen, das sich – aus reiner Freundlichkeit – dem Stallburschen hingibt, um sich verderben zu lassen. Es gibt einen christlichen Altarpriester, der Wimperntusche aufträgt, um wie eine Hure auszusehen, und schmutzige erotische Abenteuer im Zirkus genießt. Es gibt eine Kreuzigung, den Leib Christi, den Kopf eines Esels. Es gibt einen heiligen Märtyrer, der seinen Vollstreckern in die Augen spuckt und unheilige Schwüre spricht. Christen, die nur daran denken, wie sie die Nichtchristen abschlachten können. Christus kommt dem heidnischen Gott Dionysos gleich, Hexerei ähnelt dem christlichen Gebet, und ein Gebet klingt nach einem Zauberspruch. Dies ist der dritte Band der Trilogie “Julianus Apostata”. Der Umfang des dritten Bandes entspricht ca. 300 Buchseiten. Der “CHRIST UND ANTICHRIST”-Zyklus “Julianus Apostata” ist die erste Roman-Trilogie aus dem “Christ und Antichrist”-Zyklus von Dmitri Mereschkowski. Die beiden anderen Trilogien sind “Leonardo da Vinci” und “Peter der Große”. Jede der drei Trilogien des “Christ und Antichrist”-Zyklus ist eine in sich geschlossene Geschichte und lässt sich unabhängig von den übrigen Trilogien als eigenständige historische Romanbiographie lesen. Zugleich sind die Trilogien aufgrund motivischer Zusammenhänge miteinander verknüpft. Der Autor wurde durch dieses Werk sowohl in Russland als auch in Westeuropa bekannt und insgesamt neunmal für den Nobelpreis für Literatur nominiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
JULIANUS APOSTATA
von
DMITRI MERESCHKOWSKI
Historische Roman-Trilogie
Übersetzt vonAlexander Eliasberg
BAND 3
Dieses Buch ist Teil der BRUNNAKR Edition: Fantasy, Historische Romane, Legenden & Mythen.
BRUNNAKR ist ein Imprint des apebook Verlags.
Nähere Informationen am Ende des Buches oder auf:
www.apebook.de
1. Auflage 2020
V 1.0
ISBN 978-3-96130-339-7
Buchgestaltung/Coverdesign: SKRIPTART
www.skriptart.de
Alle Rechte vorbehalten.
© BRUNNAKR/apebook 2020
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Erhalte zwei eBook-Klassiker gratis als Willkommensgeschenk!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Der
“CHRIST UND ANTICHRIST”-Zyklus
von Dmitri Mereschkowski
JULIANUS APOSTATA(3 Bände)
LEONARDO DA VINCI(3 Bände)
PETER DER GROSSE(3 Bände)
Der erste Band der drei Trilogien ist jeweils kostenlos!
Inhaltsverzeichnis
Julianus Apostata. Band 3
Impressum
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Eine kleine Bitte
"Christ und Antichrist" Gesamtüberblick
BRUNNAKR Edition
Buchtipps für dich
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
L i n k s
Zu guter Letzt
I
Der berühmte Sophist und Hoflehrer der Beredsamkeit, Hecebolius, hatte seine Karriere an den untersten Stufen des Staatsdienstes begonnen. Zuerst war er Diener im Astartetempel zu Hierapolis gewesen. Mit sechzehn Jahren stahl er aus dem Tempel einige Wertgegenstände und flüchtete nach Konstantinopel, wo er alles Mögliche durchmachte; eine Zeitlang trieb er sich auf den Landstraßen herum, bald mit frommen Pilgern, bald mit einer Räuberbande von kastrierten Priestern der vielbrüstigen Göttin Dindymene, die auf einem Esel in den Dörfern herumgeführt wurde und beim Pöbel sehr beliebt war.
Schließlich kam er in die Schule des Rhetors Prohaeresius und wurde bald selbst Lehrer der Beredsamkeit.
Als in den letzten Regierungsjahren Konstantins des Großen das Christentum bei Hofe Mode wurde, nahm Hecebolius den neuen Glauben an. Die Kleriker waren ihm sehr gewogen, was auch auf Gegenseitigkeit beruhte.
Hecebolius wechselte oft und immer zur passendsten Zeit seinen Glauben, je nach der gerade herrschenden Windrichtung: bald trat er vom Arianismus zur Orthodoxie über, bald von der Orthodoxie zum Arianismus; jeder Übertritt bedeutete für ihn eine neue Sprosse auf der Leiter des Staatsdienstes. Die Geistlichen schoben ihn heimlich vorwärts, was er ihnen bei Gelegenheit mit Gleichem vergalt.
Seine Haare ergrauten, seine Beleibtheit verlieh ihm ein würdiges und angenehmes Aussehen, seine klugen Reden wurden immer einschmeichelnder und überzeugender, seine Wangen leuchteten in dem frischen Rot eines gesunden Alters. Seine Augen hatten gewöhnlich einen recht freundlichen Ausdruck; zuweilen leuchtete aber in ihnen etwas wie böser, durchdringender Spott eines frechen und kalten Geistes auf; in solchen Augenblicken senkte er eilig die Lider, und sofort erlosch der aufflackernde Funke. Das ganze Äußere des berühmten Sophisten nahm allmählich etwas von der Würde eines geistlichen Herrn an.
Er war ein strenger Faster und zugleich ein berühmter Gastronom; die Fastenspeisen auf seinem Tische waren im gleichen Maße raffinierter als die leckersten Fleischspeisen bei anderen Leuten, wie seine mönchischen Scherze gepfefferter waren als die gewagtesten heidnischen. Als Tischgetränk gebrauchte er den mit allerlei Gewürzen zubereiteten Zuckerrübensaft, und viele behaupteten, dass er besser als Wein schmecke; statt des gewöhnlichen Weißbrotes erfand er wohlschmeckende Fladen, die aus den Samen einer Wüstenpflanze, mit denen sich der heilige Pachomius in Ägypten genährt haben sollte, zubereitet waren.
Böse Zungen behaupteten, dass Hecebolius eine allzu große Schwäche für das zarte Geschlecht habe. Man erzählte sich folgende Anekdote. Eine junge Frau hatte einmal ihrem Beichtvater gestanden, dass sie Ehebruch begangen habe. – »Es ist eine große Sünde! Wer war aber der Betreffende, meine Tochter?«, fragte der Beichtvater. – »Es war Hecebolius, hochwürdiger Vater.« Das Gesicht des Geistlichen klärte sich auf: »Hecebolius! Nun, das ist ja ein heiliger und frommer Mann. Tue Buße, meine Tochter, und Gott wird dir verzeihen.«
Unter Kaiser Constantius bekam er das hochbesoldete Amt eines Hofrhetors und wurde mit der Senatorentoga mit Purpurstreifen und einer blauen Schärpe über die Schulter ausgezeichnet.
Aber gerade in jenem Augenblick, als er den letzten Schritt in seiner Karriere machen wollte, kam eine unangenehme Überraschung: Constantius starb und ihm folgte Julianus, ein ausgesprochener Feind der christlichen Kirche. Hecebolius verlor aber die Geistesgegenwart nicht: er tat dasselbe, was auch andere taten, aber klüger als die anderen und, was die Hauptsache war, weder zu früh, noch zu spät, sondern gerade zur rechten Zeit.
Julianus veranstaltete bald nach seinem Regierungsantritte im Palast einen theologischen Disput. Der junge, für seine Offenheit und seinen vornehmen Sinn allgemein geschätzte Philosoph und Arzt, Cäsarius von Kappadokien, ein Bruder des berühmten Kirchenvaters Basilius des Großen, trat als Verteidiger der christlichen Lehre gegen den Kaiser auf. Julianus gewährte bei ähnlichen Anlässen vollkommene Redefreiheit und sah es gerne, wenn man ihm ohne Rücksicht auf seine Person widersprach.
An dieser Versammlung nahmen zahlreiche Sophisten, Rhetoren, Priester und Kirchenlehrer teil, und es wurde heftig debattiert.
Die Streitenden ließen sich gewöhnlich, wenn auch nicht von den Argumenten des hellenischen Philosophen, so doch jedenfalls von der Majestät des römischen Kaisers imponieren und gaben nach.
Diesmal war aber die Sache anders: Cäsarius wollte nicht nachgeben. Er war noch jung, hatte eine mädchenhafte Anmut in den Bewegungen, seidenweiche Locken und klare, unschuldige Augen. Die Philosophie Platos nannte er »schlauverschlungene Schlangenweisheit« und stellte ihr die himmlische Weisheit des Evangeliums entgegen. Julianus war sehr ungehalten, wandte sich ab, biss sich in die Lippen und beherrschte seine Aufregung nur mit großer Mühe.
Der Streit führte, wie es bei allen ernst gemeinten Disputen der Fall ist, zu nichts.
Der Kaiser verließ die Versammlung mit freundlichem Gesicht und einigen philosophischen Scherzworten; er heuchelte wehmütige Versöhnlichkeit, war aber in Wirklichkeit schwer gekränkt.
In diesem Augenblicke näherte sich ihm der Hofrhetor Hecebolius, den der Kaiser für seinen Gegner hielt.
Hecebolius kniete vor ihm nieder und begann eine Bußrede: er hätte schon lange geschwankt, nun sei er aber durch die Argumentation des Kaisers endgültig bekehrt worden; er verdamme den finsteren Aberglauben der Galiläer; seine Seele kehre zu den Erinnerungen seiner Kindheit, zu den leuchtenden olympischen Göttern zurück.
Der Kaiser half dem Greise auf die Beine und war so gerührt, dass er keine Worte fand; er drückte ihn nur kräftig an die Brust und küsste ihn auf die weichen, rasierten Wangen und auf die roten, fleischigen Lippen.
Um seinen Sieg voll auszukosten, suchte er mit den Blicken Cäsarius.
Julianus behielt Hecebolius einige Tage lang in seiner nächsten Umgebung; er erzählte bei jeder Gelegenheit und jedermann von dessen wunderbarer Bekehrung und war auf ihn stolz wie ein Priester auf ein Festopfer, oder wie ein Kind auf ein neues Spielzeug.
Er wollte ihm ein Ehrenamt bei Hofe verleihen; Hecebolius lehnte aber ab, weil er einer solchen Ehre unwürdig sei und die Absicht habe, seine Seele durch Buße und Prüfungen zu den hellenischen Tugenden vorzubereiten und sein Herz durch den Dienst bei einem der alten Götter vom galiläischen Gräuel zu reinigen. Julianus ernannte ihn zum Hohepriester von Paphlagonien und Bithynien. Dieses Amt hieß bei den Heiden »Archiereus«.
Der Archiereus Hecebolius verwaltete zwei dicht bevölkerte asiatische Provinzen und gedieh bei diesem Amte ebenso glänzend wie bei dem alten. Er machte sich auch um die Bekehrung zahlreicher Galiläer zum hellenischen Glauben verdient.
Schließlich wurde er Hohepriester am berühmten Tempel der phönizischen Göttin Astarte-Atargatis, der er in seiner frühesten Kindheit gedient hatte. Dieser Tempel lag zwischen Chalkedon und Nikomedia auf einem hohen Felsvorsprung über den Wellen der Propontis; der Ort hieß Gargaria. Hierher strömten von allen Weltgegenden zahlreiche Pilger zusammen, um Aphrodite-Astarte, die Göttin des Todes und der Wollust, anzubeten.
II
In einem der großen Säle des Palastes von Konstantinopel beschäftigte sich Julianus mit den laufenden Staatsgeschäften.
Zwischen den Porphyrsäulen der gedeckten Halle schimmerte das blassblaue Meer hindurch. Der Kaiser saß vor einem runden Marmortisch, der mit Papyrus- und Pergamentrollen bedeckt war. Mehrere Schreiber kritzelten eifrig mit ihren ägyptischen Rohrfedern. Alle Beamten hatten verschlafene Gesichter; sie waren nicht gewohnt, so früh aufzustehen. Etwas abseits unterhielt sich der neue Archiereus Hecebolius im Flüsterton mit dem Beamten Junius Mauricus; dieser war ein höfischer Stutzer mit einem trockenen, gelben Gesicht und spöttischen Falten um die feinen Lippen.
Junius Mauricus war unter allen den gläubigen und abergläubischen Menschen einer der letzten Anhänger des Lukian, jenes großen Spötters aus Samosata, der in beißenden Dialogen alle Heiligtümer des Olymps und Golgathas, alle Überlieferungen von Hellas und Rom lächerlich gemacht hatte.
Julianus diktierte mit eintöniger Stimme einen Brief an den Oberpriester von Galatien, Arsakios:
»Verbiete deinen Priestern, Theater und Schenken zu besuchen und sich mit erniedrigenden Gewerben zu beschäftigen. Belohne die Gehorsamen und bestrafe die Widerspenstigen. Richte in jeder Stadt eine Herberge ein, wo nicht nur Hellenen, sondern auch Christen, Juden und Barbaren von unserer Freigebigkeit Gebrauch machen können. Für die Armen von Galatien bestimmen wir jährlich dreißigtausend Maß Weizen und sechzigtausend Xesten Wein; ein Fünftel davon sollst du an die Armen, die bei den Tempeln wohnen, verteilen, den Rest aber an arme Reisende und Bettler: es wäre eine Schande, den Hellenen eine Unterstützung zu versagen, während die Juden gar keine Bettler haben und die gottlosen Galiläer Leute von jedem Glauben ernähren, obwohl sie dabei wie Schurken verfahren, die die Kinder mit Süßigkeiten verlocken: sie beginnen mit Gastfreundschaft, Barmherzigkeit und Einladungen zu Liebesmahlen, die sie Sakramente nennen, verführen die Gläubigen allmählich zur Gottlosigkeit, und enden mit Fasten, Geißelungen des Fleisches, Schrecknissen der Hölle, Wahnsinn und Tod; dies ist der gewöhnliche Weg dieser Menschenhasser, die sich Menschenfreunde nennen. Besiege sie durch Barmherzigkeit im Namen der ewigen Götter. Verkünde diesen meinen Willen in allen Städten und Dörfern; erkläre den Bürgern, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit bereit bin, ihnen zur Hilfe zu kommen. Wenn sie aber mein besonderes Wohlwollen erlangen wollen, so sollen sie einmütig ihre Herzen und Seelen vor der Mutter der Götter, Dindymene von Pessinus, beugen und ihr in alle Ewigkeit Ehre und Ruhm erweisen.«
Die letzten Worte schrieb er mit eigener Hand.
Inzwischen wurde ihm das Frühstück gereicht, das aus einfachem Weizenbrot, frischen Oliven und einem leichten Weißwein bestand. Julianus aß und trank, ohne seine Arbeit zu unterbrechen; plötzlich wandte er sich um und fragte seinen alten Lieblingssklaven, der aus Gallien stammte und den Kaiser stets bei der Tafel bediente, auf den goldenen Teller mit den Oliven weisend:
»Warum der goldene? Wo ist der gewöhnliche Tonteller?«
»Verzeihe, Fürst! Er ist zerbrochen.«
»In Scherben?«
»Nein, nur der Rand ist abgeschlagen.«
»Bring ihn her.«
Der Sklave eilte fort und brachte einen Tonteller mit abgeschlagenem Rand.
»Das macht nichts, der Teller kann mir noch lange Zeit dienen«, sagte Julianus mit einem gutmütigen Lächeln.
»Ich habe bemerkt, meine Freunde, dass zerschlagene Gegenstände besser und länger dienen als die neuen. Ich muss gestehen, dass ich diese Schwäche habe: ich hänge immer an alten Gegenständen und sehe an ihnen einen besonderen Reiz, wie an alten Freunden. Ich fürchte mich vor einer jeden Neuerung und Änderung. Das Alte, wenn es auch schlecht ist, tut mir immer leid; das Alte ist immer so gemütlich und rührend ...«
Er lachte über seine eigenen Worte.
»Ihr seht, welche Gedanken mir zuweilen bei einem zerschlagenen Teller kommen!«
Junius Mauricus zupfte Hecebolius am Saum seines Gewandes:
»Hast du es gehört? Hier kannst du seine ganze Natur sehen: er hängt ebenso an seinen zerschlagenen Tellern, wie an seinen halbtoten Göttern. Und er soll nun über das Schicksal der Welt entscheiden! ...«
Julianus geriet in Stimmung und kam von den Edikten und Gesetzen auf seine Pläne für die Zukunft zu sprechen: in allen Städten seines Reiches sollten Schulen, Lehrstühle, Vorlesungen über die hellenischen Glaubenssätze, festgesetzte Gebetstexte und Tempelbußen, philosophische Predigten, Asyle für Männer, die die Keuschheit lieben und sich der Wissenschaft widmen, eingeführt werden.
»Wie gefällt es dir?«, flüsterte Mauricus Hecebolius ins Ohr: »Jetzt plant er Klöster zu Ehren Aphrodites und Apollos. Es wird immer schöner! ...«
»Ja, meine Freunde, dies alles wollen wir wirklich mit Hilfe der Götter ins Werk setzen«, schloss der Kaiser. »Die Galiläer wollen der Welt zeigen, dass nur sie allein etwas von Barmherzigkeit verstehen; die Barmherzigkeit ist aber allen Philosophen eigen, welchen Göttern sie auch dienen. Ich bin gekommen, um der Welt eine neue Liebe zu predigen; eine Liebe, die nicht sklavisch und abergläubisch ist, sondern frei und freudig wie der Himmel der Olympier!«
Er sah alle Anwesenden prüfend an. Er konnte aber in den Gesichtern der Beamten nichts von jenem Ausdruck entdecken, den er erwartete.
Einige Deputierte von den christlichen Lehrern der Rhetorik und Philosophie betraten den Saal. Vor kurzem war ein Edikt erlassen worden, der den galiläischen Lehrern den Unterricht in der hellenischen Redekunst untersagte; die christlichen Rhetoren mussten sich entweder von Christo lossagen oder ihre Lehrstühle verlassen.
Einer der Deputierten näherte sich dem Augustus mit einer Pergamentrolle in der Hand; es war ein schmächtiges, schüchternes Männchen, das einem alten, gerupften Papagei glich; zwei rotbackige, plumpe Scholaren begleiteten ihn.
»Frömmster Kaiser, erbarme dich unser!«
»Wie heißt du?«
»Papyrianus, Bürger von Rom.«
»Mein lieber Papyrianus, ich will euch nichts Böses tun. Im Gegenteil. Bleibt nur bei eurem galiläischen Glauben.«
Der Alte fiel dem Kaiser zu Füßen und umarmte seine Knie.
»Seit vierzig Jahren unterrichte ich in der Grammatik. Ich kenne den Homer und den Hesiod nicht schlechter als andere ...«
»Was willst du also noch?«, fragte der Kaiser mit finsterer Miene.
»Sechs Kinder habe ich, Fürst, und alle sind noch klein. Nimm mir nicht das letzte Stück Brot. Meine Schüler lieben mich. Frage sie nur ... Lehre ich sie denn etwas Schlechtes? ...«
Papyrianus konnte vor Aufregung nicht weiter sprechen; er zeigte auf die beiden Schüler, die verlegen und errötend dastanden und nicht wussten, was sie mit ihren Händen anfangen sollten.
»Nein, Freunde!«, unterbrach ihn der Kaiser leise und bestimmt. »Das Gesetz ist gerecht. Ich halte es für einen Unsinn, wenn die christlichen Rhetoren den Homer erläutern und dabei jene Götter, die Homer anbetete, verleugnen. Wenn ihr der Ansicht seid, dass unsere Weisen nichts als Märchen erdacht haben, so geht nur in eure Kirchen, um da den Matthäus und Lukas zu lehren! Merkt es euch, ihr Galiläer, dass ich es nur zu eurem eigenen Besten so angeordnet habe ...«
Unter den Rhetoren brummte jemand in den Bart:
»Zu unserem eigenen Besten werden wir vor Hunger krepieren!«
»Christliche Lehrer, ihr fürchtet, euch mit dem Opferfleisch oder dem Opferwasser zu verunreinigen«, fuhr der Kaiser unbeirrt fort, »warum fürchtet ihr nicht, euch damit zu verunreinigen, was gefährlicher ist als jedes Fleisch und jedes Wasser, nämlich mit der falschen Weisheit? Ihr sagt: ›Selig sind, die da geistlich arm sind.‹ Seid also geistlich arm. Glaubt ihr vielleicht, dass ich eure Lehre nicht kenne? O, ich kenne sie besser als irgendeiner unter euch! Ich sehe in den Geboten des Galiläers eine solche Tiefe, wie ihr sie gar nicht ahnt. Doch jedem das Seine: überlasst uns unsere eitle Weisheit, unsere armselige, hellenische Gelehrsamkeit. Was braucht ihr diese verseuchten Quellen? Ihr seid doch im Besitze einer höheren Weisheit. Wir haben das Reich von dieser Welt, euch aber gehört das Himmelreich. Bedenkt doch: das Himmelreich ist doch nicht zu gering für so demütige und bescheidene Menschen, wie ihr es seid. Die Dialektik kann nur zu freigeisterischer Ketzerei führen! Im Ernst! Seid einfältig wie die Kinder. Ist denn die gottbegnadete Unwissenheit der Fischer aus Kapernaum nicht erhabener als alle Dialoge des Plato? Die ganze Weisheit der Galiläer besteht in dem einen Wort: glaube! Wenn ihr echte Christen wäret, so hättet ihr mein Gesetz gesegnet. Nicht euer Geist empört sich dagegen, sondern euer Fleisch, dem die Sünde süß ist. – Das ist alles, was ich euch zu sagen habe, und ich hoffe, dass ihr es mir nicht übel nehmt und einseht, dass der römische Kaiser mehr um euer Seelenheil besorgt ist als ihr selbst.«
Ruhig und mit seinen Worten zufrieden schritt er durch die Menge der Rhetoren.
Papyrianus, der noch immer kniete, raufte sich seine dünnen, grauen Locken.
»Wofür, Himmelskönigin, wofür müssen wir das erdulden?«
Als die Schüler den Schmerz ihres Lehrers sahen, trockneten sie sich mit den plumpen, roten Fäusten ihre hervorquellenden Tränen.
III
Der Cäsar erinnerte sich noch an die unendlichen Kämpfe zwischen den Orthodoxen und den Arianern, denen er auf dem Konzil zu Mailand unter Kaiser Constantius beigewohnt hatte. Er beschloss, diese Feindschaft für seine Zwecke auszunützen und gleich seinen christlichen Vorgängern Konstantin dem Großen und Constantius ein Konzil einzuberufen.
Einmal erklärte er seinen erstaunten Freunden bei einem intimen Gespräch, dass er die Absicht habe, alle Verfolgungen und Gewalttätigkeiten gegen die Galiläer einzustellen, ihnen volle Glaubensfreiheit zu gewähren, und alle die Ketzer – Donatisten, Semiarianer, Marcioniten, Montanisten, Cäcilianer und wie sie alle noch hießen –, die nach den Konzilsbeschlüssen unter Konstantin und Constantius verbannt worden waren, zu begnadigen und zurückzuberufen. Er war überzeugt, dass es das beste Mittel sei, um die Christen zu vernichten. »Ihr werdet es sehen, meine Freunde!«, sagte der Kaiser, »wenn sie alle wieder zurückkehren, so wird unter diesen Menschenfreunden ein solcher Kampf ausbrechen, dass sie sich gegenseitig wie Raubtiere in Stücke reißen und dem Namen ihres Meisters mehr Schimpf antun werden, als ich es mit den grausamsten Strafen erreichen könnte!«
In alle Ecken und Enden des Römischen Reiches wurden Edikte und Schreiben versandt, nach denen es den verbannten Klerikern gestattet wurde, unbehelligt in ihre früheren Wohnorte zurückzukehren. Eine allgemeine Glaubensfreiheit wurde verkündet. Zugleich wurden die weisesten galiläischen Kirchenlehrer aufgefordert, nach Konstantinopel an den Hof zu kommen, um über einige kirchliche Angelegenheiten zu beraten. Die meisten der Eingeladenen wussten nichts vom Zweck, von der Zusammensetzung und von den Vollmachten der Versammlung; alle diese Fragen wurden in den Sendschreiben absichtlich höchst unklar dargelegt. Viele erkannten die schlaue List des gottlosen Kaisers und lehnten die Einladung ab, sich mit einer Krankheit oder der weiten Entfernung entschuldigend.
Der blaue Morgenhimmel erschien dunkel im Vergleich zu dem blendend weißen Marmor der doppelten Säulenreihe, die den großen Schlosshof, das Atrium Constantinum umgab. Weiße Tauben wirbelten mit freudigem, weichem Flügelrauschen wie Schneeflocken herum und entschwanden den Blicken. In der Mitte des Hofes stand im hellen Wasserstaub eines Springbrunnens eine Aphrodite Kallipygos; der feuchte Marmor schimmerte wie lebendige Haut. Die Mönche, die an ihr vorübergehen mussten, wandten sich ab, um sie nicht zu sehen; sie stand aber zwischen ihnen, schelmisch, nackt und zart.
Julianus hatte für das Konzil diesen etwas seltsamen Platz nicht ohne eine geheime Nebenabsicht gewählt. Die dunklen Kutten der Mönche erschienen hier noch dunkler, und die ausgemergelten, düsteren Gesichter der verbannten Ketzer noch finsterer; sie schlichen wie schwarze, hässliche Schatten über den sonnenbeschienenen Marmor.
Alle fühlten sich geniert; ein jeder gab sich Mühe, gleichgültig und sogar selbstbewusst zu erscheinen, und stellte sich so, als ob er den neben ihm stehenden Feind, dem er, oder der ihm das Leben vergiftete, nicht erkenne; und trotzdem warfen sie einander verstohlen prüfende und gehässige Blicke zu.
»Heilige Mutter Gottes! Was ist nun das? Wo sind wir hingeraten?«, regte sich der greise und beleibte Bischof von Sebaste, Eustathius, auf. »Lasst mich, lasst mich hinaus ...«
»Beruhige dich, mein Freund!«, überredete ihn der Oberst der Gardelanzenträger, der Barbar Dagalaïfus, ihn höflich von der Tür wegschiebend.
»In einem Konzil von Ketzern habe ich nichts zu suchen! Lasst mich hinaus!«
»Der allergnädigste Cäsar hat befohlen, dass alle Teilnehmer am Konzil ...«, entgegnete Dagalaïfus, indem er den Bischof mit der größten Liebenswürdigkeit zurückzuhalten suchte.
»Es ist kein Konzil, sondern eine Räuberhöhle!«, schrie Eustathius empört.
Unter den Christen fanden sich auch solche, die sich über das kleinstädtische Aussehen, über die Kurzatmigkeit und die prononcierte armenische Aussprache des Eustathius lustig machten. Er war dadurch ganz eingeschüchtert, drückte sich in eine Ecke, wurde kleinlaut und wiederholte nur verzweifelt vor sich hin:
»Gott! Womit habe ich das verdient? ...«
Auch Euandros von Nikomedia bereute, hierher gekommen zu sein und den eben in Konstantinopel eingetroffenen Jünger des Didymos Juventinus mitgebracht zu haben.
Euandros war ein großer Dogmatiker, ein Mann von scharfem und tiefem Geist; seinem Studium hatte er seine Gesundheit geopfert und war frühzeitig gealtert; seine Sehkraft war geschwächt und seine kurzsichtigen, gutmütigen Augen drückten immer Müdigkeit aus. Die zahlreichen ketzerischen Lehren beschäftigten immer seinen Geist; sie gaben ihm keine Ruhe, quälten ihn bei Tag, erschreckten ihn in seinen Träumen und zogen ihn mit ihren verführerischen Finessen und Kunstgriffen an. Er sammelte viele Jahre lang alle diese Lehren zu einem umfangreichen Manuskript, das »Gegen die Ketzer« betitelt war; er tat es mit dem gleichen Eifer, mit dem andere Liebhaber allerlei Raritäten sammeln. Er suchte mit Gier nach neuen Ketzerlehren und erfand selbst solche, die es nie gegeben hatte; je eifriger er sie bekämpfte, umso mehr verfing er sich in ihnen. Zuweilen flehte er Gott verzweifelt an, er möchte ihm doch einen einfältigen Glauben verleihen; Gott wollte ihm aber diese Einfalt nicht geben. Im täglichen Leben war er unbeholfen und vertrauensselig wie ein Kind. Den bösen Menschen fiel es sehr leicht, Euandros zu betrügen; über seine Zerstreutheit waren viele köstliche Geschichten im Umlauf.
Seine Zerstreutheit war auch der Grund, warum er zu dieser unsinnigen Versammlung gekommen war; teilweise lockte ihn auch die Aussicht, hier irgendeine neue Abart von Ketzerei kennenzulernen. Bischof Euandros machte ein verdrießliches Gesicht und beschirmte seine schwachen Augen mit der Hand vor dem blendenden Sonnenlicht und Marmor. Das Ganze kam ihm nicht ganz geheuer vor; er wollte möglichst bald in seine halbfinstere Zelle zu seinen Büchern und Handschriften zurückkehren. Den Juventinus ließ er nicht von seiner Seite; er verspottete die verschiedenen ketzerischen Lehren und warnte den Jüngling vor Ärgernis.
Durch den Saal schritt ein stämmiger Greis mit breiten Backenknochen und einem Kranz grauer, weicher Haare; es war der siebzigjährige Bischof Purpurius, ein afrikanischer Donatist, den Julianus aus der Verbannung zurückgerufen hatte.
Den Kaisern Konstantin und Constantius war es nicht gelungen, die Ketzerei der Donatisten zu unterdrücken. Ganze Ströme von Blut wurden nur aus dem Grund vergossen, weil vor fünfzig Jahren in Afrika ein gewisser Donatus unrechtmäßig anstelle eines Cäcilianus zum Bischof geweiht worden war; vielleicht war es auch umgekehrt, nämlich so, dass Cäcilianus anstelle des Donatus geweiht worden war – es ließ sich nicht mehr mit Bestimmtheit feststellen. Jedenfalls tobten zwischen den Cäcilianern und den Donatisten mörderische Kämpfe; in diesem Bruderzwist, der nicht einmal zwei Meinungen, sondern nur zwei Namen zur Ursache hatte, war kein Ende abzusehen.
Juventinus sah, wie ein cäcilianischer Bischof im Vorübergehen mit dem Saum seines Messgewandes das Gewand des Donatisten Purpurius streifte. Dieser fuhr zusammen, hob angeekelt mit zwei Fingern, sodass es alle sehen konnten, sein durch die Berührung eines Ketzers verunreinigten Mantel in die Höhe und schüttelte ihn kräftig, um den unsichtbaren Unrat zu entfernen. Euandros erzählte Juventinus, dass, wenn ein Cäcilianer zufällig in eine Kirche der Donatisten käme, diese ihn herausjagten und dann die Steinfließen, die der Fuß des Ketzers berührt hätte, sorgfältig mit Salzwasser abwuschen.
Dem Bischof Purpurius folgte auf den Fersen, wie ein Hund, sein treuer Leibwächter, der Diakon Leona, ein halbwilder, riesengroßer Neger von schrecklichem Aussehen, mit plattgedrückter Nase und dicken Lippen, eine riesenhafte Keule in den sehnigen Armen. Er gehörte zur Sekte der Selbstverstümmler, »Circumcellionen«, die in den hetulischen Dörfern hausten. Sie liefen mit Waffen in der Hand auf den Landstraßen herum, boten den ihnen begegnenden Wanderern Geld an und schrien: »Tötet uns, sonst töten wir euch!« Die Circumcellionen verstümmelten sich mit Feuer und mit Eisen und ertränkten sich zur Ehre Christi; doch begingen sie nie Selbstmord durch Erhängen, denn die Todesart des Judas Ischariot war ihnen verhasst. Zuweilen stürzten sich ganze Haufen von Anhängern dieser Sekte unter Absingen von Psalmen in Abgründe; sie behaupteten, dass der zur Ehre des Höchsten begangene Selbstmord die Seele von allen Sünden reinige. Das Volk verehrte sie als Märtyrer, vor dem Selbstmorde gaben sie sich allen möglichen Genüssen hin – aßen, tranken und vergingen sich an Weibern. Viele von ihnen gebrauchten statt des von Christus verbotenen Schwertes schwere Keulen, mit denen sie mit ruhigem Gewissen, »im Einklang mit der Schrift«, die Heiden und die Ketzer totschlugen; während sie Blut vergossen, schrien sie: »Ehre sei Gott!« Die Bewohner der friedlichen, afrikanischen Städte und Dörfer fürchteten diesen heiligen Ruf mehr als das Gebrüll von Löwen und die Kriegstrompeten der Feinde.
Die Donatisten betrachteten die Circumcellionen als ihre Leibgarde; da die hetulischen Bauern wenig von der Dogmatik verstanden, so wiesen ihnen die Donatisten, die gebildete Theologen waren, an, wen sie »im Einklang mit der Schrift« erschlagen sollten.
Euandros zeigte dem Juventinus einen schönen Jüngling, mit einem Gesicht, so unschuldig und zart wie bei einem jungen Mädchen; es war ein Kainit.
»Selig sind«, so predigten die Kainiten, »unsere stolzen und aufrührerischen Brüder: Kain, Cham, die Bewohner von Sodom und Gomorrha – das Geschlecht der Höchsten Sophia, der verborgensten Weisheit! Kommt zu uns alle Verfolgten, alle Aufrührerischen, alle Besiegten! Gesegnet sei Judas! Er allein unter den Aposteln besaß das höchste Wissen, die Gnosis. Er hatte Christus verraten, damit Christus sterbe und auferstehe; Judas wusste, dass Christus mit seinem Tod die Welt erlösen werde. Der in unsere Weisheit Eingeweihte muss alle Grenzen überschreiten, alles wagen, das Greifbare verachten und jede Angst vor dem Greifbaren überwinden; er muss alle Sünden, alle fleischlichen Genüsse kennenlernen, und so von jenem heilsamen Abscheu gegen alles Fleisch erfüllt werden, der die höchste Reinheit der Seele bedeutet!«
»Sieh, Juventinus, hier ist ein Mensch, der sich für unvergleichlich erhabener als alle Seraphim und Erzengel hält«, sagte Euandros, auf einen jungen, schlanken Ägypter hinweisend, der etwas abseits stand, nach der letzten byzantinischen Mode gekleidet war, zahllose wertvolle Ringe an den gutgepflegten weißen Händen hatte und dessen feinen Lippen, die wie bei einer Dirne geschminkt waren, ein listiges Lächeln umspielte; es war der Valentinianer Cassiodorus.
»Die Orthodoxen«, lehrte Cassiodorus, »haben zwar eine Seele wie die anderen Tiere, doch keinen Geist. Nur wir, die wir in die Geheimnisse der Gnosis und der Pleroma eingeweiht sind, verdienen den Namen Mensch; alle anderen sind Schweine und Hunde.«
Cassiodorus schärfte seinen Schülern ein: