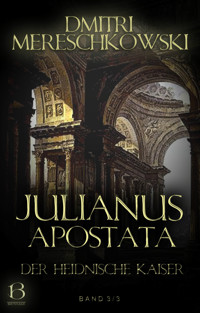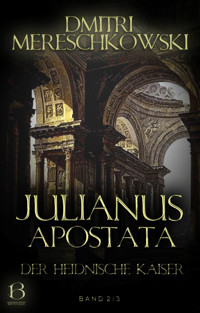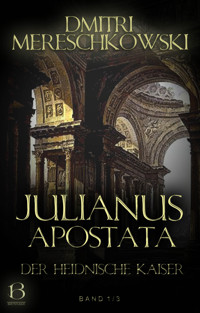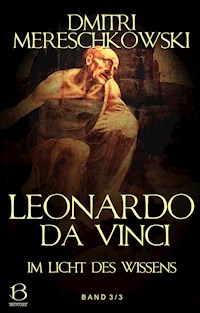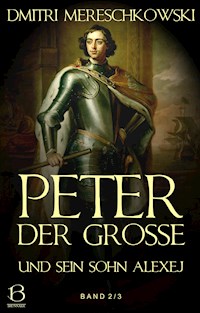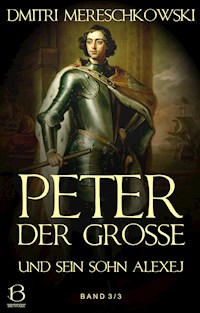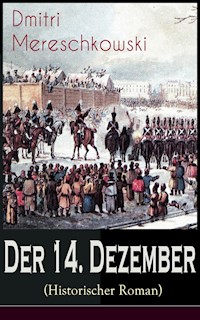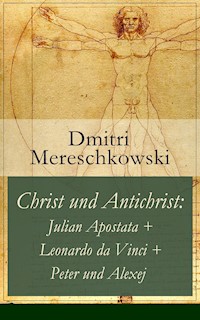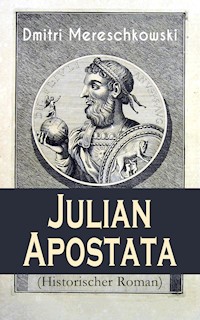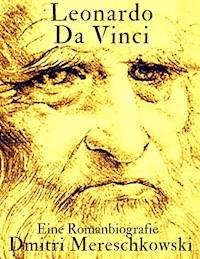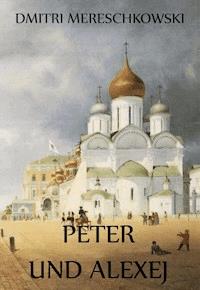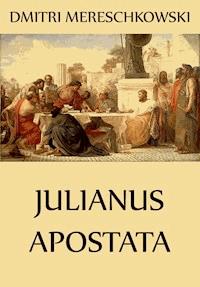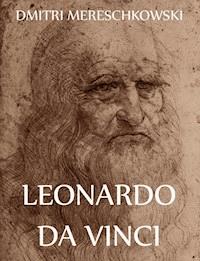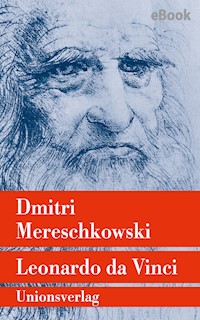
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maler, Ingenieur, Forscher, Philosoph – Leonardo da Vincis Werk und Wirken strahlt in seiner visionären Kraft und ästhetischen Vollendung bis in unsere Zeit hinein. Doch nicht nur das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa beschäftigt Wissenschaftler jeder Epoche – auch der Mann, der es schuf, gibt immer noch Rätsel auf. Der berühmte russische Symbolist Dmitri Mereschkowski hat aus den Quellen der Epoche den bis heute nicht übertroffenen Lebensroman Leonardos geschrieben. In leuchtenden Farben ergründet er den Menschen hinter dem Mythos und sein Wirken in einer Zeit, in der Weltbilder ins Wanken geraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1129
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Maler, Ingenieur, Forscher, Philosoph – Leonardo da Vincis Werk und Wirken strahlt in seiner visionären Kraft und ästhetischen Vollendung bis in unsere Zeit hinein. Der berühmte russische Symbolist Dmitri Mereschkowski hat aus den Quellen der Epoche den bis heute nicht übertroffenen Lebensroman Leonardos geschrieben.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Dmitri Mereschkowski (1865–1941) gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Russischen Symbolismus. Sein Roman Leonardo da Vinci wurde unmittelbar nach Erscheinen 1901 vielfach übersetzt und erreichte weltweit hohe Auflagen. Neunmal war er für den Literaturnobelpreis nominiert.
Zur Webseite von Dmitri Mereschkowski.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Dmitri Mereschkowski
Leonardo da Vinci
Roman
Aus dem Russischen von Erich Boehme
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1901 unter dem Titel Leonardo da Vinci. Voskresšie bogi in Sankt Petersburg.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1903 in der Verlagsbuchhandlung Schulze & Co., Leipzig.
Diese vorliegende Fassung folgt der 1953 in der Droemerschen Verlagsanstalt, München, erschienenen Ausgabe.
Originaltitel: Leonardo da Vinci. Voskressie bogi
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Janaka Dharmasena
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30843-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 17:41h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
LEONARDO DA VINCI
1 — Die weiße Teufelin2 — Ecce Deus – Ecce Homo3 — Die giftigen Früchte4 — Der Hexensabbat5 — Dein Wille geschehe6 — Das Tagebuch des Giovanni Beltraffio7 — Die Verbrennung der Eitelkeiten8 — Das Goldene Zeitalter9 — Die Doppelgänger10 — Stille Wogen11 — Wir werden Flügel haben12 — Aut Caesar, aut nihil13 — Das rote Tier14 — Monna Lisa Gioconda15 — Die heilige Inquisition16 — Leonardo, Michelangelo und Raffael17 — Der Tod, der geflügelte VorläuferAnmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Dmitri Mereschkowski
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Malerei
Zum Thema Biografie
Zum Thema Italien
Zum Thema Geschichte
Zum Thema Kunst
1
Die weiße Teufelin
Neben der Kirche Orsanmichele in Florenz befanden sich die Warenlager der Färberinnung.
An den Häusern klebten plumpe Vorbauten, Speicher, ungleiche Erker auf schrägen Holzstützen, und stießen mit ihren Ziegeldächern so dicht zusammen, dass nur ein schmaler Spalt des Himmels sichtbar blieb und die Gasse auch bei Tag im Dunkel lag.
Vor den Ladentüren hingen an Querhölzern Muster fremdländischer, in Florenz gefärbter Wollstoffe. In der Mitte der mit flachen Steinen gepflasterten Straße lief ein Graben, der bunt schillernde, aus den Bottichen der Färbereien stammende Abwässer führte. Über den Toren der ansehnlichsten Lager – Fondachi – hingen Schilder mit dem Wappen von Calimala, der Färberinnung: ein goldener Adler im roten Feld, auf einem runden Ballen weißer Wolle.
In einem dieser Fondachi saß, von Geschäftspapieren und dicken Kontobüchern umgeben, der reiche florentinische Kaufherr und Konsul des »edlen Handwerks von Calimala«, Messer Cipriano Buonaccorsi.
Den alten Herrn fröstelte im kalten Licht des Märztages und dem feuchten, seinen vollgestopften Warenlagern entströmenden Dunst. Er wickelte sich fester in den schon recht abgetragenen, an den Ellbogen durchgescheuerten Eichhornpelz. Ein Gänsekiel steckte hinter seinem Ohr. Mit schwachen, kurzsichtigen, doch alles sehenden Augen prüfte er, nur scheinbar nachlässig, in Wahrheit aber sehr genau, die Pergamentblätter eines gewaltigen Kontobuchs, dessen durch Längs- und Querlinien in Rubriken geteilte Seiten rechts das Soll, links das Haben verzeichneten. Mit gleichmäßig runder Handschrift waren hier auch die Waren eingetragen, ohne große Anfangsbuchstaben, ohne Punkte und Kommas, die Zahlen in römischen, nicht in arabischen Ziffern, die bisher noch als leichtfertige, für Geschäftsbücher unpassende Neuerung galten. Auf der ersten Seite stand in großer Schrift zu lesen: »Im Namen unseres Herrn Jesu Christi und der Heiligen Jungfrau Maria wird dieses Kontobuch begonnen im Jahr 1494 nach Christi Geburt.«
Als Messer Cipriano die letzten Eintragungen nachgeprüft und sorgfältig einen Fehler im Verzeichnis der als Pfand angenommenen Posten von Wollwaren, Pfefferschotenballen, Mekka-Ingwer und Zimtbündeln verbessert hatte, lehnte er sich müde im Sessel zurück und überdachte einen Geschäftsbrief, den er an seinen Repräsentanten auf der Tuchmesse zu Montpellier in Frankreich schreiben wollte.
Da trat jemand in den Laden. Der Alte schlug die Augen auf und erblickte den Bauern Grillo, der ihm das Ackerland und die Weinberge bei seiner Vorstadtvilla in San Gervasio im Tal des Mugnone abgepachtet hatte.
Grillo machte eine Verbeugung. Er hielt einen Korb mit dunkelgelben, vorsichtig in Häcksel verpackten Eiern in Händen. Zwei an den Beinen zusammengebundene, mit den Köpfen nach unten baumelnde Hähnchen zappelten an seinem Gürtel.
»Ah, Grillo, du bist es!«, sagte Buonaccorsi in der herzlichen Art, die er im Verkehr mit Vornehmen wie mit Geringen an sich hatte. »Wie geht es? Ein schöner Frühling dieses Jahr, nicht?«
»Uns Alten bringt auch das Frühjahr nichts Erfreuliches mehr, Messer Cipriano. Die Knochen tun weh und sehnen sich nach dem Grab. Ich bringe Euer Gnaden Eier und ein paar Hähnchen zum Osterfest«, fügte Grillo nach einer Pause hinzu. Dabei zwinkerte er freundlich verschmitzt, wobei sich feine bräunliche Runzeln um seine grünlichen Augen bildeten, wie sie an Sonne und Wind gewöhnten Menschen eigen sind.
Buonaccorsi dankte dem Alten und begann ihn über geschäftliche Dinge zu befragen: »Nun, sind die Arbeiter draußen bereit? Werden wir bis Tagesanbruch fertig?«
Grillo seufzte nachdenklich und lehnte sich auf seinen Stock. »Es ist alles bereit. Auch Arbeiter haben wir zur Genüge. Doch möchte ich vorschlagen, Messere, die Sache lieber noch etwas zu verschieben.«
»Du hast doch neulich selbst gesagt, Alter, wir dürften nicht zaudern, damit uns keiner zuvorkommt!«
»Das stimmt schon. Aber ich habe Angst. Jetzt in den heiligen Fastentagen! Und unsere Sache ist keine gute …«
»Die Sünde nehme ich auf mich. Hab keine Furcht, ich verrate dich nicht. Werden wir aber wirklich etwas finden?«
»Weshalb nicht? Alle Anzeichen sprechen dafür. Schon unsere Väter und Großväter kannten den Hügel hinter der Mühle, an der Nassen Senke. Nachts flimmern sogar Irrlichter über San Giovanni. Es gibt viel zu viel solch Zeug hierzulande! Die Leute erzählen, erst kürzlich habe man beim Brunnenbau in einem Weinberg von Marignola einen Teufel aus dem Lehm ausgegraben.«
»Was redest du da? Was für einen Teufel?«
»Aus Kupfer. Mit Hörnern, zottigen Ziegenbeinen und Hufen. Sein Gesicht war sehr spaßig, als ob er lachte. Er tanzte auf einem Bein und schnippte mit den Fingern. Ganz grün und schimmelig war er vor Alter.«
»Und, was hat man mit ihm gemacht?«
»Eine Glocke für die Kapelle des Erzengels Michael hat man aus ihm gegossen.«
Messer Cipriano fuhr zornig auf. »Weshalb hast du mir das nicht längst erzählt, Grillo?«
»Ihr wart damals in Geschäften abwesend und weiltet in Siena.«
»Du hättest mir schreiben können. Ich hätte jemand hingeschickt oder wäre selbst gekommen. Es wäre mir nicht ums Geld leid gewesen, den Leuten zehn Glocken gießen zu lassen. Diese Dummköpfe! Aus einem tanzenden Faun eine Glocke gießen zu lassen! Vielleicht war es gar ein Werk des griechischen Bildhauers Skopas!«
»Die Leute waren wirklich Dummköpfe! Seid ihnen nicht böse, Messer Cipriano. Sie haben ihre Strafe. Seit zwei Jahren, seit die neue Glocke hängt, frisst der Wurm ihnen die Äpfel und Kirschen in den Gärten, und die Oliven geraten auch nicht. Die Glocke hat nicht einmal einen schönen Klang.«
»Wieso?«
»Wie soll ich das näher beschreiben? Sie hat eben nicht den rechten Klang. Sie erquickt Christenherzen nicht – sie bimmelt nur so, ohne Sinn und Verstand. Nun ja, natürlich: Wie soll aus einem Teufel eine gute Glocke werden? Euer Gnaden mögen nicht zürnen; aber vielleicht hat der Pfarrer doch recht: Aus unreinen Dingen, sagt er, die man aus der Erde gräbt, kann nie Gutes entstehen! Also, wir müssen die Sache mit großer Vorsicht betreiben; Kreuz und Gebet müssen wir zu Hilfe nehmen, denn der Teufel ist schlau und arglistig: Zu einem Ohre kriecht er hinein, der Hundsfott, zum andern hinaus. Auch mit der Marmorhand, die Zacchello im letzten Jahr am Mühlenhügel ausgegraben hat, hat uns der Teufel genasführt: Nur Unglück hat sie gebracht, Gott bewahre uns! Der bloße Gedanke daran ist schon schrecklich.«
»Erzähl mir, Grillo, wie hast du damals die Hand gefunden?«
»Im Herbst war das, am Abend vor St. Martin. Wir saßen beim Nachtessen, die Frau hatte gerade ein Brotgericht auf den Tisch gestellt, da kam der Neffe meines Gevatters, der Knecht Zacchello, ins Zimmer gestürmt. Ich hatte ihn abends beim Mühlenhügel auf dem Felde gelassen – er sollte einen Olivenbaumstumpf ausroden, weil ich Hanf an der Stelle säen wollte. ›Herr, Herr!‹, stammelte Zacchello. Er sah schrecklich aus; er zitterte am ganzen Leib, und die Zähne klapperten ihm. ›Der Herr sei mit dir, Lieber‹, antwortete ich ihm. Er fuhr fort: ›Auf dem Feld geht Arges vor: Unter dem Baumstumpf kriecht ein Toter aus der Erde! Glaubt Ihr mir nicht, so geht selbst hin und überzeugt Euch mit eigenen Augen!‹ Wir nahmen unsere Laternen und machten uns auf den Weg. Es dunkelte schon. Hinter dem Wäldchen ging der Mond auf. Wir sahen den Baumstumpf. In der aufgewühlten Erde schimmerte etwas Weißes. Ich bücke mich und sehe eine Hand aus der Erde ragen: weiß, mit hübschen, feinen Fingern, wie sie die Stadtfräulein haben. Dass dich der Schinder!, denke ich, was ist das für eine Teufelei? Ich leuchte mit der Laterne in das Loch; da regt sich die Hand, und die Finger winken. Da hielt ichs nicht mehr aus; ich brüllte laut los und wäre beinahe lang hingefallen. Aber Großmutter Monna Bonda – sie ist Hebamme und Zauberin und immer noch ein rüstiges Weib, wenn auch schon alt – schreit uns an: ›Wovor habt ihr Angst, ihr Dummköpfe? Seht ihr nicht, dass die Hand nicht lebt und auch nicht tot ist? Aus Stein ist sie!‹ Sie packte die Hand und zog sie aus der Erde wie eine Rübe. Gerade im Gelenk war sie abgebrochen. ›Lass lieber, Großmutter!‹, rief ich, ›rühr sie nicht an! Wir wollen sie vergraben, damit sie uns kein Unglück bringt.‹ – ›Nein‹, meinte sie, ›das wäre nicht richtig. Erst müssen wir sie in die Kirche schaffen, damit der Pfarrer sie beschwört.‹ Sie hat mich aber begaunert, die Alte; sie brachte die Hand gar nicht zum Pfarrer, sondern versteckte sie im Winkel ihrer Truhe, wo sie allerhand Kram aufhebt: alte Lappen, Balsam, Kräuter und Amulette. Ich schalt sie und verlangte die Hand zurück. Aber sie gab sie nicht heraus. Seitdem vollbrachte Monna Bonda wunderbare Heilungen. Wenn jemand Zahnschmerzen hatte, berührte sie ihm nur die Backe mit der Götzenhand; sofort war die Schwellung weg. Fieber, Bauchweh, Fallsucht heilte sie auch. Wenn eine Kuh sich quälte, weil sie nicht kalben konnte, hielt ihr die Großmutter nur die steinerne Hand an den Bauch; dann brüllte die Kuh, und eh man sichs versah, lag das Kälbchen im Stroh.
Die Kunde verbreitete sich in der ganzen Gegend, und die Alte verdiente viel Geld. Aber Segen brachte es ihr nicht. Unser Pfarrer, Don Faustino, ließ mir keine Ruhe. In der Kirche vor der ganzen Gemeinde machte er mich von der Kanzel herab schlecht. Sohn des Verderbens nannte er mich, und Satansknecht! Beim Bischof drohte er mich zu verklagen, das heilige Sakrament wollte er mir verweigern. Die Buben auf der Straße rannten hinter mir her und wiesen mit Fingern auf mich: ›Da kommt Grillo! Grillo ist ein Zauberer, und seine Großmutter ist eine Hexe! Dem Teufel haben die beiden ihre Seelen verkauft.‹ Ihr könnt mir glauben, nicht einmal bei Nacht hatte ich Ruhe. Immer sah ich die Marmorhand vor mir, als käme sie näher und griffe mir liebkosend mit langen kalten Fingern nach dem Halse. Dann packte sie mich fester, presste mir die Gurgel zu, würgte mich …
Das ist ein böser Scherz, dachte ich. Und als die Großmutter eines Morgens auf die Wiese gegangen war, um noch im Tau Kräuter zu sammeln, stand ich vor Tagesanbruch auf, erbrach das Schloss ihrer Truhe, nahm die Hand heraus und brachte sie Euch. Der Trödler Lotto bot mir zwar zehn Soldi, und Ihr gabt nur acht. Aber auf zwei Soldi soll es mir für Euer Gnaden nicht ankommen, mein Leben gäbe ich für Euch hin; der Herr schenke Euch alles Gute, Euch und Monna Angelica und den lieben Kindern und Enkelkindern.«
»Nach allem, was du mir berichtest, werden wir im Mühlenhügel sicher etwas finden«, meinte Messer Cipriano sinnend.
»Finden schon«, antwortete der Alte mit einem tiefen Seufzer. »Aber wir müssen dafür sorgen, dass Don Faustino nichts davon erfährt. Wenn er etwas hört, kämmt er mir ohne Kamm derartig den Kopf, dass mir kaum wohl sein wird dabei. Euch würde es auch schaden, er kann die Leute aufhetzen und die Ausführung der Arbeit hindern. Nun aber, Gott ist gnädig. Verlasst mich nur nicht, Ihr seid mein Wohltäter. Legt ein gutes Wort für mich ein beim Richter!«
»Wegen des Stücks Land, das der Müller dir streitig macht?«
»Jawohl, Messere. Der Müller ist ein habsüchtiger Schurke. Er weiß, wo der Teufel den Schwanz hat. Ich habe dem Richter ein Kalb gebracht; da schenkte er ihm eine trächtige Kuh, und die kalbte während unseres Prozesses. Der Halunke hat mich überlistet! Ich habe große Sorge, der Richter könnte zu seinen Gunsten entscheiden: Zum Unglück hat die Kuh auch noch ein Stierkalb geworfen. Verwendet Euch väterlich für mich! Nur für Euer Gnaden gebe ich mir so viel Mühe mit dem Mühlenhügel. Für keinen Menschen nähm ich solche Sünde auf mich!«
»Mach dir nur keine Sorgen, Grillo. Ich bin mit dem Richter gut Freund und werde mich für dich verwenden. Jetzt geh! Lass dir in der Küche zu essen und zu trinken geben. Heute Nacht reiten wir zusammen nach San Gervasio.«
Grillo dankte mit tiefer Verbeugung und entfernte sich. Messer Cipriano aber zog sich in sein kleines Arbeitszimmer neben dem Laden zurück, das niemand außer ihm betreten durfte.
Wie in einem Museum standen und hingen hier allerhand Gegenstände aus Marmor und Bronze. Auf mit Tuch bespannten Regalen prangten alte Münzen und Medaillen; ungeordnete Bruchstücke von Statuen lagen in Kisten. Durch Vermittlung seiner zahlreichen Handelskontore erhielt Buonaccorsi aus aller Welt Antiquitäten, wo sie nur aufzutreiben waren: aus Athen, Smyrna, Halikarnass, Zypern, Leukosia, Rhodos, aus dem Inneren Ägyptens und Kleinasiens.
Der »Konsul von Calimala« betrachtete seine Schätze; dann versank er in ein tiefes, angestrengtes Sinnen über den Zoll auf Wolle. Als er alles gründlichst überdacht hatte, machte er sich daran, den Brief an seinen Repräsentanten in Montpellier aufzusetzen.
Hinten im Lagerraum aber, wo bis zur Decke gestapelte Warenballen auch bei Tag nur von einem vor dem Madonnenbild flackernden Lämpchen Licht empfingen, plauderten inzwischen drei junge Leute: Dolfo, Antonio und Giovanni. Messer Buonaccorsis Ladenhelfer Dolfo, ein rothaariger, gutmütig heiterer Jüngling mit einer Stupsnase, trug die Ellenzahl des abgemessenen Tuches in ein Buch ein. Antonio da Vinci, ein etwas altmodisch ausschauender junger Mensch mit gläsernen Fischaugen und widerspenstig hoch stehenden Büscheln spärlichen schwarzen Haares, maß behänd die Stoffe mit der Canna ab, dem florentinischen Längenmaß. Giovanni Beltraffio, ein aus Mailand stammender neunzehnjähriger, etwas schüchterner und linkischer Malschüler mit großen, schwermütigen grauen Unschuldsaugen und unentschlossenem Gesichtsausdruck, saß, die Beine übereinandergeschlagen, auf einem fertigen Ballen und lauschte aufmerksam dem Gespräch.
»Was man heutzutage alles erlebt«, sagte Antonio leise und bissig. »Jetzt werden schon heidnische Götter aus der Erde ausgegraben! Schottische Wolle, braun, haarig, zweiunddreißig Ellen sechs Spannen acht Oncien«, fügte er zu Dolfo gewandt hinzu, der die Zahlen in das Warenbuch eintrug.
Dann schleuderte Antonio das abgemessene und wieder zusammengerollte Tuch flink und geschickt auf den Platz, wo es hingehörte, hob den Zeigefinger und rief in prophetischem Ton, den Frate Girolamo Savonarola nachahmend: »Gladius Dei super terram cito et velociter!1 Der heilige Johannes hatte auf Patmos eine Vision: Ein Engel packte den Drachen, die uralte Schlange – das ist der Teufel –, fesselte ihn für tausend Jahre, stürzte ihn in den Abgrund, verschloss und versiegelte diesen, damit der Böse die Menschen nicht verführen könne, bevor die tausend Jahre – eine Zeit und eine halbe – verstrichen wären. Jetzt aber hat sich Satan aus dem Kerker befreit. Die tausend Jahre sind vergangen. Falsche Götter, Vorläufer und Knechte des Antichrist steigen aus der vom Engel versiegelten Erde, um die Menschen zu verführen. Wehe denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer! Brabanter Wolle, glatt, siebzehn Ellen vier Spannen neun Oncien …«
»Wie meint Ihr, Antonio?«, erkundigte sich Giovanni ängstlich, mit hastiger Neugier. »Alle diese Zeichen bedeuten …«
»Jawohl, ja. Nichts anderes. Wachet! Die Zeit ist nahe herbeigekommen. Jetzt gräbt man nicht nur alte Götter aus, sondern schafft auch neue, die den alten gleichen. Bildhauer und Maler von heute dienen dem Moloch – das ist der Teufel. Aus dem Hause Gottes machen sie einen Tempel des Satans. Unreine Götter stellen sie auf Heiligenbildern als Märtyrer und Heilige dar und beten sie an: Bacchus als Johannes den Täufer, die Hure Venus als Muttergottes. Verbrennen müsste man solche Bilder und die Asche in alle Winde zerstreuen!«
Die trüben Augen des frommen Gehilfen funkelten plötzlich in unheimlichem Feuer. Giovanni schwieg; er wagte nichts zu entgegnen und zog in hilfloser Gedankenarbeit die dünnen, kindlichen Brauen zusammen.
»Antonio«, sagte er dann, »ich habe gehört, dass Euer Vetter Leonardo da Vinci zuweilen Schüler in seine Werkstatt aufnimmt. Längst schon habe ich den Wunsch …«
»Wenn du das Verderben deiner Seele willst, Giovanni«, unterbrach ihn Antonio finster, »dann geh zu Messer Leonardo.«
»Wieso? Warum?«
»Er ist zwar mein Vetter und zwanzig Jahre älter als ich. Aber es steht geschrieben in der Heiligen Schrift: ›Wende dich ab vom Ketzer nach der ersten und zweiten Belehrung!‹ Messer Leonardo ist ein Ketzer und ein Gottesleugner. Satans Hochmut hat seinen Geist umnachtet. Mit Mathematik und schwarzer Magie sucht er die Geheimnisse der Natur zu ergründen.« Und die Augen gen Himmel hebend, wiederholte Antonio Worte aus Savonarolas letzter Predigt: »Die Weisheit unserer Welt ist Aberwitz vor dem Herrn. Wir kennen diese Gelehrten; sie alle wandern der Behausung Satans zu!«
»Habt Ihr schon gehört, Antonio«, fragte Giovanni noch schüchterner weiter, »dass Messer Leonardo in Florenz weilt? Eben ist er aus Mailand eingetroffen.«
»Zu welchem Zweck?«
»Sein Herzog hat ihn geschickt, um zu erkunden, ob aus Lorenzos des Prächtigen Nachlass wohl einige Gemälde käuflich zu erwerben seien.«
»Nun, ist er hier, so mag er hier sein. Mir ist es gleich«, unterbrach ihn Antonio und maß noch emsiger mit der Canna das Tuch ab.
In den Kirchen wurde zum Feierabend geläutet. Dolfo reckte sich froh und klappte das Buch zu. Die Arbeit war getan. Die Läden wurden geschlossen.
Giovanni trat auf die Straße hinaus. Ein grauer, nur leicht geröteter Himmel schimmerte zwischen nassen Dächern. Es war windstill; ein leichter Regen nieselte herab. In einer Nebengasse erklang aus einem offenen Fenster plötzlich ein Lied:
»O vaghe montanine pastorelle,
Donde venite si leggiadre e belle?«2
Es war eine jugendlich helle Stimme, die da sang. Das gleichförmige Geräusch eines Tretbretts ließ Giovanni erraten, dass die Sängerin am Webstuhl saß. Er lauschte, ihm fiel ein, dass Frühling war, und er fühlte sein Herz in grundloser Rührung und Schwermut pochen.
»Nanna! Nanna! Wo steckst du, Teufelsmädchen? Bist du taub? Komm zum Abendessen! Die Nudeln werden kalt.«
Holzschuhe klapperten flink über die Fliesen – dann war alles still.
Giovanni stand noch lange und starrte auf das offene Fenster. Das Frühlingslied klang in seinen Ohren nach wie Töne einer fernen Schalmei: »O vaghe montanine pastorelle …«
Dann seufzte er leise, trat in das Haus des Konsuls von Calimala, stieg eine steile Treppe mit morschem, wurmzerfressenem Geländer hinan und betrat ein großes, als Bibliothek dienendes Gemach, in dem über einen Schreibtisch geneigt Giorgio Merula saß, der Hofchronist des Herzogs von Mailand.
Giorgio Merula war in seines Herrn Auftrag nach Florenz gekommen, um seltene Bücher aus der Bibliothek des Lorenzo de’ Medici anzukaufen. Wie stets war er im Hause seines Freundes Messer Cipriano Buonaccorsi abgestiegen, eines ebenso großen Liebhabers von Antiquitäten wie er selbst. Unterwegs hatte der gelehrte Historiker in einer Herberge zufällig Giovanni Beltraffio kennengelernt und ihn, der eine hübsche, flotte Handschrift besaß, mit zu Cipriano genommen, weil er angeblich einen guten Schreiber brauchte.
Als Giovanni eintrat, untersuchte Merula gerade sehr genau ein ganz zerfetztes Buch, das aussah wie eine Rituale oder ein Psalter. Behutsam strich er mit einem feuchten Schwamm über das besonders zarte, aus der Haut eines tot geborenen irischen Lammes hergestellte Pergament, rieb ein paar Zeilen mit Bimsstein ab, glättete sie mit einer Messerschneide und einem Falzbein und betrachtete sie dann wieder, indem er das Blatt gegen das Licht hielt.
»Ihr Lieben«, murmelte er, vor innerer Bewegung sich fast verschluckend. »Kommt ans Gotteslicht, ihr Armen! Wie hübsch und lang ihr seid!«
Er schnippte mit zwei Fingern und hob den kahlen Kopf mit dem gedunsenen, von weichen, beweglichen Falten durchfurchten Gesicht, der rotblauen Nase und den kleinen, vor Lebensfreude und Heiterkeit sprühenden Äuglein. Neben ihm auf dem Fensterbrett standen ein irdener Krug und ein Becher. Der Gelehrte schenkte sich Wein ein, trank, räusperte sich und wollte sich gerade wieder in seine Arbeit vertiefen, als er Giovanni erblickte.
»Guten Abend, Mönchlein«, begrüßte ihn der Alte scherzend; er nannte Giovanni so wegen seiner schüchternen Sittsamkeit. »Ich habe mich schon um dich gesorgt. Wo steckt er nur?, dachte ich. Hat er sich etwa schon verliebt? Die Mädchen von Florenz sind berühmt, und lieben ist ja keine Sünde. Ich habe meine Zeit inzwischen nicht vertan. So etwas Spaßiges hast du gewiss noch nie im Leben gesehen! Soll ichs dir zeigen? Nein, lieber nicht – du plauderst es womöglich aus. Dieses Buch habe ich bei einem jüdischen Trödler unter altem Kram gefunden und ganz billig erstanden. Nun, seis drum, ich zeige es dir allein.«
Geheimnisvoll winkte er ihm mit dem Finger, näher zu treten. »Komm hierher, näher ans Licht!« Er wies ihm eine mit schmaler, spitzer Kirchenschrift bedeckte Seite des Buches. Es waren religiöse Loblieder, Gebete und Psalmen mit ungefügen großen Gesangsnoten. Dann schlug er eine andere Stelle des Buches auf und hielt es in Augenhöhe ans Licht. Jetzt bemerkte Giovanni, dass an den Stellen, wo Merula die Buchstaben weggerieben hatte, kleine, kaum erkennbare Zeilen, farblose Spuren alter Schrift, Vertiefungen im Pergament sichtbar wurden, nicht Buchstaben, sondern blasse, schwache Schatten längst entschwundener Schriftzeichen.
»Nun? Siehst du? Siehst du es?«, fragte Merula triumphierend. »Da sind die lieben Kerle! Habe ich nicht gesagt, Mönchlein, es sei ein spaßiges Ding?«
»Was ist das? Woher kommt es?«, fragte Giovanni.
»Ich weiß es selbst noch nicht. Anscheinend ein Bruchstück einer alten Textsammlung. Vielleicht auch ein ganz neuer, der Welt noch unbekannter Schatz der griechischen Muse. Wenn ich nicht wäre, hätte er nie das Tageslicht erblickt! Bis ans Weltenende wäre er unter Lobgesängen und Bußpsalmen verborgen geblieben …« Und Merula erklärte ihm, irgendein Mönch, ein mittelalterlicher Abschreiber, der das kostbare Pergament noch einmal benutzen wollte, habe die alten heidnischen Zeilen wegradiert und es neu beschrieben.
Die Sonne, den Wolkenschleier zwar nicht brechend, sondern nur durchleuchtend, erfüllte das Zimmer mit einem allmählich verlöschenden, rosigen Schimmer. Im Schein der letzten Sonnenstrahlen waren die Vertiefungen, die Spuren der alten Buchstaben noch deutlicher zu sehen.
»Siehst du, siehst du, die Toten steigen aus den Gräbern«, rief Merula entzückt. »Anscheinend ist es eine Hymne an die Olympier. Schau, die ersten Verse sind lesbar!« Und er übersetzte aus dem Griechischen: »›Heil dem holden, mit Weinlaub reich bekränzten Bacchus! Heil dir, weithin schleudernder Phöbus mit dem Silberbogen, o Schrecklicher, schön gelockter Gott, der du Niobes Söhne erlegtest …‹ Und hier – ein Hymnus an Venus, die du, mein Mönchlein, so sehr fürchtest! Aber er ist schwer zu entziffern: ›Heil dir, goldfüßige Mutter Aphrodite, Wonne du der Götter und Menschen …‹«
Hier brach die Strophe ab – sie verlor sich unter Kirchenschrift.
Giovanni ließ das Buch sinken. Die Spuren der Buchstaben wurden undeutlich, ihre Vertiefungen waren nicht mehr zu erkennen und verflossen in der gelben Farbe des glatten Pergaments, die Schatten verschwanden. Nur die klaren, fetten, schwarzen Buchstaben des Klosterrituals blieben deutlich sichtbar und die großen eckigen Noten des Bußpsalmes: »Herr Gott, lass mein Gebet vor Dich kommen, neige Dein Ohr meinem Flehen, denn meine Seele ist voll Jammer, und mein Leben ist nahe der Hölle.«
Das rosige Licht draußen verblasste, es wurde dunkel im Zimmer. Merula schenkte sich aus dem irdenen Krug Wein ein, trank und bot auch Giovanni davon an. »Auf dein Wohl, Freund! Vinum super omnia bonum diligamus.«3
Giovanni lehnte ab.
»Nun, Gott mit dir. Dann trinke ich auf dein Wohl. Was hast du, Mönchlein? Weshalb bist du so verstimmt, als hätte dich jemand ins Wasser geworfen? Hat der scheinheilige Antonio dir wieder mit seinen Weissagungen Angst gemacht? Spei darauf, Giovanni, wirklich, spei darauf! Was krächzen diese Mucker? Der Teufel soll sie holen! Beichte! – Hast du mit Antonio gesprochen?«
»Allerdings.«
»Und worüber?«
»Über den Antichrist und über Messer Leonardo da Vinci …«
»Nun ja, da haben wirs! Dauernd fantasierst du nur von Leonardo. Hat er dich behext? Hör mal, Freund, schlag dir die Torheiten aus dem Kopf. Bleib lieber als Sekretär bei mir – ich bringe dich schon vorwärts. Ich lehre dich Latein und mache einen Rechtsgelehrten, einen Redner oder einen Hofpoeten aus dir. Reich und berühmt sollst du werden. Was ist Malerei? Schon der Philosoph Seneca nannte sie ein Handwerk, das eines freien Manns unwürdig sei. Sieh dir nur die Künstler an: Es sind alles ungebildete, ungeschliffene Menschen …«
»Ich hörte aber, Messer Leonardo sei ein großer Gelehrter«, antwortete Giovanni.
»Gelehrter? Warum nicht gar? Der Mann kann nicht einmal Latein lesen. Verwechselt Cicero mit Quintilian. Vom Griechischen hat er überhaupt keine Ahnung. Der soll ein Gelehrter sein! Lächerlich …«
»Es heißt doch aber, er erfinde wunderbare Maschinen?«, beharrte Beltraffio. »Und seine Beobachtungen der Natur …«
»Maschinen! Beobachtungen! Nein, Freund, damit kommt man nicht weit. Ich habe in meinen ›Schönheiten der lateinischen Sprache‹ zweitausend neue, besonders schöne Redewendungen zusammengestellt. Hast du einen Begriff davon, was das für Mühe gekostet hat? Verzwickte Räder an Maschinen anbringen, gucken, wie die Vögel in der Luft fliegen, wie das Gras wächst – das ist doch keine Wissenschaft … Ein Zeitvertreib ist das, ein Kinderspiel!«
Der Alte schwieg. Seine Miene wurde strenger. Dann nahm er die Hand des jungen Manns und sagte mit sanftem Ernst: »Höre, Giovanni, und merke dir das: Unsere Lehrer sind die alten Griechen und Römer. Sie haben alles geleistet, was wir Menschen auf Erden zu leisten vermögen. Wir können ihnen nur folgen und sie nachahmen. Es heißt doch: Der Schüler ist nicht über seinem Lehrer.«
Er nahm einen Schluck Wein, schaute Giovanni verschmitzt in die Augen, und seine weichen Runzeln verzogen sich plötzlich zu einem breiten Lächeln.
»Ach Jugend, Jugend! Ich schau dich an, Mönchlein, und beneide dich. Eine junge Frühlingsknospe bist du! Wein trinkst du nicht, vor den Weibern rennst du davon. Still und fromm bist du. Aber innen, da sitzt der Teufel! Ich durchschaue dich. Warts nur ab, Freundchen, der Teufel wird schon herauskommen! Du bist schwermütig, aber es ist doch lustig mit dir. Du bist wie das Buch hier, Giovanni: oben Bußpsalmen, aber darunter – eine Hymne an Aphrodite!«
»Es ist dunkel, Messer Giorgio. Wärs nicht Zeit, Licht anzuzünden?«
»Warte noch, lass! Ich plaudere gern im Dämmerlicht, erinnere mich meiner Jugend …« Seine Zunge wurde schwer, seine Rede verlor den rechten Zusammenhang. »Ich weiß schon, lieber Freund«, fuhr er fort, »du schaust mich an und denkst bei dir: Der alte Kerl ist betrunken und schwatzt Unsinn. Aber da oben habe ich auch was!« Und selbstzufrieden wies er mit dem Finger auf seinen kahlen Schädel.
»Ich prahle nicht gern. Aber frag den ersten besten Scholaren: Er wird dir sagen, ob je einer den Merula in der lateinischen Redekunst übertroffen hat. Wer hat den Martial entdeckt?«, fuhr er in steigender Erregung fort. »Wer hat die berühmte Inschrift auf den Ruinen der Porta Tiburtina entziffert? Oft bin ich da so hoch hinaufgeklettert, dass mir schwindlig wurde. Wenn mir da ein Stein unter den Füßen wegbröckelte, konnte ich nur gerade noch einen Strauch packen, um nicht selber in die Tiefe zu stürzen. Tagelang habe ich mich in der Sonnenglut abgemüht, habe an den alten Inschriften gerätselt und sie abgeschrieben. Hübsche Bauerndirnen kamen vorüber und lachten: ›Seht, Mädels, wie hoch der Dummkopf geklettert ist – gewiss sucht er einen Schatz!‹ Ich scherze mit ihnen, sie gehen weiter und ich arbeite wieder. Unter Efeu und Dornen, unter Steingeröll fand ich die zwei Worte: Gloria Romanorum.« Und als lausche er dem Klang längst verstummter, großer Worte, wiederholte er dumpf und feierlich: »Gloria Romanorum! Der Römer Ruhm! Ach, wozu daran denken, die Zeit kommt nie wieder!« Er machte eine resignierte Geste, hob sein Glas und stimmte mit heiserer Stimme den Tischgesang der Scholaren an:
»Wenn ich nüchtern bin,
Red ich keine Zeile.
Leben tat ich in der Schänke,
Und ich sterbe hinterm Fasse.
Lieben tu ich Wein und Lieder
Und latein’sche Grazien.
Wenn ich trinke, singe ich
Schöner als Horatius,
Toller Rausch mir tobt im Herzen.
Dum vinum potamus,
Brüder, singt zu Bacchus:
Te Deum laudamus!«4
Er hüstelte und brach ab. Im Zimmer war es jetzt ganz dunkel. Giovanni konnte das Gesicht des Alten kaum noch sehen. Es regnete stärker; man hörte die Tropfen aus der Dachrinne unablässig in eine Pfütze klatschen.
»Ja, so ist es, Mönchlein«, lallte Merula mit unsicherer Zunge. »Was wollte ich gleich sagen? Ja, meine Frau ist ein schönes Weib … Nein, das nicht … Wart mal! Ja, ja … Erinnerst du dich an den Vers: ›Tu regere imperio populos, Roma, memento‹?5 Oh, weißt du, das waren wahre Giganten von Männern, Beherrscher des Weltalls …«
Seine Stimme bebte; Giovanni kam es so vor, als blinkten Tränen in Messer Giorgios Augen.
»Jawohl, Giganten! Und jetzt … Oh, man schämt sich, davon zu reden! Nimm nur unseren Lodovico il Moro, Herzog von Mailand! Gewiss, ich stehe in seinen Diensten; ich schreibe seine Geschichte nach dem Vorbild des Titus Livius; ich vergleiche den feigen Hasen, den Emporkömmling, mit Pompejus und Cäsar. Aber im Herzen, Giovanni, in meinem Herzen …«
Nach der Art alter Höflinge schielte er argwöhnisch nach der Tür, ob jemand horche; dann neigte er sich zu dem jungen Mann hinüber und flüsterte ihm ins Ohr: »Im Herzen des alten Merula ist die Liebe zur Freiheit nicht erloschen und wird nie erlöschen. Aber – rede nicht darüber, zu keinem Menschen! Wir haben böse Zeiten, schlimmer sind sie nie gewesen. Und die Menschen heute! Übel wird einem bei dem Anblick! Schimmliges Gewächs, das kaum über dem Boden zu sehen ist! Aber die Nase tragen sie hoch und vergleichen sich mit den Alten! Und was sind sie denn, über was freuen sie sich? Ein Freund schreibt mir da aus Griechenland: Waschweiber eines Klosters auf Chios haben kürzlich, als sie in der Morgendämmerung am Meeresufer Wäsche spülten, einen echten alten Gott gefunden, einen Triton mit Fischschwanz, Flossen und Schuppen. Die dummen Weiber erschraken, sie dachten, es sei der Teufel, und liefen davon. Hinterher sahen sie, dass er alt und schwach war, anscheinend auch krank. Er lag bäuchlings im Sand, fror und wärmte seinen grünlichen, schuppigen Rücken in der Sonne. Sein Kopf war grau, die Augen trübe wie die von Säuglingen. Da bekamen die gemeinen Weiber wieder Mut, sie umringten ihn mit christlichen Gebeten und verprügelten ihn mit Waschhölzern. Totgeschlagen haben sie ihn wie einen Hund, den alten Gott, den letzten der mächtigen Götter des Ozeans. Vielleicht gar ein Enkel Poseidons …« Der Alte schwieg, ließ traurig den Kopf hängen, und über seine Wangen rollten zwei trunkene Tränen des Mitleids mit dem Meerwunder.
Ein Diener brachte Licht und schloss die Fensterläden. Die heidnischen Schattenbilder entschwanden. Es wurde zum Abendessen gerufen. Merula aber war so voll Wein, dass man ihn unter den Armen stützen und zu Bett bringen musste.
In dieser Nacht fand Beltraffio lange keinen Schlaf. Er lauschte auf Messer Giorgios sorgloses Schnarchen und dachte an den, der letzthin alle seine Gedanken mehr als alles andere erfüllt hatte – an Leonardo da Vinci.
Giovanni war im Auftrage seines Onkels, des Glasmalers Oswald Ingrimm, aus Mailand nach Florenz gekommen, um Farben einzukaufen, namentlich die leuchtenden, durchsichtigen, die ausschließlich in Florenz zu haben waren.
Der Glasmaler Oswald Ingrimm stammte aus Graz und war ein Schüler des berühmten Straßburger Meisters Johann Kirchheim. Er arbeitete an den Fenstern der nördlichen Sakristei des Mailänder Doms. Giovanni, der uneheliche Sohn eines Bruders von Oswald, des Steinmetzen Reinhold Ingrimm, war Waise. Er trug den Namen seiner aus der Lombardei stammenden Mutter, Beltraffio, die, wie der Onkel behauptete, ein liederliches Weib gewesen war und seinen Vater zugrunde gerichtet hatte. Als einziges Kind war Giovanni im Haus des mürrischen Oheims aufgewachsen. Oswald Ingrimms endlose Erzählungen von allerhand unreinen Mächten, Teufeln, Hexen, Zauberern und Unholden hatten die Seele des Knaben verdüstert. Am meisten Angst flößte ihm eine von den Leuten aus dem Norden nach Italien gebrachte Sage ein, von einem weibsgestaltigen Dämon, der sogenannten Weißbrauigen Mutter oder Weißen Teufelin.
Schon in frühester Kindheit, wenn Giovanni nachts im Bett weinte, schreckte ihn Onkel Ingrimm mit der Weißen Teufelin; der Knabe wurde dann sofort still und steckte den Kopf unters Kissen. Aber trotz aller Angst quälte ihn die Neugier, und er begehrte die Weißbrauige einmal von Angesicht zu sehen.
Oswald gab seinen Neffen zu dem Heiligenbildmaler Fra Benedetto in die Lehre. Das war ein gutherziger, schlichter Alter. Er lehrte Giovanni, vor der Arbeit den allmächtigen Gott, die hochgeliebte Fürsprecherin der Sünder, die Jungfrau Maria, den Evangelisten Lukas als ersten christlichen Maler und alle Heiligen des Paradieses um Beistand zu bitten; sich mit dem Gewand der Liebe und Gottesfurcht, des Gehorsams und der Geduld zu schmücken; dann erst die Tempera von Eigelb und milchigem Feigensaft mit Wasser und Wein anzurühren und die Malbretter aus altem Feigen- oder Buchsbaumholz durch Abreiben mit einem Pulver aus gebrannten Knochen herzurichten – zu welchem Zweck Rippen- und Flügelknochen von Hühnern und Kapaunen oder Rippen- und Schulterknochen von Hammeln angeblich besonders geeignet waren.
Es gab unzählige Lehren. Giovanni wusste schon vorher, wie verächtlich Fra Benedetto die Brauen heben würde, wenn die Rede auf die »Drachenblut« genannte Farbe käme, wie er unfehlbar sagen würde: »Lass das und gräme dich nicht darum; sie kann dir nicht viel Ehre bringen.« Er ahnte, dass Fra Benedettos Lehrer und der Lehrer des Lehrers gewiss dieselben Worte gebraucht hatten. Ebenso unabänderlich war Fra Benedettos stilles Lächeln des Stolzes, wenn er dem Schüler Geheimnisse seiner Kunst enthüllte, die er für die höchsten Errungenschaften menschlicher Kunst und Wissenschaft hielt. So zum Beispiel die Vorschrift, zum Untermalen für jugendliche Gesichter Eidotter von Stadthühnern zu benutzen, weil er heller sei als der der Landhühner, deren Dotter sich wegen seiner rötlichen Färbung mehr zur Darstellung alter, bräunlicher Körper eigne.
Trotz all dieser Feinheiten war Fra Benedetto als Maler harmlos wie ein kleines Kind. Zur Arbeit bereitete er sich durch Fasten und nächtliche Gebete vor. Bevor er begann, warf er sich auf die Knie, betete und erflehte vom Herrn Kraft und Verstand. Jedes Mal, wenn er eine Kreuzigung malte, war sein Gesicht in Tränen gebadet.
Giovanni liebte seinen Lehrer und hielt ihn für den größten aller Meister. Doch waren in letzter Zeit Zweifel über den Schüler gekommen – namentlich, wenn Fra Benedetto ihm seine einzige anatomische Regel erklärte: die Länge des männlichen Körpers betrage acht und zwei Drittel der Gesichtslänge, wozu er mit der gleichen verächtlichen Miene, mit der er vom »Drachenblut« zu sprechen pflegte, hinzufügte: »Was den weiblichen Körper anbetrifft, so lassen wir ihn besser beiseite, denn er hat keine rechten Maße.« Von der Gültigkeit dieser Anschauung war er ebenso unerschütterlich überzeugt wie davon, dass Fische und überhaupt alle unvernünftigen Lebewesen oben dunkel und unten hell seien oder dass der Mann eine Rippe weniger habe als das Weib, weil der liebe Gott Adam eine Rippe genommen habe, um Eva zu schaffen.
Einmal sollte er die vier Elemente allegorisch darstellen, jedes durch ein Tier. Fra Benedetto wählte für die Erde den Maulwurf, für das Wasser den Fisch, für das Feuer den Salamander und für die Luft das Chamäleon. Weil er aber das Wort Chamäleon für eine Vergrößerungsform des Wortes cammello – das heißt Kamel – hielt, stellte der Mönch in der Einfalt seines Herzens die Luft als ein Kamel dar, das den Rachen weit aufreißt, um besser atmen zu können. Als ihn jüngere Künstler wegen dieses Fehlers verlachten, erduldete er ihren Spott mit christlicher Demut, blieb aber bei seiner Überzeugung, dass zwischen Kamel und Chamäleon kein Unterschied sei. Auf der gleichen Höhe standen auch die sonstigen naturwissenschaftlichen Kenntnisse des frommen Meisters.
Schon längst waren die Zweifel in Giovannis Herz wach geworden. Der neue aufrührerische Geist, »der Dämon weltlicher Philosophie«, wie der Mönch sagte, hatte sich seiner bemächtigt. Als Fra Benedettos Schüler kurz vor seiner Reise nach Florenz einige Zeichnungen von Leonardo da Vinci zu sehen bekam, erfassten diese Zweifel seine Seele mit solcher Macht, dass er nicht mehr gegen sie anzukämpfen vermochte.
In jener Nacht, da er neben dem friedlich schnarchenden Messer Giorgio ruhte, prüfte er zum tausendsten Mal diese Gedanken in seinem Geist; aber je mehr er sich in sie vertiefte, desto wirrer wurde es in ihm.
Schließlich entschloss er sich, seine Zuflucht zu himmlischer Hilfe zu nehmen. Einen Blick voller Hoffnung richtete er in die Finsternis der Nacht und betete also: »O Herr, hilf Du mir und verlass mich nicht! Ist Messer Leonardo wirklich ein gottloser Mensch und seine Wissenschaft Sünde und Trug, so schaffe, dass ich nicht mehr an ihn denke und dass ich seine Zeichnungen vergesse. Erlöse mich von der Versuchung, denn ich will nicht sündigen vor Dir. Wenn es aber möglich ist, Dir zu dienen und Deinen Namen durch die edle Kunst der Malerei zu verherrlichen und dennoch alles zu wissen, was Fra Benedetto nicht weiß und was ich so heiß zu wissen trachte – Anatomie, Perspektive und die herrlichen Gesetze von Licht und Schatten –, dann, o Herr, verleihe mir einen festen Willen und erleuchte meine Seele, auf dass ich nicht mehr zweifle; gib, dass Messer Leonardo mich in seine Werkstatt aufnimmt und dass Fra Benedetto in seiner Güte mir verzeiht und begreift, dass ich mich nicht versündige vor Dir.«
Als er so gebetet hatte, fühlte Giovanni Freude und Ruhe einziehen in sein Herz. Seine Gedanken wurden wirr. Er dachte daran, wie in den Händen des Glasers die weißglühende Spitze des Werkzeugs in das Glas eindringt und es mit angenehm zischendem Geräusch zerschneidet; er sah, wie die biegsamen Bleistreifen, die die einzelnen gemalten Glasscheiben im Rahmen verbinden, sich unter dem Hobel hervorwinden. Eine Stimme, die wie die des Onkels klang, sprach: Scharten, mehr Scharten an den Rändern, dann sitzt das Glas fester! Und alles verschwand. Er drehte sich auf die andere Seite und schlief ein.
Im Schlaf hatte Giovanni einen Traum, an den er später oft zurückdachte. Ihm war, als stände er im Halbdunkel eines riesigen Doms vor einem bunten Glasfenster. Es stellte die Weinlese des geheimnisvollen Weinstocks dar, von dem es im Evangelium heißt: »Ich bin der rechte Weinstock, und mein Vater ein Weingärtner.« Der nackte Leib des Gekreuzigten liegt auf der Kelter, und Blut fließt aus seinen Wunden. Päpste, Kardinäle, Kaiser fangen es auf, füllen es in Fässer und rollen sie fort. Die Apostel bringen Trauben, der heilige Petrus stampft sie. Im Hintergrund graben Propheten und Patriarchen und schneiden Trauben. Ein Bottich voll Wein wird auf einem Wagen vorübergefahren, an den die Tiere des Evangeliums gespannt sind – der Löwe, der Stier, der Adler – und den der Engel des heiligen Matthäus lenkt. Glasmalereien mit ähnlichen Darstellungen hatte Giovanni in der Werkstatt seines Onkels häufig gesehen, aber noch nie solche Farben, so dunkel und gleichzeitig leuchtend wie Edelsteine. Am meisten entzückte ihn das dunkle Rot des Blutes des Herrn. Und aus der Tiefe des Doms erklangen die sanften, zarten Töne seines Lieblingslieds:
»O fior di castitate,
Odorifero giglio,
Con gran soavitate
Sei di color vermiglio.«6
Das Lied verstummte, das Glasgemälde ward dunkel, und die Stimme des Gehilfen Antonio da Vinci flüsterte Giovanni ins Ohr: »Flieh, Giovanni, flieh! Sie ist hier!« Er wollte fragen: Wer?, aber er fühlte, dass die Weißbrauige hinter ihm stand. Kalt wehte es ihn an: Plötzlich packte eine schwere Hand ihn von hinten am Hals und würgte ihn. Er meinte zu sterben.
Er schrie laut auf, erwachte – und sah Messer Giorgio, der sich über ihn beugte und ihm die Decke wegzog.
»Steh auf! Steh auf! Sonst reiten sie ohne uns fort. Es ist höchste Zeit!«
»Wohin? Was ist?«, brummte Giovanni, noch halb im Schlaf.
»Hast du ganz vergessen? Nach der Villa in San Gervasio! Zur Ausgrabung im Mühlenhügel.«
»Ich komm nicht mit …«
»Du kommst nicht mit? Soll ich dich vergebens geweckt haben? Ich habe doch das schwarze Maultier satteln lassen, damit wir es zu zweien behaglicher haben. Nun also, steh auf, sei so freundlich! Sei nicht eigensinnig! Wovor hast du Angst, Mönchlein?«
»Ich habe gar keine Angst. Ich mag einfach nicht …«
»Hör mal, Giovanni, dein viel gepriesener Meister Leonardo da Vinci kommt auch hin!«
Da sprang Giovanni auf und kleidete sich ohne längere Widerrede an.
Sie traten auf den Hof hinaus. Alles war schon zum Aufbruch bereit. Grillo gab noch eifrig Ratschläge und lief emsig umher.
Ein paar Bekannte von Messer Cipriano, darunter Leonardo da Vinci, wollten später, auf einem anderen Weg, direkt nach San Gervasio kommen.
Es regnete nicht mehr. Der Nordwind hatte die Wolken verjagt. Am mondlosen Himmel flimmerten die Sterne wie Lampenflämmchen, die im Wind flackern. Pechfackeln qualmten und knisterten und ließen Funken sprühen.
Durch die Via Ricasoli, an San Marco vorüber, erreichten sie den zinnenbewehrten Turm des Tores San Gallo. Die verschlafenen Wächter zeterten und fluchten lange, verstanden nicht, was los war, und ließen die Reiter erst gegen ein gutes Trinkgeld aus der Stadt hinaus.
Der Weg führte durch das schmale, tiefe Tal des Mugnone. Die Reiter kamen durch ein paar ärmliche Orte mit ebenso engen Straßen wie die von Florenz, mit hohen festungsartigen Häusern aus grob behauenen Steinen, und gelangten dann in den Olivenhain der Bauern von San Gervasio. An einer Wegkreuzung stiegen sie ab und wanderten durch Messer Ciprianos Weinberg zum Mühlenhügel. Hier harrten ihrer bereits Arbeiter mit Spaten und Schaufeln.
Hinter dem Hügel, jenseits des »Nasse Senke« benannten Sumpfes, schimmerten in der Dunkelheit schwach die weißen Mauern der Villa Buonaccorsi zwischen den Bäumen. Unten am Mugnone stand eine Wassermühle. Auf dem Gipfel hoben sich schlanke Zypressen dunkel vom Himmel ab.
Grillo bezeichnete die Stelle, wo man seiner Ansicht nach graben sollte; Merula wies auf eine andere Stelle am Fuße des Hügels, wo man die Marmorhand gefunden hatte. Ein Vorarbeiter aber, der Gärtner Strocco, meinte, man müsse unten bei der Nassen Senke beginnen, weil, wie er sagte, »alle unreinen Geister immer nahe am Sumpf ihr Wesen treiben«.
Messer Cipriano befahl, an der Stelle zu graben, die Grillo angab. Die Spaten klirrten. Es roch nach frisch gegrabener Erde. Eine Fledermaus streifte mit dem Flügel fast Giovannis Gesicht. Er fuhr zusammen.
»Keine Angst, Mönchlein, keine Angst!« Merula klopfte ihm ermunternd auf die Schulter. »Keinen Teufel finden wir hier. Wenn bloß dieser Esel, der Grillo, nicht … Gott sei Lob, wir haben schon andere Ausgrabungen mitgemacht. In Rom zum Beispiel, in der 450. Olympiade« – Merula missachtete die christliche Zeitrechnung und blieb bei der altgriechischen – »unter Papst Innozenz VIII. fanden lombardische Erdarbeiter auf der Via Appia in der Nähe von Cäcilia Metellas Grabmal einen altrömischen Sarkophag mit der Inschrift: ›Julia, Tochter des Claudius‹ – darin lag die mit Wachs überzogene Leiche eines fünfzehnjährigen Mädchens, das aussah, als schliefe es. Die rosige Farbe des Lebens war noch nicht aus Julias Gesicht geschwunden. Es war, als atme sie. Eine gewaltige Volksmenge wich nicht von dem Sarg. Aus fernen Landen kamen die Leute, um das Mädchen zu sehen; denn Julia war so schön, dass niemand, der sie nicht gesehen, es geglaubt hätte – wenn es überhaupt möglich wäre, ihre Schönheit zu beschreiben. Der Papst erschrak, als er hörte, das Volk bete eine tote Heidin an, und befahl, sie bei Nacht heimlich am Pinciotore einzuscharren. Jawohl, Freund, solche Ausgrabungen kommen vor!« Merula blickte geringschätzig in die Grube, die rasch tiefer wurde. Plötzlich gab die Schaufel eines Arbeiters lauten Klang. Alle bückten sich nieder.
»Knochen«, erklärte der Gärtner. »In alter Zeit reichte der Friedhof bis hierher.«
In San Gervasio hörte man einen Hund lang gezogen melancholisch heulen.
Ein Grab haben sie geschändet, dachte Giovanni, lieber hätt ich nichts mit ihnen zu tun! Ich sollte fliehen vor der Sünde …
»Ein Pferdegerippe«, erklärte Strocco schadenfroh und warf einen halbverfaulten länglichen Schädel aus der Grube.
»Tatsächlich, Grillo. Du hast dich anscheinend geirrt«, sagte Messer Cipriano. »Wollen wir es nicht lieber an einer andern Stelle versuchen?«
»Natürlich. Warum hört man auf einen Narren?«, bemerkte Merula. Mit zwei Arbeitern begab er sich an den Fuß des Hügels, um dort graben zu lassen. Auch Strocco nahm, dem eigensinnigen Grillo zum Trotz, ein paar Leute mit und begann an der Nassen Senke zu suchen.
Nach einiger Zeit rief Messer Giorgio triumphierend: »Da! Hier schaut! Ich wusste doch, wo wir graben müssen!« Alle eilten zu ihm. Aber der Fund war wertlos, das Marmorstück war ein unbehauener Stein.
Trotzdem kehrte niemand zu Grillo zurück, der sehr beschämt unten in der Grube stand und beim Schein einer zerbrochenen Laterne hartnäckig und aussichtslos weiter in der Erde wühlte.
Der Wind hatte sich gelegt, die Luft war jetzt wärmer. Nebel stieg über der Nassen Senke auf. Es roch nach brackigem Wasser, nach gelben Frühlingsblumen und Veilchen. Der Himmel hatte sich aufgeklärt. Die Hähne krähten zum zweiten Mal. Die Nacht ging zu Ende.
Plötzlich kam aus der Tiefe der Grube, in der sich Grillo befand, ein verzweifelter Schrei. »Oh, oh! Haltet mich! Ich versinke!«
Zuerst war in der Dunkelheit überhaupt nichts zu erkennen, denn Grillos Laterne war ausgegangen. Man hörte ihn nur zappeln, stöhnen und ächzen. Man brachte andere Laternen und erblickte nun ein halb mit Erde verschüttetes Ziegelgewölbe – anscheinend die Decke eines sorgsam gemauerten unterirdischen Kellers, die Grillos Last nicht getragen hatte und unter ihm eingestürzt war.
Zwei kräftige junge Arbeiter kletterten behutsam in die Grube hinein. »Wo bist du, Grillo? Gib die Hand! Bist du sehr zerschlagen, armer Kerl?«
Grillo antwortete nicht. Ungeachtet des heftigen Schmerzes im Arm, den er für gebrochen hielt, der aber nur verrenkt war, tat er irgendetwas, tastete, kroch weiter und rumorte seltsam im Keller umher. Schließlich rief er freudig: »Eine Götzenfigur! Eine Götzenfigur! Messer Cipriano, ein wunderbarer Götze!«
»Was schreist du denn so?«, knurrte Strocco misstrauisch. »Hast du vielleicht wieder einen Eselsschädel?«
»Nein, nein! Nur eine Hand fehlt … Beine, Rumpf, Brust – alles ist heil«, murmelte Grillo fast atemlos vor Freude.
Die Arbeiter banden sich Stricke unter die Schultern und um den Leib, falls etwa das Gewölbe unter ihnen einbrechen sollte, ließen sich in die Grube hinab und räumten behutsam die morschen, mit Schimmel bedeckten Ziegel beiseite. Giovanni lag halb auf der Erde und spähte zwischen den gebückten Rücken der Arbeiter hindurch in die Tiefe des Kellers, aus dem dumpfe Feuchtigkeit und Grabeskälte emporstieg.
Als das Gemäuer fast abgetragen war, befahl Messer Cipriano: »Geht mal weg und lasst mich sehen!«
Und Giovanni erblickte auf dem Grund der Grube zwischen Ziegelmauern einen nackten weißen Körper. Er lag da wie eine Leiche im Sarg; aber im flackernden Fackelschein wirkte er nicht wie tot, sondern erschien rosig, lebendig und warm.
»Eine Venus«, flüsterte Giorgio andachtsvoll. »Eine Venus von Praxiteles! Ich beglückwünsche Euch, Messer Cipriano. Hätte man Euch das Herzogtum Mailand und Genua noch dazugeschenkt, Ihr könntet Euch nicht glücklicher schätzen!«
Grillo kletterte mühsam empor, und obwohl aus einer Stirnwunde Blut über sein mit Erde beschmutztes Gesicht rann und er den verrenkten Arm nicht rühren konnte, strahlte doch Siegesstolz in seinen Augen.
Merula eilte auf ihn zu: »Grillo, lieber Freund! Mein Wohltäter! Dich habe ich gescholten! Einen Narren habe ich dich genannt! Dich, den klügsten aller Menschen!« Und er umarmte ihn und küsste ihn zärtlich. »Der Baumeister Filippo Brunelleschi in Florenz fand einst unter seinem Haus, in genau so einem Keller, die Marmorstatue des Gottes Merkur. Gewiss haben in jener Zeit, als die Christen die Heiden überwunden hatten und ihre Götzenbilder vernichteten, die letzten Anbeter der alten Götter diese Statuen in solchen gemauerten Kellern versteckt, weil sie Verständnis für ihre vollendete Schönheit hatten und sie vor dem Verderben retten wollten.«
Grillo lauschte und lächelte selig. Er bemerkte nicht, dass eine Hirtenschalmei im Feld klang, dass Schafe beim Austreiben blökten, dass der Himmel zwischen den Hügeln in durchsichtigem Licht immer heller wurde und dass fern über Florenz die Morgenglocken mit zarten Klängen einander anriefen.
»Vorsicht! Vorsicht! Mehr nach rechts. So – da! Weiter weg von der Wand«, rief Cipriano den Arbeitern zu. »Jeder bekommt fünf Silbergrossi, wenn ihr sie unbeschädigt heraufbringt.« Langsam stieg die Göttin empor. Mit dem gleichen hellen Lächeln, mit dem sie einst dem Schaum der Meereswogen entstiegen war, kam sie jetzt aus dem Dunkel der Erde, dem tausendjährigen Grab zum Vorschein.
»Heil dir, goldfüßige Mutter Aphrodite, Wonne du der Götter und Menschen!«, begrüßte Merula sie.
Alle Sterne waren verblichen, nur das Gestirn der Venus blinkte wie ein Demant im Leuchten der Morgenröte. Ihm entgegen hob sich jetzt das Haupt der Göttin über den Rand des Grabes.
Giovanni blickte in ihr vom Morgenlicht bestrahltes Antlitz und flüsterte, vor Schreck erbleichend: »Die Weiße Teufelin!«
Er sprang auf und wollte fliehen. Doch die Neugier besiegte seine Furcht. Selbst wenn ihm jemand gesagt hätte, er begehe eine Todsünde, die er mit ewiger Verdammnis büßen müsse – er hätte doch seine Blicke nicht losreißen können von dem nackten, unschuldigen Leib, von dem herrlichen Antlitz der Göttin. Auch in jenen Tagen, da Aphrodite noch Herrscherin der Welt war, hatte wohl niemand sie mit so andachtsvollem Schauer betrachtet.
In der kleinen Dorfkirche von San Gervasio läuteten die Glocken. Alle sahen sich unwillkürlich um und erstarrten. In der Morgenstille klang dieser Ton wie ein zornig klagender Schrei. Zuweilen verstummte der feine, zitternde Glockenklang wie abgerissen; sofort aber tönte er wieder lauter, eindringlich und verzweifelt.
»Jesus, sei uns gnädig«, rief Grillo und fasste sich an den Kopf. »Da kommt der Priester – Don Faustino! Seht die Leute auf der Straße! Sie rufen, sie haben uns gesehen, sie fuchteln mit den Armen. Hierher kommen sie … Ich bin verloren, ich Unglücklicher!«
Eine Gruppe von Reitern näherte sich dem Mühlenhügel. Das waren die andern zur Teilnahme an der Ausgrabung geladenen Bekannten. Sie hatten sich unterwegs verirrt und kamen deshalb zu spät.
Beltraffio warf einen flüchtigen Blick auf sie; obwohl er ganz in die Betrachtung der Göttin vertieft war, fiel ihm doch das Gesicht des einen auf. Der Ausdruck kühler, ruhiger Aufmerksamkeit und tiefen Interesses, mit dem der Unbekannte die Venus betrachtete und der zu Giovannis Aufregung und Verwirrung in so starkem Gegensatz stand, machte großen Eindruck auf ihn. Ohne seine fest auf die Statue gerichteten Blicke von ihr abzuwenden, fühlte er doch diesen Mann mit dem ungewöhnlichen Gesicht dauernd hinter sich.
»So machen wir es«, sagte Messer Cipriano nach kurzem Nachdenken. »Die Villa ist nur ein paar Schritte entfernt. Das Tor ist fest und hält jedem Angriff stand …«
»Das ist richtig«, rief Grillo erfreut. »Also flink, Freunde, hebt sie auf!« Mit väterlicher Zärtlichkeit bemühte er sich um die Erhaltung der Statue.
Sie schafften die Statue glücklich durch die Nasse Senke. Kaum hatten die Träger die Schwelle des Hauses überschritten, als oben auf dem Mühlenhügel Don Faustinos drohende Gestalt mit gen Himmel erhobenen Armen sichtbar wurde. Das untere Stockwerk der Villa war unbewohnt. Ein gewaltiger Saal mit geweißten Wänden und Bogendecken diente als Lagerraum für Ackergeräte und große irdene Gefäße für Olivenöl. In einer Ecke reichte aufgestapeltes goldschimmerndes Weizenstroh bis an die Decke. Auf dieses Stroh, diese bescheidene ländliche Lagerstätte, bettete man behutsam die Göttin.
Kaum waren alle eingetreten und die Tore geschlossen, als draußen lautes Geschrei und Geschimpf ertönte und lärmend an die Tore geschlagen wurde.
»Aufmachen! Aufmachen!«, kreischte Don Faustino mit brüchiger Fistelstimme. »Im Namen des lebendigen Gottes beschwöre ich euch, macht auf! …«
Messer Cipriano stieg auf einer steinernen Innentreppe zu einem schmalen, hoch über dem Boden befindlichen Gitterfenster empor, musterte die Menge draußen, sah, dass sie nicht allzu groß war, und begann mit dem ihm eigenen feinen, höflichen Lächeln zu verhandeln. Der Priester ließ nicht ab und verlangte die Auslieferung des Götzenbildes, das man, wie er behauptete, aus der Erde des Friedhofs ausgegraben habe.
Der Konsul von Calimala entschied sich für eine Kriegslist und erklärte fest und ruhig: »Hütet euch! Ein Eilbote nach Florenz ist unterwegs, zum Befehlshaber der Wache. In zwei Stunden sind Berittene hier. Mit Gewalt dringt niemand ungestraft in mein Haus ein.«
»Schlagt das Tor ein«, zeterte der Priester. »Fürchtet euch nicht! Gott steht uns bei. Schlagt zu!«
Den Händen eines halb blinden, pockennarbigen Greises mit melancholischem, demütigem Gesicht und verbundener Wange entriss er eine Axt und schlug mit voller Wucht gegen das Tor. Die Menge aber folgte seinem Beispiel nicht.
»Don Faustino, Don Faustino«, lispelte der demütige Alte und zupfte ihn sachte am Ellbogen. »Wir sind arme Leute, mit der Hacke holen wir kein Geld aus der Erde. Man wird uns zur Verantwortung ziehen und ins Elend bringen!«
Viele in der Menge überlegten, als sie von den Stadtknechten gehört hatten, wie sie sich unbemerkt davonmachen könnten.
»Gewiss, wenn sie das auf eigenem Grund und Boden gefunden hätten! Aber auf Gemeindeland – das ist eine andere Sache«, meinten einige.
»Wo läuft denn die Grenze? Nach dem Gesetz …«
»Was heißt Gesetz? Das ist ein Spinngewebe. Die Fliege fängt sich drin, die Bremse kommt durch. Für die Herren sind keine Gesetze geschrieben«, wandten andere ein.
»Das stimmt. Jeder ist Herr auf seinem Boden.«
Indessen betrachtete Giovanni noch immer die geborgene Venus. Ein Strahl der Morgensonne fiel durch ein Seitenfenster. Der noch nicht völlig von der Erde gereinigte Marmorleib glänzte in der Sonne, als erhole und wärme er sich nach der langen Finsternis und Kälte unter der Erde. Die feinen gelben Halme des Weizenstrohs glühten im Morgenlicht und umgaben die Göttin als bescheidene, doch prächtige goldene Gloriole.
Und wieder richtete Giovanni seine Aufmerksamkeit auf den Unbekannten. Dieser kniete jetzt neben der Venus, hielt Zirkel, Winkelmaß und Halbbogen aus Messing in der Hand, ähnlich denen in mathematischen Bestecken, und begann die einzelnen Teile des herrlichen Körpers zu vermessen, mit dem gleichen festen, ruhigen, eindringlichen Interesse in seinen kalten hellblauen Augen und auf den fest geschlossenen Lippen. Dabei neigte er den Kopf so tief, dass sein langer blonder Bart den Marmor berührte.
Was macht er da? Wer ist das?, grübelte Giovanni mit wachsendem Staunen, fast mit Angst, und beobachtete die schnellen, dreisten Finger, die über die Glieder der Göttin hinglitten und in alle Geheimnisse ihrer Schönheit eindrangen, indem sie den Augen nicht erkennbare Rundungen des Marmors prüfend betasteten.
Die Menge der Bauern vor dem Tor der Villa schwand und lichtete sich mit jedem Augenblick mehr.
»Halt! Halt, ihr Nichtstuer, ihr Christusverkäufer! Vor den Stadtknechten habt ihr Angst, aber die Macht des Antichrist fürchtet ihr nicht«, keifte der Priester und streckte die Arme nach ihnen aus. »Ipse vero Antichristus opes malorum effodiet et exponet – so spricht der große Lehrer Anselmus von Canterbury. Effodiet! Hört ihr? Der Antichrist wird die alten Götter aus der Erde graben und sie von Neuem der Welt zeigen …«
Doch niemand hörte ihm mehr zu.
»Unser Padre Faustino ist aber ein ordentlicher Schreihals«, meinte kopfschüttelnd der verständige Müller. »Schon so schwach und doch ganz außer Rand und Band. Wenn sie noch einen Schatz gefunden hätten …«
»Das Götzenbild soll aber aus Silber sein …«
»Ach was, Silber! Ich habe es selbst gesehen: aus Marmor, und splitternackt ist das schamlose Weibsbild …«
»Mit so einer Unflätigen, Gott verzeih mir, lohnt es nicht, die Hände zu beschmutzen …«
»Wo gehst du hin, Zacchello?«
»Ich muss aufs Feld.«
»Dann geh mit Gott. Ich muss in den Weinberg.«
Alle Wut des Priesters richtete sich jetzt gegen seine Pfarrkinder: »So seid ihr, ihr ungetreuen Hunde, ihr Knechtsseelen! Euren Seelenhirten lasst ihr im Stich! Wisst ihr auch, ihr Satansbrut, dass euer verdammtes Dorf schon längst in die Erde versunken wäre, wenn ich nicht Tag und Nacht für euch gebetet, mich kasteit, gefleht und gefastet hätte? Jetzt ist es aus! Ich gehe hinweg von euch und schüttele den Staub von meinen Füßen. Verflucht sei euer Land! Verflucht sei euer Brot und euer Wasser, euer Vieh und eure Kinder und Kindeskinder! Ich bin nicht länger euer Vater, euer Seelenhirte! Anathema!«
In dem stillen Winkel der Villa, wo auf ihrem goldenen Strohlager die Göttin ruhte, trat Giorgio Merula zu dem Unbekannten, der die Statue vermaß.
»Sucht Ihr göttliche Proportionen?«, fragte der Gelehrte mit einem Gönnerlächeln. »Wollt Ihr die Schönheit mathematisch erfassen?«
Der andere blickte ihn stumm an, als habe er die Frage nicht recht verstanden, und vertiefte sich wieder in seine Arbeit. Die Schenkel des Zirkels öffneten und schlossen sich und beschrieben regelmäßige geometrische Figuren. Mit ruhigen, sicheren Bewegungen legte er das Winkelmaß an die herrlichen Lippen der Aphrodite, deren Lächeln Giovannis Herz mit Entsetzen erfüllte, las die Zahlen ab und trug sie in ein Buch ein.
»Gestattet mir die Frage«, versuchte Merula von Neuem, »wie viel Teilstriche sind es?«
»Mein Instrument ist leider ungenau«, antwortete der Fremde unwillig. »Um die Proportionen zu messen, teile ich das menschliche Gesicht gewöhnlich in Grade, Minuten, Sekunden und Terzen. Jeder Unterteil beträgt immer ein Zwölftel des vorhergehenden.«
»Aber!«, warf Merula ein. »Der letzte Unterteil muss dann kleiner sein als die Dicke des dünnsten Haares. Fünfmal ein Zwölftel …«
»Eine Terz«, erklärte der andere immer noch recht zurückhaltend, »ist der 48 823. Teil des ganzen Gesichts.«
Merula hob die Brauen und lächelte.
»Man lernt nie aus! Ich hätte nie gedacht, dass man es zu solcher Genauigkeit bringen kann!«
»Je genauer, desto besser«, bemerkte der andere.
»Oh, natürlich! … Immerhin, wisst Ihr, in der Kunst, in der Schönheit – alle diese mathematischen Berechnungen, Grade, Sekunden …! Offen gestanden, ich kann nicht recht glauben, dass ein Künstler im Rausch des Entzückens und flammender Inspiration – sozusagen, wenn der Geist Gottes über ihn kommt …«
»Ja, ja, Ihr habt wohl recht«, pflichtete ihm der Unbekannte wie gelangweilt bei. »Aber es ist doch interessant, zu wissen …«
Er beugte sich wieder nieder und stellte mit dem Winkelmaß die Anzahl der Grade zwischen Haaransatz und Kinn fest.
Wissen!, dachte Giovanni. Als ob man so etwas wissen und messen könnte! Welch Aberwitz! Fühlt er, begreift er das nicht?
Merula, der anscheinend den Gegner reizen und zu einem Streit herausfordern wollte, begann über die Vollkommenheit der Alten zu reden und meinte, man müsse ihnen alles nachmachen. Der Unbekannte aber schwieg, und als Merula endete, spielte ein feines Lächeln um seine Lippen, und er entgegnete: »Wer aus der Quelle trinken kann, wird nicht abgestandenes Wasser vorziehen.«
»Gestattet«, rief der Gelehrte. »Wenn Euch sogar die Alten abgestandenes Wasser sind – was ist dann die Quelle?«