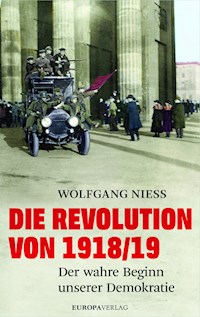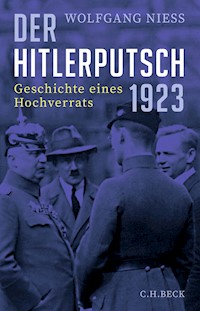19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Revolution von 1918/19, der Hitlerputsch, die Reichspogromnacht, das Attentat von Georg Elser auf Adolf Hitler und die friedliche Revolution von 1989 – alle diese Ereignisse sind mit dem 9. November verknüpft. Er ist der deutsche Schicksalstag. Der Historiker und Journalist Wolfgang Niess erzählt, was jeweils geschah, und beschreibt den Kampf um die Erinnerung. So entsteht ein Panorama des deutschen 20. Jahrhunderts mit all seinen Widersprüchen. «Der 9. November ist der deutsche Schicksalstag.» So begann Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble am 9. November 2018 seine Ansprache zur Gedenkveranstaltung des deutschen Bundestages. «An diesem Datum verdichtet sich unsere jüngere Geschichte in ihrer Ambivalenz, mit ihren Widersprüchen, ihren Gegensätzen. Das Tragische und das Glück, der vergebliche Versuch und das Gelingen, Freude und Schuld: All das gehört zusammen. Untrennbar.» Seit 1918 ist der 9. November ein besonderer Tag der deutschen Geschichte, der eine eigene historische Bedeutung besitzt. Die Ereignisse stehen nicht bloß in einem anekdotischen, sondern in einem realen Zusammenhang. Im Spiegel dieses Datums lässt sich daher eine deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts schreiben. Der 9. November macht den langen, von furchtbaren Rückfällen in die Barbarei unterbrochenen, schließlich aber erfolgreichen Kampf um die Demokratie in Deutschland anschaulich wie kein anderer Tag des Jahres. Es ist an der Zeit, ihn zu einem nationalen Gedenktag zu erklären.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Wolfgang Niess
Der 9. November
Die Deutschen und ihr Schicksalstag
C.H.Beck
Zum Buch
Die Revolution von 1918/19, der Hitlerputsch, die Reichspogromnacht, das Attentat von Georg Elser auf Adolf Hitler und die friedliche Revolution von 1989 – alle diese Ereignisse sind mit dem 9. November verknüpft. Er macht den langen, von furchtbaren Rückfällen in die Barbarei unterbrochenen, schließlich aber erfolgreichen Kampf um die Demokratie in Deutschland anschaulich wie kein anderer Tag des Jahres. Der 9. November ist der deutsche Schicksalstag. Der Historiker und Journalist Wolfgang Niess erzählt, was jeweils geschah, und beschreibt den Kampf um die Erinnerung. So entsteht ein Panorama des deutschen 20. Jahrhunderts mit all seinen Widersprüchen.
Über den Autor
Wolfgang Niess ist promovierter Historiker und war lange Jahre Redakteur beim SWR Fernsehen. Er machte sich als Moderator im Radio des SWR und SDR einen Namen, ebenso durch die Veranstaltungsreihe «Autor im Gespräch», die er entwickelte und seit mehr als 20 Jahren moderiert. Niess ist Autor zahlreicher Radio- und Fernsehsendungen, Aufsätze und Buchpublikationen zu Aspekten der Zeitgeschichte. Zuletzt erschien: «Die Revolution von 1918/19. Der wahre Beginn unserer Demokratie».
Inhalt
1: Der 9. November – Kein Tag wie andere
2: «Es lebe die deutsche Republik» – Die Novemberrevolution 1918
3: Von der «größten aller Revolutionen» zum «Dolchstoß» – Der 9. November wird nicht Nationalfeiertag
4: Nur die Spitze des Eisbergs – Der «Hitler-Putsch» 1923
5: «Geburtsstunde der Republik» oder «Landesverrat» – Der 9. November und der Kampf um die Weimarer Demokratie
6: Opferkult und Propaganda – Die Usurpation des 9. November durch das NS-Regime
7: Rückfall in die Barbarei – Der Novemberpogrom 1938
8: Was ein Einzelner vermag – Das Attentat des Georg Elser 1939
9: Hitlers Trauma – Der 9. November in den Kriegsjahren
10: Trennendes Gedenken – Die Nachkriegsjahre
11: Am Ende bleibt die Schuld – Der 9. November in der Geschichtskultur der Bundesrepublik
12: «Vollstreckerin der historischen Lehren» – Der 9. November in der Geschichtskultur der DDR
13: «Wahnsinn!» – Der Mauersturz 1989
14: Angst und Sorge dominieren – Der 9. November wird (wieder) nicht Nationalfeiertag
15: Der Blick wird freier – Der 9. November in der Geschichtskultur des vereinten Deutschland
16: Etwas mehr Mut, bitte … – Der 9. November und die Stärkung der Demokratie
Anmerkungen
1 Der 9. November – Kein Tag wie andere
2 «Es lebe die deutsche Republik» – Die Novemberrevolution 1918
3 Von der «größten aller Revolutionen» zum «Dolchstoß» – Der 9. November wird nicht Nationalfeiertag
4 Nur die Spitze des Eisbergs – Der «Hitler-Putsch» 1923
5 «Geburtsstunde der Republik» oder «Landesverrat» – Der 9. November und der Kampf um die Weimarer Demokratie
6 Opferkult und Propaganda – Die Usurpation des 9. November durch das NS-Regime
7 Rückfall in die Barbarei – Der Novemberpogrom 1938
8 Was ein Einzelner vermag – Das Attentat des Georg Elser 1939
9 Hitlers Trauma – Der 9. November in den Kriegsjahren
10 Trennendes Gedenken – Die Nachkriegsjahre
11 Am Ende bleibt die Schuld – Der 9. November in der Geschichtskultur der Bundesrepublik
12 «Vollstreckerin der historischen Lehren» – Der 9. November in der Geschichtskultur der DDR
13 «Wahnsinn!» – Der Mauersturz 1989
14 Angst und Sorge dominieren – Der 9. November wird (wieder) nicht Nationalfeiertag
15 Der Blick wird freier – Der 9. November in der Geschichtskultur des vereinten Deutschland
16 Etwas mehr Mut, bitte … – Der 9. November und die Stärkung der Demokratie
Literaturverzeichnis
Dank
Bildnachweis
Personenregister
1
Der 9. November – Kein Tag wie andere
«Der 9. November ist der deutsche Schicksalstag.» So begann Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble am 9. November 2018 seine Ansprache zur Gedenkveranstaltung des Deutschen Bundestages. «An diesem Datum verdichtet sich unsere jüngere Geschichte in ihrer Ambivalenz, mit ihren Widersprüchen, ihren Gegensätzen. Das Tragische und das Glück, der vergebliche Versuch und das Gelingen, Freude und Schuld: All das gehört zusammen. Untrennbar.»[1]
Mehr als jeder andere Tag des Jahres bewegt der 9. November die Deutschen. Landauf, landab finden Gedenkveranstaltungen statt. Die Medien erinnern regelmäßig an spezifische historische Facetten. Immer wieder wurde das Datum als Nationalfeiertag ins Spiel gebracht. Die Kultusministerkonferenz hat dazu aufgerufen, in jedem Jahr am 9. November einen Projekttag in den Schulen durchzuführen. Die Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung haben Materialien erarbeitet, die helfen sollen, den historischen Gehalt des 9. November in seiner ganzen sachlichen und emotionalen Komplexität zu entschlüsseln und zu verstehen.
Es sind vor allem vier herausragende Ereignisse, die meist mit dem 9. November verbunden werden:
die Revolution, die am 9. November 1918 die Monarchien in Deutschland beseitigte und zur Gründung der ersten deutschen Republik führte («Ausrufung der Republik»)
der Hitler-Putsch von 1923
die Novemberpogrome des Jahres 1938, mit denen die öffentliche Gewalt gegen die deutschen Juden eine neue Eskalationsstufe erreichte
der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989.
In allen Fällen weist die Datierung eine gewisse Unschärfe auf. Die Novemberrevolution nahm bereits einige Tage zuvor in Kiel ihren Anfang, aber mit dem Sieg und der Ausrufung der Republik in Berlin wurde der 9. November zum Symboltag der demokratischen Umwälzung. Hitlers Putsch in München begann am 8. November und scheiterte am folgenden Tag. Die reichsweiten Novemberpogrome wurden am späten Abend des 9. November initiiert und hatten ihren Schwerpunkt am 10. November. Zum Sturz der Berliner Mauer kam es am 9. November kurz vor Mitternacht, gefeiert wurde in den Nacht- und Morgenstunden des 10. November. Es ist deshalb nicht nur sinnvoll, sondern auch legitim, ein fünftes Ereignis hinzuzufügen, das oft deshalb nicht berücksichtigt wird, weil es – wie Hitlers Putschversuch – am 8. November stattfand:
das gescheiterte Attentat von Georg Elser auf Adolf Hitler im Jahr 1939.
Auch dieses Attentat gehört sachlich und terminlich in den Kontext des 9. November.
Ethisch wie emotional markieren 1938 und 1989 die Spannweite. Der 9. November 1938 steht «für den unvergleichlichen Bruch der Zivilisation, für den Absturz Deutschlands in die Barbarei»,[2] so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der erwähnten Gedenkveranstaltung, der 9. November 1989 gilt als «der glücklichste Tag der Deutschen».[3] Vor allem die extreme Spannung zwischen tiefster Scham und Schuld einerseits und größter Freude andererseits hat 1990 verhindert, dass der 9. November zum Nationalfeiertag des vereinten Deutschland wurde. Für viele war es unvorstellbar, beides an einem Tag zusammenzubringen.
Die Gedenkstunde des Deutschen Bundestages am 9. November 2018 kann vor diesem Hintergrund gar nicht genügend gewürdigt werden. Erstmals in der deutschen Geschichte hat die politische Elite des Landes den Versuch unternommen, den 9. November in seiner ganzen Bandbreite in den Blick zu nehmen – mit großem Ernst und Nachdenklichkeit, mit Sensibilität und aufrichtigem Bekenntnis zur Verantwortung für die Gräueltaten der Nazizeit, mit Freude und Dankbarkeit. Der Versuch ist mehr als gelungen, die Veranstaltung wurde eine Sternstunde des Parlaments und der deutschen Demokratie.
1918 – 1923 – 1938 – 1989 – und immer der 9. November. Das begründet den ganz besonderen Ruf des 9. November als «Schicksalstag» der Deutschen. Der Völkische Beobachter hat den Begriff allerdings schon 1927 benutzt, die Süddeutsche Zeitung erstmals 1946, auch Historiker haben ihn bisweilen verwendet, um auf die besondere Bedeutung des Datums hinzuweisen. Aber erst der Fall der Mauer hat ihm den entscheidenden Auftrieb gegeben, so dass heute in Medien, Politik und politischer Bildung fast flächendeckend vom «Schicksalstag» gesprochen wird. Die Bundeszentrale für politische Bildung verwendet den Begriff als Titel für Bücher und Materialien, das ZDF und n-tv als Sendungstitel, die Deutsche Welle in ihrem Internetauftritt. Kaum eine Zeitung oder ein Magazin, das auf den «Schicksalstag» verzichtet, wenn vom 9. November in der deutschen Geschichte die Rede ist.
Die griffige Formulierung soll vordergründig vor allem die herausragende Bedeutung des 9. November unterstreichen. Zugleich aber lädt sie das Datum mit mystischer Bedeutung auf, indem sie das «Schicksal» als über menschlichem Handeln stehende Kategorie ins Spiel bringt. Am 9. November scheinen geheimnisvolle Mächte im Hintergrund zu wirken. Vor solchem Denken sollten wir uns hüten – ganz besonders im Hinblick auf den 9. November. Wo die Metaphysik ins Spiel kommt, hören die Fragen auf. Zusammenhänge und Hintergründe verschwinden im mystischen Nebel. Das trübt den Blick und behindert Aufklärung.
Es ist bemerkenswert, wie häufig die genannten Ereignisse nebeneinander abgehandelt werden, ohne mögliche Zusammenhänge näher zu untersuchen. Gelegentlich wird auf der metaphysischen Ebene nach Verbindendem gesucht: «Am neunten November tritt die ideologische Leidenschaft in einen Wettbewerb mit der kühl organisierenden und vorausblickenden Vernunft – und die Affekte gewinnen.»[4] Mitunter werden die vier Novemberdaten der Jahre 1918, 1923, 1938 und 1989 ergänzt um andere, wenig bedeutsame Ereignisse in anderen Jahren. Zu welchen Erkenntnissen es allerdings führen könnte, den Tod des RAF-Terroristen Holger Meins 1974 in die Reihe der Novemberdaten aufzunehmen,[5] erschließt sich beim besten Willen nicht. Anekdotisches Aneinanderreihen ersetzt nicht Geschichtsschreibung. 2017 erschien gar ein Taschenbuch mit dem Titel 9. November – Schicksalstag der Deutschen. Heiteres und Besinnliches einer am 9. November Geborenen.
Der 9. November taugt nicht als Perlenschnur, an der entlang einzelne Geschichten erzählt werden, er eignet sich auch nicht, um metaphysische Spekulationen anzustellen. Es ging und geht am 9. November seit 1918 um konkrete und handfeste Politik, auch um Geschichtspolitik.
Vier meiner fünf Novemberdaten sind eng aufeinander bezogen. Der Putschversuch von 1923 war Hitlers Reaktion auf die Novemberrevolution und die Ausrufung der Republik am 9. November 1918, die für ihn ein traumatisches und lebensprägendes Ereignis waren. Die Novemberpogrome 1938 konnten in dieser Form nur im Kontext der jährlichen Münchner NSDAP-Feierlichkeiten für die «Gefallenen der Bewegung» am 8./9. November initiiert werden. Auch das Attentat Georg Elsers 1939 war an keinem anderen Tag des Jahres denkbar. Es war nur möglich im Rahmen des jährlich am 8. November mit großer Zuverlässigkeit stattfindenden Auftritts Hitlers im Münchner Bürgerbräukeller bei den «Alten Kämpfern». Diese Zusammenhänge erschließen sich aber nur dann vollständig, wenn man nicht nur die vier «Großereignisse» betrachtet, sondern auch den Umgang mit dem 9. November als geschichtspolitisch hoch aufgeladenem Symbol.
Der 9. November hat – beginnend mit dem Jahr 1918 – eine eigene Geschichte, die zu erzählen ist. Er ist genau seit diesem Zeitpunkt ein ganz besonderer Tag der deutschen Geschichte. Deshalb beginnt meine Geschichte des 9. November nicht im Jahr 1848, als in Wien der Revolutionär und Paulskirchenabgeordnete Robert Blum von den Kräften der Gegenrevolution standrechtlich erschossen wurde. Sachlich gehört diese Hinrichtung durchaus in meinen Kontext, aber sie hat dem 9. November als Datum noch keine eigene historische Bedeutung gegeben. Erst mit dem Sieg der Novemberrevolution beginnt das Ringen um den 9. November als historisches Symbol. Es war bis 1945 Teil des erbitterten Kampfs zwischen Demokraten und den Feinden der Demokratie. In der Zeit der deutschen Teilung wurde der 9. November benutzt, um nicht demokratisch legitimierte Herrschaft ideologisch zu stützen. In der alten Bundesrepublik geriet der 9. November als Symbol der Demokratie fast völlig in Vergessenheit und wurde in erster Linie zum Symbol der abscheulichen Verbrechen an den deutschen Juden und der Shoah. Die «Friedliche Revolution», die 1989 zum Sturz der Mauer führte, brachte den Durchbruch der Demokratie auch in der DDR und erweiterte den Blick auf den 9. November um wichtige Aspekte. In der Gegenwart zeigt sich im Gedenken und in den Debatten um den 9. November wie im Brennglas das jeweilige historisch-politische Selbstverständnis der Bundesrepublik, insbesondere ihr Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, aber auch mit ihrer Demokratiegeschichte.
In dieser Hinsicht markiert der 9. November 2018 einen Wendepunkt. Erstmals hat in der Gedenkstunde des Bundestages ein deutsches Staatsoberhaupt ausführlich den 9. November 1918 als «Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte» gewürdigt – ohne den 9. November 1938 zu vernachlässigen. Beides gehört zusammen, alle Facetten des 9. November gehören zusammen und machen wesentliche Elemente der deutschen Geschichte aus.
Folgen wir also der Spur des 9. November durch das 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart – und starten wir da, wo alles begann, am 9. November 1918 …
2
«Es lebe die deutsche Republik» – Die Novemberrevolution 1918
Der 9. November 1918 war ein Samstag, ein normaler Arbeitstag in den Berliner Betrieben.[1] Es war ein typischer Novembertag: neun Grad, trüb, in der Frühe regnete es. Wie an jedem anderen Werktag machten sich die Arbeiter auf den Weg in die Fabriken. Am Morgen schien noch alles wie gewohnt – aber es lag etwas in der Luft. Seit drei, vier Tagen hatte sich eine flirrende Anspannung über die Stadt gelegt. Nachrichten von der Küste waren durchgesickert. Matrosen der Hochseeflotte hätten sich geweigert, zu einem letzten Gefecht in einem erkennbar verlorenen Krieg auszulaufen. In Kiel und anderen Städten an der Küste sei es zu Aufständen gekommen. Bremen, Hamburg und Kiel seien in den Händen von Arbeiter- und Soldatenräten, hatte der Vorwärts, das Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), am Vortag berichtet, allerdings erst auf Seite drei.[2] In München sei sogar der König abgesetzt worden und Bayern jetzt Freistaat und Republik, hieß es. Aber sicher konnten die einfachen Arbeiter sich nicht sein, die am 9. November auf dem Weg in die Fabriken waren. Die Reichshauptstadt war inzwischen von allen Verbindungen zur Außenwelt abgeschnitten. Der Zugverkehr von und nach Berlin war auf Anordnung des militärischen Oberbefehlshabers eingestellt worden. Versammlungen waren verboten. Über die Stadt war der Belagerungszustand verhängt, es herrschte Pressezensur.
Immer mehr Truppen sah man nun in der Stadt. Beunruhigend war auch, dass der Oberkommandierende in den Marken – so der offizielle Titel des Militärbefehlshabers – allen auf Urlaub in Berlin befindlichen Offizieren befohlen hatte, sich «feldmarschmäßig ausgerüstet» am 8. November, mittags 12 Uhr auf der Kommandantur am Schinkelplatz zu melden. Am Abend des 8. November waren am Halleschen Tor schwer bewaffnete Infanterieeinheiten, Maschinengewehr-Kompanien und leichte Feldartillerie gesehen worden, die in schier endlosen Kolonnen vorbeizogen. Es braute sich etwas zusammen in der Hauptstadt.
Es waren ausgemergelte Männer und dürre Frauen mit fahlen Gesichtern, die sich am Morgen des 9. November auf den Weg in die Fabriken machten. Schon seit zwei, drei Jahren gab es nicht mehr genügend zu essen, und was es gab, hätte man in Friedenszeiten wohl nur an Schweine verfüttert. Die Grippe grassierte und forderte auch in Berlin viele Menschenleben. Das alles war vollends unerträglich geworden, seit die Heeresleitung erklärt hatte, man müsse einen Waffenstillstand schließen. Der Krieg war verloren, warum jetzt noch weiterkämpfen, leiden und hungern? Jetzt musste mit alledem Schluss sein. Vor allem mit dem Krieg. Sofort!
Seit einigen Wochen hatte sich diese explosive Stimmung immer mehr aufgebaut, in den letzten Tagen spürte man, dass ein kleiner Funke genügte. Nachdem es am 8. November zu Verhaftungen gekommen war, beschloss der Vollzugsausschuss des Arbeiter- und Soldatenrates Berlin, für den 9. November zum Generalstreik und zu Massendemonstrationen aufzurufen. Der Arbeiter- und Soldatenrat war die illegale Organisation der Berliner Arbeiter, in der sich auch Vertreter sozialistischer Parteien und Gruppen zusammengefunden hatten. Ein Gremium, in dem man sich beriet und abstimmte, aber keine Revolutionszentrale. Noch in der Nacht entstanden zwei Flugblätter, die am frühen Morgen verteilt wurden, aber nur in kleiner Auflage und in wenigen Betrieben. Im einen, unterzeichnet vom Vollzugsausschuss des Arbeiter- und Soldatenrates, hieß es: «Arbeiter, Soldaten, Genossen! Die Entscheidungsstunde ist da! … Wir fordern nicht Abdankung einer Person, sondern Republik! Die sozialistische Republik mit allen ihren Konsequenzen. Auf zum Kampf für Friede, Freiheit und Brot. Heraus aus den Betrieben. Heraus aus den Kasernen! Reicht Euch die Hände. Es lebe die sozialistische Republik.»[3] Das andere stammte von der Spartakusgruppe, entschiedenen sozialistischen Kriegsgegnern um Karl Liebknecht. Ihr Flugblatt forderte die Beseitigung der Dynastien, die Wahl von Arbeiter- und Soldatenräten, die Übernahme der Regierung durch deren Beauftragte sowie die sofortige Verbindung mit der russischen Arbeiterrepublik. Es endete mit einem «Hoch auf die sozialistische Republik!»[4] Die Spartakusgruppe war zwar im Vollzugsausschuss des Arbeiter- und Soldatenrates vertreten, aber sie betrieb Propaganda für ihre eigenen Ziele. Nicht nur am 9. November.
In der Morgenausgabe des Vorwärts, den in diesen Tagen fast jeder Berliner Arbeiter zu lesen versuchte, erschien am 9. November ein Aufruf des Parteivorstands und der Reichstagsfraktion der SPD vom Vorabend. Darin wurden die Arbeiter vor «Unbesonnenheiten» gewarnt. Die SPD-Spitze habe am 7. November ultimativ eine Reihe von Forderungen erhoben, die zum Teil bereits erfüllt worden seien. Noch nicht erledigt sei die «Kaiserfrage», man erwarte aber den Rücktritt des Monarchen unmittelbar nach dem Abschluss des Waffenstillstands und habe das Ultimatum bis zu diesem Zeitpunkt verlängert. Die Arbeiter wurden aufgefordert, einige wenige Stunden Geduld aufzubringen und mit allen Aktionen abzuwarten. «Eure Kraft und Eure Entschlossenheit verträgt diesen Aufschub.»[5]
Philipp Scheidemann, seit 1917 neben Friedrich Ebert einer der beiden SPD-Vorsitzenden, war unsicher, ob das an diesem Morgen tatsächlich noch galt. Scheidemann hatte eine ausgezeichnete Nase für Stimmungen, er spürte, was angesagt und notwendig war. Seit Anfang Oktober 1918 war Philipp Scheidemann als Staatssekretär (in unserem heutigen Sprachgebrauch: Minister) Mitglied der Reichsregierung, und wusste, dass inzwischen von Kiel bis München die Stimmung eindeutig war: «Fort mit dem Kaiser!»
Am frühen Morgen des 9. November, noch vor sieben Uhr, rief Scheidemann zum wiederholten Mal drängend in der Reichskanzlei an und erklärte, die Abdankung Wilhelms II. sei überfällig. Wenn der Kaiser nicht sofort zurücktrete, dann wisse er nicht, wie er und die anderen Männer der SPD-Spitze die Leute noch davon abhalten könnten, auf die Straße zu gehen. Scheidemann kündigte an, sein Amt als Staatssekretär niederzulegen, wenn der Kaiser in einer Stunde nicht zurückgetreten sei. Auch Reichskanzler Prinz Max von Baden saß wie auf Kohlen, aber er hatte keine Neuigkeiten aus dem Großen Hauptquartier im belgischen Spa, wohin sich der Kaiser einige Tage zuvor zurückgezogen hatte.
Prinz Max hatte erst am 3. Oktober das Amt des Reichskanzlers und das des Preußischen Ministerpräsidenten übernommen. Er galt als liberal und sollte vor allem im Ausland, besonders bei den Kriegsgegnern, den Eindruck erwecken, es habe sich etwas geändert im preußisch-militaristischen Deutschland. Aus diesem Grund hatte er auch die Aufgabe, Sozialdemokraten und bürgerliche Demokraten mit in die Regierung einzubeziehen. Seine erste gewichtige Amtshandlung war es, bei den Gegnern um Waffenstillstand zu ersuchen. Der großherzogliche Prinz aus dem Südwesten hatte die undankbare Aufgabe nur übernommen, weil er mit dem Kaiser verwandtschaftlich verbunden war und dieser ihm seine Unterstützung zugesagt hatte. Doch als ihm der Druck in Berlin zu groß wurde, hatte sich Wilhelm II. zu seinen Generälen nach Spa abgesetzt. Max hatte schon seit Tagen keinen Zugang mehr zum Kaiser und fühlte sich zugleich vollständig abhängig von ihm.
Am Morgen des 9. November war der Oberbefehlshaber in den Marken noch sehr zuversichtlich, dass in der Reichshauptstadt eine Revolution verhindert oder sofort niedergeschlagen werden könnte. Generaloberst Alexander von Linsingen wusste zwar, dass inzwischen in vielen Städten des Deutschen Reiches Arbeiter- und Soldatenräte die Macht übernommen hatten, aber er war der festen Überzeugung, dass noch nichts verloren sei, solange Berlin gehalten werden konnte. Er hatte die Bildung von Räten ausdrücklich verboten und vorsorglich in den vergangenen Tagen als besonders kaisertreu geltende Truppenteile zur Verstärkung in die Stadt geholt. Mehrere Tausend Soldaten, darunter die Garde und die Naumburger Jäger, sicherten im Zentrum das Regierungsviertel und wichtige strategische Punkte. Sie waren mit Maschinengewehren ausgerüstet, mit Artillerie und Panzerkraftwagen. Auch Flugzeuge mit Bomben standen bereit. Der Oberbefehlshaber war auf alles vorbereitet. Am Abend des 7. November hatte er dem Kanzler versichert, er könne Berlin «unter allen Umständen» halten. «Er würde allerdings unter Umständen scharf zufassen, auch Artillerie verwenden müssen.» Der Kanzler war einverstanden. «Beschränkungen wurden ihm von mir in keiner Weise auferlegt», erklärte Max von Baden später lapidar in seinen Erinnerungen.[6]
Gegen acht Uhr begann in den ersten Betrieben der Generalstreik. Arbeiter machten sich in Demonstrationszügen auf den Weg in die Innenstadt. Ernste Entschlossenheit prägte diese Demonstrationszüge. Fröhliche Gesichter sah man am Morgen des 9. November nicht. Keiner der Demonstranten wusste, ob er den Abend dieses Tages erleben würde. Sie machten sich dennoch auf den Weg, weil jetzt endlich Schluss sein musste, koste es, was es wolle.
Um 9 Uhr trat in der Reichskanzlei das Regierungskabinett zusammen, nahm den Rücktritt Scheidemanns zur Kenntnis und vertagte sich auf 12 Uhr. Vom Kaiser gab es nichts Neues. Der Austritt der Sozialdemokraten aus der Regierung des Prinzen Max war eine Wende in buchstäblich letzter Minute. Nur so konnte die SPD vermeiden, in den Strudel des untergehenden Kaiserreichs gezogen zu werden, und es gelang ihr mit dieser Volte sogar, zu einem entscheidenden Faktor der Revolution zu werden.
Am Morgen des 9. November tagten im völlig überfüllten SPD-Fraktionszimmer des Reichstages die Mitglieder des Partei- und des Fraktionsvorstands gemeinsam mit den Berliner Betriebsvertrauensleuten der Partei. Die einlaufenden Nachrichten und Berichte widersprachen sich zum Teil erheblich, aber sie ließen doch keinen Zweifel mehr zu: Die Arbeiter marschierten. Die SPD musste handeln, wenn sie den Kontakt zur Berliner Arbeiterschaft nicht verlieren wollte. Der SPD-Reichstagsabgeordnete Otto Wels eröffnete die Sitzung mit klaren Worten: «Die Würfel sind gefallen! Geredet wird nicht mehr! Heraus aus den Betrieben, auf die Straßen.» Wels verkündete den versammelten Betriebsvertrauensleuten auch die Parole, mit der sich die SPD äußerst erfolgreich zurück ins Spiel brachte: «Von heute ab gibt es keinen Streit mehr in der Arbeiterschaft, heute kämpfen wir den Entscheidungskampf unter dem alten gemeinsamen Banner.» Die im Krieg erfolgte Abspaltung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD) von der SPD sollte von nun an ganz in den Hintergrund treten. «Heute mischt sich vielleicht unser Blut mit dem unserer Arbeiterbrüder im gemeinsamen Kampf. Komme, was kommen mag, jetzt heißt es vorwärts, durch Kampf zum Sieg.»[7] Die Sitzung dauerte nur wenige Minuten, dann machten sich die Vertrauensleute auf den Weg zu ihren Kollegen, die zum Teil schon auf dem Marsch in die Berliner Innenstadt waren.
Inzwischen war es zehn Uhr geworden, und es waren bereits Hunderttausende unterwegs. Auch Frauen waren dabei – zum Teil mit Kindern. Die spärlich vorhandenen Waffen wurden in den hinteren Reihen der Demonstrationszüge getragen. Die Demonstranten suchten keine Konfrontation, und doch schien sie unvermeidlich. Truppe und Polizei hatten den Befehl, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Zeitweise lag eine fast nicht zu ertragende Spannung über der Hauptstadt.
Was sich im November 1918 Bahn brach, war zunächst vor allem eine gewaltige Sehnsucht nach Frieden. Mehr als vier Jahre dauerte inzwischen der Erste Weltkrieg. Er hatte Millionen Soldaten das Leben gekostet, und auch in der Heimat herrschten Hunger und Not. Dazu kam ab Juni die Spanische Grippe, der im Lauf weniger Monate Zehntausende zum Opfer fielen. Im Sommer 1918 scheiterte die letzte Offensive an der Westfront. Seit dem Kriegseintritt der USA griffen immer mehr frische amerikanische Truppen in die Kämpfe ein. Jeden Monat kamen 250.000 Mann zusätzlich an die Front. Die Oberste Heeresleitung (OHL), der im Laufe des Krieges diktatorische Macht zugewachsen war – mit Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg als symbolischer Spitze und Generalleutnant Erich Ludendorff als strategischem Kopf –, befürchtete, dass ein Durchbruch unmittelbar bevorstehe.
Als am 25. September Bulgarien um Waffenstillstand ersuchte, war der Weg nach Mitteleuropa für die alliierten Truppen frei und die Verbindung mit der verbündeten Türkei blockiert. Damit war in Ludendorffs Augen die Entscheidung gefallen. Plötzlich und sehr vehement verlangte deshalb die OHL Ende September, so schnell wie möglich einen Waffenstillstand zu erreichen. Aber nicht nur das. Weil US-Präsident Woodrow Wilson angekündigt hatte, er werde einen Verständigungsfrieden keinesfalls mit den bisherigen Machthabern schließen, sollten nach dem Willen der OHL auch die sogenannten Mehrheitsparteien im Reichstag an der Regierung beteiligt und die Reichsverfassung geändert werden.
Alles musste jetzt blitzschnell gehen. Schon am 3. Oktober wurde Prinz Max von Baden Kanzler einer neuen Regierung, in die auch Sozialdemokraten, Linksliberale und die Zentrumspolitiker eintraten. Unmittelbar nach ihrem Zustandekommen bat die neue Regierung den amerikanischen Präsidenten darum, einen Waffenstillstand herbeizuführen. Mit unvorstellbarer Geschwindigkeit wurde dann eine Verfassungsreform durchgepeitscht, und bereits Ende Oktober war das Deutsche Reich de jure eine parlamentarische Monarchie.
Für die deutsche Öffentlichkeit kam all das völlig überraschend. Hatte man nicht Russland im Frühjahr einen Siegfrieden aufgezwungen? Warum sollte das nicht auch im Westen möglich sein? Die deutschen Truppen standen doch weit in Frankreich. Die meisten Deutschen verstanden nicht, was da geschah. Das nationale Lager war fassungslos. Die einfachen Soldaten und Arbeiter dagegen hofften vor allem, dass jetzt Leiden und Sterben möglichst schnell ein Ende haben würden.
Doch daraus wurde nichts. Die hektischen Aktivitäten der deutschen Politik überzeugten die amerikanische Regierung nicht. Sie wollte genau wissen, ob das deutsche Volk nun tatsächlich die Macht hatte, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Diplomatische Noten wurden ausgetauscht, die Amerikaner forderten Garantien. Das ging den deutschen Militärs dann doch zu weit. Am 24. Oktober vollzogen sie eine Kehrtwende. Die Heeresleitung ordnete an, den militärischen Kampf mit aller Kraft wieder aufzunehmen, und die Seekriegsleitung befahl der Flotte, sich für eine große Schlacht gegen die Royal Navy bereit zu machen. Es war ein Geheimbefehl, den auch der Reichskanzler nicht kannte, man kann es auch eine Meuterei der Admirale gegen die neue Regierung nennen. Die Flotte wurde vor Wilhelmshaven zusammengezogen, am 30. Oktober sollte sie in Richtung Themsemündung auslaufen.
Offiziell sollte es auf Übungsfahrt in die Nordsee gehen, aber auf den Schiffen sickerte durch, was die Flottenleitung tatsächlich plante. Matrosen durchschauten, dass damit alle Bemühungen um den scheinbar so nahen Waffenstillstand hintertrieben werden sollten. In der Nacht vor dem Auslaufen kam es auf einigen Schiffen zur offenen Meuterei. Zeitweise lagen sich Schiffe der Flotte mit gefechtsbereiten Geschützen und Torpedorohren drohend gegenüber. Dann gaben die Meuterer auf. Der Flottenchef ließ sie festnehmen und an Land in Arrest bringen. Weil er sich der Besatzungen nicht mehr sicher war, blies er jedoch das Flottenunternehmen ab und schickte die Schiffe wieder zu ihren Standorten zurück.
Das dritte Geschwader machte sich durch den Nord-Ostsee-Kanal auf den Rückweg nach Kiel. Weil dessen Kommandeur den Eindruck hatte, wieder Herr der Lage zu sein, ließ er während der Durchfahrt weitere 49 Matrosen festnehmen, die er für Rädelsführer hielt. Sie wurden in Kiel inhaftiert, alle anderen erhielten Landurlaub. Aber den Matrosen stand der Sinn nicht nach Vergnügen, ihnen lag vor allem daran, ihre verhafteten Kameraden frei zu bekommen. Verhandlungen scheiterten, es kam zu Demonstrationen. Arbeiter schlossen sich an, die Meuterei wurde zum Aufstand, und der breitete sich mit atemberaubender Geschwindigkeit aus. In Kiel übernahmen die Revolutionäre am 4. November die Macht, in Lübeck und Brunsbüttel am 5. November. Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven folgten am 6., Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Köln und München am 7. November. Dann Leipzig und die meisten großen Städte Westdeutschlands. Innerhalb weniger Tage erfasste die revolutionäre Bewegung das ganze Land. Berlin allerdings war am Morgen des 9. November noch in der Hand des alten Regimes.
Nicht nur die militärische Führung, auch der Kaiser hatte viel zur revolutionären Stimmung beigetragen, weil er nicht bereit war, persönliche Konsequenzen aus der offenkundigen Niederlage zu ziehen. Immer stärker setzte sich im Oktober die Auffassung durch, mit dem Kaiser an der Spitze werde es keinen schnellen Waffenstillstand geben, Wilhelm II. müsse zurücktreten. Selbst in monarchistischen Kreisen forderte man die Abdankung des Kaisers, um eine Revolution zu vermeiden. Russland war warnendes Beispiel.
Die Entwicklung in Russland sah aber auch die übergroße Mehrheit der sozialistischen Arbeiterbewegung in Deutschland nicht als Hoffnung, sondern als Bedrohung. Die deutsche Sozialdemokratie hatte sich in den Kriegsjahren über die Frage, ob die Reichstagsfraktion der SPD Kriegskredite bewilligen sollte, nicht nur zerstritten, sondern gespalten. Nach heftigen internen Zerwürfnissen und verbunden mit tiefgreifenden persönlichen Verletzungen, waren die Gegner einer Bewilligung aus der SPD-Fraktion gedrängt worden und hatten schließlich im April 1917 eine eigene Partei gegründet, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Die russische Februarrevolution von 1917 sahen sowohl SPD als auch USPD positiv, denn sie zeigte: Eine Revolution war möglich, selbst im rückständig-reaktionären Russland! Den Staatsstreich der Bolschewiki im November 1917 – nach dem russischen Kalender als Oktoberrevolution bezeichnet – beobachteten beide Parteien aber mehrheitlich mit Skepsis. Als Lenin dann im Januar 1918 die Duma rigoros beiseiteschob, weil die Parlamentswahlen nicht das Ergebnis erbracht hatten, das er sich gewünscht hatte, war das Urteil in der SPD klar: Dies konnte und durfte nicht die Strategie deutscher Sozialdemokraten sein. Für sie konnte der Weg zum Sozialismus nur ein demokratischer sein. Das sah die Mehrheit in der USPD genauso.
Allerdings gab es in der USPD auch Gruppen, die vom entschiedenen Vorgehen der Bolschewiki fasziniert waren. Zu ihnen gehörten der Spartakusbund um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg und die Gruppe der Revolutionären Obleute. Bei den Obleuten handelte es sich um Betriebsvertrauensleute, die sich im Verlauf des Krieges vor allem in der Berliner Metall- und Rüstungsindustrie zusammengefunden hatten. Sie hatten bereits 1917 begonnen, erste Streiks zu organisieren, und registrierten im Herbst 1918 sehr genau die zunehmend revolutionäre Stimmung in den Betrieben. Es war vor allem ihrer Verankerung in der Berliner Arbeiterschaft zu verdanken, dass sich am 9. November 1918 schier endlose Züge auf den Weg in die Innenstadt machten. Die Hauptstadt erlebte die größte Massendemonstration ihrer Geschichte.
Unter dem Eindruck dieser gewaltigen Massen löste sich dann recht schnell die Anspannung. Es zeigte sich, dass die allermeisten Soldaten nicht bereit waren, auf Demonstranten zu schießen. Immer mehr Truppenteile verbrüderten sich mit den marschierenden Arbeitern, verteilten Waffen, verweigerten ihren Offizieren den Gehorsam, wählten Soldatenräte und schlossen sich der Revolutionsbewegung an. Selbst die Naumburger Jäger gingen zu den Aufständischen über.
Übergabe der Berliner Garde-Ulanen-Kaserne an die Mitglieder des Arbeiter- und Soldatenrates am 9. November 1918. Fast überall weigerten sich Soldaten, auf Demonstranten zu schießen.
An der Kaserne der Garde-Füsiliere in der Chausseestraße fielen allerdings noch am Vormittag tödliche Schüsse. Als sich ein Demonstrationszug der Kaserne näherte, wurde er von den Soldaten jubelnd begrüßt. Sie riefen den Demonstranten zu, sie seien von ihren Wachmannschaften eingesperrt worden und würden daran gehindert, die Kaserne zu verlassen. Man solle sie befreien, sie wollten sich anschließen. Die demonstrierenden Arbeiter und Soldaten ließen sich nicht zweimal bitten. Sie brachen die Türen der Kaserne auf und stürmten hinein. Ein Offizier erschoss drei der eindringenden Demonstranten gezielt aus der Menge heraus. Der 26-jährige Erich Habersaath, Metallarbeiter und führender Kopf der sozialistischen Jugendbewegung, der Monteur Franz Schwengler und der Gastwirt Richard Glatte waren die ersten Toten des 9. November. Am Ende des Tages waren es 15, fast ausschließlich Demonstranten, die von Offizieren erschossen worden waren.
Gegen elf Uhr hörte der Reichskanzler aus dem Großen Hauptquartier, dass Wilhelm II. sich entschieden habe abzudanken, der Text der Abdankungserklärung folge in einer halben Stunde. Der Kanzler wartete vergeblich. Um einer Absetzung des Kaisers durch die Revolutionäre zuvorzukommen, gab er dann kurz vor Mittag eine Erklärung an das Wolffsche Telegraphenbüro, die wichtigste Berliner Presseagentur: «Der Kaiser und König hat sich entschlossen dem Throne zu entsagen», hieß es da. Friedrich Ebert solle Reichskanzler werden, und es sollten Wahlen für eine Verfassunggebende Nationalversammlung ausgeschrieben werden, die dann über die künftige Staatsform entscheiden solle.[8]
Praktisch zeitgleich erschien eine Extraausgabe des Vorwärts mit der übergroßen Schlagzeile «Generalstreik!» Im Text hieß es: «Der Arbeiter- und Soldatenrat von Berlin hat den Generalstreik beschlossen. Alle Betriebe stehen still. Die notwendige Versorgung der Bevölkerung wird aufrechterhalten. Ein großer Teil der Garnison hat sich in geschlossenen Truppenkörpern mit Maschinengewehren dem Arbeiter- und Soldatenrat zur Verfügung gestellt. Die Bewegung wird gemeinschaftlich geleitet von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Arbeiter, Soldaten, sorgt für Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung. Es lebe die soziale Republik!»[9]
Als der Text in Druck ging, war das reines Wunschdenken der SPD-Spitze. Von einer Leitung der Bewegung durch die SPD konnte keine Rede sein, sie hatte keinerlei Einfluss auf das Zustandekommen des Generalstreiks, und auch die USPD konnte nicht im Ernst für sich in Anspruch nehmen, diese gewaltige Massenerhebung zu «leiten». Die Arbeiter und Soldaten wollten ein sofortiges Ende des verlorenen und sinnlosen Krieges, und sie waren bereit, alles beiseite zu schaffen, was der Verwirklichung dieser Forderung im Weg stand. Die Revolutionsbewegung war am 9. November vor allem eine radikale Friedensbewegung. Frieden – jetzt! Es gab kein einheitliches politisches Gesamtprogramm, die Bewegung war spontan und vielfältig, und sie hatte viele lokale und regionale Zentren.
Um die Mittagszeit waren Regierungsgebäude und Ämter besetzt, Arbeiter und Soldaten entwaffneten Offiziere, entfernten Kokarden und Schulterstücke der kaiserlichen Armee von den Uniformen, bildeten Soldatenräte. Ähnlich problemlos verlief es im Kriegsministerium. Das Polizeipräsidium am Alexanderplatz war dagegen wie eine Festung hergerichtet worden: Auf den Treppen, in den Gängen und an den Fenstern hatte man Maschinengewehre in Stellung gebracht. Im Lichthof standen kriegsmäßig ausgerüstete Schutzleute, eine Jägerkompanie und eine Infanterie-Abteilung. Aber auch diese Trutzburg wurde eingenommen. Es wurden Hunderte von politischen Gefangenen befreit. Am frühen Nachmittag war die ganze Innenstadt mit dem Regierungsviertel, dem Gelände um den Reichstag und das Schloss von demonstrierenden Arbeitern und Soldaten besetzt. Vom Reichstag, vom Brandenburger Tor und vom Roten Rathaus wehten rote Fahnen. Es gab nun keinen Zweifel mehr am vollständigen Sieg der Revolution. Berlin – und damit letztlich das Deutsche Reich insgesamt – war in den Händen der Revolutionsbewegung.
Im Reichstagsgebäude ging es schon seit den Morgenstunden zu wie in einem großen Heerlager, hielt der SPD-Fraktionsvorsitzende Philipp Scheidemann später in seinen Erinnerungen fest. Mittags stürmte nun ein Haufen von Arbeitern und Soldaten zu dem Tisch im Speisesaal, an dem Scheidemann gemeinsam mit Friedrich Ebert und anderen Spitzenpolitikern der SPD saß. An die fünfzig Mann drängten Scheidemann, herauszukommen und zu reden. Es gebe Gerüchte, dass Karl Liebknecht, der mit Abstand populärste Politiker der Spartakusgruppe, die «Sozialistische Republik» ausrufen wolle. Dem wollte Scheidemann unter allen Umständen zuvorkommen. Also sprach er von der Balustrade eines Fensters im Reichstag zu den Menschen vor dem Gebäude. Ohne Absprache mit seinem Kollegen und designierten Reichskanzler Friedrich Ebert rief er den Versammelten spontan zu: «Das Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das alte Morsche ist zusammengebrochen; der Militarismus ist erledigt! Es lebe die deutsche Republik!»[10]
Friedrich Ebert war wenig erfreut über Scheidemanns Proklamation. Als Scheidemann an den Tisch im Speisesaal des Reichstags zurückkam, war Ebert vor Zorn dunkelrot im Gesicht. Er tobte, schlug auf den Tisch und schrie Scheidemann an: «Du hast kein Recht, die Republik auszurufen! Was aus Deutschland wird, ob Republik oder was sonst, das entscheidet eine Konstituante!»[11] Ebert war kein Monarchist, sondern überzeugter Republikaner. Er hatte aber offenbar im vertraulichen Gespräch mit dem immer noch amtierenden Reichskanzler Max von Baden Zusagen gemacht, an die er sich gebunden fühlte.
Gleich dreimal rief Karl Liebknecht in diesen Stunden tatsächlich die «Sozialistische Republik» aus. Im Tiergarten etwa zum selben Zeitpunkt wie Scheidemann, am frühen Nachmittag dann zweimal am Schloss, einmal von einem Kraftwagen aus und ein zweites Mal vom Balkon über dem Portal IV des Schlosses.[12] Dort forderte er die Versammelten zum Schwur auf die Freie Sozialistische Republik und die Weltrevolution auf. Viele Hände erhoben sich, und am Mast der Kaiserstandarte wurde die rote Fahne gehisst.
Prinz Max von Baden startete am Nachmittag des 9. November einen letzten Versuch, einen scheinbar systemimmanenten Übergang zu bewerkstelligen. Er übertrug dem SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert das Amt des Reichskanzlers. Staats- und verfassungsrechtlich gab es dafür keinerlei Grundlage, und die revolutionäre Dynamik ging innerhalb eines Tages darüber hinweg. Schon am 10. November war von einem Reichskanzler Ebert keine Rede mehr.
Was sich am 9. November 1918 in Berlin ereignete, war alles andere als ein Spaziergang. Die Arbeiter, die am Morgen ihre Fabriken verließen und in die Innenstadt zogen, mussten mit dem Schlimmsten rechnen, wussten nicht, was sie erwarten würde. Sie machten sich dennoch auf den Weg und liefen auch nicht auseinander, als die ersten Schüsse fielen und die ersten Toten zu beklagen waren. Polizei- und Armeeführung waren entschlossen, diese Arbeiterdemonstrationen zusammenzuschießen. Sie waren vorbereitet, und sie wussten, was auf dem Spiel stand. Die Truppen waren schwer bewaffnet und hätten ein Massaker unter den Demonstranten anrichten können. Dass es nicht dazu kam, lag nicht an der Einsicht der militärischen Führung, sondern am Widerstand der Soldaten.
Es war kein Mob, der am 9. November die Berliner Straßen eroberte. Es waren disziplinierte, zielorientierte, entschlossene Arbeiter und Soldaten, die nach mehr als vier Jahren Krieg mit schlimmsten Entbehrungen endlich Frieden und ein auskömmliches Leben in Sicherheit und Würde wollten, die den bislang Herrschenden nicht mehr vertrauten und sie für ein Hindernis auf dem schnellen Weg zum Frieden und zu einem gerechten Volksstaat hielten. Es kam am 9. November nicht zu Plünderungen, nicht zur Misshandlung von Offizieren. Rangabzeichen und Kokarden wurden von den Offiziers-Uniformen abgerissen, die Kennzeichen der alten Armee. Das war alles. Ein starkes Symbol für die einfache Vorstellung von der gleichen Würde aller Menschen, die als Utopie in den Köpfen vieler Demonstranten steckte.
Theodor Wolff, der Chefredakteur des Berliner Tageblatts, schrieb am Abend seinen Leitartikel, der am nächsten Morgen zu lesen war, und er schreckte vor Superlativen nicht zurück: «Die größte aller Revolutionen hat wie ein plötzlich losbrechender Sturmwind das kaiserliche Regime mit allem, was oben und unten dazu gehörte, gestürzt. Man kann sie die größte aller Revolutionen nennen, weil niemals eine so fest gebaute, mit so soliden Mauern umgebene Bastille so in einem Anlauf genommen worden ist. Es gab noch vor einer Woche einen militärischen und zivilen Verwaltungsapparat, der so verzweigt, so ineinander verfädelt, so tief eingewurzelt war, dass er über den Wechsel der Zeiten hinaus seine Herrschaft gesichert zu haben schien. Durch die Straßen von Berlin jagten die grauen Autos der Offiziere, auf den Plätzen standen wie Säulen der Macht die Schutzleute, eine riesige Militärorganisation schien alles zu umfassen, in den Ämtern und Ministerien thronte eine scheinbar unbesiegbare Bürokratie. Gestern früh war, in Berlin wenigstens, das alles noch da. Gestern Nachmittag existierte nichts mehr davon.»[13]
Nach dem erfolgreichen Sturz des Kaiserreichs wurden am Morgen des 10. November in allen Berliner Fabriken und Kasernen Arbeiter- und Soldatenräte gewählt. Das ging vor allem auf die Initiative der Revolutionären Obleute zurück, die sich durch die SPD-Führung nicht an den Rand drängen lassen wollten. Die Reichshauptstadt folgte damit dem Muster aller anderen Städte, in denen die revolutionäre Bewegung sich durchgesetzt hatte. Schon bei Streiks in den Kriegsjahren hatten die Arbeiter Räte gewählt, einfache Organe der Organisation und Führung, weil weder die Parteien noch die Gewerkschaften solche Streiks offiziell führen konnten und wollten. Die meisten Mitglieder der Räte waren gestandene Gewerkschafter und Sozialdemokraten beider Parteien.
Mit den Sowjets in der russischen Revolution hatten diese Räte kaum mehr als den Namen gemeinsam. Sie waren kein Instrument einer Partei, so wie die deutsche Novemberrevolution nicht das Werk einer Gruppe oder Partei war. Weder die Revolutionären Obleute noch der Spartakusbund oder andere Gruppen der radikalen Linken konnten in Anspruch nehmen, die Revolution «gemacht» zu haben. Anders als der Staatsstreich der Bolschewiki ein Jahr zuvor war die deutsche Novemberrevolution tatsächlich eine Revolution: eine spontane Erhebung großer Volksmassen, die einen Regimewechsel herbeiführten und sich dabei außerhalb der Bahnen des alten Regimes bewegten.
Die Arbeiter- und Soldatenräte verkörperten in den ersten Novembertagen diese Revolutionsbewegung. Sie waren Inhaber der politischen, der administrativen, der polizeilichen und auch der militärischen Gewalt. Die Groß-Berliner Arbeiter- und Soldatenräte sollten sich am Nachmittag des 10. November im Rundbau des Circus Busch versammeln, um stellvertretend für die gesamte Revolutionsbewegung eine provisorische Regierung für das Deutsche Reich zu wählen.
Am Morgen des 10. November erschien der Vorwärts mit der Schlagzeile «Kein Bruderkampf».[14] Das SPD-Zentralorgan traf damit die Stimmung in der Arbeiterschaft: Nach den Jahren des Streits über Krieg und Kriegskredite sollte die sozialdemokratische Bewegung jetzt einheitlich handeln. Bereits am 9. November hatten erste Gespräche über eine gemeinsame Regierung zwischen den beiden sozialdemokratischen Parteien stattgefunden. Zu einer Verständigung war es aber noch nicht gekommen. Am folgenden Morgen setzten die Spitzen von SPD und USPD dann alles daran, der Räteversammlung am Nachmittag einen gemeinsamen Regierungsvorschlag präsentieren zu können. Über die Wunden, die im jahrelangen Streit geschlagen worden waren, versuchte man hinwegzukommen.
Der SPD-Spitze war inzwischen klar, dass die Übertragung des Reichskanzleramtes Ebert in den Reihen der sozialistischen Arbeiterbewegung keinerlei Legitimationsgrundlage für Regierungshandeln verschaffte. Sie akzeptierte, dass die neue Regierung am Nachmittag des 10. November von der Räteversammlung im Circus Busch bestimmt werden würde, und sie war zu großen Zugeständnissen gegenüber der USPD bereit, um der Versammlung einen gemeinsamen Vorschlag präsentieren zu können: Die SPD akzeptierte Parität mit der kleinen Schwester, sie erkannte offiziell an, dass die Macht bei den Arbeiter- und Soldatenräten lag, sie stimmte zu, dass erst später über den Wahltermin für eine Verfassunggebende Nationalversammlung entschieden werden sollte.
Die Spitze der neuen Regierung sollte aus jeweils drei Vertretern beider Parteien bestehen. Friedrich Ebert und Hugo Haase, die beiden Parteichefs, sollten gleichberechtigte Vorsitzende werden. Für die SPD wurden daneben Philipp Scheidemann und Otto Landsberg benannt, für die USPD Wilhelm Dittmann und Emil Barth, der aus dem Kreis der Revolutionären Obleute kam. Karl Liebknecht lehnte es ab, als Vertreter der USPD in eine gemeinsame Regierung einzutreten. Wie wäre wohl die Revolution weiter verlaufen, wenn er sich anders entschieden und die Zuständigkeit für Militärfragen für sich reklamiert hätte?
Als Ebert und Haase um 17 Uhr das Ergebnis der Verhandlungen in der Versammlung der Groß-Berliner Arbeiter- und Soldatenräte präsentierten, wurden sie enthusiastisch gefeiert. Liebknecht dagegen erntete Buhrufe, als er erklärte, mit den «Regierungssozialisten», also der SPD, könne es keine Koalition geben. Die neue Regierung wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt. Sie nannte sich «Rat der Volksbeauftragten». Auch ein Organ, das die Regierung kontrollieren sollte, wurde geschaffen: der «Vollzugsrat der Groß-Berliner Arbeiter- und Soldatenräte». Übergangsweise war das Deutsche Reich ab dem 10. November eine Art Räterepublik.
Je drei Vertreter der SPD und der USPD wurden am 10. November 1918 von den Berliner Arbeiter- und Soldatenräten an die Spitze der Revolutionsregierung gewählt. Dieser «Rat der Volksbeauftragten» war eine Art sechsköpfiger Reichskanzler.
Ohne dass dies in der Räteversammlung besonders betont wurde, hatten die beiden Parteispitzen sich darauf verständigt, dass die bisherigen bürgerlichen Staatssekretäre im Amt bleiben sollten. Sie galten offiziell als «technische Gehilfen» des Rates der Volksbeauftragten, waren aber de facto weitgehend selbständige Ressortchefs, denen lediglich je ein Beauftragter der SPD und der USPD als Kontrollinstanz zur Seite gestellt wurden. Kaum im Amt, beschloss der Rat der Volksbeauftragten, den liberalen Berliner Rechtsprofessor Hugo Preuß zum Staatssekretär des Inneren zu berufen und mit der Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs zu beauftragen. Preuß war unter den deutschen Professoren für Staatsrecht wohl der einzige Demokrat und zudem mit demokratischen Verfassungsvorbildern bestens vertraut. Seine Berufung war ein deutliches Angebot zur Zusammenarbeit an die demokratischen Kräfte im Bürgertum. Die Regierung war also keineswegs «rein sozialistisch», sondern bezog von Anfang an bürgerliche Demokraten mit ein. An der Spitze der Regierung stand der Rat der Volksbeauftragten als eine Art sechsköpfiger Reichskanzler, der über die Richtlinien der Politik entschied.
Schon nach zwei Tagen, am 12. November 1918, erließ der Rat der Volksbeauftragten einen «Aufruf an das deutsche Volk». Dieser Aufruf verkündete mit Gesetzeskraft, dass von nun an in Deutschland alle Parlamente in direkter, allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl bestimmt werden sollten. Frauen bekamen das Wahlrecht. Das Preußische Dreiklassenwahlrecht und andere Klassenwahlrechte wurden abgeschafft. Die Zensur wurde aufgehoben, ab sofort galten Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Für Betriebe und Behörden wurde der Acht-Stunden-Tag verkündet.[15] Der USPD-Volksbeauftragte Wilhelm Dittmann nannte diesen Aufruf später in seinen Erinnerungen die «Magna Charta» der deutschen Revolution und unterstrich damit seine historische Bedeutung. Deutschland war eines der ersten Länder der Erde, in denen Frauen aktives und passives Wahlrecht erhielten.
Die Revolutionsregierung setzte klassische liberale Freiheitsrechte in Kraft und machte zugleich deutlich, dass das neue Staatswesen eine soziale Republik sein sollte. Ausnahmegesetze und zeitweilige Einschränkungen sozialer Rechte wurden aufgehoben. Die Regierung erklärte allgemein, «das sozialistische Programm» verwirklichen zu wollen, kündigte aber zugleich an, sie werde «die geordnete Produktion aufrecht erhalten, das Eigentum gegen Eingriffe Privater sowie die Freiheit und Sicherheit der Person schützen.» Das war weit mehr Entgegenkommen, als man im Unternehmerlager und in den bürgerlichen Parteien erwartet hatte, nachdem seit Jahrzehnten der «Sozialismus» das große Ziel der Sozialdemokratie war; der Sozialismus, zu dem nach allgemeinem Verständnis die Überführung der großen Fabriken aus Privateigentum in Gemeineigentum gehörte. Die Regierung machte deutlich, dass sie in der Sozialisierungsfrage – zumindest vorerst – keine großen Schritte unternehmen wollte.
Der Entwurf für den «Aufruf des Rates der Volksbeauftragten an das Deutsche Volk» stammte vom USPD-Vorsitzenden Hugo Haase. Natürlich hatte er ihn nicht innerhalb eines Tages aus dem Nichts erarbeitet, sondern sich an Forderungen beider Parteien und gemeinsamen Parteiprogrammen aus der Vorkriegszeit orientiert. Die beiden Parteispitzen gingen nun also daran, all das umzusetzen, was die Sozialdemokratie seit Jahrzehnten als dringende Forderungen bezeichnet hatte. Sie setzten damit klare politische und soziale Signale, die gar nicht deutlich genug hervorgehoben werden können. Zum ersten Mal sollte auf deutschem Boden ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat entstehen, der mit dem Frauenwahlrecht ein grundlegendes Emanzipationsziel verwirklichte. Das ging weit über die Freiheitsrechte bürgerlicher Republiken hinaus. Unter den großen europäischen Staaten war die deutsche Republik einer der Vorreiter bei der Gleichberechtigung der Frau und der sozialen Emanzipation.
Nach dem Verständnis der beiden Parteispitzen war diese demokratische und soziale Republik die Basis des Sozialismus, dessen Verwirklichung innerhalb der deutschen Sozialdemokratie schon seit den 1890er Jahren als Angelegenheit von Jahrzehnten und nicht von Tagen galt. Barth hatte in der beschließenden Sitzung des Rates der Volksbeauftragten den Versuch unternommen, konkrete Sozialisierungsmaßnahmen in die Proklamation aufzunehmen, und konnte sich damit nicht durchsetzen.[16] Er scheiterte nicht etwa, weil seine Kollegen Sozialisierung grundsätzlich ablehnten, sondern weil keine der beiden Parteien bislang konkrete Vorstellungen davon entwickelt hatte, wie denn eigentlich dieser Übergang zum Sozialismus ganz praktisch-politisch vonstattengehen sollte. Womit sollte man beginnen? Was bedeutete Überführung ins Eigentum des Staates oder der Gesellschaft konkret? Wie konnte man gewährleisten, dass die Produktion nicht völlig zusammenbrach, wenn bestimmte Industriezweige verstaatlicht oder vergesellschaftet wurden?
Keine der beiden Parteien verfügte über ein Aktionsprogramm, das auch nur den Anspruch erhoben hätte, Leitlinien für die Steuerung eines solchen Sozialisierungsprozesses zu geben. Beide Parteispitzen sahen darin in den Novembertagen 1918 aber auch kein entscheidendes Manko, weil sie der Auffassung waren, dass in Zeiten der Not ohnehin nicht sozialisiert werden könne. Sozialisierungsmaßnahmen hätten nach ihrer Überzeugung in dieser Situation die Aufrechterhaltung der Produktion gefährdet, und das wollten sie unter allen Umständen vermeiden – genau wie die führenden Männer in den Gewerkschaften. Die Freien Gewerkschaften neigten ohnehin seit langem dazu, sich ganz auf die konkrete Verbesserung der Lage der Arbeiter zu konzentrieren und das kapitalistische Wirtschaftssystem stillschweigend als gegebenen Rahmen zu akzeptieren.
Schon seit mehr als einem Jahr waren Gewerkschaften und Unternehmer insgeheim im Gespräch über «die Zeit danach», über die Zeit nach dem Ende des Krieges. Wirkliche Bewegung kam in die Sache aber erst, als die Oberste Heeresleitung im September 1918 die sofortige Einleitung von Waffenstillstandsverhandlungen forderte und damit eingestand, dass der Krieg verloren war. Nun hatten beide Seiten den ernsthaften Willen, sich zu verständigen. Die Novemberrevolution beschleunigte dann die Einigung rasant. Bereits am 15. November schlossen Gewerkschaften und Unternehmerverbände ein Abkommen, mit dem erstmals die Gewerkschaften als Interessenvertretung der Arbeiterschaft anerkannt wurden. Beide Seiten verständigten sich auch darüber, die gesamte deutsche Wirtschaft in Zukunft gemeinsam und paritätisch zu organisieren. Die Gewerkschaften sollten in allen grundsätzlichen Fragen der Wirtschaft bis hinein in die einzelnen Branchen paritätisch mitentscheiden.[17] Die traditionellen Gegensätze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern wurden damit entschärft.
Die Gewerkschaftspresse feierte das «Stinnes-Legien-Abkommen» – benannt nach den Verhandlungsführern beider Seiten – als «Sieg von seltener Größe» und als «Magna Charta» der deutschen Arbeiter. Die politische Isolierung und Ohnmacht der Gewerkschaften seien jetzt überwunden. Gewürdigt wurde auch die von den Volksbeauftragten bereits verfügte und hier noch einmal festgeschriebene Einführung des Achtstundentags, für den Millionen von Arbeitern 30 Jahre hindurch am 1. Mai demonstriert hatten. Die von den Volksbeauftragten in Aussicht gestellten weiteren sozialpolitischen Verfügungen ließen darauf hoffen, dass die zentralen Forderungen der Gewerkschaften, insbesondere nach materieller Absicherung der Arbeitnehmer gegen die Folgen von Krankheit, Unfällen, Arbeitslosigkeit und im Alter, erfüllt würden und dass die Verfassung der neuen Republik einen Katalog sozialer Grundrechte enthalten würde.
Andererseits hatten auch die Arbeitgeber keineswegs das Gefühl, eine Niederlage erlitten zu haben, im Gegenteil. Als auch die Revolutionsregierung das Abkommen zustimmend zur Kenntnis nahm, hatten die Industriellen allen Grund zur Zufriedenheit. Weniger als eine Woche nach dem Sturz der Monarchie wurde mit dem Abkommen der Fortbestand der Wirtschaftsordnung einschließlich der privaten Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel sowohl von den größten Massenorganisationen der Arbeiterschaft als auch von der Revolutionsregierung bis auf weiteres garantiert. Das war ein außerordentlich starkes Bollwerk gegen alle Sozialisierungsforderungen, die von der USPD, aber auch von vielen Mehrheitssozialdemokraten erhoben wurden.
Die langfristige Bedeutung des Abkommens zwischen Unternehmern und Gewerkschaften kann gar nicht hoch genug veranschlagt werden. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte wurde mit diesem Abkommen der Gedanke der Sozialpartnerschaft in die Organisation des Wirtschaftslebens eingeführt, der heute die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft deutscher Prägung ist. Mit dem Betriebsrätegesetz folgte dann im Januar 1920 auch noch die betriebliche Mitbestimmung von Arbeitervertretungen, die heute ein besonderes Merkmal der deutschen Wirtschaft ist.
Gelegentlich ist im Nachhinein argumentiert worden, das alles wäre auch ohne Revolution verwirklicht worden. Die Revolution sei unnötig gewesen, weil das Deutsche Reich ja schon mit den Reformen im Oktober eine parlamentarische Regierungsform bekommen habe. Die parlamentarische Monarchie existierte freilich nur auf dem Papier und hatte keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen der führenden Militärs, die nach wie vor die Macht im Staat hatten. Auch Kaiser Wilhelm II. und sein letzter Reichskanzler Max von Baden waren nicht dauerhaft bereit, sich auf eine vom Parlament gewählte und kontrollierte Regierung einzulassen. Das zeigen ihre später niedergeschriebenen Erinnerungen sehr deutlich. Die Eliten des Kaiserreichs waren entschiedene Gegner der Demokratie, und sie blieben das in ihrer großen Mehrheit. «Die Ansicht, dass es in Deutschland möglich gewesen wäre, das unter dem Prinzen Max von Baden eingeleitete System parlamentarischer Regierung im Frieden auch ohne Revolution fortzusetzen und zu festigen, entspringt einem (…) Optimismus, der die Nachprüfung nicht verträgt», hielt Theodor Wolff zum ersten Jahrestag der Revolution fest, «in einem kaiserlichen Deutschland hätte das Militär leicht immer wieder das Parlament in die Ecke gedrückt.»[18] Das Volk musste tatsächlich auf die Straße gehen und sich die Macht erkämpfen, damit die parlamentarische Republik mit liberaler und sozialer Verfassung Wirklichkeit werden konnte. Ohne Revolution keine Demokratie.
Warum aber ist auch mehr als einhundert Jahre danach so wenig darüber bekannt, was wir der Revolution von 1918/19 verdanken? Warum wird nicht Jahr für Jahr daran erinnert, dass diese Revolution die wesentlichen Grundlagen der heutigen demokratischen Gesellschaft in Deutschland geschaffen hat, dass sie eine der stärksten Wurzeln der Bundesrepublik ist?
Jahrzehntelang wurde die Weimarer Demokratie, die 1919 als Ergebnis der Revolution entstand, fast nur von ihrem Ende her betrachtet. Die gescheiterte und zerstörte Republik, an deren Ende die Nationalsozialisten an die Macht kamen, schien bestenfalls als Negativfolie zu taugen, aber keine positiven Beiträge zu einer demokratischen Erinnerungskultur beisteuern zu können. Das galt noch mehr für die Novemberrevolution von 1918, die schon von den Zeitgenossen nach kurzer Zeit nicht mehr als Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte wahrgenommen wurde. Einer der Gründe dafür ist gewiss, dass viele der Reformen mit großer Selbstverständlichkeit umgesetzt wurden und zunächst kaum auf Widerstand stießen. Zweitens spielt sicher auch eine Rolle, dass Friedrich Ebert am 6. Februar 1919 zur Eröffnung der Nationalversammlung in Weimar erklärte, die Regierung der Volksbeauftragten habe sich als «Konkursverwalter des alten Regimes» verstanden: «Wir haben der Nationalversammlung nicht vorgegriffen.»[19] Unter Gesichtspunkten politischer Taktik war diese Behauptung verständlich, sachlich ist sie falsch, aber sie prägt unser Bild von der Politik der Volksbeauftragten bis heute. Drittens schließlich – und dies ist der Hauptgrund für die Geringschätzung der Revolution – wurden ihre großen Erfolge schnell von politischen Kämpfen überlagert, die das positive Bild der Revolution ins Negative gewendet haben.
Der Spartakusbund lehnte bereits unmittelbar nach der Beseitigung der Monarchie allgemeine Wahlen zu einer Nationalversammlung ab und propagierte «Alle Macht den Räten». Viele Zeitgenossen sahen russische Verhältnisse drohen. Unternehmer finanzierten mit Millionenbeträgen Kampagnen gegen den «Bolschewismus». Alles drehte sich in der politischen Propaganda im November und Dezember 1918 um die Wahl der Nationalversammlung. Dabei war diese Wahl nicht wirklich gefährdet.
Am 16. Dezember trat im Berliner Abgeordnetenhaus der Erste Allgemeine Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands zusammen. 490 Delegierte der Arbeiter- und Soldatenräte aus ganz Deutschland waren nach Berlin gekommen. Dieser Reichsrätekongress war die legitime Vertretung der Revolutionsbewegung, und er wurde sowohl von der SPD als auch von der USPD als letzte und höchste Entscheidungsinstanz anerkannt. Er stimmte im Verlauf seiner sechstägigen Zusammenkunft mit einer überwältigenden Mehrheit von 80 Prozent für Wahlen zu einer Verfassunggebenden Nationalversammlung bereits am 19. Januar 1919. Der revolutionäre Souverän bekannte sich also völlig eindeutig zur parlamentarischen Demokratie, und keine Gruppe der radikalen Linken war personell und strukturell in der Lage, einen Staatsstreich durchzuführen. Das unterschied die Lage in Deutschland elementar von der in Russland ein Jahr zuvor. Liebknecht und seine politischen Freunde machten zwar lautstark Propaganda, aber objektiv stellte der sogenannte Bolschewismus keine ernsthafte Gefahr dar. Subjektiv sahen das viele Zeitgenossen ganz anders. Die Propaganda beider Lager führte zu hysterischen Ängsten.
Der Reichsrätekongress traf neben der Weichenstellung in Richtung parlamentarische Demokratie zwei weitere Richtungsentscheidungen. Er beschloss eine demokratische Umgestaltung der Armee, und er beauftragte die Regierung, sofort mit der Sozialisierung der dafür reifen Industrien zu beginnen. Die drei Beschlüsse in ihrer Gesamtheit deuten an, worum es der Revolutionsbewegung im November und Dezember tatsächlich ging: nicht um irgendeine Art von Räterepublik, sondern um parlamentarische Demokratie und eine insgesamt demokratische Gesellschaft. Der Obrigkeitsstaat des Kaiserreichs sollte «demokratisiert» werden. In Verwaltung und Armee sollte demokratischer Geist herrschen. Natürlich auch in Schulen, Universitäten und Gerichtssälen. Und nicht zuletzt sollte im Bergbau mit der Sozialisierung begonnen werden, die beide sozialistische Parteien seit langem forderten.
Über das Ziel einer umfassend demokratischen und sozialen Republik bestanden zwischen den Regierungsparteien kaum Differenzen. Während es der SPD-Spitze allerdings mit der Wahl der Nationalversammlung nicht schnell genug gehen konnte, wollte die Mehrheit der USPD zuvor eine Reihe von Reformen einleiten, um die Demokratisierung der deutschen Gesellschaft unumkehrbar zu machen. Dabei ging es der USPD-Spitze um die Verschiebung des Wahltermins um einige Monate, keinesfalls länger.
Gemeinsam standen SPD und USPD in den Revolutionsmonaten vor gewaltigen Alltagsproblemen. Das Millionen-Heer musste zurückgeholt werden, die Menschen mussten mit Nahrung und Brennstoff versorgt werden, die Wirtschaft musste von Kriegs- auf Friedensproduktion umgestellt werden und wieder in Gang kommen, Arbeitsplätze mussten geschaffen werden. Bei alledem meinte vor allem die SPD-Spitze, auf Experten des alten Regimes nicht verzichten zu können. Das gab der Revolution über kurz oder lang einen konservativen Zug. Die bürgerlichen Staatssekretäre verstanden es mit Hilfe ihrer Ministerialbürokratie vorzüglich, ihre Interessen im Spiel zu halten.