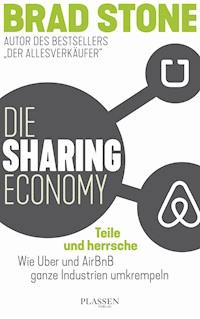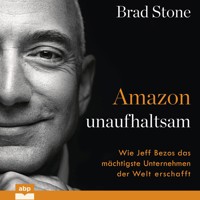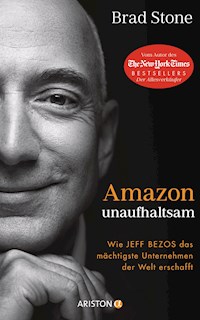22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Inside Amazon Bewundert, gefürchtet und hart kritisiert: Firmengründer Jeff Bezos und sein Unternehmen Amazon mit Sitz in Seattle ist längst nicht nur der größte Onlineeinzelhändler der Welt. In beängstigendem Tempo treibt der Erfinder des Kindle die digitale Wirtschaft vor sich her und erobert immer mehr Geschäftsfelder: von Hardware, Logistik, digitalem Content und künstlicher Intelligenz - Alexa lässt grüßen - bis zu einem ehrgeizigen Raumfahrtprojekt. Was ist das Geheimnis des Systems Amazon? Wer zahlt den Preis? Der Technologieexperte Brad Stone ist der Erste mit Zugang zum Zentrum der Macht. Er liefert den spannenden Insiderblick auf Licht und Schatten der Erfolgsgeschichte des Netzgiganten, auf das Profil seines rücksichtslos kompetitiven Gründers sowie den Ausblick auf seine Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Brad Stone
Der Allesverkäufer
Jeff Bezos und das Imperium von Amazon
Aus dem Englischen von Bernhard Schmid
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Bewundert, gefürchtet und hart kritisiert: Firmengründer Jeff Bezos und sein Unternehmen Amazon mit Sitz in Seattle ist längst nicht nur der größte Online-Einzelhändler der Welt. In beängstigendem Tempo treibt der Erfinder des Kindle die digitale Wirtschaft vor sich her und erobert immer mehr Geschäftsfelder – von Hardware, Logistik, digitalem Content und künstlicher Intelligenz – Alexa lässt grüßen – bis zu einem ehrgeizigen Raumfahrtprojekt.
Was ist das Geheimnis des Systems Amazon? Wer zahlt den Preis? Der Technologieexperte Brad Stone ist der Erste mit Zugang zum Zentrum der Macht. Er liefert den spannenden Insiderblick auf Licht und Schatten der Erfolgsgeschichte des Netzgiganten, auf das Profil seines rücksichtslos kompetitiven Gründers sowie den Ausblick auf seine Zukunft.
Vita
Brad Stone schrieb für die New York Times über neue Technologien und arbeitet heute für Bloomberg Businessweek in San Francisco. Er verfügt über hervorragende Quellen und Insiderberichte von Freunden und Feinden, dank derer er über die Macht, die Geheimnisse und den Erfolg von Jeff Bezos und seinem Web-Riesen berichtet.
Für Isabella und Calista Stone
INHALT
VORWORT
Kapitel Prolog:Der Laden für alles
TEIL 1 GLAUBEN IST ALLES
Kapitel 1Das Haus der Algorithmen
Kapitel 2Das Buch Bezos
Kapitel 3Fieberträume
Kapitel 4Milliravi
TEIL 2 LITERARISCHE EINFLÜSSE
Kapitel 5Rocket Boy
Kapitel 6Die Chaostheorie
Kapitel 7Ein Technologieunternehmen, kein Einzelhändler
Kapitel 8Fiona
TEIL 3 MISSIONAR ODER SÖLDNER?
Kapitel 9Der Start ist geglückt
Kapitel 10Praktische Überzeugungen
Kapitel 11Das Königreich der Fragezeichen
EPILOG
DANK
ANHANG
JEFFS LEKTÜREKANON
ANMERKUNGEN
Wenn Sie mit achtzigin einer besinnlichen Stundeüber die ganz persönliche VersionIhrer Lebensgeschichte reflektieren,
wird sie besonders kompakt undaussagekräftig ausfallen, wenn Sie sichauf Ihre Entscheidungen konzentrieren.
Letzten Endes sind wir unsere Entscheidungen.
Jeff Bezos in einer Rede vor Absolventender Princeton University, 30. Mai 2010
VORWORT
Alexa, wer ist der reichste Mensch der Welt?
Im Herbst 2017 bekam man von Amazons sprachaktivierter digitaler Assistentin eine neue Antwort auf diese Frage: Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon.com und eine der weltweit bekanntesten Persönlichkeiten der Geschäftswelt.
Im Aufwind der Aktienpreise seines gerade mal 23 Jahre alten Unternehmens war Bezos‹ persönliches Vermögen auf mehr als 100 Milliarden Dollar angewachsen, ein Erfolg, der nahezu alle Welt überraschte, sieht man mal von seinen glühendsten Anhängern ab. Das Unternehmen hatte Milliarden in einen neuen Schwung teilautomatisierter Versandzentren investiert, die in den meisten städtischen Gegenden eine Lieferung am nächsten oder übernächsten Tag ermöglichten. Im Sommer 2017 hatte man für 13,7 Milliarden Dollar die Biokette Whole Foods Market aufgekauft und damit einen weiteren Schritt hin zum Verkauf verderblicher Waren getan, was bei den konventionellen Supermärkten eine Welle von Angst auslöste. Außerdem dominierte man nach wie vor die Rivalen Google und Microsoft beim Wettlauf um die lukrativen Cloud-Computing-Dienste für Unternehmen, Universitäten und Behörden.
Amazons bemerkenswerteste Leistung freilich dürfte die Erfindung von Alexa selbst gewesen sein. Seit 2011 hatte das Unternehmen in aller Stille Start-ups aus dem Bereich der Spracherkennung aufgekauft sowie AI-Ingenieure und auf dem Gebiet der natürlichen Sprache forschende Wissenschaftler eingestellt. Hinter der fieberhaften Aktivität stand Bezos‹ Traum von einem Computer, mit dem man so sprechen konnte, wie die Crew der Enterprise in seiner Lieblingsserie Star Trek mit ihrem Raumschiff sprach. Ihre Arbeit resultierte 2014 in der Einführung des Smart-Speakers Echo, der eine neue Ära im Bereich des sprachaktivierten Computings einläutete. Hier manifestierte sich auf perfekte Weise Bezos‹ Philosophie, aktuelle Quartalszahlen oder die Ergebnisse des nächsten Geschäftsjahres außen vor zu lassen und stattdessen auf lange Sicht zu denken.
Alexa, Amazon Web Services und der Erwerb von Whole Foods sind Initiativen, die im dritten Jahrzehnt von Amazons Bestehen über die Zukunft des Unternehmens entscheiden werden. Das vorliegende Buch erzählt die Geschichte der ersten 21 Jahre; es versucht sich an der Chronik eines Kampfs auf Biegen und Brechen, schildert, wie eine simple Idee realisiert und dann eine skeptische Welt davon überzeugt wird, dass sich ein zu Verlusten neigender Online-Einzelhändler zu einem erstklassigen Tech-Unternehmen entwickeln kann. Es beschreibt darüber hinaus, wie aus einem Startup mit einigen Dutzend Leuten aus einer heruntergekommenen Gegend Seattles ein Ungetüm mit mehr als einer halben Million Angestellten in über dreißig Ländern und einer Unternehmenskultur wurde, die allenthalben als unerbittlich und skrupellos gilt.
Unerbittlich und skrupellos. Diese Adjektive werden Ihnen auf den folgenden Seiten immer wieder begegnen. Sie stehen für extreme Werte, wie sie freilich den meisten erfolgreichen Unternehmen vertraut sind. Jeff Bezos‹ erstaunliches Talent besteht darin, stets die richtige Mischung dieser tödlichen Kombination einzusetzen: Sie ist womöglich der größte Aktivposten des Unternehmens.
Brad Stone
Mai 2018
Kapitel Prolog:Der Laden für alles
Anfang der 1970er Jahre entwickelte eine rührige Werbemanagerin namens Julie Ray eine gewisse Faszination für ein unkonventionelles staatliches Förderprogramm für hochbegabte Grundschüler im texanischen Houston. Ihr Sohn gehörte zu den ersten Schülern des später als »Vanguard Program« bekannt gewordenen Konzepts zur Förderung von Kreativität, Unabhängigkeit und offenem, unkonventionellem Denken. Ray war sowohl vom Lehrplan als auch von der Gemeinschaft leidenschaftlicher Lehrer und Eltern derart angetan, dass sie sich auf die Suche nach ähnlichen Schulen machte und ein Buch über die damals aufkommende Hochbegabtenförderung in Texas plante.
Einige Jahre später, ihr Sohn war bereits an der Highschool, besuchte Ray das Programm ein weiteres Mal im Rahmen der Arbeit an ihrem Buch. Es war in einem Flügel der Grundschule des wohlhabenden Houstoner Bezirks River Oaks untergebracht, deren Direktor ihr einen seiner Schüler, einen wortgewandten Sechstklässler mit sandfarbenem Haar, als Begleiter zuwies. Die Eltern des Jungen baten sich lediglich aus, dass sie im Buch seinen richtigen Namen verschwieg. Also nannte Ray ihn Tim.
Tim, so schrieb Julie Ray später in ihrem Buch Turning On Bright Young Minds: A Parent Looks at Gifted Education in Texas, war »ein Schüler von überragendem Intellekt und schmächtigem Wuchs, freundlich, aber ernst«. Seinen Lehrern zufolge verfügte er »nicht unbedingt über Führungsqualitäten«, bewegte sich aber selbstbewusst unter seinesgleichen und ließ sich ihr gegenüber eloquent über die Vorzüge von J. R. R. Tolkiens Roman Der Hobbit aus, den er gerade las.
Tim war mit seinen zwölf Jahren bereits vom Konkurrenzdenken geprägt. Wie er Ray erzählte, las er eine breite Palette von Büchern, um sich für einen speziellen Lektüreschein zu qualifizieren, meinte aber, einer Klassenkameradin nicht das Wasser reichen zu können, die – ihrer eigenen, eher unwahrscheinlichen Behauptung nach – ein Dutzend Bücher die Woche las. Tim zeigte Ray auch sein Projekt für die Wissensmesse der Schule: eine batteriebetriebene Vorrichtung mit rotierenden Spiegeln, die die optische Illusion eines endlosen Tunnels schuf. Er hatte seinen Infinity Cube, wie er die Vorrichtung nannte, einem Gerät nachempfunden, das er in einem Laden gesehen hatte. Nur hatte der Würfel dort 22 Dollar gekostet – und »meiner war billiger«, sagte er. Von seinen Lehrern erfuhr Julie Ray, dass man drei von Tims Projekten bei einem lokalen naturwissenschaftlichen Wettbewerb einzureichen gedachte, der sonst eher für Highschools gedacht war.
Der Lehrkörper lobte Tims Erfindungsreichtum; man könnte sich aber durchaus einen gewissen Argwohn seinem Intellekt gegenüber vorstellen. Tim hatte nämlich eine Methode entwickelt, die Lehrer der sechsten Klasse zu bewerten. Es gehe ihm darum, so sagte er, Lehrer danach zu bewerten, »wie sie unterrichten, nicht nach ihrem Beliebtheitsgrad«. Er hatte seinen Fragebogen in der Klasse herumgehen lassen und war zur Zeit von Julie Rays Besuch im Begriff, die Ergebnisse zu berechnen und das Abschneiden der einzelnen Lehrer in Relation zu allen anderen grafisch darzustellen.
Tims Durchschnittstag war, wie Ray sich ausdrückte, vollgepackt. Er stand morgens früh auf und nahm um sieben den Bus, der einen Block vom Elternhaus entfernt losfuhr. Nach 20 Meilen Fahrt stürzte er sich in der Schule in ein Sperrfeuer von Fächern: Mathematik, Lesen, Sport, Chemie, Biologie, Physik, Spanisch, Kunst. Außerdem war eine gewisse Zeit für Einzelprojekte und Diskussionen in kleinen Gruppen reserviert. In einer der Stunden, so schrieb Julie Ray, saßen sieben Schüler, darunter Tim, in einem engen Kreis im Büro des Rektors beisammen; die Übung hieß produktives Denken. Man gab ihnen kurze Artikel, die sie, jeder für sich, lasen, um sie im Folgenden zu diskutieren. Im ersten Artikel ging es um einige Archäologen, die bei der Rückkehr von einer Expedition die Entdeckung eines Schatzes kostbarer Artefakte bekannt gaben, was sich später als Betrug herausstellte. Ray notierte sich Auszüge aus dem folgenden Dialog:
»Wahrscheinlich wollten sie berühmt werden. Da wünschten sie einfach weg, was sie nicht sehen wollten.«
»Es gibt Leute, die gehen durchs Leben, ohne sich zu ändern.«
»Man sollte Geduld haben. Analysieren, womit man arbeiten muss.«
Tim sagte Julie Ray, dass ihm viel an diesen Übungen liege. »So wie die Welt nun mal ist, wissen Sie, könnte Ihnen jemand sagen, dass Sie auf den Knopf drücken sollen. Man muss in der Lage sein, für sich selbst zu entscheiden, was man macht.«
Es gelang Ray nicht, einen Verleger für Turning On Bright Minds zu interessieren. Den Lektoraten der großen Verlage war das Thema zu eng gefasst. So finanzierte sie schließlich 1977 mit den Einnahmen aus dem Text für einen Weihnachtskatalog die Herstellung von 1 000 Taschenbüchern, die sie im Eigenverlag vertrieb.
Über 30 Jahre später fand ich eines davon in der Stadtbibliothek von Houston. Außerdem spürte ich die Autorin auf, Julie Ray, die heute in Central Texas lebt und im Bereich Planung und Kommunikation für Umwelt- und kulturelle Projekte tätig ist. Sie habe, so sagt sie mir, Tims Aufstieg zu Ruhm und Reichtum in den letzten zwei Jahrzehnten voller Staunen und Bewunderung, aber ohne große Überraschung verfolgt. »Als ich ihn kennenlernte, als Schüler, waren seine Anlagen offensichtlich, und das Vanguard Program förderte diese und bestärkte ihn«, sagte sie. »Das Programm wiederum profitierte von seiner Empfänglichkeit und seiner Begeisterung fürs Lernen. Es war eine Bestätigung auf der ganzen Linie für das Konzept.«
Sie erinnert sich, was ihr eine Lehrerin seinerzeit sagte, als Ray sie um eine Einschätzung bat, in welche Klasse die Leistung des Jungen wirklich gehörte. »Das könnte ich jetzt nicht sagen«, antwortete die Lehrerin. »Aber dem, was der Junge leisten kann, sind wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt, wenn er etwas Anleitung bekommt.«
Ende 2011 besuchte ich »Tim« – alias Jeff Bezos – im Hauptquartier seiner Firma Amazon.com in Seattle. Ich war dort, um ihn für die Mitarbeit an diesem Buch zu gewinnen, für den Versuch, mit anderen Worten, den außergewöhnlichen Aufstieg eines ebenso innovativen wie polarisierenden Unruhestifters von einem technologischen Powerhouse aufzuzeichnen, des Unternehmens, das als eines der ersten das grenzenlose Versprechen des Internets erkannt und schließlich unsere Art, einzukaufen und zu lesen, auf immer verändert hat.
Amazon gehört zunehmend zum Alltag unserer modernen Welt. Millionen Menschen dirigieren ihren Browser regelmäßig auf die gleichnamige Website oder die von Unternehmenstöchtern wie Zappos.com und Diapers.com, um dem Grundinstinkt jeder kapitalistischen Gesellschaft zu frönen: dem des Konsums. Die Site von Amazon.com bietet die denkbar breiteste Auswahl von Büchern, Filmen, Gartenwerkzeugen, Möbeln, Nahrungsmitteln und gelegentlichen Kuriosa wie das aufblasbare Einhorn-Horn für Katzen (9,50 US-Dollar) oder den 500-Kilo-Waffentresor mit Elektronikschloss (903,53 US-Dollar) – binnen zwei bis fünf Tagen ist alles bei Ihnen zu Hause. Das Unternehmen hat die sofortige Befriedigung praktisch zur Kunstform erhoben; es liefert digitale Produkte in Sekundenschnelle und ihre materielle Inkarnation in nur wenigen Tagen. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, einen Kunden schwärmen zu hören, seine Bestellung habe ihn wie durch Zauberhand vor dem genannten Termin erreicht.
Amazon hat 2012, in seinem 17. Geschäftsjahr, weltweit einen Umsatz von 61 Milliarden Dollar erwirtschaftet und dürfte die 100-Milliarden-Dollar-Grenze schneller überschreiten als irgendein Einzelhändler zuvor. Viele Kunden lieben die Firma heiß und innig, aber nicht weniger inbrünstig ist die Furcht der Konkurrenten. Sogar der Name selbst hat bereits Einzug ins Business-English gefunden, wenn auch in einer alles andere als schmeichelhaften Bedeutung, denn to be Amazoned bedeutet, »hilflos zusehen zu müssen, während der Online-Parvenü aus Seattle Ihnen Kundschaft und Profite Ihres konventionellen Geschäfts absaugt«.
Die Geschichte von Amazon.com, so wie die meisten sie verstehen, ist eine der ikonischen Geschichten des Internet-Zeitalters. Die Firma startete bescheiden als Online-Buchhandlung, erweiterte aber Ende der 1990er Jahre, hoch auf dem Kamm der ersten Welle des Dotcom-Überschwangs, ihr Sortiment um Musik, Filme, Elektronikartikel und Spielzeug. Nachdem das Unternehmen um Haaresbreite die Katastrophe umschifft und der – die Dotcom-Pleite von 2000 und 2001 begleitenden – Springflut von Skepsis hinsichtlich seiner Zukunftsaussichten getrotzt hatte, meisterte es die Einzelheiten seiner komplexen Distribution und weitete das Sortiment auf Software, Schmuck, Kleidung, Sportartikel, Autoteile und weiß Gott noch was aus. Und kaum hatte es sich als größter Einzelhändler im Internet und führende Plattform für die Artikel von Fremdanbietern etabliert, definierte Amazon sich abermals neu, diesmal als vielseitiges Technologieunternehmen. Als solches verkauft man die als Amazon Web Services bekannte Infrastruktur für Cloud-Computing und so günstige, praktische Gerätschaften wie den E-Book-Reader Kindle und den Kindle Fire-Tablet-PC.
»Für mich ist Amazon die Geschichte eines brillanten Gründers, der die Vision persönlich vorangetrieben hat«, sagt der Chairman von Google Erich Schmidt, der selbst als erklärter Konkurrent des Unternehmens der kurzen Lieferzeiten wegen Amazon-Prime-Kunde ist. »Es gibt praktisch keine besseren Beispiele. Apple vielleicht, aber man vergisst dabei gern, dass Amazon weithin abgeschrieben worden war, da das Unternehmen sich nicht im Rahmen einer realistischen Kostenstruktur vergrößern ließ. Es schrieb Verluste auf Verluste. Es verlor Hunderte von Millionen. Aber Jeff ist nun mal so redefreudig wie clever. Er ist der klassische technische Unternehmensgründer, der auch das letzte Detail noch versteht und dem daran mehr als sonst einem liegt.«
Trotz des jüngsten Anstiegs der Aktienkurse in schwindelerregende Höhen bleibt Amazon eine so beispiellose wie beispiellos rätselhafte Firma. Der Saldo einer Amazon-Bilanz fällt notorisch dürftig aus, und bei all den hektischen Expansionsbemühungen in neue Märkte und Produktkategorien machte die Firma 2012 trotz des Rekordumsatzes Verlust. Aber der Wall Street scheint das egal zu sein. Mit seinen ständigen Verlautbarungen, er baue sein Unternehmen für die Zukunft, hat Jeff Bezos sich bei seinen Aktionären eine Vertrauensbasis geschaffen, die sie geduldig auf den Tag warten lässt, an dem er das Tempo seiner Expansion drosselt und gesunde Profite einfährt.
Den Meinungen anderer, gelegentlich selbst denen seiner eigenen Chefetage gegenüber, erwies Bezos sich bislang als praktisch immun. Er ist ein leidenschaftlicher Problemlöser, ein Mann mit dem Blick eines Schachgroßmeisters für den Wettbewerb, und er konzentriert sich mit der Besessenheit eines Zwangsneurotikers auf die Zufriedenheit seiner Kunden, denen er selbst dann Dienstleistungen wie kostenlosen Versand und verkaufssteuerfreie Transaktionen bietet, wenn sich das nachteilig auf die finanzielle Gesundheit seiner Firma auswirkt. Sein Ehrgeiz ist grenzenlos – und das nicht nur in Bezug auf Amazon, sondern auch in seinem Bemühen, die Medien umzugestalten und die Grenzen der Wissenschaft neu zu ziehen. So kaufte er über die Gründung seiner eigenen Raketenfirma Blue Origin hinaus im August 2013, in einem für die Medienindustrie völlig überraschenden Deal, für 250 Millionen Dollar die schwächelnde Traditionszeitung The Washington Post.
Wie viele seiner Angestellten bescheinigen werden, ist Bezos ein über die Maßen schwieriger Chef. Trotz seines allseits bekannten herzhaften Lachens und der öffentlichen Maske des stets gut Gelaunten neigt er zu denselben Ausbrüchen bissigen Spotts wie Steve Jobs, Apples mittlerweile von uns gegangener Gründer, der einen Angestellten schon allein dadurch zu Tode ängstigen konnte, dass er mit ihm in den Aufzug trat. Bezos ist ein Mikromanager mit einem unversiegbaren Quell frischer Ideen, der durchaus grob werden kann, wenn die Anstrengungen seinen strengen Maßstäben mal nicht genügen.
Wie Jobs sorgt auch Bezos für ein »realitätsverzerrendes Feld« – eine Aura von durchaus überzeugender, aber letztlich unbefriedigender Propaganda für seine Firma. Immer wieder betont er, Amazons Unternehmensauftrag bestehe darin, »für alle Branchen weltweit die Messlatte höher zu legen, was Kundenorientiertheit« angehe.1 Aber während Bezos und seine Angestellten in der Sorge um die Kunden aufgehen, können sie beim Wettbewerb mit Rivalen, ja selbst mit Partnern durchaus skrupellos sein. Bezos sagt gerne, die Märkte, auf denen Amazon operiere, seien riesig und böten vielen Gewinnern Platz. Das mag stimmen, aber Tatsache ist auch, dass Amazon bei der Schädigung oder Vernichtung so einiger kleiner wie großer Rivalen, die einst weltbekannt waren – Circuit City, Borders, Best Buy, Barnes & Noble – eine Hand mit im Spiel gehabt hat.
Der Amerikaner an sich wird nervös angesichts allzu mächtiger Firmen, zumal solchen in fernen Großstädten, deren Erfolg den Charakter der eigenen Kommune verändern könnte. Wal-Mart sah sich dieser Skepsis gegenüber, desgleichen Sears, Woolworth und andere Einzelhandelsgiganten jeder Ära bis zurück zu A & P, der Lebensmittelkette, die in den 1940er Jahren einen ruinösen Antitrust-Prozess durchzustehen hatte. Amerikaner strömen in die großen Einzelhandelsketten, weil sie bequemer und billiger sind. Ab einer bestimmten Größe jedoch offenbart sich ein Widerspruch in der kollektiven Psyche. Sicher wollen wir billig einkaufen, aber niemand will wirklich den Tante-Emma-Laden an der Ecke oder die kleine Buchhandlung verschwinden sehen, deren Existenz seit Jahrzehnten gefährdet ist, erst durch das Aufkommen großer Buchhandelsketten wie Barnes & Noble und eben jetzt durch Amazon.com.
Bezos weiß immens klug zu kommunizieren, wenn es um seine Firma geht. Er gibt sich als Sphinx, was Details seiner Pläne angeht, behält Gedanken und Absichten gerne für sich und bleibt Seattles Geschäftswelt nicht weniger ein Rätsel als der Technologiebranche allgemein. Er spricht selten auf Konferenzen und gibt noch weniger Interviews. Selbst Leute, die ihn bewundern und die Amazon-Story gespannt verfolgen, neigen zur falschen Aussprache seines Nachnamens – man sagt »beɪzəs« (wie in »Dock of the Bay«), nicht »bi:zəs« (wie in »Biene«).
John Doerr, der Risikoanleger, der Amazon praktisch von Anfang an unterstützt hat und ein Jahrzehnt im Board of Directors saß, hat Amazons sparsamen PR-Stil einmal die »Kommunikationstheorie nach Bezos« genannt. Bezos, so sagt er, gehe Pressemitteilungen, Produktbeschreibungen, Ansprachen und Aktionärsbriefe mit dem Rotstift durch und streiche dabei alles, was nicht mit einfachen, positiven Worten den Kunden anspricht.
Wir denken, wir kennen die Amazon-Story, aber im Grunde sind wir lediglich mit der firmeneigenen Mythologie vertraut, den Zeilen in Pressemitteilungen, Ansprachen und Interviews, die Bezos‹ Rotstift nicht zum Opfer gefallen sind.
Amazon residiert in einem Dutzend bescheidener Gebäude im Süden von Seattles Lake Union, einem kleinen Gletschersee, der durch Kanäle mit dem Puget Sound im Westen und dem Lake Washington im Osten verbunden ist. Im 19. Jahrhundert war dort ein großes Sägewerk zu Hause, davor hatte das Land den Indianern gehört. Die pastorale Idylle ist längst dahin, und heute punktieren biomedizinische Start-ups, ein Krebsforschungszentrum und Gebäude der medizinischen Fakultät der Universität von Seattle die dicht bebaute Stadtlandschaft.
Von außen sind Amazons moderne, eher flache Bürogebäude nicht zu erkennen und auch alles andere als bemerkenswert. Betritt man jedoch Day One North, den Sitz von Amazons Oberkommando an der Ecke Terry Avenue und Republican Street, sieht man sich, von der Wand hinter der rechteckigen Rezeption her, von Amazons lächelndem Logo begrüßt. Auf der einen Seite der Rezeption steht eine Schüssel mit Hundekeksen, falls ein Angestellter sein Tier mit ins Büro bringt – eine der raren Vergünstigungen in einer Firma, die ihre Mitarbeiter für Parkplätze und Snacks zahlen lässt. Bei den Aufzügen lässt eine schwarze Plakette in weißer Schrift den Besucher wissen, dass er das Reich des Philosophen-CEO betreten hat:
Es gibt noch so viel zu erfinden. Es wird noch so viel Neues passieren. Man macht sich noch keine Vorstellung davon, welchen Einfluss das Internet zukünftig haben wird, und dass dies in vieler Hinsicht der erste Tag ist.
Jeff Bezos
Amazons interne Gebräuche sind eigen bis wunderlich. PowerPoint-Präsentationen in Meetings sind verpönt. Stattdessen verlangt man von den Mitarbeitern ein sechsseitiges Exposé, das ihre Argumente in Prosa bringt, weil das Bezos‹ Ansicht nach das kritische Denken fördert. Für jedes neue Produkt erarbeiten die Mitarbeiter ein Dokument im Stil einer Pressemitteilung. Ziel ist es, eine vorgeschlagene Initiative so vorzutragen, als würde man damit zu einem Kunden gehen, der davon zum ersten Mal hört. Jedes Meeting beginnt damit, dass alle still das Dokument lesen, bevor es diskutiert wird – ganz wie seinerzeit bei der Übung unter dem Motto »produktives Denken« im Büro des Rektors der Grundschule in River Oaks. Für dieses spezielle Treffen mit Bezos wollte ich mich den Gepflogenheiten seiner Firma entsprechend vorbereiten – mit einer fiktiven Pressemitteilung im Amazon-Stil als Plädoyer für das vorliegende Buch.
Bezos empfing mich in einem Executive-Konferenzraum, und wir setzten uns an einen riesigen Tisch aus einem halben Dutzend aneinandergerückter »Türschreibtischen« aus genau derselben Sorte hellem Holz, die Bezos 20 Jahre zuvor benutzt hatte, als er in seiner Garage aus dem Nichts Amazon schuf. Diese Schreibtische aus mit Tischbeinen versehenen Türrohlingen stehen immer wieder symbolisch für die anhaltende Sparsamkeit des Unternehmens. Als ich Bezos 2000 zum ersten Mal interviewte, hatte man ihm die Jahre gnadenloser Geschäftsreisen rund um die Welt angesehen; er wirkte käsig und völlig außer Form. Jetzt war er mager und fit; er hatte seine äußere Erscheinung ebenso geformt wie seine Firma. Selbst das damals bereits schüttere Haar war jetzt kurz geschoren, was ihm die Windschnittigkeit eines seiner SciFi-Helden verlieh: Captain Picard aus der Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert.
Wir setzten uns, und ich schob ihm die Pressemitteilung über den Tisch hinweg zu. Als ihm klar wurde, was ich vorhatte, lachte er derart, dass ihm der Speichel aus dem Mund flog.
Man hat im Lauf der Jahre viel Aufhebens um Bezos‹ berühmtes Lachen gemacht. Es ist ein pulstreibendes Wiehern, hinter das er all seine Kraft zu legen scheint, wenn er, die Augen geschlossen, das Kinn vorschiebt und ein gutturales Brüllen ausstößt, eine Kreuzung zwischen dem Paarungsschrei eines See-Elefanten und einem Elektrobohrer. Oft lacht er, wenn sonst niemand sieht, was da so lustig sein soll. In gewisser Weise ist auch Bezos‹ Lachen ein ungelöstes Rätsel; man würde einen derart ungestümen Ausbruch nicht erwarten von einem so angespannten, konzentrierten Menschen wie ihm; und niemand in seiner Umgebung fällt in dieses Lachen mit ein.
Seine Angestellten kennen es in der Hauptsache als akustischen Stich ins Herz, ein Geräusch, das wie eine Klinge durch Gespräche fährt und sein Gegenüber bis ins Mark erschüttert. So einige seiner Kollegen meinen dahinter eine Absicht zu erkennen: dass Bezos dieses Lachen als Waffe einsetzt. »Man kann es unmöglich missverstehen«, sagt Rick Dalzell, der als Chief Information Officer bei Amazon bis 2007 für die Entwicklung der Informationstechnologie verantwortlich war. »Es ist so entwaffnend wie tödlich. Er bestraft einen damit.«
Bezos beschäftigte sich ein, zwei Minuten lang schweigend mit meiner Pressemitteilung, dann diskutierten wir die Absichten des vorliegenden Buches – die Geschichte von Amazon zum ersten Mal sorgfältig und detailliert zu erzählen, und zwar von ihren Anfängen an der Wall Street zu Beginn der 1990er Jahre bis zum heutigen Tag. Unser Gespräch dauerte eine Stunde. Wir unterhielten uns über andere bahnbrechende Bücher aus der Business-Welt, die als Modell dienen könnten, und über Walter Isaacsons kurz nach dem verfrühten Tod des Apple-Bosses erschienene Biografie Steve Jobs.
Außerdem betrachteten wir die einem solchen Unterfangen inhärenten Probleme sowohl hinsichtlich der Arbeit als auch des Verkaufs eines Buches über Amazon zum gegenwärtigen Zeitpunkt. (Jeder, der The Everything Store – online wie offline – verkaufen sollte, hätte zweifelsohne eine entschiedene Meinung dazu. So hat sich der französische Medienriese Hachette Livre, dem Little, Brown and Company – der Verleger des Titels – gehört, erst kürzlich nach einem langwierigen Kartellverfahren mit dem US-Justizministerium und der Europäischen Kommission geeinigt, in einem Verfahren, das auf die Auseinandersetzung des Unternehmens mit Amazon um die Preisgestaltung bei E-Books zurückgeht. Wie so viele andere Firmen im Einzelhandel und der Medienbranche musste Hachette in Amazon sowohl einen nützlichen Verkaufspartner wie auch einen gefährlichen Konkurrenten sehen. Natürlich hat Bezos auch darüber nachgedacht: »Es ist nicht etwa so, dass Amazon der Buchbranche passiert«, sagt er gerne Autoren wie Journalisten. »Was der Buchbranche da passiert, ist die Zukunft.«)
Ich habe mit Bezos wahrscheinlich ein Dutzend Mal gesprochen im Verlauf des letzten Jahrzehnts, und unsere Unterhaltungen waren stets lebhaft, vergnüglich und immer wieder von Salven seines Lachens interpunktiert. Er ist engagiert und voll nervöser, leidenschaftlicher Energie (wenn man ihm auf dem Flur begegnet, zögert er nicht, einen wissen zu lassen, dass er im Büro nie den Aufzug benutzt, immer die Treppe). Beim Gespräch wirkt er ganz und gar konzentriert und im Gegensatz zu vielen anderen CEOs vermittelt er nie den Eindruck, dass er es eilig habe oder etwas anderes im Kopf; er achtet jedoch sorgsam darauf, dass das Gespräch nicht von den bewährten – und recht abstrakten – Themen abweicht. So manche seiner Maximen hat man schon so oft gehört, dass man sie fast als »Jeffismen« bezeichnen möchte. Ein paar haben sich seit einem Jahrzehnt gehalten, wenn nicht länger.
»Wenn Sie wirklich dahinterkommen wollen, was uns anders macht«, sagt Bezos und leitet damit einen vertrauten Jeffismus ein: »Unsere aufrichtige Sorge gehört dem Kunden, wir sind aufrichtig an der Zukunft orientiert, und wir erfinden für unser Leben gern. Bei anderen Unternehmen ist das in der Regel anders. Sie konzentrieren sich auf die Konkurrenz anstatt auf den Kunden. Sie arbeiten an Konzepten, die ihnen in zwei, drei Jahren Dividenden einbringen, und wenn sie in zwei, drei Jahren nicht funktionieren, wenden sie sich etwas anderem zu. Sie sind lieber getreue Kopisten als Erfinder, weil das sicherer ist. Wenn Sie also die Wahrheit über Amazon einfangen wollen, ist genau das der Grund, warum wir anders sind. Es gibt nur wenige Unternehmen, die sich auf alle drei Elemente konzentrieren.«
Gegen Ende der Stunde, die wir über das Buchprojekt sprachen, lehnte Bezos sich auf die Ellbogen gestützt vor und fragte: »Wie wollen Sie der narrativen Verzerrung entgehen?«
Ah ja, natürlich, die narrative Verzerrung. Einen Augenblick verspüre ich die schweißtreibende Panik, die während der letzten 20 Jahre noch jeden Mitarbeiter von Amazon befallen hat, wenn er sich mit einer unvermuteten Frage seines hyperintelligenten Chefs konfrontiert sah. Narrative Verzerrung, so erklärte mir Bezos, sei ein Begriff, den Nassim Nicholas Taleb 2007 in seinem Buch Der schwarze Schwan geprägt habe. Er habe damit die angeborene Neigung des Menschen benennen wollen, komplexe Realitäten als beruhigende, aber allzu simple Geschichten zu sehen. Talebs Argumentation zufolge führen gewisse, dem menschlichen Gehirn eigene Einschränkungen bei unserer Spezies zu der Tendenz, zusammenhanglose Fakten und Ereignisse als Gleichungen von Ursache und Wirkung sehen zu wollen, um sie dann in leicht verständliche Narrative zu verwandeln. Diese Geschichten, so Taleb, schützen den Menschen vor der eigentlichen Ungeordnetheit seiner Welt, dem Chaos menschlicher Erfahrung und, bis zu einem gewissen Grad, vor dem entnervenden Element des glücklichen Zufalls, das stets eine gewisse Rolle bei Erfolg und Scheitern spielt.
Möglicherweise, so ließ Bezos durchblicken, handele es sich beim Aufstieg von Amazon um eine Geschichte von eben dieser Art unfassbarer Komplexität. Es gebe eben keine wohlfeile Erklärung dafür, wie es zur Erfindung gewisser Produkte kommt. Nehmen wir nur die Amazon Web Services, das bahnbrechende Cloud-Computing-Business, über das heute so viele andere Internet-Firmen ihre Geschäfte abwickeln. »Wenn ein Unternehmen eine Idee entwickelt, ist das kein geordneter Prozess. Es gibt keinen Augenblick, in dem allen ein Licht aufgeht«, sagte Bezos. Amazons Geschichte auf ein simples Narrativ zu reduzieren, so meinte er besorgt, könnte womöglich nur den Eindruck von Klarheit vermitteln, als tatsächlich etwas zu klären.
Taleb schreibt in seinem Buch (das, ganz nebenbei bemerkt, alle Senior Executives von Amazon lesen mussten), die narrative Verzerrung lasse sich vermeiden, indem Experiment und kühl analysierendes Wissen über Erzählen und Erinnerung gestellt werden. Eine praktikablere Lösung – wenigstens für den ambitionierten Autor – besteht vielleicht darin, ihren potenziellen Einfluss einzuräumen und dann trotzdem an die Arbeit zu gehen.
Und so beginne ich hier mit einer Offenlegung. Die Idee zum Unternehmen Amazon wurde 1994 im 39. Stock eines Wolkenkratzers in Midtown Manhattan geboren. Fast 20 Jahre später beschäftigt das aus dieser Idee entstandene Unternehmen über 90 000 Menschen und hat sich zu einer der bekanntesten Firmen der Welt entwickelt, die ihre Kunden immer wieder mit einem breiten Sortiment, niedrigen Preisen und einem exzellenten Kundendienst erfreut, während sie ganze Branchen umkrempelt und die Verantwortlichen einiger der berühmtesten Marken der Welt ins Schwitzen bringt. Es handelt sich bei diesem Buch um einen Versuch zu beschreiben, wie das alles hat kommen können. Es basiert auf über 300 Interviews mit gegenwärtigen und ehemaligen Führungskräften und Angestellten von Amazon, inklusive meiner Gespräche über die Jahre mit Bezos selbst, der das Projekt letzten Endes dann doch unterstützte, obwohl er der Ansicht ist, dass es für einen analytischen Rückblick auf Amazon noch »zu früh« sei. Nichtsdestoweniger bewilligte er zahlreiche Interviews mit seinem Management, seiner Familie und seinen Freunden, wofür ich ihm dankbar bin. Darüber hinaus baute ich auf meine 15-jährige Berichterstattung über das Unternehmen für Newsweek, Bloomberg Businessweek und die New York Times.
Ziel des vorliegenden Buches ist es, die Hintergrundgeschichte eines der größten unternehmerischen Erfolge zu erzählen, seit ein gewisser Sam Walton seine zweisitzige Turboprop über den Süden der USA steuerte, um sich nach geeigneten Standorten für seine Wal-Mart-Filialen umzusehen. Es ist die Geschichte eines begabten Kindes, das zu einem außergewöhnlich besessenen und vielseitigen CEO heranwächst; und sie erzählt, wie er, seine Familie und seine Kollegen so gut wie alles auf ein revolutionäres Netzwerk mit Namen Internet und die grandiose Vision eines Ladens gesetzt haben, in dem es schlichtweg alles zu kaufen gibt.
TEIL 1 GLAUBEN IST ALLES
Kapitel 1Das Haus der Algorithmen
Bevor sich das Unternehmen zur größten Buchhandlung der Erde erklärte, um dann zum dominierenden Superstore des World Wide Webs zu werden, geisterte Amazon.com als Idee durch das New Yorker Büro einer der ungewöhnlichsten Firmen der Wall Street: D. E. Shaw & Co.
Als ein quantitativer Hedgefonds wurde DESCO, wie die Mitarbeiter ihre Firma liebevoll nannten, 1988 von David E. Shaw, einem ehemaligen Professor für Informatik an der Columbia University, ins Leben gerufen. Neben den Gründern anderer bahnbrechender Quant-Häuser der Zeit – namentlich Renaissance Technologies und die Tudor Investment Corporation – war Shaw einer der ersten, die mithilfe von Computern und ausgeklügelten mathematischen Formeln Kapital aus anomalen Mustern auf den globalen Finanzmärkten zu schlagen verstanden. Wenn etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, der Kurs einer Aktie in Europa geringfügig höher lag als der Kurs desselben Papiers in den Vereinigten Staaten, nutzten DESCOs zu Wall-Street-Kriegern aufgestiegene ehemalige Computerfexe diese Unterschiede durch von selbstgeschriebener Software gesteuerte An- und Verkäufe in Sekundenbruchteilen aus.
Der Finanzgemeinde war D. E. Shaw kaum ein Begriff und der vielseitig versierte Gründer der Firma wollte, dass das auch so blieb. Er zog es vor, den Radar weit zu unterfliegen, wenn er mit dem Privatkapital reicher Investoren wie dem milliardenschweren Finanzier Donald Sussman und der Tisch-Dynastie operierte, damit die geschützten Trading-Algorithmen nicht der Konkurrenz in die Hände fielen. Falls DESCO tatsächlich ein Pionier neuer Ansätze im Investmentbereich werden sollte, dann würde die Firma, davon war Shaw fest überzeugt, ihren Vorsprung nur behalten, wenn sie ihre Erkenntnisse nicht ausposaunte und der Konkurrenz auf die Nase band, was von diesem computergestützten Neuland zu halten war.
David Shaw war in den ersten Tagen der aufkommenden Ära neuer und leistungsfähiger Supercomputer erwachsen geworden. Er hatte 1980 seinen Doktor in Informatik in Stanford gemacht und war dann nach New York gegangen, um am Department für Informatik der Columbia University zu lehren. Die ganzen frühen 80er Jahre über versuchten Hightech-Firmen, ihn in den privaten Sektor zu locken. Der Erfinder Danny Hillis, Gründer des Supercomputerherstellers Thinking Machines Corporation (und später einer von Jeff Bezos‹ engsten Freunden), hätte Shaw um ein Haar dazu gebracht, in seiner Firma bei der Entwicklung von Parallelrechnern mitzuwirken. Shaw nahm sein Angebot versuchsweise an, überlegte es sich dann jedoch wieder anders. Er sagte Hillis, er wolle sich nach etwas Lukrativerem umsehen; wenn er es zu etwas gebracht habe, könne er immer noch auf die Supercomputer zurückkommen. Hillis wandte ein, Shaw würde, selbst wenn er ein Vermögen machte – was unwahrscheinlich schien – nie wieder in die Informatikbranche zurückkehren. (Was Shaw aber dennoch tun sollte, nachdem er es zum Milliardär gebracht hatte und das Tagesgeschäft von D. E. Shaw anderen übertragen war.) »Ich hätte in beiden Fällen nicht spektakulärer danebenliegen können«, sagt Hillis dazu.
Morgan Stanley gelang es schließlich, Shaw von der akademischen Welt loszueisen; er rekrutierte ihn für eine legendäre Gruppe, die mit der Entwicklung von statistischer Arbitrage-Software für das kommende Phänomen des algorithmischen Tradings beschäftigt war. Aber Shaw drängte es danach, etwas Eigenes aufzuziehen. Er verließ Morgan Stanley 1988 und richtete sich mit 28 Millionen Dollar Seed Capital von Investor Donald Sussman in einem Büro über einer kommunistischen Buchhandlung in Manhattans West Village ein.
D. E. Shaw sollte sich vom ersten Augenblick an ganz bewusst von anderen Wall-Street-Firmen unterscheiden. Shaw stellte nämlich nicht etwa Finanzfachleute ein, sondern Wissenschaftler und Mathematiker – geistige Riesen mit ungewöhnlichen Hintergründen, hehren akademischen Referenzen und mehr als nur einem Touch sozialer Ahnungslosigkeit. Bob Gelfond, der zu DESCO stieß, nachdem die Firma in einen Loft an der Park Avenue South umgezogen war, sagte: »David wollte die Macht von Technologie und Computer auf wissenschaftliche Weise auf die Finanzwelt angewandt sehen« – und: »Er wollte mit bewunderndem Blick auf Goldman Sachs ein ikonisches Wall-Street-Unternehmen aufbauen«.
Im Hinblick auf diese beiden – und viele andere – Punkte ging David Shaw das Management seiner Firma mit einer strikten Grundhaltung an. So schickte er regelmäßig Memos herum, in denen er seine Angestellten anwies, den Namen der Firma auf eine ganz bestimmte Weise zu schreiben: mit einem Leerraum zwischen dem D. und dem E. Außerdem verfügte er, dass sich hinsichtlich des Unternehmensauftrags alle an einen bestimmten verbindlichen Wortlaut zu halten hätten; und zwar bestand dieser im »Handel mit Aktien, Anleihen, Futures, Optionen und Finanzinstrumenten anderer Art« – in dieser Reihenfolge und keiner anderen. Aber Shaws Rigorosität erstreckte sich durchaus auch auf die Substanz. So konnte zwar jeder seiner Informatiker Ideen zum Trading einbringen, aber diese Ideen hatten hinsichtlich ihrer Validität eine strenge wissenschaftliche Prüfung und statistische Tests zu bestehen.
1991 verzeichnete D. E. Shaw ein derart rapides Wachstum, dass die Firma in die oberen Etagen eines Wolkenkratzers in Midtown Manhattan umzog, nur einen Block vom Times Square entfernt. Die eindrucksvollen, wenn auch spärlich ausgestatteten Räumlichkeiten, für die der Architekt Steven Holl verantwortlich zeichnete, umfassen eine zweigeschossige Lobby: schier endlose weiße Wände mit fluoreszierenden Aussparungen, aus denen farbiges Licht in den Raum reflektiert. In diesem Herbst fungierte Shaw als Gastgeber einer Spendenveranstaltung für den Präsidentschaftskandidaten Bill Clinton; Prominente vom Rang einer Jacqueline Onassis blätterten um die 1 000 Dollar pro Karte hin. Man bat die Angestellten, ihre Büros für den Abend zu räumen. Jeff Bezos, einer der jüngsten Vice Presidents der Firma, ging mit einigen Kollegen zum Volleyball, ließ sich aber erst noch mit dem künftigen Präsidenten fotografieren.
Bezos war damals Mitte zwanzig, 1,73 Meter groß, mit angehender Glatze und der zerknitterten, käsigen Erscheinung des besessenen Workaholics. Er war bereits im fünften Jahr an der Wall Street und hatte allem Anschein nach jeden, der mit ihm zu tun gehabt hatte, beeindruckt mit seiner unmäßigen Zielstrebigkeit und seinem scharfen Verstand. Nach seinem Abschluss in Princeton 1986 hatte Bezos für zwei Professoren von der Columbia University in einer Firma namens Fitel gearbeitet, wo man ein privates transatlantisches Computernetz für Börsenhändler entwickelte. Graciela Chichilnisky, eine der Mitbegründerinnen von Fitel und Bezos‹ Chefin, hat ihn als fähigen, stets munteren Angestellten in Erinnerung, der unermüdlich arbeitete und zu unterschiedlichen Zeiten für die Geschäfte der Firma in London und in Tokio verantwortlich war. »Er machte sich keine Gedanken darüber, was andere dachten«, sagt Chichilnisky. »Man gab ihm so ein richtig solides intellektuelles Problem, und er verbiss sich darin, bis es gelöst war.«
1988 wechselte Bezos zu dem Finanzunternehmen Bankers Trust. Er war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits frustriert vom, wie er fand, eingefleischten Widerwillen der Geschäftswelt, den Status quo infrage zu stellen, und sah sich nach einer Möglichkeit um, ein eigenes Geschäft aufzuziehen. 1989 und 1990 verwandte er mehrere Monate seiner Freizeit auf die Arbeit an einem Start-up; sein Partner dabei war ein Mann von Merrill Lynch namens Halsey Minor, der später das Online-News-Unternehmen CNET auf die Beine stellen sollte. Ihr kaum flügges Unterfangen, per Fax einen maßgeschneiderten Newsletter zu verschicken, scheiterte, als Merrill Lynch die versprochene Finanzierung zurückzog. Dennoch hinterließ Bezos dort einen Eindruck. Minor erinnert sich, dass Bezos sich intensiv mit den Biografien einiger reicher Geschäftsleute befasst hatte und besondere Bewunderung für einen gewissen Frank Meeks hegte, einen Unternehmer aus Virginia, der ein Vermögen mit einer Reihe von Domino’s-Pizza-Franchises gemacht hatte. Außerdem verehrte Bezos den Informatiker Alan Kay, dessen Aphorismus »Ein Standpunkt ist 80 IQ-Punkte wert« er immer wieder zitierte – als Erinnerung daran, dass es das Verständnis einer Sache fördern kann, sie auf neue Weise zu sehen. »Er ging praktisch bei jedem zur Schule«, sagte Minor. »Ich glaube nicht, dass Jeff auch nur einen kannte, von dem er nicht gelernt hätte, was immer von ihm zu lernen war.«
Bezos war drauf und dran gewesen, der Wall Street den Rücken zu kehren, als ihn ein Headhunter überredete, sich mit den Executives einer weiteren Finanzfirma zu unterhalten, ein letztes Mal sozusagen, wegen des ungewöhnlichen Stammbaums der Firma. Bezos sollte später sagen, er hätte in David Shaw eine Art Seelenverwandten am Arbeitsplatz gefunden – »einen der wenigen Leute, die ich kenne, deren linke Hirnhälfte nicht weniger voll entwickelt ist als die rechte«.1
Bei DESCO legte Bezos viele der Eigenheiten an den Tag, die seine Angestellten später bei Amazon beobachten sollten. Er war diszipliniert und präzise, notierte ständig Ideen in ein Notizbuch, das er stets bei sich hatte, als könnten sie ihm verloren gehen, wenn er sie nicht aufschrieb. Er war rasch bei der Hand, wenn es darum ging, alte Auffassungen zu verwerfen und neue anzunehmen, wenn sich eine bessere Option bot. Außerdem kennzeichnete ihn bereits dieselbe jungenhafte Begeisterung und das seismische Lachen, das noch die ganze Welt kennenlernen sollte.
Bezos ging alles analytisch an, auch sein Privatleben. Da er damals Single war, begann er Tanzstunden zu nehmen, weil ihn das mit – wie er sich ausdrückte – n+ Frauen in Kontakt brachte. Wie sattsam bekannt, sollte er später eingestehen, darüber nachgedacht zu haben, wie sich sein »Frauen-Flow« erhöhen ließ2 in Anlehnung an den »Deal-Flow« der Wall Street, die Zahl von neuen Beteiligungen, die einem Banker gerade offenstehen. Jeff Holden, der erst bei D. E. Shaw und dann bei Amazon unter Bezos tätig war, sagt, er habe nie jemanden kennengelernt, der intensiver in sich hineingehorcht hätte. »Er ging alles in seinem Leben methodisch an.«
Bei D. E. Shaw hielt man nichts von den unnötigen Formalitäten anderer Wall-Street-Firmen; der wahrnehmbaren Stimmung nach ging es dort eher wie bei einem Start-up aus dem Silicon Valley zu. Die Angestellten trugen nicht Anzug und Krawatte, sondern Jeans und Khakis, und die Hierarchie war entschieden flach (auch wenn die Schlüsselinformationen zu Trading-Formeln streng geheim waren). Bezos schien der Gedanke eines ununterbrochenen Arbeitstags zu behagen; er hatte einen eingerollten Schlafsack in seinem Büro und etwas Profilschaum auf der Fensterbank für den Fall, dass er mal über Nacht blieb. Nicholas Lovejoy, ein Kollege, der später mit zu Amazon kommen sollte, meint, der Schlafsack »war nicht weniger Requisit als tatsächlich nützlich«. Wenn sie jedoch nicht im Büro blieben, unternahmen Bezos und seine Kollegen bei DESCO noch gerne etwas zusammen und spielten Backgammon oder Bridge bis in die Puppen, für gewöhnlich um Geld.
Als die Firma größer wurde, machte David Shaw sich zunehmend Gedanken darüber, wie sich das Spektrum ihrer Kompetenzen erweitern ließ. Er machte sich jenseits von Mathe- und Computer-Geeks auf die Suche nach »Generalisten«, wie er es nannte, Leuten, die jüngst ihren Abschluss an der Spitze ihrer Jahrgänge gemacht und dabei beträchtliche Fähigkeiten in speziellen Fächern an den Tag gelegt hatten. Außerdem durchkämmte die Firma die Reihen der Fulbright-Stipendiaten und die Dean’s Lists der besten Colleges. Man verschickte Hunderte von Schreiben an diese jungen Leute, in denen sich die Firma mit den Worten vorstellte: »Unsere Rekrutierungspolitik ist ungeniert elitär.«
Leute, die auf diese Schreiben reagierten, flog man, sofern sie wirklich außergewöhnlich schienen und sowohl ihre Durchschnittsnoten als auch die Resultate ihrer Neigungstests überzeugten, nach New York und nahm sie einen Tag lang in die Mangel. Man hatte bei DESCO eine Riesenfreude daran, diese Rekruten mit völlig willkürlichen Fragen – wie etwa »Wie viele Faxgeräte gibt es in den Vereinigten Staaten?« – zu bombardieren. Man wollte sehen, wie die Kandidaten die Lösung schwieriger Probleme angingen. Nach den Interviews setzten sich alle, die an dem Prozess teilgenommen hatten, zusammen und entschieden sich bei jedem Kandidaten für eine von vier Meinungen: auf keinen Fall einstellen; eher nicht einstellen; könnte man einstellen; unbedingt einstellen. Eine Enthaltung konnte einen Kandidaten versenken.
Bezos sollte später eben diesen Prozess, zusammen mit den Grundideen einiger anderer Managementtechniken, von DESCO mit nach Seattle nehmen. Noch heute bedienen sich die Angestellten von Amazon dieser Kategorien, wenn es an die Abstimmung über Neueinstellungen geht.
Sowohl die massiven Rekrutierungsaktionen als auch die Einstellungsverfahren passten ausgezeichnet zu Bezos‹ Mentalität; sie zogen sogar diejenige an, die Bezos‹ zukünftige Lebenspartnerin werden sollte. MacKenzie Tuttle hatte 1992 in Princeton ihren Abschluss in Englisch gemacht; sie hatte bei der Schriftstellerin Toni Morrison studiert und war als Verwaltungsassistentin zu dem Hedgefonds gestoßen, bevor sie direkt für Bezos zu arbeiten begann. Lovejoy erinnert sich, dass Bezos eines Abends eine Limousine mietete, um einige Kollegen in einen Nachtclub auszuführen. »Er lud uns alle ein, die ganze Gruppe, aber es war klar, dass das Ganze MacKenzie galt«, erzählt er.
MacKenzie sagte später, es sei genau andersherum gewesen – sie hätte zuerst ein Auge auf ihn geworfen. »Mein Büro war gleich neben seinem und ich konnte den ganzen Tag sein fantastisches Lachen hören«, erzählte sie Vogue 2012. »Wie sollte man sich nicht in dieses Lachen verlieben?« Sie tat den ersten Schritt, indem sie Bezos zum Mittagessen einlud. Nachdem sie drei Monate miteinander gegangen waren, verlobten sie sich; weitere drei Monate später heirateten sie.3 Ihre Hochzeit fand 1993 in »The Breakers« statt, einem Luxushotel in West Palm Beach; es gab Spiele für die Erwachsenen und eine nächtliche Party am Pool. Von D. E. Shaw waren Bob Gelfond und ein Programmierer namens Tom Karzes mit von der Partie.
So rasant wie DESCO wuchs, gestaltete die Leitung der Firma sich von Tag zu Tag schwieriger. Einige Kollegen aus der Zeit erinnern sich, dass D. E. Shaw einen Management Consultant kommen ließ, der alle Angehörigen des Executive Teams einem Myers-Briggs-Typentest unterzog. Es überraschte niemanden, dass sie alle »introvertiert« waren. Der am wenigsten Introvertierte des Teams war Jeff Bezos. Bei D. E. Shaw war er Anfang der 1990er Jahre praktisch der Extrovertierte vom Dienst.
Bezos war als Führungskraft bei DESCO ein Naturtalent. Bereits 1993 leitete er aus der Ferne die von Chicago aus operierende Options Trading Group und schließlich den medienträchtigen Einstieg ins Drittmarktgeschäft mit einem alternativen OTC-Handel, der es Privatanlegern erlaubte, Papiere ohne die übliche Kommission zu handeln, die sonst an die New Yorker Börse zu zahlen ist.4 Brian Marsh, ein Programmierer der Firma, der später ebenfalls bei Amazon arbeiten sollte, meint, Bezos sei »unglaublich charismatisch« gewesen und sehr »überzeugend hinsichtlich des Drittmarktprojekts. Es war ganz offensichtlich, dass er ein großartiger Führer war«. Bezos‹ Abteilung sah sich jedoch vor einer Herausforderung nach der anderen. Der dominante Player dieses Segments war ein gewisser Bernard Madoff (der Architekt eines riesigen Ponzi-Schemas, das sich 2008 auflösen sollte). Madoffs eigene Drittmarkt-Division leistete Pionierarbeit und konnte ihre Marktführung behaupten. Bezos und sein Team konnten von ihrem Büro hoch über der Stadt aus in die Fenster von Madoffs Büro im Lipstick Building an der East Side sehen.
Während der Rest der Wall Street in D. E. Shaw einen geheimnisvollen Hedgefonds sah, hatte man bei DESCO selbst eine andere Meinung von sich. David Shaws Einschätzung nach war die Firma noch nicht einmal ein richtiger Hedgefonds, sondern ein vielseitiges Technologielabor voller Erfinder und talentierter Ingenieure, das mithilfe der Informatik eine ganze Reihe von Problemen anzugehen verstand.5 Investment war nur die erste Domäne, auf die man sein Können anwenden würde.
So fand Shaw 1994, als sich den wenigen aufmerksamen Beobachtern die Möglichkeiten des Internets zu eröffnen begannen, dass seine Firma sich in einer ganz einzigartigen Position befand, um Kapital aus diesen Möglichkeiten zu schlagen. Und der Mann, den er zum Chefpionier erkor, war Jeff Bezos.
Und in der Tat waren bei D. E. Shaw die Voraussetzungen für die Nutzung des Internets ideal. So arbeitete der größte Teil der Mitarbeiter statt an den sonst üblichen proprietären Trading-Terminals an Sun-Workstations mit Internet-Zugang; und man setzte frühe Internettools ein wie Gopher, Usenet, E-Mail und Mosaic, einen der Webbrowser der ersten Stunde. Um Dokumente abzufassen, arbeitete man mit Latex, einem Textsatzsystem für Akademiker, obwohl Bezos selbst es nicht mit der Kneifzange anfassen wollte, weil es ihm unnötig kompliziert erschien. D. E. Shaw war darüber hinaus unter den ersten Wall-Street-Firmen, die eine eigene URL eintragen ließen. Wie aus Internet-Archiven hervorgeht, wurde Deshaw.com 1992 beantragt; Goldman Sachs übernahm seine Domain 1995 und Morgan Stanley ein Jahr danach.
Shaw, der das Internet und seinen Vorgänger, das Advanced Research Projects Agency Network, kurz ARPANET, bereits während seiner Zeit als Professor benutzt hatte, war begeistert von den kommerziellen wie den gesellschaftlichen Implikationen eines vereinten weltweiten Computernetzes. Bezos hatte mit dem Internet zum ersten Mal 1985 in einem Seminar über Astrophysik in Princeton zu tun gehabt, hatte sich jedoch nie Gedanken über sein kommerzielles Potenzial gemacht, bevor er zu DESCO stieß. Wie auch immer, Shaw und Bezos trafen sich ab sofort einige Stunden pro Woche zum Brainstorming und tauschten Ideen bezüglich dieser kommenden technologischen Welle aus, die Bezos dann auf ihre Machbarkeit abzuklopfen begann.6
Anfang 1994 erwuchsen aus diesen Diskussionen zwischen Bezos, Shaw und anderen bei DESCO erste weitblickende Geschäftskonzepte. Eines davon war ein kostenloser, durch Werbung finanzierter E-Mail-Dienst für Verbraucher – eben der Gedanke, der hinter Gmail und Yahoo Mail steht. DESCO sollte die Idee zu einer Firma namens Juno entwickeln, die 1999 an die Börse ging und kurz darauf mit seinem Rivalen NetZero fusionierte.
Eine weitere Idee bestand in einer neuen Art von Finanzdienstleistung, die Internet-Nutzer online mit Aktien und Anleihen handeln ließ. 1995 machte Shaw daraus eine Tochter von Farsight Financial Services, eine Vorläuferin von Firmen wie E-Trade. Shaw verkaufte diese Firma später an Merrill Lynch.
Und dann diskutierten Shaw und Bezos noch eine andere Idee. Sie nannten sie den everything store.
Einige der Executives, die zu der Zeit bei DESCO waren, bestehen darauf, dass die Idee für den Laden, der einfach alles führen sollte, simpler nicht hätte sein können: eine Internet-Firma, die als Vermittler zwischen Kunde und Hersteller diente, und das für so gut wie jede Art von Produkt und überall auf der Welt. Ein wichtiges Element schon dieser frühen Vision war, dem Kunden die Möglichkeit zur Bewertung des gekauften Produkts zu geben. Das war eine eher egalitäre, aber vor allem glaubwürdigere Version; die alten Besprechungen platzierten die Lieferanten selbst im Katalog von Montgomery Ward. Shaw selbst bestätigte das Konzept des Internet-Stores, als er 1999 dem New York Times Magazine sagte: »Es ging schon immer darum, dass ein Zwischenhändler Profit machen sollte. Die Kardinalfrage ist nur: Wer soll dieser Zwischenhändler sein?«7
Durch Shaws Überzeugung von der unabwendbaren Bedeutung des Internets neugierig geworden, begann Bezos bezüglich seines Wachstums zu recherchieren. John Quarterman, ein Autor und Verleger aus Texas, hatte erst kürzlich mit den Matrix News einen monatlichen Newsletter auf den Markt gebracht, der das Internet pries und seine kommerziellen Möglichkeiten zu diskutieren begann. Insbesondere eine Reihe von Tabellen in der Ausgabe vom Februar 1994 erregten Bezos‹ Aufmerksamkeit. Als Erster überhaupt hatte Quarterman das Wachstum des damals gerade mal ein Jahr alten World Wide Web aufgeschlüsselt und darauf hingewiesen, dass dessen einfaches, freundliches Interface ein weit größeres Publikum ansprach als alle anderen Internet-Technologien. Aus einer der Tabellen ging hervor, dass die Menge der durch das Web übertragenen Bytes (Folgen von Binärziffern) zwischen Januar 1993 und Januar 1994 um einen Faktor von 2 057 gestiegen war. Eine weitere Grafik zeigt, dass die Zahl der über das Web transportierten Datenpakete (formatierte Dateneinheiten) im gleichen Zeitraum um einen Faktor von 2 560 gestiegen war.8
Anhand dieser Zahlen berechnete Bezos, dass die Aktivitäten im World Wide Web in diesem Jahr um einen Faktor von etwa 2 300 gestiegen waren – das entspricht einem Zuwachs von 230 000 Prozent. »Nichts wächst so schnell«, sagte Bezos später. »So etwas ist hochgradig ungewöhnlich, und das hat mich auf die Frage gebracht: Welches Unternehmenskonzept ist wohl im Kontext eines solchen Wachstums sinnvoll?« (In seinen Ansprachen während der Frühzeit von Amazon sagte Bezos gern, es seien die »2 300 Prozent« jährliche Wachstumsrate gewesen, die ihn aus seiner Selbstgefälligkeit gerissen haben. Was eine interessante historische Fußnote ergibt: Amazon begann mit einem Rechenfehler.)
Bezos schloss aus alledem, dass ein wirklicher Laden für alles unpraktisch wäre – jedenfalls für den Anfang. Er stellte eine Liste von 20 möglichen Produktkategorien auf, darunter Computer-Software, Büroartikel, Kleidung, Musik. Die Kategorie, die sich schließlich als die beste Option anbot, waren Bücher. Sie schienen ihm die Handelsware schlechthin zu sein; ein Exemplar eines Buches in der einen Buchhandlung glich dem entsprechenden Titel in jeder anderen; der Käufer wusste also genau, was er bekommen würde. Es gab damals in Amerika mit Ingram und Baker & Taylor zwei maßgebliche Distributoren für Bücher, sodass ein neuer Einzelhändler sich nicht an Tausende von Verlagen wenden musste. Und was noch wichtiger war: Es gab weltweit drei Millionen lieferbare Bücher, weit mehr als eine Filiale von Barnes & Noble oder Borders je auf Lager halten konnte.
Wenn er schon nicht vom Fleck weg mit einem Laden für alles anfangen konnte, so könnte er zumindest dessen Essenz – die unbegrenzte Auswahl – in wenigstens einer wichtigen Produktkategorie einfangen. »Mit dieser ungeheuren Zahl unterschiedlicher Produkte konnte man online einen Laden aufziehen, den es sonst schlicht nicht geben könnte«, sagte Bezos. »Aber so ließ sich ein wahrer Superstore aufbauen, mit einem erschöpfenden Sortiment und einer Sektion für Kundenurteile.«9
Bezos konnte vor Begeisterung kaum an sich halten in seinem Büro im obersten Stock des Wolkenkratzers mit der Nummer 120 in der West Forty-Fifth Street. Zusammen mit Charles Ardai, dem Leiter Personalbeschaffung bei DESCO, sah er sich einige Websites der ersten Online-Buchhandlungen an, Book Stacks Unlimited in Cleveland Ohio zum Beispiel und WordsWorth in Cambridge, Massachusetts. Ardai hat noch heute den Beleg über einen Kauf, den sie bei der Prüfung dieser frühen Websites getätigt hatten. Er kaufte ein Exemplar von Isaac Asimov’s Cyberdreams auf der Website von Future Fantasy, einer Buchhandlung im kalifornischen Palo Alto. Es kostete 6,04 Dollar. Als das Buch – zwei Wochen später – kam, riss Ardai die Kartonverpackung auf und zeigte es Bezos. Es hatte auf dem Transport gelitten, gelinde gesagt. Offensichtlich war noch niemand dahintergekommen, wie man Bücher über das Internet richtig verkauft. Bezos sah darin eine unerschlossene Möglichkeit, eine enorme Chance.
Bezos wusste, das Projekt würde nie wirklich seine Firma werden, wenn er es weiterhin innerhalb von D. E. Shaw verfolgte. Shaw hatten schließlich anfänglich auch Juno und FarSight zu 100 Prozent gehört; er hatte bei beiden als Chairman fungiert. Wenn Bezos sich wirklich etwas erarbeiten, wenn er ein richtiger Unternehmer mit einem signifikanten Aktienanteil an seines Geistes Kind werden wollte, ein Mann, der auf eine finanzielle Belohnung im Bereich des Pizzamagnaten Frank Meeks hoffen konnte, dann musste er seinem ebenso behaglichen wie lukrativen Zuhause an der Wall Street den Rücken kehren.
Was als Nächstes passierte, gehört heute zu den Gründerlegenden des Internets. Im Frühjahr 1994 eröffnete Bezos David Shaw, dass er die Firma zu verlassen gedenke, um eine Online-Buchhandlung aufzuziehen. Shaw schlug einen Spaziergang vor. Zwei Stunden schlenderten sie durch den Central Park und sprachen über das Unterfangen und was es heißt, Unternehmer zu sein. Shaw versicherte Bezos, vollstes Verständnis für seinen Impuls zu haben – als er von Morgan Stanley weggegangen sei, habe er schließlich dasselbe getan. Er wies außerdem darauf hin, dass D. E. Shaw rasant wachse – Bezos habe mit anderen Worten bereits einen Superjob. Und dann, so sagte er Bezos noch, würden sie womöglich irgendwann als Konkurrenten dastehen. Die beiden einigten sich darauf, dass Bezos sich das Ganze noch mal durch den Kopf gehen ließ.
Bezos war damals frisch verheiratet, hatte eine komfortable Wohnung an der Upper West Side und einen bestens bezahlten Job. Obwohl MacKenzie ihm versicherte, ihn jederzeit zu unterstützen, falls er sich selbstständig machen wolle, fiel ihm die Entscheidung nicht leicht. Als er sich später zu seinen damaligen Überlegungen äußerte, hörte er sich, eher ungewöhnlich für ihn, an wie ein Geek. So habe er sich seinerzeit für die Entscheidung über den nächsten Schritt in seiner Karriere ein »Reue-Minimierungs-System« zurechtgelegt.
»Wenn man mitten im Getümmel ist, bringen einen Kleinigkeiten schnell durcheinander«, sagte Bezos einige Jahre später. »Ich wusste, dass ich mit 80 zum Beispiel nie und nimmer darüber nachdenken würde, warum ich 1994 meinem Wall-Street-Bonus den Rücken kehrte, mitten im Jahr, zur denkbar schlechtesten Zeit. Über so etwas macht man sich keine Gedanken mehr, wenn man 80 Jahre alt ist. Gleichzeitig wusste ich aber auch, dass ich es womöglich ernsthaft bedauern würde, mich nicht an diesem Ding namens Internet beteiligt zu haben, das für mich als umwälzendes Ereignis feststand. Und als ich so überlegte … fiel mir die Entscheidung unglaublich leicht.«10
Bezos‹ Eltern, Mike und Jackie, standen kurz vor der Rückkehr aus Bogotá, wo Mike drei Jahre als Erdölingenieur für Exxon tätig gewesen war, als der Anruf kam. »Was soll das heißen, du willst Bücher über das Internet verkaufen?«, war laut Mike Bezos ihre erste Reaktion. Sie hatten über Prodigy, einen frühen Online-Service, mit der Familie zu Hause korrespondiert und darüber auch Jeffs und MacKenzies Verlobungsparty organisiert; es war also nicht etwa Naivität gegenüber dem Internet, was die beiden nervös machte. Es war eher die Tatsache, dass ihr erfolgreicher Sohn eine gut bezahlte Stellung an der Wall Street aufgab, um eine Idee zu verfolgen, die sich nach einem kompletten Hirngespinst anhörte. Jackie Bezos schlug ihrem Sohn vor, sich doch abends oder an den Wochenenden um die neue Firma zu kümmern. »Nein, dazu ändert sich das alles zu schnell«, sagte ihr Bezos. »Da heißt es rasch handeln.«
Und so begann Jeff Bezos seine Reise zu planen. Er gab eine Party in seinem Apartment an der Upper West Side, wo man sich gemeinsam die allerletzte Episode von Star Trek: The Next Generation ansah. Dann flog er ins kalifornische Santa Cruz, um sich mit zwei erfahrenen Programmierern zu treffen, die Peter Laventhol, David Shaws erster Angestellter, ihm vorgestellt hatte. Bei Blaubeerpfannkuchen im Old Sash Mill Café in Santa Cruz konnte Bezos einen der beiden, einen alten Start-up-Kämpen namens Shel Kaphan, für seine Idee interessieren. Bezos »hatte in vieler Hinsicht dieselbe Begeisterung gepackt wie mich, was die Entwicklung des Internets anging«, sagt Kaphan. Gemeinsam sahen sie sich in Santa Cruz Büroräume an, bis Bezos von einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahre 1992 hörte, die ein früheres Urteil bestätigte, laut dem Kaufleute keine Verkaufssteuer in Bundesstaaten zu verlangen brauchen, in denen sie nicht physisch präsent sind. Als Folge davon meiden Versandgeschäfte in der Regel besonders bevölkerungsstarke Staaten wie Kalifornien oder New York. Jeff Bezos sollte es genauso halten.
Wieder zurück in New York, informierte er seine Kollegen, dass er DESCO verlassen würde. Bezos und Jeff Holden, der erst kürzlich seinen Abschluss an der University of Illinois in Urbana-Champaign gemacht und für Bezos als Ingenieur an dem Drittmarktprojekt gearbeitet hatte, ging eines Abends mit ihm etwas trinken. Die beiden verstanden sich blendend. Holden stammte aus Rochester Hills, Michigan, und hatte als Teenager unter dem Nom de Guerre »Nova« großes Geschick beim Cracken von kopiergeschützter Software an den Tag gelegt. Er war ein begeisterter Rollerblader und redete wie ein Schnellfeuergewehr; er sprach so schnell, dass Bezos des Öfteren scherzend meinte, Holden habe ihm beigebracht, »schneller zuzuhören«.
Jetzt saßen sie einander im Virgil’s, einem Grill in der Forty-Forth Street, gegenüber. Bezos hatte seiner Firma versuchsweise den Namen Cadabra Inc. gegeben, sich aber noch nicht festgelegt. Holden füllte Vorder- und Rückseite eines Zettels aus seinem Notizbuch mit Alternativen. Am besten von allen fand Bezos MakeItSo.com – nach dem Kommando von Star Treks Captain Picard.
Über einigen Bieren sagte Holden Bezos, dass er gerne mitkommen würde. Was Bezos jedoch Sorgen machte; eine Klausel seines Vertrags mit D. E. Shaw verbot ihm ausdrücklich für zwei Jahre nach seinem Ausscheiden, jemanden aus der Firma zu rekrutieren. Er wollte sich David Shaw nicht zum Feind machen. »Du hast gerade die Schule hinter dir, du hast Schulden. Und das hier ist riskant«, sagte Bezos. »Bleib hier. Schaff dir etwas Eigenkapital. Wir bleiben in Kontakt.«
Einige Wochen später packten Bezos und MacKenzie ihren Hausstand ein und wiesen die Möbelpacker an, einfach mal Richtung Westen zu fahren; sie würden sie am nächsten Tag unterwegs anrufen, um ihnen den endgültigen Bestimmungsort mitzuteilen. Dann flogen die beiden nach Fort Worth in Texas, wo sie sich von Bezos‹ Vater einen Chevy Blazer Baujahr 88 ausliehen. Damit fuhren sie Richtung Nordwesten, MacKenzie am Steuer, Bezos auf dem Beifahrersitz; er tippte Einnahmeprojektionen in eine Excel-Tabelle – Zahlen, die sich später als von Grund auf falsch erweisen sollten. In Shamrock, Texas, wollten sie in einem »Motel 6« einchecken, das jedoch ausgebucht war, sodass das Paar in einem Motel mit Namen »The Rambler« abstieg.11 Als MacKenzie das Zimmer sah, weigerte sie sich, die Schuhe auszuziehen – die ganze Nacht. Tags darauf hielten sie schließlich am Grand Canyon und sahen die Sonne aufgehen. Er war 30, sie 24, und zusammen saßen die beiden an einer unternehmerischen Gründerstory, die sich der kollektiven Fantasie von Millionen Internet-Usern und hoffnungsvollen Gründern von Start-ups einprägen sollte.
Es dauerte über ein Jahr, bis Jeff Holden wieder von seinem Freund hörte. Bezos hatte sich in Seattle eingerichtet und mailte Holden den Link zu einer Website. Sie hieß jetzt Amazon.com. Die Site war primitiv und bestand vorrangig aus Text; beeindruckend war sie jedenfalls nicht. Holden kaufte einige Bücher über die Site und bot Bezos sein Feedback an. Danach verging wieder ein Jahr, und schließlich, einige Monate nach Ablauf der Abwerbevereinbarung mit David Shaw, klingelte bei Holden das Telefon.
Es war Bezos. »Es ist so weit«, sagte er. »Es haut hin.«
Kapitel 2Das Buch Bezos
Am 21. August 1994 tauchte in einem Usenet-Bulletin-Board folgendes Posting auf.
Gutkapitalisiertes Start-up sucht extrem talentierte C/C++/UnixEntwickler zur Mithilfe bei der kommerziellen Erschließung des Internets. Verlangt wird Erfahrung in Design und Aufbau großer, komplexer (aber wartbarer) Systeme, und das in etwa einem Drittel der Zeit, die man unter kompetenten Leuten für möglich hält. Sollte über BS, MS oder Dr. in Informatik verfügen oder Äquivalent. Erstklassige Kommunikationsfähigkeit Voraussetzung. Vertrautheit mit Webservern und HTML hilfreich, aber nicht unabdingbar.
Talentierte, motivierte, konzentrierte und interessante Mitarbeiter erwartet. Müssen bereit sein, in die Gegend von Seattle zu ziehen (wir tragen zur Deckung der Umzugskosten bei).
Ihr Gehalt umfasst eine sinnvolle Beteiligung am Aktienkapital.
Bewerbung mit CV an Jeff Bezos.
US Mail: Cadabra, Inc. 10704 N. E. 28th St. Bellevue, WA 98004
Wir bieten allen Mitarbeitern und Bewerbern die gleiche Chance.
»Es ist einfacher, die Zukunft zu erfinden, als sie vorauszusehen.«
Alan Kay
Zuallererst, das war jedem klar, musste ein besserer Name gefunden werden. Die magischen Anklänge von Cadabra Inc. waren, wie Bezos‹ erster Anwalt Todd Tarbert erklärte, nachdem man den Namen im Juli 1994 ins Washingtoner Handelsregister hatte eintragen lassen, viel zu obskur; und am Telefon verstanden die Leute auch gern mal Cadaver. Nachdem Bezos und MacKenzie sich gegen Ende des Sommers in einem eingeschossigen Vier-Zimmer-Ranch-House in Bellevue, einer Vorstadt von East Seattle, eingemietet hatten, begannen sie mit dem Brainstorming. Wie aus Internet-Archiven hervorgeht, trugen sie in dieser Zeit die Webdomains Awake.com, Browse.com und Bookmail.com ein. Bezos zog vorübergehend auch Aard.com in Betracht, nach dem niederländischen Wort für Art, Wesen, nur um in den Listings der Websites, die damals noch alphabetisch geordnet waren, ganz vorn zu stehen.
Bezos und seine Frau verguckten sich in dieser Zeit auch in eine andere Möglichkeit: Relentless.com. Freunde meinten, gnadenlos, unerbittlich hätte definitiv etwas Finsteres, aber irgendetwas muss Bezos daran fasziniert haben, da er die URL nicht nur – im September 1994 – eintragen ließ, sondern dann auch behielt. Tippen Sie mal Relentless.com in Ihren Browser und Sie landen bei Amazon.
Bezos hatte sich dazu entschlossen, seine Firma in Seattle anzusiedeln. Zum einen, weil die Stadt den Ruf eines technologischen Zentrums genießt, zum anderen weil Washington von der Bevölkerungszahl her – im Vergleich zu Kalifornien, New York und Texas – ein eher kleiner Bundesstaat ist, was bedeutete, dass Amazon nur einer verschwindend geringen Zahl seiner Kunden eine Verkaufssteuer zu berechnen hätte. Während die Gegend noch als abgelegener städtischer Außenposten galt, eher für Grunge-Rock bekannt als für seine Business-Community, kam Microsoft im nahegelegenen Redmond gerade so richtig in Schwung. Und die University of Washington sorgte für einen steten Strom von Informatikern. Seattle lag außerdem gar nicht so weit von einem der beiden großen Barsortimenter: Ingram hatte ein Lager gerade mal sechs Autostunden weiter in Rosenburg, Oregon. Außerdem lebte dort der Geschäftsmann Nick Hanauer, den Bezos unlängst über einen Freund kennengelernt hatte – er hatte Bezos empfohlen, es doch mal mit Seattle zu probieren. Hanauer sollte später eine entscheidende Rolle dabei spielen, Bezos mit potenziellen Investoren zusammenzuführen.