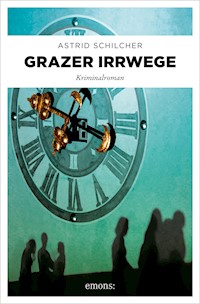Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Florian Steiner, Professor der Politikwissenschaft, ist charismatisch, eloquent und mit einem beachtlichen IQ ausgestattet. Von den untätigen Politikern, dem Populismus und Nationalismus frustriert, gründet er seine eigene Partei und kündigt eine autokratische Herrschaft im Sinne des Gemeinwohls an. Der Erfolg gibt ihm Recht und den nötigen Aufwind, die extremen Forderungen nach verpflichtendem Arbeitsdienst, Wählerführerschein und Resozialisierungen in der Alpenrepublik durchzusetzen. Während der Verführer der Massen an ausgeklügelten Propagandakonzepten feilt und sich sein Aufstieg auf EU-Ebene ausdehnt, wachsen in Steiners Frau die Zweifel an seiner Arbeit. Provokant, geistreich und erfrischend entwirft Astrid Schilcher, stellvertretend für unsere westlichen Demokratien, das Bild einer österreichischen Zukunftsgesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Astrid Schilcher
Der Alpendiktator und Menschenfreund
Gesellschaftsroman
Schilcher, Astrid : Der Alpendiktator und Menschenfreund. Hamburg, acabus Verlag 2020
Originalausgabe
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-744-2
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-743-5
Print-ISBN: 978-3-86282-742-8
Lektorat: acabus Verlag
Satz: Sarah Zechel, acabus Verlag
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: © Man Giving A Speech On Stage von rudall30/stock.adobe.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2020
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Die Handlung des Romans sowie sämtliche Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Drei Zeitzeugen
Florian Steiner war zum Führen geboren. Meine lebendigste Erinnerung an ihn stammt aus der Volksschulzeit. Wir waren Klassenkameraden. Schon damals wäre es niemandem in den Sinn gekommen, ihn Flo zu nennen. Es war ein sonniger Herbsttag, knapp nach Schulbeginn. Wir waren acht Jungs, Lausbuben, und stritten darüber, ob wir Cowboys und Indianer oder Wer fürchtet sich vorm Schwarzen Mann spielen sollten. An diesem Tag bekamen wir alle von einem Achtjährigen unsere erste Lektion im demokratischen Mehrheitsprinzip.
Florian kletterte kurzerhand auf die Parkbank und verkündete mit einer angeborenen Autorität, die unser wildes Durcheinandergeschrei augenblicklich verstummen ließ: »Hört mal her, es gibt eine ganz einfache Lösung.« Es folgte eine kurze Erklärung der Begriffe Mehrheit und Demokratie mit dem Hinweis, dass wir in einer demokratischen Republik lebten. Wir verstanden höchstens die Hälfte, waren aber zu erstarrt in einer Mischung aus Faszination und Scham über unsere eigene Unwissenheit, um Fragen zu stellen oder gar Widerspruch zu leisten. »Damit eine Einigung zustande kommt und wir endlich spielen können, muss die Minderheit ihren Protest aufgeben und dem Willen der Mehrheit folgen. So ist das in einer Demokratie«, schloss er sein Plädoyer und wir alle nickten betreten.
Die Abstimmung endete 5:3 für Cowboys und Indianer. Dass Florian den begehrten Part des Indianerhäuptlings einnahm, stand außer Frage. Später fragte ich mich manchmal, was geschehen wäre, hätte das Voting 4:4 ergeben. Aber ich bin mir sicher, dass er auch dafür eine Lösung parat gehabt hätte. Wahrscheinlich hätte er uns einen Exkurs über parlamentarische Diskussionsrunden verpasst. Florian war zwar der Kleinste und Schmächtigste von uns, überragte uns aber haushoch in seinen rhetorischen Fähigkeiten. Er hätte es zweifelsohne geschafft, einen aus der Wer fürchtet sich vorm Schwarzen Mann Fraktion zum Überlaufen zu bewegen.
***
Ich unterrichtete Florian Steiner in der Oberstufe des Akademischen Gymnasiums in Physik. Er war der Albtraum für einen noch relativ jungen und unerfahrenen Lehrer wie mich. Nicht etwa, weil er störte oder aufmüpfig war, nein, es waren seine Fragen, die mir den Angstschweiß auf die Stirn trieben, sobald ich ihn brav die Hand heben sah. Dabei ging es ihm keinesfalls darum, uns Lehrer bloßzustellen. Er war einfach unendlich wissbegierig. Aber wie, um Himmels Willen, kam ein Siebzehnjähriger auf derartige Fragestellungen?
»Wenn das Verhalten eines Schwarzen Lochs nach außen hin vollständig durch seine Masse, elektrische Ladung und seinen Drehimpuls bestimmt ist und es außerdem in der Quantenphysik keinen Verlust von Information geben kann, was passiert dann mit der Information der Objekte, die von einem Schwarzen Loch aufgesogen wurden?« Hatte man keine zufriedenstellende Antwort parat, und die hatte natürlich niemand, verlor Florian rasch das Interesse und verabschiedete sich mental vom Unterricht, was ich jedes Mal als persönliche Niederlage empfand. Gegenüber seinen Mitschülern war er durchwegs hilfsbereit, erklärte ihnen geduldig nicht verstandene Teile des Unterrichtsstoffes und gab einigen sogar unentgeltlich Nachhilfeunterricht.
Als ich hoffnungslos daran scheiterte, der Maturaklasse eine Vorstellung von der vierten Dimension zu vermitteln, hob Florian wieder einmal seine gefürchtete Hand: »Darf ich es versuchen?« Ich nickte resigniert und sah mit an, wie er aus einem papierenen zweidimensionalen Würfelnetz einen Würfel formte und diesen dann wieder in die zweite Dimension auffaltete. Danach projizierte er den Schatten eines Würfels auf einen zweidimensionalen Schirm und skizzierte, wie man aus diesem Schatten ein Würfelnetz konstruieren konnte. Daraus folgerte er, dass der Schatten eines Tesserakts in unserer Dimension ein 3D-Würfel sei, aus dem sich ebenfalls ein Tesseraktnetz ableiten ließ, welches zusammengefaltet schlussendlich einen Hyperwürfel ergäbe. »Keiner von uns kann sich die vierte Dimension wirklich vorstellen, aber ich denke, so bekommen wir zumindest eine brauchbare Näherung«, schloss er seine Darbietung.
Ich hätte froh sein sollen, solch einen begabten Jungen in meiner Klasse zu haben. Stattdessen verspürte ich in meiner jugendlichen Unsicherheit, ich war damals gerade sechsundzwanzig, nur Irritation gepaart mit einem Aufflammen kindischer Eifersucht. Es dauerte drei Schuljahre, bis ich Florians Erklärungsmodell in meinen Unterricht übernahm. Heute würde ich viel dafür geben, unter den stumpfsinnigen, bestenfalls unkritischen Schülern einen Florian Steiner zu haben und seine eifrige Hand nach oben schnellen zu sehen.
***
Ich war mit Florian Steiner an der Uni zusammen. In der Masse der überwiegend noch kindischen männlichen Studenten glich er einem 2009er Château Lafite Rothschild unter Heurigenweinen. Wir studierten beide Volkswirtschaftslehre und waren für zehn Monate ein Paar. Florian war hochintelligent, hatte tadellose Manieren und wusste genau, was er wollte. Diese Mischung wirkte anziehend auf mich, gab mir Sicherheit. Auch optisch war er durchaus herzeigbar, wenn auch mit 1,72 Meter etwas klein für einen Mann. Mein Spitzname für ihn war Spock. Immerzu logisch und besonnen, ließ er Gefühle nur kontrolliert zu, weshalb ich letztlich mit ihm Schluss machte.
Rhetorisch beherrschte er alle Finessen, was mir bei Streitigkeiten stets das Gefühl gab, manipuliert zu werden. Seit Florian reagiere ich allergisch auf Gewaltfreie Kommunikation, Metakommunikation, NLP und sonstigen Rhetorik-Trainer-Scheiß.
»Du verstehst mich einfach nicht.«
»Ich höre, dass du frustriert bist, weil ich deine Erwartungen nicht erfülle. Das tut mir leid. Hilf mir bitte und sag mir, was du willst.«
»Verdammt, Florian, ich will dir keine Gebrauchsanweisung liefern müssen. Ich will, dass du mich verstehst!«
»Anna, diese Erwartung ist nicht nur unlogisch, sondern auch unfair; und das weißt du auch. Du bist eine intelligente Frau, sei bitte nicht so irrational!«
Am Ende dieser Szene packte ich meine Koffer und verließ ihn. Die Trennung verlief, in typischer Spock-Manier, unaufgeregt. Da Florian mir im Studium voraus war, kreuzten sich unsere Wege auch nicht mehr. Von gemeinsamen Bekannten hörte ich, dass er ein Jahr in Paris verbrachte, weil er zu schnell studiert hatte und nun seine Zulassung zur zweiten Diplomprüfung abwarten musste. Angeblich absolvierte er in dieser Zeit ein Praktikum beim Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien und beschäftigte sich mit Integrationsstrategien für die Sicherheits- und Entwicklungspolitik in der EU. Ich nehme an, das motivierte ihn, ein Doktorat in Politikwissenschaft anzuhängen. Soweit ich weiß, hat er in Paris auch seine Frau kennengelernt. Ich hoffe, Spock hat seine Vulkanierin gefunden.
Florian Steiner und die Lage der Welt
Sonntagmorgen. Da Camille an den Wochenenden gerne ihrem Langschläfer-Gen huldigt, widme ich mich der Frühstücksvorbereitung. Bevor ich meine Frau wecke, lasse ich den Blick ein letztes Mal über den Tisch gleiten, stelle sicher, dass alles da ist, was ihr Herz begehrt: eine Schraubkanne für vier Portionen Kaffee, eine Karaffe Orangensaft, zwei weichgekochte Eier, ein Korb mit Dinkel-Vollkornbrot, Butter, Himbeer-Rhabarber-Marmelade, verschiedene Käsesorten, Radieschen, zwei Schalen mit frischen Erdbeeren und Joghurt, Die Zeit und Le Monde. Früher lasen wir auch noch die New York Times, aber seit acht Jahre Trump und mehr als eine Dekade Republican Party die USA an den Rand des Bürgerkrieges und in die weltpolitische Bedeutungslosigkeit geführt haben, sparen wir uns die Lektüre.
Camille und ich zelebrieren unser Sonntagsfrühstück-Ritual. Sie ist eine brillante Juristin und wir diskutieren mit Vergnügen das aktuelle Weltgeschehen über unserem Dejeuner. Das Weltgeschehen – beim Umblättern entfährt mir ein gequälter Seufzer.
»Na, die Zeitungsmeldungen verderben dir auch immer öfter die Laune, chéri«, stellt meine Angetraute treffend fest.
»Kein Wunder, bei solchen Nachrichten! Überfällige Reformen, die von feigen Politikern nicht angegriffen werden. Wahlen, die zur Zitterpartie werden, dass die rechtspopulistischen Demagogen die Mehrheit davontragen. Immer die gleiche Leier. Das alles steht mir bis hier.« Zur Verdeutlichung führe ich meine ausgestreckten Finger mit einer schnittigen Bewegung unter meiner Unterlippe vorbei.
Meine Frau schmunzelt. Sie weiß, wie sehr ich das westliche Europa liebe und wie tief es mich schmerzt, dass dieses seiner Probleme nicht Herr wird, sein Potenzial nicht ausschöpft.
»Mit den USA am Boden gibt es keinen Grund, warum Europa nicht die Vormachtstellung einnehmen und florieren könnte. Das einzige Hindernis sind wir selbst«, alteriere ich mich weiter.
»Was willst du dagegen tun?«, fordert Camille mich heraus.
Normalerweise kapituliere ich an dieser Stelle, aber nicht heute. Volksabstimmung über Kopftuchverbot in Kindergärten und im öffentlichen Dienst. Volksabstimmung über Mitspracherecht von Eltern und Schülern bei Lehrstoff und Notengebung. Steigende Arbeitslosenzahlen und dem gegenüber Betriebe, die händeringend nach Arbeitskräften suchen. Welche Meldung auch immer der Auslöser war, für mich ist eine Grenze überschritten.
»Da, hör dir das an: Neo-Faschisten in Italien wollen nach Wahlsieg Volksabstimmung über EU-Austritt einberufen. Aus Brüssel kommt bis jetzt nur geschocktes Schweigen. Die Demokratie versagt an allen Ecken und Enden. Das Volk entscheidet über Dinge, von denen es keinen blassen Schimmer hat, manipuliert von Propagandabombardement, Alternative Facts und picksüßen Wahlzuckerln. Wie lange wollen wir noch zuschauen, wie Zukunftsperspektiven und Gemeinwohl unter der Diktatur ignoranter Wutbürger geopfert werden?«
Le Monde senkt sich und Camilles grüne Bergsee-Augen blicken mir fragend entgegen.
»Höchste Zeit, dass irgendwer den Mumm aufbringt, offen über eine nötige Reform unseres demokratischen Systems nachzudenken.«
Ich kann die Fragezeichen in den Augen meiner Frau förmlich sehen. Mittlerweile wölbt sich auch eine Stirnfurche über ihren Brauen. Das lässt Widerspruch befürchten und ich beeile mich fortzufahren: »Platons Schiffs-Analogie trifft es auf den Punkt: Die Welt braucht einen fähigen Kapitän, unterstützt von Experten, anstelle laienhafter Passagiere, die angesichts eines Orkans im Sesselkreis über Navigationsmanöver abstimmen. Das kann nur zu Schiffsbruch führen.«
»Die Demokratie ist sicher nicht perfekt. Diese Entwicklungen beunruhigen mich genauso wie dich. Aber bis dato haben wir keine bessere Regierungsform gefunden. Oder hast du eine klügere Idee, mon cher?«
»Längere Legislaturperioden, ein mächtigeres Staatsoberhaupt mit einem Stab an Expertenberatern, was weiß ich. Auch die Gründerväter der USA hatten nie die Intention, das Wahlrecht jedem zuzugestehen. Ist es zu viel verlangt, dass Wahlberechtigte auch ein Verständnis über die Abstimmungs-Materie mitbringen und Zusammenhänge sowie langfristige Auswirkungen ermessen können?«
Le Monde liegt inzwischen feinsäuberlich gefaltet neben dem Teller und ich genieße die volle Aufmerksamkeit meiner Gesprächspartnerin.
»Wahlrecht nur für weiße Männer mit Landbesitz, wie zu Beginn der Vereinigten Staaten?«
Diese bewusste Provokation bringt mich zum Schmunzeln und ich kontere: »Vielleicht gar keine so schlechte Idee. In einigen Schweizer Kantonen bekamen die Weiberleut auch erst 1990 das Stimmrecht und so schlecht sind die Eidgenossen damit nicht gefahren.«
»Idiot«, zischt Camille, wirft ein Radieschen nach mir und verschwindet dann wieder hinter ihrer Tageszeitung.
Meine Laune hat sich zwar gebessert, aber die Problematik gärt innerlich weiter. In meinem Hinterkopf formiert sich die Idee zu einem Studentenexperiment.
Eine Vorlesung in Politischer Philosophie
»Ist mehr direkte Demokratie die Lösung für den Vertrauensverlust der Bürger in das System?«, frage ich ins Auditorium, aus dem mir verständnislose bis gleichgültige Gesichter entgegenblicken. Ich warte, lasse die Stille bis zur Unerträglichkeit anschwellen, während mein Blick herausfordernd über die Bankreihen gleitet. »Sie sind der Professor, sagen Sie es uns«, kapituliert schließlich einer der Studenten.
»Das nächste Mal, wenn Sie das Gebäude betreten, schauen Sie einmal, was über dem Eingang steht, statt auf Ihre Smartphones. Einige von Ihnen werden überrascht sein, dort das Wort Universität zu sehen. Es impliziert, dass ich es als meine Pflicht erachte, Ihnen selbstständiges Denken und eigenständige Problemlösung beizubringen. Diejenigen, die sich aus dem Gymnasium verirrt haben, mögen bitte den Hörsaal verlassen.«
Für einige Sekunden herrscht ungläubiges Schweigen, dann wagt sich eine Studentin aus den mittleren Reihen vor: »Die grundlegende Bedeutung von Demokratie ist ja, dass die Macht vom Volk ausgeht. Dem wird mehr direkte Demokratie sicherlich besser gerecht als der Umweg über gewählte Volksvertreter.«
»Außerdem bezweifle ich, dass die Politiker wirklich unsere Interessen vertreten«, schaltet sich ihr Sitznachbar ein. Langsam erwachen die Studierenden aus ihrem Dämmerzustand, immer mehr Stimmen fallen in den zustimmenden Chor ein. Sie sind so berechenbar wie das Volumen eines Würfels.
»Es wird auch Zeit, sich von den ganzen aufgeblasenen und geldverschlingenden Institutionen zu verabschieden. Wozu brauchen wir einen Nationalrat und einen Bundesrat?«
»Alle Macht dem Volke? Sie sind also der Meinung, dass es eine gute Sache wäre, das Volk zu wichtigen Entscheidungen direkt zu befragen?«, folgere ich und ernte ein inbrünstiges »Ja«.
»Nehmen wir einmal an, wir lassen die Bevölkerung über folgende Fragen abstimmen: Sollen geistig Behinderte und drogensüchtige Frauen sterilisiert werden? Sollen in Seenot geratene Flüchtlingsboote Hilfe erhalten und in einen sicheren EU-Hafen gebracht werden?«
Stille.
«Entnehme ich Ihrem betretenen Schweigen, dass Sie sich unwohl fühlen, diese Entscheidung den Bürgern zu überlassen?”
»Na ja, es geht hier um fundamentale Menschenrechte«, versucht es eine Studentin.
»Sie sind also unsicher, ob die Mehrheit im Sinne der Menschenrechte, den Basiswerten unserer Zivilisation, entscheiden würde und meinen trotzdem, dass mehr direkte Demokratie eine gute Idee sei?«
»Ich vertraue darauf, dass die Gesellschaft moralisch richtig entscheiden würde«, ruft jemand trotzig aus den hinteren Reihen.
»Moralisch richtig, sehr schön. Schließlich beschäftigen wir uns in der Politischen Philosophie mit der Frage der Ethik von politischen Systemen. Dann kommen wir gleich zu unserem nächsten Beispiel. Stellen Sie sich vor, es gibt wieder einen Terroranschlag, bei dem dutzende Menschen getötet werden. Ein Islamist wird verhaftet, auf den Verdacht hin, einer der Drahtzieher im Hintergrund zu sein. Die Polizei vermutet, dass er Kontakt zu Personen an der Spitze der Terrorzelle hat, aber er leugnet alles. Eine Volksbefragung über die Legitimierung von Folter wird einberufen und medial kräftig von rechtspopulistischen Gruppierungen aufgeheizt. Was meinen Sie, wie wahrscheinlich es ist, dass das Völkerrecht hochgehalten wird?«
»Nur, weil Volksabstimmungen möglicherweise in Völker- und Menschenrechtsfragen gefährlich sind, heißt das noch lange nicht, dass ein Mehr an direkter Demokratie in anderen Bereichen eine schlechte Idee wäre.« Ich erkenne Markus Neumayer, der mir schon in einigen Seminaren als eines dieser seltenen Pflänzchen aufgefallen ist, die eine eigene Meinung äußern und für diese auch logisch konsistent argumentieren können.
»Diese Schlussfolgerung ist korrekt. Wenden wir uns somit Beispielen von wirtschaftspolitischen Fragestellungen zu.« Wir diskutieren darüber, dass die meisten Menschen für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Umweltschutz stimmen würden. Wie würden sie aber über Importzölle, deren Höhe sich nach Sozial- und Umweltstandards in den Herstellungsländern richtet und die das Ende von billigen Klamotten, Schuhen, Lebensmitteln, etc. bedeuten würden, entscheiden? Und würden sie die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen solcher Zölle verstehen?
Der Brexit ist ebenfalls ein wunderbares Beispiel für neuzeitliches Demokratieversagen, das nicht nur eine wirtschaftliche Talfahrt, sondern, nach der Abspaltung Schottlands und Nordirlands, auch den Zerfall des Vereinigten Königreichs nach sich gezogen hat.
»Man könnte den Eindruck gewinnen, Sie hätten ein negatives Menschenbild, Herr Professor«, versucht Markus Neumayer mich zu provozieren.
Ich schenke dem Auditorium mein entwaffnendstes Lächeln: »Wahrscheinlich habe ich zu lange mit Studierenden zu tun gehabt. Aber Sie alle haben noch drei Semester, mich vom Gegenteil zu überzeugen.«
Gelächter. Meine Studenten mögen mich, schätzen die Kurzweiligkeit und Unkonventionalität meiner Lehrveranstaltungen, weshalb ich mit derartigen Kommentaren durchkomme.
Als Aufgabe verlange ich eine schriftliche Zusammenfassung der heutigen Erkenntnisse, inklusive einer daraus abgeleiteten persönlichen Meinung. Bei der Korrektur zeigt sich, dass alle die vordergründigen Schwachpunkte direkter Demokratie erfasst haben. Einfallslos zitieren Sie Platon, Nietzsche und Tocqueville, schreiben über die Diktatur von Mehrheiten, die sich über Minderheitsinteressen hinwegsetzen. Fehlentscheidungen aufgrund unvollständiger Informationen und mangelndem Verständnis, Populismus, kurze Wahlzyklen, Selbstinteressen, die kontraproduktiv dem Gemeinwohl wirken – all diese offensichtlichen Demokratie-Wehwehchen plappern sie folgsam nach. Wie erwartet kommen sie zu dem Schluss, dass es nicht ratsam sei, dem Volk mehr Entscheidungen zu überlassen. Die Kernproblematik unserer modernen Demokratie, die Politiker zum Führen zu bewegen, hat hingegen kein einziger meiner Hörer erfasst.
Nur Markus Neumayer tanzt wieder einmal aus der Reihe. In einem flammenden Plädoyer gesteht er zwar die Schwächen der Demokratie ein, betont jedoch mit einer Referenz auf Churchill, dass wir noch kein besseres System gefunden hätten.
Der Schluss, dass diese Schwächen ein Weniger an Demokratie rechtfertigen, ist absurd, genauso als würde man aus den Unzulänglichkeiten unseres Schulsystems eine Abschaffung der Schulpflicht oder die Sinnhaftigkeit von weniger Bildung ableiten.
Weiters argumentiert Neumayer, dass wir, anstatt die Demokratie in Frage zu stellen und einzuschränken, besser daran täten, die Gründe für ihr teilweises Versagen an der Wurzel auszumerzen. Er fordert, Bildungssystem und Informationsverbreitung so zu gestalten, dass nötiges Basiswissen und Fakten bei den Wählern ankommen sowie die Länge der Legislaturperioden zu überdenken.
Zumindest die letzten Punkte sind in meinem Sinne. Ich mag diesen Studenten. Er beweist Kampfgeist und Intelligenz. Einen wie ihn könnte ich gut gebrauchen. Jetzt gilt es, daran zu arbeiten, ihn für meinen Zweck einzuspannen. Mit dem Rotstift schreibe ich einen ausführlichen Kommentar zu seiner Hausarbeit, lobe eigenständiges Denken sowie schlüssige Argumentation und ergänze, dass ich mich freuen würde, ihn in meinen Wahlfach-Seminaren zu sehen.
Studentenexperimente
Markus Neumayer hat den Köder geschluckt und sitzt in meinen Seminaren Kritische Staats- und Gesellschaftstheorien und Vertiefende Analyse des Wählerverhaltens.