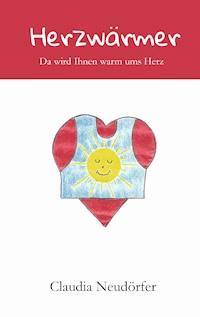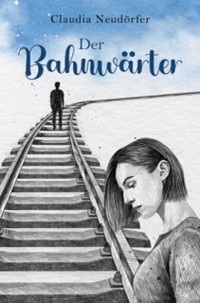
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Nina: jung, erfolglos, Single, Reporterin. Als ob das noch steigerungsfähig wäre: nicht gerade eine Schönheit, wohnt zu allem Übel auch noch über der Garage ihrer Eltern. In einer Kleinstadt, naja, eher einem Dorf. Einem Dorf an einer vielbefahrenen Eisenbahnstrecke. Dort munkelt man von seltsamen Geschehnissen an diesen Bahnschienen. Abgelegene Ortschaften, frei zugängliche Bahngleise, Nachtstunden, ICEs. An diesem Ort gehen verzweifelte Menschen auf die Gleise, stürzen sich vor den Zug. Hier, so sagt man, wache eine unsichtbare Hand darüber, dass niemand zu Schaden komme. Alte-Leute-Geschwätz? Wunschdenken? Ninas Reporterneugier ist geweckt. Was steckt hinter diesem Gerede? Ist sie der einen, großen Story auf der Spur, die ihre Reporterlaufbahn endlich in erfolgreiche Bahnen führt? Die junge Frau lässt nicht locker, bis sie Erstaunliches zu Tage fördert. Die Großeltern der Autorin "Emil und Julia Neudörfer" waren einst Bahnwärter am Bahnübergang 191 a in Rastatt-Niederbühl. Im Wald stand früher ein Haus in dem Familie Neudörfer lebte. Die Autorin vereint in diesem Roman eine spannende Geschichte und Erinnerungen ihrer Familie an das Bahnwärterleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Danke
Autorinnen Vita
Impressum:
1. Auflage
Copyright: © 2025 Claudia Neudörfer
Covergestaltung: Tom Jay Buchcoverdesign und Nalart Studio
Lektorat: Petra Kind
Buchsatz: Kerstin G. Rush
Alle Rechte dieser Publikation liegen beim Autor. Nachdruck, auch auszugsweise ist nicht gestattet. Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung.
Widmung:
Für meine Eltern
Kapitel 1
Zitternd stand ich auf den Gleisen, die rechts und links von Weizen und Maisfeldern gesäumt waren und wartete auf einen Zug. Lange hatte ich mir überlegt, wie das Problem zu lösen sein könnte, aber ich sah einfach keinen anderen Ausweg mehr.
So machte ich mich, als es bereits dunkel wurde, auf den Weg zu den Bahngleisen, die unweit von meinem Elternhaus verliefen. Den ersten Zug hatte ich voller Angst an mir vorbei rasen lassen. Dieses Ungetüm aus blankem Stahl hatte mir einen höllischen Schrecken eingejagt, als es nur wenige Meter entfernt von mir vorbei gedonnert war. Nun hatte ich mich voller Ungeduld auf die Schienen gesetzt und nahm mir vor, beim nächsten Zug nicht zu zögern und meine Chance zu nutzen.
Kurz darauf fingen die Gleise unter mir an zu vibrieren. Ein Brummen, das immer lauter wurde, zeigte mir an, dass es nun so weit war. Schon tauchte die Bahn in meinem Blickfeld auf und näherte sich mit einer rasenden Geschwindigkeit. Eilig stand ich auf und postierte mich auf den Schienen. Der Zug war nur noch circa fünfzig Meter entfernt, da tauchte plötzlich eine Gestalt neben mir auf, legte eine Hand auf meine Schulter und zog mich beherzt von den Gleisen herunter. Der Fremde trug einen schwarzen Mantel, eine Kapuze verhüllte sein Gesicht. Mir war klar, dass ich IHN gefunden hatte.
Viele Wochen war ich täglich die Schienen auf und ab gegangen, hatte an der Tür des Bahnwärterhäuschens gerüttelt und nichts war geschehen. Das kratzte natürlich sehr an meiner Reporterehre, denn es gab keine Geschichte, die „Nina Reutling“ noch nicht aufgedeckt hatte.
Unser Dorf war nichts Besonderes und außer ein paar Feldern, auf denen seit Jahrhunderten Meerrettich angepflanzt wurde, hatte dieser Ort nichts Erwähnenswertes zu bieten.
Na ja, bis auf die große Beliebtheit der nahegelegenen Bahnstrecke bei Selbstmördern. Das war zumindest früher so gewesen, denn laut meiner Recherchen war die Zahl der Todesfälle innerhalb der letzten fünf Jahre fast auf null gesunken. Um die Ursache dieses Phänomens rankten sich die wildesten Gerüchte. Die meisten berichteten von einem wundersamen Mann im Bahnwärterhaus, der es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht hatte, die Schranke und die Weichen zu kontrollieren, sondern auch ein Schutzengel für die Lebensmüden zu sein schien.
Keiner konnte so recht beschreiben, wie dieser „Lebensretter“ genau aussah und vor allem nicht, warum er das tat, was er tat.
Seit letztem Jahr arbeitete ich als Volontärin bei der Redaktion des „Dorfblattes“ und war täglich auf der Jagd nach neuen, sensationellen Geschichten. Und diese Geschichte hier schien mir mehr als interessant zu sein.
Nach wochenlanger, ergebnisloser Suche hatte ich nun nur noch die glorreiche Idee, dass ich mich wohl selbst auf die Gleise stellen musste, wenn ich den mysteriösen „Schutzengel“ treffen wollte. Und jetzt hatte ich es tatsächlich gewagt. Mit Erfolg, wie es schien.
Die verhüllte Gestalt lies mich nun los und schob mich schweigend vor sich her, bis wir kurz darauf vor dem Bahnwärterhaus standen. Er öffnete die Türe und ich setzte vorsichtig einen Fuß über die knarrende Schwelle.
Zwei Monate zuvor:
„Rüdiger, bitte nicht schon wieder der Kleintierzuchtverein! Kann das nicht mal der Hermann übernehmen? Der mag doch die Hasen viel lieber als ich!“
Ich setzte einen bettelnden Blick auf und strich spielerisch eine Haarsträhne hinter mein Ohr.
Diese Aktion, die ich mir bei meiner attraktiven Kollegin Tamara abgeschaut hatte, blieb leider wirkungslos. Eigentlich hätte ich selbst wissen müssen, dass eine kaum 1,60 m kleine, unscheinbare, graue Maus, die ich nun mal war, bei den Männern kein Interesse hervor rief.
„Solange Du mir nichts Besseres als die schlechte Ernte der Erdbeerplantage bringst, kannst Du dich darauf einstellen, deine nächsten Wochenenden mit den Langohren zu verbringen. Und jetzt raus aus meinem Büro!“, schepperte mein Boss und wies mit seinem speckigen Zeigefinger auf die Türe zum Flur.
Nicht ohne meinen Unmut durch ein lautes Seufzen zu äußern, steuerte ich den Weg zum Ausgang an und warf dann doch viel zu leise die Türe ins Schloss.
Mein Kollege Herrmann hätte sich das sicher nicht gefallen lassen und nicht so leicht kleinbeigegeben, aber ich war eben nicht Herrmann und auf diesen Job angewiesen.
Sicher, das Gehalt war nicht gerade hoch und meine Eltern wünschten sich, dass ihre Tochter endlich einen sicheren Job ergreifen würde und somit nicht mehr über ihrer Garage hausen musste. Nicht zu vergessen, wünschten sie sich ebenfalls mindestens zwei Enkelkinder, also von mir. Was soll ich sagen, die Chancen für Letzteres standen noch viel schlechter als die Chancen auf eine Beförderung.
Nun galt es also ein spannendes Thema zu finden, dass meinen Chef von den Socken riss und ihn endlich davon überzeugen würde, mir eine Festanstellung in der Redaktion zu geben.
Aber was für ein Thema sollte das sein? Ich lebte in einem kleinen Dorf, in dem nicht viel passierte.
Da waren das alljährliche Meerrettich-Fest und der Adventsbasar der katholischen Kirche -schon klare Highlights für unsere kleine Dorfzeitung. Ich weiß, es muss barbarisch klingen,
aber ich sehnte mich nach einem kleinen Verkehrschaos - natürlich nur mit Blechschäden, -oder einem winzigen Tornado, der nur knapp unser Dorf verfehlte. Das wäre sicher eine Schlagzeile wert, das müsste selbst Rüdiger zugeben.
Grübelnd hielt ich mein Kinn zwischen zwei Fingern, während ich auf meinem Bürostuhl Platz nahm und nervös mit der Lehne wippte.
„Was ist los Nina, suchst Du mal wieder eine „Top-Story?“, lästerte Tamara und klapperte mit ihren langen Fingernägeln auf der Computer-Tastatur.
Mir stellten sich die Nackenhaare auf und ich drehte Tamara den Rücken zu.
Sie konnte nichts dafür, dass sie der Liebling aller war, aber ich konnte sie trotzdem nicht leiden mit ihrem adretten Hosenanzug, den langen, dunkelblonden Haaren und den perfekt manikürten Fingernägeln, die zum Tippen eigentlich viel zu lang waren.
Sie war eine Frau, die es in unserer Zeitung schon zur Chefsekretärin gebracht und zudem drei Kinder vorzuweisen hatte. Nicht zu vergessen einen Ehemann, der zu Hause blieb, sich um die Kleinen kümmerte und dafür sorgte, dass das Haus immer tip-top aussah.
„So bringt man Karriere und Familie unter einen Hut“, sagte mein Vater Norbert immer, wenn es um Tamara ging.
Und meine Mutter Thea seufzte dann mit einem Blick zu mir: „Kannst Du nicht ein bisschen wie Tamara sein?“
Nein, kann ich nicht und will ich auch nicht! Meine Wut stieg mir schon wieder bis zur Kehle, weshalb ich mich entschloss, meine „Top-Story“ draußen vor der Türe zu suchen.
Eine gute Idee, fand ich. Schließlich spielte sich das Leben nicht hier am Schreibtisch, sondern dort draußen ab. Ich schnappte meine alte Jeansjacke und verließ eilig das Büro.
Mal sehen was die Bürger unseres Dorfes so interessierte und über wen heute wieder gesprochen wurde.
Ich schaute beim Bäcker vorbei, der eigentlich eine sehr gute Anlaufstelle für den neuesten Tratsch war. Aber es war nur ein einzelner, kaffeeschlürfender, älterer Herr dort und die Inhaberin war nicht in Klatschlaune.
Bei der Bank drückte ich mich einige Minuten herum und tat so, als ob ich meine Kontoauszüge studieren würde, bis mich einer der Bankangestellten freundlich, aber bestimmt des Raumes verwies. Scheinbar hatten sich ein paar Kunden beschwert, denen ich zu sehr auf die Pelle gerückt war. Zugegeben eine Bank war nicht der geeignete Platz für Recherche.
Frustriert nahm ich die Stufen zum Dorf-Friseur und setzte mich leicht ermattet auf das Sofa im Empfangsbereich.
„Hallo Nina, hast Du einen Termin?“, wurde ich kurz darauf von meiner Friseurin Elvira aus meiner Lethargie gerissen.
„Äh, nein, ich wollte nur ein bisschen hören …,“ begann ich.
„Kein Problem, ich kann dich zwischenrein schieben. Deine Spitzen sollten wirklich mal wieder dringend nachgeschnitten werden, so kannst du dich ja nicht mehr unter die Leute trauen. Bin gleich bei Dir“, bestimmte Elvira.
Leicht beleidigt strich ich durch meine Haare, beschloss aber dieses Angebot anzunehmen. Nicht weil ich so wild auf einen neuen Haarschnitt war, sondern weil es sich zwischen den
anderen Damen so am besten unauffällig recherchieren ließe. Man kann es glauben, oder nicht, bei diesem Friseur wurden noch feinsäuberlich Männchen und Weibchen getrennt.
Ich nahm in einem Frisierstuhl Platz und lauschte Geschichten von Oma Erna und Beate, die sich immer auf den Enkelbesuch freuten, aber noch mehr, wenn dieser überstanden war. Opa Kalle schimpfte über die lange Wartezeit beim Hausarzt und den Hundehaufen vor seiner Tür.
Ich bemerkte eine Teenagertochter, die sich die Haare von braun auf weiß färben ließ, das soll anscheinend jetzt modern sein. Die anderen Damen waren da, um sich die weißen Haare braun färben zu lassen. Belanglose Gespräche über Hauskatzen oder eine zu hohe Hecke des Nachbarn, wechselten sich ab mit Erzählungen über Hochzeiten und Beerdigungen.
Ich wollte gerade wieder ohne Haarschnitt von meinem Platz aufstehen, da diese Art der Recherche scheinbar auch nicht von Erfolg gekrönt war, da warf mir Elvira einen Friseurumhang um die Schultern und begann mir die Haare zu waschen. Während sie das Shampoo in meine Kopfhaut einmassierte, ergoss sich ein weiterer Schwall von unbrauchbaren Gesprächen in mein Ohr. Irgendwann schaltete ich auf Durchzug und wartete nur noch ungeduldig auf das Ende der Haarwäsche.
Endlich beendete Elvira ihr Werk und warf mir ein Handtuch über den Kopf. „Bin gleich wieder da“, flötete sie und verschwand im Nebenraum.
Aus dem Augenwinkel beobachtete ich eine Frau um die Fünfzig, die sich leise mit Ihrer Friseurin unterhielt und dabei mit den Tränen kämpfte. Es war meine Nachbarin Frau Rischke, die gegenüber wohnte.
Als sie nach dem Farbeauftragen unter die Trockenhaube geschoben wurde, konnte ich nicht anders als sie anzusprechen.
„Ist alles in Ordnung bei Ihnen?“, fragte ich vorsichtig.
Die Frau schniefte in ein Taschentuch und schaute dann leicht lächelnd zu mir. „Ja, es geht mir gut. Es sind nur Tränen der Erleichterung“, erklärte sie.
„Der Erleichterung, da bin ich ja erleichtert … ich meine ich bin froh, dass es nichts Ernstes ist. Darf ich fragen, was passiert ist?“, fragte ich vorsichtig.
„Es geht um meinen Mann. Es ging ihm sehr schlecht. Er verging schon seit Monaten in einer Melancholie und hatte nicht mal mehr Lust morgens aufzustehen. Er war schon länger krankgeschrieben und lag nur noch auf dem Sofa herum. Nichts konnte ihn aufheitern.“
Ich nickte mit meinem einfühlsamsten Blick, den ich bieten konnte.
„Irgendwann sprach er von Selbstmord und dass er keinen Sinn mehr in seinem Leben sehen würde. Ich habe ihn nicht ernst genommen, ich war ja auch immer mit den Kindern beschäftigt. Verstehen Sie?“, fragte sie ängstlich und ich nickte abermals.
„Vor einer Woche war er plötzlich verschwunden. Er hatte einen Zettel auf den Küchentisch gelegt - „Bin im Wald spazieren“. Da war ich wirklich erschrocken! Der ist doch schon seit Monaten nicht mehr spazieren gegangen, schon gar nicht im Wald, dachte ich alarmiert.“ Wieder fasste die Frau nach dem Taschentuch und schnäuzte sich geräuschvoll.
Ich fiel fast vor Spannung von meinem Stuhl und bemerkte nicht, dass ich so gestrampelt hatte, dass das Handtuch verrutscht war und ich mit meinen nassen Haaren den Boden vollgetropft hatte. „Und dann?“
„Als die Dunkelheit anbrach wurde ich immer ängstlicher, aber ich konnte die Kinder doch nicht zu Hause alleine lassen, geschweige denn mit ihnen im Wald nach ihrem Vater suchen.“
„Und?“, fragte ich wieder und verursachte bei meinem Gegenüber einen irritierten Blick.
„Ich weiß nicht genau. Er kam nach zwei Stunden wieder nach Hause. Voller Gestrüpp und er roch nach Pfefferminz, aber sonst wohl behalten und voller neuer Hoffnung.“
„Hat er gesagt, was vorgefallen ist?“, hakte ich wieder nach.
„Er hat nur sehr wenig erzählt. Er meinte er hätte auf den Bahngleisen gestanden und sich vor einen Zug werfen wollen und dann sei eine Gestalt vor ihm erschienen, in einem dunklen Gewand und einer Kapuze, die ihn davon abhielt sich das Leben zu nehmen.“
„Eine Gestalt, im Wald? Wer war diese Person?“, ich sprang von meinem Platz auf und das Handtuch landete dabei auf dem Boden. Meine Nachbarin schaute verwundert auf mich und auf die Pfütze unter mir. Ich drängte sie mit meinen Augen zu einer Antwort. Mein Blick schien derart intensiv zu sein, dass sie von der Pfütze abließ und sich wieder dem Gespräch zuwandte.
„Ich weiß es nicht, mein Mann hat ihn nicht erkannt. Aber er ist wie neu geboren. Er spielt wieder mir den Kindern, geht arbeiten und hilft ehrenamtlich beim Seniorentreff. Ist das nicht wunderbar?“, setzte die Frau nun ein Lächeln auf.
„Wissen Sie, wo ihr Mann diesen „Retter in der Not“ genau getroffen hat?“, löcherte ich die Dame weiter, während ich das Handtuch vom Boden aufhob.
„Im Wald, bei dem alten Bahnwärterhaus“, antwortete sie.
Ich wand mich zum Gehen und steuerte schnellen Schrittes den Ausgang an.
„Aber ich weiß nicht, ob mein Mann nicht einfach nur zu viel getrunken hat an dem Abend“, rief mir die Frau noch hinterher.
Beim Hinausgehen stieß ich fast mit Elvira zusammen.
„Wo gehst Du denn hin?“, fragte sie erschrocken.
„Muss weg!“, erklärte ich und schloss die Türe von außen.
„Aber deine Haare sind doch noch ganz nass“, rief mir Elvira hinterher. Kopfschüttelnd holte sie einen Schrubber hinter der Türe hervor, um meine Wasserspur aufzuwischen und ließ mich ziehen.
Zwischenzeitlich drehte sich das Gedankenkarussell wie wild in meinem Kopf. War diese Quelle wirklich seriös, gab es noch mehr solcher Beobachtungen? Oder redeten wir hier von einem Ehemann, der einen zu viel im Tee gehabt hatte? Oder einem Mythos wie „Big Foot“, „Nessie“ oder dem „Yeti“? Es war meine Aufgabe das herauszufinden.
Kapitel 2
Meine Haare waren kaum getrocknet, als ich mich auf die Suche nach dem von Frau Rischke beschriebenen „Retter“ machte. Als Journalistin durfte man sich nicht nur auf Zeugenaussagen verlassen, sondern musste selbst Einsatz zeigen. Und das tat ich. Ächzend krabbelte ich auf allen Vieren durchs Unterholz im angrenzenden Wald. Als ich das Gelände um das alte Bahnwärterhaus absuchte, hatte ich auf dem höchsten Punkt eines Hügels die Balance verloren und war wie eine Kugel den Abhang hinuntergerollt. Eine verdammt große Kugel. Ich rappelte mich unter Schmerzen wieder auf und versuchte, meine Kleidung notdürftig zu säubern, in dem ich sie von oben bis unten abklopfte, was nur sehr wenig nutzte. In meinen Haaren steckten ein paar kleine Äste mit Tannenzapfen und Harz verklebte meinen Pony.
Ich war schon seit mehreren Wochen immer wieder auf der Suche nach dem „Bahnwärter“, gewesen, ohne Erfolg. Keiner wollte diesen Mann bisher gesehen haben. Auch die Recherche am Schreibtisch hatte nicht den erhofften Durchbruch gebracht. Immerhin hatte ich noch vier weitere Personen gefunden, die von diesem Schutzengel an den Gleisen gehört hatten. Wahrhaftig getroffen hatte ihn natürlich niemand, alles nur Gerüchte. Wer würde auch von einem vereitelten Selbstmordversuch durch den Bahnwärter reden wollen, wenn er ihn selbst unternommen hatte. Natürlich keiner. Ich musste tiefer graben.
Bis jetzt hatte ich meinem Chef Rüdiger nur spärlich von meiner Suche nach dem Bahnwärter erzählt. Mit einer zerrissenen Hose, aufgeschrammten Ellenbogen und kleinen Ästen im Haar schlich ich mich etwas verspätet an diesem Mittag ins Büro. Ich war der Meinung, mich und mein verspätetes Erscheinen hätte niemand bemerkt, bis Tamara vor mir stand und mir mit einem zufriedenen Lächeln mitteilte, dass der Chef mich sehen wolle. Spöttisch kichernd über mein Auftreten verschwand sie im Pausenraum.
Ich betrat sogleich Rüdigers Büro und stand wie ein schuldbewusstes Schulmädchen vor ihm, bis er endlich sein enormes Doppelkinn hob und mich ausdruckslos anschaute.
Er holte tief Luft, was seine Kinne erzittern ließ.
„Nina, ...“, begann er.
„Rüdiger, ich bin da an einer ganz großen Sache dran. Ich brauche nur noch ein paar Wochen für die Recherche…“, fiel ich ihm ins Wort.
„Sag mir nicht, dass Du noch immer diesen „Bahnwärter“ suchst!“, rief Rüdiger und seine Augenbrauen bebten.