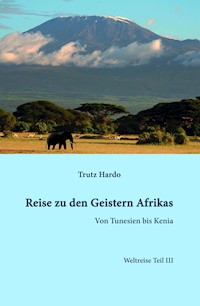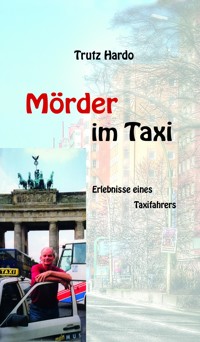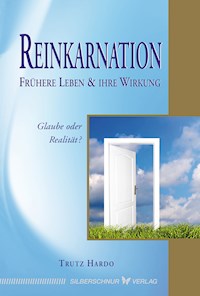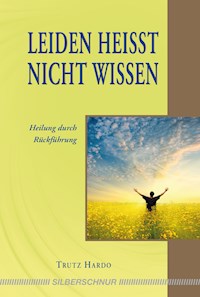4,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Berlin in den 1990er Jahren - nach dem Fall der Mauer lebt ein blinder Dichter, der sich in die Heimleiterin des Blindenvereins verliebt und sie schließlich heiratet. In seiner Vorstellung ist seine Frau eine Schönheit, welche er in seinen Gedichten mit jener Helenas gleichsetzt. Durch Zufall hört er das Gespräch zweier Frauen, die seine Frau als die hässlichste der Welt beschreiben. Eine Welt der Illusionen stürzt für ihn zusammen. Er fühlt sich als betrogen. Nach vielen Irrungen in die Tiefen seiner Seele führt ihn sein Weg nach Weimar. Der blinde Dichter wird zu einem sehenden, der die Welt hinter den Illusionen erschaut hat. Dieser Roman nimmt es sicherlich mit den spannendsten Romanen unserer Zeit auf und fügt ihm außerdem eine dichterische Dimension hinzu, die heutzutage nur noch sehr selten in der erzählenden Literatur anzutreffen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
© 2016 by Trutz Hardo
2. Auflage
Umschlaggestaltung: Trutz Hardo
Abbildung Titel: Fotografie von Goethes Gartenhaus
Korrektorat u. Satz: Angelika Fleckenstein; spotsrock.de
Verlag: tredition GmbH Hamburg
ISBN:
978-3-7345-1252-0 (Paperback)
978-3-7345-1253-7 (Hardcover)
978-3-7345-1254-4 (eBook)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Trutz Hardo
Der blinde Dichter
Roman
Inhaltsverzeichnis
Illusion und Blindheit
Aufdecken und Verstehen
Vergebung und Verwandlung
Erfüllung
Illusion und Blindheit
Gestern war die Beerdigung. Ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll vor Freude, Freude darüber, dass sie endlich befreit ist von ihren schmerzvollen Leiden, und weinen darüber, dass sie nicht mehr bei mir ist. Wie auf einer Wippe der Gefühle stehend, überkommt mich oft ein Weh, wenn ich zu der einen Seite hin meinen Fuß beschwere und somit das Brett in die eine Schräge befördere, und das Freudegefühl nimmt wieder überhand, wenn ich den anderen Fuß belaste und folglich das Brett in die entgegengesetzte Schräglage versetze. Aber meistens halte ich die Balance, weshalb ich anfangs sagte, ich weiß nicht, ob ich weinen oder mich freuen soll. Doch so ich diese Balance durch Unachtsamkeit oder durch ein Mich-gehen-Lassen in die eine oder andere Richtung aufgebe, gebe ich mich sogleich entweder jener Trauer hin, die mir Tränen über das Gesicht strömen lässt, oder bin dann von jener Freude erfüllt im Wissen darüber, dass sie es endlich geschafft hat. Sie wohnt nun in einer viel schöneren Welt und darf all ihre Attribute von perfekter Ausgewogenheit im Gesicht wieder erhalten, sodass ich jetzt – würde ich sie sehen können – von ihrer Schönheit geblendet wäre.
Warum ich es nun unternehme, unser beider Geschichte – natürlich aus meiner Sicht heraus – auf Tonband zu diktieren, hat seinen Grund darin, dass ich dir, liebe Leserin und lieber Leser, meine Torheit beichten möchte und ich dich – mit deiner Erlaubnis natürlich – zu meinem Beichtvater wählen möchte. Ob du mir am Ende meiner Beichte Absolution erteilen kannst, muss ich deinem Urteil überlassen. Doch bitte ich dich, mich bis zu Ende anzuhören, und verspreche auch – wenn so etwas überhaupt möglich ist – nichts über mich beschönigen zu wollen.
Ich bin ein blindgeborener Schriftsteller. Manche Leute sprechen von mir auch als einem Dichter, habe ich doch nebst zwei Romanen auch einen Gedichtband veröffentlicht. Worin liegt bei diesen beiden Worten der Unterschied? Die Franzosen haben keine Hemmungen, von einem Mann, der ein paar Gedichte geschrieben hat, als von einem Dichter zu sprechen. Wir Deutschen legen einem Schriftsteller erst dann den Titel Dichter bei, wenn wir ihn adeln wollen für seine Worte, welche die Saiten unserer Seele anzupfen und darauf Töne voller Gott-Innigkeit zum Erklingen bringen. Wenn ich also dieses zu diktierende Buch späterhin mit der Überschrift Der blinde Dichter versehen möchte, so will ich mich dadurch nicht selbst adeln, sondern vielmehr mein Blindsein als Dichter hervorkehren, denn ein Dichter muss ein Sehender sein. Wie kurzsichtig ich jedoch als ungeadelter Dichter bin, darüber wird meine Beichte genug aussagen.
Dass ich gezwungen bin, meine schriftstellerischen Erzeugnisse auf die Kassette eines Tonbandgeräts zu diktieren, liegt in meinem Blindsein begründet, sehe ich doch nur Schwarz vor mir, da auch das äußere Licht von meinen Augen nicht aufgenommen werden kann. Ich möchte nun nicht meine ganze Geschichte mit meiner geliebten Christiane in althergebrachten Traditionen erzählen, umso etwas wie einen autobiographischen Kurzroman zu verfassen, sondern möchte – um jeglicher Lesemonotonie entgegenzuwirken – die erzählerische Vergangenheitsform hier und dort unterbrechen, um das Vorgefallene in seiner dramatischen Unmittelbarkeit vorzustellen, sodass das Vergangene unvermittelt zur Gegenwart werden kann.
Christiane: Sag mir, mein Liebling, was willst du damit sagen, wenn du an dieser Stelle den Dichter als das Haus des Lebens bezeichnest?
Thomas: Ja, du hast recht. Ich sollte an dieser Stelle ein wenig ausführlicher darauf eingehen, damit der Leser – wenn er weiterliest – nicht festgehalten wird von der Frage: Was meint er mit dem Haus des Lebens?
Christiane: Genau. Der Leser könnte sich auf das weitere, das ihm im Text präsentiert wird, nicht richtig konzentrieren, da er ja noch immer nach der Beantwortung seiner Frage forschen mag.
Thomas: Dichter haben zwar oft die Art, ihren Lesern durch Andeutungen so etwas wie ein Rätsel aufzugeben. Aber sicherlich hast du Recht, dass ich jenen Ausdruck an dieser Stelle klarer ins Licht rücken sollte. Bitte, mein Herzchen, füge also an dieser Stelle Folgendes ein: Der Dichter ist wie der Eigentümer eines Hauses, unter dessen Dach er allen Herberge gewährt, die er in seiner Dichtung zum Leben erwecken möchte. Jeder ist ihm willkommen – mag er nun Mörder, Bettler, Priester, Advokat oder Heiliger oder mag sie Hure, Wäscherin, Krankenschwester, Pilotin oder Gräfin sein. Alle haben unter seinem Dach Platz – ebenso wie eine Glucke ihre Flügel über ihre ganze Brut ausbreitet, ohne die Küken zu bewerten. Ein Dichter darf nicht bewerten. Das Bewerten geschieht durch den Leser. Wenn er, der Dichter, bewertet, wird er trivial, denn er beurteilt oder verurteilt gar.
Erscheinungsformen der menschlichen Seele hat er unvoreingenommen seiner Leserschaft derart darzubieten, wie sie sich darstellen oder von anderen gesehen oder erlebt werden. Der Inhaber dieses Hauses ist an sich neutral, und dieses Haus verschließt sich niemandem, der darin einkehren möchte. Somit ist er, der Dichter, zugleich der Verwalter eines Hauses des Lebens. Er darf keinem, der bei ihm Einlass sucht, die Türe weisen. Doch ihm bleibt es vorbehalten, wem von den Einkehrenden er die unteren Räume oder gar die des Kellers zuweist, und wem er die oberen, besseren Zimmer zugesteht, gar Zimmer mit wundervoller Aussicht, Balkon und Blumen, ja, wem er das Zimmer neben dem seinen unter dem Giebel anvertraut. All dies bleibt seine Entscheidung. Aber ein zu schreibender Roman zieht wie von selbst die nötigen Charaktere an. Sie müssen in dem Haus des Dichters zumindest für die Dauer des Schreibens an einem bestimmten Werk dort Unterkunft finden, egal, welcher edlen oder unedlen Gesinnung jene Romanfiguren anhängen mögen. Doch meistens befinden sich diese geladenen oder auch ungeladenen Gäste schon lange vor ihrer Verdichtung in Worte in jenem Haus, damit ihr Gastgeber genügend Zeit haben möge, all diese Charaktere ausgiebig zu befragen und sie somit ins richtige Bild zu setzen.
Christiane: Das hast du sehr schön formuliert. Jetzt ist der Leser klar informiert, was du mit jenem Ausdruck meinst. Zugleich wird er aber nun beim Weiterlesen eifrig mitverfolgen wollen, welchen Figuren du im Weiteren welches Zimmer in deinem Haus anbieten wirst. Du lässt ihn somit tiefer an der Entstehung des Werkes teilhaben. Ja, du beschäftigst den Leser auf diese Weise. Er ist nicht mehr bloß passiv Verdauender des ihm in Lettern Dargebotenen, nein, er wird zum Detektiv, der dem Aufbau, dem Entstehen und Werden, ja vielleicht sogar der Intention des Romans größere Aufmerksamkeit widmet. Es bereitet ihm große Freude, mitschöpferisch zu lesen.
Thomas: Mein liebes Herzchen – wer bist du, dass du für mich und mein Leben als Dichter das wunderbarste Geschenk des Himmels bist? Weißt du, dass du in den Häusern der in Zusammenarbeit erschaffenen Werke in meinem Giebelzimmer wohnst? Ohne dich hätte ich nicht die Kraft und den Mut, noch irgendetwas zu schreiben. Du bereicherst meine Dichtung. Ja, ich bin davon überzeugt, dass du inspiriert sein musst von irgendwelchen unsichtbaren Genien, die mir durch dich etwas sagen wollen, um meine Werke zu bereichern. Du bist sozusagen ihr Sprachrohr.
Christiane: Ach, geliebter Tomi, sag mir nicht solche Schmeicheleien. Aber ich liebe nun mal deine schriftstellerischen Bemühungen. Und oft sagt mir als deine Leserin der gesunde Menschenverstand, was hier und dort zu verbessern oder zu erweitern wäre. Ich bin nur eine einfache Frau, habe auch keine Literaturwissenschaften studiert, doch schon als junges Mädchen einen Roman nach dem anderen verschlungen. Ja, die Literatur ist die mir nächste Freundin geworden. Ich fühle mich wohl, wenn ich Hand in Hand mit ihr spazieren gehe.
Thomas: Und an der anderen (lachend) hältst du mich, deinen Schriftsteller. Mein Herzchen, du bist so wundervoll romantisch. Ich liebe dich.
Christiane: Ich liebe dich auch, mein Allergeliebtester.
Ich habe dir, geliebter Leser (und in diesen männlichen Substantiv möchte ich dich, geliebte Leserin, mit einschließen, nicht dass ich in irgendeiner Form diskriminierend wäre, ganz im Gegenteil)… um nochmals anzufangen: Ich habe dir, geliebter Leser, noch gar nicht erzählt, dass Christiane und ich uns vor etwa drei Jahren vermählt und daraufhin eine komfortable Dreizimmerwohnung inmitten von Steglitz bezogen haben. In Berlin war ich großgeworden. Dies ist meine Heimatstadt. Christianes Mutter kommt aus dem Sudetenland. Sie selbst ist auch dort gezeugt worden, kam jedoch auf der Flucht nach Sachsen in einem kleinen Dorf in einer Scheune zur Welt. Christiane ist sieben Jahre jünger als ich. Wir lernten uns in dem Blindenvereinsheim im Grunewald, einem vornehmen Villenstadtteil Berlins, kennen.
Ich pflegte dort, in die Auerbacher Straße 7, wenigstens einmal pro Woche mit dem Bus hinzufahren oder, was sehr selten geschah, mich bei Regenwetter auch von einem Taxi hinfahren zu lassen, denn ich traf dort meistens einige Blinde, die ich noch aus meiner Schulzeit oder von anderen gemeinsamen Aufenthalten her kannte. Mit Pedro , so wurde er genannt – vielleicht weil er einst spanische Literatur studiert hatte –, hatte ich früher an der Freien Universität Vorlesungen über Psychologie, Philosophie und die Literatur verschiedener Völker gehört, die meine Neugier geweckt hatten und von denen ich mir für mein Studium der Germanistik eine Bereicherung versprach.
Pedro: Du, Thomas, ich habe mir gestern eine neue Ausgabe von Cervantes Don Quichote in Blindenschrift schicken lassen. Ich habe gleich zu lesen angefangen. Es ist eine ausgezeichnete Übersetzung, auch wenn sie bei weitem nicht an das Original heranreicht.
Thomas: Mensch, das freut mich, dass du dieses Werk in Blindenschrift nun selbst in Besitz hast. Natürlich werde ich es lesen, sobald du damit durch bist. Weißt du schon, wer die neue Vereinsleiterin ist?
Pedro: Ich habe nur gehört, dass sie von drüben gekommen sein soll. (Das Von-Drüben bezieht sich auf den östlichen Teil des von 1949 bis 1989 zweigeteilten Deutschlands.)
Thomas: Schade, dass Frau Rörich bei uns aufhört. Ich habe sie sehr gemocht.
Pedro: Aber sie übernimmt ein Blindenheim in Brandenburg. Das ist eine größere Herausforderung für sie. Man sollte immer mutig genug sein, die neuen Herausforderungen anzunehmen, denn wir wachsen in und mit den Aufgaben.
Thomas: Genau. Wer nicht bereit ist, neue Herausforderungen, die das Leben häufig an uns stellt, anzunehmen, kann seelisch und geistig nicht wachsen und stagniert vor allem spirituell. Gleich soll uns die Neue vorgestellt werden. Ich bin gespannt, wer sie ist. Doch irgendetwas sagt mir, dass sie ein bedeutsamer Mensch ist.
Frau Rörich: Liebe Mitglieder und liebe Freunde unseres Blindenvereins! Wie Sie wissen und ihr alle wisst, habe ich unser heutiges Treffen mit meiner Abschiedsfeier verbunden. Alle zwölf Jahre, die ich bei Ihnen und euch sein durfte, waren mir eine große Freude, trotz gewisser Probleme und Unstimmigkeiten, die wir aber – so hoffe ich doch – immer zur Zufriedenheit der Betroffenen gelöst haben dürften. Ich habe von Ihnen und euch allen viel, viel lernen dürfen. Sie und ihr waren und wart oft ein Vorbild an Geduld für mich. Und oft waren Sie und ihr meine Lehrmeister. Sie und ihr haben oft auf Dinge wie aus der Ferne geschaut und mir dadurch Probleme als relativ erscheinen lassen, sodass diese plötzlich viel kleiner geworden waren. Das Wissen und die Liebe, die ich hier empfangen habe, nehme ich jetzt mit nach Beelitz, wo mir die Leitung einer größeren Abteilung eines Blindenheims angeboten worden ist. Sie und ihr – wenn ich das so sagen darf – sind und bleiben meinem Herzen immer nah, denn ich bin durch Ihre und eure Liebe reich beschenkt worden und nehme dieses Geschenk als mein kostbarstes Gut zu meiner neuen Wirkungsstätte mit. Ich danke Ihnen und euch allen für dieses Geschenk. Aber ich habe für Sie und für euch ebenfalls ein wundervolles Geschenk, mit dem ich nun alle bekanntmachen möchte. Ich darf nun meine Nachfolgerin Frau Christiane Fuchs vorstellen. (Händeklatschen) Sie wird sicherlich gleich ein paar Worte zu Ihnen und euch sprechen wollen. Ich, meine Lieben, sage Ihnen und euch nochmals herzlichen Dank für alles, was ich von allen empfangen habe – und wenn ihr irgendwann einmal nicht mehr auf eigenen Füßen stehen könnt und einem Heim zugewiesen werden sollt, dann denkt daran, dass eure Ella Rörich für euch in Beelitz immer ein Bett zur Verfügung stehen hat. Alles Gute für Sie und euch alle. (Verstärkter Beifall)
Frau Fuchs: Liebe Mitglieder und Freunde des Blindenvereins! Ich bin bestimmt keine so geschickte Rednerin wie Ihre Frau Rörich, die, so scheint mir, das Herz auf dem rechten Fleck hat. Ich bin schon als Kind mit einem Blinden in Berührung gekommen, denn mein Onkel ist im Krieg erblindet. Meine Mutter nahm ihn zu sich, sodass ich schon früh lernte, ihn durch die Stadt und auch aufs Land zu führen. Ich musste ihm alles beschreiben, wie viele Korn- oder Mohnblumen im Feld oder am Wegrand zu sehen waren oder wie der Himmel gerade aussah. Über alles wollte er bis ins kleinste Bescheid wissen. Und ich bin dadurch dazu erzogen worden, mir die Dinge genauer anzusehen. Ja, durch einen Blinden bin ich sehender geworden. Und somit freu ich mich, bei Ihnen sein zu dürfen, denn ich weiß, dass ich in meinem Sehen – mit den Augen und dem Herzen – von Ihnen weiter bereichert werde. Ich freue mich auf unser Zusammenwirken. Und ich wünsche Ihnen heute noch viel Freude bei dieser Abschiedsfeier von Frau Rörich. (Großer Beifall durch Händeklatschen)
Wir hatten nach dieser Rede gleich über die Neue zu tuscheln begonnen. Wer ist sie eigentlich genauer? Wo hat sie sich für die Blindenarbeit qualifiziert? Aber sicherlich hat sie alles Nötige schon durch ihren Onkel gelernt. Ja, wir werden uns gewiss gut verstehen. Sie hat eine angenehme Stimme. Sie sprach so ganz von Herzen.
Ich glaube sagen zu dürfen, dass wir angenehm überrascht waren.
Pedro: Wie stellst du dir vor, wie sie wohl aussieht?
Thomas: Ich habe das Gefühl, dass sie eine sehr attraktive Frau sein muss. Darüber hinaus spricht aus ihr solch eine angenehme Natürlichkeit und Menschenliebe. Solch eine Frau kann einfach nur schön sein.
Pedro: Ja, ich stimme dir zu. Wir sind ja alle blinde Don Quichotes, und jede Dulcinea – und sei sie noch so hässlich – wird uns zur zweiten Helena. (Frau Rörich nähert sich mit Frau Fuchs den beiden Sitzenden.)
Frau Rörich: Und dies, liebe Frau Fuchs, ist Herr Franz Laub, genannt Pedro. Er hat Romanistik studiert und wird hin und wieder als Dolmetscher für Spanisch und Französisch eingestellt. Pedro, darf ich Ihnen Frau Fuchs vorstellen?
(Pedros Stuhl wird bei seinem Aufstehen etwas nach hinten geschoben. Beide geben sich die Hand und tauschen sehr erfreut, „ganz meinerseits“ aus.)
Frau Rörich: Und dies ist unser Dichter, Herr Thomas Moosmann. Darf ich Ihnen Frau Fuchs vorstellen?
(Thomas steht ebenfalls auf und gibt der neuen Leiterin unter Anwendung der höflichen Begrüßungsfloskeln die Hand.)
Frau Fuchs: Sie sind Dichter? Das ist ja interessant. Was haben Sie denn schon geschrieben?
Frau Rörich: Oh, er ist ein beliebter Schriftsteller. Zwei Romane sind schon als Taschenbuch im Buchhandel erschienen. Auch ein Gedichtband ist veröffentlicht. Er ist schon ein bekannter Dichter.
Thomas: Liebe Frau Rörich, Sie übertreiben gewaltig. Meine Dichtkunst – wenn ich von einer solchen überhaupt reden darf – ist ganz bescheiden. Ich versuche den Lesern vorzustellen, wie man als Sehender die meisten Dinge nicht sieht – oft auch die wesentlichen Dinge, da das Überangebot an zu Betrachtendem automatisch eine Auswahl erfordert, die von den meisten Menschen nach dem Diktat ihrer Bequemlichkeit und ihres Sich-gehen-Lassens getroffen wird. Ich möchte einfach den Lesern vermitteln, die wertvollen Dinge des Lebens in Augenschein zu nehmen, und somit ihr Leben qualitativ verbessern helfen.
Frau Fuchs: Ja, das vermag nur ein blinder Dichter den Menschen zu sagen. Sind ihre Bücher in der Blindenbibliothek vorrätig?
Frau Rörich: Aber freilich doch. Alle zwei Romane gibt es sogar schon in Blindenschrift. Ich zeige sie Ihnen nachher.
Frau Fuchs: Das freut mich, mich mit einem Schriftsteller unterhalten zu können. Ich werde gleich heute noch einen Ihrer Romane ausleihen und ihn heute Nacht zu lesen beginnen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier bei uns sind. (Nachdem beide gegangen sind:)
Pedro: Die hätte dich ja am liebsten gleich abgeküsst. Heute Nacht wirst du von ihr verschlungen werden.
Thomas (lachend): Ich bin doch nicht mein Roman. Zwischen dem Werk eines Dichters und dem Dichter selbst klaffen ja oft ungeheure Weiten. Oft legt der Dichter seine Sehnsüchte und Ideale in sein Werk, und der Leser oder die Leserin setzt diese, wenn sie mit den eigenen Sehnsüchten und Idealen übereinstimmen sollten, mit dem Dichter gleich. Er ist dann das Idol, in welchem sich alle reizvollen Vorstellungen verschmelzen.
Pedro: Ich mache mit dir jede Wette, dass du ihr Idol wirst.
Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, dass Pedro Recht behalten sollte.
Als ich mich am kommenden Mittwochnachmittag wieder im Blindenvereinsheim einfand, um dort den Nachmittagskaffee und das Abendbrot einzunehmen, begab ich mich in den Aufenthaltsraum, setzte mich wie üblich zuerst in jene Ecke, in der die Zeitschriften für Blinde auslagen, und vertiefte mich alsbald in einen literarischen Artikel, dessen gepunktete Buchstabensymbole ich mit Hilfe meiner Fingerkuppen im Eiltempo überflog. Unsere Bedienstete, die wir immer nur Emma nannten, servierte mir auf Wunsch meinen Tee und ein Stück Kuchen und stellte beides vor mich auf ein Tischchen. Nachher würde ich mich wieder mit Pedro unterhalten, der immer erst kurz vor dem Abendessen ankam. Oder ich würde mir vorher noch eine Symphonie über Kopfhörer zu Gehör bringen, oder es würde sich eventuell mit jemandem ein Gespräch ergeben. Wenn ich hierher kam, wollte ich eigentlich nichts weiter, als mich meiner kleinen Zweizimmerwohnung in Friedenau zu entziehen und mich zerstreuen beziehungsweise zerstreuen lassen. Und Pedro war ein interessanter Zerstreuer, der es immer wieder verstand, mir so ganz nebenbei neue Impulse zu geben, die mich anspornten, am nächsten Tag meine schriftstellerische Arbeit umso eifriger fortzusetzen. Ach, es war so unbefriedigend, alles erst auf Band zu sprechen und dann beim Abhören nicht gleich korrigierend eingreifen zu können, sondern warten zu müssen, bis meine Sekretärin alles in Blindenschrift abgetippt hatte, und dann erst Korrekturen anbringen oder Änderungen einfügen zu können. Alles war so umständlich und nahm mir bei meinem Schaffen oft den Elan. Als ich mich wieder in jenen Geburtstagsartikel über Goethe vertieft hatte, sprach mich plötzlich eine Stimme an.
Frau Fuchs: Wie schön, dass ich Sie, lieber Herr Moosmann, hier allein antreffe. Ich habe in der vergangenen Woche Ihre zwei Romane und auch Ihren Lyrikband gelesen. Sie sind wirklich ein Dichter. Und ich schätze mich darum besonders glücklich, Sie bei uns sehen zu dürfen.
Thomas: Was hat Ihnen denn am besten gefallen, Frau Fuchs?
Frau Fuchs: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Denn alles, wirklich alles, hat mich tief angesprochen oder sogar zu Tränen gerührt. Und oft musste ich wieder lachen über Ihren Humor und Ihre mit liebevollen Augen betrachtende Ironie. Am meisten erstaunt, ja verblüfft war ich über Ihre farbigen Landschaftsbeschreibungen. Sie sind doch, wie mir Frau Rörich sagte, blind geboren. Wie können Sie derartig treffend farbige Landschaftsbilder beschreiben? Wie ist das möglich? Woher wissen Sie, wie Rot aussieht?
Thomas: Ich habe viel gelesen. Wenn Dichter wie Jean Paul oder Adalbert Stifter einen Sonnenauf- oder untergang beschreiben, dann kann ich ihn mir genau vorstellen, denn ich gehöre zu jenen Blinden, die sich Bilder sehr gut ausmalen können. Wenn Novalis von der Blauen Blume spricht, dann sehe ich sie genau vor mir. Sie hat dann das Blaugemisch eines Enzians und einer Kornblume. Ich weiß also genau, wie ein Sonnenuntergang aussieht, und könnte tausend verschiedene Sonnenuntergänge genauestens beschreiben.
Frau Fuchs: Gut, das kann ich einsehen. Aber es könnte doch sein, dass Sie für sich das Rot der Sehenden zu Ihrem Blau kreiert haben und somit nicht wie wir einen roten, sondern einen blauen Sonnenuntergang – vielleicht auf gelbem Hintergrund – sehen?
Thomas: Im Grunde ist es egal, wie die Wirklichkeit wirklich ist, denn wir Menschen nehmen sie sowieso ganz anders wahr. Deshalb ist es auch egal, ob meine Farben tatsächlich die Farben der Sehenden sind. Aber – ich weiß auch nicht woher – ich bin überzeugt, dass meine Farbvorstellungen denen zumindest ähnlich sind, welche die Sehenden wahrnehmen.
Frau Fuchs: Ich könnte schwören, dass schon aufgrund Ihrer farbigen Naturschilderungen keiner Ihrer Leser – es sei denn, er weiß, dass Sie blind sind – je auf die Idee käme, der Autor habe jene farbigen Naturspektakel nie gesehen, ja jene Farben, über die er schreibt, überhaupt noch nie wahrgenommen. Darf ich fragen, woran Sie jetzt schreiben oder zu schreiben vorhaben?
Thomas: Ich arbeite an einem Drama.
Frau Fuchs: Das klingt ja ganz aufregend. Sicherlich eine ganz neue Art Ihres Schriftstellertums?
Thomas: Ja, ganz gewiss. Es gilt, Geschichtliches als ewig Daseiendes, also auch zur Gegenwart Gehöriges, den Zuschauern als etwas zu veranschaulichen, das sie unmittelbar anspricht. Es geht um Vergegenwärtigung dessen, was durch die Zeit von uns abgespalten und vergessen wird. Und man weiß als Dramatiker nie, wie ein Publikum diese Vergegenwärtigung verinnerlichen kann. Ein Drama ist immer schwieriger zu schaffen als ein Roman, da man bei letzterem das Historische als Historisches in der Vergangenheitsform stehen lassen kann, das vom Leser, so wie es ist, angenommen oder abgelehnt wird. Doch beim Drama muss es gelingen, den Zuschauer in jene Zeit zu versetzten, vielmehr die Vergangenheit mittels der Gegenwartsform in die Gegenwart zu verwandeln. Man muss ihn, den Leser, als unmittelbaren Zeugen dabei sein lassen. Doch er darf sich dadurch nicht entfremdet oder gar verloren fühlen dürfen. Dies ist die Kunst eines Dramatikers – den Zuschauer als verzauberten Zeugen mit Interesse am Vorgeführten teilhaben zu lassen, wobei das ewig Wahre zeitlos in ihn hineingreift und in ihm seine eigenen ähnlichen Veranlagungen oder Träume gleichsam als Wiedererkennungsaspekte zum Schwingen bringt.
Frau Fuchs: Von welcher Person oder welcher Zeit handelt Ihr geplantes Drama?
Thomas: Im Mittelpunkt steht ein römischer Kaiser, der auf dem Höhepunkt seiner Macht während eines Feldzuges gegen die Perser von diesen in eine Falle gelockt und gefangengenommen wird. Sein Gegner, der Schah, benutzt dabei sogar seinen Rücken als Steigbügel, um auf sein Pferd zu steigen. Der damals mächtigste Herrscher der Welt erlebt den Sturz in das Gegenteil. Wie er mit diesem Gegenteil fertig wird, wie er sich gegen dieses Schicksal sträubt und es schließlich doch annimmt, soll in jenem Drama gezeigt werden.
Frau Fuchs: Das klingt ja hochdramatisch, ja, ein wirklicher Festschmaus für Theaterbesucher. Wie kommen Sie mit Ihrer Arbeit voran?
Thomas: Ja, daran krankt es im Moment. Wenn ich früher für meine beiden Romane geschichtliche Zusammenhänge oder Fakten recherchieren musste, wandte ich mich per Anschlag an einen hilfsbereiten Studenten oder eine Studentin, die gegen Bezahlung für mich die Quellen studierten und mir vortrugen, aus denen ich dann das Nötige herausfiltern konnte. Doch bei der jetzigen Quellensuche ist es schwierig. Ich müsste unter anderem jene Zeit im größeren Zusammenhang erfassen und mir vielleicht viele hundert Seiten aus Quellen vorlesen lassen. Und dazu fehlt es mir – offen gesagt – an Geld.
Frau Fuchs: Wissen Sie, wenn Sie jemanden benötigen, der Ihnen unentgeltlich bei diesen Recherchen zur Hand geht, dann stelle ich mich gern dafür zur Verfügung. Ich habe, da ich an den Wochenenden immer hier zu sein habe, den jeweiligen ganzen Montag und Dienstag frei. Es wäre mir wirklich eine Freude, Ihnen bei den weiteren Recherchen helfen zu dürfen. Bitte, nehmen Sie mein Angebot an. Sie würden mir dadurch eine ganz besondere Freude bereiten.
Thomas: Aber liebe Frau Fuchs, so leicht ist das doch gar nicht. Ich muss nach Büchern fahnden und sie mir eventuell von entlegenen Bibliotheken kommen lassen.
Frau Fuchs: Ich bin fest davon überzeugt, dass ich Ihnen dabei bestens behilflich sein kann. Es ist mir eine Ehre, einem Dichter bei der Erschaffung seiner Werke meine bescheidenen Dienste zur Verfügung stellen zu dürfen. Wollen wir uns also Montag treffen? Soll ich – sagen wir – um zehn Uhr vormittags bei Ihnen sein?
Thomas: Ja, versuchen wir s. Ich freue mich auf Ihr Kommen.
Und sie kam. Ich will die vielen Dinge, die sich ereigneten, ein wenig zusammenfassen, um dich, lieber Leser, nicht zu weit vom Kern dieses Buches hinwegzuführen, denn zur Spitze eines Romanberges kann man mehrere Wege einschlagen. Man kann den bequemen Weg für alte Leute wählen, oder aber einen solchen Pfad, den abenteuerlustige Jugendliche gelegentlich gern als Abkürzung einschlagen, auch wenn dieser sie durch Gestrüpp und über klobiges Gestein kriechen oder klettern lässt. Christiane war das reinste Gottesgeschenk für mich. Sie hatte sich in den Büchereien schnell in die Kataloge hineingelesen und wusste bald, wie man etwas zu finden oder wen man nach etwas zu fragen hatte. Sie gab die von mir gewünschten Bücher als Bestellung auf, holte sie sogar für mich ab, und in den ersten zwei Monaten war sie an jedem Montag und Dienstag pünktlich um zehn Uhr bei mir und blieb manches Mal sogar bis zu später Stunde, weil sie mir das eine oder andere Buch oder einen Zeitschriftenbeitrag noch zu Ende lesen wollte.
Christiane: Wissen Sie, lieber Herr Moosmann, mir macht meine Mithilfe bei Ihrem kreativen Wirken so viel Freude, dass ich mir überlegt habe, einen Computerkurs zu besuchen und mich darin so weit zu perfektionieren, dass Sie mir all Ihre Werke direkt in den Computer diktieren können. Ich kann Ihnen dann vom Bildschirm den Text wieder vorlesen, sodass ich gleich an Ort und Stelle Ihre Berichtigungen eingeben kann. Ich glaube, dass Ihnen solch eine Zusammenarbeit viel Mühe ersparen dürfte.
Thomas: Das ist natürlich wahr. Sie wollen wirklich…?
Frau Fuchs: Ja, sogar mit großer Freude. Und die Kurse möchte ich auch von meinem Geld bezahlen.
Thomas: Nein, nein. Das kommt auf keinen Fall in Frage. Die bezahle ich auf jeden Fall für Sie.
Und schon am nächsten Tag meldete sie sich zu zwei, montags und dienstags stattfindenden, Abendlehrgängen an, die sich über einige Wochen hinstrecken sollten. Mich selbst brachte sie dazu, im Blindenvereinsheim aus meinen Büchern vorzulesen, was ich nur mit Zögern tat, wollte ich doch nicht vor meinen Mitblinden als etwas Besonderes dastehen. Doch Frau Fuchs redete mit solch überzeugender Liebenswürdigkeit auf mich ein, sprach auch davon, dass gerade eines blinden Dichters Wort den anderen Blinden sehr viel Mut und Selbstvertrauen einzuflößen vermöge, dass ich mich ihrem Andringen schließlich nicht weiterhin entziehen konnte und in der Folge jeden zweiten Mittwochabend im Blindenvereinsheim eine Lesung aus meinem Werk abhielt.
Jeder in unserem Verein war von Frau Fuchs positiv eingenommen. Sie war ein richtiger Engel, ein Engel, der nicht nur mit Liebe sprach, sondern Liebestaten vollbrachte. Sie verstand es, mit uns Spiele zu veranstalten, welche uns, während wir angefasst im Kreise standen, oft derart erheiterten, dass bei manchen vor Lachen die Wangen von Tränen genässt wurden. Ja, solche habe ich nicht nur bei mir gespürt, sondern auch, wenn wir Blinden uns hin und wieder gegenseitig das Gesicht berühren sollten, um unsere Züge mit den Händen zu ertasten. Frau Fuchs brachte uns alle näher zusammen. Wir wurden zum ersten Mal eine Familie, wenn ich das so sagen darf. Auch behandelte sie uns wie Sehende. So wurden Blumensträuße auf die Tische gestellt, was es noch nie zuvor gegeben hatte, denn wir konnten sie ja nicht sehen. Doch jetzt befühlten wir die Blumen, errieten oft ihre Namen und ihre Farben. Und vor allem rochen wir an den Blüten. Für mich war es jetzt immer eine ganz besondere Freude, an den Mittwochnachmittagen im Blindenvereinsheim zu erscheinen.
Ja, Frau Fuchs hatte auch bei mir in der Wohnung viel verändert. Auch dort kamen bald Blumen in Vasen zu stehen, die sie jeden Montagoder Dienstagmorgen mitbrachte. Da ich einmal in der Woche eine Polin kommen lassen konnte, die mir die Wohnung säuberte und auch für den betreffenden Tag mein Essen bereitete, meinte ich sagen zu dürfen, dass bei mir eigentlich alles aufgeräumt aussehen sollte. Doch Frau Fuchs meinte, meine Tischdecke sei zerschlissen, sie würde mir eine der ihrigen, die sie nicht mehr benötigte, bringen. Und so wurde mit der Zeit auch das eine oder andere ausgetauscht, ja, meine Wohnung, ohne dass ich es sehen konnte, erneuerte sich. Sie, die liebe Frau Fuchs, überzeugte mich gar davon, meine Küche neu streichen zu lassen und auch das Wohnzimmer neu zu tapezieren. Ich weigerte mich und wies auf die Kosten hin. Doch was machte Frau Fuchs? Sie überredete die Polin, mit ihr zusammen all die Verschönerungen in meiner Wohnung vorzunehmen.
Auch ich veränderte mich. Ich hatte plötzlich einen anderen Anstrich. Frau Fuchs ging mit mir eine neue Krawatte, neue Schuhe und einen neuen Hut kaufen. Sie sagte mir auch, in welchem meiner Anzüge ich am besten aussähe, ging mit mir gar zum Friseur und gab ihm Anweisung, welche neue Frisur mir zu geben sei. Und wenn ich an den Mittwochnachmittagen jeweils ins Blindenvereinsheim kam, hatte ich mich bewusst schick angezogen, also etwas getan, woran ich früher bei solchen Besuchen nie gedacht hatte. Ja, vielleicht wollte ich Frau Fuchs imponieren. War ich damals schon in sie verliebt? Ja, natürlich. Aber ich wagte es mir nicht einzugestehen. Wie sah sie wohl aus? Pedro erzählte mir, dass er gehört habe, dass sie eine kleine Warze auf der Nase hätte. Er meinte, dass das sicherlich ein Schönheitsfleck sei, den sich andere Frauen gelegentlich als zusätzlichen Attraktionspunkt sonst wo im Gesicht anbringen ließen, um eben damit das besonders Schöne im Gesichtsfeld noch mehr hervorzukehren. Frau Fuchs hatte also von Natur aus einen Schönheitsfleck. Ja, ich ertappte mich in Gedanken schon dabei, diesen zu berühren – und (ich habe ja versprochen, ganz ehrlich zu sein) ich hatte ihn auch schon in meiner Phantasie geküsst. Wenn sie mich fragen würde, ob ich sie zu meiner Frau nehmen wollte, würde ich sofort ja sagen. Sie scheint alle meine Gedanken zu erraten. Wünschte ich mir, dass noch mehr Milch im Kaffee sein sollte, fragte sie mich im gleichen Augenblick: Möchten Sie vielleicht noch ein bisschen mehr Milch in den Kaffee? Dachte ich daran, für unseren Gang zur Bibliothek festeres Schuhwerk anzuziehen, da ich soeben gehört hatte, dass es gerade zu regnen begonnen hatte, bemerkte sie in ebendemselben Augenblick: Herr Moosmann, ziehen Sie lieber Ihre braunen Schuhe an, die sind regenresistenter. Ja, sie konnte wahrhaftig Gedanken lesen, das heißt meine Gedanken. Ob sie diese Fähigkeit auch anderen Menschen gegenüber besaß, konnte ich damals noch nicht feststellen.
Als wir nach etwa dreieinhalb Monaten unseres Zusammenwirkens an einem Dienstagnachmittag beim Tee zusammensaßen, spielte sich folgende Szene ab.
Frau Fuchs: Herr Moosmann, haben Sie sich schon einmal in eine Frau verliebt?
Thomas: Ich denke, dass sich alle blinden Männer schon in mehrere Frauen heimlich verliebt haben dürften. Aber man wagt nicht, einer Sehenden seine Liebe zu gestehen aus Angst, vielleicht nicht ernst genommen zu werden. Denn wer von den Sehenden würde schon gerne einen blinden Freund, Liebhaber oder Ehemann haben?
Frau Fuchs: Dabei sollten sich Frauen glücklich schätzen, einen Blinden heiraten zu dürfen. Denn ein Blinder ist als Ehepartner hundertprozentig treu. Die meisten Ehen der Sehenden beschwören Unsicherheiten herauf, Eifersüchteleien, Unfriede, Drohungen, Ehestreit und oft auch die Scheidung wegen Untreue. Die eigentlichste Rolle der Frau besteht in dem Sichhingeben, ja in dem Aufgehen im anderen, in dem aus Liebe Sichübereignen. Wo könnte eine liebevermögende Frau besser diese Rolle ausfüllen, als an der Seite eines geliebten Mannes, der diese Liebe als ein kostbares Gut zu schätzen und zu erwidern weiß? Haben Sie noch bei keiner Frau gewusst: Die möchte ich gerne als Gattin haben?
Thomas: Eigentlich noch nicht. Das heißt…
Frau Fuchs: Das heißt…? Es gibt also doch jemanden, den Sie zur Frau erwählt hätten, wäre die Sache ausgesprochen und von ihrer Seite akzeptiert worden? Nicht wahr?
Thomas: Ich bin mir noch zu unklar, da… Nun ja, sprechen wir von etwas anderem. Sie hat doch hoffentlich nicht bemerkt, dass ich dabei an sie gedacht habe.
Frau Fuchs: Nun, ich werde nun meine Arbeit fortsetzen.
Auch ein Blinder sollte den Mut zum Wagnis haben. Wenn er jemanden liebt, dann möge er es auch aussprechen. Herzensweh geschieht häufig durch Dinge, die nicht ausgesprochen werden. Die oft unberechtigte Angst vor einer möglichen Niederlage hindert uns daran, etwas zu wagen. Ich wünschte, mehr Menschen würden mehr Mut aufbringen und immer wieder ein Wagnis eingehen, wenn es sie innerlich dazu drängt.
Auf dem Boden und auf dem Tisch stehen Tassen, Teller, Terrinen, Pfannen, die Frau Fuchs aus dem Küchenschrank herausgenommen hat, um sie, wie sie sagt, neu und übersichtlicher zu ordnen. Sie steigt auf einen Stuhl, um etwas ins oberste Fach zurückzustellen, verliert dabei die Balance und fällt auf den Boden.
Frau Fuchs: Au! Au! Mein Kopf!
Thomas: Was ist los? (Eilt herbei)
Frau Fuchs: Vorsicht! Das Porzellan auf dem Boden!
Thomas tritt auf eine Untertasse, die zerspringt, verliert, da er seinen Fuß noch schnell wegsetzen will, die Balance, versucht sich am Tisch festzuhalten, fasst aber indessen in eine dort befindliche Terrine, schwankt und fällt mit der Stirn schließlich in die am Boden aufgestellten Weingläser.
Thomas: Au!
Frau Fuchs: Ist was passiert? Bleiben Sie liegen. Ich helfe Ihnen gleich beim Aufstehen. Sie bluten ja heftig an der Stirn. Es steckt sogar noch ein Glassplitter darin. Kommen Sie, ich bringe Sie ins Wohnzimmer… Legen Sie sich aufs Sofa. Ich hole schnell den Verbandskasten.… (Zurückkehrend) Ich wische Ihnen erst einmal das Blut von der Stirn.
Thomas: Haben sie sich denn vorhin nicht selbst sehr wehgetan?
Frau Fuchs: Ich bin beim Herunterfallen mit meiner Hüfte an die Kante des Küchenschranks geraten. Es tut da noch weh. Aber Ihre Wunde ist viel schlimmer. Der Splitter ist nicht groß. Ich hole ihn nun mit der Pinzette heraus. Es wird vielleicht etwas wehtun… So, das wär‘s. Hat es wehgetan?
Thomas: Nein, kaum der Rede wert.
Frau Fuchs: Die Schnittwunde ist etwas größer, aber gottseidank nicht tief. Doch sie blutet noch weiter. Ich mache Ihnen einen Stirnverband. Genäht muss nicht werden. Wir können uns einen Arzt sparen… Haben Sie sich sonst noch wehgetan?
Thomas: Mein Handgelenk schmerzt ein wenig.
Frau Fuchs: Gleich, wenn ich mit dem Verbinden fertig bin, zeigen Sie mir Ihr Handgelenk… Welches Handgelenk ist es denn?
Thomas: Das linke.
Frau Fuchs (nimmt dieses zwischen ihre Hände): Ich umschließe jetzt mit meinen Händen Ihr Handgelenk und sende dort Heilstrahlungen hinein, denn das hilft in solchen Fällen prompt, wie ja auch Mütter in das angestoßene Knie des Kindes die aus ihren Händen strömende Heilkraft einfließen lassen… Nun, haben die Schmerzen schon abgenommen?
Thomas: Ja, tatsächlich. Vielleicht beruht das aber nur auf Suggestion.
Frau Fuchs: Die Ausstrahlung von Heilenergie hat am wenigsten mit Suggestion zu tun, denn sie wirkt zum Beispiel auch bei Schlafenden. Und nun lege ich meine Hände noch über Ihre Stirn. Auch das beschleunigt den Heilungsprozess.
Thomas: Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Fuchs. Sie sind eine bewunderungswürdige Frau. Was können Sie eigentlich nicht?
Frau Fuchs: Ich kann zum Beispiel einem anderen nicht sein Glück aufzwingen.
Thomas: Glauben Sie, dass auch meine Hände Heilkräfte haben?
Frau Fuchs: Ja, natürlich. Sie sollten es einmal ausprobieren. Haben Sie Mut dazu.
Thomas: Welche Hüftseite schmerzt Sie denn?
Frau Fuchs: Die linke.
Thomas: Können Sie sich jetzt nicht auf das Sofa legen, damit ich Ihnen dort die Hände auflege?
Frau Fuchs: Nein, nein. Sie müssen jetzt liegenbleiben.
Thomas: Doch, doch (aufstehend). Sie legen sich jetzt dort hin… Zeigen Sie mir jetzt Ihre Schmerzstelle.
Frau Fuchs: Hier, an dieser Stelle.
Thomas: Soll ich die Hände drauflegen oder darüber halten?
Frau Fuchs: Das ist oft verschieden. Lassen Sie sich von Ihrer Intuition leiten.
Thomas: Fühlen Sie irgendetwas? Jetzt berühren meine Finger sie zum ersten Mal, von jenem üblichen Händeschütteln abgesehen. Nein, sie ist nicht fett. Sie muss einen sehr schönen Körper haben.
Frau Fuchs: Ich fühle eine angenehme Wärme. Ich glaube, Sie sind ein geborener Heiler. Ja, meine Schmerzen sind fast ganz weg. Darf ich Ihre Hände nehmen. Dies sind begnadete, heilende Hände. Darf ich sie küssen? (Seine Hände küssend) Ja, wenn ich einmal krank werden sollte, dann werde ich Sie bitten, zu mir zu kommen, um Ihre Hände auf mich zu legen. Würden Sie mir versprechen, mir in solch einem Falle den Segen Ihrer heilenden Hände zuteil werden zu lassen?
Thomas: Ja, Frau Fuchs, das verspreche ich Ihnen hoch und heilig. Denn ich liebe Sie.
Frau Fuchs: Sagen Sie das Letzte nochmals.
Thomas: Christiane, ich liebe dich. Willst du meine Frau werden?
Frau Fuchs: Ja, ich will. (Sie küssen sich)… Ich wusste schon im ersten Augenblick, als ich dich sah, dass du mein Mann bist, auf den ich schon so lange gewartet habe. Ich hab dich sofort geliebt.
Thomas: Wie konntest du wissen, dass ich dein Mann sein werde?
Christiane: Als ob eine innere Stimme, vielleicht auch meine innere Sehnsucht nach Erfüllung, gesprochen hätte. Ich wusste es auf einmal, als ob gesagt worden wäre: Und dies ist dein Mann.
Und wir küssten uns wieder. Meine Lippen fanden auch jene Nasenwarze, und ich küsste sie. Ja, auch in Zukunft ließ ich bei meinen Küssen nie diese Stelle aus. Ich sehnte mich sogar schon danach, diese wieder küssen zu können. Natürlich war mir ihr Gesicht schon bald sehr vertraut, hatte ich es doch nicht nur mit meinen Lippen, sondern auch mit meinen Händen erfühlt. Ja, sie war eine schöne Frau. Und dann kam auch schon bald unsere erste gemeinsame Nacht, und zwar bei ihr zu Hause, in ihrem Einzimmerappartement, das von nun ab vorerst mein zweites Zuhause werden sollte. Ich ertastete und küsste ihren ganzen Körper. Sie hatte einen wunderschönen Busen, ähnlich dem jener marmornen griechischen Helena, die ich im Atelier eines Bildhauers auf seine Erlaubnis hin ertasten durfte. Christianes Hüften, ihr Schoß, ihre Beine, ihre Füße, alles war so geheimnisvoll schön und wonnevoll. Ja, meine Glücksgefühle beim ersten in ihren Schoß ergossenen Samen waren – das möchte ich dir, lieber Leser, unumwunden gestehen – das Schönste, das Herrlichste, das alles Erträumte in den Schatten stellende Erlebnis meines bisherigen Blindendaseins gewesen.
Unsere schon vier Wochen später erfolgte Hochzeitsfeier vom November 1990 fand unmittelbar nach der kirchlichen Eheschließung – die staatliche Trauung war schon tags zuvor geschehen – in unserem Blindenvereinsheim statt. Diese Feier, an der alle Mitglieder und persönlichen Freunde teilnahmen, kostete die Hälfte meiner Ersparnisse. Aber Christiane sagte mir, dass wir, da wir anstatt in zwei von nun ab nur in einer Wohnung wohnen würden, viele Kosten einsparen könnten, sodass das Konto bald wieder aufgefüllt sein würde. Und es kamen viele meiner blinden Freunde und gratulierten mir. Sie freuten sich so sehr mit mir, dass ich eine solch herrliche Frau heiraten konnte. Und einer sagte: Ja, Dichter müsste man sein.
Pedro: Thomas, lass dich umarmen: Du bist ein wahrer Glückspilz. Eine so wunderbare und schöne Frau heiraten zu dürfen, geht nicht nur über alle Begriffe eines Blinden, nein, auch jeder Sehende würde, nein, müsste der glücklichste Mann der Welt sein.
Thomas: Ich danke dir, mein Freund. Ja, ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ich könnte mir kein größeres Glück vorstellen. Jetzt kann ich auch in meinen Romanen aus eigener Erfahrung über Liebesdinge schreiben, die bisher nur nachempfunden, nein, nur ausgedacht gewesen waren.
Pedro: Ja, der Ritter Don Quichote ist von seiner Rosinante abgestiegen und hat Dulcinea, das Weib seiner Träume, fleischlich genommen. Du bist wenigstens in jener Beziehung von einem Blinden zu einem Wissenden geworden.
Thomas: Und zu einem Genießenden. Die sexuelle Begegnung, lieber Pedro, ist die Wonne der Wonnen. Du hast, wie du mir sagtest, bisher nur mit zwei Prostituierten geschlafen. Ich habe es nur einmal versucht. Und in meiner Aufregung hat auch alles nicht geklappt. Aber mit jemandem zu schlafen, den man liebt und von dem man geliebt wird, ist unbeschreiblich. Selbst ein Schriftsteller ist bei einer solchen Beschreibung hilflos in seiner Wortwahl.
Pedro: Wie groß ist ihr Schönheitsfleck?
Thomas: So groß wie der Kopf einer Stecknadel. Ich liebe diese kleine Warze auf ihrem Nasenflügel.
Pedro: Hast du schon bemerkt, dass sie beim Sprechen manchmal kleine feuchte Spritzer aussendet?
Thomas: Ja, oft. Ich nehme sie an wie ausgesendete Küsse. Ich wünschte, lieber Pedro, diese Frau gäbe es noch einmal. Dann würde ich versuchen, euch zwei zu verkuppeln.
Pedro: Thomas, ich freue mich über euer Glück. Möge es euch erhalten bleiben.
Über unser Eheleben zu berichten, fällt mir nicht schwer, gab es doch nie – ich möchte betonen – nie irgendeine Unstimmigkeit. Sie erriet meine Wünsche. Sie überhäufte mich mit Liebenswürdigkeiten. Sie brachte neuen Lesestoff herbei – meist Romane, den sie mir zu meinem größten Vergnügen vorlas. Sie besorgte mir Schallplatten oder Kassetten aus der Ausleihbibliothek, vor allem solche, auf denen gesprochen wurde, sodass ich zum Beispiel Thomas Mann und Hermann Hesse direkt mit ihrer eigenen Stimme hören durfte. Oft las sie mir Gedichte vor. Wir sprachen dann darüber, und sie wusste so Vortreffliches darüber zu bemerken, dass ich – ich muss es dir, lieber Leser, gestehen – selbst von ihr hinzulernen durfte. Ihre Gegenwart beflügelte mich. Ich nahm durch sie reicher an diesem Leben teil.
Etwa viereinhalb Monate nach unserer Vermählung fanden wir in Steglitz eine Dreizimmerwohnung, und zwar in der Nähe jener Buslinie, die zum S-Bahnhof Grunewald führt, von wo es nur noch ein kurzes Stückchen zu unserem Blindenvereinsheim zu gehen ist. Wegen der Neuanschaffungen und der Mietkaution war mein Sparkonto nun natürlich ganz aufgezehrt.
Aber Christiane verdiente gut, und ich versprach mir von meinem allmählich Fortschritte machenden Drama, dass es in ein bis zwei Jahren auf den deutschen Bühnen zu sehen sein würde, und dass ich dann – welch frommes Hoffen! – schließlich neben meiner Blindenrente und den bescheidenen Tantiemen für meine zwei Romane noch einige Nebeneinkünfte verbuchen dürfte. Ja, wir waren so zuversichtlich, dass wir schon planten, im nächsten Jahr nach Tirol zu reisen, denn ich wollte einmal in den hohen Bergen wandern.
Hatte ich bisher alles Schriftstellerische wie auch meine Lyrik auf Band gesprochen, so konnte ich schon bald Christiane alles in ihren Computer diktieren, den sie sich damals schon zu Beginn ihres Kurses zugelegt hatte. Doch eines Tages überraschte sie mich.
Christiane: Schau, lieber Tomi, ich habe dir etwas in einer Werkstatt basteln lassen.
Thomas: Was ist es? Es fühlt sich an wie eine aus Drahtgeflecht bestehende Leiter. Was könnte ich wohl damit anfangen?
Christiane: Leg dieses Drahtgeflecht einmal auf diesen Papierbogen. Du siehst, es hat die gleiche Größe wie dein Schreibpapierblock. Nimm deinen Kugelschreiber und schreibe nun in die durch diese Drahtsprossen vorgegebenen Linien… Du siehst, es geht ganz einfach. Diese Drahtleiter ist leicht. Du kannst sie mit deinem Schreibblock überall hin mitnehmen und wo auch immer zu schreiben beginnen, und ich kann die Zeilen nachher leicht und übersichtlich lesen.
Thomas: Hast du dir das ausgedacht, geliebtes Herzchen?
Christiane: Ja, das ist mir so eingefallen.
Thomas: Ich danke dir ganz herzlich für dieses Geschenk, liebe Christel. Es wird mir gute Dienste leisten. Lass dich küssen, mein goldener Engel.
Mein ganzes Leben veränderte sich. Der blinde Junggeselle war zu einem nahezu sehenden Ehemann geworden, denn meine Frau verlieh mir ihre Augen. Sie begleitete mich auf vielen meiner Wege, sodass ich den Blindenstock nur noch benutzte, wenn ich alleine das Haus verließ. Gingen wir spazieren – und wir hielten uns meistens an der Hand oder sie fasste meinen Arm –, so machte sie mich durch einen sanften Druck mit dem Daumen darauf aufmerksam, dass ein Stein, eine Pfütze, ein Kothaufen oder was auch immer im Wege war. Vor Stufen gab sie mir einen verstärkten Daumendruck, einen zuerst als Vorankündigung, dann bei den letzten drei Schritten jeweils wieder einen Druck, sodass ich die Treppen ebenso sicher nehmen konnte wie alle Sehenden. Auch meine Blindenmarkierung, die ich am linken Arm zu tragen pflegte, hatte sie abgestreift und gesagt, dass ich sie nicht mehr bräuchte, solange sie an meiner Seite sein durfte. Und insgeheim bat ich Gott, dass meine Christiane bis an mein Lebensende meine geliebte Gattin bleiben möge. Ja, ich konnte mir schon bald nicht mehr ausmalen, wie ich noch leben könnte, wenn sie mir durch einen Unfall genommen werden würde.
Doch einen Tag vor ihrem Geburtstag, als sie wieder im Blindenvereinsheim beschäftigt war, ging ich zur Bank, hob 1.000 Mark ab und begab mich zum Juwelier. Ich sagte ihm, dass ich für meine Frau ein Geburtstagsgeschenk in Form einer goldenen Kette haben wollte. Und ich erhielt das Gewünschte, an dessen Mitte sogar noch ein großer Halbedelstein zu hängen kam, blau wie jene Blaue Blume.
Und zu Hause setzte ich mich hin und schrieb in die Drahtleiter auf den darunterliegenden Block ein Gedicht:
Wenn Dichter je das Wort ergriffen,
Um Preis zu singen der Geliebten,
Sie bei Metaphern Zuflucht suchten,
Die mehr verdeutlichen als Wort.
Als ich, geliebtes Wesen, dich begriffen,
Mit meinen Händen, diesen ungeübten,
Dein Gesicht berührte, diese Buchten:
Ich wusst , ich bin am Heimatort.
Du hast die Augen mir geöffnet,
Dein Strahlen ist in sie gedrungen.
Drum sei nun dir, geliebte Helena,
zu deinem Ehrentag Dir Dank gesungen.
Ich liebe dich immer und ewiglich
Dein Thomas
Ich wusste natürlich, dass dieses Gedicht keines Druckes würdig ist. Aber nun soll es doch in mein Beichtbuch mit eingewoben sein, weil solche und ähnliche kleine gereimte und ungereimte Herzensergüsse zu unserer besonderen Beziehung gehörten.
Ich vergaß, zu erwähnen, dass Christiane ihre Arbeit im Blindenverein erst um zwei Uhr nachmittags begann, und dann dort meist bis nach zehn Uhr abends beschäftigt war. Somit konnten wir täglich gemeinsam frühstücken und zu Mittag essen. Sie bereitete mir auch mein Abendbrot schon vor, welches ich nur dem Kühlschrank zu entnehmen hatte, während ich den warmen Tee aus der Thermosflasche in den schon bereitstehenden Becher goss. Was war das für eine köstliche Umstellung, nicht mehr auf das Essen des fahrbaren Mittagstisches , das mir jeden Tag – außer an dem Tag, an welchem meine Polin bei mir war – schon gegen elf Uhr morgens gebracht wurde, angewiesen zu sein. Ich bin eigentlich in meinem Essensgeschmack sehr anspruchslos. Doch nun, nachdem Christiane mir jeden Tag ein neues, sehr schmackhaftes Essen servierte – gekocht und zubereitet mit all ihrer Liebe – hatte ich die Wohltat vorzüglichen Essens erst zu schätzen gelernt. Ja, liebe Leserin, lieber Leser, ich wünschte, du hättest einmal an unserem sonntäglichen Mahl teilnehmen können! Und dann ihre Kuchen! Ja, sie war eine perfekte Hausfrau. Als ich sie einmal fragte, wo sie all diese Künste erlernt habe, meinte sie, dass sie in ihrer Mutter eine allerbeste Lehrmeisterin gehabt hätte, die sie immer wieder darauf hinwies, dass Liebe durch den Magen geht, weshalb sie sehr gut kochen müsse, um die Liebe eines Mannes zu erhalten. Ich antwortete ihr daraufhin: Selbst wenn du nicht kochen könntest, mein Herzchen, würde ich dich gegen keine Frau der Welt eintauschen. Und wäre ich vor die Wahl gestellt, entweder sehen zu können oder dich zu verlieren, dann würde ich gern für immer auf mein Augenlicht verzichten, denn du bist mein Augenstern. Du bedeutest mir viel, viel mehr, als die Sehkraft meiner Augen mir je bedeuten könnte.
Unsere Geburtstage, Weihnachten, der Hochzeitstag wurden für uns zu großartigen Festen. Christiane half mir in jeder Beziehung. Selbst bei der Planung eines neuen Romans gab sie mir, nachdem ich ihr den Rahmen meines Projektes dargelegt hatte, hilfreiche Hinweise zum Aufbau, wusste genau, an welcher Stelle ich den Höhepunkt zu setzen hatte, ja, und sie gab mir die Worte und Ideen für die ersten Seiten des Buches, denn diese sind oft das Schwierigste eines ganzen Romans. Mein Kaiserdrama war mit ihrer Mithilfe beendet. Ich erwartete nun Reaktionen jener Bühnen, an die sie es geschickt hatte. Und jeden Abend betete ich zu Gott und bat ihn, mir meine Christiane, die ich oft auch Christel nannte, so zu erhalten, wie sie ist.
Der Wunsch, zusammen ein Kind zu haben, wurde ihrerseits dadurch aufgehoben, dass sie mir erzählte, dass sie sich ein Dreivierteljahr vor unserem Kennenlernen wegen ständiger Unterleibsblutungen einer Ausschabung unterziehen musste, sodass sie kein Kind mehr bekommen könne. Ich wollte eigentlich nur aus Liebe zu ihr ein Kind, denn ich wusste gar nicht, wie ich als Blinder ein Kind erziehen könnte. Ich hatte, offen gestanden, sogar Angst davor, Vater zu werden.
Christiane: Weißt du, mein Liebling, die Blinden sind meine Kinder.
Thomas: Und so gesehen bin ich auch dein Kind.
Christiane: Aber nein, du bist mein geliebter Ehemann. Ich habe nie für eine Sekunde den Gedanken gehabt, dass du mein Kind seist. Aber bedenke, wenn wir ein Kind hätten, müsste ich meinen Beruf für längere Zeit, ja vielleicht auf Jahre hin aufgeben. Wir könnten uns dann nicht mehr unsere Wohnung leisten. Außerdem benötigten wir noch ein zusätzliches Kinderzimmer. Ich habe mich damit abgefunden, in diesem Leben kein Kind zu haben. Außerdem, wenn wir ein Kind hätten, müsstest du meine Liebe mit dem Kind teilen, denn viele meiner dir gewidmeten Aufmerksamkeiten würden dir dann abgezweigt werden müssen. Nein, ich finde es gut, mein Liebling, dass wir kein Kind bekommen können, denn du sollst immer im Mittelpunkt meiner uneingeschränkten Liebe verankert bleiben. Ich liebe dich, mein Tomi.
Thomas (aufstehend und sich zu ihr begebend): Und ich liebe dich auch, geliebtes Herzchen. (Sie küssen sich).
Lieber Leser, es wird mir nun schwerfallen, dir die nächsten Begebenheiten zu schildern. Bitte fasse dich mit mir in Geduld. Du wirst gleich den dümmsten Dummkopf dieser Welt erleben – aber es ist nun einmal die reine Wahrheit.
Wenn Christiane im Blindenvereinsheim ihren Dienst verrichtete, stieg ich an sonnigen Nachmittagen so manches Mal in den Bus und fuhr zum Botanischen Garten. Geliebter Leser, du wirst erstaunt sein, dass ich, ein Blinder, dort überhaupt und dann auch noch mit größter Freude hinging, wo doch für alle Besucher die höchste Wonne gerade in dem von den Tausenden von Blumen und Blüten mit all ihrer Farbenpracht gebotenen Augenschmaus besteht. Aber ich sah diese Farbenpracht ebenfalls. Denn ich ging dorthin, wo es am meisten duftete, befühlte auch – wenn in meiner Reichweite befindlich – die eine oder andere Blüte oder Blume und befragte einen Passanten, welche Farbe sie hätte. So war mir bald der größte Teil des Botanischen Gartens wie auch der seiner Gewächshäuser bestens vertraut. Und da ich oft nach dem botanischen Namen des mich interessierenden Gewächses fragte, hätte ich für manchen Sehenden einen kundigen Führer durch Berlins Botanischen Garten abgeben können.
Oft saß ich lange auf irgendeiner Bank, meist unter einem duftenden Strauch. Ich wusste mittlerweile natürlich, wo überall Bänke platziert waren, sodass ich auch ohne den mitgeführten Stock meine bestimmten Plätze hätte finden können. Und oft kamen mir auf solchen Bänken großartige Ideen zu meinen schriftstellerischen Vorhaben, sodass ich den bei solchen Ausflügen stets mitgeführten Kassettenrecorder anstellte, um oft seitenweise zu diktieren. Als ich so eines herrlichen Frühsommernachmittags unter einem Jasminstrauch saß und soeben mein Diktiergerät eingeschaltet hatte, um meinen Roman um einige Seiten fortzuführen, kam es zu folgender Szene.
Frau Fischer: Ach, guten Tag, Herr Moosmann.
Thomas: Guten Tag, Frau Fischer. Wie geht es Ihnen?
Frau Fischer: Danke, Herr Moosmann. Und Ihnen?
Thomas: Es könnte mir nicht besser gehen. Wie ich höre, sind Sie in Begleitung.
Frau Fischer: Ja, meine Nichte aus Überlingen ist für einige Tage nach Berlin gekommen und wohnt bei mir. Sie heißt Evelyn König.
Frau König: Darf ich Ihnen die Hand schütteln. Angenehm, Ihnen zu begegnen. Mein Schlafzimmer befindet sich gleich neben Ihrer Wohnung. Wir sind sozusagen Wand an Wand. Ich habe schon einiges über Sie gehört. Sie sind ja Schriftsteller. Ich werde mir mal eines Ihrer Bücher besorgen. Wie schreiben Sie eigentlich Ihre Bücher?
Thomas: Auf verschiedene Weise, entweder diktiere ich alles in ein Diktiergerät, oder ich diktiere jemandem oder ich schreibe auch direkt mit der Hand auf, was meine Frau später in den Computer eingibt.
Frau Fischer: Ja, Sie können sich bedanken, dass Sie solch eine liebe Frau haben, die Sie in allem unterstützt.
Thomas: Hoffentlich setzen sich die beiden jetzt nicht zu mir. Ja, meine Frau würde ich für nichts in der Welt hergeben.
Frau König: Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir für einen Augenblick neben Ihnen Platz nehmen?
Thomas: Ganz gewiss nicht. Bitte, nehmen Sie Platz. So, Ihre Nichte kommt vom Bodensee. Ja, Sie haben den badischen Akzent.
Frau König: Nun, bei uns sprechen wir untereinander alle noch Mundart. Aber jetzt wohnen immer mehr Zugezogene bei uns, sodass irgendwann auch unser Dialekt ausstirbt.
Thomas: Alles auf Erden hat die Tendenz, sich zu verändern. Wir müssen lernen loszulassen, sonst bleiben wir haften. Wir sollten uns mit den Veränderungen ebenfalls verändern. Denn weigern wir uns und bleiben stehen, wird eine notwendige Veränderung mit einem schmerzvollen Ruck geschehen müssen.
Frau König: Ja, Sie sind ein wirklicher Schriftsteller. Von Ihnen kann man sicherlich viel lernen. Können Sie mir vielleicht sagen…
Thomas: Darf ich Sie für ein paar Augenblicke alleine lassen, denn ich möchte eben mal zur Toilette gehen. Ich kann doch meine Tasche hier bei Ihnen liegenlassen?
Frau Fischer: Aber sicher doch, Herr Moosmann. Wir bleiben hier, bis Sie wiederkommen.
Frau König: Ich bewundere ihn, dass er in seinem Leid als Blinder so viel Kraft aufbringt zu dichten. Er macht einen mit sich selbst ganz zufriedenen Eindruck.
Frau Fischer: Für mich ist er der Mann, dem der größte Betrug dieser Welt widerfahren ist.
Frau König: Wieso das?
Frau Fischer: Weißt du, dass er mit der hässlichsten Frau dieser Welt verheiratet ist, ohne von ihrer Hässlichkeit zu wissen? Vor anderen verbirgt sie, so gut sie kann, ihr Hexengesicht.
Frau König: Ist sie jene Frau, die ich schon zweimal im Treppenhaus sah, die eine Sonnenbrille und einen Schal um ihren Hals und Mund geschlungen trägt?
Frau Fischer: Jawohl, die ist es. Es ist eine Schande, mit dieser Hässlichkeit unter einem Dach zu leben. Mein Mann sagte, dass kein Mann sie mit einer Mistgabel berühren würde. Als er und ich nämlich mal unseren Hausmeister in seinen Ferien vertreten mussten, haben wir beide zweimal mit ihr unerwartet sprechen müssen und dabei auch ihr Gesicht gesehen. Du kannst dir so etwas Hässliches einfach nicht vorstellen. Ihr Mund ist ganz schief. Er geht von rechts nach links schräg hinauf. Drei ihrer oberen Zähne sind schief, und einer ragt auch rechts hervor. Da die unteren Zähne nach innen gewachsen sind, liegt immer die Zunge darauf, sodass die Spitze aus dem Mund hervorsieht. In ihren Mundwinkeln sammelt sich dauernd ein schaumiger Speichel. Und wenn sie spricht, verspritzt sie ihn.
Frau König: Oh Gott, oh Gott! Das ist ja grässlich! Der arme Ehemann!
Frau Fischer: Aber Evelyn, das Schlimmste kommt ja noch. Auf ihrer schrägstehenden und plattgedrückten Nase ist eine große Warze, eine richtige Hexenwarze, verstehst du. Einfach abscheulich.
Frau König: Elfriede, hör auf. Ich kann das nicht mehr hören.
Frau Fischer: Mein Eberhard hat gemeint, der Teufel hätte ihr bei der Geburt ins Gesicht getreten. Genauso muss es gewesen sein. So viel Scheußlichkeit in einem Gesicht kann man gar nicht erfinden.
Frau König: Und warum trägt sie eine Sonnenbrille?
Frau Fischer: Ich habe zufällig in ihre Augen sehen können, als ihre Sonnenbrille vor dem Haus nass geworden war und sie sie absetzte, um sie trocken zu wischen. Sie hat nicht bemerkt, dass ich an ihr vorbeiging und mich dann nach ihr umdrehte. Weißt du was?
Frau König: Was?
Frau Fischer: Ihr linkes Auge ist wie ein Krater des Abscheus. Die Pupille ist mit dem vertieft sitzenden Augapfel ganz nach links oben verdreht, sodass sie damit wohl kaum irgendetwas sehen dürfte. Und mit ihrem rechten Auge scheint auch nicht alles in Ordnung zu sein. Kein Wunder, dass sie ihre Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille mit Korrekturgläsern verbergen muss. Sie kann nur die Ausgeburt einer Hexe sein, die es mit dem Teufel getrieben hat.
Frau König: Oh, mein Gott. Der arme blinde Dichter! Und so hat man ihn hintergangen.
Frau Fischer: Ja, solch eine Frau konnte sich nur einen blinden Mann angeln. Sie ist sicherlich ganz bewusst in die Blindenarbeit gegangen, um einen ahnungslosen Mann zu heiraten, der nichts von ihrer Hässlichkeit weiß, der sie vielleicht sogar für schön hält. Weißt du, Evelyn, wenn ich diesem armen Mann manchmal auf der Treppe begegne, habe ich einerseits großes Mitleid mit ihm, dass er so hereingelegt worden ist, und auf der anderen Seite könnte ich ihm nicht die Hand geben, wenn ich daran denke, dass er seine Frau vielleicht zuvor noch mit den Fingern im Gesicht berührt hat. Als mein Eberhard sie zum ersten Mal sah, ist er danach schnell auf unsere Toilette gerannt, da er dachte, er müsse sich übergeben.
Frau König: Hör auf, Elfriede. Mir kommen die Tränen. Wie kann eine solch gemeine Frau einen Schriftsteller wie Herrn Moosmann derart betrügen? Solch eine Frau wäre bei Adolf sowieso nicht alt geworden. Aber wie kann der Staat es zulassen, dass solche Hässlichkeit überhaupt frei herumläuft? Denn jeder sieht einer solchen doch an, dass sie von Gott gestraft worden ist.
Frau Fischer: Ja, genau diese Worte hat die Hausmeisterin auch benutzt. Und ihr Mann hat gesagt: Vielleicht sollen wir durch solche Menschen an Gottes Gerechtigkeit gemahnt werden, damit wir nicht durch böse Taten ebenfalls seinen Zorn auf uns ziehen. Sicherlich hat Frau Moosmanns Mutter Gott beleidigt und musste deshalb solch eine Höllengeburt zur Welt bringen. Doch da kommt ihr Mann schon wieder zurück. Am besten ist, wir gehen gleich wieder, sobald er sich gesetzt hat.
Frau König: Ja, das wird das Beste sein. Der arme Herr Moosmann!
Frau Fischer: Du kannst dir ja denken, warum außer einem blinden Freund kein Mensch die beiden besuchen kommt, noch nicht einmal jemand aus ihrer Familie, wenn sich überhaupt jemand zu ihr bekennen will. Ja, sie ist eine abgebrühte Gaunerin, die solch einen Mann tief, tief betrogen hat… Nun, da sind Sie ja wieder. Meine Nichte und ich wollen noch in der Schlossstraße einkaufen gehen. Also dann, auf Wiedersehen.
Frau König: Auf Wiedersehen. Ich werde mir heute noch eines Ihrer Bücher in einer Buchhandlung besorgen.
Thomas: Ja, auf Wiedersehen. Haben Sie noch einen schönen Nachmittag. Und herzlichen Dank, dass Sie auf meine Tasche aufgepasst haben!
Als ich mich wieder gesetzt hatte, sog ich erst den wundervollen Jasminduft ein. Ja, am nächsten Montagnachmittag, wenn das Wetter schön ist, will ich mit Christiane hier sitzen. Sie weiß solche Plätze, die ich liebe, ebenfalls zu schätzen. Ja, sie hat an allem, was mir gefällt, auch eine große Freude. Und oft küssten wir uns dort lange, ja, wir benahmen uns gar, als ob wir uns gerade erst verliebt hätten. Gestern hatte ich ihr wieder eines meiner Lieblingsgedichte für sie vorgelesen. Ich hatte auch über ihre Schönheit geschrieben. Und sie entgegnete: Weißt du, lieber Tomi, es kommt doch ganz und gar nur auf die innere Schönheit an. Denk doch an Adalbert Stifters Novelle ‚Brigitta‘. Welch edle Seele! Wobei ihr Äußeres ganz und gar nicht einem Schönheitsideal entspricht.
Thomas: Du hast Recht. Die Schönheit der Seele ist allein, was zählt.
Christiane: Zählen sollte, lieber Tomi.
Thomas: Mein Herzchen, ich weiß nicht, was ich an dir vorziehen sollte. Für mich bist du Goethes edle Seele und zugleich Petrarcas schöne Beatrice in einem.
Christiane: Du bist eben ein blinder Dichter. Wenn du mich sehen würdest, würdest du von mir nicht als deiner Beatrice oder Helena sprechen. Ich bin nur ein einfaches Weib, die aber für meinen lieben Tomi enorme Liebeskräfte entwickelt hat. Ja, Geliebter, ich könnte ohne dich gar nicht mehr leben. Ich wüsste nicht, was ich dann tun sollte. Ich glaube, ich würde dann sterben müssen.
Thomas: Nein, mein Herzchen, wir bleiben beieinander, bis der Tod uns scheidet. So haben wir es vor Gottes Altar geschworen. Ich liebe dich. Christiane: Ich dich auch, mein allerliebster, herzensguter Mann.
Thomas: Ich glaube, dass all meine Gedichte ein Nichts sind gegenüber dem, was du wirklich bist. Du bist mir vom Himmel gesandt worden. Gott müsste ich jeden Tag in Gedichten preisen, dass er dich mir zur Frau gegeben hat, womit er mich sicherlich zum glücklichsten Blinden auf dieser Erde erkoren hat. (Sie küssen sich).
Während ich unter jenem Jasminstrauch an meinen geliebten Engel dachte, kamen mir Verse zu einem Liebesgedicht, in welchem ich am Ende Gott danken wollte, dass er mir diese wundervolle Frau geschenkt hat. Ich wollte meinen neuen Kassettenrecorder aus der Tasche hervorholen – übrigens hatte Christiane ihn mir zu meinem zweiundfünfzigsten Geburtstag geschenkt –, um diese Verse zu diktieren, als mir wieder einfiel, dass ich ihn ja schon neben meiner Tasche liegen hatte. Und ich stellte nun fest, dass er auf Aufnahme eingestellt war und die Kassette sich noch immer drehte. Ach ja, ich hatte ihn gerade in jenem Moment angestellt, als diese zwei Frauen kamen, und hatte vergessen, ihn abzustellen, als ich auf die Toilette ging. Vielleicht haben die beiden über mich gesprochen. Doch zuerst will ich mein Gedicht aufs Band diktieren. Nachher werde ich zurückspulen und mir ihren Dialog anhören.