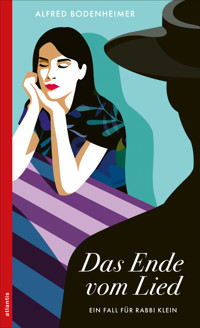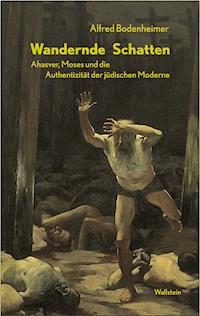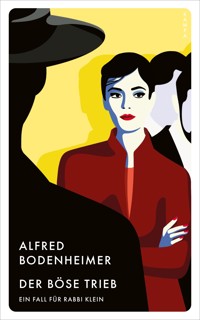
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Red Eye
- Sprache: Deutsch
Eigentlich hat Rabbi Klein in seiner Zürcher Gemeinde genug zu tun, doch als in Inzlingen kurz hinter der deutschen Grenze der Zahnarzt Viktor Ehrenreich erschossen wird, fühlt sich Klein zu einem Kondolenzbesuch bei dessen Ehefrau Sonja verpflichtet. Schließlich kannte er den Toten gut: Jedes Jahr zu Beginn des Monats Elul hat er eine »Sichat Nefesch«, ein Seelengespräch, mit ihm geführt. Steht der Mord mit den Eheproblemen der Ehrenreichs in Verbindung? Oder hat er mit der Mussar- Bewegung und Viktors regelmäßigen Reisen in den Kongo zu tun? Und welche Rolle spielt Sonjas Freundin Anouk Kriesi, die mit ihrem Mann einen dubiosen Youtube-Kanal unterhält? Klein beginnt auf eigene Faust zu ermitteln - nicht nur, weil er den zuständigen Kommissar Unmüßig nicht ausstehen kann, sondern auch, um sich nicht mit seinen eigenen Problemen beschäftigen zu müssen: Er hat sich so mächtige Feinde gemacht, dass ihm ein Berufsverbot droht. Das Schlimmste aber ist, dass Rivka wütend auf ihn ist: Denkt Klein zwischen seinen ganzen Verpflichtungen vielleicht auch mal an seine Frau und seine Töchter?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bodenheimer
Der böse Trieb
Ein Fall für Rabbi Klein
Kampa
Rabbi Jehuda lehrte: In der Zukunft wird Gott den bösen Trieb holen und ihn in Gegenwart sowohl der Gerechten wie der Bösewichte schlachten. Den Gerechten wird er hoch wie ein Berg erscheinen und den Bösewichten wird er wie ein dünnes Haar erscheinen. Beide aber werden weinen. Die Gerechten werden weinen: »Wie konnten wir einen so hohen Berg überwinden?«, und die Bösewichte werden weinen: »Wie konnten wir über ein so dünnes Haar straucheln?«
Babylonischer Talmud, Traktat Sukka, 52a
Weshalb leben Sie eigentlich dort, Viktor? Warum zieht ein frommes jüdisches Ehepaar in dieses Kaff? Wo es wahrscheinlich keinen anderen Juden gibt. Inzingen, oder wie es heißt.
Inzlingen.
Inzlingen also. Warum?
Na ja, vielleicht erzähle ich die Geschichte von Anfang an.
Ich bitte darum.
Ich bin in Berlin aufgewachsen. Sonja in der Nähe von Stuttgart. Meine Eltern stammen aus St. Petersburg. Ihre aus der Ukraine. Wir sind beide als Kinder nach Deutschland gekommen. Beide aus atheistischen Elternhäusern. Als meine Eltern vor dreißig Jahren nach Berlin kamen, wurden sie Mitglieder in der Gemeinde, weil sie dachten, dass ihnen das soziale Zusatzleistungen bringen würde. Da war aber nicht viel, wir blieben im Plattenbau, meine Mutter arbeitete für ein Reinigungsunternehmen, mein Vater hatte mal hier, mal da einen Gelegenheitsjob. In Russland war er ein hoher Angestellter in einer Flaschenfabrik gewesen, und er hatte immer gemeint, er müsse in Deutschland nur mit dem Finger schnippen, dann läge ihm alles zu Füßen. Aber keiner wollte was von ihm wissen. Immer schimpften meine Eltern, auf Deutschland, auf das Leben und am meisten auf mich, weil sie behaupteten, sie seien nur meinetwegen hergekommen, damit ich im Leben mehr Chancen haben würde. Arzt, Anwalt sollte ich werden, am besten gleich beides, immer musste ich mir das anhören. Und jede Note, die keine Eins war, wurde mir tagelang vorgehalten. Sie verlangten sogar, dass ich nach einem Jahr in Deutschland der Beste in Deutsch sein müsse. »Wenn du in eine Klosterschule gehen würdest, müsstest du dort auch der beste Katechet sein.«
Klingt nach einer unentspannten Jugend. Und Sie haben es ja auch zum Zahnarzt gebracht. Auftrag erfüllt, gewissermaßen.
Wie man’s nimmt. Sonja jedenfalls ist unter ähnlichem Druck aufgewachsen. Sollte Klaviersolistin werden. Jeden Tag vier Stunden üben. Aber sie hatte Rückenprobleme, und sie musste umsatteln. Ehrlich gesagt, ich glaube, sie hat das mit den Rückenschmerzen auch dramatisiert, um nicht Solistin werden zu müssen.
Hat sie Ihnen das einmal gesagt?
Nicht direkt. Aber sie hatte einfach noch andere Interessen. Mathematik. Theater. Sie war zu vielseitig, um ihr ganzes Leben nur an den Tasten zu sitzen.
Und wo haben sich die beiden geplagten Kinder kennengelernt?
Als wir uns kennenlernten, waren wir längst erwachsen. Und nicht mehr sonderlich geplagt. Nicht mehr und noch nicht. Ein sogenannter Jugendkongress des Zentralrats. Nettes Programm in einem feinen Hotel für umme, damit sich junge Juden, pardon, junge Jüdinnen und Juden kennenlernen.
Sie haben also doch damals schon eine jüdische Partnerin gesucht.
Ach, Herr Rabbiner, Sie haben da so romantische Vorstellungen. Religiös romantisch, meine ich. Eine Partnerin war das Letzte, woran ich dachte. Ich war mitten im Studium, es lief ganz gut, von zu Hause war ich weggezogen, damals kriegte man ja eine Bude in Berlin für fast gar kein Geld, ich kam mit Bafög und etwas Geld von der Gemeinde super klar, hatte mal hier, mal dort Sex.
Und Sonja?
Ist mir gleich aufgefallen. Einfach eine umwerfende Erscheinung. Ich war überzeugt, sie habe schon jemanden, oder jedenfalls, dass ich bei ihr keine Chance haben würde. Ich hatte schon damals kein Filmstarformat.
Und dann bekamen Sie doch Ihre Chance.
Ja. Aber die Sache hatte ihren Preis. Sonja bekam eine Stelle in Bruchsal. Ich wechselte an die Uni Heidelberg und zog zu ihr. Nach zwei Jahren schloss ich ab und arbeitete am Klinikum in Karlsruhe. Wir lebten gut, reisten in der Freizeit herum, Sonja lehrte mich, Konzerte und Theater zu schätzen. Einmal fuhren wir extra nach Wien, nur um eine Strindberg-Aufführung von Peter Zadek zu sehen. Aber sie wurde zusehends religiöser, das war für mich schwierig. Ich passte mich an, sonst hätte ich sie wohl verloren. Begann zu lernen, Tora, Halacha und so weiter. Schließlich haben wir geheiratet, Chuppa und Kidduschin, wie es sich gehört. Wir aßen nur noch streng koscher, hielten den Schabbat, Nida und so weiter. Wir hatten vor, nach Frankfurt zu ziehen, um eine große Gemeinde um uns zu haben. Dann plötzlich kam ein Anruf eines ehemaligen Studienkollegen aus Berlin. Sein Vater war Zahnarzt in Inzlingen und wollte sich auf Mallorca zur Ruhe setzen. Der Sohn war an einer Rückkehr aus Berlin nicht interessiert, und der Vater suchte einen jungen Nachfolger. Der Kollege wusste, dass ich im Süden lebte, und fragte mich an. Ein Einkauf in die gut laufende Praxis zu sehr fairen Bedingungen, Übernahme des gesamten Hauses. Ich wusste, dass ich eine solche Gelegenheit nur einmal erhalten würde.
Und wie haben Sie Sonja überzeugt mitzukommen?
Ich glaube, ich habe sie bis heute nicht überzeugt. Sie willigte aus Liebe ein, nicht aus Überzeugung. In Lörrach war eine Stelle am Gymnasium frei, Musik und Mathe, wie auf sie zugeschnitten. Ich versprach ihr, wenn Kinder kämen, würden wir die Praxis wieder verkaufen, dann hätten wir auch genug Geld, woanders was aufzubauen, wo es jüdische Schulen gebe.
Doch die Kinder kamen nicht.
Nein. Die Kinder kamen nicht.
1
Inzlingen also. Mehr Pampa ging wirklich nicht, dachte Klein, als er links in die Straße mit den schmucken, großzügigen, am Hang gebauten Einfamilienhäusern einbog. An der gesuchten Adresse, Blumenacker 19, angekommen, hielt er in der Parkbucht neben der Garage und stapfte die Stufen bis zum Eingang hinauf. Bruchim habaim stand in hebräischen Buchstaben auf der Fußmatte, darunter Welcome. Am Türpfosten hing eine etwas kitschige farbige Mesusa. Klein erinnerte sie an ähnliche Exponate, die er in den kabbalistisch inspirierten Kunsthandwerkläden in der Altstadt von Safed gesehen hatte. Neben der Tür ein stilvolles Plexiglasschild: Zahnarzt Dr. V. Ehrenreich. Klein betrachtete einen Augenblick die beiden Klingelknöpfe, dann drückte er auf den oberen, auf dem Privat stand.
Sogleich surrte der Öffner, Klein trat ein und sah oben an der Treppe in der geöffneten Glastür Sonja stehen.
»Herr Rabbiner, kommen Sie herauf«, rief sie leise, angestrengt.
»Sie wissen nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie da sind«, sagte sie ohne weitere Grußformel, als er oben angekommen war. Klein verzichtete darauf, Sonja die Hand hinzustrecken, sondern verbeugte sich, wie es die Ultraorthodoxen taten, die ihren Respekt bezeugen wollten, ohne die Frau zu berühren. Er tat es vor allem aus Rücksicht auf Sonja, die ihn nach Art der frommen Jüdinnen mit eng um den Kopf gebundenem Turban empfing, der ihr Haar vollkommen verhüllte.
Er schaute sich kurz um. Ein geräumiger, geschmackvoll modern eingerichteter Wohntrakt mit eindrücklichen Bücherwänden, in denen religiöse und profane Bücher standen, unaufdringlich, aber hell beleuchtet, während hinter einem großen Fenster der Hang mit einigen Obstbäumen in der aufkommenden Dämmerung noch erahnbar war. An der Wand hingen mehrere abstrakte Bilder in unterschiedlichen Blau- und Grüntönen, die alle aus der Hand von einem oder zwei Künstlern zu sein schienen. Dazwischen, wie ein vollkommener Stilbruch, in der Mitte der einen Längswand die Reproduktion eines alten schwarz-weißen Porträts von einem Mann mit dichtem grauen Bart und Bowler Hat. Die beiden (wie man sogar auf dieser Aufnahme sah) verschiedenfarbigen Augen unter starken Brauen waren zugleich sorgenvoll und hypnotisch auf den Betrachter gerichtet. Klein wusste nicht, wer das war, und es war nicht der Augenblick, um nachzufragen.
Beherrscht wurde der Salon von einem riesigen Konzertflügel. Mitten im C von BECHSTEIN, als hätte jemand darauf gezielt, klaffte ein hässliches kleines, von Splittern umgebenes Loch, um das eine ziemlich ungeschickte Polizistenhand einen Kreidekreis gemalt hatte.
»Das war der Schuss, der danebengegangen ist«, sagte Sonja Ehrenreich tonlos hinter ihm. »Der Schuss, der ihn verfehlt hat. Der erste.«
»Der erste«, wiederholte Klein heiser und räusperte sich. Es hätte theoretisch auch der zweite sein können, dachte er. Auch wenn es eher sinnlos schien, noch in ein Klavier zu schießen, wenn der Mensch, den man treffen wollte, schon darniederlag. Das kleine Loch im Flügel war jedenfalls das letzte noch im Raum verbliebene Zeugnis des Verbrechens, das hier geschehen war. Niemand hätte vermutet, dass in diesem Zimmer noch zwei Tage zuvor die Leiche Viktor Ehrenreichs in ihrem Blut gelegen hatte. Das Kirschbaumparkett wies keine Spuren mehr auf. Versiegelt, dachte Klein unversehens. Zudem hatte die Polizei offenbar sehr schnell gearbeitet, um den Tatort wieder in Sonja Ehrenreichs Heim zurückzuverwandeln.
Sonja bat ihn, sich an den Esstisch zu setzen, auf dem eine Karaffe mit zwei Gläsern und eine kleine Schale mit einer Nussmischung standen. Sie schenkte bedächtig zwei Gläser Wasser ein.
Klein war es gewohnt, mit Menschen zusammenzukommen, die soeben ihre nächsten Angehörigen verloren hatten. Manche waren gefasst, andere aufgelöst. Fast immer gelang es ihm, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, den Ring, den der Schmerz um ihre Brust legte, etwas zu lösen. Aber mit dieser Frau, deren überpudertes Gesicht ihn beinahe maskenhaft anschaute, die gestern Abend von einer weiten Reise zurückgekommen war und plötzlich vor einem polizeilich versiegelten Haus stand, ihn nun aber bereits wieder im selben Haus mit den Insignien bürgerlicher Wohlanständigkeit und Ordnung empfing, wie sollte er da ins Gespräch einsteigen? Wie sie so vor ihm saß, ein beiges Tuch um den Kopf, waren ihre Gesichtszüge etwas verquollen und aufgedunsen. War es bloß die Trauer? Waren es Medikamente? Klein wusste schon länger, dass sie an psychischen Problemen litt. Sie trug blütenweiße Handschuhe, von denen sie sich offensichtlich nicht trennen konnte. Viktor hatte ihm von dieser Handschuhmanie seiner Frau erzählt.
Als Klein die Ehrenreichs vor sieben Jahren kennenlernte, trug sie die Handschuhe noch nicht. Damals waren ihm Sonjas große blaue Augen und die feinen Gesichtszüge aufgefallen, die ihr, in Kombination mit dem üppigen schwarzen Echthaarscheitel, ein romantisches, fast zauberhaftes Aussehen verliehen. Sie schien zu Viktor, dem drahtigen Mann mit dem schütteren braunen Haar neben ihr, gar nicht recht zu passen.
Er wartete, ob Sonja etwas sagen würde, doch sie schaute ihn ihrerseits erwartungsvoll an. Behutsam und zugleich um Sachlichkeit bemüht fragte er: »Und der zweite Schuss? Hat der ihn sofort getötet? Oder musste er noch lange leiden?«
»Die Polizei sagt, der zweite Schuss wurde aus nächster Nähe abgegeben. Viktor sei danach sofort tot gewesen.«
»Hat denn keiner der Nachbarn reagiert? Ist rübergekommen, um zu schauen, was los ist?«
»Wie es scheint, war kaum jemand in der näheren Nachbarschaft zu Hause. Es sind Schulferien, und hier wohnen fast nur Familien mit Kindern. Leute im Dorf haben zwar bestätigt, dass sie Schüsse gehört haben, aber sie konnten sie nicht lokalisieren. Dachten wohl auch, es seien Knallpatronen.«
»Und Sie waren verreist«, meinte Klein lakonisch.
»In Vietnam«, antwortete sie. »Zweieinhalb Wochen.«
»Vietnam?«
Sie nickte nur, und er fragte nicht, was sie dort gemacht hatte. Etwa Ferien? Allein in einem Land, in dem es kaum koscheres Essen gab? Oder war sie etwa nicht allein verreist? War es ihre Revanche dafür, dass Viktor seit einigen Jahren jährlich um die Weihnachtszeit für drei Wochen in den Kongo verschwand? Aber das war ein anderes Thema.
»Und vorgestern sind Sie zurückgekommen.«
»Ja«, meinte sie. »Etwas früher als geplant. Aber dennoch zu spät.«
Er schaute vor sich hin, griff schließlich mechanisch in die Nussschale und stopfte sich ein paar Nüsse in den Mund.
»Wann haben Sie zum letzten Mal mit ihm gesprochen?«, fragte er schließlich.
Sie blickte in eine andere Richtung.
»Ich habe ihn vor einer Woche angerufen. Die Verbindungen sind dort nicht überall besonders gut.«
Sonja zog ein Kosmetiktuch aus einer Packung, die auf dem Tisch stand, und wischte sich eine Träne weg.
»Gefunden hat ihn seine Praxishilfe«, fuhr sie fort. »Das war am Montagmorgen. Sie hat mich versucht zu erreichen, gleich nachdem sie die Polizei gerufen hatte. Sie hat mir auch eine Nachricht hinterlassen. Nur, dass ich sie bitte umgehend zurückrufen sollte. Die Polizei hat dann auch versucht mich anzurufen, mehrmals. Aber mein Telefon war aus. Und gestern Abend stand ich vor dem versiegelten Haus.«
Für Montagabend hatte Viktor Ehrenreich sich zu seinem jährlichen »Seelengespräch«, wie er es nannte, bei Klein angekündigt. Doch diesmal war er nicht gekommen. Klein hatte ihn nicht erreicht. Am Tag darauf hatte er dann auf die Festnetznummer des Ehepaars angerufen, und dort hatte ihm Sonja geantwortet. Er hatte es zuerst überhaupt nicht glauben wollen, als sie sagte, ihr Mann sei tot, er sei erschossen worden, wahrscheinlich am Sonntagabend. Spontan hatte Klein daraufhin gefragt, ob sie wolle, dass er in den nächsten Tagen vorbeikomme.
Sie hatte dankbar bejaht. Und so war er dann tags darauf gegen Abend ins Auto gestiegen und eine gute Stunde nach Inzlingen gefahren, gleich jenseits der Schweizer Grenze hinter Riehen bei Basel.
»Hier auf dem Boden hat er gelegen«, sagte Sonja und zeigte auf eine Stelle auf dem Parkett nahe der Treppe, die ins Dachgeschoss führte, wo sich eine Galerie und die Schlafräume befanden. »Eine Kugel im Herz. Alles voller Blut natürlich.«
»Unbegreiflich«, sagte Klein.
»Und die Ermittler tappen vollkommen im Dunkeln. Es gibt zwar Fingerabdrücke von fremden Personen, aber die Polizisten meinen, es sei nicht logisch, dass jemand eine Hinrichtung plant und zugleich so tollpatschig ist, am ganzen Tatort Spuren zu hinterlassen.«
»Es war eine gezielte Hinrichtung?«
»Jedenfalls gibt es keinen Hinweis darauf, dass es ein Raubüberfall oder ein ertappter Einbrecher gewesen sein könnte.«
»Ein Profi war es jedenfalls kaum. Ein Schuss daneben.«
»Vielleicht ein Warnschuss. Oder Viktor konnte sich vielleicht zuerst noch wegducken. Er war ja körperlich sehr agil. Ein leidenschaftlicher Radfahrer, wie Sie wissen.«
Zwischen dem ersten und dem zweiten Schuss musste irgendetwas geschehen sein. Das Klavier befand sich im Zimmer auf der genüberliegenden Seite der Treppe, wo Viktor nach Sonjas Angabe gelegen hatte. War er nach dem ersten Schuss in Richtung Treppe gelaufen, auf den Mörder zu, und wurde dabei aus nächster Nähe erschossen? Das klang nicht gerade plausibel. Oder hatte er versucht, mit dem Mörder zu verhandeln?
»Die Frage ist«, meinte Klein, »wer sollte Viktor hinrichten wollen? Ich denke zwar, an Feinden hat es ihm nicht gemangelt. Das hat er jedenfalls in den Gesprächen mit mir immer wieder betont. Aber das waren doch vermutlich keine, die ihn tatsächlich umgebracht hätten.«
»Natürlich hat er sich mit vielen Leuten verkracht. Mit fast der ganzen jüdischen Gemeinde von Lörrach und noch einigen mehr. Aber da blieb es bei Beschimpfungen oder abgebrochenem Kontakt. Nicht mal den Kletzki, diese Ratte, würde ich eines Mordes für fähig halten.«
Klein zuckte zusammen. Er hatte gewusst, dass Viktor Ehrenreich sich mit Rabbiner Bunem Kletzki, einem Lubawitscher Chassid, der die Gemeinde von Lörrach angeblich auf den Kurs seiner Bewegung bringen wollte, nicht verstanden hatte. Aber derart despektierlich über einen Rabbiner zu sprechen, das hatte er von einer so religiösen und kultivierten Frau wie Sonja nicht erwartet.
»Und wenn es ein Hassverbrechen war? Antisemitismus?«
»Das habe ich die Polizisten natürlich auch gefragt. Aber sie meinen, wer heute ein Hassverbrechen begehe, der wolle, dass die Absicht dahinter öffentlich werde. Hier findet sich nichts dergleichen. Keine antisemitischen Mails oder Posts und kein Bekennervideo oder Ähnliches.«
»Haben Sie denn einen Verdacht?«
»Offen bedroht wurde Viktor eigentlich nur von einer Person.«
»Von wem denn?«
»Moser heißt er. So ein Taugenichts aus einem Kaff hier in der Gegend. Der hat behauptet, Viktor hätte seinem Vater bei einer Wurzelbehandlung einen Nerv durchtrennt und ihn damit so geschädigt, dass er arbeitsunfähig geworden sei. Er hat überall herumerzählt, Viktor lasse sich nicht auf einen Vergleich mit ihnen ein, weil sie sich keinen Anwalt leisten könnten.«
»Dieser Streit ist aber doch schon älter. Ihr Mann hat mir, wenn ich mich richtig erinnere, schon in unserem Gespräch vor einem Jahr davon erzählt.«
»Ja, aber die Sache ist eskaliert«, sagte Sonja. »Im letzten Winter hat er Viktor telefonisch bedroht, und kurz danach wurden bei unserem Auto alle Scheiben eingeworfen. Daraufhin haben wir Anzeige erstattet.«
»Dann weiß die Polizei ja auch davon.«
»Die sprachen von einem Mangel an Beweisen. Der Moser hat erklärt, am Telefon nur höflich nachgefragt zu haben, ob sich sein Vater noch Hoffnungen auf eine einvernehmliche Lösung machen könnte, und bei der Sache mit dem Auto gab es keine Zeugen.«
Klein schwieg. Das klang alles ziemlich diffus.
»Herr Rabbiner Klein«, sagte Sonja schließlich mit schwacher Stimme.
»Ja«, sagte er und rückte unwillkürlich etwas näher an sie heran, wie um sie besser zu verstehen, aber auch um seine Anteilnahme zu signalisieren.
»Am Ende ist es doch fast gleichgültig, wer ihn umgebracht hat. Man spricht immer von Gerechtigkeit, wenn ein Mörder gefasst wird. Aber letztlich: Wem nützt es noch etwas? Dass er nicht mehr lebt, das ist doch das Entscheidende. Wissen Sie, wir hatten es zusammen ja nicht immer leicht, aber dass ich heimkomme, und dann …«
Plötzlich schluchzte Sonja auf und hob die Hände vors Gesicht. Klein setzte zu einem tröstenden Satz an, dass Viktor sie sehr geliebt habe und sicher gewollt hätte, dass sie aus dieser Liebe auch jetzt noch Kraft bezog. Doch er ahnte, dass sie dies eher als leeres Gerede denn als Trost empfunden hätte. Der tiefe Schmerz, der diese Ehe schon lange plagte, nebst der Tatsache, dass Sonja nie nach Inzlingen hatte ziehen wollen, war die Kinderlosigkeit. Viktor hätte ursprünglich wohl gerne Kinder gehabt, aber mit der Zeit hatte er sich, wie es Klein schien, mit der Situation arrangiert. Doch er hatte Klein auch in mehreren Gesprächen verraten, dass Sonja die Sache sehr schwernahm. Sie hatte endlose Tests, Hormontherapien und anderes über sich ergehen lassen, und es war ihr von Ärzten versichert worden, dass sie Kinder haben könnte. Viktor hatte sich aber allen Tests entzogen. Er behauptete, vor seiner Zeit mit Sonja bei einem »Unfall« eine Zufallsbekanntschaft geschwängert zu haben, die dann abgetrieben hatte. Dieser etwas schwammige Beweis reichte ihm aus, um jeden Zweifel an seiner eigenen Fruchtbarkeit auszuräumen.
Vor etwa drei Jahren hatte Sonja beschlossen, ein Kind zu adoptieren, und Viktor hatte sich halbherzig darauf eingelassen. Doch die Behörden mauerten. Viktor war darüber nicht besonders unglücklich, und er hatte Klein ziemlich offen gesagt, es liege wahrscheinlich daran, dass sich seine Frau seit einiger Zeit in psychiatrischer Behandlung befinde. Für Sonja waren die Depressionen, an denen sie litt, Folge ihrer Kinderlosigkeit, doch für die Amtsstellen zählte nicht der Kummer kinderloser Frauen, sondern das Kindswohl. Obwohl sie eine untadelige, engagierte Lehrerin war, wollten sie ihr offenbar kein Kind zur Adoption anvertrauen. Und dass vom Ehemann auch eher laue Bekenntnisse zu einer Adoption zu hören waren, mochte der Sache nicht geholfen haben.
Sonja glaubte, laut Viktor, man verweigere ihnen ein Kind, weil sie praktizierende Juden seien und die Behörden sie als ›sektiererisch‹ betrachteten. Doch Viktor hatte Klein das vor allem erzählt, um damit auszudrücken, dass seine Frau in dieser Angelegenheit vollkommen überspannte Vorstellungen habe.
Nun war Sonja allein. Dazu saß sie auch noch in einem Dorf, in dem sie, außer vielleicht einige Eltern von Schülern, keine Kontaktpersonen hatte, kein jüdisches Gemeindeleben, das sie auffing, umso weniger, als sie mit der jüdischen Gemeinde zerstritten war und deren Rabbiner mit Schmähworten bedachte.
»Wollen Sie für einige Tage zu uns nach Zürich kommen?«, fragte Klein. »Bis zur Beerdigung dauert es ja vielleicht noch eine Weile. Oder auch zum Schiwa-Sitzen. Das würde ich Ihnen gerne anbieten.«
Mit Rivka abgesprochen war das nicht. Aber er wusste, in einer solchen Situation würde er sich auf das große Herz seiner Frau verlassen können, auch wenn sie den Ehrenreichs nie besonders zugetan war. Es fiel ihm schwer, sich vorzustellen, wie Sonja Ehrenreich allein in diesem großen Haus sitzen würde, in ihrem Kopf dauernd die Frage wälzend, wie es gekommen war, dass ihr Mann erschossen auf dem Esszimmerparkett gelegen hatte.
Sie nahm die Hände von den geröteten Augen.
»Das ist sehr freundlich«, sagte sie. »Aber ich muss hierbleiben. Schon allein wegen allem, was es zu erledigen gibt. Der ganze bürokratische Kram. Und natürlich die Organisation der Beerdigung.«
»Gibt es denn jemanden, der in dieser Zeit bei Ihnen wohnen könnte?«
Sie winkte ab.
»Ich schätze Ihre Fürsorge. Aber nein, das brauche ich wirklich nicht.«
Klein blieb nur noch kurz. Draußen war es nun ganz dunkel, die Bäume hinter dem Fenster sah man nicht mehr. Er beobachtete, wie sich eine tiefe Müdigkeit über ihr Gesicht zu legen begann. Er erhob sich und bat sie, ihn über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Sie versprach es und konnte ein Gähnen nicht mehr unterdrücken.
Er hatte sich bereits verabschiedet und war auf der Treppe ins Erdgeschoss, als sie aus der offenen Wohnungstür noch einmal seinen Namen rief.
»Ja?« Er wandte sich um.
»Einen Wunsch hätte ich an Sie. Dass Sie Viktors Hesped halten. Den Kletzki kann ich damit nun wirklich nicht betrauen.«
»Wenn Rabbiner Kletzki damit einverstanden ist, werde ich das gerne tun«, sagte Klein.
»Würden Sie das mit ihm direkt regeln? Das würde mir sehr helfen.«
»Kann ich machen«, brummte er, ging die paar letzten Stufen bis zur Haustür und trat ins Freie, wo ihn eine erfrischende Luft empfing.
Dem Navigationssystem folgend fuhr er denselben Weg zurück, den er hergefahren war, bei Rheinfelden über die Brücke vom deutschen zum Schweizer Ort desselben Namens, danach auf die Autobahn. Der Verkehr floss ruhig und friedlich dahin. Klein ließ zuerst noch das Radio laufen, doch es störte ihn in seinen Gedanken, die um das Ehepaar Ehrenreich kreisten. Er hatte nicht erfahren, was Sonja die ganze Zeit über alleine in Vietnam gemacht hatte, warum sie sich so lange nicht bei Viktor gemeldet hatte und früher zurückgekommen war. Er hatte keine Ahnung, in welche Richtung die Polizei ermittelte. Doch seine Aufgabe war es nun ohnehin zuallererst, in den nächsten Tagen eine anständige Trauerrede auf Viktor zu schreiben. Was wusste er über ihn? Eigentlich ziemlich viel, auch wenn er ihn nur einmal im Jahr für zwei bis drei Stunden getroffen hatte.
Ihre Bekanntschaft hatte an einem organisierten Wochenende in dem etwas heruntergekommenen Koscherhotel von Arosa begonnen. Klein hatte dort einen Vortrag gehalten und war deshalb mit der ganzen Familie über den Schabbat eingeladen. Viktor und Sonja hatten die Gelegenheit genutzt, aus ihrer gewohnten Schabbateinsamkeit auszubrechen, auch wenn sie von den anwesenden, fast durchgehend schweizerischen Juden kaum jemanden kannten. Man hatte sich nett unterhalten, aber Klein war recht erstaunt gewesen, wenige Wochen danach von Viktor Ehrenreich eine Mail zu bekommen, ob er bereit wäre, ihn zu Beginn des Monats Elul, der einen Monat vor dem Neujahrsfest die Zeit der Besinnung und Buße ankündigte, zu einer »Sichat Nefesch«, einem Seelengespräch zu empfangen. Klein hatte damals zugesagt, und seither hatte Viktor jedes Jahr von Neuem ein solches Gespräch erbeten. Rivka hatte sich darüber geärgert und gemeint, es gehe nicht an, dass jemand, der nicht aus seiner Gemeinde stamme, dem Rabbiner regelmäßig so viel Arbeitszeit abverlange, ohne etwas dafür zu bezahlen – außer vielleicht mit einer Dose Kekse oder einem Wein. Aber Klein musste zugeben, dass er auch fasziniert war von diesem Mann.
Am überraschendsten war gewesen, dass Viktor darauf Wert legte, diese höchst vertraulichen Jahresgespräche aufzuzeichnen, und dann jeweils eine Kopie an Klein geschickt hatte. Offenbar erwartete er, dass Klein jeweils vor einem Gespräch das des Vorjahrs noch einmal anhörte, wie er selbst es auch tat, um daran anknüpfen und die Entwicklungen weiterverfolgen zu können. Davon erzählte Klein Rivka nichts, es hätte sie noch mehr erzürnt, weil es noch mehr von seiner Zeit in Anspruch nahm – doch er hatte es immer geschafft, sich jeweils in den Wochen vor Rosch Chodesch Elul, wenn er im Auto oder in der Bahn unterwegs war, die Aufzeichnung zu Gemüte zu führen. Und nun waren diese Aufnahmen, die er alle in einer Datei gespeichert hatte, eine ideale Vorbereitung für die Grabrede.
Als er, zu Hause angekommen, noch am selben Abend wieder in die Gespräche mit Viktor hineinhörte, überlief ihn zunächst ein Schauer, als er gewahr wurde, dass diese Stimme im Wesentlichen das war, was ihm von der Bekanntschaft mit Viktor noch bleiben würde. Auch fiel ihm mehr als je zuvor der starke russische Akzent in Viktors Stimme auf.
Wissen Sie, weshalb ich gerade Sie um diese Sichat Nefesch gebeten habe? Sie sind jemand, der zuhören kann. Zuhören ist wichtiger als alles.
Ich will mich bemühen. Ich spüre, etwas bedrückt Sie.
Mein Leben.
Ihr Leben.
Es fährt an mir vorbei. Wie ein langsam rollender Zug, auf den man aufspringen sollte, aber bei jedem Wagen verpasst man es von Neuem.
Aber Sie leben doch. Nichts fährt an Ihnen vorbei. Sie sind Zahnarzt. Behandeln täglich Menschen und helfen ihnen. Sie sind Ehemann. Sie sind Jude. Wie ich verstehe, bemühen Sie sich, die Mitzwot einzuhalten.
Genau das sind die Eisenbahnwagen: der Zahnarztwagen, der Ehewagen, der Wagen mit den Mitzwot. Die rollen alle an mir vorbei.
Sie schauen überall rein, wollen Sie sagen. Aber nirgendwo sind Sie wirklich beteiligt.
Ich sagte ja: Sie können zuhören.
2
Rabbiner Bunem Kletzki war überrascht über Kleins Anruf.
»Ich wusste nicht, dass Sie mit Doktor Ehrenreich in Kontakt waren.«
»Seit einigen Jahren, ja.«
»Eine fürchterliche Geschichte. Weiß man denn schon mehr über den Tathergang? Gibt es eine Spur?«
»Das müssen Sie die Polizei fragen. Ich rufe Sie vor allem wegen eines Anliegens von Frau Ehrenreich an.«
Kletzki schwieg einen Augenblick. »Sie hat Ihnen gesagt, dass unser Verhältnis …«
»Ich habe aus ihren Worten herausgehört, dass es … angespannt ist. Warum eigentlich?«
»Das müssen Sie Frau Ehrenreich fragen. Von meiner Seite gibt es dazu keinen Anlass.«
»Lieber Reb Bunem«, sagte Klein freundlich und dennoch leicht gereizt. »Wir wissen alle, dass es immer zwei Seiten gibt. Sie werden vielleicht den Grund von Frau Ehrenreichs Zorn nicht verstehen. Aber kennen werden Sie ihn.«
»Ich hatte nie einen Konflikt mit Frau Ehrenreich. Mit ihrem Mann schon, das stimmt. Ich glaube, ihre Abneigung gegen mich ist mehr eine Form der Loyalität zu Viktor, als dass sie persönlich wäre.«
»Und was war Ihr Konflikt mit Viktor?«
Kletzki seufzte. »Ich will keinen Laschon hara sprechen.«
»Und ich will keinen Laschon hara hören«, sagte Klein leicht genervt. »Aber vielleicht hilft es ja, den Konflikt zwischen Ihnen und Sonja Ehrenreich beizulegen, wenn die Ursache analysiert werden kann. Gerade nachdem jetzt der Monat Elul begonnen hat.«
»Es fing eigentlich sehr gut an«, sagte Kletzki nach kurzem Zögern schließlich. »Die Ehrenreichs und unsere Familie kamen beide ungefähr gleichzeitig hierher. Ich war einer der ersten Absolventen des neuen Berliner Rabbinerseminars, Viktor übernahm die Praxis in Inzlingen vom Vater eines Studienfreunds, wenn ich mich nicht irre. Jeden Schabbat marschierte er stramm eine Dreiviertelstunde in die Synagoge und wieder zurück, am Freitagabend und am Schabbatmorgen. ›Sie durchqueren ein ganzes Land, um am Schabbat in die Synagoge zu kommen‹, sagte ich ihm damals. Wir haben uns gut verstanden.«
»Ein ganzes Land?«
»Na ja, die Eiserne Hand.«
»Reb Bunem, Sie sprechen in Rätseln.«
»Die Eiserne Hand ist ein schmales Stück Schweiz, das ins deutsche Staatsgebiet hineinragt. Das muss man durchqueren, um von Inzlingen ohne Umweg nach Lörrach zu kommen. Nur ein paar Hundert Meter, aber eben ein doppelter Grenzübertritt.«
»Ach so.«
»Jedenfalls, ich sah ihn immer als eine Stütze der Gemeinde an, er war ziemlich aktiv. Bis vor etwa sechs Jahren.«
Klein horchte auf. Das war kurz nachdem er Viktor in Arosa kennengelernt und bald darauf sein erstes Seelengespräch mit ihm geführt hatte.
»Was war vor sechs Jahren?«
»Kennen Sie Anschel Fink?«, fragte Kletzki zurück.
»Sie meinen den Anwalt? Mit dem Viktor die Neue Mussar-Bewegung gründete?«
Klein hörte Kletzki leise schnauben.
»Die Neue Mussar-Bewegung. Genau die, ja.«
»Die habe ich immer als leicht exzentrisches, aber harmloses Experiment verstanden«, meinte Klein. »Ich glaube, sie hatte zu ihren besten Zeiten etwa zwei Mitglieder.«
Kletzki lachte bitter.
»Exzentrisch können Sie laut sagen. Was die Harmlosigkeit angeht – kommt drauf an, was man darunter versteht.«
»Können Sie sich etwas klarer ausdrücken?«
»Die Neue Mussar-Bewegung verstand sich als Speerspitze gegen Chabad Lubawitsch. Oder jedenfalls verstand Viktor Ehrenreich sie so. Und weil ich Chabad Lubawitsch angehöre, hat er alles zu torpedieren versucht, was ich aufgegleist habe. Zuerst waren das nur diffuse Vorwürfe: Dass wir ein Feelgood-Judentum verkaufen und den Leuten mit unserem Maschiach-Gerede, wie er es nannte, den Kopf verdrehen. Was so üblicherweise von denen gesagt wird, die Chabad nicht mögen. Aber später hat er begonnen, regelrechte Komplotte gegen uns zu schmieden. Er hat behauptet, ich hätte Gelder der Gemeinde veruntreut, um eine Chabad-Veranstaltung zu bezahlen.«