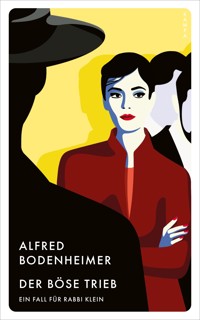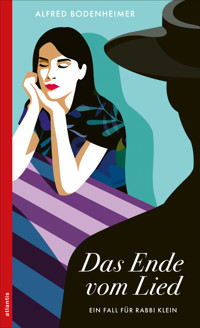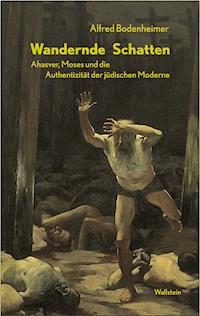Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Atlantis VerlagHörbuch-Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Rabbi Klein
- Sprache: Deutsch
Warum die Torah nicht mit dem ersten, sondern mit dem zweiten Buchstaben beginnt? Weil der zweite Kaffee immer der beste ist. Mit so weltlichen Bonmots beginnt Gabriel Klein gern seine Schabbatpredigt; die jüdischen Texte haben viel mit dem Alltag der Menschen zu tun, davon ist der Zürcher Rabbi überzeugt. Dass allerdings Bibelexegese auch bei Mordermittlungen helfen kann, wird Klein erst bewusst, als sein Gemeindemitglied Nachum Berger tot aufgefunden wird, vermutlich ermordet. Weil Klein die letzte Person war, mit der Berger in Kontakt stand, bestellt Karin Bänziger, Kommissarin der Stadtpolizei Zürich, den Rabbi zu sich ein. Wenige Tage erst ist es her, dass der Tote, ein beliebter Lehrer, bei den Kleins zu Besuch war. Verständlich, dass der Rabbi sich berufen fühlt, selbst ein wenig nachzuforschen. Das Nachdenken über den Brudermord Kains und die Prüfung Hiobs bringen ihn auf die entscheidende Spur …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bodenheimer
Kains Opfer
Kriminalroman
Atlantis
Rabbi Jehuda ben Tema sagt:
Sei mutig wie ein Panther, leicht wie ein Adler,
schnell wie ein Hirsch und stark wie ein Löwe,
den Willen deines Vaters im Himmel zu tun.
Mischna, Traktat Awot 5,6
1
»Warum beginnt unsere heilige Torah nicht mit demersten Buchstaben des hebräischen Alphabets? Warum mit dem zweiten? Weil der zweite Kaffee immer der beste ist.«
Gabriel Klein saß in seinem engen, hellen Arbeitszimmer und blinzelte in die Oktobersonne. Es war Donnerstagvormittag, und er schrieb wie jede Woche um diese Zeit seine Schabbatpredigt. Am Samstag würde der Torahzyklus von Neuem beginnen, mit dem Wochenabschnitt, der nach dem allerersten Wort benannt war: »Bereschit«, zu Deutsch: »Im Anfang«. Generationen von Gelehrten hatten zu erklären versucht, warum nicht dem ersten Buchstaben des hebräischen Alefbets, dem Alef, sondern eben dem Bet die Ehre widerfahren war, die Torah zu eröffnen. Dabei war einiges an Kreativität freigesetzt worden, eine bekannte Erklärung etwa lautete: Mit Alef beginnen die Wörter für die Eltern, »Aw« und »Em«, Vater und Mutter. Die Wörter für die Kinder hingegen beginnen mit Bet, »Ben« und »Bat«, Sohn und Tochter. Dass die Torah mit dem Bet beginnt, bedeutet deshalb, dass wir nicht in der ersten von Gott geschaffenen Welt leben. Frühere Welten waren an ihrer Ungerechtigkeit zugrunde gegangen.
Die Erklärung mit dem Kaffee stammte von seinem Vater. Sie war vielleicht theologisch nicht gerade stichhaltig, aber sie war eingängig, und sie würde einen guten Einstieg bieten für die Synagogenbesucher, die sich wieder auf das Jahr einstimmen mussten, ermüdet von den Herbstfeiertagen, die sich, vom jüdischen Neujahr über den Jom Kippur zum Laubhütten- und Torah-Freudenfest, über fast einen Monat erstreckt und erst am vergangenen Sonntag geendet hatten. Klein streckte die Glieder: Auf ins neue Jahr! Für Gabriel Klein war die lange Zeit der kalten, kurzen Tage immer eine Zeit des ungebremsten Tatendrangs. Ungebremst auch wegen der fehlenden Verlockungen der Natur. Denn Zürich zwischen Oktober und Februar, das bedeutete größtenteils bedeckten Himmel und giftige Kälte – der heutige Sonnentag wollte genossen sein!
Ein markanter Charakter war sein Vater gewesen, die große Figur von Gabriels Jugend. Und dennoch schon eine Gestalt aus einer ganz anderen Zeit, einer der vielen jüdischen Textilhändler, die damals in Zürich lebten und deren Nachkommen an der Universität studierten. Prinzipientreue war alles gewesen für Kleins Vater, in seiner Bürgerlichkeit wie in seiner Religiosität. Als »Vorkriegsware« hatte er sich selbst in bissigem Stolz auf seine zähe Gesundheit bezeichnet, die ihn seine jung verstorbene Frau lange überleben ließ. In Wirklichkeit war er »Zwischenkriegsware« gewesen, Ende der Zwanzigerjahre geboren, aber darauf hinzuweisen hätte kleinlich gewirkt.
Klein schaute die zwei Zeilen an, die er geschrieben hatte, und wusste nicht weiter. Zwar wollte er den Gedanken weiterverfolgen, wie er die Frage des Anfangsbuchstabens der Torah seiner Gemeinde in einem neuen Bild darstellen könnte: dass wir oft nur das anschauen, was uns als Erstes entgegenkommt – wie eben das Alef. Doch interessant wurde es erst, wenn man den Blick auf die Hintergründe richtete. Es war keine Hexerei, das in eine Predigt zu gießen, er hatte sich alle wesentlichen Punkte zurechtgelegt und brauchte nur noch einige Stichworte aufzuschreiben – von der vollständig abgelesenen Predigt war er in den letzten Jahren abgekommen.
Sein Blick schweifte vom Bildschirm weg auf die Tischplatte. Dort lag die Karte, die gestern angekommen war und ihn außerordentlich gerührt hatte. Eigentlich eine konventionelle, etwas kitschige israelische Neujahrskarte mit den üblichen Symbolen des Rosch-Haschana-Festes: Auf weißer Tischdecke ein Schofar, ein Topf mit Honig und ein Teller mit Apfelstücken, die man bei der ersten Mahlzeit des Festes in den Honig zu tunken pflegte, darunter in hebräischer und englischer Sprache der Neujahrssegen: »A Good and Sweet Year«. Eine Karte, wie Klein sie jedes jüdische Neujahr zu Dutzenden von Gemeindemitgliedern aus Freundlichkeit oder Gewohnheit zugeschickt bekam. Das Besondere an dieser Karte war weniger, dass sie über einen Monat unterwegs gewesen war, um von einer israelischen Poststelle in sein Haus zu gelangen, sondern der Absender, David Bohnenblust.
»Dein Ziehsohn«, nannte ihn Kleins Frau Rivka. Dabei hatte David damals höchstens zehn Tage bei ihnen gewohnt, nachdem Klein ihn am Hauptbahnhof aufgelesen und mit nach Hause genommen hatte. Sein einziges Gepäck war seine Geige in ihrem hellbraunen Geigenkoffer gewesen – um zur Not als Straßenmusikant etwas Geld zu verdienen, wie David erklärte. Später, als er die Matur machte – er war gerade siebzehn geworden – und beschloss, nach Israel zu gehen, hatte Klein ihm geholfen, einen Platz in einer Institution für junge ausländische Juden zu finden. Wie er ihm mit vielem geholfen hatte damals.
In den ersten Monaten hatte David aus Israel regelmäßig E-Mails geschickt, zuweilen recht ausführliche, über seine Erfolge, seine Krisen, sein Leben. Er hatte ihm auch die Aufforderung zu einer Facebook-Freundschaft geschickt, doch Klein mochte soziale Netzwerke nicht. Dann waren die E-Mails seltener geworden, schließlich ausgeblieben. Klein nahm es als ein gutes Zeichen. David hatte genug Zutrauen und würde sich melden, wenn er ihn brauchte. Offenbar hatte er seinen Platz gefunden.
Und deshalb hatte es den Rabbiner so gefreut, diese Karte zu bekommen. In seiner Handschrift, eine seltsame Verbindung aus fahrig und übergenau, hatte David mit einem schmierenden Kugelschreiber drei unverbindliche, aber nette Sätze geschrieben: »Lieber Herr Rabbiner, zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen beste Gesundheit, wie auch ihrer Familie. Länger haben Sie von mir nichts mehr gehört, aber machen Sie sich keine Sorgen, es geht mir gut. Ich hoffe, Ihnen auch.« Darauf folgte die gängige hebräische Glückwunschformel für das Neujahrsfest und Davids übliche Unterschrift: »Ihr David B.«
Schon beim zweiten Lesen allerdings war die Karte Klein eigenartig vorgekommen. Davids Aufforderung, sich keine Sorgen zu machen, deutete an, dass das Gegenteil angebracht war. David war nicht der Typ, der direkte Botschaften schrieb. Ein Hochbegabter, wie er im Buche stand, in sich gekehrt und geprägt von seinem leichten Tourette-Syndrom, das ihn immer daran gehindert hatte, innere Stabilität zu finden. In der Schweiz hatte nur die Musik ihm Ausgeglichenheit und Ruhe verschafft. Wohl eher deshalb, schätzte Klein, als um des Gelderwerbs willen hatte er seine Geige mitgenommen, als er von zu Hause weggelaufen war.
Aus Israel hatte David einmal berichtet, das Syndrom trete mittlerweile seltener auf. Aber die Krankheit hatte ihn zweifellos geformt, ihn in vielerlei Hinsicht übervorsichtig gemacht. Zwar hatte sie ihn nicht daran gehindert, nach Israel zu ziehen, aber sie hemmte ihn womöglich daran, sich dort unbefangen zu bewegen.
Gestern hatte Klein keine Zeit gehabt, auf die Karte zu reagieren. Nun beschloss er, seine Arbeit an der Predigt zu unterbrechen und David eine Mail zu schreiben.
Die Antwort kam prompt: Undelivered Mail Returned to Sender.
Sollte er die Eltern anrufen? Vielleicht würde er das heute Abend tun. Eine Neujahrskarte mit der fünf Wochen alten Nachricht ihres Sohnes, es gehe ihm gut, und eine Mailadresse, die nicht mehr funktionierte, waren kein guter Grund, einen Handchirurgen und eine Augenärztin mitten am Vormittag aus ihrer Arbeit zu reißen.
Oder er rief David direkt an. Vielleicht stand ja auf dem Briefumschlag seine Telefonnummer. Klein hatte den Umschlag gleich weggeworfen, nicht einmal achtlos, sondern bewusst. Seit einer mehrtägigen Aufräumaktion vor einigen Monaten hatte er sich vorgenommen, auf seinem Schreibtisch Ordnung zu halten. Der Umschlag musste noch im Papierkorb sein.
Als Klein sich bückte, um den Umschlag herauszufischen, vibrierte auf dem Tisch sein Telefon. Er fuhr hoch und schlug sich den Kopf an der Tischplatte an. Er fluchte leise und möglichst wenig gotteslästerlich und griff zum Apparat. Nachum Berger stand auf der Leuchtanzeige. Klein hielt sich den Kopf und meldete sich so gut gelaunt wie möglich.
»Nachum, was hört sich?«, fragte er mit der hebräischen Formel. »Ich habe deine Nachricht erhalten.«
Auf der anderen Seite blieb es einen Moment lang still. Dann meldete sich, etwas unsicher, eine Frau. »Hallo? Spreche ich mit Rabbi Klein?«, fragte sie auf Schweizerdeutsch.
Klein war perplex. »Ja«, sagte er gedehnt, nun ebenfalls vom Hebräischen in den Dialekt wechselnd, »hier spricht Rabbiner Klein. Mit wem habe ich die Ehre?«
»Es tut mir leid, dass ich Sie störe«, sagte die Stimme, nun sicherer geworden. »Mein Name ist Karin Bänziger, ich bin Kommissarin der Stadtpolizei Zürich.«
»Ja? Womit kann ich dienen?«, fragte Klein zögernd. Eine Kommissarin, die von Bergers Telefon aus anrief?
»Herr Klein, wäre es möglich, dass wir uns treffen? Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen.«
»Geht es um Herrn Berger? Ist ihm etwas zugestoßen? Ich meine, weil Sie von seinem Telefon aus anrufen.«
»Herr Berger wurde heute Morgen tot in seiner Wohnung aufgefunden«, sagte Kommissarin Bänziger. »Es tut mir leid. Ihre Nummer war der letzte Kontakt auf seinem Handy, deshalb rufe ich Sie an.«
Klein brachte kein Wort heraus.
»Könnten Sie um elf auf die Wache am Bahnhofquai kommen?«, fragte Frau Bänziger nach einer kurzen Pause.
»Um elf?« Klein schaute auf die Uhr. Es war kurz nach zehn. »Ja, doch, das sollte gehen«, sagte er langsam.
»Sehr gut, vielen Dank. Büro dreihundertneunzehn, dritter Stock. Bis gleich also.«
»Aber Herr Berger …«
»Wenn es Ihnen recht ist, besprechen wir alles Weitere in meinem Büro.«
Klein stützte den Ellbogen auf die Tischplatte, die rechte Hand, zur Faust geballt, auf seinen Mund gepresst. Heute Morgen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Ermordet? Warum sonst rief die Polizei von seinem Handy aus an?
Noch am letzten Freitagabend war Nachum bei Kleins zu Gast gewesen. Wie so oft. Aber gerade an diesem milden Herbstabend hatte er eine Vitalität versprüht, die selbst für seine Verhältnisse auffällig war. Es war der letzte Abend in der Laubhütte, und Nachum erzählte von einem Hebräischlehrbuch für Kinder, das er zur Begutachtung erhalten hatte. Es kam aus den USA, und es strotzte vor Fehlern. Berger hatte eine imaginäre Sitzung der Buchautoren inszeniert, die sich in fehlerhaftem Hebräisch mit starkem amerikanischem Akzent unterhielten. Klein hatte sich gebogen vor Lachen. Sogar der andere Gast, ein wortkarger junger Israeli, der als Sicherheitsbeamter auf dem Flughafen arbeitete und den Klein einige Tage zuvor, am Jom Kippur, in der Synagoge erstmals gesehen und für den Abend eingeladen hatte, musste lachen. Als Nachum, später als sonst, gegangen war, hatte Rivka ihren Mann noch darauf hingewiesen, dass sie in all den Jahren, die sie Nachum kannten, sein komisches Talent nicht bemerkt hatten. Und heute war er tot. Es war unfassbar.
Klein beschloss, den Weg zur Wache zu Fuß zurückzulegen. An ein Weiterschreiben der Predigt war ohnehin nicht mehr zu denken. Zu Hause war niemand, mit dem er hätte sprechen können, die Kinder waren in der Schule, und Rivka gab am Donnerstagmorgen den Kurs für angehende Konvertitinnen. Er nahm Mantel und Hut und verließ das Haus.
Klein hatte genug Zeit, um einen Umweg über das Seeufer zu nehmen. Er brauchte einen Moment des Innehaltens, einen Blick in die Weite, bevor er in dieses Polizeibüro treten und der Kommissarin Bänziger gegenübersitzen würde. Gewöhnlich konnte er im Stadtzentrum keine zehn Minuten gehen, ohne bekannte Gesichter zu treffen, und er war ein aufmerksamer Fußgänger, der die Menschen, die ihn unterwegs grüßten, auch zur Kenntnis nahm. Heute Morgen bog er, den Blick stur geradeaus, vom Schanzengraben her aus der Beethovenstraße in den Bleicherweg, geriet beinahe unter ein stürmisch klingelndes Tram und war trotz seines gemessenen Schritts ziemlich erschöpft, als er einige Minuten später den Bürkliplatz erreichte. Er ließ sich auf eine Bank fallen und schaute über den glitzernden See, auf dem sich die letzten Schwaden des Morgennebels lichteten. Am Horizont konnte man die Glarner Alpen erahnen, vor dem Bootshafen am Mythenquai schoss die Fontäne hoch. Die Panta Rhei, das größte Zürichseeschiff, war eben zur Grossen Rundfahrt gestartet, hinter ihren mächtigen Fensterscheiben fotografierten Dutzende Asiaten mit orangen Hüten das sich entfernende Ufer. Zwei Kinder fütterten die Schwäne und Enten, hinter ihm rollte gemächlich der Verkehr eines späten Zürcher Vormittags.
Klein war hier aufgewachsen, in dieser Stadt, genau zwischen der Enge und Wiedikon, er hatte seit früher Kindheit brav täglich für die Rückkehr des jüdischen Volkes nach Jerusalem und den Wiederaufbau des Tempels gebetet – aber die gut drei Jahre seines Lebens, die er insgesamt in Jerusalem verbracht hatte, waren Jahre der Sehnsucht gewesen nach dieser Stadt, ihrer Landschaft und ihren Menschen, die ihm nicht besonders sympathisch waren und größtenteils nicht wirklich nah – aber Heimat, auch in ihrer Kleinkariertheit. Das hier kannte er, hier ging er auf sicherem Grund, hier wusste er, was hinter der nächsten Ecke wartete – und auch, was ihm in düsteren Momenten Seelenruhe geben konnte. Er schloss die Augen, schob den Hut in den Nacken und spürte die milde Wärme auf seiner Stirn.
Nach ein paar Minuten fühlte er sich besser, erholt. Er erhob sich und trat den Weg zur Wache an.
Die Begegnung mit dem Tod war Teil seines Alltags. Oft ging es ihm nahe: bei jungen Menschen, bei Eltern von kleinen Kindern, bei Selbstmördern. Es gab auch alte oder kranke Menschen, deren Tod absehbar war, die er aber bei seinen wöchentlichen Besuchen in den Spitälern und jüdischen Altersheimen ins Herz geschlossen hatte. Hin und wieder wurden die sterblichen Überreste von der Polizei beansprucht, wenn die Todesursache nicht eindeutig war. Aber dass die Polizei ihn angerufen und augenblicklich einbestellt hatte, noch dazu bei einem Menschen, den er sehr gut gekannt hatte und der ihn gestern noch zu erreichen versucht hatte, das war eine neue Erfahrung, und er konnte sich darauf überhaupt keinen Reim machen.
Um Punkt elf Uhr klopfte er an der Tür von Frau Bänzigers Büro. Ein stämmiger junger Mann mit dunklen Locken öffnete. »Herr Klein?«
»Ja.«
»Bitte kommen Sie doch herein«, rief da Frau Bänziger von hinten im Raum, und er sah sie, eine gedrungene Mittvierzigerin mit dichtem schwarzem Haar, in Jeans, heller Bluse und legerer Jacke, vor sich einen offenen Aktenordner. Sie starrte noch in die Unterlagen auf ihrem Tisch, sah dann aber auf, kam hinter dem Schreibtisch hervor und gab ihm die Hand. Der junge Mann, der sich ihm vorstellte, dessen Namen er aber nicht verstand, nahm ihm den Mantel ab, und Klein setzte sich an den runden Besprechungstisch.
Während Frau Bänzigers Assistent sich an seinem Laptop zu schaffen machte, schaute Klein sich um. Die Wände waren fast vollständig mit eleganten Büroregalen voller Aktenordner bedeckt. Nur links neben der Tür und neben dem breiten Fenster hingen zwei Kandinsky-Farbdrucke. Einen von ihnen, Bleu de ciel, hatte Klein als Jugendlicher selbst in seinem Zimmer hängen gehabt – ein Mitbringsel seiner Eltern von einer Reise nach Paris. Obwohl dieses Bild, das er immer sehr geliebt hatte, die gnadenlose Nüchternheit dieses Raumes etwas linderte, blieb er doch beklemmend unpersönlich. Klein hatte das Gefühl, dieser freundlichen, aber unnahbaren Kommissarin samt ihrem schweigenden Assistenten in einem sterilen Reich reiner Funktionalität gegenüberzusitzen. In unangemessener Schroffheit, als hätte sie ihn unverschämt lange warten lassen, fuhr er Frau Bänziger an: »Nun sagen Sie mir bitte schon, was mit Nachum Berger passiert ist.«
»Herr Rabbiner Klein«, sagte die Kommissarin bedächtig, wie um ihn durch die Nennung seines Titels an sein Amt zu mahnen, das ein ruhigeres Auftreten verlangte. »Wir sind vor gut zwei Stunden alarmiert worden, weil ein Lehrerkollege aus der Schule Herrn Berger gefunden hat. Herr Berger war nicht zum Unterricht erschienen und hatte auf Anrufe nicht geantwortet. Er ist, der Schätzung unseres Gerichtsmediziners zufolge, gestern Abend, wahrscheinlich zwischen zwanzig und zweiundzwanzig Uhr, in seiner Wohnung verstorben.«
»Sie meinen: ermordet worden. Sonst säßen wir hier nicht beieinander«, fiel Klein ihr ins Wort.
Frau Bänziger antwortete ruhig. »Er ist sicher unter Gewaltanwendung gestorben, ob er aber tatsächlich durch die Gewaltanwendung gestorben ist, muss noch geklärt werden.«
»Ich verstehe nicht.«
»Herr Berger wurde offenbar mit einem Gegenstand mehrmals auf den Kopf geschlagen. Aber ob diese Schläge den Tod verursacht haben, müssen wir untersuchen. Wir haben in Herrn Bergers Wohnung Herzmedikamente gefunden, und es könnte sein, dass die Todesursache ein Herzinfarkt war.«
Klein schwieg. Er hatte von Bergers Herzschwäche nicht gewusst.
»In welchem Verhältnis standen Sie zu Herrn Berger?«, fragte Frau Bänziger. »Wie ich Ihnen schon gesagt habe, waren Sie der letzte Kontakt auf seinem Handy gestern Nachmittag um zwei Minuten nach halb fünf.«
»Nun ja«, sagte Klein, und seine Kehle war so trocken, dass er fürchtete, bald husten zu müssen, »ich bin der Rabbiner der hiesigen jüdischen Gemeinde. Herr Berger war ja Lehrer für Hebräisch und Religion an der jüdischen Primarschule. Er war auch der Lehrer meiner beiden Töchter. Er lebte allein, und wir luden ihn alle paar Wochen zum Essen am Schabbat ein. Er war ein angenehmer und anregender Gast. Wir hatten oft spannende Diskussionen, er war an vielen Themen interessiert. Zuletzt war er vor einigen Tagen bei uns, zum Ende des Laubhütten-festes.«
»Fiel Ihnen etwas auf in seinem Verhalten?«
»Nein, nichts – außer vielleicht, dass er besonders gut gelaunt war.«
Frau Bänziger nickte fast unmerklich. »Und weshalb hat Herr Berger Sie gestern angerufen?«
»Oh, er hat mir nur eine Nachricht hinterlassen.«
»Und wie lautete der Inhalt dieser Nachricht?« Frau Bänziger hatte einen Moment gewartet, und ihre Frage hatte einen leicht verärgerten Unterton, weil Klein den Inhalt nicht gleich mitgeliefert hatte.
»Nichts von Belang. Er hatte sich von einem Kurs am Abend abgemeldet. Ich halte jeden Mittwochabend um acht Uhr eine Stunde für einige Herren ab, in dem wir den Talmud studieren. Er hat regelmäßig daran teilgenommen. Aber gestern Abend konnte er nicht.«
»Nichts von Belang?«
Es dauerte einige Sekunden, bis Klein die Nachfrage verstand. Dann erschrak er über seine eigene Dummheit. Nichts von Belang! Genau während der Zeit dieses Kurses war Berger zu Tode gekommen!
Frau Bänzigers Ausdruck blieb freundlich interessiert. »Hat er einen Grund genannt, weshalb er nicht kommen würde?«
»Ich glaube nicht. So genau habe ich nicht hingehört. Mir ging es nur um die Information, die Abmeldung. Ich fand es nett, dass er mir extra Bescheid gab, das machen nicht alle.«
»Haben Sie die Nachricht noch auf dem Handy?«
»Ich denke, ja. Sie ist aber auf Hebräisch. Herr Berger war ja Israeli.«
»Könnten Sie die Nachricht nochmals abspielen und sagen, ob Herr Berger tatsächlich keinen Grund für seine Abwesenheit nennt?«
»Ja, natürlich«, sagte Klein. Doch schon als er in seinen Hosentaschen zu kramen begann, und erst recht, als er pro forma aufstand und die Taschen seines Mantels überprüfte, in die er das Telefon nie einsteckte, wurde ihm klar, dass er es zu Hause auf dem Schreibtisch hatte liegen lassen.
»Es tut mir leid«, sagte er. »Ich war zu aufgewühlt, als ich das Haus verließ.«
Nun plötzlich wurde ihm auch klar, weshalb er auf dem Weg hierher so viel Ruhe gehabt hatte. Bestimmt hatten ihn währenddessen tausend Leute gesucht im Zusammenhang mit Bergers Tod. Nun ja, diesen stillen Moment am See nahm ihm keiner mehr.
»Bitte löschen Sie die Mitteilung auf keinen Fall«, sagte Frau Bänziger, was er als beleidigend empfand. »Und achten Sie genau darauf, was Herr Berger sagt.«
»Selbstverständlich.«
Offenbar machte er einen etwas jämmerlichen Eindruck. Frau Bänziger fragte ihn, ob er etwas zu trinken wolle, und er konnte nur ergeben nicken, worauf der junge Mann ihm einschenkte. Klein trank zu schnell, und die Kohlensäure verursachte ihm Aufstoßen, einen Moment lang sogar Übelkeit.
Frau Bänziger nippte derweil souverän und schlückchenweise an ihrem Wasser. »Hatte Herr Berger Feinde?«, fragte sie unvermittelt.
»Soweit ich weiß, nein.«
»Er hat Ihnen gegenüber nie erwähnt, dass er mit jemandem Streit hat, vor jemandem Angst hat?«
Wer sollte einen unbescholtenen, alleinstehenden Primarlehrer töten? Was für Feinde sollte denn so einer haben? »Schauen Sie«, rief er aus, »Nachum Berger hatte als Lehrer mit vielen Leuten zu tun. Manche mögen einen, andere nicht. Das geht einem Rabbiner nicht anders, wie es mit Kommissarinnen ist, weiß ich nicht. Aber hier geht es doch um Mord!«
Frau Bänziger schien seinen besserwisserischen Ton wenig zu schätzen. Ihr Blick, der bislang etwas behäbig wirkte, wurde plötzlich streng, die Stimme zum ersten Mal etwas spitz: »Erstens, Herr Rabbiner: Ob wir von Mord sprechen, wissen wir, wie bereits gesagt, noch nicht. Vielleicht von Gewalteinwirkung mit Todesfolge. Zweitens habe ich gefragt, ob er Feinde hatte. Mir ist auch klar, dass ein Elternpaar, das mit der Unterrichtsmethode unzufrieden ist, noch kein zureichendes Motiv besitzt, den Lehrer in seiner Wohnung tätlich anzugreifen.«
Etwas kleinlaut meinte Klein: »Über Feinde weiß ich nichts.« Und nach einer kurzen Pause: »Ist denn jemand gewaltsam in die Wohnung eingedrungen?«
»Nein«, sagte die Kommissarin, »er scheint den oder die Mörder eingelassen zu haben, oder die Wohnungstür war offen.« Sie schwieg einen Moment und fuhr dann fort: »Hat Herr Berger Angehörige?«
»Er hatte in Israel eine Frau, von der er sich aber wohl schon vor Jahrzehnten, kurz nach der Hochzeit, scheiden ließ. Das hat er einmal erwähnt, als ich ihn zur Familie befragte. Über andere Angehörige weiß ich nichts. Er hat nie davon gesprochen, hatte meines Wissens nie Besuch von Verwandten und lebte allein.«
Dass Berger allein lebte – darauf bestand, allein zu leben –, das hatte tatsächlich viele Mitglieder der Gemeinde irritiert. Es entsprach nicht dem Bild, das sich die Leute von einem gläubigen Juden machten, der zudem extrovertiert und gut aussehend ist. Klein erinnerte sich an die Zeit vor zwanzig Jahren, als er und Rivka frisch verheiratet waren und Berger nach Zürich gekommen war. Obwohl schon Mitte dreißig, hatte er rasch etliche Mütter von heiratsfähigen Töchtern in Schwiegermütterträume versetzt, und auch mehrere jüngere Damen des jüdischen Zürich schienen sich für ihn zu interessieren. Die rothaarige Claudette Weiss, die schon so manchen abgewiesen hatte (vor längerer Zeit einmal auch Klein selbst), verliebte sich unsterblich in Nachum, wie allgemein bekannt war, und sie umwarb ihn heftig und mit Ausdauer. Doch Nachum Berger, stets freundlich und humorvoll, blieb allein. Er kränkte niemanden und ließ niemanden an sich heran.
Natürlich wurde getratscht. Warum widerstand dieser Mann, der nett und attraktiv war und den man so gut aufgenommen hatte, jeglichem Versuch, ihn mit den weiblichen Mitgliedern der Gemeinde in näheren Kontakt zu bringen? War er schwul? Impotent? Von seiner ersten Ehe so nachhaltig traumatisiert, dass er jeden näheren Kontakt zum weiblichen Geschlecht fortan mied? Viele waren davon überzeugt, dass seine Abweisung, die sich immer als bescheidene Zurückhaltung gab, auch verantwortlich dafür war, dass Claudette Weiss – ausgerechnet sie! – lange keine feste Beziehung einging, um dann mit vierzig einen reichen holländischen Juden zu heiraten. Gut zwei Jahre später kehrte sie, schönheitsoperiert und finanziell abgesichert, aber auch geschieden nach Zürich zurück. »Die hat der Berger auf dem Gewissen«, hatte Klein einmal jemanden sagen hören – als hätte Nachum sich an ihr vergangen.
Nur langsam hatten sich die Leute aus der Gemeinde an den Umstand gewöhnt, dass Berger einfach allein bleiben wollte. Manche nannten ihn deswegen »undurchsichtig«, respektierten zwar seine pädagogische Kompetenz, mieden aber den privaten Kontakt.
Frau Bänziger brachte das Gespräch zu einem Ende. Sie erinnerte Klein nochmals daran, dass er die Nachricht von Berger auf dem Handy abhören solle, und bat um Verständnis, dass die Leiche bis zum Abschluss der gerichtsmedizinischen Untersuchungen für die Beerdigung nicht freigegeben werden könne. »Ich weiß, dass Juden ihre Toten so schnell wie möglich beerdigen. Wir werden die Sache nicht über Gebühr hinausziehen.«
Nun fühlte sich Klein wieder ganz in seinem Element. Freundlich, nicht ohne eine leicht gönnerhafte Note, sprach er der Kommissarin das Vertrauen aus, dass die Behörden effizient und wie immer mit größter Rücksicht auf die religiösen Belange der jüdischen Gemeinschaft handeln würden. Sie verabschiedeten sich voneinander mit einem verbindlichen Lächeln, der Assistent mit dem unverständlichen Namen half ihm in den Mantel, reichte ihm den Hut, und in, wie er fand, wiederhergestellter Würde verließ Klein das Amtsgebäude.
Auf dem Rückweg nahm Klein das Tram. Mit ihm zusammen stieg am Rennweg eine lärmende Schulklasse ein. Er schaute auf die lachenden, feixenden Kinder, und es fiel ihm eine Bemerkung von David Bohnenblust ein, dessen Hebräischlehrer Nachum Berger auch einmal gewesen war: »Er ist fast zu nett.« Klein hatte damals nachgefragt, was David damit meine. »Er war immer auf unserer Seite«, hatte David erklärt. »Als wären wir seine eigenen Kinder.«
Und dabei erinnerte sich Klein, dass er es wegen des Anrufs von Frau Bänziger und der folgenden Aufregung versäumt hatte, das Couvert von Davids Karte aus dem Papierkorb zu holen. Plötzlich machte er sich Vorwürfe, dass er den Kontakt mit David zu lange vernachlässigt hatte. Damals hatte er ihm geholfen, in seiner Krise, als er von zu Hause weggelaufen war, und ihn wieder auf die Beine gestellt. Aber hatte er ihn nach der Matur unbewusst vielleicht deshalb nach Israel vermittelt, um ihn los zu sein? »Ziehsohn«, murmelte er. Eine fast etwas eifersüchtige Bezeichnung. Aber wenn sie zutraf, dann war er ein miserabler Ziehvater. Er hätte sich zumindest erkundigen müssen, ob David in regelmäßigem Kontakt mit seinen Eltern stand, vor deren grenzenlosen Ansprüchen er damals geflohen war. Immer mehr glaubte Klein, in den wenigen Zeilen von Davids Karte Verzweiflung zu erkennen. Die Möglichkeit, dass er sich das bloß einredete, verschwand fast vollständig hinter seinem schlechten Gewissen.
Als er gegen halb eins nach Hause kam, war Rivka bereits vom Konvertitinnen-Kurs heimgekehrt. Sie holte ihn rasch wieder in die Realität zurück. »Wo warst du denn? Warum erreicht man dich nicht? Unser Telefon klingelt ununterbrochen. Die Chewra Kadischa, die Efrat-Schule, das Gemeindesekretariat – alle suchen dich händeringend. Nachum Berger soll ermordet worden sein.«
»Deswegen war ich weg. Die Kommissarin hat mich auf die Wache bestellt, und ich hatte mein Telefon hier liegen lassen. Aber erstens ist noch nicht klar, dass es Mord war«, sagte Klein lehrerhaft und wichtig, »zweitens bringt die Aufregung im Moment gar nichts. Wir müssen jetzt auf die Befunde warten – und auf die Freigabe des Mess. Sie sollen nicht gleich alle den Kopf verlieren.«
»Du hast ihn ja offenbar auch verloren, sonst hättest du das Telefon mitgenommen«, meinte Rivka. »Und außerdem geht es hier auch um Kinder. Die Schüler in der Efrat sind vollkommen durcheinander. Ich fürchte, Rina auch – ich hole sie heute ausnahmsweise ab. Was hat die Kommissarin denn gemeint?«
»Gemeint hat sie nichts. Sie wissen nicht, ob er getötet oder nur verletzt worden und an einem Herzinfarkt gestorben ist.«
»Glauben sie, dass es Risches war?«
»Ich weiß nicht, was sie glauben. Sie müssen es halt herausfinden.«
»Na ja.« Rivka wiegte den Kopf. »So, wie sie es damals bei Rabbi Grünbaum herausgefunden haben.« Vor einigen Jahren war mitten in Wiedikon, nicht weit vom koscheren Restaurant, auf offener Straße ein Rabbiner aus Israel ermordet worden. Man vermutete antisemitische Motive. Doch der Mörder wurde nie gefunden. Das hatten die Zürcher Juden nicht vergessen.
»Wir werden sehen«, nuschelte Klein und verzog sich in sein Arbeitszimmer. Tatsächlich quoll sein Telefon über vor Kurznachrichten, mündlichen und schriftlichen. Er ging alles durch, aß mit Rivka eine Kleinigkeit und machte sich unwillig daran, die wichtigsten Anrufe zu erledigen: mit dem Rektor der Efrat-Schule, dem Präsidenten der Chewra Kadischa und mit Frau Wild, die von weiteren Anrufen im Büro berichtete. Es gab, wie Klein in den Jahren seiner Tätigkeit hatte feststellen können, bei einer Reihe von Gemeindemitgliedern den Reflex, in Momenten großer Bestürzung den Rabbiner anzurufen. Am Telefon wussten sie dann meistens gar nichts zu sagen, hörten auch gar nicht zu, sondern wiederholten immer wieder die schreckliche Nachricht und ihre Fassungslosigkeit, dann legten sie wieder auf.
Klein rief sie alle zurück, obwohl es ihn fast den ganzen Nachmittag kostete. Denn noch schlimmer, als sich die banale Ratlosigkeit der Leute anzuhören, war, sie damit allein zu lassen.
2
»Rabbiner? Das ist doch kein Beruf für einen anständigen jüdischen Jungen.« Mit diesem Urteil seines Vaters im Ohr war Klein aufgewachsen. Auch als er nach der Matur für ein Jahr die Jeschiwa in Israel besucht und einmal erwogen hatte, seine Talmudstudien fortzusetzen, ein Rabbinerdiplom zu erlangen und eine Laufbahn als Rabbiner in Deutschland oder in der Schweiz anzustreben, hatte er die Idee bald verworfen. Ein Grund war, dass er nicht jeden Morgen von Amtes wegen schon um sechs Uhr aufstehen wollte, um pünktlich beim Morgengebet zu sein. Außerdem wollte er seine Privatsphäre wahren. Wenn er Rabbiner wäre, würde jeder Schritt und jedes Wort von den Mitgliedern und dem Vorstand der Gemeinde beobachtet und kommentiert.
Deshalb war er am Ende an die Universität gegangen und hatte Geschichte studiert.
Auch Rivka hatte immer abgewinkt, wenn er erzählte, dass ihn das Rabbineramt eigentlich interessiert hätte. Als Rebbezen sah sie sich nicht. Sie war in der kleinen jüdischen Gemeinde von Bern aufgewachsen, sie hatten sich an einem der legendären jährlichen Fußballturniere der Schweizer Juden kennengelernt. Sie spielte im gegnerischen Team, und er hatte ihr einen Schuss ins Gesicht platziert. Er hatte sich danach um sie gekümmert – ihr Nasenbein war zum Glück nicht gebrochen, und aus der ersten, schmerzvollen Begegnung wurde rasch eine Liebesgeschichte. Rivka hatte die Beziehung zwar auch einmal für eine Weile beendet; sie hatte sich noch für andere Jungen interessiert. Damals hatte Klein um Claudette Weiss geworben – rückblickend war es wohl eher eine Pflichtübung. Das schönste jüdische Mädchen von Zürich durfte man nicht unbeachtet lassen, wenn man schon wider Willen frei war. Doch am Ende hatte nichts an Rivka vorbeigeführt. Auch wenn er, anders als chassidische Juden, den Begriff des »Beschertseins«, der himmlischen Bestimmung eines Mannes und einer Frau füreinander, belächelte – besonders angesichts dessen, was er als Rabbiner so mitbekam –, in seinem und Rivkas Fall traf er zu.
Klein hatte sich schon mit seiner Diplomarbeit auf die jüdische Geschichte der Frühen Neuzeit spezialisiert, eine schöne (keine überragende) Doktorarbeit geschrieben und schließlich eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer kleinen Universität gefunden, zu der er von Zürich aus bequem pendeln konnte.
Doch diese Stelle hatte sich als Sackgasse erwiesen, in jeder Hinsicht. Zum einen hatte er sich verleiten lassen, statt eine Habilitation zu schreiben, eine Edition unveröffentlichter Regesten zu übernehmen. Das Projekt war zweifellos sehr renommiert, und er erhoffte sich davon einige Beachtung in der Fachwelt. Doch es wurde ihm bald klar, dass die akribische Arbeit an Editionen nichts für ihn war. In wachsendem Rückstand zum vorgesehenen Zeitplan saß er zwischen seinen Dokumentkopien und langweilte sich zu Tode, zerfressen vom Gefühl, dabei seine Zeit zu vergeuden, während die ersten gleichaltrigen Forscher auf Professuren berufen wurden.
Hinzu kam, dass der Ort seines Wirkens ihm zunehmend zuwider war. Die Erkenntnis ließ sich nicht länger verdrängen, dass in dem katholisch inspirierten Institut, für das er arbeitete und das sich dem christlich-jüdischen Dialog verschrieben hatte, immer ein Christ der Chef und ein Jude der untergeordnete Mitarbeiter sein würde. Er hatte, als ihm das klar wurde, um einen Termin beim Rektor der Universität gebeten und ihm erklärt, dass das nicht zeitgemäß sei, dass ein Dialog nicht von oben nach unten geführt werden könne. Der Rektor hatte freundlich, aber unverbindlich reagiert, die Institutschefin hingegen hatte Klein am folgenden Tag regelrecht zusammengestaucht. Hinter ihrem Rücken! Zu intrigieren! Er könne froh sein! Bei seinem wissenschaftlichen Output!
Da war es ihm wie eine Erlösung erschienen, dass wenige Tage später der Anruf von der jüdischen Gemeinde kam. Der Präsident lud ihn zu einem Lunch ein und fragte ihn, ob er an der Nachfolge des scheidenden Rabbinatsassistenten interessiert sei. Er deutete an, dass eine Weiterbildung Kleins zum Rabbiner on the job für die Gemeinde ein durchaus denkbares, sogar erwünschtes Modell sein könnte. Rivka, die begriffen hatte, dass ihn die Tätigkeit an der Universität ins Elend führte, gab ihr Einverständnis. »Dann werde ich halt in Gottes Namen eine Rebbezen«, hatte sie nur gesagt, doch ihr Blick signalisierte Zustimmung und sogar eine gewisse Freude auf die Herausforderung.
Klein hatte pro forma um drei Tage Bedenkzeit gebeten. Am zweiten Tag hielt er es nicht mehr aus, fürchtete plötzlich panisch, es könnte ihm noch jemand zuvorkommen und er würde auf ewig hinter seinen Regesten sitzen, blockiert und zum interreligiösen Dialog mit einer Chefin verdammt, die ihn verachtete und niemals weiterkommen lassen würde. Er rief die Gemeinde an, räumte am nächsten Tag alle Ordner aus seinem Büro und schickte sie zum Editionsleiter nach Frankfurt zurück. Zwar behauptete Rivka noch lange, der eine Tag, an dem er vor Ablauf der Bedenkzeit zusagte, habe ihn zehn Prozent seines Gehalts gekostet. Aber solche Spekulationen waren ihm gleichgültig. Er fühlte sich befreit, ging wochenlang wie auf Wolken. Die drei Monate bis zum Amtsantritt in der Gemeinde saß er in seinem Institut am leer geräumten Tisch und begann sich auf das vorzubereiten, was er als rabbinische Karriere erachtete.