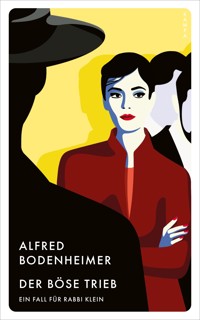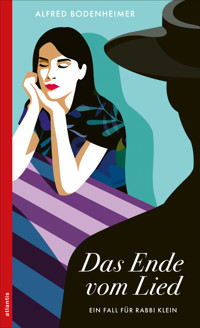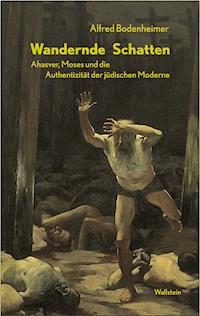Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kinny Glass
- Sprache: Deutsch
In der Jerusalemer Altstadt erschießt eine Polizistin den dreißigjährigen Musa Hamid, weil sie die Gesten des autistischen Mannes falsch deutet. Wenige Tage später stürzt der Chef der Bereitschaftspolizei Uriah Zunder auf Zypern von einer Klippe in den Tod – er war es, der seinen Untergebenen befohlen hat, »proaktiv gegen Terroristen vorzugehen«, also im Zweifelsfall Menschen zu töten, die noch gar kein Verbrechen begangen haben. War es ein Unfall, wie die offizielle Version lautet? Oder eine Kurzschlussreaktion Zunders, der noch kurz vor seiner Abreise bei der Polizeipsychologin Kinny Glass in einer Sprechstunde war? Je mehr Kinny über die Umstände seines Todes erfährt, desto mysteriöser erscheinen ihr diese, und allen offiziellen Anordnungen zum Trotz stellt sie eigene Nachforschungen an. Dabei wächst ihr Entsetzen über die politische Situation in ihrem Land, die solche Tragödien begünstigt. Privat stehen Kinny große Ereignisse bevor: Ihre Tochter erwartet das erste Kind, ihre Eltern ziehen in eine Seniorenwohnung, und dann kündigt noch Helmut aus Stuttgart seinen Besuch an, ein ehemaliger Kommilitone, in den Kinny damals verliebt gewesen ist …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bodenheimer
In einem fremden Land
Ein Jerusalem-Krimi
Roman
Kampa
Dieser Roman wurde in den Monaten
Juli und August 2023 geschrieben.
1
»Kinneret«, klang es monoton aus dem kleinen Lautsprecher.
Kinny Glass legte den Zettel mit ihrem Namen auf die Theke, und eine übermüdete junge Frau schob ihr das Tablett mit dem Café Hafuch und einer Bureka mit bulgarischem Käse hin. Kinny nahm das Tablett entgegen und setzte sich damit an einen der Bistrotische im hintersten Winkel der Ankunftshalle des Flughafens.
Eine knappe Stunde Verspätung war für die Abendmaschine aus Frankfurt angekündigt, und Kinny war ohnehin sehr zeitig gekommen. Sie hatte außer einem Apfel nichts zu Mittag gegessen, weil der Tag vollgestopft gewesen war mit Terminen. Der Druck, unter den die Polizei in den vergangenen Monaten seit Antritt der neuen Regierung gekommen war, die Unsicherheit und Angst der Beamten, auch ihre Überforderung durch außerordentliche Einsätze, die ihnen Überstunden abverlangten – das alles machte sich immer stärker auch im polizeipsychologischen Dienst bemerkbar. Gestandene Mitglieder des Korps waren während der Gespräche mit Kinny in Tränen ausgebrochen. Ihr wurde immer klarer, dass die einst einigermaßen geeinigte Truppe in Individuen zerfallen war. Keiner wusste mehr, was der andere dachte, ob jemand sich auf Kosten von Kollegen Vorteile verschaffen würde.
Sogar Uriah Zunder, der Chef der Bereitschaftspolizei, war innerhalb weniger Tage zweimal bei ihr gewesen. Kinny hatte extra Abendtermine außerhalb ihrer Arbeitszeit für ihn eingeräumt, was sie eigentlich nie tat, wenn sie nicht zum Pikettdienst eingeteilt war oder in Fällen unvorhersehbarer Katastrophen wie Attentaten. Doch Zunder war immerhin eine Führungskraft, und wenn er psychologische Unterstützung anforderte, konnte ein Hinauszögern für viele, die seinem Befehl unterstanden, zum Problem werden. So zumindest hatte sie vor sich gerechtfertigt, weshalb sie ihm spontan Treffen angeboten hatte, die für sie selbst mit Überstunden verbunden waren. Gleichzeitig musste sie sich eingestehen, dass die Gerüchte, Zunder könnte der nächste Kommandant des ganzen Jerusalemer Polizeidistrikts werden, auch eine Rolle bei ihrem Entscheid gespielt hatten. Sie machten ihn zu einer Person, deren Anliegen zu verweigern künftig seinen Preis haben könnte.
Sie hatte bereits beim ersten Treffen eine tiefgehende Verstörung an Zunder festgestellt. Wie viele andere Beamte auch, die mit der Sprache nicht herausrücken wollten und meinten, dennoch ihre Probleme auf den Tisch legen zu können, klagte er über Schlafstörungen »seit einigen Nächten«.
»Wissen Sie, was diese Schlafstörungen verursacht?«
»Stress, denke ich.«
»Hat dieser Stress denn gerade in der jüngsten Zeit zugenommen?«
»Er hat sich aufgestaut, würde ich sagen.«
Bei allen weiteren Versuchen, irgendetwas über diesen Stress herauszufinden, hatte er gemauert.
»Was wollen Sie denn von mir, Uriah? Mit welchen Erwartungen sind Sie zu mir gekommen?«
»Dass Sie mir helfen, Stress abzubauen.«
»Da gibt es schon Möglichkeiten. Aber wenn Sie sich in einer akuten Notsituation befinden, vielleicht am Beginn einer Depression, dann nützt es nichts, über Mittag eine halbe Stunde zu meditieren, um nachher gleich wieder in denselben Trott einzusteigen. Dann müssen Sie ernsthaft herunterfahren, eine Weile sogar ganz pausieren.«
Zunder hatte sich am Kopf gekratzt. Kinny wunderte sich immer wieder, mit welchen Vorstellungen die Leute zu ihr kamen. Als erhofften sie sich von einem einzigen Gespräch mit ihr das Rezept zur Behebung ihrer Probleme.
»Eine Krankschreibung, meinen Sie«, hatte er schließlich gesagt.
»Ja, eine Krankschreibung. Die kann ich Ihnen nicht ausstellen, aber ich kann einen Brief an Doktor Wigoder schreiben und ihn bitten, dass er Ihnen rasch einen Termin gibt. Von ihm erhalten Sie dann die Krankschreibung.«
Er sah sie unsicher an, und für einen Moment erinnerte er sie an ihren Yorkshireterrier Itztrubal, an diesen resigniert-erwartungsvollen Blick, wenn er darauf wartete, das im Napf bereitliegende Futter zu verschlingen, bis sie das ausschlaggebende »o.k.« ausgesprochen hatte. Kinnys Tochter Mia hatte den Hund seinerzeit ohne Rücksprache mit Kinny in ihre Wohnung gebracht. Und Mia war es auch gewesen, die dann im Internet recherchiert hatte, dass das Training eines solchen »O.k.«-Kommandos zu einer anständigen Hundeerziehung gehörte und dass das Fehlen ebendieses Kommandos der Grund sein musste, warum Itztrubal sich nicht gleich auf den vollen Fressnapf stürzte, sondern diesen sonderbaren Blick aufsetzte und dabei den Kopf auffordernd nach hinten drehte. Seine vorherigen Besitzer, das ermordete Ehepaar Wacholder, mussten ihn zu diesem Gehorsam erzogen haben.
»Ich gehe zu Wigoder«, hatte Zunder dann gesagt. »Aber Sie brauchen ihm nicht zu schreiben. Ich werde ihm sagen, dass ich bei Ihnen war, das sollte ja reichen.«
Die Bureka war fett und der Käse zu salzig, der Kaffee immerhin trinkbar. Den Leuten an den Tischen rundum sah man an, dass niemand dasaß, weil er sich diesen Ort ausgesucht hatte. Eine Gruppe strohblonder Rucksacktouristen saß um einen Tisch, jeder mit seinem Handy beschäftigt, dazwischen riefen sie sich Namen von Orten zu – sie schienen jetzt, nach der Landung, ihre Reise überhaupt erst richtig zu planen. Ein arabischer Geschäftsmann im feinen Zwirn, der einen eleganten Trolley neben sich stehen hatte, nippte an einem Espresso im Kartonbecher. Wahrscheinlich wartete er auf die nächste Zugverbindung, einen verspäteten Taxifahrer oder ein Familienmitglied, das ihn abholen sollte. Eine ältere Frau sprach über die Lautsprecher ihres Telefons mit einem hörbar keuchenden »Shuli«, offenbar ihr Sohn, begleitete ihn für alle hörbar auf jedem Schritt seines Weges, vom Fingerdock durch die biometrische Passkontrolle, die lange weite Rampe hinunter in die Ankunftshalle mit den Kofferbändern und dann auch noch während der ewigen Warterei auf das Aufgabegepäck.
»Die Idioten haben das Gehlaufband auf der Rampe abgestellt«, maulte Shuli, den Kinny sich als adipösen Mittdreißiger vorstellte.
»Was willst du?«, sagte die Mutter, »alles in diesem Land ist im Abwärtsgang.«
»Ja, alles außer dem Laufband auf dieser Rampe hier«, meinte der Sohn.
Die Mutter schien nicht zu verstehen, was er meinte, aber Kinny grinste in sich hinein. Gerade wollte sie checken, ob der Flieger aus Frankfurt nun endlich gelandet sei, da klingelte ihr Telefon. Der Anruf kam von Helmuts deutscher Nummer über eine Internetverbindung, und während Kinny im Hintergrund noch die plärrenden Anweisungen der Flugassistentin nach der Landung hörte, rief Helmut auf Englisch in die Sprechmuschel: »Wir sind am Ausrollen – hast du’s zum Flughafen geschafft?«
»Ja«, sagte Kinny, sicher viel weniger enthusiastisch, als Helmut erwartet hätte, »ich bin da. Warte in der Ankunftshalle. Lass dir Zeit, ich habe noch einen ziemlich heißen Kaffee vor mir stehen.«
»Alles klar«, sagte Helmut. »Bis gleich. Freue mich.«
Das zweite Gespräch mit Uriah Zunder hatte länger gedauert als das erste. Kinny hatte ihn zur Begrüßung erstaunt gefragt, ob etwas mit der Krankschreibung nicht geklappt habe, und Zunder hatte in einem betont selbstsicheren, beinahe triumphalen Ton erklärt, er habe sich entschlossen, Wigoder doch nicht anzurufen.
»Und warum nicht?«, fragte Kinny.
»Eine Krankschreibung passt jetzt überhaupt nicht.«
»Sie haben Angst, dass das Ihre Kandidatur für die Bezirkskommandantur beeinträchtigen könnte?«
Er schwieg für einen Moment. »Helfen würde es nicht«, meinte er schließlich. Seine Augen wichen den ihren aus.
Kinny stützte ihr Kinn auf die Hand und fixierte ihn, bis er nicht umhinkam, sie anzuschauen. Erst als ihre Blicke sich trafen, sagte sie langsam: »Sie haben mir bis jetzt nicht gesagt, was es sein könnte in Ihrem Leben, das diese Unruhe und Schlaflosigkeit verursacht. Vielleicht wäre es an der Zeit, darüber zu reden.«
»Wir haben doch letztes Mal schon darüber gesprochen. Es ist dieser immense Stress in den letzten Monaten.«
Kinny rieb sich zweifelnd die Stirn. »Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht einfach ein Burnout ist. Sie schlafen schlecht, das könnte auf eine Depression hindeuten. Und es scheint mir, Sie haben das Bedürfnis zu reden, deshalb sind Sie schon einmal hergekommen. Vielleicht habe ich zu rasch eine Krankschreibung empfohlen, das hat Sie womöglich abgeschreckt. Aber den inneren Wunsch, etwas Bestimmtes zu erzählen, das Ihnen den Schlaf raubt, haben Sie sehr wohl – sonst wären Sie heute nicht wiedergekommen. Auch wenn Sie jetzt dennoch Hemmungen haben, darüber zu sprechen.«
Zunder sagte längere Zeit gar nichts. Kinny sah, dass er mit dem Wunsch kämpfte, einfach aufzustehen und zu gehen, und sich andererseits der Sinnlosigkeit bewusst war, ein ums andere Mal die Psychologin aufzusuchen, ohne den Mund aufzumachen. Schließlich obsiegte seine Vernunft.
»Ich bin zuletzt in meinen Führungsqualitäten infrage gestellt worden. Zum ersten Mal in meiner Laufbahn.«
Er sprach nicht weiter.
»Können Sie konkreter sagen, in welchem Zusammenhang das geschah?«
»Nein, das möchte ich nicht.«
»Hat das Ihr Selbstwertgefühl beschädigt? Gerade in einer Phase, in der Sie einen großen Karriereschritt planen?«
Er wiegte den Kopf, offenbar unentschlossen, ob man das so sagen könne, und auch, ob dies das entscheidende Problem sei. Kinny spürte, dass da ein Schmerz sehr tief in ihm saß, und sie war keineswegs sicher, dass sie ihn in diesem Gespräch aus ihm herausholen könnte.
»Ist die Kritik aus politischen Kreisen gekommen? Von dort, wo über Ihre Karriere entschieden wird? Wird sie Ihnen schaden?«
Zunder schüttelte den Kopf. »In der Politik würde das, was mir vorgeworfen wird, womöglich niemanden kratzen. Die Kritik kam aus der Truppe.«
»Aus der Truppe?«
Er nickte.
Das klang für Kinny, als hätte jemand seine Autorität untergraben – viel schlimmer noch als Kritik von oben, gegen die es zuweilen noch einigermaßen half, sich von der Loyalität der Untergebenen tragen zu lassen. Nicht die Tatsache, dass der nächste Karriereschritt gefährdet sein könnte, schien ihm Probleme zu bereiten, sondern die Kritik selbst. Oder vielleicht ein Anlass, den er selbst dazu gegeben hatte, aber über den er nicht sprechen wollte.
Womöglich war gerade das die Frage, auf die er wartete.
»Ist es die Feindseligkeit des Angriffs, die Ihnen zu schaffen macht, oder ist es das, wofür Sie kritisiert worden sind?«
Er schaute sie nun direkt an. Sein Blick hatte beinahe etwas Hypnotisches. Er galt als einer der bestaussehenden Offiziere des Jerusalemer Korps, mit seinen hellblauen Augen, die ihm eine entfernte Ähnlichkeit mit Paul Newman im Film Exodus verliehen.
»Es ist kompliziert. Es war keine Führungsschwäche.«
»Sie haben gesagt, es sei Führungsschwäche, für die Sie kritisiert wurden.«
»Es war keine Führungsschwäche«, wiederholte er.
Sie machte eine Pause, nahm gleichsam Anlauf. »War es Missbrauch?«
Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen. »Nein, überhaupt nicht, damit hat es nichts zu tun.«
Sie sahen sich eine Weile an. Er spielte mit seinen Händen.
»Wollen wir einen neuen Termin ausmachen?«, fragte sie schließlich. »Wollen wir der Sache noch etwas Zeit geben, so lange, bis Sie darüber sprechen können?«
Er lächelte, fast war es ein Grinsen. »Das klingt gut.«
»Kommende Woche?«
»Ich weiß noch nicht. Ich habe Ferien genommen. Fahre ein paar Tage weg.«
»Statt der Krankschreibung, verstehe. Nehmen Sie Ihre Familie mit?«
»Meine Frau ist derzeit in Asien. Für längere Zeit. Mit den Kindern.«
»Sind Sie getrennt?«
Er lächelte erneut, diesmal allerdings wirkte das Lächeln traurig. »Das wird sich zeigen. Ich hoffe nicht.«
Obwohl Kinny die Bureka bereits schwer im Magen zu liegen begann, biss sie noch ein kleines Stück ab. Am Tisch nebenan dröhnte immer noch Shulis Stimme in voller Lautstärke aus dem Telefon.
»Ich finde den verdammten Zettel nicht«, schrie er.
»Welchen Zettel?«, fragte die Mutter.
»Na dieses blöde Teil, das der biometrische Apparat ausspuckt bei der Passkontrolle. Das muss man da unten nochmals an eine Maschine halten, damit die Barriere aufgeht.«
»Ach das«, sagte die Mutter.
»Wo ist es denn? Ich habe es doch – ach verdammt noch mal, da bist du ein paar Wochen weg, und sobald du hier wieder ankommst …«
»Sag ich doch«, meinte die Mutter. »Dieses Land …«
»Das hilft mir jetzt auch nicht weiter, dein ewiges Genörgel«, meinte Shuli. »Ich muss diesen Scheißzettel finden.«
»Hast du ihn nicht in den Pass gesteckt?«, schrie die Mutter. »Konzentrier dich!«
Kinny stand entnervt auf, warf die Papiertüte mit dem Rest der Bureka in den Mülleimer und nahm den halb vollen Kaffeebecher mit hinüber in den Hauptteil der Halle, wo sich das Eingangstor für die Ankommenden befand.
Sechs Wochen war es her, dass völlig überraschend der Anruf von Helmut gekommen war. Sie hatten den Kontakt über die Jahre nie ganz abreißen lassen, doch zuletzt hatte er sich auf ein paar Zeilen Textnachricht zum Geburtstag des jeweils anderen beschränkt.
Damals zu Studienzeiten in Tübingen war Helmut einer ihrer angenehmsten Kommilitonen gewesen, und ja, weil es ziemlich einsam war ohne ihn und weil sie spürte, wie sehr er das wollte, hatte sie damals zwei oder drei Mal mit ihm geschlafen. Ein kleines bisschen Revolte war auch dabei gewesen, das hatte sie gespürt. Mit einem Goj zu schlafen, einem deutschen Goj noch dazu, das war der finale Bruch mit der Wertewelt ihrer Eltern.
Sie hatte schon als Schülerin in einem orthodoxen Gymnasium begonnen, die religiösen Gesetze nicht mehr einzuhalten, zuerst nur im Geheimen und außerhalb von zu Hause. Doch als sie dann statt des Sozialdienstes, den die Mehrheit der orthodoxen Mädchen leisteten, den Dienst in der Armee wählte, konfrontierte sie ihre Eltern damit, dass sie mit den Ritualgesetzen nicht mehr viel am Hut hatte. Später ging sie trotz aller Wehklagen ihres Vaters zum Studieren nach Deutschland, weil es eben in Tübingen dieses Stipendium gab. Sie hatte nicht das Gefühl, ihren Eltern darüber hinaus beweisen zu müssen, dass sie ihren eigenen Weg ging. Aber noch viele Jahre nach der Rückkehr aus Tübingen trieb sie die Frage um, ob der Sex mit Helmut mehr gewesen war als nur das Ergreifen einer Gelegenheit. In der Schule hatte Kinny einst gelernt, dass Josef in der Bibel den Annäherungen von Potiphars Frau widerstanden habe, weil das Bild seines Vaters Jakob ihm erschienen sei. Mit leichtem Schauder fragte sie sich zuweilen, ob sie die Bilder ihrer Eltern irgendwo in der Studentenbude hatte aufblitzen sehen, während sie auf ihrem Einzelbett mit dem deutschen Theologensohn einigermaßen unbequemen, aber von freundschaftlichen Gefühlen getragenen Sexualverkehr pflegte. Andererseits kam ihr immer wieder der Gedanke, ob dann der Abbruch der Affäre, der von ihr ausgegangen war, nicht wiederum eine unbewusste Grenzziehung war, weil sie aus einer Verpflichtung ihrer Herkunft gegenüber nicht riskieren wollte, dass mehr daraus würde.
Bestand ihr ganzes Leben darin, insgeheim irgendwelche vorgegebenen Erwartungen zu erfüllen oder mit ihnen zu brechen? War dies im Kern das, was man früher einmal »jüdisches Schicksal« genannt hatte? War es einfach das Übertragen der Halacha, des Religionsgesetzes, das einen mit seinen allumfassenden Vorschriften auf Trab hielt, auf die komplexen größeren Fragen von Existenz und Identität?
Helmut hatte sich beruflich etabliert und geheiratet. Fünf Jahre und ein Kind später hatte er sich aber wieder geschieden – er hatte sich in eine andere Frau verliebt, die er dann nicht allzu lange nach der Scheidung geheiratet hatte. Anke hieß sie. Mit Anke bekam er einen weiteren Sohn, und anders als mit der ersten Frau hatte er gemeinsam mit ihr und dem Jungen Israel einige Male besucht. Kinny erhielt dann jedes Mal überraschend einen Anruf: »Morgen sind wir in Jerusalem, könntest du uns treffen?« Meistens hatte sie es einrichten können und manchmal – als sie selbst noch verheiratet war – gemeinsam mit Ariel und Mia, später allein mit ihnen Zeit verbracht. Merkwürdigerweise hatten Helmut und Anke, obwohl sie sich so kurzfristig ankündigten, immer irgendein Geschenk für sie dabei, zuletzt meist einen Fruchtschnaps aus dem Duty-free, von dem Kinny sehr selten trank, sodass sich die Flaschen der letzten drei Besuche bei ihr angesammelt hatten, und nur eine von ihnen, ein Himbeergeist, war halb geleert.
Dass Kinny den Kontakt mit Helmut auf eigene Initiative wieder aufgenommen hatte, stand in Zusammenhang mit der politischen Situation des Landes, die sich seit Beginn des Jahres und dann immer drastischer verschärft hatte. Samstag für Samstag und immer wieder auch unter der Woche gingen Hunderttausende auf die Straßen, mit blau-weißen Fahnen und selbst gemalten Schildern, die Angst im Gesicht, dass ihnen ihr Land gestohlen würde.
Kinny war aufgebracht. Mit ihren Eltern konnte sie nicht über die politische Situation sprechen, vor allem ihr Vater verstand nicht, wie man gegen eine Regierung sein konnte, in der die religiösen Parteien, die für ihn die Verteidiger des Judentums waren, den Ton angaben. Was konnte, so dachte er, schlecht daran sein, wenn dieser Staat jüdischer wurde und wenn man sich mehr um die Gebiete in Judäa und Samaria kümmerte, die Gott Israel im Sechstagekrieg 1967 als Geschenk, aber auch als Auftrag hatte zukommen lassen? Kinnys Tochter Mia war politisch indifferent und konzentrierte sich ganz auf ihr Privatleben. Im beruflichen Umfeld wollte Kinny sich politisch nicht äußern, und ihre Freundin Moran, die während der Pandemie noch von Existenzsorgen geplagt worden war, war nun so gefragt wie nie. Sie berichtete nur noch von den politischen Hotspots. Als liberale lesbische Journalistin war sie bei linken Medien und Podcasts angesagt, inzwischen war sie auch ausländischen Medien aufgefallen, und mit ihrem etwas holprigen und stark akzentgefärbten Englisch hörte man sie immer wieder auch in amerikanischen oder britischen Newskanälen. Ihr fühlte sich Kinny von allen Menschen um sie herum weltanschaulich noch am nächsten, aber als sie sich einmal zu einem Kaffee trafen, hing Moran dauernd an ihrem Telefon, so als könnte gerade in diesem Moment jenes alles umstürzende Ereignis geschehen, das zu verpassen ihr ganzes berufliches Dasein in den Abgrund befördern würde.
Kinny hatte jemanden zum Sprechen gebraucht, am besten jemanden mit etwas Distanz. Ihr Bruder Golan, der in New York lebte, kam dafür nicht infrage, er war vollkommen eingesponnen in seine Ressentiments und Gesprächen kaum mehr zugänglich. Als junger Mann hatte er erleben müssen, wie bei einem Bombenanschlag auf ein Restaurant im Viertel Rechavia wenige Meter von ihm entfernt seine große Liebe getötet worden war, just während er vor dem Toilettenspiegel stand und sich darauf vorbereitete, ihr einen Heiratsantrag zu machen. In all den Jahren war er nicht darüber hinweggekommen, dass die Eltern trotz ihrer Religiosität nicht imstande gewesen waren, ihm Halt zu bieten, als er ihn gebraucht hätte.
Letztlich war Kinny nur Helmut eingefallen. Sie hatte ihn vorsichtig angemailt, sie hatten ein Telefongespräch vereinbart, in dem sie dann offener mit ihm gewesen war, und seither hatten sie regelmäßig gesprochen.
Vor einigen Wochen dann hatte Helmut Kinny angerufen und gefragt, wann sie zwei bis drei Tage frei nehmen könne. Er plane, sie zu besuchen. Dass er nun plötzlich kommen wollte, verunsicherte sie etwas, doch er meinte in sachlichem Ton, er müsse sich das alles auch mal persönlich ansehen, um es wirklich zu verstehen.
»Und Anke kommt nicht mit?«, fragte sie.
Erst da erzählte er ihr, dass seine zweite Ehe in die Brüche gegangen war. Es schien, dass auch Helmut etwas unter Einsamkeit litt.
Also hatte sie sich zwei Tage frei genommen, wenn auch nicht ganz leichten Herzens, denn Mia war schwanger und würde in drei Monaten gebären, und eigentlich hätte Kinny gerne so viele freie Tage wie möglich für diese Zeit aufgespart, damit sie Mia dann beistehen könnte. Am wenigsten verstand sie aber im Nachhinein, dass sie Helmut versprochen hatte, ihn am Flughafen abzuholen. Er werde ohnehin ein Auto mieten, hatte er erklärt. Na, hatte sie ihm geantwortet, dann lasse sie sich von ihm nach Jerusalem zurückkutschieren, sie komme ohnehin lieber mit der Bahn.
Und nun saß sie hier in der Ankunftshalle und wusste nicht einmal, wie sie ihn begrüßen sollte.
Sie hielt sich etwas im Hintergrund, besah sich den nie unterbrochenen Strom von Menschen. Im Wartebereich standen wie immer einige aufgeregte junge Leute mit Ballonen, auf denen Glückwünsche oder Willkommensgrüße für ankommende Freunde und Verwandte standen, und auch die »Chapper«, wie man sie mit einem jiddischen Ausdruck bezeichnete: Taxifahrer, die versuchten, Ankömmlinge abzugreifen und so die Regulatorien des offiziellen Taxistandes zu umgehen. Und natürlich wiederholte sich endlos das Szenario, dass besonders vorfreudige Angehörige in die für die Fluggäste reservierte Zone drangen, um mit ihrem ankommenden Familienmitglied eine kleine improvisierte Ankunftsfeier zu veranstalten. So nötigten sie alle anderen, die mit ihren Gepäckwagen und Rollkoffern durch die elektrische Schiebetür in den Ausgangsbereich traten, zu komplizierten Umwegen oder geduldigem Warten. Kinny erinnerte sich, dass Ariel, wenn sie von einer Reise zurückkehrten, auf solche Tumulte immer allergisch reagiert hatte. »Können Sie einen Grundbucheintrag vorweisen, dass Ihnen die Halle hier gehört?«, hatte er jeweils die Leute angefaucht, die sich dann meist mit betretenem Grinsen aus dem Bereich entfernten, um einige Meter weiter hinten ihrer Freude erneut Ausdruck zu verleihen.
Es dauerte weitere fünfundzwanzig Minuten, bis Helmut schließlich auftauchte. Kinny hatte vor einigen Tagen auf der Website der Stuttgarter Praxis, die er leitete, sein Foto angeschaut, um sich ein möglichst aktuelles Bild von ihm zu machen, aber der Mann, der durch die elektronische Schiebetür kam, war nochmals ein Stückchen älter als derjenige, der ihr vom Bildschirm tiefgründig entgegengelächelt hatte. Helmut blickte suchend um sich. Sie hob den Arm langsam und bewegte die Hand etwas, und nach einigen Sekunden lächelte er und steuerte auf sie zu.
Sie begrüßten sich etwas förmlich mit zwei Wangenküssen, die Finger des einen sacht auf den Schultern des andern. Er machte ihr ein Kompliment über ihr Aussehen, sie fragte nach dem Flug, dann hievte er sein Gepäck vom Schiebewagen, und sie gingen, angestrengt um lockere Konversation bemüht, zur Rolltreppe, die zu den Schaltern der Autovermietungen hochfuhr.
Wenig später fuhren sie auf der Autobahn nach Jerusalem, und Kinny erklärte ihm die neu gekennzeichnete Fahrspur ganz rechts. Sie war für Busse und für Autos mit mindestens zwei Personen reserviert, aber nicht zu jeder Tageszeit, und meistens war sie ohnehin von irgendwelchen schleichenden Lastwagen besetzt. Als Helmut daraufhin einen Gesichtsausdruck aufsetzte, der ihr bekannt vorkam – eine Mischung aus Unglauben und Amüsement spiegelte sich darin –, empfand sie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Gefühl von Leichtigkeit. Sie hatte sich ausbedungen, dass sie nur deutsch miteinander sprechen würden, was sie nie mehr getan hatten, seit Kinny Tübingen damals verlassen hatte. Sie hatte im Voraus schon einige Anstrengungen unternommen, wieder in die Sprache hineinzukommen, und zuweilen abends deutsche Zeitungen gelesen und einige Fernsehkrimis aus der ARD-Mediathek mit Untertiteln für Hörgeschädigte angeschaut.
In Jerusalem fuhren sie zunächst zur Mamilla Mall, der vor einigen Jahren eröffneten Fußgängerpassage am Fuße der Stadtmauer, um etwas zu essen. Die Bureka am Flughafen hatte Kinny leichtes Sodbrennen verursacht, aber sie nicht gesättigt, und sie hatte nichts dagegen, sich von Helmut zu einem Salat einladen zu lassen.
Helmut erzählte von seiner zweiten Scheidung. Diesmal sei er es gewesen, der verlassen worden war, sagte er. Anke hatte sich in eine Arbeitskollegin verliebt.
»Ich weiß nicht, ob es das schlimmer oder besser macht, dass sie jetzt mit einer Frau zusammen ist«, sagte er. »Einerseits fragst du dich, ob die letzten zwölf Jahre eine einzige Lüge gewesen sind. Andererseits hast du das Gefühl, dass du nichts mehr aufzubieten gehabt hättest, weil sie mit den Männern wohl einfach abgeschlossen hatte.«
»Und vorher hat es keine Anzeichen gegeben?«
»Weißt du, ich will jetzt nicht albern klingen, Kinny, aber das allererste Mal, dass mir etwas seltsam vorkam mit Anke, war bei unserem letzten Besuch in Israel, als wir dich getroffen haben. Ich fand, dass sie dich mit einer seltsamen Lüsternheit betrachtete.«
»Mich?«
»Ja. Es tut mir leid, wenn dich das irritiert.«
»Und wie mich das irritiert! Hat sie denn je eine Andeutung in dieser Hinsicht gemacht?«
»Nein, nicht wirklich. Sie sagte vielleicht mal, dass sie verstehe, dass ich in dich verliebt gewesen bin.«
»Du warst in mich verliebt?«
»So ein bisschen ja schon, damals in Tübingen. Das wusstest du doch. Du etwa gar nicht in mich?«
Kinny war etwas übel. Sie entschuldigte sich und ging zu den Toiletten, um ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen.
Sollte das der Auftakt sein für die kommenden Tage mit Helmut? War er nach Jerusalem gekommen, um sich mit ihr zu trösten, in der Hoffnung, dass sie, ebenfalls eine einsame Seele, für seine Annäherungen empfänglich wäre? Ein netter, wenn auch aufgewärmter Ferienflirt vor der Rückkehr ins langweilig-einsame Stuttgart? Wie dumm sie gewesen war, ihm zu glauben, es ginge ihm vor allem um das Verstehen der Stimmung im Land!
Sie schaute in den Spiegel und sah, wie sich um ihren Mund herum Wutfältchen bildeten. Doch aus ihren Augen sprach noch etwas anderes: eine Art Mitgefühl für Helmut, den verlassenen Mann nach Beginn seiner zweiten Lebenshälfte. Sie wischte sich mit einem feuchten Papiertuch übers Gesicht, trocknete sich ab, trug etwas Puder auf und ging wieder hinaus zum Tisch, wo inzwischen ihr Salat stand und Helmut hinter seinem Teller saß und höflich wartete.
»Geht’s wieder?«, fragte er, und sie nickte stumm, schaute ihn aber nicht an.
Längere Zeit sprach keiner von beiden. Schließlich sagte Helmut, er würde morgen gerne mit ihr ans Tote Meer fahren.
»Können wir machen«, sagte sie knapp.
Als sie beide ihre Salate aufgegessen hatten und ihre Unterhaltung immer noch nicht richtig in Gang kam, beschloss Kinny, zum Nachtisch einen Affogato con Amaretto zu bestellen. Irgendwie musste man sich ja wieder locker machen.
Helmut lächelte und schaute sie von der Seite an. »Für mich bitte einen Kaffee.«
»So vernünftig?«
»Ich muss dich ja noch heim und mich ins Hotel fahren.«
»Na, die paar Meter bis nach Baka wirst du noch schaffen.«
Er kostete dann mit seinem Kaffeelöffel doch ein bisschen von ihrem Dessert, und der Mandellikör, in dem die Eiskugel schwamm, machte sie beide innerhalb kürzester Zeit beschwipst.
»Wusstest du übrigens, dass ich bald Großmutter werde?«, fragte Kinny.
»Das ist nicht wahr! Mia erwartet ein Kind?«
Kinny nickte stolz. »Sie hat vor einem halben Jahr geheiratet. Einen Bauunternehmer.«
»Gratuliere! Aber wieso schon wieder so ein Bauheini? Hat sie von der Spezies nicht schon mit ihrem Vater genug?«
»Sie ist ja auch selber ein Bauheini«, meinte Kinny in halb gespieltem, halb echtem Trotz. »Ausgebildete Architektin.«
Helmut, der das mal gewusst, aber vergessen hatte, schien es einen Moment lang peinlich zu sein. »Na ja, Bauunternehmer klingt immerhin nach einem soliden Einkommen.«
»Es geht so«, meinte Kinny. »In den letzten Jahren hat das gestimmt. Inzwischen gehen aber viele pleite. Haben sich für große Projekte verschuldet und können ihre Wohnungen nicht mehr verkaufen, weil die Hypothekarzinsen in die Höhe geschossen sind. Oder nur noch mit Abschlägen.«
»Muss ich mir Sorgen um dein ungeborenes Enkelkind machen?«, fragte er halb ernst.
Sie lächelte. »Mein Schwiegersohn scheint einer von der vorsichtigen Sorte zu sein. Der schlägt sich durch. Und Mia hat einen Staatsjob. Bauverwaltung in Rischon Lezion.«
»Mann, was sind wir alt geworden!«, meinte Helmut unvermittelt und leicht weinerlich.
Ein wenig beruhigte Kinny dieser Satz – abgesehen davon, dass er auf Helmut sichtlich zutraf. Sie hoffte, dass die Ankündigung ihrer angehenden Großmutterschaft vielleicht auch seine Erwartungen an sie zügeln würde. Wobei sie sich über die Natur dieser Erwartungen noch nicht ganz klar war.
Helmut fuhr sie dann ohne Umstände nach Hause. Er war ziemlich sicher am Steuer, wie sie beruhigt feststellte. Kurz bevor sie in ihre Straße abbogen, kreuzten sie eine kleine Demonstration. Hundert bis hundertfünfzig Menschen, die Transparente vor sich hertrugen oder israelische Flaggen schwenkten, standen an einer Straßenecke gedrängt auf dem Bürgersteig und skandierten Protestrufe. Ein Polizeiwagen mit rotblau blinkender Lampe war auf der gegenüberliegenden Seite der Straße geparkt. Es war eine dieser Demonstrationen vor Privathäusern, die gut vernetzte Regierungsgegner kurzfristig einberiefen, wenn sie herausgefunden hatten, dass ein Mitglied der Koalition an einer bestimmten Adresse zu einem Termin eintreffen würde.
»Siehst du«, sagte Kinny, die bereits wieder ganz nüchtern war, »das ist hier schon der Alltag.«
»Und wie wird das enden?«
Kinny seufzte. »Keine Ahnung. Ich muss jetzt erst mal mit meinem Hund Gassi gehen. Der Ärmste sitzt schon den ganzen Tag alleine in der Wohnung.«
Sie waren vor ihrem Wohnhaus angekommen. Sie stieg aus, und er sagte, er werde sie am nächsten Morgen um neun Uhr abholen. »Badeanzug nicht vergessen!«
Dann entfernte sich sein Mietwagen leicht rumpelnd auf dem alten Straßenpflaster in Richtung seines nahe gelegenen Boutiquehotels.
In der Wohnung erwartete Itztrubal sie schwanzwedelnd, und sie wusste, dass sie ihm mehr schuldete als die fünf Minuten Ausgang zur Darm- und Blasenentleerung, mit denen er sich sonst nach besonders langen Tagen begnügen musste. Sie fuhr durch sein weiches Fell, nahm ihn an die Leine, und bevor sie ausgingen, steckte sie ihre Hörstöpsel in die Ohren und stellte einen jener Podcasts ein, die sie auf diesen Wegen meist begleiteten.
Der Journalist, der den Podcast betrieb und alle paar Tage jemanden zum Interview einlud, führte diesmal ein Gespräch über die politische Situation mit Professor Lea Gottesmann, der großen alten Dame der israelischen Geschichtsschreibung. Mit ihren achtzig Jahren meldete sie sich immer noch regelmäßig mit pointierten Beiträgen zu Wort, in denen sie die Regierungskoalition für ihre wiederholten Manöver zur Rechenschaft zog, das Rechtswesen des Landes ihrer nationalistischen Politik unterzuordnen. Während Kinny den Hund an seinen gewohnten Lieblingsorten schnüffeln und das Bein heben ließ, lauschte sie der vom Alter leicht gebrochenen, aber immer noch kräftigen Altstimme Professor Gottesmanns, die für ein solches Organ immer schon viel zu zierlich ausgesehen hatte. Kinny musste an die Zeit zurückdenken, als die Gottesmanns in der Nachbarschaft ihrer Familie in Jerusalem gewohnt hatten und sie ab und zu mit deren Kindern auf der Straße spielte. Kinny fand sie immer viel zu gut erzogen, erinnerte sie sich.
»Ich will Ihnen etwas sagen, was ich in den fast sechzig Jahren, seit ich meinen ersten Abschluss in jüdischer Geschichte gemacht habe, noch nie gesagt habe«, bemerkte Frau Gottesmann. »Etwas, von dem ich auch nie gedacht hätte, dass ich es je sagen würde. Aber die vergangenen Wochen und Monate haben meine Überlegungen in neue Richtungen geführt.«
»Gerade dafür bewundern Sie ja viele«, sagte der Interviewer mit Hochachtung in der Stimme, »dass Sie immer wieder zu neuen Denkansätzen bereit sind.«
»Ja, aber diesmal ist es etwas ganz anderes, etwas Skandalöses«, meinte die Professorin. »Ich möchte es so formulieren: In der Diaspora wussten die Juden immer, dass sie ein Volk sind. Sie fühlten miteinander, halfen einander,