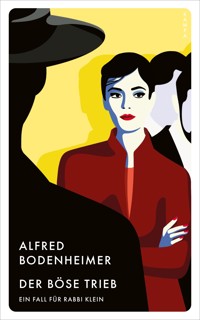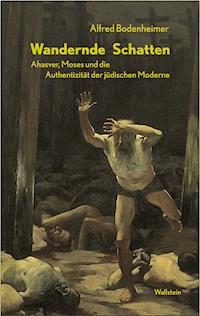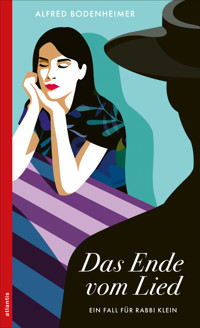
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Atlantis VerlagHörbuch-Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Rabbi Klein
- Sprache: Deutsch
Als im Bahnhof Enge eine Frau vom Zug überfahren wird, ahnt Rabbi Klein bald, dass es weder Selbstmord noch ein Unfall war. Er hat die Tote gut gekannt: Carmen Singer war ein aktives Mitglied der Cultusgemeinde in Zürich, aber auch eine mehr als anstrengende Frau, die seine Nerven des Öfteren strapaziert hat. Nach ihrem gewaltsamen Tod gerät Rabbi Kleins engstes Umfeld ins Visier der ermittelnden Kommissarin Bänziger. Doch auch Klein ist dem Verbrechen auf der Spur. Hat sein ehemaliger Förderer, der langjährige Präsident der Gemeinde, etwas zu verbergen? Und was hat die wohlhabende Julia Scheurer, deren Vater ergreifende Liebesbriefe an seine verstorbene Frau schrieb, mit der Sache zu tun? Was Klein seiner Tochter aus den Weisheiten des Talmud zitiert, bewahrheitet sich: Eine gute Tat zieht weitere gute Taten nach sich, eine Gesetzesübertretung weitere Übertretungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bodenheimer
Das Ende vom Lied
Ein Fall für Rabbi Klein
Kriminalroman
Atlantis
1
Liebe Elisabeth,
wenn Du mich heute hättest sehen können! Zum ersten Mal wieder im weißen Kittel unterwegs, das Stethoskop in der Tasche.
Den ganzen Tag wandelte ich wie auf Wolken und schwankte zwischen Lachen über das wiedergewonnene Glück, in einem richtigen, wenn auch klitzekleinen Krankenhaus Patienten behandeln zu dürfen, und Weinen in Trauer um Dich, mit der ich das nicht mehr teilen darf.
Wie ich Dir schon geschrieben habe, steht mir noch ein langer Weg bevor – die Ausbildung zum Traumatologen wird noch zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen. Aber ich spüre das Vertrauen von Doktor Fueter, und er hat heute, als wir uns im Korridor begegneten, wiederholt, dass er sich darauf freut, hier einmal eine Abteilung für Traumatologie stehen zu sehen, deren Leiter ich wäre. Er rechnet ja damit, dass in wenigen Jahren wieder Touristen hierher zum Skilaufen kommen. »Da werden dann schon genug Arm- und Beinbrüche anfallen, machen Sie sich keine Sorgen«, hat er mir aufmunternd gesagt, mit seinem breiten Akzent. Die Schweizer pflegen zuweilen einen eigenartigen Pragmatismus.
Ich sinke jetzt ins Bett. Dieser Tag mit all seinen neuen Gefühlen und Aufgaben war doch sehr ermüdend. Wie immer denke ich an Dich in meiner engen Kammer, die ich in den nächsten Wochen durch eine bequemere Wohnung zu ersetzen hoffe.
In grenzenloser Liebe
Dein H.
So kalt, wussten die Medien zu berichten, war es seit mehr als fünfzig Jahren nicht mehr gewesen. Die lokalen Zeitungen holten die Fotos von der Seegfrörni aus dem Archiv, als die Zürcher 1963 auf dem See Schlittschuh liefen. Die kleinen Seen in der Umgebung der Stadt, der Katzensee, der Türlersee, selbst der Greifensee waren bereits zum Betreten freigegeben.
Das Auto stotterte bloß. Drei, vier Versuche unternahm Gabriel Klein, dann gab er es auf. Als er die Pannenhilfe anrief, wurde ihm beschieden, man könne ihm frühestens in drei Stunden Hilfe schicken – Ausnahmezustand. Er solle wenn möglich die öffentlichen Verkehrsmittel benützen. »Wenn Sie können, lassen Sie das Auto einfach stehen, bis es wärmer ist. Das hilft womöglich schon.« Sie mussten tatsächlich ziemlich am Anschlag sein, wenn sie solche Tipps gaben.
Seit Langem hatte Rivka moniert, sie bräuchten einen Garagenplatz, doch Klein hatte sich dem immer widersetzt. »Bei den Mieten in unserer Gegend zahlen wir in einem Jahr mehr, als das ganze Auto wert ist«, hatte er ihr gesagt. Mochte sein – jedenfalls musste er jetzt nach Bern den Zug nehmen.
Er hatte aus Bern auch gleich seine Schwiegereltern, die dort wohnten, nach Zürich mitnehmen wollen. Zum Glück hatte Rivka das gestern schon getan, als das Auto noch funktionierte. Er hatte das zuerst übertrieben gefunden – wenn er heute doch hinfuhr, hatte er gemeint, dann könne er sie mitnehmen. Der Flug nach London ging ja erst morgen früh. Doch Rivka kannte die Ängste und die Unbeweglichkeit ihrer Eltern. Wenn sie morgen früh schon um fünf Uhr aufstehen mussten, um den Flieger zu bekommen, dann sollten sie wenigstens heute in Zürich einen geruhsamen Tag zur Vorbereitung haben.
Rivka hatte sich auf die Reise gefreut. Sie hatte ihren Bruder in London länger nicht besucht, und da ihre Eltern die Reise zur Barmizwa ihres Enkels davon abhängig machten, dass sie mitkommen würde, war ihr der Entschluss nicht schwergefallen. Doch je näher die Reise rückte, desto nervöser wurde sie – eine Mischung aus Angst, vor allem um ihren gebrechlichen Vater, aus Bedauern, Klein und die Töchter in Zürich zurückzulassen, und aus Vorfreude und Unbehagen vor einem Schabbat in der ziemlich mondänen Gemeinde in Hampstead. Sie hatte sich für die Gelegenheit zwei neue Kleider und ein ganzes neues Set Make-up gegönnt. Und natürlich würde sie den eleganten wattierten Kapuzenmantel tragen, den Klein ihr zum Geburtstag geschenkt hatte, ihr »Hautevoleestück«, wie sie es nannte.
Missgelaunt stieg Klein aus dem eiskalten Auto und warf die Tür zu. Er hatte ohnehin keine Lust, nach Bern zu fahren, und tat es nur, weil er die letzten beiden Sitzungen der interreligiösen Kommission geschwänzt hatte, und ein drittes Mal käme ihm ungehörig vor. Zudem war heute die kleine jüdische Gemeinde von Bern der Gastgeber, da wäre es ein besonderer Affront, wenn gerade er fehlte.
Als Klein in der Bahn saß, fand er schließlich, dass das eigentlich bequemer sei als im Auto. Er kaufte sich, als die Minibar durch den Gang rollte, einen Kaffee und nahm die prall gefüllte Klarsichtmappe aus der Tasche, die er zur Lektüre eingesteckt hatte – als hätte er eine Vorahnung gehabt, dass es am Ende mit dem Auto nichts würde. Es war ein Konvolut mit Kopien von sorgfältig handgeschriebenen Briefen. Fast drei Monate hatten sie in seinem Arbeitszimmer gelegen, bevor er beschlossen hatte, sie genauer anzusehen.
Warum er sich so lange davor gedrückt hatte, wusste er selbst nicht genau. Als Historiker war er eigentlich an Selbstzeugnissen interessiert, und was ihm Julia Scheurer über die Briefe ihres Vaters erzählt hatte, klang eigentümlich genug. Wahrscheinlich war sein Desinteresse eher psychologischer Natur gewesen.
Offenbar, so hatte Klein aus Julias Erklärung verstanden, hatte Röbi Fuchs den »Herrn Rabbiner Klein« seinem Rotarierfreund Christoph Scheurer, Julias Mann, empfohlen. Christoph Scheurer saß, wie Klein herausfand, in der Geschäftsleitung des Unterland-Versicherungskonzerns. Nicht zum ersten Mal hatte Klein das Gefühl gehabt, als eine Art Hausintellektueller der gut betuchten Zürcher Juden auch an ihre nichtjüdischen Bekannten weitergereicht zu werden.
Natürlich wusste Röbi Fuchs, dass Klein niemanden abweisen konnte, der sich auf ihn berief. Röbi Fuchs war der Gemeindepräsident gewesen, der seinerzeit, vor über zwanzig Jahren, Klein als Rabbinatsassistenten eingestellt und ihn vom Elend seiner Universitätsstelle befreit hatte. Röbi Fuchs hatte auch für das Geld und die Zustimmung im Vorstand gesorgt, um ihn später zur Vollendung seiner Rabbinatsausbildung zwei Jahre lang nach Israel zu schicken. Wenn Klein heute der Rabbiner der größten jüdischen Gemeinde der Schweiz war, verdankte er das zu einem guten Teil Röbi, und so patriarchalisch dieser zuweilen auch auftrat, spürte Klein doch immer auch echte Zuneigung und war ihm emotional verbunden. Aber deshalb musste man nicht gleich bei jedem Rotarierfreund von Röbi Fuchs oder dessen Frau sofort »Männli mache«, wie es Kleins verstorbener Vater genannt hätte. Schon die Würde seines Amts verlangte es, fand Klein, dass er Julia Scheurers Unterlagen eine Weile liegen ließ. Aber drei Monate? Frau Scheurer hatte sich zwar noch nicht gemeldet und nach Kleins Eindrücken gefragt, doch es war sicher höflicher, darauf nicht erst zu warten.
Die siebzig oder achtzig Briefe hatte sie gefunden, als die Familie nach dem Tod der Mutter das Elternhaus in der Nähe des Brienzersees geräumt hatte. Sie befanden sich in einer unscheinbaren Schuhschachtel auf dem Dachboden, und Julia hatte sofort die Schrift ihres Vaters erkannt, der bis zu seinem Tod in den frühen achtziger Jahren immer mit demselben Füllhalter geschrieben hatte – dem ersten Gegenstand, wie er ihr einmal erzählte, den er sich kaufen konnte, als er gegen Ende des Kriegs mit einem Transport aus Theresienstadt in die Schweiz gekommen war.
Hermann Pollack hatte seinen Kindern hin und wieder von seiner ersten, jüdischen Frau Elisabeth erzählt. Julia und ihre Schwestern wussten, dass er sie als junger Arzt im Wiener Rothschild-Spital kennengelernt hatte, als sie dort wegen eines Beinbruchs zwei Wochen verbrachte. Dass sie 1938, kurz nach der Annexion Österreichs, geheiratet hatten, es aber angesichts der immer schwierigeren Situation vermieden, Kinder in die Welt zu setzen. Dank seiner Tätigkeit als Arzt hatte Hermann Pollack noch bis 1943 im Krankenhaus praktizieren können, dann wurden er und Elisabeth gemeinsam nach Theresienstadt deportiert. Er hatte einen Transport nach Auschwitz vermeiden können, weil er als Arzt für die inhaftierten Juden arbeitete. So war es ihm auch gelungen, Elisabeth vor der Deportation zu bewahren, doch Mitte Januar 1945, kurz bevor sie beide mit einem Transport des Roten Kreuzes in die Schweiz hätten ausreisen können, war sie an Tuberkulose gestorben.
Hermann Pollack war bei der Ankunft ebenfalls geschwächt und wurde in das jüdische Krankenheim nach Davos gebracht. Später fand er eine Stelle bei einem Bezirksspital im Berner Oberland, wo er die Orthopädie- und Trauma-Abteilung aufbaute. Er heiratete die viel jüngere Tochter seines ersten Chefs aus dem Emmental und hatte mit ihr drei Kinder, Julia und ihre beiden Schwestern. Viel mehr wusste Julia Scheurer nicht über die Zeit vor ihrer eigenen Geburt.
Das Einzige, was im Alltag der Familie Pollack noch an Elisabeth erinnerte, war, dass Hermann Pollack jedes Jahr an einem Samstag im Januar nach Bern gefahren war, um dort in der Synagoge das Totengebet für sie zu sprechen. Er hatte nie erlaubt, dass ihn jemand aus der Familie dorthin begleitete, auch nicht seine zweite Frau.
»Für uns war Elisabeth immer halb Mensch, halb Geist«, hatte Julia Scheurer Klein gesagt. »Und ich habe nie wirklich gewusst, wie sehr mein Vater an diesem Verlust gelitten hat. Aber als ich diese Briefe fand, ist mir klargeworden, dass unsere Familie für ihn wirklich das zweite Leben war, für das er sein ganzes erstes Leben mit Gewalt hatte zuschütten müssen.«
Es waren Liebesbriefe, die Hermann an die verstorbene Elisabeth geschrieben hatte, fünf Jahre lang, bis unmittelbar vor der Heirat mit seiner zweiten Frau Margrit. Briefe, die alle mit der Anrede »Liebe Elisabeth« begannen und mit der Formel »in grenzenloser Liebe« endeten. Julia Scheurer wollte von Klein wissen, was mit diesen Briefen zu tun sei. Waren sie nur für die Familie interessant? Sollten sie in ein Archiv? Waren sie es vielleicht sogar wert, als Buch zu erscheinen?
Nun ging Klein die Briefe durch, vom ersten, der tatsächlich vor allem vom Kauf des Füllhalters in einer Papeterie in Davos berichtete, über die Berichte aus dem Krankenheim, den Kontakt, den ein Bündner Arzt für ihn zum Bezirksspital im Berner Oberland herstellte, bis zu den ersten Monaten, die er dort arbeitete.
Als Klein die Briefe nun durchsah, sich unsystematisch hier und dort festlas, spürte er, wie die Mischung aus Aufbruchsstimmung und Melancholie, die diese Briefe beherrschte, von ihm selbst Besitz ergriff. Und noch etwas fiel ihm auf: Diese Briefe waren nicht an eine Tote gerichtet. Elisabeth war für Hermann Pollack präsent, er fragte sie um Rat, beschwichtigte sie, wenn er Widerspruch erwartete, sorgte sich um sie. »Ich möchte Dir meine Albträume nicht beschreiben, das würde Dich zu sehr belasten«, las Klein an einer Stelle. Vor allem aber fiel ihm auf, dass es in etlichen dieser Briefe Bemerkungen über das Hohelied gab, die Klein nun beim ersten Lesen im Zug nur überflog, denen er sich aber später mit mehr Ruhe widmen wollte – am besten am Schabbat, wenn seine Frau in London sein würde. Offenbar hatte damals ein Rabbiner oder Religionslehrer, der die Patienten in Davos hin und wieder besuchte, Hermann Pollack eine deutsche Übersetzung der Bibel geschenkt, und das Hohelied, das er nun zum ersten Mal las, hatte den jungen, kränklichen Witwer in seinen Bann gezogen.
Erst als der Zug im Bahnhof Bern anhielt, schreckte Klein von der Lektüre der Briefe auf, packte eilig zusammen und betrat, mit noch lose hängendem Schal, den eiskalten Bahnsteig. Fünfzehn Minuten später war er im Zentrum der jüdischen Gemeinde. Im selben Gebäudekomplex lag die Synagoge, in der Rivka und er vor vielen Jahren geheiratet hatten – und in der Jahre zuvor, einmal in jedem Januar, Hermann Pollack den Kaddisch für seine erste Frau Elisabeth gesagt hatte.
Am Ende waren von den zwölf Mitgliedern der interreligiösen Kommission nur fünf gekommen – Klein eingeschlossen. Drei der Abwesenden hatten sich erst heute Morgen abgemeldet. Und auch der vorgesehene Gast, ein bekannter Theologe aus Tübingen, mit dem man über sein neues Buch mit dem trendigen Titel Religion multifunktional sprechen wollte, hatte vor einigen Stunden abgesagt. Klein hatte das Buch sogar extra gekauft und einige Passagen gelesen, um sich vorzubereiten. Er fand es nichtssagend, aber auch darüber hätte man reden können.
In seiner Region gäbe es vereiste Straßen, da sei die Autofahrt nach Bern ihm zu riskant erschienen, hatte der Professor beschieden. Klar, dachte Klein frustriert. Für die lächerlichen zweihundert Franken Honorar, die sie Gästen anboten, stieg so jemand nicht auf den Zug um.
Um das Gefühl zu haben, sich nicht ganz umsonst herbemüht zu haben, ging man die Tagesordnung pro forma im Eiltempo durch, beriet noch dies und jenes, und Klein goss sich dreimal vom übersäuerten Filterkaffee aus der Thermosflasche ein und stopfte sich in stumpfsinniger Gier Kekse in den Mund, obwohl sie ihm nicht schmeckten. Erst beim letzten Treffen war ihm aufgefallen, dass man an anderen Sitzungsorten als im jüdischen Gemeindehaus nie darauf achtete, koscheres Gebäck bereitzustellen. Sollte der Rabbiner eben die Früchte essen!
Schließlich kam man zum Schluss, dass es keinen der Anwesenden störte, wenn man heute früher Schluss machte. Sie trennten sich mit dem verbindlichen Händedruck einer verschworenen kleinen Gemeinschaft von Aufrechten, die nicht gleich kniffen, wenn es draußen mal ein paar Grad kälter war. Für diesen blöden Händedruck, dachte Klein, hatte es sich nicht gelohnt, die Reise zu unternehmen. Mit zwei anderen Kommissionsmitgliedern, die ebenfalls von auswärts gekommen und nicht viel besser gelaunt waren als er, stapfte er zum Bahnhof zurück. Sie sprachen kaum ein Wort, dafür war es zu kalt.
Der Halb-fünf-Uhr-Zug nach Zürich transportierte bereits die erste Welle Pendler aus der Bundesverwaltung nach Hause. Klein setzte sich, um der unangenehmen Promiskuität voller Viererabteile zu entgehen, in den Speisewagen. Ohnehin konnte er einen heißen Tee vertragen. Er zog die Mappe mit den Briefkopien aus der Tasche, um die Briefe Hermann Pollacks nun einer systematischeren Lektüre zu unterziehen. Gerade hatte er begonnen, sich nochmals in den ersten Brief einzulesen, der unvermittelt mit dem Ausruf begann: »Liebe Elisabeth, dieser Füllfederhalter ist für Dich!«, als ihm jemand auf die Schulter klopfte.
»Diese Schriftgelehrten – immer mit Lesestoff unterwegs, wie?«
Klein blickte auf. Über sich sah er das grinsende Gesicht von Guy Fuchs, Röbis Sohn.
»Hallo, Foxi«, sagte Klein so begeistert wie möglich.
Seit der Primarschule nannten ihn alle Gleichaltrigen so. Foxi hatte nach kurzer Gegenwehr erkannt, dass er besser damit fuhr, den Namen zu akzeptieren, und bestand am Ende geradezu darauf, so angesprochen zu werden. Als Klein, kurz nach seiner Einsetzung als Rabbiner der Cultusgemeinde, ihn Jahre später wieder getroffen hatte und ihn mit seinem Vornamen ansprach, hatte er überraschend ernst darauf hingewiesen, dass er immer noch Foxi sei. Klein hatte das eher als gespielte Lockerheit empfunden, denn Foxi galt sonst als ziemlich humorloser Snob. Vielleicht fand er es einfach chic, wenn der Rabbiner der Gemeinde ihn mit seinem alten Spitznamen rief.
Foxi wies auf den Platz Klein gegenüber. »Ist hier noch frei?«
»Ja, bitte.«
»Ich will aber nicht stören«, sagte Foxi.
»Aber überhaupt nicht«, sagte Klein und machte sich resigniert daran, Hermann Pollacks Briefkopien einzupacken. Die Kellnerin brachte seinen Tee.
Foxi bestellte ein Bier und deutete auf die Kopien. »Spannendes Zeug?«
Klein ärgerte sich. Fragte er Foxi, ob seine Finanzberatungsinstrumente »spannendes Zeug« seien?
»Briefe eines Überlebenden von Theresienstadt«, erklärte er.
»Oh – jemand aus unserer Gemeinde?«
»Kennst du Christoph Scheurer?«
Immerhin schien ja Foxis Vater mit Scheurer befreundet zu sein.
»Den Scheurer von der Unterland-Versicherung?«
»Genau der.«
Klein beobachtete, wie Foxis Augen hinter der Designerbrille einen staunend-respektvollen Ausdruck bekamen. »Ein bisschen. Wie man sich halt kennt im Geschäftsleben.«
Also gar nicht, dachte Klein. Röbi Fuchs’ Beziehungen waren nicht automatisch die seines Sohnes. »Seine Frau hat mir das gegeben. Stammt von ihrem Vater«, meinte er beiläufig.
»Scheurers Frau ist jüdisch?« Foxi schien wirklich überhaupt nichts von ihm zu wissen.
»Ihr Vater war jüdisch. Hermann Pollack aus Wien.«
»Wusste ich nicht.«
Foxis Bier kam.
»Einer der Vorzüge des Zugfahrens«, meinte Foxi, als er Klein sein Glas entgegenhob. Nachdem er einen Schluck genommen hatte, fügte er an: »Ich fahre ja sonst kaum mit dem Zug. Aber zur Abwechslung ist das doch ganz angenehm.« Und ohne dass Klein weiter nachgefragt hätte, meinte er: »Den Audi hat meine Frau gebraucht. Und der Maserati friert nicht gem. Na ja, Italiener halt.«
Klein lächelte gezwungen. Er verschwieg den Zustand seines alten Peugeot.
Foxis Miene wurde ernster. »Hast du gehört, dass mein Vater im Spital liegt?«
»Nein«, meinte Klein erschrocken. »Was hat er denn?«
»Er hatte letzten Freitag einen Herzinfarkt. Zum Glück war Rosalie gerade bei ihm. Sie hat sofort die Hatzoloh angerufen. Innert zwanzig Minuten war er im Spital. Die sind schon gut. Sonst wäre er kaum mehr unter uns.« Rosalie Schneidinger war Röbi Fuchs’ langjährige Geliebte, vor und nach seiner Scheidung, vor und nach dem Tod ihres Mannes.
»Und wie geht es ihm jetzt?«
»Besser. Er liegt nicht mehr auf der Intensivstation.«
»Kann man ihn besuchen?«
»Eigentlich versuchen wir ihn etwas zu schonen. Simone ist sehr viel bei ihm. Aber ich denke, über einen kurzen Besuch von dir würde er sich freuen.«
Foxis jüngere Schwester Simone war mit dem Zahnarzt Efrem Lubinski verheiratet, den man in der Gemeinde selten sah, weil er seine ganze Freizeit beim Segelfliegen oder Extremskifahren verbrachte. Simone war Klein immer sympathischer gewesen als ihr Bruder. Ihre Tochter Jenny war mit Kleins Tochter Dafna befreundet, was Klein nie ganz verstand, da er Jenny verwöhnt und launisch fand. Aber jedes Mal, wenn Dafna in der Lubinski-Villa in Rüschlikon eingeladen war, hatten sie vorher das halbe Koschergeschäft Zürichs leergekauft, um sie angemessen bewirten zu können, obwohl sie selbst zu Hause nicht mehr koscher aßen.
Klein und Foxi unterhielten sich den Rest der Reise über Gemeindepolitik und über ihre Kinder. Zwei- oder dreimal versuchte Foxi nochmals beim Thema Christoph Scheurer einzuhaken und mehr darüber zu erfahren, wie der Kontakt zwischen dessen Frau und Klein zustande gekommen war und in welcher Beziehung der Finanzchef des Unterland-Konzerns und der Gemeinderabbiner genau zueinander standen, doch Klein hielt sich bedeckt.
Kurz vor der Einfahrt nach Zürich, zwischen Dietikon und Altstetten, meldete sich per Lautsprecher die Zentrale der Schweizerischen Bundesbahnen in Bern. Wegen der außergewöhnlich tiefen Temperaturen seien die Gleise im Bereich des Zimmerberg-Tunnels derzeit nicht befahrbar, und im Bahnhof Enge – der alten Strecke, die vor dem Bau des Tunnels für alle Fahrten am linken Zürichseeufer benützt wurde – habe sich ein Personenunfall ereignet. Deshalb sei die Zugverbindung zwischen Zürich und der Innerschweiz, dem Bündnerland sowie nach Italien und Österreich derzeit gesperrt. Es wurde auf die Lautsprecherdurchsagen im Hauptbahnhof Zürich verwiesen.
Klein war einen Moment irritiert – für die Bahn war ein »Personenunfall«, der Tod eines Menschen auf den Gleisen, immer zunächst ein organisatorisches Problem, und für die Reisenden letztlich auch. Foxi legte ebenfalls die Stirn in Falten. »Hoffentlich hat Simone es noch heim geschafft vom Spital. Sie wollten heute Abend in die Oper. Die neue Carmen-Aufführung, du hast sicher davon gehört.«
Klein nickte kurz. Opern interessierten ihn nicht. Er zog seine Winterjacke und seine Wollmütze an, die ihm Rivka statt seines Hutes aufgenötigt hatte, und band diesmal rechtzeitig seinen Schal um. Er verabschiedete sich von Foxi mit einem Händedruck, bevor er die Handschuhe anzog, und gab ihm gute Wünsche für den Vater mit.
»Ich besuche ihn in den nächsten Tagen.«
»Er wird sich freuen, danke.«
Als Klein heimkam, war Rivka in miserabler Stimmung. Die elfjährige Rina lernte mit Kleins Rabbinatspraktikant David Bohnenblust für die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium. Dafna war in irgendein Endlosgespräch am Telefon versunken. Kleins Schwiegereltern saßen im Salon und sahen fern – ziemlich laut, wie Klein erstmals auffiel.
»Was hast du denn?«, fragte Klein seine Frau, die in der Küche fuhrwerkte.
»Nichts, alles wunderbar. Kochen für heute Abend, vorkochen für den Schabbat, fertig packen, Taxi für morgen früh bestellen, Dafna, die ihre Schulaufgaben nicht macht. Und heute Nachmittag hab ich noch zwei Stunden Unterricht gegeben. Halsweh hab ich auch. Am Ende kann ich gar nicht fliegen. Noch mehr Auskünfte gefällig?«
Klein versuchte sie zu besänftigen, obwohl er wusste, dass das nichts nützte. Er könne selbst für den Schabbat kochen.
»Ach ja? Ein Spiegelei? Oder Spaghetti?«
Sie hatte leider recht: Seine Kochkünste waren nie weit gediehen.
Er würde immerhin kontrollieren, dass Dafna ihre Schularbeiten mache. Leider müsse er aber heute Abend auch nochmals weg – sein Talmudkurs.
»Ich weiß«, sagte Rivka resigniert, aber mit leicht versöhnlichem Unterton.
Gleich nach dem Essen ging Klein zur Synagoge, in deren oberen Räumen der Lehrkurs stattfand. Die paar Teilnehmer waren trotz der Eiseskälte zum größten Teil erschienen. Sie beschäftigten sich heute mit den zwölf Broten, die eine ganz bestimmte Form besaßen, wöchentlich im Tempel auf ein Gestell gelegt worden waren und immer frisch blieben. Nur eine Familie im ganzen biblischen Israel, so lautete die Legende, beherrschte die Kunst, die Brote so zu backen.
»Eine Woche lang frisch«, schwärmte einer der Männer. »Das hat unsere Koscherbäckerei hier meistens nicht mal für einen Tag geschafft.«
»Deshalb ist sie vielleicht auch eingegangen«, sinnierte ein anderer.
»Immer frisch – das steht für die Liebe zwischen Gott und Israel«, meinte Klein. »Wie im Schir Haschirim. So verstehe ich das.« Er dachte an die Briefe Hermann Pollacks und dessen Faszination für das Hohelied.
Nach dem Ende des Kurses saßen sie noch länger beisammen, tranken Tee und bereiteten sich auf den erneuten Gang durch die bissige Kälte vor.
Als Klein nach Hause kam, war es nach halb elf. Rivka und ihre Eltern, die schon vor fünf Uhr aufstehen mussten, waren schlafen gegangen, und Dafna und Rina, die sich während des Aufenthalts der Großeltern das Zimmer teilten, tuschelten bei offener Tür noch im Bett. Als Klein ins Zimmer trat, stellte Rina sich sofort schlafend, was ihn zum Lachen brachte und die Mädchen schließlich ebenfalls. Er gab jeder einen Kuss und zog im Hinausgehen die Tür hinter sich zu.
Am Morgen gegen sechs, als das Taxi mit Rivka und ihren Eltern soeben abgefahren war und Klein sich noch einmal für ein paar Minuten hingelegt hatte, bevor er und die Mädchen würden aufstehen müssen, läutete das Telefon. Offenbar hatte Rivka etwas vergessen oder musste ihm noch vor der Abreise etwas sagen. Klein griff auf den Nachttisch und hob ab, ohne hinzusehen. »Ja?«, sagte er gedehnt, ohne seine Müdigkeit zu überspielen.
Es war aber nicht Rivka. Am Telefon meldete sich ein Mitglied seiner Gemeinde, Charly Singer, mit Grabesstimme. Seine Ex-Frau war gestern Nachmittag kurz nach fünf im Bahnhof Enge von einem Zug überfahren worden. Als sie auf die S-Bahn wartete, die sie heim nach Kilchberg hätte bringen sollen.
»Der Personenunfall!«, entfuhr es Klein unwillkürlich. Und nach einem Moment des Innehaltens fragte er: »Hat sie – sich umgebracht?«
»Es ist nicht klar. Es gibt keine direkten Anzeichen dafür. Vielleicht war es auch ein Unfall.«
»Das tut mir so außerordentlich leid«, sagte Klein.
Charly schwieg. Es gab mehrere Möglichkeiten, das zu deuten.
»Und wo ist Nathan?«, fragte Klein schließlich nach einer unangenehmen Pause.
»Nathan ist bei mir. Er wird von einer Polizeipsychologin betreut.«
»Und du?«
»Na ja, ich musste die Leiche identifizieren heute Nacht …«
»In ein paar Minuten bin ich bei dir. Wenn es dir recht ist.«
»Ja«, sagte Charly. »Es ist mir recht.«
Klein holte die Mädchen aus dem Bett und wies sie an, sich heute selber für die Schule bereit zu machen. Er bestellte ein Taxi und fuhr ins Seefeld zu Charly Singer.
2
Liebe Elisabeth,
seit vier Monaten bin ich nun in Davos. Und Du findest mich heute so gelöst, so – ich möchte fast sagen – glücklich, wie ich es nie mehr war, seit …
Und schon kann ich fast nicht mehr weiterschreiben vor Trauer und Sehnsucht. Dabei wollte ich Dir doch genau das Gegenteil berichten. Nämlich vom Besuch des Berner Religionslehrers Kupfer gestern hier in unserem Sanatorium. Er ist unser geistlicher Betreuer und Seelsorger. Du erinnerst Dich, er war es, der mir vor einigen Wochen die Bibelübersetzung von Leopold Zunz gegeben hat. »Nicht um Ihnen Glauben zu schenken«, hat er damals gesagt, »wie könnte ich mir das anmaßen. Ich bin ja kein Missionar. Sondern um Ihnen Gedanken zu schenken.« Ich habe Dir das damals geschrieben, und diese Worte bewegen mich immer noch.
Gestern hat er mich gefragt, ob ich schon Gelegenheit hatte, in der Bibel zu lesen, und ich musste ihm antworten, dass ich bisher darin keine Gedanken gefunden habe. Dass ich daran bin zu zerbrechen, weil mein einziges Lebensziel, das mich T. durchstehen ließ, Dich, meine Geliebte, zu retten, sich nicht erfüllt hat. Ich sagte ihm ganz offen, was ich vor einigen Wochen unserem hiesigen Lungenarzt Dr. Schöller anvertraut habe: dass ich keinen Zweck mehr im Leben sehe. Dr. Schöller hatte seinerzeit gemeint, ich solle die Vergangenheit hinter mir lassen, ich sei noch jung, könne neu beginnen. Ich hatte Dir das nicht geschrieben, es schmerzte mich zu sehr und hätte Dich wohl noch mehr geschmerzt.
Er hatte es gut gemeint und nichts verstanden.
Herr Kupfer hat mir hingegen geraten, das Hohelied zu studieren. »Sie brauchen Leidensgenossenschaft in der Liebe.« Mehr hat er nicht gesagt. Heute las ich die ersten Verse. Ja, sie sind das Erste, was mir seit allem, was mit uns geschehen ist, für ein paar Stunden Seelenruhe gespendet hat. Ich wollte sie mit Dir teilen, nun ist sie dahin.
In grenzenloser Liebe
Dein H.
Die Familie Singer hatte zu den unauffälligeren in der Gemeinde gehört. Klein kannte Charly Singer aus dem Jugendbund, seine Frau Carmen stammte aus der Romandie, und ihr Sohn Nathan war mit Dafna in dieselbe Klasse der jüdischen Primarschule Efrat gegangen. Näheren Kontakt pflegten die Kleins mit den Singers nicht, ab und zu führten Rivka und Carmen kurze Gespräche, wenn sie vor dem Schulgebäude darauf warteten, dass die Kinder herausstürmen würden. Klein und Charly verband lose auch das gemeinsame Schicksal von promovierten Historikern, die beide versucht hatten, den universitären Weg einzuschlagen, und dabei gescheitert waren – wobei Charly länger gebraucht hatte, um sich von seinen Illusionen zu verabschieden, als Klein, der bald in der Cultusgemeinde seinen Platz gefunden und schließlich das Rabbinat übernommen hatte. Charly Singer leitete eine Unterabteilung des Zürcher Staatsarchivs, während Carmen damals als Sachbearbeiterin an der Universität arbeitete, weil sie als Betriebswirtschafterin keine Teilzeitstelle gefunden hatte. Eine normale kleine Familie eben.
Bis eines Tages vor etwa drei Jahren Carmen Singer unangemeldet und vollkommen aufgelöst in Kleins Büro stand. Vor einigen Wochen, so erzählte sie, hätten Charly und sie sich fürchterlich gestritten, und sie habe ihm in ihrer Wut und um ihn zu demütigen an den Kopf geworfen, dass sie damals, als sie gemeinsam während Charlys Postdoktorat vor Nathans Geburt zwei Jahre in Kanada verbracht hatten, eine Affäre mit einem anderen Mann aus ihrer dortigen Gemeinde gehabt habe. Und Charly hatte daraufhin nichts anderes zu tun gehabt, als von Nathan eine Speichelprobe zu nehmen und einen Vaterschaftstest machen zu lassen.
Nathan war nicht sein Sohn.
Wenn Nathan aber Carmens Sohn aus einer verbotenen Beziehung war, dann war er ein Mamser, ein Bastard – das härteste Los, das einen jüdischen Menschen überhaupt treffen konnte, denn es gab praktisch keine jüdischen Ehepartner mehr, die er nach der Halacha heiraten durfte. Carmen verfluchte sich, in der Wut eine Spur gelegt zu haben, die sie selbst immer geahnt, aber nie verraten hatte. Sie verfluchte ihren Mann, der die Gnadenlosigkeit besessen hatte, seinen Sohn oder das, was er immer dafür gehalten hatte, in einen Mamser zu verwandeln. Und sie verfluchte ein religiöses Gesetz, das unschuldige Menschen wie ihren Sohn Nathan ein ganzes Leben lang stigmatisierte – es sei denn, der Rabbiner wisse Rat.
Diesen Rat zu wissen, war für Klein in der Tat nicht sehr schwierig gewesen. Denn so drakonisch die Maßnahmen waren, die einen Mamser trafen, so erfindungsreich waren die Rabbiner über die Jahrhunderte gewesen, um diesen Zustand faktisch abzuschaffen. Der leiseste Zweifel, der daran bestehen konnte, dass ein Mensch ein Mamser war, wurde bereits verwendet, um ihm diesen problematischen Status abzusprechen. Und wenn es einen solchen Zweifel nicht gab, konnte man notfalls auch einen schaffen.
»Wie wissen wir überhaupt, dass die Speichelprobe, die dein Mann eingesandt hat, von eurem Sohn stammte?«, fragte er die perplexe Carmen.
»Aber …«, hatte Carmen einzuwenden versucht.
»Und selbst wenn das sicher wäre – wer kann beweisen, dass dann der biologische Vater von Nathan überhaupt ein Jude war? Vielleicht hat dir dieser Mann in Kanada das nur vorgegaukelt. Oder vielleicht hattest du ja gleichzeitig noch einen anderen, nichtjüdischen Liebhaber. Denn du musst wissen, dass nach all den Pogromen und anderen Formen von Gewalt, die Juden und auch jüdische Frauen in der Geschichte erleiden mussten, nach der Lehrmeinung die Vaterschaft eines Nichtjuden das Kind nicht zum Mamser macht.«
»Aber …«
»Es gibt kein Aber!«, hatte Klein Carmen Singer barsch unterbrochen. »Solange du daran interessiert bist, dass euer Sohn kein Mamser ist, gibt es kein Aber. Alles, was es gibt, ist eine Fülle ungeklärter Fragen, die es in weite Ferne rücken lassen, Nathan aufgrund von irgendwelchen wolkigen Verdachten zum Mamser zu erklären.«
Carmen Singer war außerordentlich dankbar und erleichtert gewesen. Charly und sie wurden bald geschieden, aber sie vermieden es beide, über Nathans Identität gegenüber Dritten zu sprechen, und wie Carmen ihm später einmal erzählte, hatte Charly auch vor Gericht keinen Gebrauch von seiner DNA