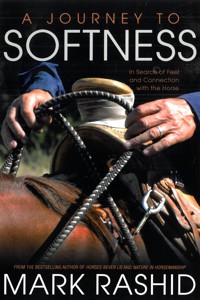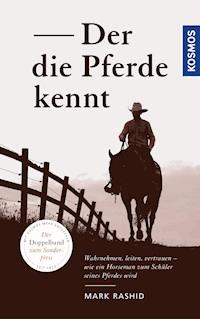
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Zwei Topseller vom sympathischen Horseman aus Colorado im Doppelpack. Mit dem Wallach Buck tritt ein ganz besonderes Pferd in Mark Rashids Leben. Es stellt seine bisherigen Prinzipien auf den Kopf und macht ihn zu einem Trainer – "Der von den Pferden lernt". Mit "Dein Pferd – dein Partner" öffnet Mark Rashid dem Leser die Augen für die Denkweise der Pferde. Er kommt dabei zu überraschenden Einsichten und manchmal zu verblüffend einfachen und gut umsetzbaren Lösungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
— Der die Pferde kennt
Wahrnehmen, leiten, vertrauen – wie ein Horseman zum Schüler seines Pferdes wird________
MARK RASHID
KOSMOS
TEIL I – Der von den Pferden lernt
Danke fürs Denken
Vor ein paar Tagen habe ich mich mit Mark Rashid unterhalten, und inmitten einer Vielzahl von Geschichten kam heraus, dass er gerade an einem neuen Buch schreibt. Nun hätte das, was wir an Wertvollem zu sagen haben, bei den meisten von uns auf der Spitze des Bleistifts Platz, mit dem ich dies schreibe. Was also könnte Mark Rashid, nach drei Büchern, noch zu sagen haben?
Ich lernte Mark kennen durch seine Bücher. Ein gemeinsamer Freund hatte Der auf die Pferde hört gelesen und sagte, das müsse ich auch lesen. Ich las es und fand den Mann, den ich durch diese Geschichten hindurch sah, auf Anhieb sympathisch. Einem guten Geschichtenerzähler kann ich einfach nicht widerstehen.
Dann kam Buch Nummer Zwei, Ein gutes Pferd hat niemals die falsche Farbe, mit noch mehr guten Geschichten. Es steckte aber vielleicht auch mehr darin als nur ein paar gut erzählte Geschichten, denn jede enthielt eine Botschaft über Pferde und Menschen und ihr Zusammenleben in einer gemeinsamen Welt. Jetzt war er nicht nur ein Geschichtenerzähler, sondern auch eine Art Freund. Noch bevor ich ihm begegnete, betrachtete ich Mark als einen Freund, dem so viel an seinen Mitmenschen liegt, dass er Geschichten erzählt, aus denen wir etwas lernen können.
Dann traf ich meinen »Freund« persönlich und sah ihn mit Schülern und ihren Pferden arbeiten. Ich sah zu und merkte, dass dieser Geschichtenerzähler ein wunderbarer Lehrer war, der sich Zeit nahm, damit die Menschen lernten, ihre Pferde zu verstehen und den »Versuch« herauszuspüren. So begegnete ich dem Pferdemann in Mark. Ich sah, wie er bei seinen Kursen und seinem Unterricht diesen kleinen Schritt auf Seiten des Pferdes herausfühlte – diese Reaktion, die bewirkt, dass das Pferd nicht den Mut verliert, sondern weiter zu verstehen versucht, was Mark will, und vielleicht sogar mit ihm zusammen sein möchte.
Dann kam noch ein Buch, Denn Pferde lügen nicht. Diesmal konnte ich den Schriftsteller in Mark erkennen. Geschichten drucken zu lassen, ist eine Sache, aber Situationen aus dem wirklichen Leben auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, damit wir erkennen, um was es geht – dazu muss man ein guter Schriftsteller sein.
Hier kommt nun also sein neuestes Werk. Und dieses Mal habe ich noch eine Seite von Mark kennen gelernt. Oder doch nicht? Vielleicht ist es nur das, was all die anderen Seiten von Mark durchschimmern lässt. Denn in diesem Buch sehe ich, was für ein Denker Mark ist. Er schreibt Geschichten über seinen Freund, das Ranchpferd Buck, und wie viel besser er als Mensch und Pferdemann ist dank Buck. Nun könnten sicher viele von uns das Gleiche erleben und keinen weiteren Gedanken daran verschwenden, aber nicht so Mark.
Wenn Sie dieses Buch lesen, denken Sie daran, wie viele Gedanken sich Mark über diese Dinge gemacht hat. Vielleicht ist das der Grund, warum Buck es nicht aufgegeben hat, Mark etwas beibringen zu wollen. Er wusste, dass Mark nachdachte und einfach Zeit brauchte.
Aber nehmen auch wir uns die Zeit, über ähnliche Dinge nachzudenken? Mit seinem Buch möchte Mark, glaube ich, nicht nur die Lektionen, die er gelernt hat, mit uns teilen, sondern er versucht auch unseren Blick dafür zu schärfen, wie viel wir von einem Pferd lernen können. Versucht er vielleicht auch, uns zum Nachdenken zu bringen? Nachzudenken darüber, was wir von unseren Pferden lernen könnten. Darüber, wie viele Gedanken eine wichtige Lektion erfordern kann. Und nachzudenken darüber, wie viel unsere Pferde vielleicht selbst denken. Mir scheint, alle großen Pferdeleute, mit denen ich zu tun hatte, sind auch wirkliche Denker.
Deshalb, Mark, danke fürs Denken. Darüber, wie sich eine Geschichte am besten erzählen lässt. Ganz viel darüber, wie du die Geschichte auf den Punkt bringen kannst, damit wir daraus lernen. Darüber, wie du das, was du von Pferden gelernt hast, so vermitteln kannst, dass wir alle bessere Pferdemenschen werden. Darüber, wie man auf andere zugeht und mit ihnen umgeht, damit sie nicht nur Schüler sind, sondern sich als Freunde fühlen. Darüber, weitere Bücher zu schreiben, denn sie werden immer besser, und wir brauchen sie.
Damit zurück zu meiner Frage: Was könnte Mark noch zu sagen haben? Sehr viel, wie dieses Buch beweist. Ich hoffe, dass es Sie mitnimmt auf eine Denkreise. Lesen Sie, genießen Sie, DENKEN SIE!
Harry Whitney
Harry Whitney
Harry Whitney nennt sich selbst nicht gern horse trainer – Pferdeausbilder. Er ist lieber einer, der einfach die Dinge vom Standpunkt des Pferdes aus sieht, jemand, der fließend »pferdisch« spricht. Seine Kurse werden von Profis aus den verschiedensten Bereichen der Pferdeszene empfohlen. Als aufmerksamer, freundlicher und klarer Lehrer ist Whitney in der Lage, Menschen dabei zu helfen, ihre Pferde zu verstehen – nicht nur zu ihren Gunsten, sondern zu Gunsten ihrer Pferde.
Man lernt nie aus
Vor vielen Jahren hatte ich die Gelegenheit, einen großen Sänger und Songwriter aus West Virginia zu treffen. Vielen ist Larry Groce vielleicht noch aus den 1970er Jahren ein Begriff, als er einen Hit namens »Junk Food Junkie« aus dem gleichnamigen Album (können Sie sich noch erinnern, was ein Album war?) herausbrachte. Damals spielte ich Gitarre in einer Bluegrass-Band, und zufällig gehörten einige Nummern aus Larrys Album damals zu unserem Repertoire.
Ein paar Monate später rief ich Larry an und fragte ihn, ob er Lust hätte, zu uns zu kommen und eine Show zu machen, und er sagte, mit Vergnügen. Ich erwähnte, dass unsere Band beinahe jeden Song aus diesem Album kannte und dass wir sie Note für Note so spielten, wie er sie aufgezeichnet hatte. Er ging damals immer ohne Band auf Tournee, und ich sagte, wir wären nur zu glücklich, bei der Show für ihn spielen zu können. Am anderen Ende der Leitung trat eine kurze Stille ein.
Dann sagte er fast entschuldigend: »Weißt du, Mark – eigentlich spiele ich diese Songs kaum noch.«
»Nicht?«, fragte ich voller Überraschung.
»Nein«, sagte er. »Diese Platte ist über zehn Jahre alt, und mir geht es jetzt irgendwie um andere Dinge.«
»Aber es sind so tolle Songs«, erwiderte ich.
»Sind sie«, stimmte er zu. »Aber es gibt da draußen noch andere tolle Songs.«
Mit dem Hörer in der Hand saß ich einigermaßen entgeistert da. Was meinte er mit den »anderen Dingen«? Was sollte das heißen, es gäbe noch andere tolle Songs? Unsere Band hatte seine Musik gerade erst entdeckt, und nun stellte sich heraus, dass er sie nicht mehr spielte. Was für ein Schock! Ich konnte nicht verstehen, warum jemand auf etwas so Wunderbares verzichten, es hinter sich lassen und weitergehen sollte.
Am Abend der Show verstand ich warum. Larry hatte ein paar Tage später zurückgerufen und gesagt, er würde doch ganz gern ein paar der alten Songs mit unserer Band spielen. Die Show begann also mit fünf oder sechs Songs aus dem Album, und wir spielten sie wie versprochen Note für Note so, dass sie klangen wie auf der Platte. Dann gingen wir ab, und Larry spielte und sang allein weiter. Mit nichts als seiner neuen Musik und seiner Gitarre brachte Larry das Haus zum Kochen. Nun war mir klar, warum er sich fortbewegt hatte – er wollte, dass seine Musik besser wurde. Und das war ihm auch gelungen. Die alten Songs waren großartig, und er brachte sie großartig, aber die neuen Sachen waren besser und er auch.
Larry hatte seine alte Musik nicht aufgegeben oder hinter sich gelassen. Er hatte sie einfach mitgenommen, als er weiterging. Es zeigte, dass hier jemand nicht zufrieden war mit dem Status quo, auch wenn er ihn weit gebracht hatte. Es zeigte, dass hier jemand auf der Suche nach Meisterschaft war.
Das Problem, wenn jemand sich auf die Suche nach Meisterschaft begibt, besteht darin, dass sich die Menschen um ihn herum plötzlich allein gelassen vorkommen können. So war es mir ergangen, als Larry mir zum ersten Mal gesagt hatte, seine Musik hätte sich weiterentwickelt. Am liebsten hätte ich ihn gepackt und geschrieen: »Halt, warte! Ich habe doch deine alte Musik gerade erst entdeckt! Ich fange gerade an, damit klarzukommen! Lass mich jetzt nicht im Stich! Die neuen Sachen gefallen mir vielleicht gar nicht. Oder noch schlimmer: Vielleicht gefallen sie mir besser! Dann muss ich mich selbst auch verändern! Wenn du dich nicht veränderst, brauche ich es auch nicht zu tun, und das wäre für mich viel leichter.«
Nun, seltsamerweise finde ich mich heute in einer ganz ähnlichen Situation wieder wie damals Larry. Im September 1992 begann ich, mein erstes Buch, Der auf die Pferde hört – Erfahrungen eines Horseman aus Colorado, zu schreiben. Es war ein Erlebnis, denn der Schreibprozess löste Hunderte wunderbarer Kindheitserinnerungen aus, die, weggepackt in einem muffigen Koffer, irgendwo im Hinterstübchen meines Unterbewusstseins geruht hatten. Es war mein erster Versuch als Buchautor und eine wunderbare Gelegenheit, einige meiner Erfahrungen mit Pferden – gute wie schlimme – mitzuteilen.
Hauptsächlich wollte ich über das Training von Pferden schreiben, ohne aber in ein allzu sachliches »How-to« zu verfallen. Schließlich fällt es mir selbst ausgesprochen schwer, Sachbücher mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu lesen, ich würde also sicher kein solches Buch schreiben können. Statt dieser typischen Form entschied ich mich für eine anekdotische Erzählweise. Zur allgemeinen Überraschung (nicht zuletzt meiner eigenen) schien ich bei meinen Lesern damit einen Nerv getroffen zu haben – das Buch wurde ein Erfolg.
Wir hatten so viele positive Rückmeldungen zu diesem Erstling, dass ich bald aufgefordert wurde, einen Nachfolger zu schreiben. Ungefähr ein Jahr später kam Ein gutes Pferd hat niemals die falsche Farbe auf den Markt. Es war im gleichen Stil geschrieben, behandelte aber verschiedene Themen und wurde ebenfalls erstaunlich gut aufgenommen.
Sehr bald nach diesem zweiten Buch kehrte ich aber zurück zu meiner Rancharbeit, mit dem Gefühl, dass meine Tage als Buchautor hiermit beendet waren. Erstens hatte ich mich eigentlich nie als Schriftsteller gesehen, und außerdem dachte ich, ich hätte sowieso nichts Weiteres mehr zu sagen.
Ein paar Jahre vergingen, und langsam war ich von der Rancharbeit immer mehr zu Kursen für Reiter und Pferde übergegangen. In manchen fing ich an, über eine Trainingsidee zu sprechen, die mir jahrelang am Herzen gelegen hatte: den passive leader, den »gewählten Führer«. Einfach gesagt, geht es darum, mit einem Pferd umzugehen und es auszubilden als »gewählter Führer«, dem das Pferd vertraut und dem es aus freiem Willen folgt, im Gegensatz zu einem »Alpha-Führer«, der normalerweise den anderen Pferden seine Führerschaft mehr oder minder gewaltsam aufzwingt.
Anscheinend brachte der Gedanke manche Kreise der Pferdewelt in einige Unruhe. Er wurde auch sehr oft missverstanden, weil ich die beiden Begriffe passive und leadership zusammen gebrauchte. Wie kann man passiv und trotzdem ein Führer sein? Wie auch immer, bald darauf schrieb ich mein letztes Buch, wie ich damals ehrlich glaubte: Denn Pferde lügen nicht – Neue Wege zur vertrauten Mensch-Pferd-Beziehung.
In diesem Buch bemühe ich mich bewusst, aus dem Schatten meiner ersten beiden Bücher herauszutreten. Sie waren mehr oder weniger Schnappschüsse gewesen, Momentaufnahmen dessen, wo ich bei meiner Arbeit mit Pferden stand. Die meisten waren in der Vergangenheitsform geschrieben und handelten von Umständen und Ideen, die mich dahin gebracht hatten, wo ich mich jetzt befand. Nicht unbedingt davon, wohin ich mich bewegte. Als ich Denn Pferde lügen nicht schrieb, war ich tatsächlich schon dabei, einige der Methoden, über die ich in meinem ersten Buch gesprochen hatte, zu verfeinern und in manchen Fällen sogar zu ändern.
Wenn Sie so wollen, bedeutet Denn Pferde lügen nicht sogar eine Veränderung in meinem Schreibstil. Das Buch enthält zwar immer noch sehr viele Anekdoten, aber es kam mir doch vermehrt darauf an, meine Ideen an den Leser zu bringen. Da ich damals noch dachte, dies sei mein letztes Buch, legte ich großen Wert darauf darzulegen, was genau der Sinn und Zweck des Buches war. Ich schrieb nicht mehr so viel in der Vergangenheit und mehr über die Gegenwart. Ich denke, Denn Pferde lügen nicht brachte, kurz gesagt, meine Leser auf den Stand, auf dem ich mich mit meiner Horsemanship damals befand.
Auf den Monat genau vor zehn Jahren habe ich begonnen, Der auf die Pferde hört zu schreiben. In dieser Zeit sind allmählich Veränderungen in meinem Leben eingetreten, besonders was den Umgang mit Pferden, aber auch was den Umgang mit Menschen anbetrifft. Vermutlich könnte man sagen, dass ich daran gearbeitet habe, es in meinem Beruf zur Meisterschaft zu bringen, ein Ziel, das ich wahrscheinlich nie erreichen werde. Ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich weiter nach Meisterschaft streben will, einiges, was ich früher getan habe, verbessern muss. Einiges muss gleich bleiben, und einiges muss ich aufgeben.
Mein neues Buch, Der von den Pferden lernt, sehe ich als nächsten Schritt in diesem Prozess. Es ist so etwas wie eine Dokumentation der fünfzehn Jahre, die ich mit Buck, meinem alten Pferd, erlebte, der mich in dieser Zeit sanft auf einen besseren Lebensweg gebracht hat. Ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob es Zufall war oder Absicht, aber eines weiß ich: Er war ganz sicher der Auslöser für meine Suche nach Wachstum, sowohl beruflich wie privat. Er machte mir klar, dass meine Arbeit mit Pferden nicht besser werden konnte, wenn ich nicht zuvor andere Dinge in meinem Leben verbesserte.
Ich hoffe, Ihnen macht das Lesen so viel Spaß wie mir das Schreiben. Auf der einen Seite bedeutet das Buch das Ende einer großartigen Partnerschaft zwischen Buck und mir, es bedeutet aber auch einen ganz neuen Anfang für uns beide. Für ihn ist es das Rentnerdasein und die wohl verdiente Freizeit. Ich fange in verschiedenen Bereichen meines Lebens gerade wieder neu an. Hoffentlich bin ich diesmal – dank der Lektionen, die ich von Buck gelernt habe – etwas besser auf das vorbereitet, was das Leben für mich bereit hält, auch wenn ich im Augenblick noch keine Ahnung habe, was das sein wird.
M. R.
Von Tieren lernen
Vor einiger Zeit hörte ich durch eine Freundin von einer interessanten Idee. »Der Mythos von Er«, wie sie es nannte, soll sehr alt sein und auf die Zeiten Platons oder sogar noch weiter zurückgehen.
Interessiert forschte ich nach und fand heraus, dass die Idee tatsächlich seit Jahrhunderten in verschiedenen Kulturen herumgeistert. Je nach Kultur hat der Mythos von Er verschiedene Namen, aber mit Ausnahme einiger unbedeutender Einzelheiten wird die Geschichte immer ziemlich ähnlich erzählt.
Der Mythos besagt, dass wir alle, bevor wir auf die Erde kommen, eine Seele erhalten. Bevor wir zum ersten Mal geboren werden, wird uns das ultimative Ziel für diese Seele eröffnet – ein weiser und freundlicher Geist zu werden, voller Leben und Wissen, was in jedem weiteren Leben weitergegeben und verbessert werden kann. Dann sollen wir uns ein Werk aussuchen, dem wir uns in dem Leben, in das wir nun hineingeboren werden, widmen sollen. Die Aufgabe, die wir wählen, hilft uns, den ultimativen Zweck unserer Seele zu erfüllen.
Wenn wir uns entschieden haben, sollen wir alle Aspekte unseres Lebens auswählen, einschließlich der Familie, in die wir hineingeboren werden, der Freunde und Bekannten, mit denen wir in unserem Leben in Kontakt kommen wollen, der Wege, die wir finden, und sogar der Tiere, mit denen wir leben und arbeiten wollen. Wenn all dies entschieden ist, und nur dann, werden wir in diese Welt geboren und beginnen unsere Reise. Der Haken dabei ist, dass wir, in dem Moment, wo wir geboren werden, den ganzen Prozess vergessen, den wir gerade durchlaufen haben.
Im Laufe unseres Lebens werden wir mit den Ergebnissen all der Entscheidungen konfrontiert, die wir vor der Geburt getroffen haben. Manche sind schwer zu ertragen, andere nicht. Aber alle sind dazu bestimmt, uns beim Erreichen des Ziels zu helfen, das wir uns für dieses spezielle Leben vorgenommen haben. Wir durchlaufen dieses Leben, und schließlich sterben wir. Nach dem Tod kehrt unsere Seele zum Ausgangspunkt zurück.
Dort haben wir wieder Zugang zu unserem Gedächtnis und sind gehalten, das Leben, das wir gerade geführt haben, einzuschätzen. Haben wir unsere Aufgabe vollendet? Wenn nicht, können wir uns dafür entscheiden, in einem neuen Leben einen weiteren Versuch zu machen, wenn Sie wollen, nach denselben Regeln. Haben wir die Aufgabe ausgeführt, wählen wir ein anderes Leben und nehmen uns eine neue Aufgabe vor. Aber bei jeder Geburt vergessen wir, was wir in unseren vorherigen Leben erlebt haben und welche Entscheidungen wir für unsere Seele getroffen haben.
Um vollkommen zu werden, sind – dem Mythos zufolge – Tausende von Lebensspannen nötig. Und hier wird der Mythos ein wenig nebulös. Je nach Kultur geht es unterschiedlich weiter, wenn die Seele die Vollkommenheit erreicht hat. Manche asiatische Kulturen schicken die Seele beispielsweise immer wieder in dieselbe Familie zurück, auch wenn sie bereits vollkommen ist. Deshalb werden in diesem Kulturbereich die Kinder so gut behandelt – den Eltern ist bewusst, dass sie als Kinder ihrer Kinder wiedergeboren werden könnten!
Ich habe eine eigene kleine Theorie entwickelt, was mit einer Seele passiert, wenn sie die Vollkommenheit erreicht hat. Ich glaube, die vollkommene Seele erhält die Gelegenheit, als Lehrer zurückzukehren für all die Menschen, die noch mit der Erfüllung ihrer Aufgabe kämpfen. Das Besondere an meiner Theorie ist, dass sie diesmal in Gestalt eines Tieres, auch eines Insekts, wiedergeboren werden.
Natürlich habe ich keinerlei Beweis für die Richtigkeit dieser Theorie, aber wenn Sie darüber nachdenken, können Sie es sich vielleicht ebenfalls vorstellen. Katzen sind vielleicht dazu da, damit wir lernen, das Leben weniger ernst zu nehmen. Von den Hausfliegen sollen wir womöglich Geduld lernen und von Ameisen, was mit Zusammenarbeit zu erreichen ist. Es könnte sein, dass wir von unseren Hunden lernen sollten, wie viel Spaß es macht, dem eigenen Schwanz hinterherzujagen. Ich wette, wenn wir genau genug hinschauen, können wir so ziemlich von jedem Lebewesen auf dem Planeten etwas Positives lernen.
Und damit komme ich zu Buck, dem Pferd, um das es in diesem Buch geht. Buck habe ich 1986 als Siebenjährigen von einem Freund bekommen. Er war damals kaum geritten. Ehrlich gesagt, war ich nicht allzu erpicht darauf, ein so altes Pferd anzureiten, aber ich dachte: Was soll’s, einem geschenkten Gaul – Sie wissen schon. 1986 war ich zwar immer noch mit Rancharbeiten verschiedenster Art beschäftigt, fing aber gerade an, mir einen Ruf als Pferdetrainer aufzubauen, der hauptsächlich mit Problempferden arbeitet. Ein großes, kräftiges Pferd wie Buck würde, wenn es sich bewährte, höchstwahrscheinlich bestens in mein Programm passen. Also war ich bereit, es mit ihm zu versuchen.
Am besten lesen Sie den letzten Satz noch einmal, denn er gibt Ihnen eine ziemlich gute Vorstellung von meinen Gedanken, als Buck und ich anfingen, zusammen zu arbeiten. Wie die meisten Pferdeleute nahm ich einfach an, dass ich derjenige sein würde, der lehrt, und Buck derjenige, der lernt.
Eine Zeitlang stimmte das auch. Aber nicht sehr lange. Mir ging schon ziemlich schnell auf, dass die Dinge diesmal anders laufen würden – weil Buck anders war.
Sie werden sehen, dass ich eine Weile brauchte, um die gewohnte Schiene zu verlassen. Aber dann merkte ich, dass ich es war, der zu lernen hatte, nicht er. Als die Jahre vergingen und sich meine Einstellung bezüglich meiner eigenen Rolle zu ändern begann, verstand ich allmählich, dass ich einem wirklich großen Lehrmeister gegenüberstand, einem, der über das Wissen vom Anbeginn der Zeiten an verfügte. Er war ein Lehrmeister, der schließlich mein bester Freund und Partner wurde. Vielleicht gehörte es alles zu einem großen Plan. Vielleicht war es nichts als Zufall. Auf jeden Fall bin ich sicher, dass ich es durch ihn viel weiter gebracht habe, als es mir ohne ihn je möglich gewesen wäre.
Dies ist nun also unsere Geschichte. Wenn Sie sie lesen, verstehen Sie vielleicht, warum ich das Gefühl habe, dass Buck das Wissen aller Zeiten mit in unsere Beziehung gebracht hat … dass er eine vollkommene Seele war, die sich dafür entschieden hatte, bei mir zu sein und mir beim Lernen zu helfen.
Vergessen Sie aber nicht: Es ist nur eine Theorie. Sie könnte auch falsch sein.
Lektionen
Die Schule beginnt
Ich hatte gerade unsere vier Pferde gefüttert, drei im Auslauf und eines im Stall, aber das im Stall fraß nicht. Ein Pferd, das zur Futterzeit nicht frisst, gibt immer Anlass zur Besorgnis, und bei jedem anderen außer diesem einen Pferd hätte ich mir auch wirklich Sorgen gemacht.
Die anderen drei Pferde legten schon die Ohren an, quietschten und jagten sich gegenseitig von den drei Heuhaufen weg, einen für jedes Pferd. Ihrem Ritual gemäß würden sie die nächsten fünf Minuten eine Art Reise nach Jerusalem spielen und sich weiterbewegen, sobald der Kleinste von ihnen – ein knapp 1,45m großer Falbe mit Aalstrich namens Tuff – beschloss, das Heu vom nächsten Haufen zu versuchen. Dann ging er mit angelegten Ohren zum nächsten Haufen und verjagte Red, einen Fuchswallach von 1,62m Stockmaß, gegen den Tuff aussah wie ein Zwerg. Red wiederum drohte mit angelegten Ohren Quincy, einem Wallach von 1,52m Stockmaß, der friedlich vom dritten Haufen fraß und nun zu dem Haufen ging, den Tuff gerade liegen gelassen hatte. Dann kehrte wieder Ruhe ein, bis Tuff sich wieder für den nächsten Haufen interessierte und das Spiel von Neuem begann.
Es war zwar lustig, den Dreien dabei zuzusehen, wie sie sich die Abendmahlzeit arrangierten, aber meine Aufmerksamkeit galt dem Wallach im Stall, meinem alten Pferd Buck. Mit dreiundzwanzig zeigte er allmählich Alterserscheinungen. Vor ein paar Monaten hatte ich ihn als Ranchpferd in Pension geschickt und meinem jüngsten Sohn Aaron geschenkt.
Vor kurzem hatte ich ihn von der Winterweide geholt, weil sie ihm nicht so gut zu bekommen schien. Er war zwar nicht ausgesprochen dünn, aber es ging ihm ganz offensichtlich nicht so gut wie den anderen. Er war schon immer ein schlechter Futterverwerter gewesen, und es war für mich seit jeher ein Alarmzeichen gewesen, wenn er anfing, Gewicht zu verlieren. Ich holte Buck also von der Weide nach Hause, damit er mit etwas Zusatzfutter vielleicht wieder ein paar Pfund zulegen konnte.
Buck stand in seinem Auslauf vor der Box und sah mich nur an. Gelegentlich verlagerte er das Gewicht von einem Hinterfuß auf den anderen, aber ohne mich aus den Augen zu verlieren. Ich hatte ihm gerade seine Abendration Pellets in die Krippe geschüttet, die er aber vollständig ignorierte, ein Verhalten, das die meisten Leute irritiert hätte. Ein Pferd, das nicht frisst, nicht einmal sein Zusatzfutter, bedeutet normalerweise nichts Gutes, möglicherweise eine Kolik. Aber ich konnte deutlich sehen, dass Buck nicht krank war. Er versuchte mir nur etwas mitzuteilen.
Ich war gerade ziemlich beschäftigt und versuchte, ihn zu ignorieren, während ich meiner Arbeit nachging. Aber nach all den gemeinsamen Jahren wusste ich, dass ich ihn nicht lange würde ignorieren können, wenn er sich so benahm. Ich drehte mich um und sah ihn an.
»Was ist?«, fragte ich.
Wie zur Antwort wandte er nonchalant den Kopf und sah in seine Box. Ich ging hinüber zum Auslauf, streckte die Hand durch den Zaun und streichelte ihm den Hals. Sein Kopf blieb aber abgewendet, und obwohl ich sein linkes Auge – das mir am nächsten war – kaum sehen konnte, bemerkte ich, dass er mich ansah.
Prima. Wenigstens war klar, dass, was immer er auch wollte, sich in seiner Box befand. Vermutlich irgendetwas mit seinen Pellets, dachte ich. Ich stellte den Rechen ab, ging um die Ecke und in den Stall, öffnete die Schiebetür zu seiner Box und ging hinein. Buck kam mir in der Box entgegen. Ich untersuchte die Pellets auf Fremdobjekte – keine da. Ich nahm ein paar auf, roch daran, probierte sie sogar, ob sie in Ordnung waren – alles okay. Ich sah nach, ob er genügend frisches Wasser hatte – hatte er.
Er stand da und sah mich an. Ich schaute mich um, konnte aber nichts Außergewöhnliches entdecken. Also klopfte ich ihm den Hals und ging hinaus. Er schnarchte laut und schüttelte den Kopf. Ich kehrte um und sah ihn durch die Gitterstäbe an. Er drehte sich ruhig um und sah hinaus zu den Pferden, die im Korral Reise nach Jerusalem um die Heuhaufen spielten. Wieder konnte ich erkennen, dass er mich, trotz seines abgewendeten Kopfes, ansah.
Okay, nun wusste ich, dass er etwas wollte, das er nicht hatte, die anderen aber hatten, und dass es etwas mit seiner Box zu tun hatte. Was es auch war, es war ihm wichtiger als zwei Schaufeln Pellets in seiner Krippe. Das war mir klar, weil Buck im Verlauf unserer gemeinsamen Jahre, bei tausend Gelegenheiten, viel Zeit darauf verwendet hatte, mir beizubringen zuzuhören, was er zu sagen hatte. Mit Engelsgeduld hatte er mir Gedanken präsentiert, die ich von keinem Lebewesen außer dem Menschen für möglich gehalten hätte.
Das erste Mal, als Buck versuchte, mich zum Zuhören zu bringen, ging es darum zu verstehen, wie Pferde Dinge erledigen. Das war ungefähr ein Jahr, nachdem wir angefangen hatten, zusammen zu arbeiten. Sieben war er damals.
Wir halfen bei einem Roundup, einem Zusammentrieb, wie ich es schon seit Jahren getan hatte. Für einen Freund sollten wir etwa 120 Pferde aus einem Areal von über zehn Quadratkilometern zusammentreiben. Buck und ich waren allein, als wir oben in den Felsen über einem schmalen Tal auf eine ca. dreißigköpfige Herde trafen. Wir trieben sie mit Erfolg hinunter ins Tal und mussten sie nun durch einen Engpass über eine ca. 1,5 km lange Wiese, durch einen Tunnel unter dem Highway und schließlich zum Sammelpunkt bringen.
Das einzige Problem war, dass Buck und ich uns plötzlich zwischen den Pferden und dem Engpass am südlichen Ende des Tals befanden. Wir würden um sie herum nach Norden reiten müssen, um sie durch den Engpass treiben zu können. Es war eine gefährliche Situation, denn eine einzige falsche Bewegung meinerseits konnte die Herde in alle Richtungen auseinanderjagen. Zu allem Übel stand, gerade außer Sichtweite in den Bäumen am Nordende des Tals, ein Tor offen, das auf weitere fünf Quadratkilometer Weidefläche führte – und da wollte ich sie ganz bestimmt nicht haben.
Langsam fingen Buck und ich an, die Herde in einem weiten Bogen zu umrunden, um sie auf keinen Fall in Aufregung zu versetzen. Wir hatten es fast geschafft, als ich bemerkte, dass die Pferde uns sehr aufmerksam mit den Augen zu verfolgen begannen. Obwohl wir uns so langsam bewegten, begannen sie, im Kreis zu laufen. Ein paar wendeten ab und bewegten sich auf die Bäume im Norden zu, genau in Richtung auf das offene Tor. Sie waren gar nicht so schnell, aber in meiner Vorstellung konnte ich sie angaloppieren und den Rest der Herde mitreißen sehen.
Da ich sie überholen und vor ihnen bleiben wollte, trieb ich Buck zu einem kleinen Jogtrab an. Sehr zu meiner Überraschung nahm er die Hilfe nicht an. So weit ich mich erinnern konnte, war dies das erste Mal, dass er sich weigerte, ein Kommando von mir auszuführen. Ich versuchte noch einmal anzutraben, und wieder verweigerte er mir den Gehorsam und blieb bei seinem langsamen, beständigen Schritt.
Ein kurzer Blick auf die Herde zeigte mir, dass sich noch ein paar mehr Pferde auf die Wanderschaft begeben hatten. Schnell versuchte ich dahinterzukommen, warum Buck nicht reagierte. Wir waren noch nicht lange unterwegs, nicht länger als eine Stunde, und die meiste Zeit war er Schritt gegangen, er konnte also noch nicht müde sein. Ich drehte mich im Sattel um und betrachtete seinen Schweif, ob er vielleicht – wie soll ich mich ausdrücken – eine Ruhepause brauchte, aber das war es auch nicht.
Nein, aus irgendeinem seltsamen Grund tat er einfach nicht, was ich von ihm wollte, und das gefiel mir gar nicht. Ich drückte ihm kräftiger die Absätze in die Seite, und er schlug trotzig mit dem Schweif. Der Rest der Herde hatte sich den anderen nun auf ihrem Zug nach Norden angeschlossen, wenn auch in lässigem Schritt. Ich knuffte ihn noch einmal, und als Antwort schlug er mit dem Schweif und schüttelte den Kopf.
Wir ritten noch eine kurze Strecke weiter, als ich sah, dass die Herde praktisch zum Stehen gekommen war. Die Pferde hatten sogar den Kopf gesenkt und fingen an zu grasen. Anstatt mich zu entspannen, sah ich dies als unsere Chance, eine größere Entfernung zwischen uns und die Herde zu bringen und den nördlichen Ausgang zu versperren. Wieder drückte ich Buck die Absätze in die Seite, und wieder weigerte er sich anzutraben, diesmal mit einem lauten Schnarchen durch die Nase.
Offensichtlich konnte er die Dringlichkeit der Situation nicht erkennen, und seine Widersetzlichkeit fing an mich zu ärgern. Inzwischen hatten die Pferde wieder die Köpfe gehoben und begonnen, sich langsam wieder nach Norden in Bewegung zu setzen. In einem Wutanfall, anders kann ich es nicht nennen, holte ich schließlich mit beiden Beinen aus und ließ sie gegen seine Rippen krachen. Er war mittlerweile so böse mit mir wie ich mit ihm, und sein Zorn äußerte sich in einem Satz, gefolgt von einem schnellen Galopp.
Na endlich, dachte ich. Endlich tut er, was er soll. Und gerade noch rechtzeitig, denn als er in Galopp fiel, wachte die Herde auf, zögerte noch einen Augenblick und setzte sich dann so schnell sie konnte zum nördlichen Ausgang in Bewegung. Plötzlich und vermutlich nicht gerade überraschend befanden wir uns in einem größeren Rennen – wir gegen dreißig gut ausgeruhte Weidepferde, und alle auf ein einziges Ziel zu galoppierend. Buck und ich übersprangen Felsen und Buschwerk, wichen den Löchern aus, die Taschenratten gebuddelt hatten, und setzten über die Pfützen vom letzten Regen. Die Herde, Schweife hoch und Mähnen im Wind flatternd, lief mit Höchstgeschwindigkeit, wobei einige laut wieherten.
Buck lief, so schnell er überhaupt konnte, und trotzdem waren wir, als wir den Wald erreichten, nur etwa fünfzig Meter vor der Herde. Ein schneller Blick über die Schulter zeigte mir, dass die Pferde schnell aufholten. Am schlimmsten aber war, dass wir Bäumen ausweichen und uns unter niedrigen Ästen ducken mussten, während sie einen schmalen Pfad ohne alle Hindernisse entlangliefen, der genau durch das Tor und auf die nun nur noch 120 Meter entfernten fünf weiteren Quadratkilometer führte.
Sie flogen nur so den Weg hinunter, und ich wusste, es würde eng werden, vielleicht zu eng. Ich trieb Buck noch mehr an, aber statt schneller zu werden, wurde er ein kleines bisschen langsamer. Die eine kleine Verzögerung genügte, damit die Herde an uns vorbei und durch das Tor schoss. Buck schaltete weiter zurück vom Renngalopp zu einem langsamen Lope, zum Trab und schließlich zum Schritt. Hilflos sah ich zu, wie die Herde in den Bäumen und Felsen auf der anderen Seite verschwand, so schnell sie die Füße trugen.
Ich erinnere mich an einen Cartoon: Zwei Pferde, beide gesattelt, stehen nebeneinander. Das eine schaut schlecht gelaunt das andere an und sagt: »Wenn mein Cowboy nicht bald anfängt, auf mich zu hören, bekomme ich einen schlechten Ruf.«
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Buck genau dies dachte, als wir da standen und hörten, wie das Hufgeklapper in der Ferne verhallte. Ich meinerseits konnte damals nur daran denken, wie viel Arbeit mir mein Pferd gerade verursacht hatte. Wäre er nur schneller geworden, als ich ihn zum ersten Mal dazu aufgefordert hatte, wäre die Herde jetzt schon im großen Pferch gewesen. Stattdessen würden wir nun die nächsten zweieinhalb Stunden damit beschäftigt sein, die Herde zu suchen, sie zusammenzutreiben und dann durch das Tor und in das schmale Tal zu bringen, aus dem wir gerade kamen.
Das Gute daran, so viel Zeit zu haben, ist, dass Sie Gelegenheit haben zu denken. Wie ich schon sagte, dachte ich anfangs hauptsächlich, wie wütend ich darüber war, dass Buck nicht gleich reagiert hatte.
Und für mein Gefühl war dies der Grund, warum wir uns jetzt in diesem Schlamassel befanden. Ich muss zugeben, dass sich meine Gedanken die nächste halbe Stunde oder so weiter um dieses Thema drehten. Wenn es bei diesem Erlebnis geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich weiter so gedacht. Aus heutiger Sicht klingt es wohl nach nicht sehr viel, aber damals empfand ich dieses Vorkommnis als sehr demütigend.
Während ich auf Bucks Rücken saß und ihn im Geiste dafür verprügelte, dass er nicht getan hatte, was er sollte, als er es sollte, ging mir auf, dass er einfach seiner Arbeit nachging, wie vor dem Rennen. Und er ging nicht nur seiner Arbeit nach, er ging auch sehr sorgsam vor. Vorsichtig stieg er über Felsen und niedergebrochene Äste und Stämme. Langsam passierte er den Engpass und suchte den sichersten Weg zum Talgrund. Wenn ihm etwas nicht geheuer war, hielt er an, wendete dann ab und wählte eine andere, klügere Richtung. Ab und zu spitzte er in eine bestimmte Richtung die Ohren und sagte mir auf diese Weise, wo die Herde sich befand.
Kurz gesagt, während ich mir leid tat und mein Pferd verfluchte, war er wieder an die Arbeit gegangen, so ziemlich ohne mich und eigentlich sogar gegen mich. Und nicht nur das, er passte dabei auch noch auf mich auf!
Wie gesagt, als ich wieder zu mir kam und merkte, was passierte, fand ich das Ganze wirklich sehr demütigend. Er hatte mir, glaube ich, an diesem Tag aber auch noch eine andere Lektion erteilen wollen, die mir total entgangen war. Leider ging mir diese Lektion erst einige Zeit später auf.
Nach dem Zwischenfall im Tal schien Bucks offensichtliche Widersetzlichkeit einfach zu verschwinden. Eigentlich verhielt er sich schon den Rest des Tages damals so gehorsam wie gewohnt. Das gute Benehmen hielt drei Monate lang an, bis ein Pferd zur Korrektur zu uns gebracht wurde, das Probleme mit dem Führen hatte. Wie sich herausstellte, ließ es sich überhaupt nicht führen.
Ich hatte mit dem jungen Wallach schon einige Zeit Bodenarbeit im Round Pen gemacht, und das machte er sehr schön. Er ließ sich dort sogar ganz gut führen. Wenn ich aber versuchte, ihn außerhalb zu führen, blockierte er nach ein paar Schritten total. Nachdem ich ihn einige Zeit mit mäßigem Erfolg zu Fuß gearbeitet hatte, beschloss ich, das junge Pferd als Handpferd mitzunehmen. Das gab mir mehr Möglichkeiten, mit ihm zu arbeiten, und außerdem konnte ich, falls er sich gegen den Strick stemmte, einfach ruhig zusehen und ihn gegen Buck arbeiten lassen statt gegen mich.
Am nächsten Tag nahm ich Buck und den Youngster mit auf den großen Platz. Ich setzte mich auf Buck und gab ihm, mit dem Führstrick in der Hand, die Hilfe zum Antreten. Der junge Wallach ging am durchhängenden Strick neben Buck her, als hätte er zeit seines Lebens nichts anderes getan. Er machte überhaupt keine Schwierigkeiten. Ohne Zwischenfälle umrundeten wir ein Mal den Platz, und alles ging so gut, dass ich dachte, vielleicht hätte die viele Bodenarbeit in den letzten Tagen doch etwas bewirkt. Gerade als ich mir auf die Schulter klopfen wollte, kamen wir wieder am Eingang vorbei, durch den wir Minuten zuvor hereingekommen waren, und ich stellte fest, dass ich doch nicht so gut zu ihm durchgekommen war, wie ich gehofft hatte.
Wir waren vielleicht zwei Meter am Tor vorbei, als der Wallach die Beine in den Boden stemmte und keinen Schritt mehr weiterging. Buck ging weiter, und sehr schnell straffte sich das Seil. Bevor es sich wirklich anspannte, wickelte ich es schnell um das Sattelhorn, damit der Zug das Sattelhorn traf und nicht mich. Als es sich spannte, konnte ich spüren, wie Buck sich in den Zug hineinlehnte. Es war, als versuchten wir, einen Panzer aus dem Schlamm zu ziehen. Ich drehte mich im Sattel um und sah, dass der Youngster sich mit aller Kraft nach hinten legte, der Führstrick zum Zerreißen gespannt und das Stallhalfter so weit gezogen, wie es nur ging. Seine Augen zeigten das Weiße, die Nüstern waren gebläht und die Lippen fest zusammengepresst.
Ich gab Buck ein Zeichen anzuhalten, was er auch tat, ohne den Zug am Seil zu verringern. Mir war ziemlich klar, dass es an diesem Punkt wenig bringen würde, weiter auf »vorwärts« zu bestehen. Selbst wenn das junge Pferd nachgab und nach vorn ging, würde es dies wahrscheinlich mit einem gigantischen Satz tun, der uns alle drei in Gefahr bringen konnte. Ich musste es anders versuchen, die Starre aufzubrechen. Also wendete ich Buck nach rechts und ging, ohne die Spannung im Seil ganz aufzugeben, auf der rechten Seite nach hinten, bis beide Pferde Seite an Seite standen, Buck mit dem Kopf nach Norden und der Youngster mit dem Kopf nach Süden. Ich ließ Buck weiter vorwärts gehen, bis er den Kopf des jungen Pferdes so weit herumgezogen hatte, dass er in dieselbe Richtung sah wie Buck und ich, ohne dass sich sein Körper allerdings bewegt hatte.
Das Prinzip war, den Wallach so weit aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass er einfach die Füße bewegen musste, um nicht umzufallen. Wenn er sich erst einmal bewegte, konnten wir ihn dirigieren und, so hofften wir, wieder mitführen.
Das Problem war, dass Buck, sobald wir den Wallach in diese Position manövriert hatten, einfach stehen blieb. Ich trieb ihn mit den Absätzen vorwärts, aber er tat, als ob er nichts merken würde. Ich trieb noch einmal, aber Buck reagierte nicht. Der junge Wallach schien leicht zu schwanken, bereit für den nächsten Schritt, und ich dachte, er bräuchte nur noch einen kleinen ermutigenden Schubs, um sich endgültig zu bewegen. Ich versuchte wieder, Buck anzutreiben, aber er tat, als sei ich überhaupt nicht vorhanden.
Schließlich hieb ich ihm die Absätze in die Seite, und seine Reaktion bestand in einer kaum wahrnehmbaren Vorwärtsbewegung. Sehr zu meiner Überraschung war dieser winzige zusätzliche Druck, als er sich leicht nach vorn lehnte, alles, was noch gefehlt hatte, damit das junge Pferd völlig den Kopf verlor. Es verlor auch das Gleichgewicht und bewegte die Füße – wie ich ursprünglich gehofft hatte –, aber leider nicht so, wie ich es erwartet hatte. Plötzlich hing am Ende eines drei Meter langen Führstricks ein höchst explosives Energiebündel an meinem Sattelhorn fest. Es fühlte sich an, als hätten wir einen neunhundert Pfund schweren Merlin an der Angel, der von seiner Situation nicht gerade begeistert war.
Sie können sich vorstellen, dass es ein paar Minuten ziemlich rodeomäßig zuging, und als sich der Staub endlich gelegt hatte, war ich froh, dass wir drei alle noch okay waren. Es dauerte weitere Minuten, bis wir uns wieder sortiert hatten und weitermachen konnten, wenn auch ein bisschen langsamer und sehr viel vorsichtiger. Der junge Wallach überwand seine Schwierigkeiten mit dem Führen in verhältnismäßig kurzer Zeit, und von da an entwickelten sich die Dinge ohne weitere Probleme.
Obwohl alles gut ausgegangen war, hatte ich in den folgenden Tagen und Wochen Mühe, das Vorkommnis aus dem Kopf zu bekommen. Ich hatte das überwältigende Gefühl, irgendetwas verpasst zu haben. Was es auch war, ich wusste, es war wichtig.
Der Lehrer spricht
Bei der AQHA ist Buck unter dem Namen Alms Setter Bar registriert, wobei das »Bar« von seinem Urgroßvater herstammt, dem berühmten Vollblüter Three Bars. Er ist also ein eingetragenes Quarter Horse und hat auch den typischen Quarter-Horse-Kopf, ist aber für diese Rasse verhältnismäßig groß und kalibrig, mit guter Schulter und dem für Vollblüter charakteristischen hohen Widerrist. In seiner Jugend war er auch so schnell wie ein Vollblüter. Er war tatsächlich eines der schnellsten Pferde – wenn nicht das schnellste überhaupt –, das ich je geritten habe.
Als Buck mit sieben Jahren zu mir kam, war er, was die meisten Menschen als unauffällig bezeichnen würden: ein Dunkelfuchs mit einem Stern auf der Stirn und hinten links weiß gestiefelt. Vorn stand er etwas zehenweit, und seine Trachten waren niedriger, als sie sein sollten – ein Problem, das ihm in späteren Jahren noch zu schaffen machen sollte. Abgesehen von einem leichten flachsfarbenen Schimmer in Mähne und Schweif, wenn sie im Sommer von der Sonne ausgebleicht waren, unterschied ihn äußerlich nichts von einer ganzen Herde fuchsfarbener Quarter Horses.
Sein unscheinbares Äußeres erschwerte mir die Erkenntnis, dass er mir mit seinem ungewöhnlichen Verhalten etwas sagen, etwas beibringen wollte. Ich meine, wäre er ein großes, auffallendes Filmross gewesen, mit jeder Menge Talent und Können und jahrelanger Erfahrung in der Arbeit mit und für Menschen, hätte ich es verstanden. Buck besaß jedoch nichts dergleichen. Er war einfach ein Pferd, das wenig geritten worden war, ja sogar wenig Umgang mit Menschen gehabt hatte, bevor es zu mir kam.
Komisch, aber vermutlich war das eine weitere Lektion, die ich von Buck gelernt habe – man kann einfach nie vorher wissen, in welcher Art Verpackung ein Lehrer aufkreuzt.
Buck hatte mit dem Unterricht begonnen, als er mir bei zwei verschiedenen, dem Anschein nach nicht miteinander zusammenhängenden Gelegenheiten den Gehorsam verweigerte. In den Monaten danach kam es immer wieder und immer öfter vor, und immer in Situationen, in denen wir mit einem anderen Pferd oder einer Gruppe von Pferden arbeiteten. Und er weigerte sich grundsätzlich in dem Moment, in dem ich das Gefühl hatte, er müsse jetzt SOFORT reagieren.
Wenn er auf meine Aufforderungen nicht reagierte, musste ich sehr viel mehr Druck auf ihn ausüben, als ich eigentlich wollte. Die Folge davon war, dass seine Reaktion, wenn sie endlich erfolgte, meist sehr viel heftiger ausfiel, als sie hätte sein sollen. Dies aber führte wiederum dazu, dass die jeweilige Situation derartig eskalierte, dass wir wieder von vorn anfangen mussten.
Sie können sich vorstellen, dass seine Widerspenstigkeit mir ziemlichen Kummer machte. Wir mussten nicht nur sehr oft unsere Arbeit zwei Mal, manchmal sogar drei Mal machen, er hatte auch das ganze vorherige Jahr niemals eine Widersetzlichkeit gezeigt. Nicht um alles in der Welt konnte ich mir einen Grund für sein Verhalten vorstellen.
In solchen Fällen ist es für Menschen nur zu natürlich, sie unter einem negativen Aspekt zu betrachten. Ich jedenfalls tat es mit Sicherheit. Welcher positive Effekt hätte auch daraus entstehen können?
Schließlich waren wir so weit, dass ich jedes Mal, wenn er mir etwas verweigerte, automatisch ihm die Schuld gab und nie mir selbst. Ich ärgerte mich über seine Weigerungen, und ich ärgerte mich noch mehr, wenn er letztendlich zu heftig reagierte und uns dadurch zwang, von vorne anzufangen, was uns Stunden zusätzlicher Arbeit kostete. Damals dämmerte mir noch nicht, dass ich jedes Mal, wenn wir eine Arbeit von vorn beginnen mussten, einen sanfteren und besseren Weg fand, sie auszuführen. Ebenso wenig war mir klar, dass Buck und ich jedes Mal dazulernten, was unsere gemeinsame Arbeit betraf. Nein, noch war ich Monate entfernt davon, diese kleinen Perlen zu erkennen. Ich konnte nur daran denken, wie ärgerlich und unangenehm es war, dass Buck mir bei den unpassendsten Gelegenheiten den Gehorsam verweigerte.
Erst fast ein Jahr nach seiner ersten Weigerung fiel mir an Buck etwas auf, das ein wenig Licht ins Dunkel brachte. Erstaunlicherweise kam die Erkenntnis nicht während unserer gemeinsamen Arbeit, sondern an einem warmen Frühlingstag, als ich ihn und die übrige Herde beobachtete. Ich war ungefähr hundert Meter vom Wassertank entfernt damit beschäftigt, Zaunpfähle zu ersetzen. Den Wassertank hatte ich vorher erst geleert, dann gesäubert und neu gefüllt.
Wie gewöhnlich ging Pete, das Alphapferd der Herde, sofort hinüber zu dem frisch gefüllten Tank, trank sich satt und bewachte ihn dann, während er in der Nähe graste. So war es so ziemlich jedes Mal, wenn ich den Tank säuberte und frisches Wasser nachfüllte. Ungefähr eine Stunde lang ließ Pete kein anderes Pferd in die Nähe. Irgendwann wanderte er dann weiter, und erst jetzt kam die übrige Herde zur Tränke und konnte trinken. Aus irgendeinem Grund war es für Pete schrecklich wichtig, dass kein anderes Pferd sich aus der frisch gefüllten Tränke bediente.
Versuchte ein Herdenmitglied, sich der Tränke zu nähern, legte Pete die Ohren an und warf ihm einen giftigen Blick zu. Keines hatte Lust, Petes Zorn am eigenen Leib zu verspüren; also drehte es schnell um und machte, dass es weg kam. Meistens brauchte Pete nicht einmal die Füße zu bewegen. Kam das durstige Pferd zu nahe – was ab ungefähr zehn Metern der Fall war –, machte Pete ein paar schnelle Schritte in seine Richtung, und das Pferd rannte auf und davon.
Bis ich den zweiten Pfosten ersetzt hatte, hatte Pete schon fünf oder sechs Pferde mit Leichtigkeit von der Tränke verscheucht. Ich ging gerade zum dritten verrotteten Pfosten hinüber, als ich sah, wie Buck auf die Tränke zuwanderte. Anfangs dachte ich gar nicht weiter darüber nach. Ich dachte, Pete würde ihn ebenso wegjagen wie alle anderen.
Ich schlug die Latten vom Pfosten ab, der daraufhin abbrach. Während ich mich daran machte, den Stumpf auszugraben, fiel mir auf, dass ich das vielsagende Geräusch hügelan galoppierender Hufe schon einige Minuten nicht vernommen hatte. Ich fragte mich in Gedanken, wieso ich Buck nicht hatte wegrennen hören, und drehte mich um, um nach dem Rechten zu sehen.
Etwa zwölf Meter entfernt stand Buck ganz ruhig da, den Kopf gesenkt und einen Hinterhuf entspannt eingeknickt. Pete graste, mit einem Ohr in Richtung Buck und einem leicht verstörten Gesichtsausdruck. Ich war wie gebannt von den beiden, und auch wenn ich noch so gern Pfähle setze – ich konnte mich nicht losreißen von dem Geschehen dort drüben.
Immer einmal wieder hob Pete den Kopf und legte die Ohren an, aber Buck zeigte keine Reaktion. Gelegentlich zuckte ein Ohr in Petes Richtung, das war alles. Das schien Pete auf die Nerven zu gehen, und nach vier oder fünf Minuten startete er eine Attacke auf Buck.
Mit angelegten Ohren und gefletschten Zähnen galoppierte er hügelan auf Buck zu. Buck hielt die Stellung bis zur wirklich allerletzten Sekunde. Dann, als Pete im vollen Galopp nur noch etwa zwei Meter entfernt war, trat er schnell, aber ruhig einen Schritt nach links und ließ Pete an sich vorbeischießen wie der Matador den Stier unter seiner Capa. Während Pete nach der misslungenen Attacke noch mit seinem Gleichgewicht kämpfte, trottete Buck in aller Gemütsruhe zum Tank hinunter, senkte den Kopf und fing an zu trinken.
Pete war weit über die Stelle hinausgeschossen, an der Buck gestanden hatte, und war nun gute zwanzig Meter entfernt. Er stand auf dem Hügel und sah zu, wie Buck trank. Ich vermute, es war ihm zu mühsam, wieder hinunterzulaufen, vielleicht dachte er auch, er brauche den Tank nicht länger zu bewachen. Jedenfalls drehte Pete um und gesellte sich zum Rest der Herde.
Langsam zog Buck den Kopf aus der Tränke, streckte den Hals, machte das Maul auf und verschob den Unterkiefer, bis etwas Wasser herauslief und ein paar unzerkaute Grasbüschel in die Tränke fielen. Ein paar Sekunden lang stand er da und verrenkte sich den Unterkiefer; dann drehte er sich langsam um und sah mich an.
Solange ich bei der Arbeit war, hatte er mich kaum beachtet. Jetzt, nach all der Aufregung, schien er mich plötzlich wahrzunehmen. Ein paar Sekunden lang sah er mich nur an. Ich schwöre, wäre er ein Mensch gewesen, ich hätte gedacht, dass er mir etwas zu sagen versuchte.
Inzwischen ist mir klar geworden, dass Buck mir jedes Mal, wenn er mich so ansieht, tatsächlich etwas zu sagen versucht. Beziehungsweise, um genauer zu sein: Er sagt etwas zu mir. Manchmal ist das, was er sagt, schwer zu verstehen. Manchmal – wie damals, als er in seinem Auslauf stand und mich anstarrte, anstatt seine Pellets zu fressen – ist es aber auch ziemlich leicht.
Damals brauchte ich nur auszusortieren. Als ich zu ihm an den Auslauf ging, schaute er in seine Box. Als ich in die Box ging und das Futter und die Tränke überprüfte, kam er ebenfalls in die Box und bestätigte mir damit, dass es nun »wärmer« wurde. Als ich wieder hinausging, schüttelte er den Kopf und prustete, um mir mitzuteilen, dass es wieder »kälter« wurde. Dann sah er nach draußen, wo die anderen Pferde fraßen.
Ein Blick nach draußen zeigte mir unmissverständlich, was Buck wollte. Die anderen Pferde hatten Heu, Buck noch nicht. Ich hatte es ihm absichtlich noch nicht vorgelegt, weil er zuerst seine Pellets auffressen sollte. Das gefiel ihm wohl nicht. Also warf ich ihm ein paar Lagen Heu in die Box, und er machte sich unverzüglich darüber her. So einfach war die Lösung für ein Problem zwischen Pferd und Mensch.
Natürlich war dieses Problem nur deshalb so leicht zu lösen, weil ihm viele Jahre vorausgingen, in denen Buck mir beigebracht hatte, auf das zu hören, was er mir zu »sagen« versuchte. Herauszufinden, was er mir beim ersten Mal, als er am Wassertank stand und mich ansah, sagen wollte, war nicht ganz so einfach, denn bei diesem Stand unserer Beziehung hatte ich noch nicht gelernt, ihm zuzuhören.
Wenn ich ihnen erzähle, dass mein Pferd mit mir zu sprechen versuchte, werden manche Leute sicherlich sagen, dass ich total übergeschnappt bin, oder aber sie werden die Augen verdrehen und finden, dass ich vermenschliche. Dass ich Gefühle, Gedanken und bestimmte Verhaltensweisen, die Menschen eigen sind, auf ein Tier, in diesem Fall ein Pferd, übertrage. Vielleicht haben sie Recht – ich weiß es nicht.
Ich finde es einfach nur schwierig zu glauben, dass einzig die menschliche Spezies den Markt für Gefühle, Gedanken und bestimmte Verhaltensweisen, zum Beispiel Kommunikation, beherrscht. Das ist besonders schwer zu glauben, wenn man bedenkt, dass die Menschen noch gar nicht so lange auf unserem Planeten sind. Andererseits glaube ich aber auch nicht, dass alle Tiere auf unserem Planeten gleich sind.
Was ich glaube, ist, dass den meisten lebenden, atmenden Geschöpfen bestimmte Wesenszüge und Gemeinsamkeiten eigen sind. An der Spitze der Gemeinsamkeiten steht der Wunsch, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Dadurch, dass wir am Leben bleiben, leisten wir unseren kleinen Beitrag zum Erhalt unserer Spezies.
Nirgends offenbart sich dieser Wunsch, am Leben zu bleiben, sichtbarer als im Flucht-oder-Kampf-Instinkt. Alle Lebewesen einschließlich des Menschen laufen vor Dingen davon, die ihre Fähigkeit, am Leben zu bleiben, bedrohen. Können sie nicht weg, bleiben sie stehen und kämpfen mit allen Mitteln um ihr Leben. So stark ist dieser Instinkt, und Sie dürfen sicher sein, dass wir uns in dieser Hinsicht nicht von Pferden oder irgendeinem anderen Tier auf unserem Planeten unterscheiden.
Bei uns Menschen ist dieser Instinkt sogar erhalten geblieben, obwohl wir im Laufe der Zeit hart daran gearbeitet haben, ihn zu verlieren. Wir tun Dinge, die unsere Vorfahren mit Entsetzen erfüllt hätten: Wir rasen, eingeschlossen in ein »Tier« aus Metall, mit hundert Stundenkilometern die Autobahn entlang oder setzen uns in einen großen, glänzenden »Vogel«, der uns hoch hinauf in den Himmel trägt. Wenn aber, während wir in unserem Metalltier die Straße entlangsausen, ein anderes Metalltier vor uns auftaucht oder wenn der große Vogel, in dem wir fliegen, aufgrund von Turbulenzen plötzlich ein paar hundert Meter absackt, kommt unser Urinstinkt, der Überlebenswille, in Sekundenschnelle wieder hervor.
Um noch einen Schritt weiterzugehen: Wir haben uns diesen Instinkt bewahrt, obwohl wir eine ganze Reihe von Religionen entwickelt haben, die uns nach dem Tod die wundervollsten Belohnungen versprechen. Trotz dieser »Karotte«, die verführerisch vor unserer Nase baumelt, tun wir immer noch alles, um am Leben zu bleiben, genau wie alle anderen Lebewesen, die diese Erde bevölkern – vielleicht mit Ausnahme der Lemminge.
Mir erscheint es nur logisch, dass wir, wenn wir einen Urinstinkt gemeinsam haben, auch noch andere Dinge teilen. So gibt es zum Beispiel in der Tierwelt (Menschen eingeschlossen) allgemein gesprochen eine Haltung des »Leben-und-leben-lassens«. Natürlich gibt es Raubtiere und Beutetiere. Aber nur sehr wenige Tiere, auch unter den Raubtieren, töten um des Tötens willen. Auf irgendeiner Ebene wissen wir alle instinktiv, dass wir nur überleben können, wenn wir auch andere Spezies überleben lassen. Auch Raubtier und Beute haben gelernt, zu überleben und auf irgendeine Art und Weise auf einer erträglichen Basis zusammenzuleben.
Ich glaube, der Grund, warum wir alle zusammen überleben können, besteht in einem grundsätzlichen Verständnis untereinander. So wird ein Tier, das einmal Angst gehabt hat, Angst bei einem anderen Tier erkennen können, auch wenn dieses einer anderen Spezies angehört. Jedes Tier, das einmal wütend war, wird Wut bei einem anderen Tier erkennen. Und gleichermaßen wird jedes Tier, das einmal mit einem anderen auszukommen versucht hat, erkennen, wenn ein anderes Tier mit ihm auszukommen versucht.
Das lässt sich noch vertiefen: Wenn ein Tier sich einem anderen Tier gegenüber nicht bedrohlich verhält, fällt es dem anderen Tier leichter, statt einer defensiven oder aggressiven Reaktion sein wahres Ich, seine wahre Persönlichkeit zu zeigen. Das Tier kann so sein, wie es wirklich ist.
Wenn dies geschieht, scheint sich eine Tür zu öffnen, die eine Kommunikation unter Tieren verschiedener Spezies ermöglicht, manchmal sogar unter erklärten Feinden. Ein schneller Blick auf die Tierwelt genügt, um zu verstehen, was ich sagen will. In manchen en der Welt ist es nicht unüblich, dass kleine Vögel im offenen Rachen von Krokodilen sitzen und ihnen Parasiten herauspicken. Das Krokodil bräuchte nur die Kiefer zuzuklappen, um das Vögelchen zu töten, aber irgendwann einmal hat es dem Vogel klar gemacht, dass es dies nicht zu tun gedenkt, und der Vogel hat verstanden, dass keine Gefahr droht.
In Afrika dösen Löwen, die sich gerade satt gefressen haben, im Schatten, während gleich daneben Beutetiere in aller Ruhe grasen. Auch hier »wissen« die Beutetiere durch Tausende Jahre der Kommunikation, dass sie nicht in Gefahr sind. Sie wissen, dass Löwen, die gerade gefressen haben, eine Zeitlang nicht mehr jagen. Sie sind also sicher, jedenfalls eine Weile.
Sicher gibt es noch unzählige weitere Beispiele für diese Art von Kommunikation, aber die Idee ist immer die Gleiche. Es kommt in der Tierwelt gar nicht selten vor, dass unterschiedliche Spezies sich gegenseitig beeinflussen und sogar voneinander lernen – besonders wenn auf lange Sicht beide Spezies davon profitieren.
Was uns zurückbringt zu Buck. Ich kann denjenigen, die meinen, ich vermenschlichte Buck, wenn ich glaube, dass er mir durch sein Verhalten etwas zu zeigen versuchte, nicht Recht geben. Ich setze Bucks Handlungen nicht mit denen von Menschen gleich. Seine Gedanken, Gefühle und Instinkte sind die eines Pferdes. Stattdessen versuche ich, das, was zwischen uns geschieht, in etwas zu übersetzen, das ich, als Mensch, verstehen kann und das für uns beide von Nutzen ist. Kurz gesagt, wenn Buck versucht, mit mir zu »sprechen«, muss ich versuchen, ihm zuzuhören.
Leider erwies sich der Teil des Zuhörens für mich als der schwierigste. Sehen Sie, als Buck und ich miteinander zu arbeiten begannen, hielt ich mich für einen ziemlich guten Pferdetrainer. Schließlich hatte ich erfolgreich mit einer großen Anzahl von Problempferden gearbeitet. Ich hatte wer weiß wie viele Pferde angeritten oder korrigiert, mich vom Mustang bis zum Kaltblüter mit allem nur Möglichen beschäftigt und war stolz darauf, so ziemlich jedem Pferd über seine jeweiligen Schwierigkeiten hinweggeholfen zu haben.
Um die Wahrheit zu sagen: Ich muss zugeben, dass ich das Gefühl hatte, schon ziemlich gut auf meine Pferde zu hören. Meine Einstellung war: Was könnte ein relativ »grünes« Pferd mir beibringen, das ich nicht schon wüsste? Mir schien, Buck hatte vergessen, dass ich der Lehrer war, nicht er. Und das sollte sich als mein größter Irrtum überhaupt herausstellen.
Das Problem wird erkannt
Von Anfang an hatte ich gelernt, Pferde zu respektieren, ihnen ihre Würde zu belassen und zu verstehen zu versuchen, was sie uns zu sagen hatten. Ich war eigentlich sogar immer ziemlich stolz auf mein Gefühl dafür gewesen, was Pferde mir während des Trainings mitzuteilen versuchten. Das war der Hauptgrund, warum es mir so schwer fiel zuzugeben, dass das, was sich zwischen Buck und mir abspielte, mein Problem war, nicht seines.
Erst nachdem ich miterlebt hatte, wie Buck die Situation mit Pete gelöst hatte, dämmerte mir, dass ich ihm vielleicht mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Selbst dann dauerte es noch Monate, bis die Dinge für mich einen Sinn zu ergeben begannen. Zwei Ereignisse, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hatten, öffneten mir dann endlich die Augen.
Ich arbeitete tagsüber auf einer Gast-Ranch, trainierte ihre Pferde und ritt ein paar junge Pferde für sie ein. Head Wrangler, also »Chef-Cowboy«, war eine kleine Frau, äußerst erfahren, gut organisiert, effizient und mit einem Händchen für die Pferde und Menschen, mit denen sie zu tun hatte. Sie lebte mit ihrem Mann auf der Ranch, und wie sich herausstellte, hatten sie jahrelang versucht, eine Familie zu gründen, aber ohne Erfolg.
Dann kam sie eines Tages und erzählte jedem, dass sie ein Baby erwartete. Es sollte außerhalb der Saison auf die Welt kommen, wenn auf der Ranch am wenigsten Betrieb war. Alle auf der Ranch freuten sich für sie und ihren Mann, weil alle wussten, wie lange sie sich schon ein Kind gewünscht hatten und wie viel es ihnen bedeutete, Eltern zu werden. Alle freuten sich, bis auf die Besitzerin der Ranch.
Diese war um die fünfzig und hatte erst vor kurzem die Leitung der Ranch übernommen, nachdem ihre Eltern, die sie viele Jahre betrieben hatten, sich aufs Altenteil zurückgezogen hatten. Offenbar dachte sie, eine Frau mit einem Baby würde ihre Pflichten auf der Ranch nicht zufriedenstellend erfüllen können. Also kündigte sie ihrem Head Wrangler ein paar Tage, nachdem sie von der Schwangerschaft erfahren hatte. Sie und ihr Mann hatten die Ranch innerhalb von zwei Tagen mit all ihrer Habe zu verlassen.
Dies alles geschah in der betriebsamsten Zeit des Jahres. Viele Familien machten Ferien auf der Ranch, und die meisten wollten ausreiten. Sie können sich vorstellen, dass es bei den Cowboys drunter und drüber ging und die Stimmung gegenüber der Ranchbesitzerin nicht gerade freundlich war. Zwei Wrangler standen einfach auf und kündigten; von der ursprünglich siebenköpfigen, zufriedenen und effizienten Mannschaft blieben ganze vier übrig, und die waren total überfordert. Natürlich waren die Pferde oft nicht rechtzeitig fertig, wenn die Leute reiten wollten. Manche Ausritte fielen ganz aus, weil nicht genügend Begleitpersonal zur Verfügung stand. Die Gäste beklagten sich, manche regten sich so auf, dass sie abreisten und ihr Geld zurückverlangten.
Es dauerte nicht lang, und die Besitzerin lief herum und schob die ganze Schuld an den Problemen auf den Head Wrangler. Sie dachte folgendermaßen: Wäre ihr Chef-Cowboy nicht schwanger geworden, hätte sie ihr nicht zu kündigen brauchen, und das alles wäre nicht passiert. Die meisten Menschen würden erkennen, wie lächerlich dieser Gedankengang war. Schuld an den Problemen war nicht der Head Wrangler, sondern die Besitzerin.
Hätte die Besitzerin sich vorher mit anderen vom Ranchpersonal unterhalten, bevor sie dem Head Wrangler kündigte, hätte sie sicher die Tragweite ihres Entschlusses besser überblickt. Aber das tat sie nicht. Offenbar hatte sie nicht im Geringsten das Gesamtbild im Blick, bevor sie ihren Entschluss fasste. Sonst wäre sie mit der Situation sicher anders umgegangen.
Zufällig begann ich zur gleichen Zeit, mit einem Pferd zu arbeiten, das noch neu auf der Ranch war. Es war ein hübscher kleiner Wallach, der für Trail-Ritte eingesetzt werden sollte. Er hatte einer älteren Dame in einer nahe gelegenen Stadt gehört und war deren einziges Pferd gewesen. Sie hatte ihn fast jeden Tag im Gelände geritten, und tatsächlich erwies er sich auch als hervorragendes Geländepferd. Mit einer Ausnahme: Er geriet in Panik, wenn andere Pferde hinter ihm waren.
Vermutlich lag das daran, dass er immer allein geritten worden war. Da nie ein anderes Pferd hinter ihm her gegangen war, hatte er auch nicht gelernt, dass ihm keine Gefahr drohte, wenn ihm doch einmal eines auf den Fersen war. Wenn also im Gelände ein anderes Pferd hinter ihm auftauchte, schoss er im Trab oder sogar im Galopp vorwärts, um möglichst schnell davon wegzukommen.
Das war ein offensichtliches Sicherheitsrisiko, aber der Wallach war in jeder anderen Hinsicht ein so ausgezeichnetes Geländepferd, dass wir den Versuch machen wollten, ihm über seine Schwierigkeiten hinwegzuhelfen, anstatt ihn wieder zu verkaufen. Damit kam er zu Buck und mir.
Ich beschloss, ihn für den Anfang in den Round Pen zu nehmen und ihn von Bucks Rücken aus zu arbeiten. Ich wollte ihn an die Führleine nehmen und eine Zeitlang als Handpferd nebenher gehen lassen. Dann wollte ich Buck langsam hinter ihn zurücknehmen und ihm zeigen, dass er von dem Pferd hinter sich nichts zu befürchten hatte.
Zuerst ging alles glatt und wie geplant. Der kleine Wallach ließ sich ohne weiteres als Handpferd mitführen. Er schien nur allzu glücklich, Buck überall hin zu folgen. Aber als ich anhielt und anfing, Buck nach hinten zu manövrieren, war nicht zu übersehen, dass ihm dies nicht behagte.
Die gute Nachricht war bis jetzt gewesen, dass er nie nach einem Pferd geschlagen hatte, das hinter ihm auftauchte. Er war nur einfach vorwärts geschossen. Als Buck und ich nun begannen, uns an sein hinteres Ende heranzuarbeiten, dachte ich, er würde sich langsam von uns wegbewegen, sobald wir seiner Hinterhand zu nahe kamen und der Druck ihm zu viel wurde. Wir hatten uns noch kaum in Bewegung gesetzt, als ich auch schon entdeckte, wie falsch ich gedacht hatte.
Ich saß auf Buck und hielt die Führleine in der Hand. Der Wallach stand still, und Buck und ich hatten gerade angefangen, uns in Richtung Hinterhand zu bewegen, als Buck wie angewurzelt stehen blieb. Sein Kopf war nahe bei der Hinterhand des Wallachs und der Kopf des Wallachs nahe bei Bucks Hinterhand. Der Wallach schien nicht aufgeregt und hatte sich auch überhaupt nicht bewegt. Die Augen blickten sanft, die Körperhaltung war entspannt. Ein Hinterfuß