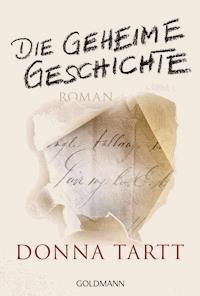9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es passiert, als Theo Decker dreizehn Jahre alt ist. An dem Tag, an dem er mit seiner Mutter ein New Yorker Museum besucht, verändert ein schreckliches Unglück sein Leben für immer. Er verliert sie unter tragischen Umständen und bleibt allein und auf sich gestellt zurück, sein Vater hat ihn schon lange im Stich gelassen. Theo versinkt in tiefer Trauer, die ihn lange nicht mehr loslässt. Auch das Gemälde, das seit dem fatalen Ereignis verbotenerweise in seinem Besitz ist und ihn an seine Mutter erinnert, kann ihm keinen Trost spenden. Ganz im Gegenteil: Mit jedem Jahr, das vergeht, kommt er immer weiter von seinem Weg ab und droht, in kriminelle Kreise abzurutschen. Und das Gemälde, das ihn auf merkwürdige Weise fasziniert, scheint ihn geradezu in eine Welt der Lügen und falschen Entscheidungen zu ziehen, in einen Sog, der ihn unaufhaltsam mit sich reißt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1553
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Es passiert, als Theo Decker dreizehn Jahre alt ist. An dem Tag, an dem er mit seiner Mutter ein New Yorker Museum besucht, verändert ein schreckliches Unglück sein Leben für immer. Er verliert seine Mutter und bleibt allein und auf sich gestellt zurück, sein Vater hat ihn schon lange im Stich gelassen. Theo versinkt in tiefer Trauer, die ihn lange nicht mehr loslässt. Auch das Gemälde, das seit dem Unfall verbotenerweise in seinem Besitz ist und ihn an seine Mutter erinnert, kann ihn nicht trösten. Ganz im Gegenteil: Mit jedem Jahr, das vergeht, kommt er immer weiter von seinem Weg ab und droht, in kriminelle Kreise abzurutschen. Und das Gemälde, das ihn auf merkwürdige Weise fasziniert, scheint ihn geradezu in eine Welt der Lügen und falschen Entscheidungen zu ziehen, in einen Sog, der ihn unaufhaltsam mit sich reißt …
Weitere Informationen zu Donna Tartt sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Donna Tartt
DER DISTELFINK
Roman
Ins Deutsche übertragen von Rainer Schmidt und Kristian Lutze
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
»The Goldfinch« bei Little, Brown and Company, New York.
Das Gemälde Der Distelfink (1654, Öl auf Leinwand) von
Carel Fabritius wurde abgedruckt mit freundlicher Genehmigung.
Copyright © The Bridgeman Art Library Limited.
Auszüge aus dem polnischen Lied »Ach, śpij kochanie«,
Copyright © Ludwik Starski und Henryk Wars 1938,
wurden verwendet mit freundlicher Genehmigung von Allan Starski.
Die Gedichtzeilen von Walt Whitman sind aus: »Walt Whitmans Werk
in 2 Bänden«, zweiter Band, ausgewählt, übertragen und eingeleitet
von Hans Reisiger, Berlin: S. Fischer Verlag, 1922.
10. Auflage
Copyright © 2013 by Tay, Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Design von Keith Hayes
unter Verwendung des Gemäldes »Der Distelfink«, 1654
(Öl auf Leinwand) von Carel Fabritius (1622–54),
Mauritshuis, Den Haag, Niederlande, The Bridgeman Art Library
Redaktion: Frauke Brodd
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-12598-1
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Mutter,für Claude
I
Das Absurde befreit nicht, es bindet.
Albert Camus
KAPITEL 1
Junger Mann mit Totenschädel
I
Noch während meines Aufenthalts in Amsterdam träumte ich zum ersten Mal seit Jahren von meiner Mutter. Über eine Woche war ich nun schon in meinem Hotel eingesperrt und hatte es nicht gewagt, jemanden anzurufen oder vor die Tür zu gehen. Die harmlosesten Geräusche brachten mein Herz ins Stolpern und Taumeln: die Aufzugglocke, das Rattern des Minibarwagens, sogar die Kirchturmuhren, wenn sie zur vollen Stunde schlugen – Westertoren, Krijtberg –, denn in ihr Dröhnen war ein dunkler Unterton gewirkt, eine unheilvolle Vorahnung wie aus einem Märchen. Tagsüber saß ich am Fußende des Bettes und versuchte, die holländischen Fernsehnachrichten zu entschlüsseln (ein hoffnungsloses Unterfangen, denn ich konnte kein Wort Niederländisch), und wenn ich kapituliert hatte, setzte ich mich ans Fenster, schaute auf die Gracht hinaus und trug dabei meinen Kamelhaarmantel über meiner Kleidung – ich hatte New York eilig verlassen, mit lauter Sachen, die nicht warm genug waren, nicht einmal im Inneren des Hotels.
Draußen herrschte überall munteres Treiben. Es war Weihnachten; abends funkelten Lichter an den Grachtenbrücken, und rotwangige dames en heren, deren Schals im eisigen Wind flatterten, rumpelten mit ihren Rädern über das Kopfsteinpflaster und hatten Tannenbäume auf die Gepäckträger gebunden. Nachmittags spielte eine Amateurkapelle Weihnachtslieder, die blechern und zerbrechlich in der Winterluft schwebten.
Chaotische Zimmerservicetabletts, zu viele Zigaretten, lauwarmer Wodka aus dem Duty-Free. In diesen rastlosen Tagen des Eingesperrtseins lernte ich jeden Zentimeter meines Zimmers kennen, genau wie ein Häftling seine Zelle. Ich war zum ersten Mal in Amsterdam, ich hatte fast nichts von der Stadt gesehen, und dennoch vermittelte mir schon das Zimmer in seiner tristen, zugigen, unpolierten Schönheit ein akutes Gefühl von Nordeuropa, wie ein Miniaturmodell der Niederlande: weiße Tünche und protestantische Rechtschaffenheit, durchmischt mit farbenfrohen luxuriösen Stoffen, geliefert von Handelsschiffen aus dem Orient. Ich verbrachte unvernünftig viel Zeit damit, ein winziges Paar goldgerahmter Ölbilder zu betrachten, die über dem Sekretär hingen. Das eine zeigte Bauern beim Eislaufen auf einem zugefrorenen Teich bei einer Kirche, das andere ein Segelschiff auf stolzer Fahrt über die raue, winterliche See: dekorative Reproduktionen, nichts Besonderes, aber ich studierte sie, als enthielten sie die Chiffre eines geheimen Schlüssels zum Herzen der alten flämischen Meister. Draußen klopfte Graupel an die Fensterscheiben und rieselte auf die Gracht herab, und trotz schweren Brokats und weicher Teppiche lag im winterlichen Licht doch ein frostiger Ton von 1943: Entbehrung und Knappheit, dünner Tee ohne Zucker, hungrig zu Bett.
Jeden Morgen in aller Frühe, wenn draußen noch alles schwarz war, bevor die Extrabesetzung ihren Dienst antrat und die Lobby sich füllte, ging ich die Treppe hinunter, um die Zeitungen zu holen. Das Hotelpersonal bewegte sich mit gedämpften Stimmen und leisen Schritten, und ihre Blicke glitten kühl über mich hinweg, als sähen sie mich gar nicht richtig, den Amerikaner aus der 27, der tagsüber nie herunterkam, und ich redete mir zur Beruhigung ein, dass der Nachtportier (dunkler Anzug, Bürstenhaarschnitt, Hornbrille) wahrscheinlich einigen Aufwand betreiben würde, um Ärger abzuwenden und Aufsehen zu vermeiden.
Die Herald Tribune brachte keine Meldung über mein Problem, aber die holländischen Zeitungen waren voll davon, dichte Blöcke von ausländischen Druckbuchstaben, aufreizend knapp außerhalb dessen, was ich verstehen konnte. Onopgeloste moord. Onbekende. Ich ging nach oben und wieder ins Bett (voll bekleidet, weil es im Zimmer so kalt war) und breitete die Zeitungen auf der Bettdecke aus: Fotos von Polizeiwagen, Absperrband, und sogar die Bildunterschriften waren nicht zu entziffern. Zwar tauchte mein Name nicht auf, aber ich bekam nicht heraus, ob sie vielleicht doch eine Beschreibung von mir hatten oder ob sie der Öffentlichkeit Informationen vorenthielten.
Das Zimmer. Der Heizkörper. Een Amerikaan met een strafblad. Das olivgrüne Wasser der Gracht.
Weil mir kalt und übel war und weil ich die meiste Zeit nicht wusste, was ich tun sollte (ich hatte nicht nur warme Sachen, sondern auch ein Buch vergessen), verbrachte ich fast den ganzen Tag im Bett. Mitten am Nachmittag schien es Nacht zu werden. Oft dämmerte ich, umgeben vom Knistern der verstreuten Zeitungen, im Halbschlaf vor mich hin, und meine Träume waren größtenteils von der gleichen unbestimmbaren Bangigkeit getrübt, die auch durch die wachen Stunden sickerte: Gerichtsverhandlungen, geplatzte Koffer auf dem Rollfeld, meine Kleider überall verstreut, und endlose Flughafenkorridore, durch die ich zu Flugzeugen rannte, von denen ich wusste, ich würde sie nie erwischen.
Dank meines Fiebers hatte ich viele und extrem lebhafte Träume, in denen ich mich schweißnass hin- und herwälzte und kaum wusste, ob es Tag oder Nacht war, aber in der letzten und schlimmsten dieser Nächte träumte ich von meiner Mutter. Es war ein kurzer, geheimnisvoller Traum, der sich eher anfühlte wie eine Heimsuchung. Ich war in Hobies Laden – besser gesagt, in einem spukhaften Traumraum, eingerichtet wie eine skizzenhafte Version des Ladens –, als sie plötzlich hinter mir auftauchte und ich sie in einem Spiegel sah. Bei ihrem Anblick war ich gelähmt vor Glück. Sie war es, bis ins kleinste Detail, bis zum Muster ihrer Sommersprossen. Sie lächelte mich an, schöner und doch nicht älter, mit ihrem schwarzen Haar und dem komisch aufwärts gekräuselten Mund, kein Traum, sondern eine Erscheinung, die den ganzen Raum erfüllte: eine Kraft für sich, eine lebendige Andersheit. Und so gern ich es wollte, ich wusste, ich konnte mich nicht umdrehen. Sie direkt anzusehen, wäre ein Verstoß gegen die Regeln ihrer Welt und der meinen. Sie war auf dem einzigen Weg zu mir gekommen, der ihr offenstand, und für einen langen, stillen Augenblick trafen sich unsere Blicke im Spiegel. Aber gerade, als sie anscheinend etwas sagen wollte – in einer Kombination aus Erheiterung, Zuneigung und Verdruss –, schob sich eine Dunstwolke zwischen uns, und ich wachte auf.
II
Alles hätte sich zum Besseren gewendet, wenn sie am Leben geblieben wäre. Aber sie starb, als ich klein war, und obwohl ich an allem, was mir seitdem passiert ist, zu hundert Prozent selbst schuld bin, verlor ich doch mit ihr den Blick für jede Art von Orientierungspunkt, der mir den Weg zu einem glücklicheren Ort hätte zeigen können, hinein in ein erfüllteres oder zuträglicheres Leben.
Ihr Tod also der Grenzstein. Vorher und Nachher. Und auch wenn es so viele Jahre später ein trostloses Eingeständnis ist, habe ich doch nie wieder jemanden kennengelernt, der mir wie sie das Gefühl gab geliebt zu werden. In ihrer Gesellschaft erwachte alles zum Leben. Sie verströmte ein verzaubertes Theaterlicht, und was man durch ihre Augen sah, leuchtete in kräftigeren Farben als sonst. Ich erinnere mich, dass ich ein paar Wochen vor ihrem Tod spätabends in einem italienischen Restaurant im Village war und wie sie mich am Ärmel packte angesichts der plötzlichen, beinahe schmerzhaften Schönheit einer Geburtstagstorte mit brennenden Kerzen, die in einer Prozession aus der Küche hereingetragen wurde, ein matter Lichtschein, der flackernd über die dunkle Decke huschte, und wie die Torte im Kreis der Familie auf den Tisch gestellt wurde und das Gesicht einer alten Lady selig leuchten ließ, während ringsum gelächelt wurde und die Kellner mit den Händen auf dem Rücken zurückwichen – ein gewöhnliches Geburtstagsessen, wie man es überall in einem preiswerten Downtown-Restaurant zu sehen bekommen kann, und ich bin sicher, ich würde mich gar nicht daran erinnern, wenn sie nicht so kurz danach gestorben wäre, aber nach ihrem Tod habe ich immer wieder daran gedacht, und wahrscheinlich werde ich mein Leben lang daran denken – an diese Runde im Kerzenschein, ein tableau vivant des täglichen, alltäglichen Glücks, das ich verlor, als ich sie verlor.
Und sie war schön. Das ist eigentlich zweitrangig, aber sie war es. Als sie frisch aus Kansas nach New York gekommen war, arbeitete sie als Teilzeit-Model, obwohl ihr Unbehagen vor der Kamera zu groß war, als dass sie es gut gekonnt hätte: Was immer sie Besonderes an sich hatte, es fand seinen Weg nicht auf den Film.
Aber sie war ganz und gar sie selbst: eine Rarität. Ich kann mich nicht entsinnen, jemals einen Menschen gesehen zu haben, der wirklich Ähnlichkeit mit ihr gehabt hätte. Sie hatte schwarzes Haar, helle Haut, die im Sommer von Sommersprossen gesprenkelt war, und porzellanblaue Augen, in denen helles Licht leuchtete, und in ihren schrägen Wangenknochen lag eine so exzentrische Mischung aus Naturvolk und keltischem Zwielicht, dass die Leute manchmal vermuteten, sie stamme aus Island. In Wahrheit war sie halb Irin, halb Cherokee und kam aus einer Kleinstadt in Kansas an der Grenze zu Oklahoma, und sie brachte mich gern zum Lachen, indem sie sich selbst als Okie bezeichnete, obwohl sie hochglänzend, nervös und elegant wie ein Rennpferd war. Auf Fotos kommt dieser exotische Charakter leider ein bisschen zu hart und unerbittlich zum Vorschein – die Sommersprossen mit Make-up übertüncht, das Haar im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden wie bei einem Edelmann in der Geschichte vom Prinzen Genji –, und was überhaupt nicht herüberkommt, ist ihre Wärme, ihre unberechenbare Fröhlichkeit, die ich an ihr am meisten liebte. An der Stille, die sie auf Bildern ausstrahlt, wird deutlich, wie sehr sie der Kamera misstraute; sie scheint sich auf wachsam tigerhafte Weise gegen einen Angriff zu wappnen. Aber im Leben war sie nicht so. Sie bewegte sich mit erregender Flinkheit, mit plötzlichen, leichten Gebärden, und hockte immer auf der Stuhlkante wie ein lang gestreckter, eleganter Sumpfvogel, der gleich erschrocken davonflattern wird. Ich liebte ihr Sandelholzparfüm, so rau und unerwartet, und ich liebte das Rascheln ihrer gestärkten Bluse, wenn sie sich herunterbeugte, um mich auf die Stirn zu küssen. Wenn sie lachte, wollte man wegwerfen, was immer man tat, und ihr die Straße hinunter folgen. Wo sie hinkam, schauten die Männer sie aus dem Augenwinkel an, und manchmal warfen sie ihr Blicke zu, die mich ein bisschen störten.
Ihr Tod war meine Schuld. Andere Leute versichern mir immer ein bisschen vorschnell, dass dem nicht so wäre, und jawohl, nur ein Kind, wer hätte das ahnen können, schrecklicher Unfall, einfach Pech, hätte jedem passieren können – das alles ist wahr, und ich glaube kein Wort davon.
Es passierte in New York, am 10. April, vor vierzehn Jahren. (Sogar meine Hand sperrt sich gegen das Datum. Beim Schreiben musste ich Druck ausüben, nur damit der Stift sich weiter über das Papier bewegte. Es war immer ein völlig normaler Tag, aber jetzt ragt er aus dem Kalender wie ein rostiger Nagel.)
Wäre der Tag planmäßig verlaufen, hätte er sich anonym in den Himmel verflüchtigt, spurlos wie der Rest meines achten Schuljahrs. Was wüsste ich jetzt noch davon? Wenig oder gar nichts. Aber natürlich ist die Textur jenes Morgens noch klarer zugegen als die des heutigen Tages, bis hin zu der mit Feuchtigkeit beladenen Luft. In der Nacht hatte es geregnet, ein schreckliches Unwetter; Geschäfte standen unter Wasser, und zwei U-Bahn-Stationen waren geschlossen. Wir beide warteten auf dem pitschnassen Teppich vor unserem Apartmentgebäude, während ihr Lieblingsportier, Goldie, der sie anbetete, mit erhobenem Arm in Richtung 57th Street zurückging und nach einem Taxi pfiff. Autos rauschten in schmutzig aufsprühenden Tropfenschleiern vorüber. Dicke Regenwolken wälzten sich über Hochhaustürme, rissen auf und umzingelten die klaren blauen Flecken am Himmel. Unten auf der Straße, unter den Auspuffgasen, war der Wind feucht und weich wie im Frühling.
»Ah, das ist besetzt, Lady«, rief Goldie durch den tosenden Straßenlärm und trat beiseite, als ein Taxi spritzend um die Ecke kam und sein Licht abschaltete. Er war der kleinste unter den Portiers, ein schmächtiger, dünner, lebhafter kleiner Kerl, ein hellhäutiger Puerto Ricaner und ehemaliger Federgewicht-Boxer. Sein Gesicht war zwar vom Trinken aufgedunsen (manchmal, wenn er zur Nachtschicht erschien, roch er nach J&B), aber er war immer noch drahtig, muskulös und flink – dauernd alberte er herum, dauernd machte er eine Zigarettenpause unten an der Ecke, trat von einem Fuß auf den anderen, blies sich auf die weißbehandschuhten Hände, wenn es kalt war, und erzählte Witze auf Spanisch, sodass die anderen Portiers sich kaputtlachten.
»Sie ganz eilig heute Morgen?«, fragte er meine Mutter. Auf seinem Namensschild stand BURT D., aber alle nannten ihn Goldie, wegen seines Goldzahns und weil sein Nachname, de Oro, auf Spanisch »Gold« bedeutete.
»Nein, wir haben reichlich Zeit, es geht schon.« Aber sie sah erschöpft aus, und ihre Hände zitterten, als sie sich das Tuch neu um den Hals schlang, weil es im Wind knatternd flatterte.
Goldie war es wohl auch aufgefallen, denn er schaute mit leiser Missbilligung zu mir herüber (ich hatte mich still hinter den Pflanzkübel aus Beton vor der Hauswand verzogen und betrachtete alles, nur nicht sie).
»Ihr fahrt nicht mit der Bahn?«, fragte er mich.
»Oh, wir haben ein paar Gänge zu erledigen«, sagte meine Mutter nicht sehr überzeugend, als sie begriff, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Normalerweise achtete ich nicht weiter auf das, was sie anhatte, aber was sie an diesem Morgen trug (einen weißen Trenchcoat, ein zartes, pinkfarbenes Tuch, schwarzweiße Slipper), hat sich so tief in mein Gedächtnis eingegraben, dass es mir jetzt schwerfällt, mich noch anders an sie zu erinnern.
Ich war dreizehn. Mir graut bei der Erinnerung daran, wie hölzern wir an diesem Morgen miteinander umgingen, so steif, dass selbst der Portier es bemerkte. Bei jeder anderen Gelegenheit hätten wir ganz vertrauensvoll miteinander geplaudert, aber an diesem Morgen hatten wir uns nicht viel zu sagen, denn ich war von der Schule suspendiert worden. Sie hatten sie am Tag zuvor im Büro angerufen; sie war schweigsam und wütend nach Hause gekommen, und das Schreckliche war, ich kannte den Grund für meine Suspendierung noch nicht mal. Allerdings war ich zu fünfundsiebzig Prozent sicher, dass Mr. Beeman auf seinem Weg von seinem Büro zum Lehrerzimmer exakt im falschen Augenblick aus dem Fenster am Treppenabsatz im ersten Stock geschaut und mich auf dem Schulgelände hatte rauchen sehen. (Genauer gesagt, er hatte mich mit Tom Cable herumstehen sehen, als der rauchte, was aber in meiner Schule praktisch auf denselben Verstoß hinauslief.) Meine Mutter konnte das Rauchen nicht ausstehen. Ihre Eltern – zu gern hörte ich Geschichten über sie, und sie waren unfairerweise gestorben, bevor ich Gelegenheit hatte, sie kennenzulernen – waren leutselige Pferdetrainer gewesen, die im Westen umherreisten und ihren Lebensunterhalt mit der Aufzucht von Morgan-Pferden verdienten: Cocktails trinkende, Canasta spielende muntere Vögel, die jedes Jahr zum Kentucky-Derby fuhren und Zigaretten in silbernen Dosen im Haus aufbewahrten. Eines Tages, als sie aus den Stallungen kam, krümmte meine Großmutter sich vornüber und fing an, Blut zu husten, und während der restlichen Teenagerzeit meiner Mutter hatten Sauerstoffflaschen auf der Veranda gestanden, und die Schlafzimmerjalousien waren unten geblieben.
Doch – wie ich befürchtete, und zwar nicht ohne Grund – Toms Zigarette war nur die Spitze des Eisbergs. Ich hatte schon seit einer Weile Ärger in der Schule. Es fing an – oder besser gesagt, der Schneeball kam ins Rollen –, als mein Vater ein paar Monate zuvor abgehauen war und meine Mutter und mich alleingelassen hatte. Wir hatten ihn nie besonders gemocht, und meine Mutter und ich waren die meiste Zeit viel glücklicher ohne ihn, aber andere Leute waren anscheinend schockiert und bestürzt, als er uns so unvermittelt verließ (ohne Geld, Kindesunterhalt oder Nachsendeadresse), und die Lehrer meiner Schule an der Upper West Side hatten so viel Mitleid mit mir gehabt und waren so eifrig bemüht gewesen, mir Verständnis und Unterstützung zu zeigen, dass sie mir – einem Stipendiaten – alle möglichen Zugeständnisse und Fristverlängerungen und zweite und dritte Chancen einräumten. Im Laufe der Monate ließen sie mich immer weiter an der langen Leine laufen, bis ich es schließlich schaffte, mich daran in ein sehr tiefes Loch abzuseilen.
Also waren wir beide – meine Mutter und ich – zu einer Konferenz in die Schule gerufen worden. Die Sitzung sollte erst um halb zwölf anfangen, aber weil meine Mutter zwangsläufig den Vormittag hatte freinehmen müssen, waren wir schon früh unterwegs zur West Side – zum Frühstücken (und, wie ich vermutete, zu einem ernsthaften Gespräch) und damit sie ein Geburtstagsgeschenk für eine Arbeitskollegin kaufen konnte. In der Nacht zuvor war sie bis halb drei auf gewesen; sie hatte mit angespanntem Gesicht im Schein des Computerbildschirms gesessen, E-Mails geschrieben und versucht, für ihren arbeitsfreien Vormittag im Büro Klarschiff zu machen.
»Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht«, sagte Goldie soeben ziemlich aufgebracht zu meiner Mutter, »aber ich sage, es reicht jetzt mit diesem feuchten Frühling. Regen, Regen …« Pantomimisch fröstelnd zog er seinen Kragen zusammen und schaute in den Himmel.
»Ich glaube, heute Nachmittag soll es aufklaren.«
»Ja, ich weiß, aber ich bin jetzt bereit für den Sommer.« Er rieb sich die Hände. »Die Leute verlassen die Stadt, sie hassen ihn, beschweren sich über die Hitze, aber ich – ich bin ein Tropenvogel. Je heißer, je besser. Immer her damit!« Er klatschte in die Hände und ging auf den Fersen rückwärts die Straße hinunter. »Und – ich sag Ihnen: Was ich am besten finde, ist die Ruhe hier draußen, die dann kommt. So im Juli? Das Gebäude ist leer und verschlafen, und alle sind weg, wissen Sie?« Er schnippte mit den Fingern, als ein Taxi vorbeiraste. »Das ist mein Urlaub.«
»Aber werden Sie denn hier draußen nicht gebraten?« Genau das hatte mein distanzierter Dad an ihr nicht ausstehen können: ihre Neigung, Gespräche mit Kellnerinnen anzufangen, mit Portiers und mit den keuchenden alten Knackern in der Reinigung. »Ich meine, im Winter können Sie doch wenigstens einen Extramantel anziehen …«
»Hören Sie, haben Sie im Winter schon mal an der Tür gearbeitet? Ich sage Ihnen, es wird kalt. Egal, wie viele Mäntel und Mützen Sie anziehen. Sie stehen hier draußen, Januar, Februar, und der Wind weht vom Fluss herein? Brrr.«
Aufgeregt nagte ich an meinem Daumennagel und starrte den Taxis hinterher, die an Goldies erhobenem Arm vorbeisausten. Ich wusste, die Wartezeit bis zu der Konferenz um halb zwölf würde qualvoll werden, und ich hatte alle Mühe, dazustehen und nicht mit verfänglichen Fragen herauszuplatzen. Ich hatte keine Ahnung, womit sie uns überfallen würden, wenn sie uns erst in ihrem Büro hätten; schon das Wort »Konferenz« ließ an eine Zusammenkunft von Autoritätspersonen denken, an Anschuldigungen, Konfrontationen, an einen möglichen Schulverweis. Der Verlust meines Stipendiums wäre eine Katastrophe. Wir waren pleite, seit mein Dad weg war, wir hatten kaum noch das Geld für die Miete. Und vor allem: Ich war krank vor Sorge, Mr. Beeman könnte irgendwie herausgekriegt haben, dass Tom Cable und ich in leere Ferienhäuser eingebrochen waren, bei meinen Besuchen bei ihm draußen in den Hamptons. Ich sage eingebrochen, obwohl wir kein Schloss geknackt und auch sonst nichts beschädigt hatten (Toms Mutter war Immobilienmaklerin, und wir klauten einfach die Ersatzschlüssel von dem Brett in ihrem Büro). Hauptsächlich hatten wir Schränke durchstöbert und Schubladen durchwühlt, aber wir ließen auch ein paar Sachen mitgehen: Bier aus dem Kühlschrank, Spiele für die Xbox, eine DVD (Jet Li, Entfesselt) und auch Geld, insgesamt ungefähr 92 Dollar, zerknüllte Fünfer und Zehner aus einem Glas in einer Küche, jede Menge Kleingeld aus den Wäschekammern.
Immer wenn ich daran dachte, wurde mir schlecht. Meine Besuche bei Tom waren Monate her, aber auch wenn ich mir immer wieder einredete, Mr. Beeman könne unmöglich wissen, dass wir in den Häusern gewesen waren – woher auch? –, ging meine Fantasie mit mir durch und schwirrte panisch im Zickzack hin und her. Ich war entschlossen, Tom nicht zu verraten (obwohl ich nicht völlig sicher war, dass er mich nicht verraten hatte), aber damit saß ich in der Zwickmühle. Wie hatte ich so blöd sein können? Einbruch war ein Verbrechen; dafür ging man in den Knast. In der Nacht zuvor hatte ich stundenlang unter Qualen wach gelegen, mich hin- und hergeworfen und zugesehen, wie der Regen in unregelmäßigen Böen gegen meine Fensterscheibe klatschte, und ich hatte mich gefragt, was ich sagen würde, wenn man mich deswegen zur Rede stellte. Aber wie sollte ich mich verteidigen, wenn ich nicht mal wusste, was sie wussten?
Goldie seufzte tief, ließ die Hand sinken und ging, die Schuhspitzen angehoben, rückwärts auf den Absätzen zu meiner Mutter zurück.
»Unglaublich«, er behielt die Straße mit einem angeödeten Blick im Auge, »wir haben Hochwasser unten in SoHo, das haben Sie gehört, oder, und Carlos sagt, drüben bei der UNO sind ein paar Straßen gesperrt.«
Düster beobachtete ich die Horden von Angestellten, die aus dem Crosstown-Bus quollen, freudlos wie ein Schwarm Hornissen. Vielleicht hätten wir mehr Glück, wenn wir zwei Straßen weiter nach Westen gingen, aber meine Mutter und ich kannten Goldie gut genug, um zu wissen, dass er beleidigt wäre, wenn wir auf eigene Faust loszögen. Genau in diesem Moment – so plötzlich, dass wir alle erschraken – schleuderte ein Taxi mit brennender Dachleuchte quer über die Fahrspur auf uns zu und ließ einen Wasserfächer aufspritzen, der nach Kloake roch.
»Pass doch auf!«, schrie Goldie, als das Taxi sich durch die Pfützen pflügte und zum Stehen kam, und dann bemerkte er, dass meine Mutter keinen Schirm hatte. »Warten Sie«, sagte er und wollte in den Hausflur laufen, zu der Kollektion von verlorenen und vergessenen Schirmen, die er in einem Messingeimer vor dem Kamin aufbewahrte und an Regentagen neu verteilte.
»Nein«, rief meine Mutter und wühlte in ihrer Handtasche nach dem winzigen, bunt gestreiften Knirps, »lassen Sie nur, Goldie, ich hab schon …«
Goldie sprang zurück an den Randstein und schloss die Taxitür hinter ihr. Dann bückte er sich und klopfte ans Fenster.
»Einen gesegneten Tag«, sagte er.
III
Ich betrachte mich gern als sensiblen Menschen (wie wir es vermutlich alle tun), und während ich all das zu Papier bringe, ist die Versuchung groß, einen Schatten ins Bild zu schraffieren, der sich über den Himmel schiebt. Aber ich war blind und taub für die Zukunft. Meine einzige, erdrückende Sorge war die Besprechung in der Schule. Ich hatte Tom angerufen, um ihm (flüsternd am Festnetztelefon, denn sie hatte mir mein Handy weggenommen) zu erzählen, dass ich von der Schule suspendiert worden war, doch er klang nicht besonders überrascht. »Hör zu«, unterbrach er mich, »sei nicht so blöd, Theo, kein Mensch weiß was davon, du musst einfach deine verdammte Klappe halten«, und bevor ich noch ein Wort hervorbringen konnte, sagte er: »Tut mir leid, ich muss Schluss machen.« Dann legte er auf.
Im Taxi wollte ich das Fenster einen Spalt weit öffnen, um ein bisschen Luft hereinzulassen, aber es klemmte. Es roch, als hätte jemand auf dem Rücksitz schmutzige Windeln gewechselt oder vielleicht tatsächlich selbst geschissen und dann versucht, den Gestank mit einem Paket Kokosnuss-Lufterfrischer, der nach Sonnenöl duftete, zu überdecken. Die Sitze waren schmierig und mit Klebeband geflickt, die Stoßdämpfer praktisch nicht mehr vorhanden. Immer wenn wir über eine Delle fuhren, klapperten meine Zähne wie der religiöse Firlefanz, der am Rückspiegel baumelte: Medaillons, ein tanzendes Miniatur-Krummschwert an einer Plastikkette und ein turbantragender bärtiger Guru, der mit durchdringendem Blick und segnend erhobener Hand nach hinten starrte.
Am Rande der Park Avenue standen Kolonnen von roten Tulpen in Habtachtstellung, als wir vorbeijagten. Bollywood-Pop – zu einem leisen, beinahe unterschwelligen Wimmern heruntergedreht – glühte in hypnotisierenden Spiralen an der Schwelle meines Gehörs. An den Bäumen kamen die ersten Blätter zum Vorschein. Lieferboten von D’Agostino und Gristedes schoben Karren voller Lebensmittel vor sich her, gehetzte Business-Frauen in hochhackigen Schuhen stürmten den Gehweg entlang und zerrten widerstrebende Kindergartenkinder hinter sich her, ein uniformierter Arbeiter fegte den Dreck aus der Gosse auf ein Kehrblech mit einem langen Stiel, Anwälte und Börsenmakler streckten die flachen Hände vor sich aus und schauten stirnrunzelnd zum Himmel. Als wir die Straße hinaufrumpelten (meine Mutter sah elend aus und klammerte sich haltsuchend an die Armlehne), starrte ich hinaus zu den magenkranken Werktagsgesichtern (sorgenvoll aussehende Leute in Regenmänteln, die in grauen Scharen über die Kreuzungen wimmelten, die Kaffee aus Pappbechern tranken, in ihre Mobiltelefone sprachen und sich verstohlen umblickten), und ich bemühte mich nach besten Kräften, nicht an all die unangenehmen Varianten zu denken, die das Schicksal jetzt für mich bereithalten konnte: Ein paar davon drehten sich um Jugendgericht oder Gefängnis.
Das Taxi bog plötzlich scharf in die 86th Street ab. Meine Mutter rutschte gegen mich und griff nach meinem Arm, und ich sah, dass ihr Gesicht feucht und weiß wie ein Stockfisch war.
»Ist dir schlecht vom Fahren?«, fragte ich und vergaß für einen Augenblick meine eigenen Sorgen. Ihren kläglichen, starren Gesichtsausdruck kannte ich nur allzu gut. Ihre Lippen waren fest zusammengepresst, die Stirn glänzte, und die Augen waren glasig und groß.
Sie wollte etwas sagen – aber dann schlug sie die Hand vor den Mund, als das Taxi an der Ampel ruckartig bremste und uns beide nach vorn und dann rückwärts gegen die Sitzlehne schleuderte.
»Warte«, sagte ich, und dann beugte ich mich vor und klopfte an die fettige Plexiglasscheibe, sodass der Fahrer (ein Sikh mit Turban) erschrocken hochfuhr.
»Hören Sie«, rief ich durch das Gitter, »es genügt schon, wir steigen hier aus, okay?«
Der Sikh (ich sah ihn in dem mit Girlanden behängten Rückspiegel) starrte mich ungerührt an. »Ihr wollt hier anhalten.«
»Ja, bitte.«
»Aber das ist nicht die Adresse, die ihr mir gegeben habt.«
»Ich weiß. Aber es ist gut.« Ich sah mich nach meiner Mutter um. Ihre Wimperntusche war verschmiert, und sie sah verwelkt aus, als sie in ihrer Handtasche nach ihrem Portemonnaie suchte.
»Alles okay mit ihr?«, fragte der Taxifahrer zweifelnd.
»Ja, ja, alles okay. Wir müssen nur aussteigen, danke.«
Mit zitternden Händen holte meine Mutter ein Knäuel feucht aussehender Dollarscheine heraus und schob sie durch das Gitter. Der Sikh schob seine Hand hindurch und kassierte sie ein (den Blick resigniert abgewandt), und ich stieg aus und hielt ihr die Tür auf.
Meine Mutter stolperte ein wenig, als sie auf den Randstein trat, und ich hielt ihren Arm fest. »Alles in Ordnung?«, fragte ich scheu, als das Taxi davonraste. Wir waren an der oberen Fifth Avenue, bei den herrschaftlichen Häusern mit Blick auf den Park.
Sie holte tief Luft, wischte sich über die Stirn und drückte meinen Arm. »Puh«, sagte sie und wedelte sich mit der flachen Hand vor dem Gesicht. Ihre Stirn glänzte, und ihr Blick war immer noch ein bisschen unstet. Sie hatte das leicht zerzauste Aussehen eines Seevogels, den der Wind vom Kurs abgebracht hat. »Entschuldige, ich habe immer noch weiche Knie. Gott sei Dank sind wir raus aus diesem Taxi. Es geht gleich wieder, ich brauche nur ein bisschen frische Luft.«
Die Leute strömten an der windigen Ecke um uns herum und vorbei: Schulmädchen in Uniform, die uns lachend und rennend auswichen, Kindermädchen mit komplizierten Kinderwagen, in denen Babys paarweise und zu dritt saßen. Ein gehetzter, anwaltsmäßig aussehender Vater schob sich an uns vorbei und zog seinen kleinen Sohn am Handgelenk mit sich. »Nein, Braden«, hörte ich ihn zu dem Jungen sagen, der traben musste, um Schritt zu halten, »so darfst du nicht denken. Wichtiger ist es, einen Job zu haben, der dir gefällt …«
Wir traten beiseite, um der Seifenlauge auszuweichen, die ein Hausmeister vor seinem Gebäude aus dem Eimer auf den Gehweg kippte.
»Sag mal«, meine Mutter drückte die Fingerspitzen an ihre Schläfen, »lag das an mir, oder war dieses Taxi unglaublich …«
»Unglaublich eklig? Hawaiian Tropic-Sonnenöl und Babykacke?«
»Ehrlich«, sie fächelte sich Luft ins Gesicht, »ohne dieses ständige Stop-and-go wäre alles okay gewesen. Mir ging’s absolut gut, und dann kam es auf einmal über mich.«
»Warum fragst du auch nie, ob du vorn sitzen darfst?«
»Du klingst genau wie dein Vater.«
Verlegen schaute ich weg – ich hatte es selbst gehört: die Andeutung seines aufreizenden, allwissenden Tonfalls. »Gehen wir rüber zur Madison und suchen was, wo du dich hinsetzen kannst«, sagte ich. Ich hatte einen Mordshunger, und dort war ein Schnellrestaurant, das mir gefiel.
Aber sie schüttelte den Kopf, und fast überlief sie ein Schauder, eine sichtbare Welle der Übelkeit. »Luft.« Sie tupfte sich die verschmierte Wimperntusche unter den Augen weg. »Die frische Luft tut gut.«
»Na klar«, sagte ich ein bisschen zu hastig und darauf erpicht, ihr entgegenzukommen. »Von mir aus.«
Ich strengte mich an, liebenswürdig zu sein, aber meine Mutter – durchgerüttelt und benommen – registrierte meinen Tonfall, und sie beobachtete mich ganz genau und versuchte herauszufinden, was ich dachte. (Eine weitere schlechte Angewohnheit, in die wir dank des jahrelangen Zusammenlebens mit meinem Vater verfallen waren: Beide versuchten wir, die Gedanken des anderen zu lesen.)
»Was ist?«, fragte sie, »gibt es da etwas, wo du hinwillst?«
»Ähm, nein, eigentlich nicht.« Ich wich einen Schritt zurück und sah mich bestürzt um. Ich hatte zwar Hunger, aber ich sah mich nicht in der Position, meinen Kopf durchzusetzen.
»Mir geht’s gleich wieder gut. Lass mir nur einen Augenblick Zeit.«
»Vielleicht …« Ich kniff gestresst die Augen zusammen: Was wollte sie, was würde ihr gefallen? »Wie wär’s denn, wenn wir uns in den Park setzen?«
Zu meiner Erleichterung nickte sie. »Na schön«, sagte sie in dem Ton, den ich immer als ihre Mary-Poppins-Stimme bezeichnete. »Aber nur, bis ich wieder Luft bekomme.« Wir machten uns auf den Weg zum Übergang an der 79th Street, vorbei an Buschskulpturen in barocken Pflanzbottichen und massiven Haustüren mit schmiedeeisernen Gitterschnörkeln. Das Licht war zu einem industriellen Grau verblasst, und der Wind war schwer wie der Dampf aus einem Teekessel. Auf der anderen Straßenseite, vor dem Park, stellten Maler ihre Stände auf, entrollten Leinwände und pinnten ihre Aquarelldarstellungen der St. Patrick’s Cathedral und der Brooklyn Bridge an die Stelltafeln.
Wir gingen schweigend nebeneinander her. Meine Gedanken schwirrten geschäftig um meine eigenen Nöte herum (hatten Toms Eltern auch einen Anruf bekommen? Warum hatte ich nicht daran gedacht, ihn zu löchern?), aber auch um die Frage, was ich mir zum Frühstück bestellen würde, sobald ich es geschafft hätte, sie in das Schnellrestaurant zu bugsieren (Western Omelett mit Fritten und einer Scheibe Speck, und sie würde nehmen, was sie immer nahm, Roggentoast mit pochierten Eiern und eine Tasse schwarzen Kaffee), und ich achtete kaum darauf, wohin wir gingen, als mir klar wurde, dass sie soeben etwas gesagt hatte. Sie sah nicht mich an, sondern schaute in den Park, und ihr Gesichtsausdruck ließ mich an einen berühmten französischen Film denken, dessen Titel ich nicht kannte und in dem verstörte Leute durch windige Straßen gingen und eine Menge redeten, aber anscheinend nicht miteinander.
»Was hast du gesagt?«, fragte ich nach einem Augenblick der Verwirrung und ging schneller, um sie einzuholen. »Sei schläfrig …«
Sie sah mich verblüfft an, als hätte sie vergessen, dass ich da war. Der weiße Mantel, der im Wind flatterte, ließ sie noch mehr wie ein langbeiniger Ibis aussehen – als würde sie gleich ihre Flügel entfalten und über den Park hinaussegeln.
»Ich soll schläfrig sein?«
»Oh.« Ihr Gesicht wurde ausdruckslos, und dann schüttelte sie den Kopf und lachte kurz auf ihre scharfe, kindliche Art. »Nein, nicht ›sei schläfrig‹. Ich habe Zeitschleife gesagt.«
Es war seltsam, so etwas zu sagen, aber ich wusste doch, was sie damit meinte, oder zumindest glaubte ich, es zu wissen: dieses Frösteln der Unverbundenheit, fehlende Sekunden auf dem Gehweg, ein Zeitsprung wie ein Schluckauf, ein paar herausgeschnittene Bilder aus einem Film.
»Nein, nein, Puppy, es ist nur die Gegend hier.« Sie wuschelte mir durchs Haar, und ich musste auf eine schiefe, halb verlegene Art grinsen: Puppy – Welpe – war mein Babyname, und ich mochte ihn nicht mehr, ebenso wenig wie das Haarewuscheln, aber auch wenn es mich verlegen machte, war ich doch froh zu sehen, dass ihre Stimmung sich gebessert hatte. »Passiert immer hier oben. Wenn ich hier oben bin, komme ich mir vor, als wäre ich wieder achtzehn und gerade aus dem Bus gestiegen.«
»Hier?«, sagte ich zweifelnd und ließ zu, dass sie mich bei der Hand hielt, was ich normalerweise nicht erlaubt hätte. »Das ist komisch.« Ich wusste alles über die erste Zeit meiner Mutter in Manhattan, ein gutes Stück weit weg von der Fifth Avenue: in der Avenue B, in einer Ein-Zimmer-Wohnung über einer Bar, wo Penner in der Haustür schliefen und Kneipenschlägereien sich auf die Straße ergossen und eine verrückte alte Lady namens Mo zehn oder zwölf illegale Katzen in einem abgesperrten Treppenhaus im obersten Stock hielt.
Sie zuckte die Achseln. »Ja, aber hier oben ist es immer noch genauso wie am ersten Tag, als ich es gesehen habe. An der Lower East Side – na, du weißt ja, wie es da unten ist, dauernd was Neues, aber für mich ist es eher dieses Rip-van-Winkle-Gefühl, immer weiter und weiter weg. An manchen Tagen bin ich aufgewacht, und es war, als hätten sie über Nacht die Ladenfassaden neu geordnet. Alte Restaurants geschlossen, eine trendige Bar, wo immer die Reinigung gewesen war …«
Ich schwieg respektvoll. Der Lauf der Zeit beschäftigte sie neuerdings häufiger, vielleicht, weil ihr Geburtstag bevorstand. Ich bin zu alt für diese Nummer, hatte sie vor ein paar Tagen gesagt, als wir zusammen die Wohnung durchstöberten. Wir hatten unter den Sofakissen gewühlt und die Taschen von Jacken und Mänteln durchsucht, um genug Kleingeld für den Botenjungen vom Deli zusammenzukratzen.
Sie bohrte die Hände in die Manteltaschen. »Hier oben ist es stabiler«, sagte sie. Es klang unbeschwert, aber ich sah den Nebel in ihren Augen; offensichtlich hatte sie nicht gut geschlafen, dank mir. »Upper Park ist eine der wenigen Gegenden, wo man noch erkennen kann, wie die Stadt in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat. Gramercy Park auch und ein Teil des Village. Aber als ich gerade nach New York gekommen war, dachte ich, diese Gegend hier sei Edith Wharton und Franny und Zooey und Frühstück bei Tiffany in einem.«
»Franny und Zooey war die West Side.«
»Ja, aber ich war zu dumm, um das zu wissen. Ich kann nur sagen, es war ein ziemlicher Unterschied zur Lower East Side, wo Obdachlose in Mülltonnen Feuer machten. Hier oben war es am Wochenende wie verzaubert – ein Spaziergang durch ein Museum – allein durch den Central Park zu zockeln …«
»Zockeln?« So vieles von dem, was sie sagte, klang in meinen Augen exotisch, und zockeln hörte sich an wie irgendein Pferdeausdruck aus ihrer Kindheit, ein träger Trott vielleicht, eine Pferdegangart zwischen Schritt und Trab.
»Ach, du weißt schon, zu bummeln und zu stromern, wie ich es tue. Ich hatte kein Geld, aber Löcher in den Strümpfen, und lebte von Hafergrütze. Ob du es glaubst oder nicht, an manchen Wochenenden bin ich zu Fuß hier heraufgegangen. Hab mein U-Bahn-Geld für die Rückfahrt gespart. Damals hatte sie noch die Marken, keine Karten. Und obwohl man doch eigentlich bezahlen muss, um in ein Museum zu gehen? Die ›erbetene Spende‹? Na, ich schätze, ich muss damals viel frecher gewesen sein, aber vielleicht hatten sie auch nur Mitleid mit mir, weil – o nein!«, sagte sie in einem veränderten Ton und blieb unvermittelt stehen, sodass ich sie ein paar Schritte hinter mir ließ, ohne es zu merken.
»Was ist?« Ich machte kehrt. »Was ist los?«
»Ich hab was gespürt.« Sie streckte die flache Hand aus und schaute zum Himmel. »Du auch?«
Und während sie noch redete, schwand das Licht. Der Himmel verdunkelte sich in Sekundenschnelle, der Wind raschelte in den Bäumen im Park, und die jungen Blätter an den Bäumen standen zart und gelb vor schwarzen Wolken.
»Herrgott, das musste ja so kommen«, sagte meine Mutter. »Gleich wird’s gießen.« Sie beugte sich über die Straße hinaus und spähte nach Norden. Kein Taxi.
Ich nahm ihre Hand wieder. »Komm«, sagte ich, »auf der anderen Seite haben wir mehr Glück.«
Ungeduldig warteten wir das letzte Blinken der Fußgängerampel ab. Papierfetzen wirbelten durch die Luft und segelten die Straße hinunter. »Hey, da kommt ein Taxi«, sagte ich und schaute die Fifth Avenue hinauf. Im selben Augenblick stürzte ein Geschäftsmann zum Randstein und hob die Hand, und das Taxilicht erlosch.
Auf der anderen Straßenseite zogen die Maler hastig Plastikplanen über ihre Bilder. Wir rannten hinüber, und gerade als wir auf der anderen Seite ankamen, klatschte mir ein dicker Regentropfen auf die Wange. Vereinzelte braune Kleckse – weit auseinander, so groß wie Zehn-Cent-Stücke – platzten auf dem Gehweg auf.
»Oh, Mist!«, rief meine Mutter. Sie fummelte in ihrer Tasche herum und suchte den Schirm, der kaum groß genug für eine Person war, von zweien ganz zu schweigen.
Und dann ging es los. Kalte Regenschleier wehten seitwärts heran, breite Böen brandeten durch die Baumwipfel und ließen die Markisen auf der anderen Straßenseite flattern. Meine Mutter kämpfte mit dem ulkigen kleinen Regenschirm und versuchte ohne großen Erfolg, ihn aufzurichten. Die Leute auf der Straße und im Park hielten sich Zeitungen und Aktentaschen über die Köpfe und hasteten die Treppe zum Portikus des Museums hinauf, weil man nur dort Schutz vor dem Regen fand. Und es hatte etwas Festliches, Glückliches, wie wir beide unter dem kümmerlichen, bunt gestreiften Schirm die Stufen hinaufsprangen, schnell schnell schnell, vor aller Augen, als flüchteten wir vor etwas Schrecklichem, statt ihm geradewegs in die Arme zu laufen.
IV
Drei wichtige Dinge waren meiner Mutter passiert, nachdem sie ohne Freunde und praktisch ohne Geld mit dem Bus aus Kansas nach New York gekommen war. Das erste war, dass sie einem Fotoagenten namens Davy Jo Pickering beim Kellnern in einem Coffeeshop im Village auffiel – eine unterernährte junge Frau in Doc Martens und Secondhand-Kleidern, mit einem Zopf auf dem Rücken, der so lang war, dass sie darauf sitzen konnte. Als sie ihm seinen Kaffee brachte, bot er ihr erst siebenhundert und dann tausend Dollar, wenn sie für ein Mädchen einspränge, das zu einem Katalog-Shooting auf der anderen Straßenseite nicht erschienen war. Er zeigte ihr den Location Van, das Equipment, das am Sheridan Park aufgebaut wurde, er zählte die Scheine ab und legte sie auf die Theke. »Geben Sie mir zehn Minuten Zeit«, sagte sie, erledigte den Rest ihrer Frühstücksbestellungen, hängte die Schürze an den Haken und ging.
»Ich war nur Katalog-Model« – darauf wies sie die Leute immer ausdrücklich hin, und es sollte bedeuten, dass sie nie für Zeitschriften oder Modenschauen gearbeitet hatte, sondern immer nur als Model für die Handzettel von Kaufhausketten, die preiswerte Freizeitkleidung für junge Mädchen in Missouri und Montana anboten. Manchmal hat es Spaß gemacht, sagte sie, aber meistens nicht: Badeanzüge im Januar, fröstelnd von einer Erkältung, Tweed- und Wollsachen in der Sommerhitze, stundenlang schwitzend unter künstlichem Herbstlaub, während ein Studioventilator ihr heiße Luft entgegenblies und ein Typ aus der Maske zwischen den einzelnen Takes heranflitzte und ihr den Schweiß aus dem Gesicht puderte.
Aber nachdem sie jahrelang herumgestanden und so getan hatte, als ginge sie aufs College – in steifer Pose, zu zweit und zu dritt vor einer künstlichen Campus-Kulisse mit einem Stapel Bücher vor der Brust –, war es ihr gelungen, genug Geld auf die Seite zu legen, um wirklich aufs College zu gehen: Kunstgeschichte an der New York University. Erst mit achtzehn hatte sie nach ihrer Ankunft in New York das erste große Gemälde mit eigenen Augen gesehen, und sie brannte darauf, die verlorene Zeit nachzuholen. »Die reine Seligkeit, ein vollkommener Himmel«, hatte sie, bis zum Hals in Kunstbüchern, mir immer wieder versichert und stets dieselben alten Dias angestarrt (Manet, Vuillard), bis sie ihr vor den Augen verschwammen. (»Es ist verrückt«, sagte sie dann, »aber ich wäre absolut glücklich damit, den Rest meines Lebens immer wieder dasselbe halbe Dutzend Bilder anzuschauen. Ich wüsste keinen besseren Weg in den Wahnsinn.«)
Das College war das zweite wichtige Ereignis für sie in New York – und in ihren Augen wahrscheinlich das wichtigste. Und wenn das dritte nicht gewesen wäre (die Begegnung und anschließende Hochzeit mit meinem Vater, alles in allem kein so glückliches Ereignis wie die beiden ersten), hätte sie höchstwahrscheinlich ihr Masterdiplom erworben und dann promoviert. Wenn sie ein paar Stunden Zeit für sich hatte, ging sie immer geradewegs ins Frick, ins MoMa oder ins Met, und als wir jetzt unter dem tropfenden Portikus des Museums standen und über die dunstige Fifth Avenue hinweg auf die Regentropfen starrten, die weiß auf dem Asphalt aufspritzten, war ich nicht sonderlich überrascht, als sie den Regenschirm ausschüttelte und sagte: »Vielleicht sollten wir hineingehen und ein bisschen herumstöbern, bis es aufhört.«
»Ähm …« Was ich wollte, war ein Frühstück.
Sie warf einen Blick auf die Uhr. »Warum nicht? Ein Taxi kriegen wir hier niemals.«
Sie hatte recht. Aber ich hatte einen Mordshunger. Wann werden wir etwas essen?, dachte ich missmutig und folgte ihr die Treppe hinauf. Vermutlich würde sie nach der Konferenz so wütend auf mich sein, dass das Essen komplett gestrichen würde. Dann müsste ich mich zu Hause mit einem Granola oder so was zufriedengeben.
Aber im Museum war es immer, als wäre Feiertag, und als wir erst drin waren, umgeben vom fröhlichen Getöse der Touristen, fühlte ich mich seltsam isoliert von dem, was auch immer der Tag noch für mich bereithalten mochte. Im großen Saal war es laut, und es stank nach nassen Mänteln. Eine durchnässte Truppe von asiatischen Senioren rauschte an uns vorbei und hinter einer stewardessenmäßig adretten Führerin her. Triefende Pfadfinderinnen steckten an der Garderobe tuschelnd die Köpfe zusammen, und vor der Information stand eine Reihe von Kadetten der Militärakademie in ihren grauen Ausgehuniformen, ohne Mützen, die Hände auf dem Rücken verschränkt.
Für mich – ein Großstadtkind, immer umgeben von den Mauern der Wohnung – war das Museum hauptsächlich wegen seiner ungeheuren Größe interessant: ein Palast, dessen Räume sich endlos aneinanderreihten und immer verlassener aussahen, je weiter man vordrang. Einige der vernachlässigten Schlafgemächer und mit Kordeln abgesperrten Salons in den Tiefen der Abteilung für europäisches Kunsthandwerk lagen wie in einen tiefen Zauber versunken, als habe seit Jahrhunderten niemand mehr einen Fuß hineingesetzt. Seit ich angefangen hatte, allein mit der U-Bahn zu fahren, ging ich zu gern allein dorthin und streifte umher, bis ich mich verirrte; ich wanderte immer weiter in das Labyrinth der Galerien, bis ich manchmal in vergessene Säle mit Rüstungen und Porzellan geriet, die ich nie zuvor gesehen hatte (und teilweise auch niemals wiederfand).
Während ich in der Kassenschlange hinter meiner Mutter wartete, legte ich den Kopf in den Nacken und schaute starr zu dem mächtigen Deckengewölbe zwei Stockwerke über mir hinauf. Wenn ich angestrengt genug hinaufstarrte, bekam ich manchmal das Gefühl, dort oben herumzuschweben wie eine Feder – ein Trick aus früher Kindheit, den ich immer weniger beherrschte, je älter ich wurde.
Unterdessen angelte meine Mutter – rotnasig und atemlos von unserem Sprint durch den Regen – nach ihrem Portemonnaie. »Wenn wir fertig sind, springe ich vielleicht noch schnell in den Museumsshop«, sagte sie. »Ich bin sicher, das Letzte, was Mathilde sich wünscht, ist ein Kunstbuch, aber sie wird sich kaum groß darüber beklagen können, ohne dass es dumm klingt.«
»Igitt«, sagte ich. »Das Geschenk ist für Mathilde?« Mathilde war Art Director in der Werbeagentur, in der meine Mutter arbeitete. Sie war die Tochter eines französischen Großimporteurs für Stoffe, jünger als meine Mutter und notorisch pingelig: Sie neigte zu Wutanfällen, wenn der Fahrzeugservice oder das Catering nicht ihren Ansprüchen genügte.
»Yep.« Wortlos reichte sie mir einen Streifen Kaugummi, den ich annahm, und warf die Packung wieder in ihre Handtasche. »Ich meine, das ist doch total Mathildes Ding – das passende Geschenk, das nicht viel Geld kosten sollte. Der perfekte, preiswerte Briefbeschwerer vom Flohmarkt. Was vermutlich fantastisch wäre, wenn einer von uns die Zeit hätte, nach Downtown zu fahren und den Flohmarkt abzusuchen. Letztes Jahr, als Pru an der Reihe war …? Sie hat Panik gekriegt, ist in der Mittagspause zu Saks gerannt und hat am Ende zusätzlich zu dem, was sie ihr mitgegeben hatten, noch fünfzig Dollar von ihrem eigenen Geld draufgelegt, um eine Sonnenbrille zu kaufen, Tom Ford, glaube ich, und Mathilde musste trotzdem noch ihren Spruch über Amerikaner und Konsumkultur loswerden. Dabei ist Pru nicht mal Amerikanerin, sondern Australierin.«
»Hast du mit Sergio darüber geredet?«, fragte ich. Sergio – selten im Büro, aber oft in der Society-Presse mit Leuten wie Donatella Versace – war der millionenschwere Eigentümer der Firma, in der meine Mutter arbeitete. »Mit Sergio über etwas reden« entsprach etwa der Frage: »Was würde Jesus tun?«
»Sergios Vorstellung von einem Kunstband ist Helmut Newton. Oder vielleicht dieses Coffeetable-Buch, das Madonna vor einiger Zeit herausgebracht hat.«
Ich wollte fragen, wer Helmut Newton war, aber dann hatte ich eine bessere Idee. »Wieso schenkst du ihr keine Metro Card?«
Meine Mutter verdrehte die Augen. »Glaub mir, genau das wär’s.« Kürzlich hatte es Aufruhr in der Firma gegeben, als Mathilde mit dem Auto in einen Stau geraten und bei einem Goldschmied in Williamsburg gestrandet war.
»Quasi anonym. Leg ihr eine auf den Schreibtisch, eine alte Monatskarte, ohne Guthaben. Nur um zu sehen, was sie macht.«
»Ich kann dir sagen, was sie macht.« Meine Mutter schob ihren Mitgliedsausweis unter dem Fenster des Kartenschalters durch. »Sie feuert ihre Assistentin und wahrscheinlich die Hälfte der Leute in der Kreativabteilung.«
Die Werbeagentur, in der sie arbeitete, war auf Accessoires für Frauen spezialisiert. Unter den aufgeregten und leicht bösartigen Augen Mathildes beaufsichtigte meine Mutter den ganzen Tag Fotoshootings mit Kristallohrringen, die auf Verwehungen von künstlichem Festtagsschnee glitzerten, und Krokohandtaschen, die unbeaufsichtigt auf den Rücksitzen verlassener Limousinen in himmlischen Lichtkränzen leuchteten. Sie war gut in dem, was sie tat; sie arbeitete lieber hinter der Kamera als davor, und ich weiß, es war ein Kick für sie, wenn sie ihre Arbeit auf Postern in der U-Bahn und Plakatwänden am Times Square sah. Aber bei allem Glanz und Glamour ihres Jobs (Champagnerfrühstücke und Präsentpakete von Bergdorf) gehörten doch auch lange Überstunden dazu, und im Zentrum des Ganzen gab es eine Leere, die sie – das wusste ich – traurig machte. Eigentlich wäre sie lieber wieder zur Schule gegangen, aber natürlich wussten wir beide, dass die Chancen dafür jetzt schlecht standen, nachdem mein Vater abgehauen war.
»Okay.« Sie wandte sich vom Schalter ab und reichte mir mein Abzeichen. »Hilf mir, die Zeit im Auge zu behalten, ja? Es ist eine Riesenausstellung«, sie deutete auf ein Plakat: PORTRÄTUNDSTILLLEBEN: NÖRDLICHEMEISTERWERKEDESGOLDENENZEITALTERS, »und wir können bei einem Besuch nicht alles sehen, aber es gibt ein paar Sachen …«
Ihre Stimme verwehte, als ich hinter ihr die große Treppe hinaufstieg, hin- und hergerissen zwischen der vorausschauenden Notwendigkeit, in ihrer Nähe zu bleiben, und dem Drang, mich ein paar Schritte zurückzuhalten und so zu tun, als gehörte ich nicht zu ihr.
»Ich finde es grässlich, hier so durchzurennen«, sagte sie eben, als ich sie oben an der Treppe eingeholt hatte, »aber andererseits ist es natürlich eine Ausstellung, in die man sowieso zwei oder drei Mal gehen muss. Da ist die Anatomiestunde, und die müssen wir natürlich sehen, aber was ich wirklich sehen möchte, ist ein winziges, selten gezeigtes Bild von einem Maler, der Vermeers Lehrer war. Der größte der alten Meister, von dem man nie etwas gehört hat. Die Frans-Hals-Gemälde sind auch eine große Sache. Hals kennst du doch, oder? Der fröhliche Trinker? Und die Vorsteherinnen des Altmännerhauses?«
»Ja, genau«, sagte ich zögernd. Von den Bildern, die sie aufgezählt hatte, kannte ich nur die Anatomiestunde. Ein Detail daraus war auf dem Plakat zur Ausstellung abgebildet: fahles Fleisch, Schwarz in vielen Schattierungen, alkoholkrank aussehende Zuschauer mit blutunterlaufenen Augen und roten Nasen.
»Sachen aus dem Grundkurs Malerei«, sagte meine Mutter. »Hier, jetzt nach links.«
Oben war es eisig kalt, und meine Haare waren noch nass vom Regen. »Nein, nein, hier entlang.« Sie griff nach meinem Ärmel. Die Ausstellung zu finden war kompliziert, und als wir durch die belebten Galerien wanderten (uns durch große Gruppen schlängelten, rechts abbogen, links abbogen, unseren Weg durch verwirrend angelegte und beschilderte Labyrinthe zurück suchten), erschienen in unregelmäßigen Abständen und an unerwarteten Stellen große, düstere Reproduktionen der Anatomiestunde wie unheilvolle Wegweiser, immer derselbe alte Leichnam mit dem enthäuteten Arm, und darunter rote Pfeile: Operationssaal, hier entlang.
Ich war nicht sehr begeistert von der Aussicht auf eine Menge Bilder mit Holländern, die in dunklen Kleidern herumstanden, und als wir durch die Glastür traten – aus hallenden Korridoren in teppichgedämpfte Stille –, dachte ich zuerst, wir seien im falschen Saal gelandet. An den Wänden leuchtete der warme, matte Dunst des Wohlstands, die typische Reife des Alten, aber im nächsten Moment brach alles auseinander und wurde zu Klarheit und Farbe und purem Nordlicht. Porträts, Interieurs, Stillleben, manche winzig, andere majestätisch: Damen mit Ehemännern, Damen mit Schoßhündchen, einsame Schönheiten in bestickten Gewändern und prachtvolle Kaufleute, Solitäre mit Juwelenschmuck und Pelz. Verwüstete Banketttafeln, übersät von geschälten Äpfeln und Walnussschalen, drapierte Tapisserien und Silber, Trompe-l’Œil-Malereien mit krabbelnden Insekten und gestreiften Blumen. Und je tiefer wir hineinwanderten, desto seltsamer und schöner wurden die Bilder. Geschälte Zitronen, deren Rinde an der Messerschneide leicht verhärtet war. Der grünliche Schatten eines Schimmelflecks. Licht auf dem Rand eines halbvollen Weinglases.
»Das hier gefällt mir auch«, flüsterte meine Mutter und kam vor einem eher kleinen und besonders spukhaften Stillleben an meine Seite. Ein weißer Schmetterling schwebte vor einem dunklen Hintergrund über einer roten Frucht. Der Hintergrund – ein schweres Schokoladenschwarz – war von einer komplizierten Wärme, die an volle Lagerräume denken ließ, an Geschichte, an das Vergehen der Zeit.
»Sie verstanden es wirklich, diesen schmalen Bereich herauszuarbeiten, diese niederländischen Maler – Reife, die in Fäulnis übergeht. Die Frucht ist perfekt, aber sie wird nicht halten, sie wird bald vergehen. Und sieh mal, besonders hier« – sie langte über meine Schulter und malte mit dem Finger in die Luft –, »dieser Teil hier, der Schmetterling.« Die Unterseite des Flügels war so puderig und zart, dass es aussah, als würde die Farbe verschmieren, sobald sie sie berührte. »Wie wunderschön er damit spielt. Stille mit einem bebenden Hauch von Bewegung.«
ENDE DER LESEPROBE