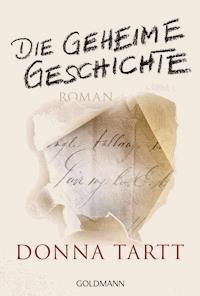
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Richard Papen stammt aus einfachen Verhältnissen. Als er aufgrund eines Stipendiums das College besuchen kann, ist er gleich fasziniert von der ihm fremden Welt. Besonders zieht ihn eine Gruppe junger Studenten in den Bann, mit denen er nicht nur Griechisch lernt, sondern auch ausgelassen feiert. Doch bald spürt er, dass unter der Oberfläche unerschütterlicher Freundschaft Spannungen lauern und dass ein furchtbares Geheimnis seine Freunde belastet – ein Geheimnis, das auch ihn mehr und mehr in seinen dunklen, mörderischen Sog zieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1063
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Richard Papen stammt aus einfachen Verhältnissen. In einem kalifornischen Provinznest geboren, träumt er von nichts anderem, als von dort weg zu kommen. Endlich gelingt es ihm, ein Stipendium für das College von Hampden in Vermont zu erhalten, und die Welt, der er dort begegnet, schlägt ihn vom ersten Augenblick an in ihren Bann. Besonders fasziniert ist Richard von einer Gruppe fünf junger Studenten, die sich zusammen mit ihm bei dem verschrobenen Griechischprofessor Julian Morrow eingeschrieben haben. Da ist Henry, der Sohn reicher Eltern und heimlicher Kopf des Zirkels, da ist Francis, der leicht dekadente und blasierte Erbe eines großen Vermögens, da sind Charles und Camilla, die Zwillinge, die seit dem Tod ihrer Eltern von den Zuwendungen ihrer Großmutter leben, und schließlich Edmund, von allen »Bunny« genannt, der liebenswürdige Schnorrer, der stets auf großem Fuße lebt, ohne je einen Pfennig in der Tasche zu haben. Gemeinsam mit ihnen paukt Richard Griechisch, zusammen mit ihnen huldigt er dem täglichen Alkohol, in ihrem Kreis verbringt er wunderbare Wochenenden auf Francis’ feudalem Landsitz. Doch bald spürt er, dass unter der Oberfläche unverbrüchlicher Freundschaft Spannungen bestehen und dass ein furchtbares Geheimnis auf seinen Freunden lastet – ein Geheimnis, das auch ihn mehr und mehr in einen dunklen, mörderischen Sog reißt …
Weitere Informationen zu Donna Tartt
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Donna Tartt
Die geheime Geschichte
Roman
Ins Deutsche übertragen von Rainer Schmidt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel »The Secret History« bei Alfred A. Knopf, New York.
Die Übersetzung der Stelle aus »The Waste Land« wurde dem Band T. S. Eliot, »Das wüste Land«, übertragen von Ernst Robert Curtius, Insel Verlag Leipzig, 1990, entnommen.
Das Zitat aus der »Orestie« wurde dem Band Aischylos, »Die Orestie«, deutsch von Emil Staiger, Reclam, Stuttgart, entnommen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 1992 by Donna Tartt
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1993
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: arcangel/© Alison Burford
Th · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-22595-7V003
www.goldmann-verlag.de
Für Bret Easton Ellis,
dessen Großzügigkeit mein Herz
immer erwärmen wird;
und für Paul Edward McGloin,
Muse und Mäzen:
Ich kann nicht hoffen, je einen lieberen Freund
auf dieser Welt zu finden.
Ich frage nun nach der Entstehung des Philologen und behaupte
1. der junge Mensch kann gar nicht wissen, wer Griechen und Römer sind,
2. er weiß nicht ob er zu ihrer Erforschung sich eignet …
FRIEDRICH NIETZSCHE Unzeitgemäße Betrachtungen
So kommt und lasst uns eine Mußestunde mit Geschichtenerzählen zubringen, und unsere Geschichte sei die Erziehung unserer Helden.
PLATODie Republik, Buch II
PROLOG
Der Schnee in den Bergen schmolz schon, und Bunny war seit ein paar Wochen tot, ehe uns der Ernst unserer Lage allmählich dämmerte. Er war zehn Tage tot gewesen, als sie ihn gefunden hatten, wissen Sie. Es war eine der größten Suchaktionen nach einem Vermissten in der Geschichte Vermonts – Staatspolizei, FBI, sogar ein Hubschrauber der Army; das College geschlossen, die Färberei in Hampden dichtgemacht; Leute, die aus New Hampshire, aus dem Staat New York, sogar noch aus Boston herbeikamen.
Es ist schwer zu glauben, dass Henrys bescheidener Plan diesen unvorhergesehenen Ereignissen zum Trotz so gut funktionierte. Wir hatten nicht die Absicht gehabt, die Leiche an einem unauffindbaren Ort zu verstecken. Genau genommen hatten wir sie überhaupt nicht versteckt, sondern einfach liegen gelassen, wo sie hingefallen war, in der Hoffnung darauf, dass irgendein Passant das Pech haben würde, über sie zu stolpern, ehe irgendjemand überhaupt gemerkt hatte, dass Bunny verschwunden war. Es war eine Geschichte, die sich selbst erzählte, einfach und gut: die losen Steine, der Leichnam am Grunde der Schlucht mit gebrochenem Hals, die schlammigen Rutschspuren von auf dem Weg nach unten in den Boden gestemmten Fersen – ein Wanderunfall, nicht mehr, nicht weniger, und dabei hätte man es belassen können, bei ein paar stillen Tränen und einer kleinen Beerdigung, wäre da nicht der Schnee gewesen, der in dieser Nacht fiel; der deckte ihn spurlos zu, und zehn Tage später, als es schließlich taute, da sahen die Staatspolizisten und das FBI und die Suchmannschaften aus der Stadt, dass sie allesamt über der Leiche hin und her gelaufen waren, bis der Schnee darüber wie Eis zusammengepresst worden war.
Es fällt schwer zu glauben, dass es zu einem solchen Aufruhr wegen einer Tat kam, für die ich teilweise verantwortlich war, und es fällt noch schwerer zu glauben, dass ich dort mitten hindurchspaziert bin – durch die Kameras, die Uniformen, die schwarzen Scharen, die auf dem Mount Cataract wimmelten wie Ameisen in einer Zuckerschüssel –, ohne auch nur dem Funken eines Verdachts zu begegnen. Aber durch das alles hindurchzuspazieren war eine Sache; davonzuspazieren hat sich leider als eine völlig andere erwiesen, und obwohl ich mal dachte, ich hätte diese Schlucht an einem Aprilnachmittag vor langer Zeit für immer verlassen, bin ich da jetzt nicht mehr so sicher. Jetzt, wo die Suchtrupps weg sind und das Leben um mich herum wieder still geworden ist, weiß ich, dass ich mir vielleicht jahrelang eingebildet habe, woanders zu sein, dass ich aber in Wirklichkeit die ganze Zeit da war: oben am Rand der Schlucht, bei den schlammigen Wagenspuren im neuen Gras, wo der Himmel dunkel ist über den zitternden Apfelblüten und wo der erste Frosthauch des Schnees, der in der Nacht fallen wird, schon in der Luft hängt.
Was macht ihr denn hier oben?, hatte Bunny überrascht gefragt, als er uns vier sah, wie wir ihn erwarteten.
Na, wir suchen nach neuen Farnen, hatte Henry gesagt.
Und nachher standen wir flüsternd im Unterholz – ein letzter Blick auf die Leiche und ein letzter Blick in die Runde, keine Schlüssel fallen gelassen, keine Brille verloren, hat jeder alles? – und gingen dann im Gänsemarsch durch den Wald, und ich warf noch einen Blick zurück durch die Schösslinge, die sich hinter mir wieder aufrichteten und den Pfad verschlossen. Und so wie ich mich an den Rückweg und an die ersten einsamen Schneeflocken erinnere, die durch die Fichten heruntergeweht kamen, daran, wie wir dankbar nacheinander in den Wagen kletterten und die Straße hinunterfuhren wie eine Familie in den Ferien, wobei Henry mit zusammengebissenen Zähnen durch die Schlaglöcher fuhr und wir anderen, über die Lehne gebeugt, plauderten wie die Kinder, so wie ich mich nur zu gut an die lange, schreckliche Nacht erinnere, die vor uns lag, und an die langen, schrecklichen Tage und Nächte, die darauf folgten, so brauche ich bis heute nur einen Blick über die Schulter zu werfen, und all die Jahre fallen von mir ab, und ich sehe sie wieder hinter mir, die Schlucht, wie sie sich in lauter Grün und Schwarz zwischen den Schösslingen erhebt, ein Bild, das mich nie verlassen wird.
Ich nehme an, es gab eine Zeit in meinem Leben, da hätte ich eine beliebige Anzahl von Geschichten gewusst, aber jetzt gibt es keine andere mehr. Dies ist die einzige Geschichte, die ich je werde erzählen können.
BUCH EINS
ERSTES KAPITEL
Gibt es – außer in der Literatur – wirklich so etwas wie den »Keim des Verderbens«, diesen auffälligen dunklen Riss, der sich mitten durch ein Leben zieht? Ich dachte immer, es gebe ihn nicht. Jetzt denke ich, es gibt ihn doch. Und ich denke, bei mir ist es dies: das morbide Verlangen nach dem Pittoresken um jeden Preis.
A moi. L’histoire d’une de mes folies.
Mein Name ist Richard Papen. Ich bin achtundzwanzig Jahre alt, und ich hatte New England oder Hampden College nie gesehen, bis ich neunzehn war. Ich bin Kalifornier von Geburt und, wie ich kürzlich herausgefunden habe, auch von Natur aus. Das Letztere ist etwas, das ich erst jetzt zugebe, im Nachhinein. Nicht, dass es darauf ankäme. Aufgewachsen bin ich in Plano, einer Kleinstadt im Norden, die von der Chip-Industrie lebt. Keine Geschwister. Mein Vater führte eine Tankstelle, und meine Mutter war zu Hause, bis ich heranwuchs und die Zeiten härter wurden und sie als Telefonistin in der Verwaltung einer der großen Chip-Fabriken außerhalb von San José arbeiten ging.
Plano. Das Wort beschwört Drive-ins herauf, Bungalowsiedlungen, Hitzeflimmern über dem Asphalt der Straßen. Die Jahre dort haben mir nie viel bedeutet; eine entbehrliche Vergangenheit, wegwerfbar wie ein Plastikbecher. Was vermutlich ein sehr großes Geschenk war, in gewisser Hinsicht. Als ich von zu Hause wegging, konnte ich mir eine neue, sehr viel befriedigendere Geschichte zulegen, geprägt von einem ebenso außerordentlichen wie klischeehaften Milieu: eine farbenprächtige Vergangenheit, leicht zugänglich für jeden Fremden. Der Glanz dieser fiktiven Kindheit – voller Swimmingpools und Orangenhaine und mit verlotterten, aber bezaubernden Eltern aus dem Showbusiness – hat das triste Original so gut wie überlagert. Ja, wenn ich über meine wirkliche Kindheit nachdenke, bin ich außerstande, mir davon viel mehr als ein betrübliches Gewirr von Gegenständen in Erinnerung zu rufen: die Turnschuhe, die ich das ganze Jahr über trug, Malbücher aus dem Supermarkt und den zerdrückten alten Fußball, den ich zu den Spielen in der Nachbarschaft beisteuerte – wenig Interessantes, noch weniger Schönes. Ich war still, groß für mein Alter, hatte eine Neigung zu Sommersprossen. Ich hatte nicht viele Freunde, aber ob das auf mich oder auf die Umstände zurückzuführen war, weiß ich nicht. In der Schule war ich, wie es scheint, gut, aber nicht außergewöhnlich gut; ich las gern – Tom Swift, die Bücher von Tolkien –, aber ich sah auch gern fern und tat es reichlich, ausgestreckt auf dem Teppich in unserem leeren Wohnzimmer an den langen, langweiligen Nachmittagen nach der Schule.
Ich kann mich ehrlich nicht an viel mehr aus diesen Jahren erinnern – abgesehen von einer gewissen Stimmung, die sie größtenteils durchdrang, einem melancholischen Gefühl, das ich damit assoziiere, dass ich sonntagabends »Die wunderbare Welt des Walt Disney« sehe. Der Sonntag war ein trauriger Tag – früh zu Bett, am nächsten Morgen zur Schule und die beständige Sorge, dass meine Hausaufgaben nicht in Ordnung waren –, aber wenn ich sah, wie das Feuerwerk im Nachthimmel über den flutlichtbestrahlten Schlössern von Disneyland hochging, erfüllte mich geradezu ein Gefühl der Beklemmung, des Gefangenseins im öden Rund von Schule und Zuhause. Mein Vater war gemein, unser Haus hässlich, und meine Mutter kümmerte sich wenig um mich; meine Kleider waren billig, mein Haarschnitt zu kurz, und niemand in der Schule schien mich besonders zu mögen, und da all das so lange galt, wie ich mich erinnern konnte, glaubte ich, dass es zweifellos in alle Zukunft in diesem deprimierenden Stil so weitergehen würde. Kurz: Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben auf irgendeine subtile, aber grundlegende Weise befleckt war.
Vermutlich ist es insofern nicht merkwürdig, dass ich mein Leben nur schwer mit dem meiner Freunde in Einklang bringen kann – oder zumindest mit ihrem Leben, wie ich es wahrnehme. Charles und Camilla sind Waisen (wie habe ich mich nach diesem harten Schicksal gesehnt!), von Großmüttern und Großtanten in einem Haus in Virginia aufgezogen: eine Kindheit, die ich mir gern vorstelle, mit Pferden und Flüssen und Süßharzbäumen. Und Francis: Seine Mutter war erst siebzehn, als sie ihn bekam – ein dünnblütiges, kapriziöses Mädchen mit rotem Haar und einem reichen Daddy, das mit dem Schlagzeuger von Vance Vane and His Musical Swains durchbrannte. Drei Wochen später war sie wieder zu Hause, sechs Wochen später wurde die Ehe annulliert, und die Großeltern zogen sie, wie Francis gern sagt, Geschwistern gleich auf, ihn und seine Mutter, zogen sie in so großmütigem Stil auf, dass selbst die Klatschweiber beeindruckt waren – englische Kinderfrauen und Privatschulen, Sommer in der Schweiz, Winter in Frankreich. Oder nehmen Sie sogar den gutmütigen alten Bunny, wenn Sie wollen. Keine Kindheit mit Blazer und Tanzunterricht, ebenso wenig wie bei mir, aber doch eine amerikanische Kindheit: der Sohn eines Football-Stars aus Clemson, der Banker geworden war, vier Brüder und keine Schwester in einem lärmerfüllten Haus in einem Vorort, Segelboote, Tennisschläger und Golden Retriever; die Sommer dann auf Cape Cod, Internat bei Boston, endlose Picknicks in der Football-Saison – eine Erziehung, die man Bunny in jeder Hinsicht anmerkte, angefangen bei seinem Händedruck bis zu seiner Art, einen Witz zu erzählen.
Ich aber hatte nichts mit ihnen gemeinsam – und das ist bis heute nicht anders –, nichts außer meinen Griechischkenntnissen und dem Jahr, das ich in ihrer Gesellschaft verbracht habe. Und selbst wenn mir klar ist, dass dies im Lichte der Geschichte, die ich erzählen werde, merkwürdig klingen mag, außer vielleicht der Liebe – wenn denn Liebe etwas ist, das man gemeinsam hat.
Wie fange ich an?
Nach der Highschool ging ich auf ein kleines College in meiner Heimatstadt (meine Eltern waren dagegen; sie erwarteten, das war unmissverständlich klargemacht worden, dass ich meinem Vater in der Tankstelle half, und das war einer der vielen Gründe, weshalb ich so sehr darauf brannte, aufs College zu gehen), und in den zwei Jahren dort studierte ich Altgriechisch. Nicht dass ich diese Sprache besonders geliebt hätte; aber ich wollte ein vormedizinisches Examen machen (Geld, müssen Sie wissen, war die einzige Möglichkeit für mich, mein Schicksal zu verbessern, und Ärzte verdienen bekanntlich eine Menge Geld), und mein Studienberater hatte vorgeschlagen, für das erforderliche geisteswissenschaftliche Nebenfach eine Sprache zu nehmen; und weil der Griechischunterricht zufällig nachmittags stattfand, belegte ich Griechisch, damit ich montags ausschlafen konnte. Es war eine absolut willkürliche und doch, wie sich zeigen sollte, schicksalhafte Entscheidung.
Meine Leistungen in Griechisch waren gut, ja exzellent, und ich gewann im letzten Jahr sogar einen Preis der Altsprachlichen Fakultät. Mein Lieblingskurs war es deshalb, weil es in einem richtigen Klassenzimmer stattfand – keine Gläser mit Kuhherzen, kein Geruch von Formaldehyd, keine Käfige mit kreischenden Affen. Anfangs hatte ich gedacht, mit harter Arbeit könnte ich die fundamentale Empfindlichkeit und Abneigung gegen meinen Beruf überwinden und mit noch härterer Arbeit könnte ich vielleicht sogar so etwas wie Begabung dafür simulieren. Aber das war nicht der Fall. Die Monate vergingen, und ich blieb desinteressiert, wenn nicht sogar regelrecht angeekelt von meinem Studium der Biologie; meine Noten waren schlecht, und Lehrer und Klassenkameraden betrachteten mich mit Verachtung. In einer Geste, die sogar mir selbst wie eine unheilträchtige Pyrrhus-Geste erschien, wechselte ich zu englischer Literatur als Hauptfach, ohne meinen Eltern etwas davon zu sagen. Ich spürte, dass ich mir damit selbst die Kehle durchschnitt, dass es mir auf jeden Fall schrecklich leidtun würde, schließlich war es besser, auf einem lukrativen Gebiet zu versagen, als in einem Fach Erfolg zu haben, von dem mein Vater (der weder von finanziellen noch von akademischen Dingen etwas verstand) versichert hatte, dass es höchst unprofitabel sei – einem Fach, das unweigerlich dazu führen würde, dass ich für den Rest meines Lebens zu Hause herumhängen und ihn um Geld anbetteln würde, Geld, das er mir, wie er mit Nachdruck versicherte, nicht zu geben beabsichtigte.
Ich studierte also Literatur, und es gefiel mir besser. Aber mit meiner Heimatstadt kam ich immer weniger zurecht. Ich glaube nicht, dass ich die Verzweiflung erklären kann, die dieser Ort in mir hervorrief. Zwar habe ich inzwischen den Verdacht, dass ich angesichts der Umstände und meiner inneren Natur überall unglücklich gewesen wäre, in Biarritz genauso wie in Caracas oder auf Capri, aber damals war ich davon überzeugt, dass mein Unglücklichsein allein jener Stadt zuzuschreiben war. Vielleicht stimmte das auch zum Teil. Milton hat wohl bis zu einem gewissen Grad recht – der Geist ist ein eigener Ort und kann in sich die Hölle zum Himmel machen und so weiter –, aber es ist dennoch unbestreitbar, dass die Gründer von Plano ihre Stadt nicht gerade nach dem Paradies geformt hatten. Auf der Highschool machte ich es mir zur Gewohnheit, nach der Schule in Einkaufszentren herumzuspazieren, durch strahlend helle, kühle Geschosse zu taumeln, bis ich so geblendet war von Waren und Produkt-Codes, von Gängen und Rolltreppen, von Spiegeln und Musikberieselung und Lärm und Licht, dass in meinem Gehirn eine Sicherung durchbrannte und auf einmal alles völlig unverständlich wurde: wie Farbe ohne Form, wie ein Gestammel unzusammenhängender Moleküle. Dann wanderte ich wie ein Zombie zum Parkplatz und fuhr zum Baseballstadion, wo ich aber nicht mal ausstieg, sondern mit den Händen am Lenkrad im Wagen sitzen blieb und auf den Stahlzaun und das gelbe Wintergras starrte, bis die Sonne unterging und es so dunkel wurde, dass ich nichts mehr sehen konnte.
Zwar hatte ich die konfuse Vorstellung, dass meine Unzufriedenheit bohemehafter, unbestimmt marxistischer Natur sei (als Teenager spielte ich töricht den Sozialisten, hauptsächlich um meinen Vater zu ärgern), aber in Wirklichkeit begriff ich sie nicht annähernd, und ich wäre wütend geworden, wenn mir jemand gesagt hätte, wie sehr sie in Wirklichkeit puritanischen Ursprungs war. Vor Kurzem habe ich in einem alten Notizbuch folgende Zeilen gefunden, geschrieben, als ich ungefähr achtzehn war: »Für mich umgibt diesen Ort ein fauliger Geruch, der faulige Geruch, den reife Früchte verströmen. Nirgendwo sind die scheußlichen Mechanismen von Geburt und Paarung und Tod – diese monströsen Aufwerfungen des Lebens, die die Griechen miasma, Gifthauch, nennen – jemals so roh oder auch so hübsch kaschiert gewesen, haben so viele Menschen ihr Vertrauen in Lügen gesetzt, in Unbeständigkeit, in den Tod Tod Tod.«
Das ist, glaube ich, ziemlich starker Tobak. Wie das klingt, wäre ich, wenn ich in Kalifornien geblieben wäre, schließlich in einer Sekte gelandet oder hätte zumindest meine Ernährung irgendwelchen gespenstischen Einschränkungen unterworfen. Ich erinnere mich, dass ich um die gleiche Zeit etwas über Pythagoras las und ein paar seiner Ideen auf wunderliche Weise ansprechend fand – weiße Kleidung zu tragen, beispielsweise, oder die Abstinenz von allen Speisen, die eine Seele haben.
Aber stattdessen landete ich an der Ostküste.
Nach Hampden kam ich durch einen Winkelzug des Schicksals. Eines Abends im Verlauf langer Thanksgiving-Ferien mit schlechtem Wetter, Preiselbeeren aus der Dose und eintönig hindröhnenden Baseballspielen im Fernsehen ging ich nach einem Streit mit meinen Eltern auf mein Zimmer (worum es dabei ging, weiß ich nicht mehr, aber wir hatten immer Streit, um Geld und um die Schule), und ich wühlte in meinem Schrank und suchte meine Jacke, als sie herausgeflattert kam: eine Broschüre vom Hampden College, Hampden, Vermont.
Sie war zwei Jahre alt, diese Broschüre. Auf der Highschool hatten mir viele Colleges Infomaterial geschickt, weil meine Ergebnisse bei den Studieneignungstests ziemlich gut gewesen waren (leider nicht gut genug, um auf irgendein nennenswertes Stipendium hoffen zu dürfen), und die Broschüre hier hatte ich das letzte Schuljahr über in meinem Geometriebuch aufbewahrt.
Ich weiß nicht, weshalb sie in meinem Wandschrank war. Vermutlich hatte ich sie aufgehoben, weil sie so hübsch war. Im letzten Schuljahr hatte ich Dutzende Stunden damit zugebracht, die Fotos zu studieren, als brauchte ich sie nur lange und sehnsüchtig genug anzustarren, und schon würde ich durch eine Art Osmose in ihre klare, reine Stille entrückt werden. Noch heute erinnere ich mich an diese Bilder wie an die Bilder in einem Märchenbuch, das man als Kind geliebt hat. Strahlende Wiesen, dunstige Berge in der Ferne; knöcheltief das Laub auf einer windüberwehten Herbststraße; Reisigfeuer und Nebel in den Tälern; Cellos, dunkle Fensterscheiben, Schnee.
Hampden College, Hampden, Vermont. Gegründet 1895. (Das allein war schon staunenswert; in Plano kannte ich nichts, was lange vor 1962 gegründet worden wäre.) Studentenzahl: 500. Koedukation. Progressiv. Spezialisiert auf die Geisteswissenschaften. Äußerst wählerisch. »Hampden bietet einen abgerundeten Studiengang in den Geisteswissenschaften und strebt damit nicht nur danach, den Studenten solide Grundkenntnisse im Gebiet ihrer Wahl zu vermitteln, sondern darüber hinaus einen Einblick in alle Disziplinen westlicher Kunst, Zivilisation und Gedankenwelt. Wir hoffen das Individuum dabei nicht nur mit Fakten auszustatten, sondern mit dem Grundstock der Weisheit.«
Hampden College, Hampden, Vermont. Schon der Name klang wie eine strenge, anglikanische Kadenz, zumindest in meinen Ohren mit ihrer hoffnungslosen Sehnsucht nach England und ihrer Taubheit für die süßen, dunklen Rhythmen kleiner Missionsstädte. Lange Zeit betrachtete ich das Bild eines Gebäudes, das sie »Commons« nannten. Es war eingetaucht in ein schwaches, akademisches Licht – anders als Plano, anders als alles, was ich je gekannt hatte –, ein Licht, das mich an endlose Stunden in staubigen Bibliotheken denken ließ, an alte Bücher und an Stille.
Meine Mutter klopfte an die Tür und rief meinen Namen. Ich antwortete nicht. Ich riss das Anforderungsformular hinten aus der Broschüre und fing an, es auszufüllen. Name: John Richard Papen. Adresse: 4487 Mimosa Court, Plano, Kalifornien. Wünschen Sie Informationen über Möglichkeiten finanzieller Unterstützung? Ja (natürlich). Und ich schickte es am nächsten Morgen ab.
Die folgenden Monate waren ein endloser, öder Papierkrieg, immer wieder unentschieden, ein Grabenkampf. Mein Vater weigerte sich, die Anträge auf Studienbeihilfe auszufüllen; in meiner Verzweiflung stahl ich schließlich seine Steuerbescheide aus dem Handschuhfach seines Toyota und machte es selbst. Wieder warten. Dann eine Mitteilung vom Zulassungsdekanat. Es sei ein Vorstellungsgespräch erforderlich, und wann ich nach Vermont fliegen könne? Ich konnte mir den Flug nicht leisten, und das schrieb ich ihnen. Wieder warten, wieder ein Brief. Das College werde mir die Reisekosten erstatten, wenn ihr Stipendienantrag akzeptiert werde. Inzwischen war die Beihilfeberechnung eingetroffen. Der Beitrag, den meine Familie zahlen sollte, war höher, als mein Vater sich angeblich leisten konnte, und er weigerte sich, ihn zu übernehmen. In dieser Art zog sich der Guerillakrieg über acht Monate hin. Noch heute begreife ich die Kette der Ereignisse, die mich nach Hampden brachte, nicht vollständig. Mitfühlende Professoren schrieben Briefe; Ausnahmen der unterschiedlichsten Art wurden meinetwegen gemacht. Und knapp ein Jahr nachdem ich mich auf den goldbraunen Plüschteppich in meinem Zimmerchen in Plano gesetzt und impulsiv den Fragebogen ausgefüllt hatte, stieg ich mit zwei Koffern und fünfzig Dollar in Hampden aus dem Bus.
Ich war nie östlich von Santa Fe, nie nördlich von Portland gewesen, und als ich nach einer langen, bangen Nacht, die irgendwo in Illinois begonnen hatte, aus dem Bus stieg, war es sechs Uhr morgens, und die aufgehende Sonne schien auf Berge und Birken und unglaublich grüne Wiesen; und für mich, benommen von der Nacht und der Schlaflosigkeit und drei Tagen auf der Landstraße, war es wie ein Land aus einem Traum.
Die Wohnheime waren überhaupt keine Wohnheime – jedenfalls nicht Wohnheime, wie ich sie kannte, aus Hohlblocksteinen und mit deprimierendem Neonlicht –, sondern weiße Schindelhäuser mit grünen Fensterläden, die ein Stück weit abseits vom Commons in Ahorn- und Eschenwäldchen standen. Trotzdem wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass mein eigenes Zimmer, wo immer es sein mochte, irgendetwas anderes als hässlich und enttäuschend sein könnte, und es war fast ein Schock, als ich es das erste Mal sah – ein weißer Raum mit großen, nach Norden gerichteten Fenstern, mönchshaft kahl, mit narbigem Eichenholzfußboden und einer schrägen Decke wie in einer Turmstube. An meinem ersten Abend dort saß ich in der Dämmerung auf dem Bett, während die Wände langsam erst grau, dann golden, dann schwarz wurden, und lauschte einer schwindelerregend auf- und absteigenden Sopranstimme irgendwo am anderen Ende des Korridors, bis das Licht schließlich völlig verschwunden war und der ferne Sopran in der Dunkelheit immer weiter seine Spiralen zog wie ein Engel des Todes, und ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich je weiter weg gefühlt hätte von den flach gestreckten Konturen des staubigen Plano als an jenem Abend.
Die ersten Tage vor Unterrichtsbeginn verbrachte ich allein in meinem weiß gestrichenen Zimmer und in den leuchtenden Wiesen von Hampden. Und ich war glücklich in diesen ersten Tagen, wie ich es wirklich noch nie gewesen war, als ich nun wie ein Schlafwandler umherstreifte, benommen und trunken von lauter Schönheit. Eine Gruppe rotwangiger Mädchen mit flatternden Pferdeschwänzen beim Fußballspielen, ihr Rufen und Lachen, das schwach über das samtige, zwielichtige Feld wehte. Bäume, knarrend unter der Last der Äpfel, und Fallobst, rot im Gras darunter, das mit schwerem, süßem Duft verfaulte, und das stete Summen der Wespen ringsum. Der Uhrturm am Commons: efeubedeckte Ziegelmauern, ein weißer Turm, wie verzaubert in diesiger Ferne. Der Schreck, als ich das erste Mal nachts eine Birke sah, wie sie in der Dunkelheit vor mir aufragte, kühl und schlank wie ein Geist. Und die Nächte von unvorstellbarer Majestät: schwarz und windig und gewaltig, ungeordnet und wild die Sterne.
Ich hatte vor, mich wieder für Griechisch einzuschreiben – es war die einzige Sprache, die ich ein wenig beherrschte. Aber als ich das dem Studienberater sagte, dem man mich zugewiesen hatte – einem Französischlehrer namens Georges Laforgue mit olivfarbener Haut und einer schmalen Nase mit länglichen Nasenlöchern wie bei einer Schildkröte –, da lächelte er nur und drückte die Fingerspitzen zusammen. »Ich fürchte, da kann es ein Problem geben«, sagte er, und sein Englisch hatte einen Akzent.
»Wieso?«
»Es gibt nur einen Lehrer für Altgriechisch hier, und er ist sehr eigen mit seinen Studenten.«
»Ich habe zwei Jahre Griechisch gelernt.«
»Das wird wahrscheinlich keinen Unterschied ausmachen. Außerdem, wenn Sie Ihr Examen in englischer Literatur machen wollen, brauchen Sie eine moderne Sprache. Es ist immer noch Platz in meinem Grundkurs Französisch, und bei Deutsch und Italienisch lässt sich auch noch etwas machen. Die Spanischklassen« – er konsultierte seine Liste –, »die Spanischklassen sind größtenteils voll, aber wenn Sie möchten, rede ich ein Wort mit Mr. Delgado.«
»Vielleicht könnten Sie stattdessen mit dem Griechischlehrer sprechen.«
»Ich weiß nicht, ob es etwas nützen würde. Er nimmt nur eine begrenzte Zahl von Studenten an. Eine sehr begrenzte Zahl. Außerdem geschieht die Auswahl meiner Meinung nach eher auf persönlicher als auf akademischer Basis.«
In seinem Ton lag ein Hauch von Sarkasmus und außerdem die Andeutung, dass er, falls es mir recht wäre, dieses spezielle Thema lieber nicht weiterverfolgen würde.
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, sagte ich.
In Wahrheit glaubte ich es durchaus zu wissen. Laforgues Antwort überraschte mich. »Es ist nichts Derartiges«, sagte er. »Selbstverständlich ist er ein ausgezeichneter Gelehrter. Zufällig ist er auch ganz charmant. Aber er hat ein paar meiner Ansicht nach sehr merkwürdige Vorstellungen vom Unterrichten. Er und seine Studenten haben buchstäblich keinen Kontakt zum Rest der Fakultät. Ich weiß nicht, weshalb man seine Kurse weiter im allgemeinen Vorlesungsverzeichnis aufführt – das ist irreführend; jedes Jahr gibt es die gleiche Verwirrung deshalb; praktisch gesehen ist sein Seminar geschlossen. Wie ich höre, muss man, um bei ihm zu studieren, die richtigen Dinge gelesen haben und ähnliche Ansichten vertreten wie er. Schon mehrmals sind Studenten wie Sie abgewiesen worden, auch wenn sie schon früher eine klassische Sprache studiert hatten. Was mich betrifft« – er hob eine Braue –, »wenn ein Student lernen will, was ich lehre, und wenn er qualifiziert ist, dann nehme ich ihn in meinen Kurs auf. Sehr demokratisch, nicht? So ist es am besten.«
»Kommt so etwas hier oft vor?«
»Natürlich. Schwierige Lehrer gibt es an jeder Schule. Und viele« – zu meiner Überraschung senkte er die Stimme –, »viele hier, die sehr viel schwieriger sind als er. Wenngleich ich Sie bitten muss, mich damit nicht zu zitieren.«
»Natürlich nicht.« Ich war ein bisschen verblüfft über diese plötzliche Vertraulichkeit.
»Wirklich, es ist ziemlich wichtig, dass Sie es nicht tun.« Er beugte sich vor und flüsterte, und sein winziger Mund bewegte sich dabei kaum. »Ich muss darauf bestehen. Vielleicht ist es Ihnen nicht bewusst, aber ich habe ein paar schreckliche Feinde hier. Sogar – auch wenn Sie das vielleicht kaum glauben – sogar hier in meinem eigenen Fachbereich. Außerdem«, fuhr er in normalerem Ton fort, »ist er ein Sonderfall. Er unterrichtet hier seit vielen Jahren und lässt sich für seine Arbeit nicht einmal bezahlen.«
»Warum nicht?«
»Er ist reich. Sein Gehalt stiftet er dem College; er nimmt, glaube ich, aus steuerlichen Gründen einen Dollar pro Jahr.«
»Oh«, sagte ich. Ich war zwar erst ein paar Tage in Hampden, aber ich war bereits an die offiziellen Berichte über finanzielle Engpässe, begrenzte Mittelausstattung und Kürzungen gewöhnt.
»Nehmen Sie mich dagegen«, sagte Laforgue. »Ich unterrichte durchaus gern, aber ich habe eine Frau und eine Tochter, die in Frankreich zur Schule geht – da kommt einem das Geld gerade recht, nicht wahr?«
»Vielleicht spreche ich trotzdem mit ihm.«
Laforgue zuckte die Achseln. »Sie können es versuchen. Aber ich rate Ihnen, sich nicht anzumelden, denn wahrscheinlich wird er Sie dann nicht empfangen. Sein Name ist Julian Morrow.«
Ich war nicht besonders versessen darauf gewesen, Griechisch zu nehmen, aber was Laforgue da erzählt hatte, faszinierte mich. Ich ging nach unten und betrat das erste Büro, das ich sah. Eine dünne, säuerlich aussehende Frau mit welken blonden Haaren saß am Schreibtisch im Vorzimmer und aß ein Sandwich.
»Ich habe Mittagspause«, sagte sie. »Kommen Sie um zwei wieder.«
»Entschuldigung. Ich suche nur das Zimmer eines Lehrers.«
»Na, ich bin die Collegesekretärin, nicht die Information. Aber vielleicht weiß ich’s trotzdem. Wer ist es denn?«
»Julian Morrow.«
»Oh, der?«, sagte sie überrascht. »Was wollen Sie von ihm? Er ist oben, nehme ich an, im Lyzeum.«
»In welchem Zimmer?«
»Ist der einzige Lehrer da. Hat es gern still und friedlich. Sie werden ihn schon finden.«
Tatsächlich war es ganz und gar nicht einfach, das Lyzeum zu finden. Es war ein kleines Gebäude am Rande des Campus, alt und dermaßen mit Efeu bewachsen, dass es von der Landschaft ringsherum fast nicht zu unterscheiden war. Im Erdgeschoss lagen Hörsäle und Seminarräume, allesamt leer, mit sauberen Wandtafeln und frisch gebohnerten Fußböden. Hilflos wanderte ich umher, bis ich schließlich in der hinteren Ecke des Hauses, klein und schlecht beleuchtet, die Treppe entdeckte.
Oben stieß ich auf einen langen, verlassenen Korridor. Genussvoll hörte ich das Knarren meiner Schuhe auf dem Linoleum, als ich beherzt hindurchmarschierte und auf den geschlossenen Türen nach Namen oder Zahlen suchte, bis ich zu einer kam, an der ein Schildrahmen aus Messing angebracht war; darin steckte eine geprägte Karte mit der Aufschrift JULIAN MORROW. Ich blieb einen Moment stehen und klopfte dann dreimal kurz.
Ein paar Augenblicke vergingen, und dann öffnete die weiße Tür sich einen Spaltbreit. Ein Gesicht schaute zu mir heraus. Es war ein kleines, weises Gesicht, wach und aufmerksam, und obwohl gewisse Züge Jugendlichkeit andeuteten – der elfenhafte Aufwärtsbogen der Augenbrauen, die energischen Konturen von Nase und Kinn und Mund –, war es doch keineswegs ein junges Gesicht, und das Haar war schneeweiß. Ich bin nicht schlecht darin, das Alter anderer Leute zu erraten, aber seines hätte ich nicht annähernd treffen können.
Ich stand für einen Moment einfach da, während seine blauen Augen mich verblüfft anblinzelten.
»Was kann ich für Sie tun?« Die Stimme klang vernünftig und freundlich, wie nette Erwachsene manchmal Kindern gegenüber klingen.
»Ich … also, mein Name ist Richard Papen …«
Er legte den Kopf auf die andere Seite und blinzelte noch einmal mit strahlenden Augen, liebenswürdig wie ein Spatz.
»… und ich möchte in Ihre Altgriechisch-Klasse.«
Seine Miene verschloss sich. »Oh. Tut mir leid.« Sein Ton schien, es war kaum zu glauben, anzudeuten, dass es ihm wirklich leidtat, mehr noch als mir. »Ich wüsste nicht, was mir besser gefallen würde, aber leider ist meine Klasse bereits voll.«
Etwas an diesem anscheinend aufrichtigen Bedauern gab mir Mut. »Sicher gibt es doch da noch eine Möglichkeit«, sagte ich. »Ein Student mehr oder weniger …«
»Es tut mir schrecklich leid, Mr. Papen«, sagte er, und es klang fast, als tröste er mich über den Tod eines lieben Freundes und als versuche er mir klarzumachen, dass er außerstande sei, mir in irgendeiner Weise zu helfen. »Aber ich habe mich auf fünf Studenten beschränkt, und es wäre mir ganz unvorstellbar, einen weiteren dazuzunehmen.«
»Fünf Studenten ist aber nicht sehr viel.«
Er schüttelte den Kopf, schnell und mit geschlossenen Augen, als wären Beschwörungen mehr, als er zu ertragen vermöchte.
»Wirklich, ich würde Sie zu gern nehmen, aber ich kann es nicht einmal in Betracht ziehen«, sagte er. »Es tut mir schrecklich leid. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen? Ich habe eine Studentin hier.«
Mehr als eine Woche verging. Mein Unterricht fing an, und ich bekam einen Job bei einem Psychologieprofessor namens Dr. Roland. (Ich sollte ihm bei irgendwelchen unbestimmten »Forschungen« helfen, deren Natur ich aber nie herausbekam; er war ein alter, benebelter, unordentlich aussehender Knabe, ein Behaviorist, der die meiste Zeit über im Lehrerzimmer herumlungerte.) Und ich fand ein paar Freunde, die meisten davon Erstsemester, die in meinem Haus wohnten. Freunde ist vielleicht kein ganz zutreffendes Wort. Wir aßen zusammen, und wir sahen einander kommen und gehen, aber hauptsächlich verband uns die Tatsache, dass keiner von uns irgendjemanden kannte – eine Situation, die einem damals nicht einmal unbedingt unangenehm vorkam. Bei den wenigen Leuten, die ich kennengelernt hatte, die schon seit einer Weile in Hampden waren, erkundigte ich mich, was es mit Julian Morrow auf sich habe.
Fast alle hatten schon von ihm gehört, und ich erhielt allerlei widersprüchliche, aber faszinierende Informationen: Er sei ein brillanter Mann; er sei ein Hochstapler; er habe kein College-Examen; er sei in den vierziger Jahren ein großer Intellektueller gewesen, befreundet mit Ezra Pound und T. S. Eliot; das Geld seiner Familie stamme aus einer Beteiligung an einer feinen Ostküstenbank oder, wie andere sagten, aus dem Erwerb von Pleite-Immobilien während der Depression; er habe sich in irgendeinem Krieg vor der Wehrpflicht gedrückt (was allerdings chronologisch schwer nachzuprüfen war); er habe Verbindungen zum Vatikan, zu einer abgesetzten Königsfamilie im Nahen Osten, zu Francos Spanien. Der Wahrheitsgehalt all dieser Spekulationen war natürlich nicht abzuschätzen, aber je mehr ich über Morrow hörte, desto größer wurde mein Interesse. Ich begann, auf dem Campus nach ihm und seiner kleinen Studentengruppe Ausschau zu halten. Es waren vier Jungen und ein Mädchen, und aus der Ferne betrachtet waren sie nicht weiter ungewöhnlich. Von Nahem gesehen aber erwiesen sie sich als fesselnde Truppe – zumindest für mich, der ich noch nie etwas Vergleichbares gesehen hatte.
Zwei der Jungen trugen Brillen, merkwürdigerweise von der gleichen Art: klein, altmodisch, rund und stahlgerändert. Der größere der beiden – und er war ziemlich groß, deutlich über eins achtzig – war dunkelhaarig und hatte ein eckiges Kinn und grobe, blasse Haut. Er hätte gut aussehen können, wenn seine Züge weniger verbissen oder wenn seine Augen hinter den Brillengläsern nicht so ausdruckslos und leer gewesen wären. Er trug dunkle englische Anzüge und hatte stets einen Regenschirm bei sich (ein bizarrer Anblick in Hampden); er lief steif durch die Scharen von Hippies und Beatniks und Preppies und Punks und zeigte dabei die befangene Förmlichkeit einer alten Ballerina, was bei seiner Größe überraschte. »Henry Winter«, sagten meine Freunde, als ich auf ihn deutete, wie er in einiger Entfernung einen weiten Bogen um eine Gruppe Bongo-Spieler machte, die auf dem Rasen hockten.
Der – nicht viel – kleinere der beiden war ein nachlässiger Blonder, rotwangig und kaugummikauend, von unerschütterlicher Fröhlichkeit, die Fäuste stets tief in den Taschen der an den Knien zerrissenen Hose. Er trug jeden Tag dieselbe Jacke, ein formloses braunes Tweedexemplar mit verschlissenen Ellbogen und zu kurzen Ärmeln, und sein sandblondes Haar war links gescheitelt, sodass immer eine lange Stirnlocke über das eine Auge fiel. Bunny Corcoran war sein Name, und Bunny war aus irgendeinem Grund die Abkürzung für Edmund. Seine Stimme war laut und quäkend und hallte weithin hörbar durch den Speisesaal.
Der dritte Junge war der exotischste in der Gruppe. Eckig und elegant, bedenklich dünn, mit nervösen Händen, einem gewieften Albinogesicht und einem kurzen, flammenden Schopf von so rotem Haar, wie ich es noch nie gesehen hatte. Ich fand (irrtümlich), er kleide sich wie Alfred Douglas oder wie der Comte de Montesquieu: wunderschöne gestärkte Hemden mit französischen Manschetten, prachtvolle Krawatten, einen schwarzen Mantel, der sich im Gehen hinter ihm blähte und ihn aussehen ließ wie eine Kreuzung zwischen einem Studentenprinzen und Jack the Ripper. Einmal sah ich ihn zu meinem Entzücken sogar mit einem Kneifer. (Später fand ich heraus, dass dieser Kneifer keine echte Brille war, sondern Fensterglas enthielt, und dass seine Augen ein Gutteil schärfer waren als meine eigenen.) Er hieß Francis Abernathy.
Und dann war da noch ein Paar, ein Junge und ein Mädchen. Ich sah sie oft zusammen, und anfangs dachte ich, sie gingen miteinander, bis ich sie eines Tages aus der Nähe sah und erkannte, dass sie Geschwister sein mussten. Später erfuhr ich, dass sie Zwillinge waren – die einzigen Zwillinge auf dem Campus. Sie hatten große Ähnlichkeit miteinander mit ihrem schweren dunkelblonden Haar und den androgynen Gesichtern, so klar, so fröhlich und so ernst wie bei zwei flämischen Engeln. Und vielleicht das Ungewöhnlichste im Kontext von Hampden – wo es Pseudointellekt und Teenagerdekadenz im Überfluss gab und wo schwarze Kleidung de rigueur war –: Sie kleideten sich gern hell, vorzugsweise in Weiß. In diesen Schwärmen von Zigaretten und kultiviertem Dunkel tauchten sie hier und da auf wie Gestalten aus einer Allegorie oder wie die längst verstorbenen Festgäste irgendeiner vergessenen Gartenparty. Sie hießen Charles und Camilla Macaulay.
Alle erschienen sie mir äußerst unnahbar. Aber ich beobachtete sie fasziniert, wann immer ich sie zufällig sah: Francis, der sich in einer Tür zu einer Katze bückte und mit ihr sprach; Henry, wie er am Steuer eines kleinen weißen BMW mit Julian auf dem Beifahrersitz vorüberflitzte; Bunny, als er sich oben aus einem Fenster lehnte und den Zwillingen unten auf dem Rasen etwas zubrüllte. Nach und nach kamen mir weitere Informationen zu Gehör. Francis Abernathy kam aus Boston und war den meisten Berichten zufolge ziemlich reich. Auch Henry, hieß es, sei reich; aber mehr noch, er war ein Sprachengenie. Er sprach mehrere alte und neue Sprachen und hatte eine Übersetzung des Anakreon samt Kommentar veröffentlicht, als er erst achtzehn war. Die Zwillinge hatten ein Apartment außerhalb des Campus und kamen irgendwoher aus dem Süden. Und Bunny Corcoran hatte die Angewohnheit, spät abends in seinem Zimmer mit voller Lautstärke Märsche von John Philip Sousa zu spielen.
Das soll nicht bedeuten, dass ich mich mit alldem übermäßig viel beschäftigt hätte. Ich richtete mich zu jener Zeit im College ein; die Kurse hatten begonnen, und ich war mit meiner Arbeit beschäftigt. Mein Interesse an Julian Morrow und seinen Griechischstudenten war zwar noch wach, fing aber doch an zu schwinden, als sich etwas Merkwürdiges ereignete.
Es geschah am Mittwochmorgen in meiner zweiten Woche auf dem Campus; ich war in der Bibliothek, um vor dem Elf-Uhr-Seminar ein paar Fotokopien für Dr. Roland zu machen. Nach etwa einer halben Stunde schwammen Lichtflecke vor meinen Augen, und als ich zur Theke am Eingang ging, um der Bibliothekarin den Kopiererschlüssel zurückzugeben, drehte ich mich um und sah sie – Bunny und die Zwillinge. Sie saßen an einem Tisch, der übersät war mit Papier, Federhaltern und Tintenfässern. An die Tintenfässer erinnere ich mich besonders, weil ich sie so bezaubernd fand, und auch die langen, schwarzen, geraden Federhalter, die unglaublich archaisch und unpraktisch aussahen. Charles trug einen weißen Tennissweater, Camilla ein Sommerkleid mit einem Matrosenkragen und einen Strohhut. Bunnys Tweedjacke hing über der Stuhllehne, sodass man mehrere große Risse und Flecken im Futter sehen konnte. Er stützte die Ellbogen auf den Tisch, eine Haarsträhne fiel ihm in die Augen, und gestreifte Ärmelhalter hielten die verknitterten Hemdsärmel. Sie hatten die Köpfe zusammengesteckt und redeten leise miteinander.
Ich wollte plötzlich wissen, was sie redeten. Also ging ich zu dem Bücherregal hinter ihrem Tisch – außen herum, als wäre ich nicht sicher, was ich suchte, und dann ganz daran entlang, bis ich ihnen so nah war, dass ich Bunnys Arm hätte berühren können. Mit dem Rücken zu ihnen zog ich ein beliebiges Buch heraus – ein lächerliches soziologisches Lehrbuch, wie sich zeigte – und tat, als studierte ich das Register. Sekundäre Abweichung. Sekundäre Analyse. Sekundäre Gruppe. Sekundärschulen.
»Ich weiß nicht«, sagte Camilla eben. »Wenn die Griechen nach Karthago segeln, dann müssen wir den Akkusativ nehmen. Erinnert ihr euch? Wohin segeln sie? So lautet die Regel.«
»Kann nicht sein.« Das war Bunny. Seine Stimme klang nasal, zänkisch – W. C. Fields mit einer schlimmen Long-Island-Maulsperre. »Wir müssen hier nicht fragen ›wohin‹, sondern ›wo‹ ist ihr Ziel. Ich wette, wir brauchen den Ablativ.«
Man hörte ratloses Papiergeraschel.
»Moment«, sagte Charles. Seine Stimme hatte große Ähnlichkeit mit der seiner Schwester; sie war heiser und hatte eine leichte Südstaatenfärbung. »Schaut mal, hier. Sie segeln nicht einfach nach Karthago, sondern sie segeln, um es anzugreifen.«
»Du bist verrückt.«
»Nein, es stimmt. Guck dir den nächsten Satz an. Wir brauchen den Dativ.«
»Bist du sicher?«
Neuerliches Papiergeraschel.
»Absolut. Epi tō karchidona.«
»Sehe ich nicht ein«, sagte Bunny. »Ablativ heißt die Parole. Bei den schwierigen ist’s immer der Ablativ.«
Eine kurze Pause. »Bunny«, sagte Charles. »Du verwechselst da was. Der Ablativ ist lateinisch.«
»Ja, natürlich, das weiß ich auch«, sagte Bunny gereizt nach einer verwirrten Pause, die auf das Gegenteil hinzuweisen schien, »aber du weißt doch, was ich meine. Aorist, Ablativ, ist doch alles das Gleiche im Grunde …«
»Hör mal, Charles«, sagte Camilla. »Dieser Dativ geht nicht.«
»Doch, er geht. Sie segeln zum Angriff, nicht wahr?«
»Ja, aber die Griechen segeln über das Meer nach Karthago.«
»Aber ich habe das epi davorgesetzt.«
»Na, wir können angreifen und immer noch epi benutzen, aber wir brauchen den Akkusativ wegen der Grundregeln.«
Segregation. Selbst. Selbstvorstellung. Ich starrte auf das Register und zermarterte mir das Hirn nach dem Kasus, den sie suchten. Die Griechen segelten über das Meer nach Karthago. Wohin. Woher. Karthago.
Plötzlich fiel mir etwas ein. Ich klappte das Buch zu, schob es ins Regal und drehte mich um.
»Entschuldigung«, sagte ich. Sofort hörten sie auf zu reden und drehten sich erstaunt zu mir um.
»Tut mir leid – aber würde der Lokativ gehen?«
Eine ganze Weile sagte niemand etwas.
»Lokativ?«, wiederholte Charles dann.
»Man muss nur ze an karchido anhängen«, sagte ich. »Ich glaube, es ist ze. Wenn ihr das benutzt, braucht ihr keine Präposition, abgesehen von dem epi, wenn sie in den Krieg ziehen. Es bedeutet ›karthagowärts‹; damit braucht ihr euch auch nicht mehr um den Kasus zu kümmern.«
Charles blickte auf sein Papier und dann mich an. »Lokativ?«, sagte er. »Ziemlich obskur.«
»Bist du sicher, den gibt es für Karthago?«, fragte Camilla.
Daran hatte ich nicht gedacht. »Vielleicht nicht«, sagte ich. »Ich weiß, dass es ihn für Athen gibt.«
Charles beugte sich vor, zog das Lexikon über den Tisch zu sich heran und fing an, darin zu blättern.
»Ach, verflucht, spar dir die Mühe«, sagte Bunny durchdringend. »Wenn man es nicht deklinieren muss und wenn keine Präposition nötig ist, finde ich es schon prima.« Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und schaute zu mir auf. »Ich würde dir gern die Hand schütteln, Fremder.« Ich reichte sie ihm; er ergriff sie und schüttelte sie kräftig, und dabei stieß er mit dem Ellbogen fast ein Tintenfass um. »Erfreut, dich kennenzulernen, ja, ja«, sagte er und hob die andere Hand, um sich das Haar aus den Augen zu streichen.
Ich war verwirrt von dieser plötzlich auflodernden Aufmerksamkeit; es war, als hätten die Figuren auf einem Lieblingsgemälde, sonst immer versunken in ihre eigenen Belange, von der Leinwand aufgeblickt und mich angesprochen. Erst einen Tag zuvor war Francis, ein Nebelstreif von schwarzem Kaschmir und Zigarettenrauch, in einem Korridor an mir vorbeigestrichen. Einen Augenblick lang, als sein Arm den meinen berührte, war er ein Geschöpf aus Fleisch und Blut gewesen, aber im nächsten Moment hatte er sich wieder in eine Halluzination verwandelt, ein Fragment meiner Phantasie, das den Gang hinunterschritt, ohne mich zu beachten, wie Geister auf ihren schattenhaften Runden die Lebenden angeblich nicht beachten.
Charles, noch immer mit dem Lexikon beschäftigt, erhob sich und streckte mir die Hand entgegen. »Mein Name ist Charles Macaulay.«
»Richard Papen.«
»Ach, du bist das«, sagte Camilla plötzlich.
»Was?«
»Du. Du bist vorbeigekommen und hast nach dem Griechischkurs gefragt.«
»Das ist meine Schwester«, sagte Charles, »und das ist – Bun, hast du dich schon vorgestellt?«
»Nein, nein, glaube nicht. Ihr habt einen glücklichen Mann aus mir gemacht, Sir. Wir hatten noch zehn solche Dinger zu machen und fünf Minuten Zeit dafür. Edmund Corcoran ist mein Name.« Wieder ergriff er meine Hand.
»Wie lange hast du Griechisch gelernt?«, fragte Camilla.
»Zwei Jahre.«
»Du bist ziemlich gut darin.«
»Schade, dass du nicht bei uns im Kurs bist«, sagte Bunny.
Angespanntes Schweigen.
»Tja«, sagte Charles voller Unbehagen, »Julian ist komisch in solchen Dingen.«
»Geh doch noch mal zu ihm«, sagte Bunny. »Bring ihm Blumen mit und sag ihm, dass du Platon liebst. Dann frisst er dir aus der Hand.«
Wieder trat Schweigen ein, unfreundlicher jetzt als beim ersten Mal. Camilla lächelte, aber es galt eigentlich nicht mir – es war ein reizendes, zielloses Lächeln, durchaus unpersönlich, als wäre ich ein Kellner oder ein Verkäufer in einem Laden. Neben ihr lächelte Charles, der immer noch stand, ebenfalls und zog höflich eine Augenbraue hoch – eine Geste, die nervös hätte sein, die eigentlich alles Mögliche hätte bedeuten können, die ich aber als Frage verstand: Ist noch was?
Ich murmelte etwas und wollte mich abwenden, als Bunny – der in die entgegengesetzte Richtung starrte – seinen Arm vorschießen ließ und mich beim Handgelenk packte. »Warte«, sagte er.
Erschrocken blickte ich hoch. Henry war gerade zur Tür hereingekommen – mit schwarzem Anzug, Regenschirm und allem Drum und Dran. Als er am Tisch angelangt war, tat er, als ob er mich nicht sähe. »Hallo«, sagte er zu den anderen. »Seid ihr fertig?«
Bunny deutete mit einer Kopfbewegung auf mich. »Schau mal, Henry, wir müssen dich mit jemandem bekannt machen.«
Henry blickte auf. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Er schloss die Augen und öffnete sie wieder, als empfände er es als ganz außerordentlich, dass jemand wie ich sich in sein Gesichtsfeld stellte.
»Ja, ja«, sagte Bunny. »Dieser Mann heißt Richard – Richard wie?«
»Papen.«
»Ja, ja. Richard Papen. Studiert Griechisch.«
Henry hob den Kopf und sah mich an. »Doch sicher nicht hier?«
»Nein«, sagte ich und schaute ihm in die Augen, aber er starrte mich so unhöflich an, dass ich meinen Blick abwandte.
»Ach, Henry, sieh dir das doch an«, sagte Charles hastig und raschelte wieder mit seinen Papieren. »Wir wollten hier den Dativ oder den Akkusativ benutzen, aber er schlägt den Lokativ vor.«
Henry beugte sich über seine Schulter und inspizierte die Seite. »Hmm, ein archaischer Lokativ«, sagte er. »Äußerst homerisch. Natürlich wäre es grammatisch korrekt, aber es fällt vielleicht ein wenig aus dem Kontext.« Wieder hob er den Kopf, um mich zu mustern. Das Licht fiel in einem solchen Winkel herein, dass es auf seiner kleinen Brille blitzte und ich die Augen dahinter nicht sehen konnte. »Sehr interessant. Du bist also Homer-Student?«
Ich hätte vielleicht Ja gesagt, aber ich hatte das Gefühl, er würde mich mit Vergnügen bei einem Fehler erwischen und er würde mühelos dazu imstande sein. »Ich mag Homer«, sagte ich lahm.
Er betrachtete mich mit eisigem Abscheu. »Ich liebe Homer«, sagte er. »Natürlich studieren wir hier moderneren Stoff, Platon etwa, die Tragödiendichter und so weiter.«
Ich überlegte immer noch, was ich antworten sollte, als er desinteressiert wegschaute. »Wir sollten gehen«, sagte er.
Charles schob seine Blätter zusammen und stand wieder auf; Camilla stand neben ihm, und diesmal reichte sie mir auch die Hand. So Seite an Seite betrachtet waren sie einander wirklich sehr ähnlich, weniger vielleicht in ihrem Äußeren als vielmehr in Manieren und Haltung; es war eine Korrespondenz von Gesten, die wie Echos zwischen ihnen hin- und hersprangen, sodass ein Augenzwinkern wenig später in einem Lidzucken des anderen widerzuhallen schien. Ihre Augen waren vom gleichen Grau, intelligent und ruhig. Sie, fand ich, war sehr schön, auf eine verstörende, beinahe mittelalterliche Weise, die dem beiläufigen Betrachter gar nicht ersichtlich wäre.
Bunny schob seinen Stuhl zurück und schlug mir zwischen die Schulterblätter. »Tja, Sir«, sagte er. »Wir müssen uns gelegentlich mal zusammensetzen und über Griechisch plaudern, was?«
»Auf Wiedersehen«, sagte Henry mit einem Kopfnicken.
»Auf Wiedersehen«, sagte ich. Sie spazierten davon, und ich blieb stehen, wo ich war, und sah ihnen nach, wie sie die Bibliothek verließen, in breiter Phalanx, Seite an Seite.
Als ich ein paar Minuten später in Dr. Rolands Büro kam, um die Kopien abzuliefern, fragte ich ihn, ob er mir einen Vorschuss auf mein Hilfskraftgehalt geben könne.
Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und richtete die wässrigen, rotgeränderten Augen auf mich. »Nun, wissen Sie«, sagte er, »in den letzten zehn Jahren habe ich es mir zur Praxis gemacht, das nicht zu tun. Und ich will Ihnen sagen, warum.«
»Ich weiß schon, Sir«, sagte ich hastig. Dr. Rolands Diskurse über seine »Praktiken« konnten gelegentlich eine halbe Stunde oder noch länger dauern. »Ich verstehe. Bloß, es ist eine Art Notfall.«
Er lehnte sich wieder nach vorn und räusperte sich. »Und was für ein Notfall«, fragte er, »wäre das?«
Er verschränkte die Hände vor sich auf dem Tisch; sie waren knorrig von Adern, und die Knöchel hatten einen bläulichen, perlmutternen Schimmer. Ich starrte sie an. Ich brauchte zehn oder zwanzig Dollar, dringend, aber ich war hereingeplatzt, ohne mir vorher zu überlegen, was ich sagen wollte. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Da ist was passiert.«
Er furchte beeindruckend die Stirn. Dr. Rolands seniles Benehmen war angeblich eine Fassade; mir aber kam es durchaus echt vor, obgleich er manchmal, wenn man nicht aufpasste, eine unerwartet aufblitzende Klarheit zeigte, die – auch wenn sie häufig nichts mit dem gerade infrage stehenden Gegenstand zu tun hatte – ein Hinweis darauf war, dass in den schlammtrüben Tiefen seines Bewusstseins stockend immer noch rationale Prozesse abliefen.
»Mein Wagen«, sagte ich in einer plötzlichen Inspiration. Ich hatte gar keinen Wagen. »Ich muss ihn reparieren lassen.«
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er sich eingehender erkundigen würde, aber er merkte sichtlich auf. »Was ist denn los?«
»Irgendwas mit dem Getriebe.«
»Doppelte Nockenwelle? Luftgekühlt?«
»Luftgekühlt.« Ich verlagerte mein Gewicht auf den anderen Fuß. Es gefiel mir nicht, wie dieses Gespräch sich entwickelte. Ich habe keinen blassen Schimmer von Autos und gerate in große Verzweiflung, wenn ich nur einen Reifen wechseln soll.
»Was haben Sie denn – eine von diesen kleinen V6-Kisten?«
»Ja.«
»Die Jungen sind anscheinend alle ganz versessen darauf. Ich würde meine Kinder nie etwas anderes fahren lassen als einen V8.«
Ich hatte keine Ahnung, wie ich darauf antworten sollte.
Er zog eine Schreibtischschublade auf und fing an, Gegenstände herauszunehmen, sie dicht vor die Augen zu heben und wieder wegzulegen. »Wenn das Getriebe einmal kaputtgeht«, sagte er, »ist ein Wagen meiner Erfahrung nach hin. Vor allem ein V6. Ebenso gut können Sie das Auto gleich verschrotten. Was mich betrifft, ich habe einen 98 Regency Brougham, zehn Jahre alt. Bei mir heißt es: regelmäßige Inspektion, neue Filter alle fünfzehnhundert Meilen, Ölwechsel alle dreitausend. Läuft wie ein Traum. Hüten Sie sich vor diesen Werkstätten in der Stadt«, fügte er scharf hinzu.
»Wie bitte?«
Endlich hatte er sein Scheckbuch gefunden. »Na, eigentlich sollten Sie zur Zahlstelle gehen, aber das hier ist wohl in Ordnung.« Er klappte es auf und fing an, mühselig zu schreiben. »Ein paar der Firmen in Hampden brauchen nur herauszufinden, dass Sie vom College kommen, und gleich berechnen sie das Doppelte. Redeemed Repair ist meistens am besten – die gehören zu einer Sekte, ›wiedergeborene Christen‹, aber sie werden Sie auch noch ziemlich tüchtig ausnehmen, wenn Sie nicht ein Auge drauf haben.«
Er riss den Scheck heraus und gab ihn mir. Ich warf einen Blick darauf, und mein Herz setzte einmal aus. Zweihundert Dollar. Er hatte unterschrieben und alles.
»Lassen Sie sich nicht einen einzigen Penny mehr abnehmen«, mahnte er.
»Nein, Sir«, sagte ich und konnte meine Freude kaum im Zaum halten. Was würde ich mit alldem Geld anfangen? Vielleicht würde er ja sogar vergessen, dass er es mir gegeben hatte.
Er schob die Brille herunter und schaute mich über den Rand hinweg an. »Redeemed Repair«, sagte er. »Das ist draußen am Highway 6. Das Firmenschild sieht aus wie ein Kreuz.«
»Danke«, sagte ich.
Mit jauchzendem Herzen und zweihundert Dollar in der Tasche ging ich den Korridor entlang. Von einer Telefonzelle im Erdgeschoss aus rief ich mir ein Taxi, um nach Hampden Town zu fahren. Wenn es etwas gibt, worin ich gut bin, dann ist das, zu lügen, ohne rot zu werden. Es ist irgendwie ein Talent.
Und was tat ich in Hampden Town? Offen gestanden, ich war so überwältigt von meinem Glück, dass ich kaum etwas tat. Es war ein wunderschöner Tag; ich hatte es satt, arm zu sein, und so betrat ich, ehe ich mich besinnen konnte, ein teures Herrenausstattergeschäft am Platz und kaufte mir zwei Hemden. Dann ging ich hinunter zur Heilsarmee, wühlte dort eine Zeit lang in den Tonnen herum und fand einen Mantel aus Harris-Tweed und ein paar braune Schuhe mit weißen Spitzen, die mir passten, dazu ein Paar Manschettenknöpfe und eine komische alte Krawatte mit Bildern von Männern, die Rehe jagten. Als ich aus dem Laden kam, stellte ich beglückt fest, dass ich immer noch fast hundert Dollar hatte. Sollte ich in die Buchhandlung gehen? Ins Kino? Eine Flasche Scotch kaufen? Mir war so wirr von all den Möglichkeiten, die sich mir feilboten, dass ich sie wie ein von einer Schar Prostituierter in Verwirrung gebrachter Bauernjunge einfach links liegen ließ, mir in einer Telefonzelle ein Taxi bestellte und geradewegs nach Hause fuhr.
In meinem Zimmer breitete ich die Kleider auf dem Bett aus. Die Manschettenknöpfe waren verschrammt und trugen fremde Initialen, aber sie sahen aus wie echtes Gold und blinkten in der trägen Herbstsonne, die zum Fenster hereinschien und den Eichenholzfußboden mit gelblichen Flecken tränkte – schläfrig, satt, berauschend.
Es war ein Déjà-vu-Gefühl, als Julian am nächsten Nachmittag die Tür genauso öffnete wie beim ersten Mal, nur einen Spaltbreit, und wachsam herausspähte, als wäre da etwas Wunderbares in seinem Büro, das er bewachen musste und das nicht jeder zu sehen bekommen sollte. Es war ein Gefühl, das ich in den nächsten Monaten noch gut kennenlernen sollte. Noch heute, Jahre später und weit fort, finde ich mich manchmal im Traum wieder vor dieser weißen Tür und warte darauf, dass er erscheint wie der Torwächter in einem Märchen: alterslos, wachsam und schlau wie ein Kind.
Als er sah, dass ich es war, öffnete er die Tür ein Stückchen weiter als beim ersten Mal. »Mr. Pippin noch einmal, nicht wahr?«, sagte er.
Ich machte mir nicht die Mühe, ihn zu korrigieren. »Leider ja.«
Er sah mich einen Moment lang an. »Sie haben einen wunderbaren Namen, wissen Sie«, sagte er. »Es gab Könige in Frankreich, die Pippin hießen.«
»Sind Sie gerade beschäftigt?«
»Ich bin nie zu beschäftigt für einen Erben des französischen Throns, falls Sie das tatsächlich sein sollten«, antwortete er freundlich.
»Leider nein.«
Er lachte und zitierte ein kleines griechisches Epigramm über die Ehrlichkeit, die eine gefährliche Tugend sei, und zu meiner Überraschung öffnete er die Tür ganz und ließ mich eintreten.
Es war ein schönes Zimmer, überhaupt kein Büro und viel größer, als es von außen erschien – luftig und weiß, mit einer hohen Decke und gestärkten Gardinen, die im Wind wehten. In der Ecke neben einem niedrigen Bücherregal stand ein großer runder Tisch voller Teegeschirr und griechischen Büchern, und überall waren Blumen, Rosen und Nelken und Anemonen, auf seinem Schreibtisch, auf dem Tisch, auf den Fensterbänken. Die Rosen dufteten besonders stark; ihr Geruch hing satt und schwer in der Luft, gemischt mit dem Aroma von Bergamotten und schwarzem chinesischem Tee und einem schwachen, tintigen Hauch von Kampfer. Ich atmete tief ein und fühlte mich berauscht. Wohin ich auch schaute, überall war etwas Schönes – orientalische Teppiche, Porzellan, winzige Gemälde wie Juwelen –, eine Flut von gebrochenen Farben, die über mich hereinbrach, als wäre ich in eine dieser kleinen byzantinischen Kirchen getreten, die von außen so schlicht aussehen und innen ein paradiesisch bemaltes Juwel voller goldener Mosaike sind.
Er setzte sich in einen Sessel ans Fenster und winkte mir, ebenfalls Platz zu nehmen. »Ich nehme an, Sie kommen wegen der Griechischklasse«, sagte er.
»Ja.«
Seine Augen blickten gütig und offen; sie waren eher grau als blau. »Es ist schon ziemlich spät im Semester«, sagte er.
»Ich würde es gern wieder studieren. Es wäre schade, nach zwei Jahren damit aufzuhören.«
Er zog die Brauen hoch und betrachtete einen Augenblick lang seine Hände. »Ich höre, Sie sind aus Kalifornien.«
»Ja, das stimmt«, sagte ich ziemlich verblüfft. Wer hatte ihm das erzählt?
»Ich kenne nicht viele Leute aus dem Westen«, sagte er. »Ich weiß nicht, ob es mir dort gefallen würde.« Er schwieg und machte ein bekümmertes Gesicht. »Und was tut man in Kalifornien?«
Ich spulte meinen Vortrag ab. Orangenhaine, gescheiterte Filmstars, Cocktailstunden im Lampenschein am Swimmingpool, Zigaretten, Überdruss. Er lauschte und schaute mir dabei fest in die Augen, anscheinend gebannt von diesen hochstaplerischen Erinnerungen. Nie war ich mit meinem Märchen auf solche Aufmerksamkeit gestoßen, auf so eifrige Zuwendung. Er wirkte so absolut fasziniert, dass ich mich versucht fühlte, die Sache ein wenig mehr auszuschmücken, als vielleicht klug gewesen wäre.
»Wie spannend«, sagte er warmherzig, als ich, selbst halb euphorisch, schließlich fertig war. »Wie überaus romantisch.«
»Na, wir sind alle ziemlich daran gewöhnt da draußen, wissen Sie«, sagte ich und bemühte mich, ganz erhitzt von meinem brillanten Erfolg, nicht zu zappeln.
»Und was sucht ein Mensch mit einem romantischen Temperament in der Beschäftigung mit den klassischen Sprachen?« Er stellte diese Frage, als brenne er nun, da er einmal das Glück gehabt hatte, einen so seltenen Vogel wie mich zu fangen, darauf, meine diesbezüglichen Ansichten aus mir herauszuholen, solange ich in seinem Büro eingesperrt war.
»Wenn Sie mit ›romantisch‹ einzelgängerisch und in sich gekehrt meinen«, sagte ich, »dann sind Romantiker, glaube ich, häufig die besten Klassizisten.«
Er lachte. »Die großen Romantiker sind häufig gescheiterte Klassizisten. Aber darum geht es nicht, oder? Wie finden Sie Hampden? Sind Sie glücklich hier?«
Ich lieferte – nicht so kurz, wie sie hätte ausfallen können – eine Exegese der Umstände, weshalb ich das College zurzeit als für meine Zwecke zufriedenstellend empfand.
»Junge Leute finden es oft langweilig auf dem Land«, sagte Julian. »Was nicht heißen soll, dass es nicht gut für sie ist. Sind Sie viel gereist? Sagen Sie mir, was Sie hierhergezogen hat. Man sollte meinen, ein junger Mann wie Sie wäre außerhalb der Großstadt verloren, aber vielleicht sind Sie des Stadtlebens überdrüssig; ist das so?«
So gewandt und gewinnend, dass ich völlig entwaffnet war, führte er mich zügig von einem Thema zum andern, und ich bin sicher, dass es ihm in diesem Gespräch, das mir nur wenige Minuten lang zu sein schien, in Wirklichkeit aber viel länger war, gelang, alles aus mir hervorzuholen, was er über mich wissen wollte. Ich kam nicht auf den Gedanken, sein Interesse könne etwas anderem entspringen als tiefster Freude an meiner Gesellschaft, und während ich unversehens ganz offen selbst über persönliche Dinge sprach, war ich überzeugt, aus eigenem Antrieb zu handeln. Der einzige Punkt, in dem er nicht mit mir übereinstimmte (abgesehen von einer ungläubig hochgezogenen Braue, als ich Picasso erwähnte; als ich ihn besser kannte, war mir klar, dass er dies fast als persönlichen Affront hatte werten müssen), war das Thema Psychologie, die mich schließlich sehr beschäftigte, weil ich ja für Dr. Roland arbeitete und so weiter.
»Aber glauben Sie wirklich«, fragte er besorgt, »dass man die Psychologie als Wissenschaft bezeichnen kann?«
»Sicher. Was wäre sie sonst?«
»Aber schon Platon wusste, dass Herkunft und soziale Zwänge und all das eine unabänderliche Wirkung auf das Individuum haben. Mir scheint, Psychologie ist nur ein anderes Wort für das, was die Alten Schicksal nannten.«
»Psychologie ist ein schreckliches Wort.«
Er pflichtete mir energisch bei. »Ja, es ist schrecklich, nicht wahr?«, sagte er, aber wie seine Miene ahnen ließ, fand er es ziemlich geschmacklos, dass ich es überhaupt benutzte. »Vielleicht ist es in gewisser Hinsicht ein hilfreiches Konstrukt, um über eine bestimmte Art von Geist zu sprechen. Die Landmenschen hier in der Umgebung sind faszinierend, weil ihr Leben so determiniert ist, dass es wirklich von einer Art Fatum bestimmt zu sein scheint. Andererseits« – er lachte – »sind meine Studenten, fürchte ich, nie besonders interessant für mich, weil ich immer genau weiß, was sie tun werden.«
Ich war bezaubert von diesem Gespräch, und auch wenn es mir die Illusion vermittelte, ziemlich modern und weitschweifig zu sein (für mich ist es ein Kennzeichen des modernen Geistes, dass er es liebt, vom Thema abzukommen), sehe ich jetzt doch, dass er mich auf Umwegen immer wieder zu denselben Punkten führte. Denn wie der moderne Geist launenhaft und geschwätzig ist, so ist der klassische schmalgleisig, unbeirrbar, unnachgiebig. Es ist eine Art von Intelligenz, der man heutzutage nicht oft begegnet.
Wir unterhielten uns noch eine Weile und verstummten dann. Einen Augenblick später sagte Julian höflich: »Wenn Sie möchten, würde ich Sie mit Vergnügen als Schüler annehmen, Mr. Papen.«
Ich schaute aus dem Fenster und hatte halb vergessen, weshalb ich eigentlich da war, und jetzt glotzte ich ihn an und wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Aber ehe Sie annehmen, müssen Sie sich mit ein paar Bedingungen einverstanden erklären.«
»Nämlich?« Ich war plötzlich hellwach.





























