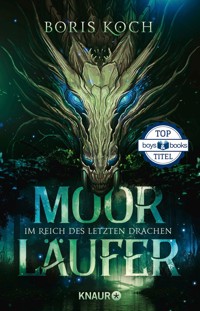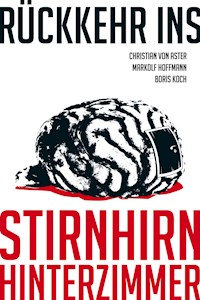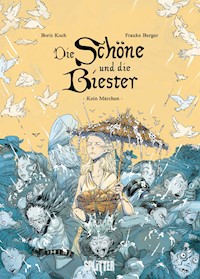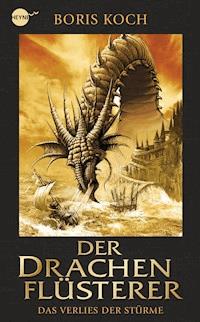
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Drachenflüsterer-Serie
- Sprache: Deutsch
Im fernen Großtirdischen Reich herrscht der mächtige Orden der Drachenritter. Geblendet von Aberglauben und Machtgier, unterjochen die grausamen Ritter die Drachen und machen sich ihre Magie zunutze. Dies sind die Abenteuer des jungen Ben, der die Fähigkeit besitzt, den Drachen ihre Flügel wiederzugeben und ihnen so die Freiheit zu schenken. Doch dadurch macht er sich Feinde, die gefährlicher sind, als er es sich je träumen ließ ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Der Drachenflüsterer Ben und seine Freunde sind Geächtete im Großtirdischen Reich und dem mächtigen Orden der Drachenritter nur mit Mühe in ferne Länder entkommen. Nun kehren sie zurück, um dem Orden die Stirn zu bieten und für die Wahrheit und Freiheit der Drachen zu kämpfen. Sie verschanzen sich im verlassenen Verlies der Stürme, einer uralten Festung auf einer kleinen Insel, die von gefangenen Winden geschützt wird. Nachts schleichen sie in die nahe Hafenstadt und hängen gefälschte Steckbriefe auf. Gemeinsam mit dem Händler Finta Dogha und dem Schiffsjungen Nesto, denen sie das Leben gerettet haben, verbreiten sie in den umliegenden Dörfern die Wahrheit über Drachen – denn Ben ist überzeugt, dass nur die Wahrheit den falschen Glauben des Ordens besiegen kann. Damit rütteln sie jedoch an den Grundfesten seiner Macht und fordern den Zorn der Drachenritter heraus. Sie werden gejagt – und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der Erste dem Orden in die Finger fällt …
Mit Der Drachenflüsterer – Das Verlies der Stürme führt Boris Koch seine Drachenflüsterer-Saga zu einem dramatischen Höhepunkt.
Boris Koch
Der Drachenflüsterer
Das Verlies der Stürme
Roman
Wilhelm Heyne Verlag
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Originalausgabe 3/2011 Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2011 by Boris Koch Copyright © 2011 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Für Claudia
PROLOG
Der Wind pfiff scharf über den Innenhof, als Akse das Kloster Sonnenflut zum ersten Mal betrat; in ihm konnte er das nahe Meer schmecken. Der Herbst war gekommen, und mit ihm sein fünfzehnter Geburtstag und der Rauswurf aus dem Kloster Dherrnschlag. Nun hatte sein Vater ihn hierhergeschickt, mit einem versiegelten Brief und der Drohung, ihn zu enterben und aus der Familie auszuschließen, wenn er erneut die nötige Disziplin vermissen ließe.
Voll Staunen betrachtete Akse die langen Stallungen, die ihren Ausmaßen zufolge mehrere Dutzend Drachen beherbergen mussten. Sonnenflut war um so vieles größer als Dherrnschlag, beeindruckender. Hier wollte er bleiben. Er schielte in alle Richtungen, ob er nicht einen Drachen sehen konnte, doch vergebens. Ihr Schnauben und Scharren vernahm er durch die offenen Fenster. Schon wollte er hinüberrennen, da erinnerte er sich wieder an die Worte seines Vaters und sein Versprechen, fügsam zu sein und zu tun, was von ihm erwartet wurde. Also ging er schnurstracks in das Hauptgebäude, wo der Abt ihn erwartete. Jetzt, und nicht in einer halben Stunde.
»So, so«, sagte der Hohe Abt Khelchos, nachdem er den Brief zweimal gelesen hatte. Er war ein älterer Mann mit lustigen Pausbäckchen und einem Lächeln auf den Lippen. Doch als er Akse musterte, lag in den Augen Strenge, fast schon etwas Unerbittliches. »Hier steht, du hast dir eine bunte Flickenhose angezogen, um wie dieser Samothanbeter Ben auszusehen, der überall gesucht wird, und hast deinen Kameraden verleitet, sich wie sein Verbündeter Yanko herzurichten. In dieser Aufmachung seid ihr quer durch Dherrnbruck gerannt. Was sollte das? Wärst du gern ein Samothanbeterr? Oder geächtet?«
»Nein, Herr!«, sagte Akse schnell. Hatte sein Vater nicht geschrieben, weshalb er es getan hatte? »Es war lediglich eine Mutprobe. Ich hatte mit anderen Knappen gewettet, dass ich …«
»Eine Wette, so, so«, unterbrach ihn der Hohe Abt scharf. »Du bist also der Ansicht, diese Steckbriefe sind für deine Belustigung da?«
»Nein, Herr.« Akse neigte demütig den Kopf. Disziplin und Gehorsam, er hatte es seinem Vater versprochen. Auf keinen Fall würde er hinausgeworfen werden, noch bevor der Abt ihn überhaupt angenommen hatte. Er musste schweigen, selbst wenn der ihm die Worte im Mund verdrehte.
»Gut.« Noch immer lächelte der Abt, und noch immer hatte das Lächeln seine Augen nicht erreicht. »Wenigstens scheinst du einsichtig. Dein Vater schreibt, du hast ein Problem mit dem Gehorsam, und bittet, ob ich mich nicht darum kümmern könnte. Das will ich gern tun, und ich hoffe, du willst das auch. Sag mir also frei heraus: Willst du Gehorsam lernen?«
»Ja, Herr.« Akse blickte den Abt möglichst treuherzig an. Er wollte Drachenritter werden, weil er auf so einem herrlichen Geschöpf sitzen und sich von ihm durch die Lande tragen lassen wollte, nicht um fraglos Befehle zu befolgen. Doch so schwer es ihm fiel, er würde sich um fügsames Verhalten bemühen. Wäre er irgendwann erst allein mit seinem Drachen unterwegs, war er frei und konnte tun und lassen, was ihm beliebte.
»Gut«, sagte der Hohe Abt. »Ich schulde deinem Vater noch einen Gefallen, und so werde ich dich hier aufnehmen und dir Gehorsam, ritterliches Pflichtgefühl und Demut beibringen. Ich werde nicht so schnell aufgeben wie der Abt von Dherrnschlag; bislang habe ich noch aus jeder Rotznase einen strammen Ordensritter geformt. Mit Geduld und den notwendigen Strafen. Hast du mich verstanden?«
»Ja, Herr.«
»Gut«, sagte der Abt zum dritten Mal. »Dann darfst du dich jetzt entfernen. Bruder Sieghold, zeig dem neuen Knappen sein Quartier.«
»Ja, Herr«, sagte einer der beiden Ritter, die während der Unterredung reglos an der Tür gewacht hatten.
»Noch etwas, Akse«, hielt ihn der Abt zurück. Das Lächeln war nun aus seinem Gesicht verschwunden. »Komm niemals auf die Idee, einen Kameraden zu solchen Verkleidungsspielchen wie in Dherrnbruck zu inspirieren. Wir sind nicht so verweichlicht wie sie. Wenn hier jemals ein solcher Ben auftaucht, wird er gehenkt. Sofort und mit dem größten Vergnügen. Mir ist es dann egal, ob es sich um einen falschen oder echten Samothanbeter handelt. Mit Hellwah und den Grundsätzen unseres Ordens wird kein Schindluder getrieben. Von niemandem. Hast du verstanden?«
ERSTER TEIL
WELLEN
GÜLDENES GESCHMEIDE
Du musst dich im Sprung nach links drehen, das hält die Seeungeheuer fern«, sagte Yanko.
»So ein Unsinn«, widersprach Ben sofort. »Das Wichtigste ist, dass man die Zehen spreizt. Auf keinen Fall zusammenkrallen, das lockt Seeungeheuer an wie ein fetter Wurm den Raubfisch.«
»Wer krallt denn schon die Zehen zusammen! Nur angstzitternde Bleichköpfe.«
»Schlafliedpfeifer.«
»Mäusemelker.«
»Nebenstraßenkriecher.«
»Flautenschlotterer.«
Die beiden Freunde standen auf einem nur zwei Hand breiten Sims mitten in einer hohen, senkrecht abfallenden Klippe und krallten die Finger in kleine Spalten. Ein gutes Dutzend Schritt in der Tiefe schwappte das leuchtend blaue Meer in sanften Wellen gegen den weißen Fels, über ihnen erstreckte sich die Klippe bestimmt weitere fünfzig oder sechzig Schritt. In den zahlreichen Rissen und Höhlungen nisteten hysterisch gackernde, weiß gefiederte Muschelelstern, brüteten ihre länglichen, grüngrau gesprenkelten Eier aus und ließen ab und zu hellen Kot in die Tiefe fallen.
»Bitte, nach dir«, sagte Yanko, der eben an der Schulter getroffen wurde, und nickte lächelnd hinab. »Mädchen zuerst.«
»Nein, nein, Säuglinge zuerst. Nach dir.« Ben erwiderte das Lächeln und dachte, dass es wirklich verdammt weit hinunter ging. Gestern waren sie nur halb so hoch geklettert. Eine leichte Brise pfiff an der Klippe entlang, brachte aber kaum Kühlung. Hier im Süden brannte die Sonne schon im Frühling unerbittlich heiß auf sie herab.
»Dämliche Drecksviecher, es langt!«, rief Yanko, der erneut von einer Ladung Muschelelsternkot getroffen wurde, diesmal auf den Kopf. Hastig wischte er sich mit der Hand durchs inzwischen lange dunkle Haar. Er hatte es wachsen lassen, während Ben seines weiterhin kurz schor, damit er nicht so aussah wie auf den Steckbriefen, und auch weil es Anula gefiel. Mit einem Triumphschrei sprang Yanko und drehte sich nach rechts, fluchte fürchterlich und ruderte mit den Armen, um die Richtung zu wechseln. Als wäre die Drehung nach links wirklich wichtig.
»Die Zehen!«, brüllte Ben ihm hinterher. Gerade hatte er dem Kerl doch noch gesagt, worauf es wirklich ankam, und jetzt machte er doch so ein Theater wegen der völlig unbedeutenden Drehung. »Pass auf die Zehen auf!«
Bevor Yanko reagieren konnte, schlug er mit zappelnden Gliedern auf dem Wasser auf und versank. Ben sah nur einen undeutlichen Schemen verschwinden, Gischt spritzte hoch, Wasser schwappte gegen die Bewegung der Wellen.
Yanko tauchte nicht wieder auf.
Ben stierte hinab, er konnte einfach nichts erkennen, immer neue Wellen rollten heran und die Zeit verrann. Er hoffte, dass Yanko nichts passiert war, dass er nicht auf einen Felsen geprallt oder von einem Ungeheuer geschnappt worden war.
Hoffentlich hatte Yanko noch rechtzeitig die Zehen gespreizt! Angst packte Ben, aber er konnte nicht springen und nachsehen; was, wenn Yanko genau in diesem Augenblick auftauchte? Er würde auf seinem Kopf landen und ihm den Hals brechen. Das wäre kaum hilfreich.
»Komm schon«, murmelte er und befürchtete jeden Moment, dass sich Blut auf den Wellen ausbreiten würde, aber ihr Schaum blieb weiß. Eine um die andere schlug gegen den Fels, angespannt begann Ben sie zu zählen. Eins, zwei, drei, vier … Das konnte doch nicht sein!
Endlich tauchte Yanko auf. Er prustete, ruderte wild mit den Armen und lachte, während Ben vor Erleichterung seinen Namen schrie.
»Tauch so tief du kannst!«, brüllte Yanko. »So tief du kannst. Und dann achte auf den Fuß der Klippe!«
»Mach ich!«, rief Ben und warf einen kurzen Blick zur Bucht hinüber, wo die vier Drachen in der Sonne lümmelten und die Mädchen im Sand saßen. Nicas blondes Haar leuchtete in der Sonne, Anulas helle Haut glitzerte wie ein zugefrorener Weiher; diese Spuren vom eisigen Atem des weißen Drachen waren ihr geblieben, auch wenn seine lähmende Kälte sie längst verlassen hatte. Die beiden sahen nicht herüber. Typisch Mädchen. Nichts bekamen sie mit, aber nachher wollten sie alles erzählt bekommen.
Lächelnd sprang Ben und spreizte die Zehen so weit er konnte. So weit, dass er einen Krampf bekam und sie zusammenkrallte, direkt bevor er auf dem Wasser aufschlug.
Fluchend riss er den Mund auf und schluckte Salzwasser, worüber er erneut eine Schimpftirade loslassen wollte und wieder Salzwasser zwischen die Zähne bekam. Er spreizte die Zehen wieder, presste die Lippen fest aufeinander und ließ sich in die Tiefe sacken. Als er langsamer wurde, stieß er mit Kopf und Armen nach unten und schwamm mit kräftigen Zügen weiter hinunter. Das Wasser drückte gegen seine Ohren, während er die Augen weit aufriss.
Schon nach wenigen Schritt erreichte er den sandigen Grund. Dort sah er sich hastig um, sein Herz schlug heftig, er wollte atmen, aber ganz sicher kein weiteres Salzwasser schlucken. Rasch entdeckte er das, was Yanko gemeint haben musste: eine etwa türgroße Höhle, die in den Fels führte. Dunkel war es dort drin, Ben konnte nicht weit hineinblicken, doch er glaubte, weit hinten einen schwachen Schimmer zu erkennen.
Als er sich wieder nach oben wenden wollte, sah er etwas Flaches, Metallisches von der Größe seiner Hand auf der Schwelle der Höhle liegen und griff danach. Dann wirbelte er herum und stieß sich vom Grund ab. Die Brust wurde ihm zusammengepresst, er brauchte dringend Luft. Japsend durchbrach er die Wasseroberfläche.
»Und?« Yanko saß auf einer Art Sims unter einem Überhang am unteren Rand der Klippe und grinste ihn an.
»Höhle«, keuchte Ben, für ganze Sätze hatte er noch keine Luft. Er wedelte mit dem Metallstück vor Yanko hin und her. »Davor.«
»Was ist das?«
»Weiß nicht«, schnappte Ben, und ließ sich auf das Sims helfen. Langsam drehte er seinen Fund in den Händen und klopfte ihn gegen den Stein. Schlamm und Rost tropften herab. Ben kratzte mit den Fingernägeln weiter daran herum, legte drei kleine kreisrunde Löcher frei, entdeckte geschwungene Verzierungen und eine Kante, von der etwas abgebrochen sein musste.
»Das ist ein Beschlag«, sagte Yanko. »Vielleicht der einer Tür …«
»Unsinn!« Ben schüttelte den Kopf. »Kein Mensch baut Türen unter Wasser. Die würden doch morsch werden und zerfallen.«
»Und nur der Beschlag übrig bleiben. Und was haben wir? Einen Beschlag, aber keine Tür.«
»Ach was! Der ist doch viel zu klein für eine Tür. Der ist höchstens von einer Truhe.«
Mit großen Augen starrten die beiden sich an.
»Eine Schatztruhe!«
»Genau! Von irgendeinem Handelsschiff, das im Sturm an der Klippe zerschellt ist.«
»Oder von einem Piratenschiff. Beladen mit unsagbaren Schätzen!«
Ben starrte seinen Freund an, schluckte und sagte mit belegter Stimme: »Ich hab da unten irgendetwas schimmern sehen.«
Yanko klappte der Kiefer nach unten. »Schimmern? Weißt du, was das heißt?«
»Ja. Wir sind reich!« Ben grinste. Er warf den alten Beschlag auf das Sims und rutschte unter dem Überhang hinaus, der ihnen Schutz vor dem sporadisch tropfenden Muschelelsternkot bot. Sie mussten wieder nach oben klettern, um ganz nach unten zu tauchen. »Piraten haben immer die allergrößten Diamanten. Abgesehen von Königen, versteht sich.«
»Kistenweise Gold und Geschmeide«, ergänzte Yanko und rutschte ihm hinterher.
»Ich werde Anula eine goldene, nein, güldene Kette bringen. Mit gleißenden Edelsteinen«, verkündete Ben feierlich und begann, die Klippe hinaufzukraxeln.
»Eine Kette?« Behände folgte Yanko ihm. »Eine Kette hat doch jedes Dienstmädchen, die Ketten kannst du meinetwegen alle haben. Nica bekommt von mir ein güldenes Diadem mit gleißenden, riesigen Edelsteinen.«
»Ach ja?« Ben kletterte schneller. Diesen unteren Teil waren sie schon mehrere Male hinaufgeklettert, er fand die passenden Ritzen und Vorsprünge inzwischen beinahe blind. »Dann nimm dir doch das erstbeste Diadem, das du findest. Anula kriegt dann eben eine kunstvoll geschmiedete Krone von mir.«
»Pah! Piraten haben keine Kronen«, knurrte Yanko und versuchte, Ben zu überholen. Wer zuerst oben war, konnte auch als Erster springen und sich die besten Schätze unter den Nagel reißen.
»Piraten rauben auch Prinzessinnen. Sie haben sehr wohl Kronen!«, keuchte Ben und zog sich weiter nach oben. Schweiß bildete sich auf seiner Stirn.
»Ach so, eine Prinzessinnenkrone meinst du. So eine will ich gar nicht, die sind ganz klein«, sagte Yanko abschätzig, während er ein Stück zurückfiel.
Ben war immer der bessere Kletterer gewesen, daheim in Trollfurt war er häufiger in die Berge gegangen, hatte dort die Einsamkeit und Ruhe gesucht, wenn er mal wieder von allen als Sündenbock durch die Stadt gejagt worden war. Oder zum Vergnügen, wenn auch nicht zu seinem. Unter dem Gackern der Muschelelstern und dem Rauschen der Wellen stieg er auf das hohe Sims, von dem sie eben gesprungen waren, machte Yanko Platz und wartete. Es war besser, gemeinsam zu tauchen – so eine Truhe voller Schätze war bestimmt schwer, und Yanko hatte ja eben auf die Kronen verzichtet. Sein Herz schlug schnell, als er sich vorstellte, wie Anula auf ein solch prunkvolles Geschenk reagieren würde. Staunen würde sie, lachen, ihn umarmen, küssen und … Er musste den Schatz einfach heben. Den schönsten Schmuck der Welt sollte sie bekommen.
Er blickte zu ihr hinüber, beobachtete, wie sie gemeinsam mit Nica am Ufer kauerte und irgendetwas aus dem Meer fischte. Wahrscheinlich Muscheln. Ben lächelte. Ja, Muscheln waren auch ganz hübsch, aber nichts im Vergleich zu einem Piratenschatz. Gar nichts.
»Kopfüber?«, fragte Yanko atemlos, der inzwischen neben ihm stand.
Ben starrte in die Tiefe. Das waren mehr als zwölf Schritt, mussten einfach mehr sein, bestimmt fünfzehn oder sechzehn. Weiß kräuselten sich die Wellen. Langsam nickte er, die Wendung unter Wasser kostete einfach zu viel Zeit und Schwung, und sie brauchten am Grund noch genug Luft, um in die Höhle zu tauchen.
»Dann auf drei.«
Gemeinsam zählten sie und sprangen. Vor Aufregung vergaßen sie, sich zu drehen oder die Zehen zu spreizen. Mit ausgestreckten Händen versuchte Ben, das Wasser zu teilen, damit er mit dem Kopf nicht allzu hart auftraf, dann tauchte er sofort mit aller Kraft in die Tiefe. Das Wasser um ihn war aufgewühlt von ihren schlagenden Beinen und Armen, er sah nichts, das Meer brannte in seinen Augen, und dann berührte er endlich den Grund und wirbelte Sand auf. Sofort glitt er am Boden entlang zur Klippe, nur keine Zeit und Luft verschwenden. Hinter sich spürte er Yanko, der ihm folgte.
Ben fand die Öffnung im Fels, zog sich hinein und stierte in die Dunkelheit vor sich. Das Wasser war hier ruhiger, doch kein Sonnenlicht drang zwischen die rauen, von verkrusteten Muscheln und Korallen überwucherten Wände, an denen er sich entlanghangelte. Trotzdem sah er ein schwaches Leuchten vor sich – dort musste der Schatz liegen. Wahrscheinlich war eine der Truhen aufgebrochen und das Gold darin so rein, dass es von allein schimmerte; Blausilber tat dies schließlich auch. Ben spürte, wie ihm die Luft knapp wurde, doch das Schimmern war so nah, jetzt würde er nicht aufgeben. Das Schimmern schien von einer Münze auszugehen, die einfach so im Wasser schwebte, ganz nah der rechten Höhlenwand. Sie musste sich irgendwo verfangen haben, an einer dünnen Alge hängen oder an einer vorspringenden Koralle.
Noch zwei Züge.
Noch einen.
Ben streckte die Hand aus. Die leuchtende Münze schwebte direkt neben einer dunklen Abzweigung von der Haupthöhle, gleich über einem Haufen bleicher Knochen, die halb vom Sand bedeckt waren. Dabei handelte es sich um große Knochen, keine kleinen Fischgräten. Noch bevor ihm recht bewusst wurde, was dort lag, packte ihn etwas am rechten Knöchel und zerrte ihn blitzschnell zurück. Ben wurde hin und her gewirbelt und traf mit der ausgestreckten Hand gegen den Fels, sodass ihm bohrender Schmerz in den Unterarm fuhr.
Yanko, knurrte er innerlich. Dieser vermaledeite Giergeier wollte unbedingt schneller beim Schatz sein als er. Doch das würde er nicht zulassen, er …
In diesem Moment schoss eine schuppige Fratze mit einem kopfgroßen, aufgerissenen Maul, in dem gewaltige spitze Zähne prangten, aus der dunklen Abzweigung und schnappte zu, nur eine Handbreit vor Bens Nase. Hervorquellende, perlmuttfarbene Augen stierten ihn kalt an.
Voller Panik schrie Ben los, was unter Wasser nur ein hilfloses Blubbern zur Folge hatte, schlug und trat um sich und kratzte der widerlichen Fratze über das rechte Auge, das sich glatt und kühl anfühlte, aber auch hart wie geschliffener Marmor. Hinter der Fratze schloss sich ein kurzer Hals an und daran ein salamanderartiger Körper mit verkümmerten, flossenartigen Vorderfüßen. Die Kreatur schlängelte zurück in ihren Abgrund, dann bleckte sie wieder die Zähne.
So schnell er konnte, zog sich Ben an den engen Felswänden Richtung Höhlenausgang, den Blick stur auf das lauernde Unwesen gerichtet. Dessen Augen schimmerten im Schein der schwebenden Münze, die Kiemen pumpten, doch es startete keinen weiteren Angriff.
Als er endlich den Ausgang der Höhle erreichte, war ihm vor Luftmangel so schwindlig, dass er sich kaum orientieren konnte. Seine Arme und Beine waren schwer und schwach. Doch Yanko hatte dort auf ihn gewartet, er packte ihn unter der Achsel und zerrte ihn mit nach oben. Zumindest hoffte Ben, dass Yanko noch wusste, wo oben war. Er selbst war sich nicht sicher, ließ sich einfach leiten.
Prustend tauchten sie kurz darauf auf. Ben schnappte nach Luft und schluckte just das Wasser einer heranrollenden Welle. Fluchend spuckte er aus und sog dann endlich herrlich frische Luft ein. Langsam zogen sie sich auf das untere Felssims.
»Danke«, sagte Ben kraftlos und atmete tief durch, wieder und wieder. Er zitterte.
»Keine Ursache.«
»Was, bei Samoths verlogener Zunge, war das?« Die kalten Augen und riesigen Zähne waren noch immer in seinem Kopf, das Herz schlug laut.
»Ein Münzmolch.«
»Ein was?« Das klang so albern, Ben hätte fast gelacht. Doch ihm war nicht nach Lachen zumute.
»Ein Münzmolch. Mein Vater hat mir davon erzählt, als ich kleiner war und immer nach Piratengeschichten gefragt habe. Ich saß auf dem Amboss und ließ die Beine baumeln, während er das Schmiedefeuer schürte. Da hat er gesagt, selbst die schlimmsten Piraten fürchten nur weniges so sehr wie den Münzmolch. Keiner weiß, woher er stammt und wo die Jungen schlüpfen, aber immer kriecht einer über den Meeresgrund herbei, wenn ein Schiff oder Boot gesunken ist. Mit den großen vorderen Pranken schleppt er gierig die Schätze in das nächste düstere Loch auf dem Grund und häuft sie auf, um darauf zu brüten. Hat er sich eingerichtet, hängt er eine einzige Münze als Lockmittel vor sein Versteck, am liebsten eine goldene. Diese befestigt er mit Hilfe eines besonderen Speichelfadens an einem Felsen oder an Korallen. Der getrocknete Faden ist unsichtbar und fest wie der eines Spinnennetzes. Also, übertragen, du musst dir eine entsprechend riesige Spinne vorstellen, der Körper groß wie ein Ochse oder gar eine Hütte. Dann leckt der Molch die Münze an, woraufhin sie von allein zu schimmern beginnt. Fortan wartet er auf neugierige Fische, die der Glanz anlockt, auf Krebse und anderes Getier, um diese zu verschlingen. Doch vor allem lauert er auf ahnungslose Schatzsucher; denn der Münzmolch ist ein Menschenfresser. Mit jeder Woche, die verstreicht, wachsen seine fürchterlichen Zähne, während die hinteren Pranken verkümmern, da er sie kaum noch braucht. Hat er einmal einen Schatz in Besitz genommen, bewegt er sich dort nicht mehr fort und wird zu einem verbiesterten, bissigen Gesellen, der seinen angehäuften Besitz bis auf den Tod verteidigt. In jedem anderen Wesen sieht er einen neiderfüllten Dieb, vor dem er seinen Schatz verbergen muss, obwohl er es ja selbst ist, der andere mit der schimmernden Münze anlockt.
Der Münzmolch sei ein Widerspruch in sich, hat mein Vater gesagt. Sein ständiges Misstrauen, seine Angst, jeder Fisch, Krebs und Mensch wäre ein Dieb, und die tiefe Dunkelheit seines Lochs dringen ihm unter die Schuppen, das ständige Warten macht ihn hungrig. Er liebt seinen Schatz und er hasst ihn, weil er ihn nicht fressen kann. Dabei kann der Schatz ebenso die Ladung eines gesunkenen, goldbeladenen Handelsschiffs sein wie auch drei mickrige Münzen, der steinlose Ring und die alte Angelschnur eines armen Fischers, der vom Sturm überrascht wurde und über Bord ging. Doch je größer der Schatz, desto größer der Molch.«
Noch immer angespannt starrte Ben Yanko an. Er machte ihm keinen Vorwurf, dass er ihn nicht gewarnt hatte, obwohl er von der Existenz derartiger Kreaturen gewusst hatte. In seinem Kopf war gar kein Platz für Vorwürfe, das Bild der großen, gierigen Fratze hatte sich ihm eingebrannt, und eigentlich wollte er nie wieder dort hinunter. Doch je größer der Molch, desto größer der Schatz, hatte Yanko gesagt, und für eine ordentliche Krone musste man seine Angst überwinden und in den meisten Erzählungen auch ein schreckliches Untier. Einen Schatz musste man erringen, davon war Ben überzeugt.
Noch einmal würde die Kreatur ihn nicht überraschen. Eilig sah er sich um und tastete auf dem Fels herum, als könne er hier eine passende Waffe in die Hand bekommen. Die Messer hatten sie dummerweise bei den Mädchen gelassen. »Dann müssen wir wieder runter. Der Bursche war riesig.«
»Nein.« Yanko lachte nervös. »Der war eher klein. Richtiges Geschmeide finden wir da nicht, höchstens ein paar Weinkrüge aus Bronze und eine Handvoll Münzen.«
»Bronze? Bronze ist eine Beleidigung für jeden echten Schatzjäger. Ich kann doch Anula keinen Bronzekrug schenken. Soll die sich den statt einer Krone auf den Kopf setzen, oder was? Eine Vierjährige könnte so Prinzessin spielen, aber Anula?«
»Das geht auf keinen Fall«, stimmte ihm Yanko zu. »Nica würde mich auslachen. Da findet man ja auf der Straße schöneres Geschmeide. Lass uns lieber ein paar Muscheln hochholen. «
»Ja, Muscheln sind hübscher als Bronzekrüge. Mädchen mögen Muscheln. Und daraus kann man auch Ketten machen. « Ben nickte und versuchte das Bild der geifernden Fratze aus seinen Gedanken zu vertreiben. Klein sollte dieser Münzmolch also gewesen sein. Dann müssten die großen ja die Ausmaße eines Drachen wie Aiphyron haben. Kein Wunder, dass sogar Piraten sie fürchteten. Auf jeden Fall hatte Yanko gesagt, Münzmolche verharrten in ihren Höhlen und warteten – er würde sie beim Muscheltauchen also nicht überraschen. Gut.
Gemeinsam ließen sie sich wieder ins Wasser gleiten und suchten den sandigen Grund ab. Schon bald hatte Ben eine schöne, münzgroße, fächerförmige Muschel gefunden, die im Sonnenlicht tiefblau glänzte.
»Meine ist größer«, sagte da Yanko und zeigte ihm eine schneckenförmige mit hellgrünen Spitzen, so dick wie eine Männerfaust.
»Pah«, knurrte Ben herausgefordert und sprang zurück ins Meer. Da fand er sicher eine noch größere.
Eine gute Stunde später waren sie sicher, dass sie den gesamten Grund in Reichweite abgesucht hatten, die Muscheln türmten sich hoch auf dem Sims. Und sie konnten sich nicht entscheiden, wer von ihnen die größere gefunden hatte. Bens Favorit war flach und beinahe rund, von schwarz-silbernen Ringen überzogen und groß wie ein Teller. Yanko hatte eine röhrenförmige, die grün-gelb-weiß gescheckt und lang wie ein Unterarm war. Länger als Bens Fund, aber schmaler. Nach einigem Hin und Her einigten sie sich auf Unentschieden, schließlich waren beide etwa gleich schwer. Dass beide Muscheln zu schwer und zu groß waren, um sie sich um den Hals zu hängen, spielte keine Rolle mehr. Die Mädchen würden sich dennoch freuen, am Strand der Bucht hatten sie sicher nichts Vergleichbares gefunden.
»Trotzdem ist das nur ein Anfang«, sagte Yanko. »Weißt du, für Mädchen muss man richtige Heldentaten vollbringen. Besonders für so schöne wie unsere.«
»Aber das haben wir«, protestierte Ben. »Wir haben sie beide gerettet. Erst Nica, dann Anula. Und wir haben Drachen befreit.«
»Das ist schon lange her.«
»Ein halbes Jahr, nicht viel länger.«
»Für Frauen kann das eine Ewigkeit sein.«
»Ach ja? Und wer sagt das? Yanko, der Kenner der tausend Frauen?«
»Das weiß man eben.« Herablassend sah Yanko Ben an. »Meine Mutter hat meinem Vater stets vorgeworfen, dass früher alles besser gewesen sei, als er ihr noch regelmäßig Schmuck geschmiedet hat. Und er hat dann gebrummt, sie solle sich nicht beschweren, sie habe jetzt ja alles, Ringe und Ketten und Ohrringe und Armreifen, und er könne sich jetzt doch wenigstens einmal einen gemütlichen Feierabend mit Freunden in der Wildsau leisten. Aber den alten Schmuck hat sie nicht gelten lassen, als würde er gammlig werden wie Käse oder Wurst, sie wollte neu beschenkt werden. Ich sage dir, Frauen kriegen nie genug.«
»Hm.« Ben erinnerte sich nicht an seinen verschollenen Vater, aber seine Mutter hatte diesem auch Jahre nach seinem Verschwinden jedes Mal Vorwürfe gemacht, wenn sie getrunken hatte. Und getrunken hatte sie jeden Tag. Aber genau genommen hat sie jedem Vorwürfe gemacht – auch Ben und jedem in Trollfurt, den Göttern und eigentlich der ganzen Welt.
»Doch, glaub mir. Gibst du ihnen eine Heldentat, dann wollen sie jeden Monat eine neue.«
»Und was machen wir jetzt?«, fragte Ben, der Anula auf keinen Fall verlieren wollte. Was, wenn Yanko recht hatte? Diesen Monat hatte er noch nichts Heldenhaftes vollbracht. Anula war wunderschön, sie konnte jeden haben, aber Ben wollte nicht, dass sie jeden hatte. Er wollte, dass sie bei ihm blieb.
»Na ja. Wir könnten einen Unschuldigen befreien, oder böse Monster oder schreckliche, menschenfressende Räuberhauptmänner töten. Oder auch legendäre Schätze finden. «
Ben dachte an den geifernden Münzmolch und daran, dass versunkene Schätze von seinen Artgenossen bewacht wurden. Er dachte daran, dass er Nicas Vater im Kampf getötet hatte und ihn das in zu vielen Träumen verfolgt hatte. Eigentlich wollte er nicht wieder töten. Zumindest keinen Menschen. »Ich kenne keinen Räuberhauptmann.«
»Ich auch nicht.« Yanko schnaubte und spuckte ins Meer.
»Dann lass uns doch Jungfrauen befreien. Jungfrauen erretten ist die heldenhafteste aller Heldentaten.«
»Und dann?«
»Was dann?«
»Was machen wir mit den Jungfrauen?« Yanko lachte kurz auf. »Die sind immer wunderschön und schrecklich dankbar, die können wir ja nicht einfach so mitnehmen, da würden uns Nica und Anula die Köpfe abreißen.«
»Stimmt. Aber vielleicht gibt es auch alte Jungfrauen? Solche, die einfach nur errettet und heimgebracht werden wollen? «
»Hm. Das klingt nicht …«
»Ja, schon gut.«
»Also ich finde, wir sollten das mit den Schätzen weiterverfolgen. Schätze an Land, die nicht von einem Münzmolch bewacht werden. So vollbringen wir Heldentaten und haben zudem noch Geschenke zum Mitbringen.«
FLASCHENPOST
Stolz überreichten Ben und Yanko ihre Muscheln und setzten sich neben Anula und Nica, ließen sich zum Dank küssen und klopften sich innerlich selbst auf die Schulter, während die Mädchen die außergewöhnliche Schönheit der beiden Geschenke lobten. Anula hob das helle Schimmern von Bens Muschel hervor, während Nica mal auf diese, mal auf jene Stelle im Muster von Yankos Geschenk deutete und sagte, wie einzigartig und hübsch die Farben gerade dort ineinandergriffen.
»Und sie sind ziemlich groß, oder?«, bemerkte Yanko schließlich.
»Richtige Brocken«, ergänzte Ben und verkniff sich die Frage, welche größer sei.
»Ja.« Nica nickte bedächtig und drehte ihre Muschel in den Händen. »Sie sind schon ein bisschen arg schwer, aber irgendwie können wir sie schon mitschleppen. Wäre schade, sie hierzulassen, sie sind ja wirklich schön.«
»Wir und mitschleppen ist gut gesagt«, mischte sich der Drache Aiphyron ein und blinzelte gegen die tief stehende Sonne. »Im Endeffekt landen die Dinger doch auf unseren Rücken. «
»Willst du jetzt etwa sagen, dass dir eine Muschel zu schwer ist?«, stichelte Ben.
»Nein, nein. So groß sind sie ja wirklich nicht. Weit im Westen gibt es Muscheln, die werden von den Menschen dort mit eigenen Kränen aus dem Meer gehievt und als eine Art Badewanne für die ganze Familie benutzt. Zwei kleine Kinder, die nicht schwimmen konnten, sind darin schon ertrunken. Das nenne ich groß.«
»Dann ist es ja gut, dass unsere so winzig klein sind.« Anula lächelte und strich Ben über die Wange. »Klein und wunderschön. «
Ben schwieg und knirschte mit den Zähnen. Das nächste Mal würde er ihr eben eine wirklich kleine Muschel mitbringen, damit sie sehen konnte, was winzig klein bedeutete.
Yanko wechselte das Thema und erzählte ausführlich, wie sie heldenhaft von der Klippe gesprungen waren, kopfüber und bestimmt aus zwanzig Schritt Höhe. »Zwanzig Schritt! Niemand aus Trollfurt hat das je gemacht.«
»Das war bestimmt sehr schön«, sagte Nica. »Aber wollt ihr gar nicht wissen, was wir gemacht haben?«
»Ähm, ich dachte, ihr habt hier einfach in der Sonne gesessen? «
»Auch.« Nicas Augen blitzten.
»Aber ihr seid nicht die Einzigen, die etwas gefunden haben«, bemerkte Anula.
»Na, dann zeigt uns eure Muscheln«, sagte Ben, auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, dass sie am Strand wirklich große gefunden hatten. »Die sind bestimmt auch wunderschön. Und auch leichter zu tragen.«
»Keine Muscheln. Wir haben das dort aus den Wellen gefischt. « Anula zeigte auf eine dreckige Flasche mit kurzem dickem Hals, die hinter ihnen im Sand lag. Algen klebten auf dem verkratzten, milchigen Glas. Ohne sie gründlich zu säubern, würde Ben auf keinen Fall daraus trinken wollen. Darüber hinaus war sie vollkommen leer.
»Ähm, ja, auch schön«, sagte Ben. Er fragte nicht, wie sie aus ihr eine schöne Kette machen wollten.
Yanko wirkte ähnlich ratlos. Doch er langte hinüber und nahm die Flasche in die Hand, schüttelte sie mit hochgezogenen Brauen, hielt sie gegen die Sonne und kniff ein Auge zu. Dann tat er, als würde er daran lauschen, und sagte gewichtig: »Scheint tatsächlich leer zu sein.« Grinsend roch er auch noch an der Öffnung und verzog das Gesicht. »Abgesehen vom Gestank.«
»Aber als wir sie aus dem Meer gefischt haben, war sie nicht leer.« Triumphierend schwenkte Nica ein Stück Pergament.
»Was bei Samoths stinkendem Atem ist das?« Yanko starrte sie an. »Zeig her!«
Auch Ben wurde von dem Fund völlig überrumpelt. War das etwa eine Schatzkarte? Hatten die Mädchen mit ihrer Strandhockerei mehr erreicht als sie beim Tauchen? Aufgeregt rutschte er zu Yanko hinüber. Nica legte das Pergament in den Sand. Es war keine Karte, sondern eine unverständliche Nachricht.
Ben hatte solche Schriftzeichen noch nie gesehen. Sie waren kantiger als die Buchstaben des Tirdischen und wurden dominiert von geraden Linien; nirgendwo fand sich ein geschwungener Schnörkel oder auch nur ein kleines Häkchen. Wuchtige Zeichen wie aus Fels gehauen.
»Auch wenn es keine Karte ist – meint ihr, das ist wenigstens die Wegbeschreibung zu einem Schatz?« Yankos Stimme klang nur halb so hoffnungsvoll wie seine Worte.
Ben schüttelte den Kopf. Üblicherweise handelte es sich bei einer Flaschenpost um einen Hilferuf, das wusste er aus zahlreichen Erzählungen, Piratengeschichten und Heldensagen. Vielleicht hatte sie ein unschuldig Gefangener aus seinem Verlies geworfen, in einen Fluss vor dem vergitterten Fenster, der ins ferne Meer mündete. Oder sie stammte von einem Schiffbrüchigen, der auf einer einsamen Insel irgendwo dort draußen festsaß und noch immer vom Pech verfolgt wurde. Ja, nicht nur verfolgt, geradezu verhöhnt! Wie unwahrscheinlich war es, dass eine solch winzige Flasche im riesigen Meer tatsächlich von irgendjemandem gefunden wurde? Dass sie an Land gespült und entdeckt wurde, bevor ein riesiger Fisch sie versehentlich schluckte oder sie an einer kantigen Klippe zerschellte? Dass sie von den Wellen in diese verlassene Bucht getragen wurde, just in jenem Moment, da sich hier vier Menschen aufhielten? Auf einen solchen Zufall zu hoffen, musste schwer sein.
Und nun kamen all diese glücklichen Umstände zusammen, doch keiner der Finder konnte die Schriftzeichen lesen. Alles war vergebens. Wenn der Absender das wüsste, würde er fluchen und heulen wie ein Klagewolf und sich die Haare raufen, dachte Ben, noch mehr als sowieso schon. Er müsste verzweifeln.
»Das ist bestimmt die Nachricht eines Schiffbrüchigen«, sagte Anula.
»Und wo ein Schiffbrüchiger ist, da ist ein Schiff gesunken«, sagte Yanko. »Und wo ein Schiff gesunken ist, da liegt ein Schatz. Immer. So einfach ist das. Eine solche Nachricht ist fast so gut wie eine Schatzkarte.«
»Oder er ist ein gefährlicher Meuterer, der niedergerungen und vom Kapitän und seiner getreuen Mannschaft ausgesetzt wurde. Dann ist da kein Schiff gesunken«, gab Ben zu bedenken.
Seit sie selbst Vogelfreie waren, konnte er jedoch jeden gut verstehen, der meuterte oder sich sonst wie zur Wehr setzte, insbesondere wenn es sich um ein Schiff des Ordens der Drachenritter handelte.
Doch bevor er weiter über Meuterer nachdenken konnte, tauchte plötzlich wieder das Bild eines gigantischen, geifernden Münzmolchs vor seinem geistigen Auge auf, und er war nicht mehr sonderlich erpicht darauf, einen versunkenen Schatz zu finden. Gegen einen vergrabenen Schatz auf der Insel selbst hätte er dagegen selbstverständlich nichts einzuwenden.
»Ach, was, Meuterer. Das ist bestimmt ein Schiffbrüchiger, dessen Insel von versunkenen Truhen geradezu umzingelt ist. Einem Meuterer geben sie doch keine Flasche und Feder und Pergament mit, wenn sie ihn aussetzen!« Aufgekratzt drehte sich Yanko zu den dösenden Drachen um. »He, Aiphyron, kannst du das lesen?«
»Nein, kann er nicht. Das haben wir ihn natürlich schon gefragt«, sagte Nica so spitz, wie es sonst nur Anula hinbekam. Die beiden Mädchen freundeten sich immer mehr an. »Auch die anderen drei. Wir haben nicht einfach nur so in der Sonne herumgesessen.«
»Hab ich doch nie gesagt«, brummte Yanko.
»Ach nein?«
»Zumindest hab ich es nicht so gemeint.«
»Dann ist es ja gut.«
Ben starrte aufs Meer hinaus und versuchte zu erkennen, woher die Wellen kamen. Irgendwo dort draußen lag eine Insel, auf der vielleicht ein Schiffbrüchiger oder Meuterer festsaß, einsam und ausgehungert. Seit Wochen oder Monaten, vielleicht gar seit Jahren. Der dieser Flasche nachgestarrt hatte, die all seine Hoffnungen über die Wellen mit sich trug. Der seither täglich den Horizont absuchte, ob sich nicht endlich ein Segel und somit Rettung zeigte.
Ben blickte zu der kleinen zerkratzten Flasche, die neben Yanko im Sand steckte, und dann wieder auf das Meer hinaus. Er empfand Mitleid mit diesem Fremden, der so ganz andere Schriftzeichen verwendete, und wollte ihm helfen. Es müsste doch ein Leichtes sein, mit den Drachen dort hinzufliegen und ihn zu retten! Sie konnten jeden Tag Entfernungen zurücklegen, für die ein Schiff eine gute Woche oder noch länger benötigte. Irgendwie müssten sie herausfinden können, welchen Weg die Flasche genommen hatte, wenn sie schon die Nachricht nicht entziffern konnten. Einen Schiffbrüchigen zu retten, galt sicher auch als Heldentat. Und wenn sich Yanko dann noch mit den Münzmolchen anlegen wollte, sollte er das doch tun. Ben würde Anula mit der Errettung eines Verhungernden beeindrucken, das war heldenhaft genug. Jedenfalls, solange Yanko nicht vor ihm eine güldene Krone fand.
»Ich weiß nicht, woher die Wellen kommen«, sagte Anula, als könne sie seine Gedanken lesen, und legte den Kopf auf Bens Schulter. »Wir haben die Flasche nicht kommen sehen, nur auf der letzten Welle torkeln.«
Ben nickte. Vielleicht könnten sie hoch oben in der Luft die Meeresströmungen erkennen, vom Rücken eines Drachen aus sehen, woher die Flasche gekommen sein musste.
In den letzten Monaten hatten sie nichts anderes getan, als von einem schönen Ort zum anderen zu fliegen, je weiter weg vom Großtirdischen Reich, desto besser. Aiphyron, der von allen am weitesten herumgekommen war, hatte ihnen den Roten Wasserfall von Algone im Sonnenaufgang gezeigt, wenn das Wasser weithin leuchtete wie eine Feuersäule, und bei einer steifen Brise die Singenden Klippen am Ende einer Meeresenge, deren Name Ben schon wieder vergessen hatte. Einen gigantischen Baum, dessen Wipfel fast so ausladend war wie halb Trollfurt. Seine violetten, handförmigen Früchte schmeckten süßer als alles, was Ben bisher gegessen hatte, und jeder Finger doch ein wenig anders.
Sie waren weit im Süden gewesen, in Ländern, in die sich der Sommer zurückzog, wenn in Trollfurt Winter herrschte. Länder, in denen die Bauwerke und Trachten der Menschen völlig fremd waren. Seinen sechzehnten Geburtstag hatte Ben auf dem Gipfel der Himmelsklippe gefeiert, einem riesigen Berg mit senkrechter Nordwand, auf dem der Drache Kaedymia herangewachsen war. Sie hatten oben gesessen, die Beine über eine Felskante baumeln lassen und den Sonnenuntergang beobachtet. Dann waren sie im Sturzflug in die Nacht gestürmt. Kurz hatten sie sogar das Land besucht, in dem ewiges Eis herrschte und das tatsächlich so schön war, wie Aiphyron geschwärmt hatte, doch auch fürchterlich kalt, viel zu kalt für Anula.
Vieles hatten sie seit ihrer Flucht gesehen, sich beinahe täglich neue Ziele gesucht, waren einfach ihren Launen und den Winden gefolgt. Nur die Städte hatten sie stets gemieden und darauf geachtet, anderen Menschen aus dem Weg zu gehen, weil sie nicht in die Fänge des Ordens geraten wollten, der auf sie ein Kopfgeld ausgesetzt hatte und allen Drachen die Flügel abschlug, um sie zu gefügigen, sprachlosen, an den Boden gefesselte Kreaturen zu machen.
Wenn sie also sowieso keine genauen Pläne hatten, warum sollten sie da nicht nach einer Insel suchen, auf der jemand festsaß, und ihn retten?
Als er es vorschlug, war niemand dagegen, und Anula drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Vielleicht war das nur eine späte Entschuldigung dafür, dass sie seine Muschel klein genannt hatte, aber wahrscheinlich hatte Yanko recht: Mädchen wollten Jungen, die immer neue Heldentaten vollbrachten. Gut, dass er das jetzt wusste. Er würde nie wieder aufhören mit den Heldentaten.
Als die Sonne kurz darauf den Horizont berührte und sich der Himmel rot färbte, forderte Yanko den schilffarben geschuppten Drachen Juri zu einem Wettschwimmen heraus, wie er es seit zehn Tagen jeden Abend getan hatte. So sehr sich Yanko auch anstrengte – auch diesmal zog der Drache mühelos davon und gewann mit zwei Körperlängen Vorsprung. Seinen gewaltigen Körperlängen, nicht denen eines fünfzehnjährigen Jungen. Er war am Wasser geboren, es war sein Element, aber als Yanko prustend und keuchend an den Strand torkelte, schwor er, eines Tages werde er ihn schlagen. Juri ließ ein amüsiertes Schnauben hören und verzichtete ganz auf seine üblichen ausufernden Ausführungen darüber, warum dies nie geschehen werde.
Dann suchten sich die beiden Paare jeweils ein abgeschiedenes Plätzchen und zogen sich zurück, während die Drachen weiterdösten oder im letzten Tageslicht über das Meer flogen und nach Fischen schnappten, die sich an die Oberfläche wagten.
Stunden später lag Ben noch immer wach, an Anulas Rücken gekuschelt und den Arm auf ihrer Schulter, so wie sie es mochte. Seit sie Gefangene des Ordens gewesen war und der Eishauch eines weißen Drachen sie berührt hatte, hungerte sie nach jedem Sonnenstrahl und nach menschlicher Wärme, auch wenn die Kälte des Drachen längst aus ihrem Körper verschwunden war – wenn auch noch nicht aus ihren Gedanken und Träumen. Sie schlief besser, wenn sie wusste, dass jemand über ihren Rücken wachte, und sie wollte, dass Ben dieser Jemand war. Niemandem sonst erzählte sie von der Kälte in sich, sie hielt sie für eine Schwäche, und Schwächen gab man nicht zu.
Eine widerspenstige Locke kitzelte Ben in der Nase, aber das war es nicht, was ihn am Einschlafen hinderte. Anula atmete regelmäßig und ruhig, und auch er schreckte seit vielen Nächten nicht mehr aus Albträumen hoch. Die Bilder von Nicas Vater, den er im Kampf getötet hatte, um sie vor dem rituellen Opferpfahl zu retten, machten ihm seltener zu schaffen als noch vor Monaten. Auch plagte ihn schon lange nicht mehr jede Nacht die Angst, der Orden der Drachenritter könnte ihn aufspüren. Fern des Großtirdischen Reichs hatten sie alle mit jeder ruhigen Nacht diese Angst weiter abgestreift; Ben fühlte sich nicht mehr wie ein Gejagter.
Und doch lag er nun wach und starrte in einen Himmel, in dem er zwar die meistern Sterne von daheim kannte, doch sie standen an ungewohnter Stelle. Über dem Meer bildete eine Gruppe von neun hellen Sternen ein Gesicht, das er in Trollfurt nie gesehen hatte.
Er dachte an seine Heimatstadt am Fuß des Wolkengebirges, an seine verhasste, trinkende Mutter, die ihn oft geschlagen hatte und schließlich in den Dherrn gesprungen und ertrunken war, an die heiligen Spiele in Chybia und wie sie dem Orden ein ums andere Mal entkommen waren. Daran, wie sie Anula und den Drachen Marmaran aus dem Kloster mit den zwölf Zinnoberzinnen befreit hatten. An den schwelenden Bürgerkrieg zwischen Ordensrittern und Ketzern, die sich selbst Freiritter nannten und doch kein bisschen besser zu Drachen waren, denn sie hielten sie für Geschöpfe Samoths, die unterdrückt werden mussten, und schlugen ihnen ebenso die Flügel ab wie der Orden. Die gleiche Handlung, nur zwei unterschiedliche Lügen als Rechtfertigung und Begründung. Und er dachte an den Münzmolch, der unter der Klippe dort drüben lauerte.
All das war weit weg. Endlich.
Endlich hatte er geschafft, dies alles hinter sich zu lassen, die Bilder der gehenkten Ketzer vor Vierzinnen und die der zusammengepferchten flügellosen Drachen im Kloster mit den zwölf Zinnoberzinnen plagten ihn nicht mehr. Er dachte kaum noch daran, nur eben jetzt. Und immer dann, wenn er sich bewusst machte, dass er nicht mehr daran dachte.
Verdammt!
Er verabscheute die Erinnerung an Drachen, denen er nicht hatte helfen können.
Tief atmete er durch und zwang sich zu anderen Gedanken. An die Flaschenpost und den Schiffbrüchigen, der irgendwo dort draußen auf Hilfe hoffte. Vielleicht war er längst gerettet oder verhungert, von wilden Tieren gefressen oder ertrunken beim verzweifelten Versuch, an eine Planke geklammert nach Hause zu paddeln. Ben wusste nicht, wie er aussah, doch er hatte sich ihn in den letzten Stunden immer wieder vorgestellt, dürr und verdreckt und ausgelaugt und voller Schrammen.
Warum hatten gerade sie die Flaschenpost gefunden? War das Vorsehung, ein Zeichen? War es eine ihnen auferlegte Aufgabe, ihm zu helfen?
Ihn ärgerte, dass er die Nachricht nicht entziffern konnte, dass er auf Mutmaßungen angewiesen war, von wem und woher die Flasche stammte.
Hatte ihn das wach gehalten?
Die Überzeugung, dass irgendwo dort draußen jemand darauf hoffte, von ihnen gerettet zu werden? Dabei kannte er ihn doch gar nicht. Aber wie sollte derjenige denn auf seine Verwandten und Freunde zählen, wenn diese keine Nachricht von seiner Not hatten?
Langsam löste sich Ben von Anula und hob den Kopf, musterte ihr Gesicht mit den vollen roten Lippen, das auch im Mondlicht schimmerte wie von Eis überzogen. Eine widerspenstige Haarsträhne hing ihr quer über die Nase. Obwohl sie zwei Jahre älter war, wirkte sie im Schlaf so klein und verletzlich. Das war sie nicht, natürlich nicht, aber sollte der Orden sie ein weiteres Mal in die Hände bekommen, würde ihr all ihre Stärke nicht helfen. Jeder Mensch konnte gebrochen und getötet werden. Ben wollte sie küssen, doch zugleich wollte er sie nicht wecken, also ließ er es sein.
Leise schlüpfte er unter der Decke hervor und erhob sich. Anula brummte irgendetwas, schlief aber weiter, und Ben schlenderte zu Aiphyron ans Meer hinüber.
Der Drache maß an die fünfzehn Schritt, und seine blauen Schuppen wirkten im Licht des Halbmonds viel dunkler als am Tag, kaum heller als der nächtliche Himmel, nur dass die Gestirne fehlten. All die feinen, an Granit erinnernden Konturen wurden von der Dunkelheit geschluckt. Als Ben noch zwei Schritte entfernt war, schlug Aiphyron die leuchtend blauen Augen auf.
»Kannst du auch nicht schlafen?«, fragte Ben.
»Ich hab tagsüber zu viel gedöst, außerdem schlafe ich doch nie tief. Aber was hält dich wach?«
»Ich weiß es nicht.« Ben strich dem Drachen freundschaftlich über die Schnauze und setzte sich vor ihm in den Sand. »Glaubst du wirklich, wir können den Weg der Wellen zurückverfolgen und den Ort finden, von dem die Flasche gekommen ist?«
»Ich kann es dir nicht versprechen, wir können es nur versuchen. Ist dir das so wichtig?«
»Seltsam, nicht wahr?« Mit der Rechten grub Ben eine Muschel aus dem Sand und schleuderte sie wie einen flachen Stein aufs Meer hinaus. Sie sprang nicht ein einziges Mal auf, sondern tauchte sofort mit einem Platschen ins Wasser und versank. »Glaubst du an Schicksal?«
»An Schicksal?«
»Ja. Schicksal, Vorsehung, was auch immer. Glaubt ihr Drachen daran? Wir Menschen tun es eigentlich, aber wir sollen auch glauben, dass man Drachen die Flügel abschlagen muss, um sie von einem Fluch zu befreien, und das ist Unsinn, und darum weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ist es ein Wink des Schicksals, dass wir diese Flaschenpost gefunden haben, oder nur ein dämlicher Zufall? Hätte sie auch jeder andere finden können, der rein zufällig hier entlanggeschlendert wäre, oder war sie für uns bestimmt? Sind wir dazu ausersehen, diesen Schiffbrüchigen zu suchen, auch wenn wir seine Nachricht gar nicht lesen können?«
»Macht das denn einen Unterschied?«
»Ja. Natürlich.« Ben krallte die Hand wieder in den Boden, fand jedoch nur kühlen, feuchten Sand. Mit Schwung schleuderte er ihn weit hinaus ins Meer. »Ich weiß es nicht. Darum frage ich dich ja.«
»Ich glaube, einem Schiffbrüchigen ist es vollkommen egal, ob er zufällig gerettet wird oder von einem, der es für sein Schicksal hält. Hauptsache, er wird gerettet. Es spielt keine Rolle, ob du die Botschaft durch Zufall oder schicksalhafte Absicht erhalten hast. Es geht nur darum, was du mit dem neuen Wissen machst.«
»Welches Wissen denn?«, brummte Ben. »Neues Wissen hätte ich, wenn ich die rattenbolligen Buchstaben lesen könnte. Aber das kann ja keiner. Dabei dachte ich, du sprichst alle Sprachen.«
»Aber ich lese keine einzige. Und das mit dem Sprechen ist so auch nicht …«
»Ja, schon gut. Ich wollte ja nur wissen, ob das Schicksal hier eine Aufgabe für mich hat.«
Schweigend sah Aiphyron ihn an, dann sagte er: »Hast du eigentlich in Trollfurt alles getan, was deine Mutter von dir verlangt hat?«
»Was? Wieso …?« Was kümmerte ihn jetzt seine Mutter? Warum konnte Aiphyron einfach nicht beim Thema bleiben? »Nein, natürlich nicht.«
»Und hast du stets das gemacht, was der Priester verlangt hat?«
»Nein, aber …«
»Und das, was all die Jungen erwartet haben, die dich immer wieder durch die Straßen gejagt haben?«
»Nein! Was denkst du denn, weshalb sie mich gejagt haben? «
»Gut.« Der Drache lächelte. »Wenn es also wirklich so etwas wie Schicksal, Vorhersehung und Prophezeiungen geben sollte, warum solltest du denn dann tun, was sie von dir erwarten, wenn du es bei sonst niemandem tust?«
»Weil … weil …« Ben schüttelte den Kopf. Das konnte man doch nicht vergleichen! Das war etwas ganz anderes, das war … Zögerlich zuckte er mit den Schultern und begann unsicher zu grinsen. »Weil das Schicksal viel … nun ja, viel mächtiger ist?«
»Aha.« Aiphyron verzog den lippenlosen Mund. »Du willst dich also einfach nur den Mächtigen beugen?«
»Nein! Verdammt, nein!« Warum verdrehte ihm der Drache einfach die Worte im Mund? Er hatte sich doch auch nicht vor dem mächtigen Orden der Drachenritter gebeugt, der dämliche Schuppenkopf wusste das doch! Das war einfach etwas anderes, das war … Aber Ben konnte nicht richtig fassen, wo der Unterschied lag, und brachte kein Wort heraus.
»Dachte ich mir. Dann musst du wohl einfach selbst entscheiden, was du tun willst.«
»Was wir tun, haben wir doch längst entschieden«, knurrte Ben. Darum ging es ihm nicht, er wollte nur verstehen, warum er den Schiffbrüchigen und die Flasche nicht aus dem Kopf bekam. Warum er nicht schlafen konnte.
»Selbst wenn es Schicksal wäre, dann wäre es nicht deines«, sagte Aiphyron. »Sondern das von Anula. Schließlich hat sie die Flasche gefunden.«
»Aber damit wäre es auch meines«, sagte Ben und erhob sich wieder. Das war etwas, das Drachen nur schwer verstanden. Sie wurden aus der Welt heraus geboren, wuchsen in der Erde, im Fels, in Bäumen oder auf dem Grund des Meeres heran. Sie hatten keine Eltern, kannten keine Liebe. Auch wenn sie sehr wohl wussten, was Freundschaft war, waren sie im Kern Einzelgänger.
VON INSEL ZU INSEL
Sicher, dass die Muschel nicht doch zu schwer ist?«, neckte Ben Aiphyron und schwang sich auf seinen Rücken, kaum dass die Sonne zwei Handbreit hoch am Himmel stand.
Die Muschelelstern der Klippe gackerten laut und wild durcheinander, letzte Beschimpfungen der Eindringlinge zum Abschied. Eine leichte Brise wehte über das Meer herein, und das hieß, die Wellen stiegen ein wenig höher als gestern, ihre weißen Schaumkronen waren leichter zu sehen.
»Wenn mir meine Last zu schwer wird, werf ich einfach überflüssigen Ballast runter«, entgegnete Aiphyron. »Dich wahrscheinlich. Ich weiß ja, dass die Muschel Anula gefällt, die bring ich schon heil ans Ziel.«
»Danke.« Anula saß bereits auf den Schultern des moorschwarzen Marmaran und lachte. »Dann habe ich wenigstens ein letztes Andenken an den armen, in die Tiefe gestürzten Ben.«
»Das könnt ihr vergessen. Wenn ich stürze, dann reiß ich die Muschel mit hinab.« Lachend klemmte Ben die Knie unter zwei Halsschuppen, um genügend Halt zu finden.
»Wieso trage eigentlich ich Anulas Muschel?«, fragte Aiphyron und sah Marmaran an. »Sie sitzt immerhin auf deinem Rücken.«
»Ich habe Ben überzeugt, ein Kavalier zu sein und das schwere Ding für seine Freundin zu tragen.«
»Wie nobel von dir. Du lernst menschliches Verhalten erstaunlich schnell.« Aiphyron schnaubte und sprang in die Höhe, breitete die Schwingen aus und erhob sich mit kräftigen Flügelschlägen in die Luft.
Der Wind pfiff durch Bens kurzes Haar und ließ sein dünnes Hemd flattern, dessen Ärmel er weit hochgekrempelt hatte. Egal, wie oft Ben inzwischen schon geflogen war, jedes Mal fühlte er sich wieder frei und leicht und glücklich wie beim ersten Flug, nur dass ihm nicht mehr übel wurde von all dem Auf und Ab.
Es war, als würde er alle schweren Gedanken und Ängste am Boden zurücklassen. Er konnte nicht anders, er schrie seine Freude gegen den Wind hinaus und hörte schwach die Rufe seiner Freunde, die hinter ihm verweht wurden. Dann beugte er sich vor und klammerte sich ganz an Aiphyron, um dem Wind weniger Angriffsfläche zu bieten. Den Kopf hielt er dabei so, dass er aufs Meer hinabsehen konnte. Hell glitzerte die Sonne auf jedem Wellenkamm, darunter war das Wasser von einem tiefen Blau, durch das hie und da ein Schatten huschte. Ben konnte nur die grobe Richtung der Strömung erahnen, und nicht einmal dessen war er sicher. Endlos schien sich das Meer in alle Richtungen auszubreiten, von überall rollte es heran. Wie sollten sie hier dem Weg einer winzigen Flasche folgen?
»Meinst du, der Wind ändert die Richtung der Wellen?«, rief er Aiphyron ins Ohr.
»Ich habe keine Ahnung.«
»Weißt du denn wenigstens, wo wir ungefähr hinmüssen? «
»Ganz ungefähr. Aber Juri kennt sich mit Wasser viel besser aus.«
Der am Wasser geborene Drache flog neben ihnen und hatte den Blick stur nach unten gerichtet. Nun zog er an ihnen vorbei, machte einen leichten Bogen nach links und hielt diese Richtung minutenlang bei. Dann stürzte er hinab, während die anderen die Höhe hielten, raste direkt über der Wasseroberfläche entlang, bis er plötzlich mit schlagenden Flügeln in der Luft verharrte und die hintere rechte Klaue ins Meer hielt, als wolle er die Temperatur prüfen.
Oder den Verlauf der Strömung.
Langsam nahm er wieder Geschwindigkeit auf und änderte die Richtung erneut ein wenig. Noch einmal senkte er kurz eine Klaue ins Meer, dann gesellte er sich zu ihnen in der Höhe, um eine halbe Stunde später wieder in die Tiefe zu stürzen und den ganzen Kopf im Meer zu versenken. Als sie nach oben kamen, hatte er zwar keine Richtungsänderung vorgenommen, aber drei Fische verschlungen, und Yanko war vollkommen durchnässt und beschimpfte den Drachen vergnügt.
Auf diese Weise legten sie Meile um Meile zurück. Ben wusste längst nicht mehr zu sagen, welchen Wellen sie folgten, eine sah aus wie die nächste, doch Juri klang zuversichtlich, dass sie nicht weit vom Kurs der Flasche entfernt sein konnten: »Natürlich weiß ich nicht, welche Stürme oder Meerestiere ihren Weg noch beeinflusst haben, aber die ungefähre Richtung stimmt. Sollten wir drei Meilen rechts oder links vom Kurs abkommen, so sehen wir eine mögliche Insel von hier oben immer noch.«
Kurz nach Mittag entdeckten sie tatsächlich ein Dutzend schwarzer Klippen, die wie riesige grobe Säulen aus dem Meer ragten.
Die Drachen landeten, um sich einige Augenblicke auszuruhen. Dann aßen die vier Menschen vom Proviant, während sich die Drachen frische Fische fingen. Aiphyron beschimpfte einen leuchtend roten Fisch mit gelber Rückenflosse als widerlichen Feuerfisch, hakte nach, ob er wirklich einer sei, und als der Fisch stumm blieb, schleuderte er ihn wieder ins Meer, um sich einen anderen zu krallen, einen mit silbrig grauen Schuppen.
Keinen kümmerte das, denn inzwischen hatten sich auch Anula und Marmaran längst an diese kurzen Anfälle Aiphyrons gewöhnt, in roten Tieren Feuerwesen zu vermuten. Zudem waren sie seltener geworden. Auf keiner der Klippen ließ sich irgendein Anzeichen finden, dass hier je ein Mensch gewesen war; die spärlichen Überreste von drei verlassenen Vogelnestern in drei Spalten waren die einzigen Anzeichen von Leben. Nach einer Weile flogen sie weiter.
Als er den Proviant aus dem Rucksack gezogen hatte, war Ben auch wieder einmal das Blausilber in die Hände gefallen, das er seit ihrer Flucht aus Trollfurt mit sich herumschleppte. Egal, wie wertvoll es war, sie hatten es bislang nicht verkauft, denn der Orden stellte daraus die Schwerter her, mit denen er den Drachen die Flügel abschlug. Aus keinem anderen Metall ließen sich derart scharfe Klingen schmieden, und der Orden besaß schon mehr als genug Waffen. Wem sie die groben Brocken auch verkaufen mochten, er würde sie mit Sicherheit an den Orden weiterverscherbeln. Und da Ben dies nicht wollte, trug er es seitdem mit sich herum.
Mehrmals hatte er daran gedacht, daraus Schmuck für Anula schmieden zu lassen, weil poliertes Blausilber diesen wunderschönen Schimmer besaß. Doch er wusste, sobald der Orden eine solche Kette oder Ringe oder Armreifen in die Finger bekam, würde er alles ohne Zögern einschmelzen und zu Waffen verarbeiten, um sie gegen geflügelte Drachen einzusetzen. So wie er es bei den vier getan hatte, mit denen Ben jetzt flog. Er war ein Drachenflüsterer, seine Gabe befähigte ihn, Drachen zu heilen, indem er ihnen die bloßen Hände auflegte. Wie konnte er da dazu beitragen, dass sie verstümmelt wurden?
Ben spuckte aus, er verabscheute den Orden und seine Taten im Namen des Sonnengottes Hellwah. Irgendwo würde er sicher besonders gleißende Edelsteine und Gold und Silber auftreiben, aus denen er Anula außergewöhnlichen Schmuck machen lassen konnte. Oder er würde doch noch einen Piratenschatz finden. Aiphyron war sein Freund, er würde ihm sicher gegen den Münzmolch helfen, wenn dieser nicht in einer so engen Höhle wie unter der Bucht lauerte.
Langsam zog Ben einen faustgroßen Brocken Blausilber aus dem Rucksack, der wie eine Art Satteltasche über den Drachen geschnallt war und hinter Bens rechtem Bein baumelte, während links zwei Decken und das Kochgeschirr hingen. In der Sonne strahlte das Blausilber hell und schimmerte. Sein verschollener Vater hatte in einer Mine gearbeitet, und damals war Ben bestimmt schrecklich stolz auf ihn gewesen, doch er erinnerte sich nicht mehr. Schließlich hatte er früher auch Drachenritter werden wollen.
»Verdammte Lügen«, murmelte er und ließ den Brocken fallen. Sie flogen so hoch, dass er den Aufschlag im Meer nicht hören konnte.
»He! Was tust du da?«, rief Yanko, der neben ihm flog. »Ich wollte daraus Schmuck für Nica machen!«
»Aus meinem Anteil?«, brüllte Ben, obwohl sie das schwere Metall wegen des hohen Gewichts auf alle Rucksäcke verteilt hatten, nicht nach Anteilen. »In deinem Kopf nistet doch ein Schrumpfwurm! Außerdem hatte ich die Idee lange vor dir! Aber ich hab sie verworfen, weil …«
»Du wolltest Schmuck für Nica machen?«, mischte sich da Anula ein, die mit Marmaran plötzlich über ihm auftauchte. Sie beugte sich tief über den Drachenhals hinab und klang gar nicht erfreut.
»Nein! Nicht Nica, dir!«
»Aha! Aber jetzt wirfst du das Blausilber doch lieber ins Meer? Gönnst du den Fischen wohl mehr als mir?«
»Und was ist mit Nica?«, hakte Yanko nach. »Wenn du schon Anula …«
»Ja, was ist mit mir?« Nica hatte ihren Namen gehört und mit Feuerschuppe aufgeschlossen.
»Ben wirft gerade unseren Schmuck ins Meer«, erklärte Anula.
»Was?«
»Ich werfe Blausilber ins Meer! Blausilber, verdammt! Keinen Schmuck!« Wütend zerrte er noch einen Brocken aus dem Rucksack und schleuderte ihn hinab. »Daraus macht man keinen Schmuck, sondern Waffen, die die Schuppen von Drachen durchdringen können. Ich will nicht, dass das irgendwie dem Orden in die Hände fällt!«
»Niemand von uns will dem Orden in die Hände fallen, weder mit noch ohne Schmuck.«
»Trotzdem hatten sie uns alle schon gefangen! Wäre das Blausilber nicht bei den Drachen gewesen, wäre all das jetzt ein Schwert.«
»Dann schmeißen wir es halt runter!«, brüllte Yanko und zerrte ein Stück Blausilber aus seinem Rucksack. Mit gespieltem Bedauern ließ er es in die Tiefe fallen. »Du wärst ein herrliches Diadem geworden.«
»Der Gedanke zählt.« Nica lächelte Yanko an und kramte ebenfalls das Blausilber aus ihrem Ruchsack, um es ins Meer regnen zu lassen.
»Und diese Gedanken sollten wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren.« Auch Anula warf nun ihr Rohmetall hinab. »Auch ohne Blausilber.«
»Auf dass der fieberköpfige Orden keine einzige neue Waffe in die Finger bekommt!«
Ein Brocken nach dem anderen raste hinab, jeder wurde mit einem weiteren Fluch gegen den Orden begleitet. Schließlich drückten sie auch den Drachen Blausilber in die Klauen, das diese mit vergnügten Flüchen ins Meer schleuderten.
»Danke«, sagte Aiphyron, als der letzte Krümel Blausilber vom Ozean geschluckt worden war.
»Reiner Selbstschutz«, brummte Ben. »Ich dachte, ich mach das mal, bevor du doch noch mich zu Ballast erklärst.«