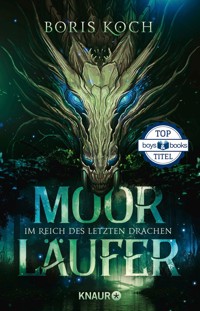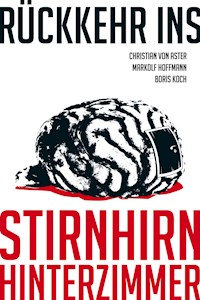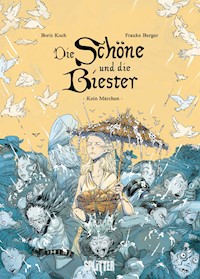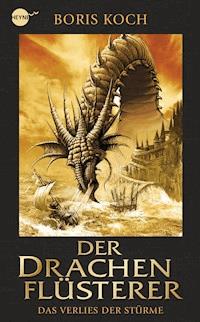12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Drachenflüsterer-Serie
- Sprache: Deutsch
Der reiche Orden der Drachenritter zwingt Drachen mit Gewalt unter seine Herrschaft, so wie die alten Legenden es verlangen. Doch der geächtete Drachenflüsterer Ben weiß, dass die Legenden lügen. Ausgestattet mit der magischen Gabe, Drachen zu heilen, bieten er und seine Freunde dem Orden die Stirn. Mit jedem Sieg wächst die Zahl seiner Verbündeten, bis Ben erkennt, dass er dringend Gold benötigt, um seine Mission weiterzuführen. Doch woher nehmen? Gejagt vom Orden der Drachenritter begibt er sich auf die Suche nach dem sagenhaften Schatz am Riff der Seetrolle. Als er dann auch noch Hinweise auf seinen lange verschollenen Vater erhält, bleibt Ben nichts anderes übrig, als den Rat einer Toteneiche zu suchen. Doch diese verlangt für ihre Antworten einen hohen Preis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Seit Jahrhunderten zwingt der reiche Orden der Drachenritter Drachen mit Gewalt unter seine Herrschaft, so wie die alten Legenden es verlangen. Doch der geächtete Drachenflüsterer Ben weiß, dass die Legenden lügen. Ausgestattet mit der magischen Gabe, Drachen zu heilen, bietet er gemeinsam mit seiner Freundin Anula, seinem treuen Drachen Aiphyron und einigen kampferprobten Gefährten dem Orden die Stirn. Mit jedem Sieg wächst die Zahl ihrer Verbündeten, bis Ben erkennt, dass er dringend Gold benötigt, um die Mission weiterzuführen. Doch woher nehmen? Gejagt vom Orden der Drachenritter begibt er sich auf die Suche nach dem sagenhaften Schatz am Riff der Seetrolle. Als er dann auch noch Hinweise auf seinen lange verschollenen Vater erhält, bleibt Ben nichts anderes übrig, als den Rat einer Toteneiche zu suchen. Doch diese verlangt für ihre Antworten einen hohen Preis ...
Die große DRACHENFLÜSTERER-Saga:
Erster Band: Der Drachenflüsterer
Zweiter Band: Der Schwur der Geächteten
Dritter Band: Das Verlies der Stürme
Vierter Band: Die Feuer von Arknon
Fünfter Band: Das Lied der Toteneiche
Der Autor
Boris Koch, Jahrgang 1973, wuchs auf dem Land südlich von Augsburg auf und studierte Alte Geschichte und Neuere Deutsche Literatur in München. Nach 15 Jahren in Berlin lebt er heute als freier Autor in Leipzig. Zu seinen Buchveröffentlichungen gehören die DRACHENFLÜSTERER-Saga, die humorvolle Abenteuergeschichte Das Kaninchenrennen und der mit dem Hansjörg-Martin-Preis ausgezeichnete Jugendkrimi Feuer im Blut. Sein Roman Vier Beutel Asche wurde von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur als Jugendbuch des Monats April 2013 ausgezeichnet.
BORIS KOCH
DER DRACHENFLÜSTERER
DAS LIED DER TOTENEICHE
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Roman wurde mit Geldern aus dem Stipendienprogramm 2021 der VG WORT im Rahmen von NEUSTART KULTUR gefördert.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 08/2022
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2022 by Boris Koch
Copyright © 2022 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagillustration: Luisa Preißler
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Karte: Andreas Hancock
Innenillustrationen: Dirk Schulz
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-28810-5V001
www.heyne.de
Für alle,
die lange darauf gewartet haben.
Wie auch für diejenigen,
die ohne Wartezeit hier gelandet sind.
PROLOG
Der Hohe Abt Morghon saß an seinem Schreibtisch im Kloster Sonnenflut und dachte an den Drachenflüsterer Ben und ans Abendessen. Sein Kopf schmerzte, der Magen knurrte, auf dem mächtigen Eichentisch stapelten sich Bücher, Briefe, Notizen, Urkunden und weitere Papiere zum Vulkan Arknon, zu sämtlichen Blausilberschmieden des Großtirdischen Reichs und zu Faystos, dem Gott der Schmiedekunst. Alles hatte Morghon durchgesehen, manches gar zweimal, doch nichts davon hatte im Kampf gegen die Geächteten den erhofften Erfolg gebracht; auch nicht der Erlass neuer Kopfgelder nach dem Erlöschen des Vulkans. Nirgends fand sich eine Prophezeiung, dass die Götter das Feuer zurückbringen würden.
Es klopfte, und Morghon hob den Kopf. »Herein.«
Die Tür öffnete sich, und der Knappe Ernek trat mit einer Verbeugung ein. »Hoher Abt.«
Ernek war groß und schlank, er hatte volles Haar und ebenmäßige Gesichtszüge, und darum hatte Morghon ihn für den Posten vor seiner Tür ausgewählt. Der Abt wollte Besucher schon mit dem wachhabenden Knappen beeindrucken, und für den ersten Eindruck war Aussehen wichtiger als geleistete Taten und Fähigkeiten. Herumstehen, anklopfen und sich verbeugen konnten die Knappen schließlich alle. »Ritter … Ritter …« Ernek verstummte, seine Züge zeigten Entsetzen, und er lief tiefrot an.
»Ja?«, knurrte Morghon.
»Ritter … Ich-habe-seinen-Namen-vergessen, verzeiht, aber er ist zurück und bittet darum, empfangen zu werden. Er sagt, es sei dringend.«
»Er soll noch einen Moment warten«, beschied ihm Morghon. »Und du, Junge, mistest eine Woche lang die Drachenställe aus. Fürs Vergessen des Namens. So schwer kann es doch nicht sein, einen einzigen Namen von vor der Tür bis hinter der Tür zu behalten!«
»Nein, Hoher Herr. Ja, Hoher Herr.«
Mit gesenktem Kopf verließ der Knappe das Arbeitszimmer, und Morghon dachte verärgert: Jetzt muss ich auch noch einen neuen Türknappen finden. Dann waren seine Gedanken schon bei dem angekündigten Ritter; egal, wer es war, Morghon hoffte, er käme mit guten Nachrichten.
Eilends legte er die breite Goldkette mit Hellwahs Sonnensymbol an und rückte seinen Stuhl hinter dem massiven Eichentisch zurecht. Er richtete den goldenen Brieföffner an der Tischkante aus und drückte den Rücken durch, wie es sich für einen Mann von Rang gehörte und wie er es auf dem großen goldgerahmten Portrait tat, das an der Wand hinter ihm hing. Doch nun blendete ihn die tief stehende Sonne, die zum Fenster hereinschien, und Morghon verrückte den Stuhl rasch ein Stück weit nach rechts, bis er im Schatten saß. Von dort aus befahl er: »Herein!«
Mit festem Schritt trat der Ritter ein. Er war zwei Handbreit größer als der Knappe Ernek und recht jung; der Staub der Straße haftete noch an seiner Kleidung, der spärliche Bart war struppig und das Gesicht ungewaschen. Unter den Augen hatte er tiefe Ringe, so als hätte er tagelang kaum geschlafen. Morghon erinnerte sich an das Gesicht, doch der Name wollte ihm nicht gleich einfallen. Aber ihm durfte das passieren, er war schließlich Abt, kein Knappe. Auch wohin er ihn geschickt hatte, wollte Morghon nicht einfallen; er hatte einfach zu viele Ritter ausgesandt.
Dutzende hatte er beauftragt, in alle Ecken des Großtirdischen Reichs nach einer Möglichkeit zu suchen, die Feuer von Arknon erneut zu entfachen, dem heiligen Vulkan wieder Leben einzuhauchen, der vor wenigen Wochen erloschen war. Doch bislang hatte niemand etwas gefunden, und auch alle Gebete an Hellwah und Faystos waren ungehört geblieben.
Drei Schritt vor dem Schreibtisch blieb der Ritter stehen und beugte das Knie. Er senkte den Kopf und grüßte mit überraschend tiefer Stimme: »Hoher Abt.«
»Erhebe dich, Ritter«, sagte Morghon. »Was hast du bezüglich des Vulkans herausgefunden?«
Der Ritter hob den Kopf, stand jedoch trotz der Aufforderung nicht auf. »Leider nichts«, gestand er.
In dem Moment fiel es Morghon wieder ein. Nibel, so hieß der Bursche. Die Namen all jener, die ihn enttäuschten, vergaß er nicht.
»Und dafür störst du mich?«, fuhr Morghon ihn an. »Schmutzstarrend und ungewaschen! Was ist denn an einem Nichts so drängend, dass es nicht warten kann?« Wütend erhob er sich, und da wurde er wieder von der Sonne geblendet. Wie sollte er blinzelnd und mit zusammengekniffenen Augen gebieterisch wirken? Innerlich fluchend trat er neben den Tisch und auf den Ritter zu, um wieder im Schatten zu stehen.
»Vergebt mir, aber ich war weit im Norden, wo es keine großen Bibliotheken und kein großes Wissen gibt. Doch ich habe etwas anderes erfahren, das ich Euch sofort berichten wollte. In Trollfurt, der Heimat des Drachenflüsterers Ben, bin ich mit einer älteren Frau ins Gespräch gekommen, die dem Orden auch in den Tagen der Ketzer treu geblieben war. Sie hat behauptet, Ben sei gar keine Waise, wie wir immer dachten, sondern sein Vater lebe vermutlich noch. Nur seine Mutter, eine verbitterte Säuferin, sei vor ein paar Jahren gestorben, in den Fluss gefallen oder gesprungen, in jedem Fall betrunken ertrunken. Sein Vater, ein Minenarbeiter der alten Blausilbermine, habe seine Familie und Trollfurt ein paar Jahre zuvor verlassen, sie wusste nur nicht, wohin. Ich habe andere Leute darauf angesprochen, und die meisten haben mir die Geschichte bestätigt. Auch wenn niemand sicher wusste, wohin der Vater gegangen ist, vermuteten die meisten doch, er habe sich Arbeit in einer anderen Mine im Norden gesucht, so wie es eine ganze Reihe weiterer Arbeiter getan haben. Nur haben die anderen ihre Familien mitgenommen. Manche glauben, er sei mit der Absicht, Frau und Kind nachzuholen, aufgebrochen und dann gestorben, aber die meisten sagten, er habe vermutlich eine andere Frau getroffen, und besonders verlässlich sei er sowieso nie gewesen. Aber zäh, und so waren die meisten überzeugt, dass er noch lebt. Ich dachte, das interessiert Euch sicher, und Ihr würdet ihn gern in die Finger bekommen und aufknüpfen.«
»Aufknüpfen?«, fragte Morghon überrascht. »Weshalb sollte ich ihn einfach so aufknüpfen wollen?« Der Vorschlag erschien ihm arg plump für den jungen Mann, der ansonsten ganz aufgeweckt wirkte, mit einem ausgeprägten Sinn dafür, was wichtig war.
Ritter Nibel lächelte, und endlich erhob er sich. »Um Ben zu demütigen. Um allen, die sich ihm anschließen wollen, Angst zu machen, dass auch ihre Familien in Gefahr sein könnten. Wer Angst hat, denkt zweimal darüber nach, was er tut. Und mit etwas Glück bringt das sogar manch einen seiner Spießgesellen dazu, Ben zu verlassen und zu verraten.«
»Kein übler Gedanke.« Morghon nickte und beschloss, den jungen Mann im Auge zu behalten; er dachte mit und entwickelte Pläne. Jemand wie er war nützlich oder gefährlich – oder beides.
Langsam trat Morghon wieder hinter den Schreibtisch und sperrte die linke Schublade auf, wo er stets ein paar Beutel Geld aufbewahrte, Silber wie Gold, fein säuberlich sortiert nach Gewicht und Wert. Ohne zu zögern, fischte er einen kleinen Beutel mit Gold aus der Schublade und warf ihn Nibel zu. Der fing ihn mit einer Hand, ohne die Miene zu verziehen.
»Das ist für deine Information und fürs Mitdenken«, sagte Morghon. »Und jetzt wasch dich, lass dir zu essen geben und schlaf aus. Morgen machst du dich auf den Weg, Bens Vater zu finden und herzubringen. Ich gebe dir Männer mit, denen du vertrauen kannst, doch sage sonst niemandem, was du herausgefunden hast. Niemandem, verstanden?«
»Verstanden«, wiederholte der Ritter und nickte.
»Seid ihr erfolgreich, bekommt ihr alle noch einmal Gold. Mehr Gold.«
»Hoher Abt.« Mit einer Verbeugung verabschiedete sich Ritter Nibel und ging.
Morghon sah ihm nach und dachte, der Orden bräuchte mehr Ritter wie Nibel. Und dann dachte er: Bens Vater. Und lächelte. Er musste ihn unbedingt in die Finger bekommen. Zuerst würde er ihn befragen und dann möglicherweise wirklich hinrichten. Oder vielleicht besser noch: Er würde Ben mit ihm eine Falle stellen. Ben würde alles riskieren, um die Hinrichtung seines Vaters zu verhindern, das hatte er sogar für Fremde getan. Ganz egal, wie wütend Ben auf seinen Vater war, er hatte sicher Fragen – jeder junge Mann hatte Fragen an seinen Vater, und das sogar besonders dann, wenn er wütend auf ihn war. Ben würde kommen, selbst wenn er eine Falle vermutete. Und die würde er vermuten, er war nicht dumm. Sie brauchten also neben der offensichtlichen Falle eine weitere, in die Ben dann tappen würde.
»Du bist noch ein halbes Kind, irgendwann hilft dir auch dein unverschämtes Glück nicht mehr weiter«, murmelte Morghon und trat ans Fenster. Irgendwo dort draußen versteckte sich der Bursche mit seinen Spießgesellen, doch wo?
Das spielt keine Rolle, dachte Morghon, ich werde euch alle finden und aufknüpfen. Ihr werdet mich nicht weiter zum Narren halten. Er war fest davon überzeugt, dass die Geächteten irgendwo in einem Loch hausten, in einer Höhle im Wald, und Angst hatten. Der Winter stand vor der Tür, der würde sie zermürben. Bei dem Gedanken daran huschte ein Lächeln über seine Lippen.
Die Sonne versank hinter der westlichen Klostermauer, und der Himmel färbte sich tiefrot. Die Nächte wurden wieder länger, und ein frischer Wind zog vom Meer herein. Morghon fröstelte und verschränkte die Arme, dann trat er zurück ins Zimmer.
Nach einem letzten prüfenden Blick zum Schreibtisch und auf sein Gemälde machte er sich auf den Weg zum Abendessen. Er hatte großen Hunger, heute würde er sich drei Gänge gönnen. Mindestens.
EINE UNVORSICHTIGE WETTE
Einen langen Augenblick starrte Ben auf die acht Ritter und den Hohen Abt in ihrer Mitte. Er musste sie alle erwischen, wenn er noch einmal den Hals aus der Schlinge ziehen wollte, und er hatte nur einen einzigen Versuch. Der Fels unter seinen nackten Füßen war rau und kühl, doch er lief einfach gern barfuß, solange es ging. Der Wind frischte auf. Das auch noch! Wieso nur hatte er sich darauf eingelassen? Möwen schrien, Wellen rauschten, und eine vorlaute Ziege meckerte ganz in der Nähe.
Elender Stolz, dachte Ben. Er hätte sich nicht von Yanko herausfordern lassen dürfen, hätte wissen müssen, dass das schiefgeht, schließlich war es Yanko.
Tief atmete Ben durch, und der Wind flaute wieder ab. Das war seine Gelegenheit, trotzdem durfte er es nicht überstürzen. Sanft strich er über die schwere Holzkugel in seinen Händen und sammelte sich. Die Oberfläche war leicht rau, denn sie hatten feine Drachenschuppen hineingeritzt; damit es Drachen waren, die die hölzernen Ordensfiguren zu Fall brachten.
»Mach schon«, drängte Yanko grinsend. Das dunkle schulterlange Haar hatte er wie immer zusammengebunden, die dunklen Augen blitzten. Er war breiter gebaut als der drahtige Ben, doch noch immer zwei Fingerbreit kleiner. Seine früheren Ankündigungen, er werde Ben noch über den Kopf wachsen, hatte er aufgegeben, doch fand er regelmäßig andere Möglichkeiten, Ben herauszufordern. So wie gerade eben.
»Schnauze!«, raunzte Ben.
»Nervös?« Yanko grinste. »Oder hast du die Hosen voll, Furchtsamer?«
»Warum fragst du, Redeschwalliger?«, erwiderte Ben. »Sind deine Hosen etwa leer? Ist da nur Luft unterhalb des Gürtels?«
Die Umstehenden lachten, aber Ben war nicht sicher, zu wem sie hielten. Etwa ein Dutzend Geächtete drückte sich vor ihren Aufgaben und sah zu, wie er gegen Yanko kegelte. Aber was sollte er sagen – er und Yanko drückten sich ja auch, das gehörte zum Leben auf ihrer Insel dazu. Zum Glück war Anula nicht unter den Zuschauern; es reichte vollauf, wenn er sich vor den anderen blamierte.
Vor etwa drei Wochen hatte Akse in einer kleinen Küstenstadt zwei Bücher für Byasso und einen Schwung Kegel aufgetrieben, und die Fischerstochter Vilette und der junge Schustersohn Tharas hatten daraufhin aus dem Holz eines alten Seetrolltischs eine Kegelbahn gebaut. Sie lag ein gutes Stück vor dem Verlies der Stürme, der gewaltigen Festung aus dunklem Stein, in der Ben und seine Gefährten lebten. Mit beinahe tausend Schritt Länge und ihren zahlreichen massiven Türmen beherrschte sie die namenlose felsige Insel, auf der sie lebten. Die Kegelbahn verlief parallel zu Festung und Meer und maß gerade mal fünfzehn bis siebzehn Schritt in der Länge, je nachdem, wer die Schritte machte.
Die Apothekertochter Dolna und die Sängerin Ayna hatten mit viel Geschick acht Kegel als Ritter angemalt und den größten, der in der Mitte stand, als einen Abt, den Hohlen Morghon. Von ihm blätterte die Farbe bereits ab, denn jeder wollte den Abt immer zuerst abräumen. Außerdem hatte der jagdhundgroße Wachdrache Quobemhonn neulich zum Vergnügen aller auf ihm herumgekaut – wie ein Hund auf einem Knochen. Seit sie die Bahn hatten, spielten sie, auch bei Regen oder im Fackelschein bei Nacht. Und am häufigsten und geschicktesten spielte Yanko.
Noch einmal atmete Ben tief durch und fasste die Kegel genau ins Auge. Er nahm die Kugel allein mit der Rechten und machte einen halben Schritt zurück, um Schwung zu holen. Just in dem Moment frischte der Wind wieder auf, stärker sogar und so plötzlich, dass es Ben beinahe die Kugel aus der Hand gerissen hätte. Schnell packte er zu und hielt sie wieder mit beiden Händen fest.
Die Kegel selbst standen im Windschatten der hölzernen Umfassung, die zu ihrem Schutz errichtet worden war, und damit die Kugel nicht über die halbe Insel rollte, nachdem sie die Kegel getroffen hatte. Doch die vorderen zwei Drittel der Bahn waren den Winden ungeschützt ausgesetzt, ebenso die felsige Anlaufstrecke für den Spieler davor.
»Wirfst du jetzt, oder wirfst du nicht?«, fragte Yanko grinsend.
»Wenn der Wind nachlässt.«
»Der Wind war kein Teil der Wette, und eine Wette ist eine Wette. Es hätte mich auch erwischen können.«
»Hat es aber …«, fing Ben an, doch noch bevor er den Satz beendet hatte, ließ der Wind wieder nach, und Ben sparte sich jedes weitere Wort. Er atmete tief durch und nahm die Kugel in die Rechte. Ohne zu zögern, machte er einen kleinen Ausfallschritt, ging leicht in die Knie, zielte und … Erneut hob der Wind an, heulend und pfeifend, und Ben fluchte lauthals los: »Du elende stinkende Trollfanfare! Das gibt’s doch nicht!« In seiner Wut hätte er die Kugel beinahe fortgeschleudert. »So ein verfluchtes Pech!«
Yanko, der sichtlich damit kämpfte, ein lautes Lachen zu unterdrücken, sagte mit scheinheiliger Stimme: »Ja, das Glück ist eben mit den Mutigen, o Schreckensbleicher.«
»Wenigstens gibst du zu, dass du einfach Glück hast«, knurrte Ben.
»Neidisch?«, fragte Yanko. »Oder was gibt es gegen Glück einzuwenden?«
»Nichts«, brummte Ben. »Aber ich brauch auch keines.« Entschlossen stemmte er sich gegen den Wind und nahm noch drei weitere Schritte Anlauf. Seit der Herbst gekommen war, spielten die Winde um die Insel immer wieder verrückt. Vermutlich lag das an der Magie der vergrabenen Beutel Ailons, daran konnte man nichts ändern. Und Yanko hatte recht: Eine Wette war eine Wette, davor konnte man sich nicht einfach drücken, nur weil das Wetter gerade gegen einen war.
Jetzt, dachte Ben und lief los. Der Wind drückte Ben mit Macht nach rechts, aber er hielt mit ebenso viel Kraft dagegen. Drei, vier, fünf, sechs Schritte stemmte er sich erfolgreich gegen das Tosen und dachte: Es geht! Ich schaffe es! Fast hatte er die Abwurfstelle an der Bahn erreicht, und weit holte er mit der Kugel aus, den Blick stur auf die Kegel gerichtet. Noch zwei letzte Schritte hatte er vor sich, da erstarb mit einem Schlag der Sturm; von einem Augenblick zum nächsten herrschte völlige Windstille.
Ben geriet ins Straucheln und fiel. Wie selbstverständlich riss er die Arme hoch, um den Sturz abzufangen, und schickte dabei die Kugel mit viel Schwung und ohne jede Kontrolle auf die Reise. Sie verließ seine Hand im hohen Bogen, schlug hart auf die Kegelbahn, hüpfte weiter, statt zu rollen, schräg über die Bahn hinweg und verließ sie sofort wieder über die Seite, sprang über die anschließenden Felsen, schreckte drei zerzauste Möwen auf, die schimpfend davonflogen, und schanzte über einen vorspringenden Felsen hinaus ins Meer.
»Matschiger Trollbollen noch mal!«, fluchte Ben, während auch Yanko auf die Knie fiel, wenn auch vor Lachen.
»Du hast echt kein Glück«, brach es aus ihm heraus.
Manche Umstehenden fielen in das Lachen ein, andere kämpften selbst mit dem Gleichgewicht, zwei oder drei saßen auf dem Boden und fluchten und lachten zugleich.
»Wer die Kugel wirft, muss sie holen«, erinnerte Sidhy Ben an die Regeln. Sidhy war längst nicht mehr der blasierte Junge von früher, doch wenn es um Ordnung, Absprachen und Regeln ging, brach manchmal noch immer die alte Herablassung durch.
»Ja, gleich«, erwiderte Ben genervt.
Sidhy zuckte mit den Schultern. »Ich sag’s nur, weil sie im Wasser gelandet ist, und zwar genau da, wo die Strömung von der Insel fortführt. Wenn du also noch länger wartest, dann …«
»Oh, verdammt!« Ben sprang auf und rannte Richtung Meer. Im Laufen zog er sich das Hemd über den Kopf und schleuderte es zu Boden. Der Wind frischte wieder auf, erfasste das Hemd und trieb es an Ben vorbei aufs Ufer zu. Fassungslos sah er ihm hinterher. Das konnte doch nicht wahr sein!
»Lass es!«, rief Yanko und stürmte heran. »Ich hol das Hemd, hol du die Kugel.«
Ben drehte sich nach ihr um, und sie trieb bereits mehrere Schritt vom Ufer entfernt. Dort war das Wasser viel zu tief, um zu stehen. Wie konnte einer allein so viel Pech haben! Hastig schlüpfte er im Stehen aus der Hose und wäre beinahe vom Wind umgeblasen worden. Auf einem Bein hüpfend hielt er sich gerade noch aufrecht, und plötzlich stieg in ihm ein Lachen auf, und er lachte laut und donnernd, er konnte nicht anders.
Noch immer lachend sprang er vom Felsen, sprang so weit er konnte hinaus, und lachend schlug er aufs Wasser, tauchte ein, und Kälte umfing ihn. Auch wenn tagsüber die Sonne schien, die Nächte und das Wasser trugen den Herbst längst in sich. Prustend tauchte Ben auf und schrie: »Verfluchte Schrumpelritter noch mal, ist das kalt!«
Mit ausholenden Kraulbewegungen schwamm er der Kugel hinterher und dachte: Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass plötzlich ein Hai auftaucht.
Yanko rief: »Ich hab dein Hemd. Soll ich die Hose auch festhalten?«
»Ja!«, brüllte Ben, und salziges Wasser schwappte in seinen Mund, bevor er Yanko fragen konnte, was die alberne Frage sollte. Ohne sich zum Ufer umzudrehen, schwamm er weiter und weiter.
Ein gutes Stück vor ihm rollte die Kugel über die Wellen, und er musste sie einholen, bevor sie ganz abgetrieben wurde. Es war die beste ihrer drei Kugeln, er durfte sie nicht verlieren. Die zweite hatte eine Beule, die dritte einen tiefen Riss, und hier auf der Insel fehlte ihnen das passende Werkzeug, um sich weitere zu machen. Keiner ihrer Versuche war annähernd rund geworden. Auf dem Festland wollte Ben keine kaufen, denn Geld fehlte ihnen ebenso wie das Werkzeug.
Immer näher kam Ben der Kugel, gleich hatte er sie eingeholt. Doch die Wellen wuchsen und wuchsen, und für einen Moment glaubte er, ein Stück vor sich eine Haiflosse zu erkennen, die durchs Wasser pflügte. Im nächsten Moment wurde sie von einer Welle verdeckt, und als Ben über den Wellenkamm gehoben wurde, war da nichts mehr. Sofort tauchte er den Kopf unter und sah in alle Richtungen, das Salzwasser brannte ihm in den Augen. Doch auch im Wasser erspähte er keinen Hai, keinen großen grauen Schemen, nur die kleinen blau-gelb gestreiften Fische mit den Beulen über den Augen, deren Namen er sich nie merken konnte. Sie huschten davon, und er tauchte wieder auf.
Kurz musste er sich neu orientieren, dann entdeckte er die Kugel, weiter weg als zuvor. Mit kräftigen Zügen machte er sich an die weitere Verfolgung, kam näher und näher, bis er sie schließlich einholte. Fest packte er sie mit beiden Händen und zog sie an sich.
»Ja!«
Jubel erhob sich am Ufer, doch die Stimmen klangen dünn und weit entfernt, obwohl der Wind sie doch zu ihm wehen musste. Ben drehte sich um, die Kugel im Triumph erhoben, und erschrak. Er war weit draußen auf dem Meer, viel weiter als erwartet. Die Strömung musste stärker sein als gedacht. Für einen Moment wollte er nach einem Drachen rufen und ihn um Hilfe bitten, aber dann nahm er die Kugel in die Linke und schwamm entschlossen zurück. Seine peinliche Niederlage beim Kegeln war schon schlimm genug, auf keinen Fall wollte er auch noch beim Zurückholen der Kugel versagen. Trotz Strömung und Wind musste er es allein schaffen.
Doch sosehr er auch mit den Füßen und dem einen Arm ruderte, er kam kaum voran. Wieder und wieder klatschten ihm die Wellen ins Gesicht, der Wind pfiff über ihn hinweg, und die Sonne glitzerte auf dem Wasser und blendete ihn. Langsam, aber unerbittlich kroch ihm die Kälte in die Knochen. So würde er es nicht schaffen, die Kugel behinderte ihn zu sehr.
Vielleicht brauche ich doch Hilfe, dachte er, aber er schüttelte den Gedanken rasch ab. Fest fasste er die Kugel mit beiden Händen, hob sie hoch und schleuderte sie Richtung Ufer, so weit er konnte. Dort wurde geschrien, manch einer warf entsetzt die Arme in die Höhe.
»He!«, trug ihm der Wind zu.
»Was tust du da?«
»Bist du verrückt?«
Er antwortete nicht, sondern schwamm mit aller Kraft auf die Kugel zu, die ihm wieder entgegentrieb. Selbst mit zwei freien Armen kam er gegen die Strömung nur langsam voran – aber er kam voran. Dabei behielt er die Kugel immer im Blick und erwischte sie, bevor sie an ihm vorbeitreiben konnte. Erneut schleuderte er sie Richtung Ufer, und jetzt hatten sie verstanden, und es wurde gejubelt.
Irgendetwas berührte ihn am Bein. Ben zuckte zusammen, erstarrte für einen Moment, doch dann war es fort, was immer es gewesen war. Nun schwamm Ben noch schneller, obwohl er nicht wusste, woher er die Kraft nahm. Wieder erreichte er die Kugel, wieder warf er sie voran, wieder und wieder, bis er sie irgendwann bis beinahe ans Ufer brachte und der kleine Tharas kopfüber ins Wasser sprang, um sie herauszufischen. Doch der drei Jahre ältere Gibor sprang weiter.
»Ich bin dran!«, jubelte Gibor und rannte mit der Kugel in Richtung Kegelbahn davon.
»Ich spiel gegen dich!«, rief Ayna sofort und heftete sich an seine Fersen. Die meisten folgten ihnen, um bei der neuen Partie zuzusehen, auch Tharas, der ihnen mit hängenden Schultern hinterhertrottete.
Nur Yanko wartete, bis auch Ben zurück an Land war. Mit letzter Kraft kroch er auf die Steine und blieb schwer atmend liegen. Er zitterte vor Kälte, und Gänsehaut überzog seinen ganzen Körper.
»Geht’s dir gut?« Yanko setzte sich neben ihn. Jedes Anzeichen von Triumph war aus seinen Zügen verschwunden.
»Ja«, keuchte Ben mit klappernden Zähnen. »Aber die Strömung ist verflucht …« Seine weiteren Worte gingen in einem Hustenanfall unter. Kaum war der vorüber, nieste Ben. Selbst hier in der Sonne wollte die Kälte nicht aus seinen Gliedern weichen, die Sonne war nicht mehr stark genug, der Sommer war vorbei.
»Da.« Yanko hielt ihm sein Hemd entgegen. »Zum Abtrocknen. Und dann hol dir deine Jacke aus dem Ewigen Eis raus, deine Lippen sind ganz blau.« Er grinste.
»Danke.« Im Sitzen rieb Ben sich trocken, doch eine Jacke holte er sich nicht, auch kein neues Hemd. Er war viel zu schlapp und ausgelaugt, um sich zu erheben. Auf keinen Fall wollte er sich groß bewegen, und schon gar nicht hinein. Die dicken Steinmauern der alten Seetrollfestung hielten die Räume viel zu kühl. Umständlich schlüpfte er in die Hose. »Ich bleib noch kurz in der Sonne, dann helfe ich Sidhy beim Abendessen.«
Yanko grinste, klopfte ihm auf die Schulter und stand auf. »Ich geh mal, den großen Turm winterfest machen. Nicht dass die kalten Winterwinde früher auftauchen, als wir denken.«
Ben nickte und ließ sich wieder auf den Boden sinken. Er schloss die Augen, das Gesicht der Sonne zugewandt. Sie waren im Süden, der Winter würde hoffentlich milder werden als in Trollfurt.
Als Anula eine Weile später zu ihm ans Ufer kam, lag Ben noch immer in der Sonne. Sie hatte eins seiner Hemden dabei und ging neben ihm in die Hocke. Seit der Weiße Drache sie mit seinem Hauch gefoltert hatte, glitzerte ihre Haut wie Eis in der Sonne. Auch in ihr Inneres war seine Kälte gekrochen und hatte sie ausgefüllt, doch vor wenigen Wochen hatte der Vulkan Arknon den größten Teil davon wieder vertrieben. Das Glitzern auf der Haut war geblieben.
Das lange schwarze Haar fiel ihr offen über die Schultern, und sie sagte: »Ayna meint, du wärst fast ertrunken.« Sie wirkte mehr verärgert als mitfühlend.
Ben blinzelte und winkte ab. »Ach was, ich hab es ganz allein ans Ufer geschafft. Und den Hai habe ich mir auch nur eingebildet.«
»Den Hai?«
»Nur eingebildet«, versicherte Ben nachdrücklich. »Der war überhaupt nicht da. Mir geht es bestens.« Schwungvoll richtete er sich auf, um es zu beweisen, aber dann entrang sich seiner Kehle erneut ein Husten, sosehr er es auch zu unterdrücken versuchte.
»Soso, bestens.« Sie setzte sich neben ihn und warf ihm das Hemd in den Schoß.
»Ja«, versicherte er. Die Sonne stand noch immer hoch am Himmel, und Ben war inzwischen nicht mehr so durchgefroren. Trotzdem war er dankbar für das Hemd und zog es über.
»Was wolltest du in der Strömung?«
»Ich musste die Kugel holen, weil ich sie geworfen hatte«, erklärte er. »So lautet die Regel, und da kann ich mich schlecht rausnehmen, nur weil ich eben ich bin, oder?«
»Natürlich nicht.« Anula schnaubte. »Aber die Regel wurde fürs Spielen an Land gemacht. Normalerweise kegelt niemand bis ins Meer.«
»Trotzdem«, brummte Ben. »Regel ist Regel, kneifen wäre feige gewesen.«
»Feige, soso«, erwiderte sie spitz. »Es gibt da noch eine andere Regel, die wichtigste überhaupt: Niemand soll für ein Stück Holz ertrinken. Und da kannst du dich auch nicht rausnehmen.«
Er lächelte sie an, aber weil ihn die Sonne blendete, kniff er dabei das linke Auge zu und das rechte halb. »Dann ist es ja gut, dass ich nicht ertrunken bin.«
»Ausgesprochen gut. Andernfalls hättest du Ärger mit mir bekommen.«
»Oh, ja, ich weiß«, sagte er lächelnd. Er war sicher, sie wäre ihm bis ins Jenseits gefolgt, um ihm zu erklären, was für eine Dummheit er angestellt hätte. »Aber wir können uns keine neue Kugel leisten, und wir können sie nicht selbst herstellen. Es ist die Einzige, die etwas taugt, und sie zu verlieren hätte auch Ärger bedeutet, weil alle gern spielen.«
Anula hob eine Augenbraue und sah ihn scharf an. »Dann sollen eben auch alle in die Strömung springen, wenn sie so gern kegeln.«
»Nicht, wenn ich es bin, der vorbeikegelt. Dann muss ich das machen. Und bevor ich ertrunken wäre, hätte mich schon irgendwer aus dem Meer gezogen, keine Angst. Wahrscheinlich Juri.«
»Ja. Aber was, wenn der Hai dich erwischt hätte?«
»Der war nur eingebildet«, erinnerte sie Ben, aber während er es aussprach, wusste er selbst, dass das ein schwaches Argument war.
»Und wenn es der nächste nicht ist?«
Ben zuckte mit den Schultern. Juri war stärker als jeder Hai, aber er wäre nie schnell genug da gewesen, wäre der Hai echt gewesen und versessen darauf, Ben zu verspeisen. Lahm sagte er: »Vielleicht wäre er schon satt gewesen.«
»Ja, vielleicht.« Anula schnaubte. Dann fuhr sie ihm mit der Hand durchs Haar. Jetzt, da es kälter wurde, ließ er es wieder wachsen, obwohl er damit der Beschreibung auf den Steckbriefen wieder mehr ähnelte. »Aber wenn du schon dein Leben riskieren musst, dann besser für einen Haufen Gold. Dann können wir uns zwei Dutzend solcher Kugeln kaufen.«
Ben legte den Kopf in ihren Schoß. »Wenn wir Geld haben, sollten wir uns lieber Essen kaufen, für den Winter brauchen wir noch einige Vorräte. Auch Decken, Dachschindeln und Werkzeug.«
»Dein Leben setzt du also ein, aber ein paar läppische Münzen willst du für eine Kugel nicht ausgeben?« Ungläubig schüttelte sie den Kopf.
»Das ist was anderes«, protestierte Ben. »Das Geld gebe ich aus, aber das Leben riskiere ich nur.«
Sie hob nur eine Augenbraue.
»Ich weiß, wie das klingt«, rechtfertigte er sich. »Aber das Geld ist danach auf jeden Fall weg, das Leben nicht. Das Risiko war nicht so groß, und …« Er brach ab.
Sie strich ihm übers Haar. »Aber wenn dein Leben weg ist, ist es weg, und das ist mehr wert als alle Gulden der Welt. Frag also das nächste Mal sicherheitshalber einfach einen Drachen oder paddel auf einem Balken hinterher.«
Brummend versprach er es.
In der Hinsicht war es bedauerlich, dass sie um die Insel herum wegen der gefangenen Stürme keine Boote und Schiffe verwenden konnten, auch wenn sie das sonst vor Überfällen schützte. Trotz des Versprechens befürchtete er, dass er auch das nächste Mal wieder schwimmen würde. Doch dann fragte er sich, weshalb Anula eigentlich davon ausging, dass es ein nächstes Mal geben würde. Als hätte sein Fehlwurf nicht am Wind gelegen, sondern an ihm.
»Yanko hat gewonnen, oder?«, sagte sie in dem Moment, als hätte sie dasselbe gedacht wie er. Und obwohl es als Frage gestellt war, war es keine.
Ben murrte: »Wieso glaubst du das? Traust du mir keinen Sieg zu?«
»Du hast ins Meer gekegelt«, erinnerte sie ihn. Ein spöttisches Lächeln umspielte auf einmal ihre Lippen. »Und wer ins Meer kegelt …«
»Das lag nur am Wind! Er hat plötzlich aufgehört.« Noch während er sprach, wurde Ben von allein immer leiser; er wusste selbst, wie es klang.
»Außerdem habe ich Yanko bis ins Verlies hinein jubeln hören«, sagte Anula. »Laut und ausgelassen und lang. Als hättet ihr um einen Einsatz gespielt.«
»Haben wir auch«, gestand Ben.
»Um viel?«
Er zuckte mit den Schultern. »Es geht auch immer um die Ehre, oder nicht?«
»Um wie viel?«, hakte sie nach.
»Kein Geld.«
»Worum dann?«
»Küchendienst.«
»Küchendienst?«, echote sie verblüfft. Dann lachte sie. »So viel Theater wegen einmal Küchendienst?«
»Nicht einmal«, murmelte Ben. »Ich muss seine Schichten für ein halbes Jahr übernehmen.«
»Ein halbes Jahr?« Anula starrte auf ihn herab, ihre Lippen kräuselten sich. »Darauf hast du dich eingelassen? Du weißt doch, dass er beim Kegeln immer gewinnt.«
»Nicht immer«, widersprach er halbherzig, aber auf die Schnelle fiel ihm keine Kegelpartie ein, die Yanko verloren hatte. »Er hat mich herausgefordert, hat gesagt, ob wir einmal mit Einsatz spielen wollen, nicht immer nur zum Spaß und um die Ehre, und ich habe Ja gesagt, und Sidhy, der alles gehört hat: Warum nicht um den nächsten Küchendienst? Da habe ich gesagt, das sei läppisch, weil ich auf Küchendienst keine Lust hatte, aber bevor mir ein Gegenvorschlag eingefallen ist, haben Leute um uns gerufen: Dann eben einen Monat! Drei Monate! Ein halbes Jahr! Und Yanko hat seine Hand ausgestreckt: Also gut. Ein halbes Jahr Küchendienst. Und er hat gegrinst, und ich konnte keinen Rückzieher mehr machen.«
»Geschickt.« Anula klang amüsiert.
»Außerdem dachte ich, es sei vielleicht gut, wenn er mal gegen mich gewinnt. Wir sind Freunde, seit ich denken kann. Und er nimmt den Wettkampf um die Höhe der Kopfgelder so ernst, aber da kann er mich nicht schlagen, weil ich die Gabe habe und der Orden mich unbedingt in die Hände bekommen will, weißt du? Das kann er nicht ändern, egal, was er anstellt. Und dann bist du ihm auch noch enteilt, weil du den Vulkan zum Erlöschen gebracht hast.«
»Aber …«, wollte sie ihn unterbrechen, doch Ben ließ es nicht zu.
»Ich weiß, dass du es nicht allein warst, jeder von uns weiß das. Aber für den Orden bist du die schillernde Frau aus der Prophezeiung, und gegen eine Prophezeiung kommt Yanko nicht an, egal, wie sehr er sich darum bemüht, dass sein Kopfgeld steigt. Und dann kommt auch noch heraus, dass Cathe über eine Gabe verfügt. Noch ist sein Kopfgeld höher als ihres, aber …« Ben schnaubte und sah ihr in die Augen. »Er hat nichts gesagt, was soll er auch sagen? Und da dachte ich eben, er solle in irgendwas gewinnen. Aber inzwischen bin ich nicht mehr sicher, ob das nicht Blödsinn war und ich nur schlauer sein will, als ich es bin.«
»Ist es nicht.« Sie küsste ihn auf die Stirn, ihre Haare fielen auf sein Gesicht und kitzelten ihn. »Langsam akzeptierst du, dass du unser Anführer bist, und fängst an, wie einer zu denken.«
»Und was hat mir das eingebracht? Ein halbes Jahr Küchendienst. Das beweist höchstens, dass ich kein geschickter Anführer bin.«
»Das beweist, dass du zwar Anführer bist, aber kein Hoher Abt und kein König. Die übernehmen sicher keinen Küchendienst, und wie die wolltest du nie sein. Oder?«
»Stimmt«, sagte Ben und stand auf. »Dann gehe ich als guter Anführer mal in die Küche und schau, wo ich helfen kann. Vielleicht finde ich sogar jemanden, der mit mir um Yankos Küchendienst spielt, damit ich den wieder loswerde.«
Anula lachte. »Verlier aber nicht, sonst kommst du nie wieder aus der Küche raus …«
UNGEZÄHLTE STEINE
Am nächsten Morgen kroch Ben in der Dämmerung aus dem großen Bett, das er sich mit Anula teilte, um in die kleine Bibliothek hinüberzugehen. Trotz der Fenster aus Venzaraglas war es kühl, die Türritzen waren breit, und nachts sanken die Temperaturen. Leise zog sich Ben eine Jacke über. Anula drehte sich im Schlaf auf die andere Seite, brummte etwas Unverständliches und kuschelte sich tiefer in die Bettdecke hinein.
»Träum weiter«, flüsterte er lautlos und schlich barfuß aus dem Zimmer. Sanft schloss er die Tür hinter sich und schlüpfte erst vor dem Zimmer in die Schuhe.
Bevor er die Treppe hinunterstieg, warf er einen Blick aus dem offenen Turmfenster; ihr Zimmer lag ganz oben über dem Speisesaal. Die Sonne, groß und rot, hatte sich noch nicht mal zur Hälfte über den Horizont erhoben. Glühend spiegelte sich ihr Licht auf dem Meer, legte sich auf die heranrollenden Wellen. Abgesehen von wenigen Wolkenfetzen war der Himmel klar, doch ein frischer Wind wehte vom Festland herüber.
Juri lag halb im Meer, die Flügel an den massigen Körper angelegt, seine schilffarbenen Schuppen schimmerten im erwachenden Licht. Ebenso die gelbgrünen Zacken, die in zwei parallelen Reihen über den Rücken verliefen. Es wirkte beinahe träge, wie er dalag, die lange Schnauze auf dem Fels abgelegt, aber auch lauernd. Immer wieder schnaubte er einen plötzlichen Wasserstrahl durch die Nüstern hoch in die Luft und versuchte, den bussardkleinen verfressenen gelbschuppigen Ellyhmottheen zu treffen, der mit flinken Flügelschlägen über ihm kreiste. Schnell und aufmerksam, und so konnte er jeder Fontäne spielerisch ausweichen.
Ben sah ihnen zu und lächelte. Den Flug eines Drachen würde er immer mit Freiheit und Glück verbinden, immer mit dem Tag, an dem er zum ersten Mal auf Aiphyrons Rücken geflogen war. Doch dann kam ihm der Orden der Drachenritter in den Sinn, und das Lächeln erstarb. Wie konnte der Orden nur glauben, dass man Drachen die Flügel abschlagen musste, um sie zu befreien?
Natürlich kannte Ben die alte Legende vom ersten Drachenritter und wusste auch, dass der Orden sich auf diese Weise Drachen gefügig machte, ihnen den freien Willen und die Sprache nahm, und dass der Orden den unterdrückten großen Drachen seine Machtfülle verdankte. Er verstand auch, dass der Orden diesen Glauben verteidigen wollte, weil er das schon immer geglaubt und selbst verbreitet hatte, und davon abzulassen, war schwierig. Aber wie konnte es schwieriger sein, als weiter einem Irrtum anzuhängen, von dem man wusste, dass es einer war? Wie konnte Tradition mächtiger sein als Wissen und Wahrheit?
Auch Ben hatte die Legende einst geglaubt, bis er den ersten freien Drachen getroffen und mit ihm geredet hatte. Das hatte alles geändert. Warum also änderte der Orden sich nicht? Wer je einen freien Drachen hatte fliegen sehen, konnte doch nicht ernsthaft davon überzeugt sein, er täte ihm etwas Gutes, wenn er ihm die Flügel abschlug.
»Macht«, hatte Aiphyron ihm erklärt. »Es geht immer um Macht, nicht um Wahrheit.«
Aber auch ohne Drachen zu unterdrücken, würde der Orden doch nicht alle Macht verlieren. Er besaß Klöster und ausgedehnte Ländereien, Einfluss am Königshof und massenhaft Gold und Blausilber. Zahlreiche Ritter gehörten ihm an, darunter Söhne der einflussreichsten Familien des Landes. Er gebot über ausgebildete Jungfrauen und ein Heer an Bediensteten, und …
»Warum?«, murmelte Ben. Warum reichte das nicht, wieso musste der Orden unbedingt auch Drachen versklaven und verstümmeln? Warum war ihm dieser Preis für ein Mehr an Macht nicht zu hoch? Ben konnte das nicht begreifen, er wollte es auch nicht. Er wollte den Orden besiegen, ihm alle Macht nehmen und den Drachen ihre Freiheit zurückgeben.
»Na, wenn es weiter nichts ist«, schnaubte er, stieß sich vom Fensterbrett ab und ging. Draußen flog Ellyhmottheen lachend einen Salto, und Juri verfehlte ihn ein weiteres Mal.
Ohne einen weiteren Blick hinaus stieg Ben die gewundenen Stufen hinab und trat in den Innenhof. Viele Bodenplatten waren von Rissen durchzogen oder herausgebrochen, andere lagen schief, weitere hatten sie inzwischen begradigt. Ein Hahn stand auf dem Dach des verwinkelten Hühnerhauses neben dem Tor und krähte halbherzig, weiter hinten im Hof antwortete eine ihrer Krummhornziegen mit einem lauten Meckern. Zwei vereinzelte Blaukammhühner waren schon wach und staksten zwischen den großen Hochbeeten umher, die Ayna mit der Hilfe von Drachen und Menschen überall angelegt hatte. Menschen hatten die Umrandung gebaut, Drachen die fruchtbare Erde vom Festland herübergeschafft. Viel wuchs hier nicht mehr, die Zeit der Ernte war vorbei.
Als Ben den Hof beinahe durchquert hatte, fragte er sich plötzlich, warum sie die Kegelbahn eigentlich nicht hier drinnen, sondern draußen am Meer errichtet hatten. Hier, auf allen Seiten umgeben von gewaltigen Mauern und Bauwerken. Da hätte nicht einmal ich ins Meer gekegelt, dachte er.
Noch immer kopfschüttelnd, öffnete er die massive Tür und stieg in den dritten Stock hinauf, wo er ohne Zögern den Bibliothekssaal betrat, einen der größten Räume der gesamten Anlage, die einst von Seetrollen errichtet und für deren gewaltige Größe ausgelegt worden war. Zwei Reihen von breiten Säulen unterteilten den Saal in drei Bereiche, die hohe Decke war bemalt wie der Nachthimmel bei Neumond, dunkelblau und voller Sterne. Den Fußboden zierten verblasste, ausgetretene Wellen.
Linker Hand, nahe des Eingangs, standen drei rötliche Holzregale an der Wand. Die unterschiedlichsten Bücher, Flugschriften, Briefe und Schriftrollen fanden sich auf ihren Brettern. Obwohl ein großer Mensch sich strecken musste, um das oberste Brett zu erreichen, wirkten die Regale in dem gewaltigen Saal beinahe verloren. Ihre Sammlung von Büchern, angelegt und erweitert von Byasso, war winzig im Vergleich zu der Großen Bibliothek von Venzara, in die Ben damals eingedrungen war, um die berühmten Fensterscheiben aus buntem Glas für Anula zu stehlen. Sie war kleiner als die des Hellwahtempels in Trollfurt und auch kleiner als die der meisten Ordensklöster, und trotzdem hatte Byasso von Anfang an auf den großen Raum bestanden.
»Das ist eine wichtige Entscheidung, Ben«, hatte er gesagt, weil er als Sohn eines Bürgermeisters immer daran dachte, wie eine Handlung und Entscheidung nach außen wirkte. »Ein Zeichen für uns alle. Das hier ist erst ein Anfang, die Bibliothek soll stetig wachsen. Wissen ist wichtig, und die Größe des Saals zeigt, dass du an die Bibliothek und ihr beständiges Wachsen glaubst. Wenn du die Bücher dagegen in eine kleine Kammer steckst, vermittelst du allen, dass die Menge der Bücher und das Wissen klar erkennbare Grenzen haben. Dabei haben wir in der riesigen Festung doch mehr als genug Platz für alles.«
Also war die Bibliothek hier gelandet, und Byasso hatte sie gefüllt. Mit Cathe und Feuerschuppe zusammen hatte er seine Bücher aus Trollfurt geholt und dazu eine weitere Handvoll seines Vaters entwendet. Drei unterschiedliche Klöster hatte er mittels gefälschter Briefe dazu gebracht, Knappen mit bestimmten Büchern zu Morghon zu schicken, weil der Hohe Abt die angeblich benötigte, und die Knappen hatte er dann überfallen und ausgeraubt. Jeden der Geächteten hatte er dazu gedrängt, überall nach jeder Art von Schriften Ausschau zu halten. Er hatte Bücher im Spiel gewonnen und sich weitere ertauscht. Stetig erweiterte er die Sammlung, und die Bibliothek wuchs. Byasso katalogisierte die Schriften, sortierte sie, begeisterte andere dafür und las selbst, so viel er konnte. In jedem Werk suchte er nach Wissen, das sie im Kampf gegen den Orden verwenden konnten.
»Byasso?«, fragte Ben laut, als er die Bibliothek betrat, doch er erwartete keine Antwort, und er bekam auch keine. So früh am Morgen kam außer ihm kaum jemand her, und deshalb tat er es, wenn er Ruhe zum Nachdenken brauchte.
Gemächlich durchquerte er die Bibliothek, fuhr im Vorbeigehen mit den Fingerspitzen über die Regale und ließ den Blick über die Buchrücken gleiten. Dann betrat er das Planungszimmer, das Byasso im angeschlossenen Nebenraum eingerichtet hatte.
»Kriegszimmer«, hatte er es ursprünglich genannt, aber Ben war gegen den Namen gewesen, denn er hoffte noch immer, dass der Kampf gegen den Orden sich nicht zu einem Krieg auswuchs.
Aber von dem Zimmer selbst, das von einem massiven runden Tisch dominiert wurde, war er begeistert gewesen. Ein Raum, der ganz dem Kampf für die Freiheit der Drachen gewidmet war, in dem sie zusammen Pläne schmieden, Wissen sammeln und Fortschritte dokumentieren konnten.
Unter anderem hatte Byasso auch eine Liste mit allen bekannten Blausilberschmieden des Großtirdischen Reichs angelegt, die er und Ben bei neuen Erkenntnissen regelmäßig ergänzten. Auf dem zentralen Tisch lag eine große ausgebreitete Landkarte des Großtirdischen Reichs, festgeklopft mit kleinen Nägeln, damit sie nicht verrutschte. Alle Fenster waren – wie die der gesamten Bibliothek – mit Glasscheiben ausgestattet, damit weder Regen noch Wind die Bücher schädigen konnten, und Schnee auch nicht, sollte der Winter überraschend streng werden. Die Scheiben stammten ausnahmslos aus Venzara, und so war das Glas klar und der Raum hell.
Langsam trat Ben an den Tisch und ließ den Blick über die Karte schweifen. Quer über das ganze Land verteilt saßen zahlreiche weiße, glatt geschliffene Feuersteine und graue Granitwürfel mit harten Kanten, während die seltenen Türme aus schwarzem Obsidian fast ausschließlich in den nördlichen Bergen standen.
Jeder der Feuersteine repräsentierte eine Blausilberschmiede, die noch immer ihre Arbeit tat. Gelang es ihnen, einer Schmiede ihr Ewiges Feuer zu entwenden, nahmen sie den entsprechenden Stein von der Karte und warfen ihn in eine Holzschale daneben. Denn ohne Ewiges Feuer konnten keine Blausilberwaffen geschmiedet werden, und die Schmiede verlor ihre Bedeutung für den Kampf. Elf Steine lagen bereits in der Schale, doch auf der Karte standen noch deutlich mehr. Ben hatte sie nie gezählt, er wollte nicht wissen, wie viele es waren.
Kurz nachdem der Vulkan Arknon erloschen war, hatten sie mehrere Schmieden überfallen, die überrumpelten Schmiede gefesselt und das Feuer aus dem Boden gegraben. Einst hatten sie es mithilfe einer Stahlplatte fortgetragen, nun hatten sie den vulkangeborenen Drachen Orghonikk dabei. Er hatte die nie erlöschenden Flammen mit blanken Klauen getragen und sie ins Meer geworfen, weit entfernt von der Küste. Unter Wasser waren die Feuer zu winziger Glut zusammengeschrumpft und auf den Grund gesackt, wo sie keinen Schaden anrichten konnten. Niemand würde sie dort finden und heraufholen, um die Flammen aus der unzerstörbaren Glut zu wecken. Niemand konnte so tief hinabtauchen, niemand vom Orden wusste überhaupt, wo die Glut lag.
Doch schon bald hatte der Orden begriffen, was sie taten, und seitdem ließ er jede Blausilberschmiede von Rittern und angeheuerten Söldnern bewachen, meist begleitet von einem oder zwei flügellosen Drachen. Der Orden wusste, was auf dem Spiel stand, und die Ritter waren angespannt und bereit, jeden Eindringling ohne das geringste Zögern anzugreifen und totzuschlagen. Seitdem hatten die Geächteten die Überfälle auf die Schmieden eingestellt. Ben wollte niemanden der Geächteten in den Tod schicken, auch wollte er keine Verwüstung in den Städten anrichten. Er wollte die Leute auf seine Seite ziehen und davon überzeugen, freien Drachen zu vertrauen, und das gelang nicht, wenn man mit fauchenden Drachen über einen Handwerker herfiel. Das würde nur alle im Irrglauben bestätigen, geflügelte Drachen seien von Samoth, dem lügnerischen Gott der dunklen Orte, verflucht und bösartige Geschöpfe.
Nein, sie mussten mit List vorgehen, auch wenn sie noch nicht genau wussten, wie. Und so hatten sie sich in letzter Zeit vor allem darum gekümmert, die Festung winterfest zu machen und Wissen zu sammeln. Byasso hatte weiter Bücher beschafft, und Yanko und Feuerschuppe hatten einem einzelnen Ritter auf der Straße sein Schwert geraubt, doch ansonsten war es zu keinen Auseinandersetzungen gekommen.
Der Hohe Abt Morghon suchte fieberhaft nach den Geächteten, das hatte Nesto ihnen geschrieben. Er durchsuchte Häuser und Kutschen auf bloßen Verdacht hin, Verleumdungen und Angst nahmen in Rhaconia und dem Umland zu, immer wieder wurde jemand verhört. Wie es im Rest des Landes stand, wusste Nesto nicht, aber vermutlich nicht viel anders.
Orghonikk war aufgebrochen, um mit seinem Gespür für Vulkane zu schauen, ob es weitere gab, mit deren Feuer sich Blausilber zu Klingen schmieden lassen würde. Um herauszufinden, ob noch von anderen Orten Gefahr ausging. Und sicher auch, um für eine Weile allein zu sein, denn Drachen waren im Grunde ihres Herzens Einzelgänger. Auch wenn es Ausnahmen gab, wie die Drachen hier auf der Insel tagtäglich bewiesen.
Während die Geächteten weiter nach einer neuen List suchten, ließ der Orden in jeder Mine mit höchster Anstrengung Blausilber aus der Erde schürfen. Die Schmieden liefen Tag und Nacht und produzierten Schwert um Schwert, getrieben von der Angst, sie könnten das letzte Ewige Feuer eines Tages verlieren.
Getrieben von der Angst vor uns, wiederholte Ben den Gedanken, und ein kurzes Lächeln huschte über seine Lippen. Vereinzelt ließen sich Adlige oder Händler, die reich genug waren, um Blausilber zu besitzen, daraus Schmuck anfertigen, um zu zeigen, dass sie keine Angst hatten. Nicht vor einer Handvoll Geächteter.
»Allein indem sie über uns reden, zeigen sie, dass sie uns ernst nehmen«, hatte Byasso dazu gesagt. »Wären wir tatsächlich unwichtig, würden sie uns überhaupt nicht erwähnen. Mit dem Erlöschen des Vulkans haben wir sie beunruhigt, völlig egal, was sie sagen.«
»Ach, alle Reichen besitzen sowieso schon eine Blausilberklinge und dazu zahlreiche Wachen«, hatte Aiphyron gebrummt. »Mit dem Schmuck zeigen sie nur, dass sie Glitzerdinge mögen und den ärmeren Angstschlotterern kein Schwert gönnen.«
Trotz der alten Prophezeiung hatte kaum jemand geglaubt, dass der Vulkan Arknon tatsächlich erlöschen könnte. Und auch wenn die unterschiedlichsten Geschichten im Umlauf waren, wie das hatte geschehen können, gaben doch viele Ben, dem Drachenflüsterer, die Schuld. Dem Anführer der Geächteten.
Dem Sohn Samoths.
Gefährte der schillernden Frau.
So unmöglich die Aufgabe erschienen war, sie hatten sich darauf gestürzt und nicht klein beigegeben, und mit viel Glück war es ihnen tatsächlich gelungen. Mit Glück, und weil sie den Orden überrascht hatten. Doch jetzt, nachdem das scheinbar Unmögliche getan war? Jetzt, da nichts mehr unmöglich scheinen sollte, fühlte sich Ben von der Menge der Aufgaben erdrückt. Jetzt wollten sie das Feuer aller Blausilberschmieden löschen, dem Orden jede Blausilberklinge entwenden, Hunderte unterworfene Drachen befreien und jeden einzelnen heilen und sämtliche Bewohner des Großtirdischen Reichs von der Wahrheit überzeugen. Für sich betrachtet – einen Drachen befreien, eine Schmiede berauben, eine Klinge im Meer versenken – schien keine der Aufgaben auch nur annähernd so schwierig wie das Erlöschen des Vulkans, doch die schiere Menge drohte Ben zu erdrücken. Wie sollten sie das je schaffen? Was sollten sie zunächst angehen?
Unbewusst begann Ben, die Feuersteine zu zählen, doch bei zwanzig brach er wieder ab und murmelte: »Zu viele.«
Auch das Überraschungsmoment hatten sie nicht mehr auf ihrer Seite, längst wusste der Orden, worauf sie es abgesehen hatten. Zahlenmäßig waren die Ritter ihnen hundertfach überlegen, und noch mehr. Hinzu kam, dass sie mit ihrem Reichtum Tausende Söldner anheuern konnten, die für den Orden kämpften, glaubten, sprachen oder auch einen Kopfstand machten, ganz wie Morghon es ihnen befahl.
»Geld«, schnaubte Ben. Immer wieder lief es darauf hinaus. Damals in Trollfurt hatte er sich jahrelang ohne durchgeschlagen, aber jetzt …? Jetzt war er nicht mehr allein, und die Verantwortung ließ ihn schlecht schlafen.
Was, wenn der Winter Einzug hielt und die Vorräte knapp wurden, wenn die Kopfgelder weiterwuchsen und die Ersten es bereuten, sich ihnen angeschlossen zu haben? Fluchend vergrub Ben den Kopf in den Händen.
Er kam nicht nur her, wenn er nachdenken wollte, sondern auch, wenn er niedergeschlagen und hoffnungslos war. Das wollte er den anderen nicht zeigen, sie verließen sich auf ihn. Allein durfte er es sein – wenigstens für einen Moment.
»Ihr seid mehr, aber wir können fliegen«, knurrte Ben und griff sich die Liste an Schmieden, denen das Ewige Feuer verliehen worden war.
Die Liste war nicht nur lang und vielleicht unvollständig, von den drei aufgeführten Orten Krathen, Eichschlag und Steinmahren wussten sie nicht, wo sie lagen. Auf keiner Landkarte hatten sie sie bislang gefunden, keinen klaren Hinweis in irgendeinem Text, nur dass sie das Ewige Feuer bekommen hatten.
»Kleine Weiler, vergessene Dörfer oder eine einsame Schmiede irgendwo im Niemandsland«, hatte Byasso vermutet.
Aber waren diese Schmieden noch immer in Betrieb oder hatte der Orden sie selbst längst aufgegeben oder einfach vergessen? Brannten dort noch immer Flammen vor sich hin, ungenutzt und unbeachtet, unbewacht und leicht zu entwenden? Oder war das Feuer längst an einen anderen Ort gebracht worden?
Für Eichschlag und Steinmahren konnte Ben das glauben, doch nicht für Krathen. Dorthin war laut der Aufzeichnungen das erste Feuer vom Vulkan Arknon geschafft worden, noch bevor selbst der Schmied des Königs seines erhalten hatte. Was war das für ein Ort, der so bevorzugt wurde? Welcher Schmied hatte damals dort gearbeitet? Und weshalb war er heute vergessen, der Ort ebenso wie der Schmied?
Suchend ließ Ben den Blick über die Karte gleiten, wie er es schon so oft getan hatte. Während die Feuersteine Blausilberschmieden markierten, standen die Obsidiantürme für aktive Blausilberminen und die grauen Granitwürfel für Kloster des Ordens oder andere Orte, an denen viele Blausilberwaffen versammelt waren. Die ganze Karte war übersät mit Markierungen, nur nordwestlich von Aphrasehr, in der Ebene der rollenden Winde, befanden sich kaum Feuersteine. Lagen dort die gesuchten Schmieden Eichschlag, Steinmahren und Krathen?
Oder sogar noch weitere?
Grübelnd blätterte Ben in zwei neue Bücher hinein, die Byasso ihm am Vortag herausgelegt hatte, wie er es manchmal tat: Die abenteuerlichen Reisen des Wellenbrechers Lyssiver durch die sieben Meere und Die Trollkriege – Erinnerungen des Ritters Garnath. Beides dicke Bücher mit abgegriffenen Einbänden.
Auf den ersten Blick entdeckte Ben weder hier noch da einen Hinweis auf das Ewige Feuer, auch nicht auf den zweiten und dritten, nur eine Reihe an Rezepten der zutiefst verwerflichen Trollküche in Garnaths Aufzeichnungen. Kopfschüttelnd las er die ersten Überschriften, Darmwickel im Augen-Ohren-Sud und Schweißfußsuppe mit Rattenzähnchen, und legte die Bücher angewidert zur Seite. Er würde Byasso fragen, was es damit auf sich hatte und ob er sie schon gelesen hatte. Zugleich musste er verhindern, dass Sidhy sie in die Finger bekam; nicht dass der bei den Rezepten noch auf dumme Gedanken kam.
Im Augenwinkel bemerkte er plötzlich eine Bewegung vor dem Fenster und fuhr herum. Draußen flatterte der stachelbewehrte erdbraune Wachdrache Quobemhonn auf der Stelle und blickte auffordernd herein. Fünf Generationen lang hatte er in Rhaconia das Anwesen einer Händlerfamilie behütet, und das hatte Spuren in seinem Verhalten hinterlassen. Täglich flog er um das Verlies der Stürme und hielt nach Besuchern Ausschau, gebetenen wie ungebetenen. Nun knurrte er etwas, das Ben durch die Glasscheibe hindurch nicht verstand.
Ben zuckte mit den Schultern, hob dann die Hand zu einem kurzen Gruß und wollte sich abwenden.
Wieder rief Quobemhonn etwas.
Erneut zuckte Ben mit den Schultern.
Quobemhonn rief lauter.
Ben hob fragend die Arme. Drachen hatten keine Lippen, es war schwer zu lesen, was sie sagten.
Quobemhonn deutete auf Ben und das Buch vor ihm auf dem Tisch und tat so, als würde er sich etwas in den Mund schieben.
»Essen?«, fragte Ben und dachte angewidert an die Schweißfußsuppe mit Rattenzähnchen. Rattenzähnchen! Woher kannte Quobemhonn das? Oder meinte er ein anderes Rezept? »Ich?«
Quobemhonn nickte grinsend.
»Nein!« Entsetzt schüttelte er den Kopf.
Quobemhonn nickte nachdrücklich.
»Du?«
Noch ein Nicken.
Ben griff wieder nach dem Buch, um dem Burschen das Rezept unter die Nase zu halten, doch Quobemhonn schüttelte den Kopf, und da endlich begriff Ben. Es ging nicht um das Buch, es ging ums Frühstück. Erst jetzt wurde ihm richtig bewusst, wie hell es draußen war, die Sonne musste schon mehrere Handbreit über dem Horizont stehen. Sein Magen knurrte laut, und Ben nickte und rief: »Gleich.«
Quobemhonn salutierte zufrieden und flog weiter.
Ben wollte vor dem Frühstück nur noch kurz in das dicke schwarze Buch sehen, in dem Byasso einen Überblick über ihr Geld zu behalten versuchte. Darin notierte er nicht nur alle größeren Ausgaben und Einnahmen, sondern auch, welche wichtigen Anschaffungen noch bevorstanden.
Yanko lachte oft darüber und rief: »Ach, was uns fehlt, das holen wir uns alles vom Orden, da kostet es uns nichts.«
Doch alles konnten sie nicht stehlen, und so war Ben dankbar für die Aufzeichnungen. Ohne sie hätte er nicht einmal annähernd einen Überblick über ihr Geld, das hatte er nie gelernt. Schöner Anführer! Hastig schlug er das Buch auf, sein Magen knurrte schon wieder, noch lauter diesmal. Der letzte Eintrag lautete noch immer:
Söldner – 1000 Gulden.
Laut den Brüdern Knechter, geschickten Spionen für die Geächteten, waren die Söldner, die vom Orden für die Bewachung der traditionsreichen Schmiede von Drakenthal angeheuert worden waren, zu einem Handel bereit. Für tausend Gulden wollten sie sich kampflos überwinden lassen, denn Wahrheit oder Lüge war ihnen egal, sie glaubten einzig an Gold. Ben gefiel diese Haltung nicht, aber er wollte das Feuer. Das Problem war nur, dass sie keine tausend Gulden besaßen und das Angebot nur noch zehn Tage galt. Woher also sollten sie das Geld nehmen?
Hungrig schlug Ben das Buch wieder zu. Dass sie mehr Geld brauchten, als sie besaßen, wusste er, den großen Überblick musste Byasso behalten. Und vielleicht Anula, sie hatte früher in einem reichen Haushalt gedient und dort den Umgang mit Geld gesehen und war schlau. Schulterzuckend stellte Ben das Buch zurück und ging essen.
»Ich weiß, wie wir an Gold kommen!«, rief Yanko und sprang von seinem Stuhl auf, als Ben den großen Speisesaal im Erdgeschoss der Festung betrat.
Alle Geächteten wussten von dem Angebot der Söldner und den fehlenden Vorräten, jeder machte sich Gedanken über das Geld.
»Weiß er nicht«, widersprach Anula und schüttelte den Kopf, blieb aber sitzen.
»Doch«, beharrte Yanko, die Hände auf die Tischplatte gestützt.
Ein gutes Dutzend Geächteter saß beim Frühstück, und hier und da wurde genickt. Der Saal wurde von einer riesigen Tafel dominiert, an der einst die Seetrolle gespeist hatten. Die Geächteten hatten die Tischbeine auf ein menschliches Maß gekürzt und fanden an ihr allesamt Platz; sie hätten sogar noch Gäste einladen können.
»Doch«, bestätigte auch Tharas schmatzend, den Blick auf Ben gerichtet, während der kleine Drache Ellyhmottheen ihm heimlich eine dicke Scheibe Wurst vom Teller stibitzte.
»Zu riskant!«, riefen dagegen andere, und Ben begriff, dass Yankos Idee schon länger diskutiert wurde. Aus der Küche zog der Duft von frischem Tee und Gebratenem herüber, Zwiebeln und Eiern. Auch Ziegenkäse roch Ben, und das Wasser lief ihm im Mund zusammen.
»Unser ganzer Kampf ist riskant!«, stellte Yanko klar, in alle Richtungen blickend. »Es kann immer etwas schiefgehen, und …«
»Was ist dein Plan?«, unterbrach ihn Ben. Er hatte nicht den Eindruck, als käme er zum Essen, bevor er sich geäußert hatte. Sein Magen knurrte fordernd.
»Ganz einfach.« Mit glänzenden Augen deutete Yanko auf die Steckbriefe, die sich über alle vier grauen Wände verteilten. Fast jeder Geächtete hing dort, viele mehrfach und falsch beschrieben oder furchtbar schlecht gezeichnet; manche Steckbriefe waren geknickt, manche eingerissen, manche mit Flecken übersät. Sie hatten sie überall im Großtirdischen Reich eingesammelt. Die Belohnungen schwankten von wenigen Gulden bis einigen Tausend – und mehr.
Yanko verkündete: »Wir müssen nur einen von uns beim Orden abliefern. Einen, der gesucht wird, natürlich.«
»Was?«, entfuhr es Ben.
»Überleg doch, wie hoch manche Kopfgelder sind! Zwei, drei von uns verkleiden sich einfach als Kopfgeldjäger, schleppen einen anderen von uns in ein Kloster und kassieren die ausgesetzte Summe.« Yanko grinste und breitete begeistert die Arme aus. »Und noch in derselben Nacht befreien wir ihn aus seiner Zelle.«
Ben starrte ihn an.
»Mit etwas Glück steigt sein Kopfgeld dann sogar noch weiter, weil er fliehen konnte. Und der Orden hat sich wieder einmal vor allen lächerlich gemacht.«
»Die Idee hatten wir schon mal«, sagte Nica. Sie hatte tiefe Augenringe, als hätte sie kaum oder gar nicht geschlafen. »Und haben sie verworfen.«
»Ich finde sie trotzdem gut«, hielt Vilette dagegen, und Nica musterte sie kalt, sagte jedoch nichts.
»Nur, wenn einer sich freiwillig meldet«, warf Akse ein und hob mahnend die Gabel. »Niemand kann durchs Los gezwungen werden, dass …«
»Natürlich nicht!«, stieß Yanko verärgert aus. »Niemand wird zu irgendwas gezwungen, wir sind nicht der Orden.« Dann sah er sofort wieder Ben an. »Und? Was denkst du?«
»Ich denke, ich hab Hunger. Ich brauch erst mal Frühstück«, sagte er und sah, wie Byasso lächelte. Nie überhastet eine Entscheidung treffen, hatte der ihm mehrmals bei Gesprächen in der Bibliothek geraten. Zurückrudern ist viel zu schwierig.
»Da!« Yanko warf ihm Brot und ein Stück harten Ziegenkäse zu. Ben fing beides und ließ sich auf den nächsten Stuhl sinken.
»He!«, protestierte Akse lautstark. »Keine Bestechungen.«
Manche lachten, Ben grinste. Dann biss er glücklich ab und kaute. Im Augenwinkel entdeckte er Ellyhmottheen, der sich ihm langsam näherte, wobei er das Geschirr auf dem Tisch als Deckung nutzte. Ben drehte sich um und fixierte den Drachen. Der Drache sah rasch weg und tapste bemüht unauffällig fort. Fehlte nur noch, dass er ein harmloses Lied pfiff.
»So, wie du es erzählst, klingt es natürlich gut«, sagte Anula, während Ben kaute. »Schnell alle Geldsorgen loswerden und dabei sogar noch den Orden demütigen. Aber was, wenn das mit der Befreiung nicht klappt? Was, wenn es zur Hinrichtung kommt? Wenn einer von uns am Galgen landet, weil wir ihn selbst verkauft haben? Willst du das Blutgeld wirklich haben?«
Einige Geächtete sahen unwohl weg, doch Yanko schüttelte vehement den Kopf.
»Das wird nicht passieren«, beharrte er. »Mit der Befreiung von Ben damals haben wir bewiesen, dass es klappt.«
Fast hätte Ben eingeworfen, dass der erste Versuch nicht sonderlich erfolgreich gewesen war, aber er hatte den Mund so voll, dass er kein Wort herausbrachte.
»Und Sinje«, ergänzte dafür Vilette. »Die haben wir auch befreit.«
Auch dazu hätte Ben gern etwas gesagt, konnte aber noch immer nicht. Er kaute, so schnell er konnte.
»Inzwischen passen sie besser auf«, erwiderte Anula ruhig, aber bestimmt.
»Woher willst du das wissen?«, rief Yanko.
»Sie bewachen jede Schmiede im Land aus Angst vor uns. Warum sollten sie dann ausgerechnet ihre eigenen Klöster ohne Schutz lassen?«
»Genau deshalb!« Yanko deutete mit dem Zeigefinger auf sie. »Weil alle Ritter auf die Schmieden verteilt wurden, ist kaum noch jemand in den Klöstern, um sie zu verteidigen.«
»Das glaube ich nicht.« Akse schnaubte. »Der feige Morghon verzichtet bestimmt nicht auf eine fette Leibwache.«