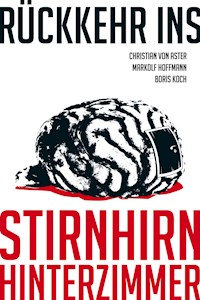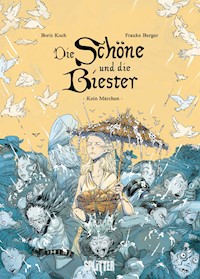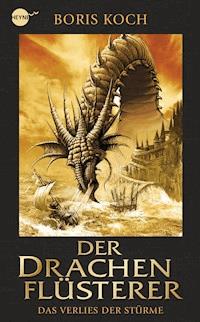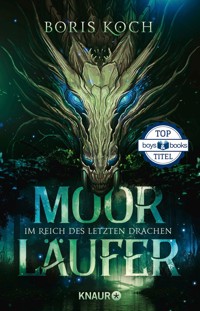
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Hüte dich vor der Bestie im Moor – und vor der Nacht in den Herzen der Menschen Düster, geheimnisvoll und hoch atmosphärisch erzählt Boris Koch im Fantasy-Roman »Moorläufer. Im Reich des letzten Drachen« von Irrlichtern, Schuldgefühlen und dem Monster im Moor. Nur in den gewaltigen nebelverhangenen Schwarzmooren am Rand des Königreichs ist jener besondere Torf zu finden, der die magischen Feuer der Alchymisten nährt. Jeden Tag riskieren die Torfstecher aus der abgelegenen Stadt Nebelbruch ihr Leben für das wertvolle Gut, denn im Moor lauert der Tod in mannigfaltiger Gestalt: Ein falscher Schritt, und man versinkt in der schwarzen Tiefe oder wird von fleischfressenden Sumpfkriechern angefallen. Nachts locken Irrlichter die Unvorsichtigen und Einsamen ins Verderben, und im dunklen Herz der Schwarzmoore haust der Letzte der grausamen Drachen: der sagenumwobene Nachtwyrm. Immer wieder tötet die Bestie Menschen, und auch die Schwester des jungen Milan fällt ihr zum Opfer – einen Moordiamanten in der Hand, gestohlenes Eigentum des Königs. Die Wut über den Diebstahl trifft Milans gesamte Familie hart. Seine Eltern sind gebrochen und geben ihm die Schuld, dass seine Schwester zur Diebin wurde. Und er, geplagt von Alpträumen, schafft es nicht, die Vorwürfe abzuschütteln. Gefangen zwischen Schuldgefühlen und Rachegedanken durchstreift Milan auf längst vergessenen Pfaden das Moor – ohne die Wahrheit über sich selbst zu ahnen. Und der Nachtwyrm ist weiterhin hungrig … Tauche ein in die atmosphärischen Märchenadaptionen von Boris Koch: - Dornenthron - Narrenkrone
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Boris Koch
Moorläufer
Im Reich des letzten Drachen
Roman
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Hüte dich vor der Bestie im Moor – und vor der Nacht in den Herzen der Menschen
Düster, geheimnisvoll und hoch atmosphärisch erzählt Boris Koch im Fantasy-Roman »Moorläufer. Im Reich des letzten Drachen« von Irrlichtern, Schuldgefühlen und dem Monster im Moor.
Nur in den gewaltigen nebelverhangenen Schwarzmooren am Rand des Königreichs ist jener besondere Torf zu finden, der die magischen Feuer der Alchymisten nährt. Jeden Tag riskieren die Torfstecher aus der abgelegenen Stadt Nebelbruch ihr Leben für das wertvolle Gut, denn im Moor lauert der Tod in mannigfaltiger Gestalt: Ein falscher Schritt, und man versinkt in der schwarzen Tiefe oder wird von fleischfressenden Sumpfkriechern angefallen. Nachts locken Irrlichter die Unvorsichtigen und Einsamen ins Verderben, und im dunklen Herz der Schwarzmoore haust der Letzte der grausamen Drachen: der sagenumwobene Nachtwyrm.
Immer wieder tötet die Bestie Menschen, und auch die Schwester des jungen Milan fällt ihr zum Opfer – einen Moordiamanten in der Hand, gestohlenes Eigentum des Königs. Die Wut über den Diebstahl trifft Milans gesamte Familie hart. Seine Eltern sind gebrochen und geben ihm die Schuld, dass seine Schwester zur Diebin wurde. Und er, geplagt von Alpträumen, schafft es nicht, die Vorwürfe abzuschütteln.
Gefangen zwischen Schuldgefühlen und Rachegedanken durchstreift Milan auf längst vergessenen Pfaden das Moor – ohne die Wahrheit über sich selbst zu ahnen.
Und der Nachtwyrm ist weiterhin hungrig …
Tauche ein in die atmosphärischen Märchenadaptionen von Boris Koch:
Dornenthron
Narrenkrone
Inhaltsübersicht
Widmung
Karte
Prolog
I Schuld
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
II Irrlicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
III Torf
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
IV Alchymie
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
V Herzen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
VI Nachtwyrm
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Danksagung
Für Sandra und Sven,
die man gern an der Seite hätte, müsste man ins Moor.
Oder auch in den Biergarten …
Prolog
Nebel kroch über das nächtliche Moor und ballte sich dichter und dichter zwischen den Bäumen. Mit schweren Schritten kehrten die Torfstecher aus den Abbaugruben zurück, viel später, als Milan gedacht hatte. Als er sie hörte, trat er hinter den nächsten Baum, um nicht bemerkt zu werden. Er drückte sich in den Schatten, die Hand um die kleine Schnitzerei in seiner Tasche gelegt, und lugte vorsichtig auf den Weg hinaus.
Im Fackelschein sah er hängende Köpfe und vertraute Gesichter, erschöpft und verdreckt, und nirgendwo ein Lächeln – er hatte nach den Befehlen der Freifrau auch keins erwartet. Viele schwiegen, manche murmelten vor sich hin, doch niemand erwähnte den Nachtwyrm. Es musste ihn niemand erwähnen, sie alle hatten ihn im Kopf; die Dunkelheit war seine Zeit.
»Geh schneller«, murrte jemand, »der Nebel drückt mir schon das Herz zusammen.«
»Sei doch ruhig«, motzte ein anderer, aber alle schritten aus, niemand wollte bei Nacht noch im Moor sein.
Auch Milan nicht, aber er musste, denn er wollte sie unbedingt finden, auch wenn er nicht wusste, wie. Die Schwarzmoore waren unermesslich weit und tückisch, er musste einfach auf sein Glück vertrauen, auch wenn es verrückt war. Noch einmal berührte er sanft die Schnitzerei in seiner Tasche, dann trat er auf den Pfad hinaus. Die letzten Torfstecher und Fackeln waren in Richtung Nebelbruch verschwunden, und Milan lauschte ihnen nach, bis er nichts mehr hörte. Dann drehte er sich um, hin zum Moor, zur Nacht, zum Nebel. Zum Reich des Nachtwyrms.
Langsam setzte er sich wieder in Bewegung. Er dachte zurück an die Tage vor fünfeinhalb Jahren, als dies alles begonnen hatte. Damals war er noch ein Kind gewesen, gerade mal elf Jahre alt, und es hatte sich alles geändert.
I Schuld
1
Es würde noch knapp fünf Jahre dauern, bis Milan einem Irrlicht folgen durfte, um ein königlicher Torfstecher zu werden. Fünf lange Jahre, bis er endlich alt genug wäre, um im Moor nach Nachttorf zu graben. Doch noch blieb er zurück, wenn seine Eltern und seine Schwester Elyn im Morgengrauen aufbrachen, und sah ihnen und den anderen Torfstechern aus der Nachbarschaft nach. Sie hatten die Spaten geschultert, und ihr Schritt war schleppend, weil es niemand eilig hatte, zur Arbeit zu kommen. Durch die verwinkelten Gassen des alten Pfahlviertels verließen sie die Stadt, um auf den nur anfangs befestigten Wegen hinaus ins Moor zu ziehen, wo Sumpfkriecher, Giftschlangen, Mücken und tückische Moorlöcher warteten und immer wieder auch der dichte, lichtverschlingende Nebel, der vielen eine Gänsehaut verursachte, selbst an heißen Sommertagen. Anderen, wie Milans Mutter, kroch er tief in die Knochen und ließ die Gelenke an Fingern und Füßen rot anschwellen, sodass jede Bewegung schmerzte. Trotzdem gruben sie wie alle, denn der Nachttorf musste ohne Unterlass abgebaut werden. Der König duldete keine Verzögerungen, und die Freifrau Jade von Nebelbruch achtete darauf, dass es keine gab.
Kurz nach den anderen verließ auch Milan das schmale Holzhaus mit den Schindeln aus gehärteter Sumpfzypressenrinde und holte nebenan seinen besten Freund Pjer ab, der drei Monate älter, einen halben Kopf größer und um einiges kräftiger war. Gemeinsam gingen sie zur Arbeit in den königlichen Torfwerken am nordwestlichen Rand Nebelbruchs, ein gutes Stück vom Pfahlviertel entfernt. Dort schufteten sie zusammen mit weiteren Torfstecherkindern, die noch nicht ins Moor durften, und Alten und Versehrten, die ihre Zeit in den Abbaugebieten hinter sich hatten und hier nun nützlicher waren.
Weil die beiden Sorten Torf bei Licht nicht recht zu unterscheiden waren, teilten sie ihn im Dunkel einer fensterlosen Außenhalle auf. Der gute Nachttorf, der von einem kaum erkennbaren silbernen Schimmer durchzogen war, wanderte in die glockenförmigen Öfen im Herzen der Torfwerke. Dort wurde er erhitzt und zu nachtschwarzer Torfkohle gepresst, die von den Alchymisten für ihre Kunst verwendet wurde. Silbern schimmerte sie nur noch im Schein des Vollmonds oder eines Irrlichts. Sternenstaub wurde der Schimmer in der Alchymie genannt, obwohl jeder Torfstecher wusste, dass er nichts mit den Sternen zu tun hatte.
Der minderwertige Torf, der sich kaum von dem aus anderen Mooren unterschied, wurde aussortiert, auf lange Pferdewagen verladen und an die drei Brennereien der Stadt verkauft, deren rauchiger Branntwein namens Nachtbrannt stark und im ganzen Land beliebt war. Doch zahlreiche Fässer verließen Nebelbruch gar nicht erst, denn hier, am Rand von Königreich und Schwarzmooren, wurde viel gesoffen, insbesondere in den Nächten, wenn der Nebel sich schwer und dicht auf die Stadt legte.
Abends war Milan regelmäßig erschöpft von der harten Arbeit, wie alle, und er stank nach Feuer, Rauch und Schweiß.
Auf dem Heimweg wurden die Torfstecherkinder immer wieder von den älteren Kindern ehrbarer Familien gehänselt, von den Handwerkersöhnen und Bauerntöchtern und allen anderen, die sich für etwas Besseres hielten. Trotz Erschöpfung und Unterzahl blieben Milan und seine Freunde keine Beleidigung schuldig, sondern stürzten sich mit geballten Fäusten in jeden Kampf. So hatte sein Vater es ihm von klein auf eingebläut: »Auch wenn die anderen uns Torfstecher für Dreck halten, haben wir mehr Mut und Ehre im Leib, als sie sich vorstellen können. Diese selbstgefälligen Feiglinge, die noch nie einen Fuß ins Moor gesetzt haben und zitternd ins Bett pissen, wenn sich ein Irrlicht mal in die Stadt verirrt.«
Und wie viel Mut und Ehre sie im Leib hatten, bewiesen Milan und seine Freunde in jedem Kampf aufs Neue. Kam Milan mit Schrammen oder blutend nach Hause, fragten seine Eltern nicht: »Was ist passiert?«, sondern immer nur: »Habt ihr gewonnen?«
Bestätigte Milan das, waren sie zufrieden.
»Deine Schwester hat sich damals auch nie was gefallen lassen.«
»Das tu ich auch heute nicht«, sagte Elyn darauf jedes Mal und grinste.
Milan war stolz auf sie und seine Eltern und darauf, dass er irgendwann selbst einer der Torfstecher von Nebelbruch sein würde. Nur die wagten sich freiwillig in die gewaltigen menschenfeindlichen Schwarzmoore. Hungrige Sumpfkriecher, Giftschlangen und andere wilde Tiere lauerten dort im Morast, im Wasser oder zwischen den verschlungenen Wurzeln nachtgrauer Sumpfzypressen, hochgewachsener Knotenahorne und anderer Bäume. Nachts lockten Irrlichter die Menschen auf falsche Pfade und tief in die Moore hinein, wo die eine Kreatur hauste, die auch die Torfstecher fürchteten: der Nachtwyrm.
»Der letzte der alten Drachen«, hatte der Vater ihn mit Ehrfurcht in der Stimme gewarnt, noch bevor Milan zwei Jahre alt geworden war und auch nur die Hälfte der Worte kannte. »Der einzige, der dem Drachentöter damals entgangen ist, gnadenlos und schrecklich. Und heutzutage gibt es niemanden mehr, der sich einer solchen Kreatur entgegenstellen könnte.«
Trotz des Nachwyrms und aller Gefahren wagten sich die Torfstecher in die Schwarzmoore hinaus, denn nur dort gab es den Nachttorf, der – erhitzt und gepresst – die dunkelherzigen Flammen mit den silbernen Funken hervorbrachte, die die Alchymisten für ihre gefeierten Werke benötigten. Fluchmedaillons und Heiltränke für alle einfachen Leute, die sich das leisten konnten, auch Feuerwerk, Liebestränke, gewaltige Waffen und anderes mehr. Die Alchymie machte den König von Juwaren zum mächtigsten König des Kontinents, machte sein Königreich zum mächtigsten Land des Kontinents, vielleicht der Welt, doch auf die Torfstecher, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre, sahen alle herab.
»Warum ist das so?«, fragte Milan wieder einmal, nachdem einer der Ihren im Moor geblieben war.
»Wir sind einfach ersetzbar«, meinte seine Schwester verbittert. »Und noch haben wir mehr Kinder fürs Moor als Tote.«
Obwohl das sicherlich der Wahrheit entsprach, war es Milan als Antwort nicht genug. Auch Bauern und Handwerker hatten Kinder, die in ihre Fußstapfen traten.
Also fragte er eines Tages in der Mittagspause auch die einarmige Fajenna, die mit ihnen in den Torfwerken arbeitete. Sie hatte viel erlebt und gesehen, ihr einfach geknotetes Haar leuchtete silbern in der Sonne.
»Sie fürchten den Nachtwyrm und das Moor, und weil wir uns, anders als sie, hinauswagen, machen sie uns und unsere Arbeit klein, um uns nicht bewundern zu müssen«, erklärte sie kauend.
Milan, der dem Gedankengang nur halb folgen konnte, schnaubte. »Wenn sie das Moor fürchten, sollten sie lieber dankbar sein, dass wir unsere Arbeit machen! Sonst müssten sie selbst hinaus, denn der König wird auf den Torf für seine Alchymisten nicht verzichten.« Wie jedes Torfstecherkind sprach er in der Wir-Form von den Torfstechern, auch wenn er noch keiner war. Schließlich würde er einer werden so wie jedes Torfstecherkind.
»Das wird der König nicht«, bestätigte Fajenna. »Aber statt uns würden sie Verbrecher hinausschicken, Verschuldete und Verurteilte. Das sind die, die uns ersetzen oder ergänzen, und weil sie die fürchten, sehen die Leute auch auf uns herab.«
»Das ergibt doch keinen Sinn!«
»Wie vieles im Leben.« Schmunzelnd deutete sie auf ihren vernarbten Armstumpf. »Weißt du, wie ich den verloren habe?«
Milan schüttelte den Kopf, und Pjer, der ihnen zugehört hatte, rückte neugierig näher.
»Nun, es ist über zehn Jahre her. Nur wenige Wochen zuvor hatten wir die Arbeit in einem neuen Abbaugebiet aufgenommen, tief drinnen im Moor, und der Nachttorf war dunkel und schwer, sein Silberschimmer so klar, wie ich es noch nie gesehen hatte. Wir waren stolz darauf, dass wir die Stelle entdeckt hatten, auch wenn uns auf dem Heimweg des Öfteren die Dämmerung überraschte und wir so weit draußen manchmal das Fauchen des Nachtwyrms im Nebel hörten. Also achteten wir auf jedes Geräusch in der Ferne, damit er uns nicht überraschte, aber ich hätte besser mal mehr auf die Nähe achten sollen. Durstig und erschöpft vom Graben, ging ich zum Flussarm hinüber, der ganz in der Nähe vorbeifloss, um zu trinken. Dabei habe ich den jungen Sumpfkriecher übersehen, der wie ein Baumstamm im Wasser trieb. Er war zwei, höchstens drei Schritt lang, aber sein Maul war groß genug, meinen Arm im Ganzen zu verschlingen. Plötzlich schnellte er aus dem Wasser und schnappte zu. Und mit einem einzigen Happs biss er mir den Arm ab.« Schnaubend schüttelte sie den Kopf, als könne sie es noch immer nicht fassen. »Ich schrie und fiel, der Schwanz der Bestie traf mich wuchtig an der Schläfe, und dann waren auch schon meine Kumpane da, allen voran mein Cousin Yiv. Schreiend prügelten sie mit den Spaten auf das Biest ein, vertrieben es, verbanden meine Wunde und schleppten mich sofort zurück in die Stadt – gerade noch rechtzeitig. Tagelang lag ich mit Wundfieber im Bett und schon halb im Grab, aber ich habe überlebt; sie haben mir das Leben gerettet. Yiv grub nun auch da den Torf aus dem Boden, wo ich vor der Verwundung gegraben hatte, und ratet, was passiert ist?«
Milan zuckte mit den Schultern, aber Pjer schien etwas zu ahnen. Er stöhnte auf: »Nein!«
»Doch.« Sie lächelte schief.
»Was denn?«, rief Milan.
»Er hat einen Moordiamanten gefunden.«
»Ich wusste es!« Fluchend schlug sich Pjer die Hand gegen die Stirn.
»Deinen Moordiamanten?«, wiederholte Milan mit schwacher Stimme. Bei dem Gedanken wurde ihm schwummrig. Moordiamanten waren äußerst selten, und ein solcher Fund, der Traum aller Torfstecher, änderte alles. Damit erlangte man in der ganzen Stadt und darüber hinaus Ansehen, nicht nur bei den anderen Torfstechern. Der Stein selbst gehörte natürlich dem König, doch der Finder wurde reich belohnt, und es wurde groß gefeiert, einen Tag lang getanzt und gelacht bis in die Nacht, gesoffen und geschlemmt, und die Freifrau von Nebelbruch bezahlte im Namen des Königs alles.
»Seinen«, korrigierte ihn Fajenna. »Er hat ihn gefunden, es war seiner.«
»Aber hätte das Biest dir nicht den Arm abgerissen …?«
»… wäre es wohl meiner gewesen, ja.«
»Du hast deinen Arm und den Stein verloren, weil du im falschen Moment durstig warst?«, fasste Pjer kopfschüttelnd zusammen.
»So könnte man das sehen, ja. Man könnte aber auch sagen, ich hätte einfach besser aufpassen sollen.«
»Hat dein Cousin dir von dem Geld abgegeben?«, wollte Milan wissen.
»Er hat es versucht. Aber er hatte mir schon das Leben gerettet, Geld habe ich nicht angenommen. Ich hatte den Arm verloren, nicht meinen Stolz und meine Ehre. Was soll ich mit Almosen?«
Pjer schüttelte noch immer den Kopf, während Milan die Worte sacken ließ. Er wäre nicht auf die Idee gekommen, das Geld als Almosen zu betrachten, er hätte das Teilen als gerecht empfunden, aber sie wusste eben mehr. In Zukunft würde er auf so etwas achten – auch wenn er natürlich nicht den Arm verlieren wollte. Doch auf keinen Fall wollte er Stolz und Ehre verlieren, ohne die wäre er kein richtiger Torfstecher. Schließlich fragte er: »Und was hat das damit zu tun, dass die anderen auf uns herabsehen?«
»Nichts«, gestand Fajenna. »Es sollte dir nur zeigen, dass vieles im Leben keinen Sinn ergibt und man es trotzdem hinnehmen muss. Es lohnt nicht, über etwas zu verzweifeln, das man nicht ändern kann.«
Milan nickte zögerlich, obwohl er ans Verzweifeln nie gedacht hatte.
»Vielleicht hast du das von deiner Schwester. Die hat am Anfang dieselben Fragen gestellt – und noch mehr. Aber sie hat ebenso fleißig gearbeitet, ich mochte sie. Wie geht es ihr?«
»Gut«, erwiderte Milan knapp. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass Elyn zu Hause mit zehn oder elf auch so viel gefragt hatte. Aber damals war er auch noch sehr jung gewesen. Heute fragte sie wenig.
»Ich wette, sie hat viele Verehrer, sie war immer hübsch.«
»Ich weiß nicht, sie redet nie darüber«, wich er aus.
»Nie?« Fajenna schmunzelte. »Dann hat sie wohl die falschen.«
»Oder keinen.«
»Dann würde sie auch darüber reden«, behauptete Fajenna und erhob sich; die Pause war vorüber.
Milan, der während des Gesprächs vergessen hatte zu essen, schlang hastig seine letzten Happen herunter und eilte den anderen in die stickige Halle nach.
Bereits vor gut tausend Jahren hatten hier die ersten Torfstecher und Moorfischer gesiedelt, wusste Milan, am festen rechten Ufer des Yssypy, während sich am linken die unermessliche Weiten der wilden Schwarzmoore erstreckten. Schon bald war Enary gekommen, ein Freiherr ohne Land, aber mit dem Segen des Königs, und hatte im Jahr 643 den Grundstein seiner Burg auf den weißen Felsengrund neben der Torfstechersiedlung gesetzt. 643 galt fortan als Jahr der Stadtgründung, als wäre davor nichts gewesen, und Enary war nun kein Freiherr ohne Land mehr, sondern der von Nebelbruch.
Mit ihm kamen Soldaten und Handwerker, die seine Burg errichteten, samt ihren Familien. Bauern siedelten sich an und bestellten die fruchtbare Ebene jenseits des schmalen Felsplateaus auf der rechten Flussseite. Ohne zu murren, bezahlten sie ihre Abgaben, sie waren es nicht anders gewohnt. Jeder, der auf dem Felsengrund und in der Ebene siedelte, musste Abgaben bezahlen, so legte es der Freiherr, der Herr der Stadt, fest und ließ es sich vom König in der fernen Hauptstadt bestätigen.
Die Armen dagegen stöhnten über die Abgaben, darunter auch die Torfstecher und Moorfischer, die die Stadt ursprünglich gegründet hatten. Zwar arbeiteten sie auf der linken Flussseite im Moor, doch wohnten sie in der Stadt. Bis einige von ihnen auf die Idee kamen, über dem Fluss und den Ausläufern des Moors Pfahlbauten zu errichten und somit vor dem Felsen zu leben, nicht auf ihm. Der Freiherr tobte, aber der König gab den Torfstechern und Moorfischern recht, und das Pfahlviertel wuchs ebenso wie die Treue der Torfstecher zum König und der Neid jener, die Abgaben zahlen mussten. Immer mehr Leute zogen ins Pfahlviertel, die Häuser wucherten eng aneinander und ohne Plan. Dann verschwanden die ersten Menschen, ins Moor gelockt von Irrlichtern, die den Fluss nur sehr selten überquerten, aber das Pfahlviertel nachts regelmäßig aufsuchten. Einige flohen zurück auf den Felsen, die anderen blieben, vor allem die Torfstecher. Sie wussten um die Gefährlichkeit der Irrlichter, und sie waren zu stolz, um zu fliehen.
Nach einigen Jahren kamen nur noch selten Irrlichter, und die Rivalität zwischen Pfahlviertel und dem Rest der Stadt nahm weiter zu. Drei, vier Generationen gingen dahin, und der Königsthron gewann an Macht. Nun erhob der König selbst überall Steuern, und davon war niemand befreit, denn ihm gehörte auch das Moor. Dennoch blieb die Rivalität zwischen den Vierteln bestehen, und irgendwann lebten nur noch Torfstecher und Moorfischer im Pfahlviertel. Ihnen waren die abschätzigen Bemerkungen über ihr Quartier egal; sie waren allein schon aufgrund ihrer Arbeit Außenseiter, da machte das andere auch nichts mehr. Und die Pfahlbauten waren längst ihre Heimat geworden. Die Häuser mochten schief sein und kleiner als viele auf dem Felsen, aber sie zeugten davon, wie ihre Vorfahren sich vom damaligen Freiherrn unabhängig gemacht hatten, und diese Erinnerung würde immer Bestand haben.
Die Freiherren und Freifrauen unterstanden nun stärker dem König, sie waren sein verlängerter Arm, sein Sprachrohr und Richter in seinem Namen. Der König vereinte alle Macht auf sich, er war der absolute Herrscher, das ganze Land war ihm untertan. Sein Wille war Recht, und sein Wille wurde hier, so weit vom Hof entfernt, dieser Tage von der Freifrau Jade von Nebelbruch durchgesetzt. Auf dem Felsen ebenso wie im Pfahlviertel.
Auf dem Heimweg von der Arbeit ergingen sich Milan und Pjer in Träumen von gemeinsamen Moordiamantfunden, und sie teilten das erdachte Geld gerecht auf. Weil in ihren Träumen keiner einen Arm oder ein Bein verlor, waren es auch keine Almosen. Kopfschüttelnd bedauerten sie Fajennas Pech.
So sehr waren sie in ihr Gespräch vertieft, dass sie nicht bemerkten, wie sie immer weiter hinter die anderen Arbeiter der Torfwerke zurückfielen, und als sie in die verwinkelte Gasse hinter dem stets überfüllten Roten Adler bogen, waren sie allein. Aus dem Fenster des Wirtshauses drangen Flüche, Lachen und Lallen, der Boden unter ihren Füßen bestand aus Stein, so wie in einem großen Teil Nebelbruchs.
Das Pfahlviertel mit seinen kleinen, ausgebesserten Holzbauten begann drei, vier Straßen hinter dem Roten Adler. Hier dagegen standen Steinhäuser, viele davon breit, farbig verputzt und sauber. Die Sonne war längst hinter den Gebäuden verschwunden, bald würde sich der Himmel rötlich färben.
Milan und Pjer schritten schneller aus, um die anderen einzuholen, da trat unvermittelt ein halbes Dutzend Burschen aus den Schatten und versperrte ihnen den Weg. Fünf von ihnen waren größer und wohl auch ein, zwei Jahre älter als Milan und Pjer. Milan fluchte lautlos.
»Sieh an, wen haben wir denn da?«, sagte der Anführer mit gespielter Freundlichkeit. Er hatte ein blaues Auge und eine frisch verschorfte Schramme auf der Wange.
Milan schwieg, Pjer raunte ihm zu: »Haben? Noch haben die niemanden …«
»Ich höre, ihr betet den Nachtwyrm an«, fuhr der Anführer fort. Eine Hand hatte er auf den Dolch an seinem Gürtel gelegt, eine überflüssige Drohgebärde, denn Waffen wurden in solchen Prügeleien nicht gezogen. Es war ein Dolch, wie ihn Soldaten trugen, und wahrscheinlich wollte der Bursche so zeigen, dass er ein Krieger war.
Milan hatte ihn nie zuvor gesehen, doch drei der anderen kannte er von früheren Kämpfen. Sie starrten ihn hasserfüllt an, wahrscheinlich erinnerten sie sich auch.
»Das tun wir nicht«, presste Pjer hervor.
»Ich hab’s aber gehört. Ihr auch, Jungs?«
»Ja, Thomma«, sagten die anderen im Chor. Sie grinsten, und es blitzte in ihren Augen. »Wieder und wieder.«
»Von wem?« Pjer hob das Kinn und machte sich breit. »Wer sagt das?«
»Meine Tante.«
»Die kenn ich nicht. Kennt sie uns?«, fragte Pjer.
»Warum sollten wir zwei das tun?«, ergänzte Milan. »Sagt sie dazu auch etwas?«
»Nicht ihr zwei. Ihr schweineschmutzigen Morastfresser alle!«
Milan ignorierte die Beleidigung, er kannte sie zur Genüge. »Das beantwortet nicht meine Frage! Warum, also?«
»Um ihn zu besänftigen, dass er euch nicht frisst! Er ist der letzte der Drachen, sein Herz besteht aus kaltem schwarzem Stein, und ihr streift durch sein Reich. Warum sollte er euch sonst verschonen?«
»Er verschont uns nicht!«, stieß Pjer hervor. »Unsere Leute sterben im Moor!«
Thomma grinste. »Nun, wenn er euch nicht verschont, ist es umso dümmer, ihm zu opfern!«
»Das tun wir nicht!«
»Dann nennst du meine Tante also eine Lügnerin?« Thomma hatte den Dolch losgelassen und brachte drohend die Fingerknöchel zum Knacken.
Pjer starrte ihn an und zitterte, aber Milan wusste nicht, ob aus Wut oder vor Angst. Sechs gegen zwei, es würde schmerzhaft werden.
Warum waren sie nur so dumm gewesen, die anderen aus den Augen zu verlieren? Kurz dachte Milan daran zu fliehen, aber das würde er nicht tun, er war ein Torfstecher. Lieber Schmerzen ertragen als feige sein.
Pjer dachte wohl ähnlich, denn er spuckte auf die Straße und hob das Kinn. »Wie gesagt, deine eselsköpfige Tante kenne ich nicht, und sie ist auch nicht hier. Der Einzige, der hier dumm rumsteht und Lügen erzählt, bist du.«
Verdammt, dachte Milan, das tut doppelt weh – und doppelt gut. Er lachte und tänzelte auf der Stelle, bereit zuzuschlagen.
Thomma lief rot an, und seine Augen quollen hervor, während seine Freunde die Fäuste ballten und auf den Befehl zum Angriff warteten. »Ich schlag dich zu Matsch!« Speichel regnete ihm aus dem Mund.
»Dann schlag endlich und laber nicht.« Pjer hob die Fäuste.
»Matsch«, wiederholte Thomma, »blutiger Matsch!« Und er riss, das Gesicht wutverzerrt, den Dolch aus dem Gürtel. »Ich zerschneid dir das Maul, dass nicht mal deine Mutter dich noch erkennt!«
Hell blitzte die Klinge auf, und für einen Augenblick erstarrten alle. Niemand sagte ein Wort, keiner seiner Spießgesellen hielt Thomma zurück, keiner unterstützte ihn. Sie warteten einfach ab, Entsetzen oder Neugier im Blick.
Thomma, das Gesicht noch immer verzerrt, trat auf Pjer zu. »Und jetzt, kleiner Morastfresser? Angst? Wo ist dein Stolz jetzt?«
Wie gebannt starrte Pjer auf die Waffe und rührte sich nicht.
»Hättest du besser mal mir geopfert als dem Nachtwyrm, was?«
»Thomma«, sagte der Küfersohn Eliks, als wollte er ihn aufhalten, aber er sprach leise, und zwei andere hielten ihn, den Blick gebannt auf die blitzende Klinge gerichtet, an der Schulter fest.
In dem Moment sprang Milan plötzlich vor, ob von Mut, Wut oder Verzweiflung getrieben, wusste er selbst nicht. Mit aller Wucht trat er dem überrumpelten Thomma zwischen die Beine und spuckte ihn an. »Elender Feigling!«
Schreiend sackte Thomma zusammen und krümmte sich, ritzte sich dabei selbst mit dem Dolch am Oberschenkel, ließ ihn jedoch nicht fallen.
»Scheiße«, jaulte er, »du bist tot! Tot! Packt sie!«
Aber seine Leute zögerten einen Moment, noch immer überrascht von Milans Angriff oder dem Dolch, und Milan griff Pjer an der Schulter und zerrte ihn fort. Und Pjer erwachte aus seiner Starre.
Sie rannten, so schnell sie konnten, und verschwendeten keine Zeit damit, sich umzusehen. Schon nach wenigen Augenblicken hörten sie lautes Rufen hinter sich und rannten noch schneller, rannten um zwei Ecken und bogen scharf in die schmale Fischergasse ein, hetzten durch einen verlassenen Hinterhof, über eine Mauer hinweg und weiter, bis sie den trägen Fluss erreichten. Ohne zu zögern, sprangen sie ins Wasser und wateten und schwammen weiter hinaus.
Milan drehte sich um, und er sah keine Verfolger, doch ihr Rufen hörte er noch immer. Jederzeit konnten sie zwischen zwei Häusern auftauchen. Milan und Pjer kämpften sich weiter, bald hatten sie keinen Grund mehr unter den Füßen. Ihre Kleidung sog sich voll und hing schwer an ihnen, nur mühsam konnten sie sich über Wasser halten. Die Strömung trieb sie unter die ersten Pfahlbauten, wo sie wieder stehen konnten und Freunde über sich wussten; hierhin würden ihnen die anderen nicht folgen, das wagten sie nicht.
Trotzdem glitten sie zur Sicherheit noch weiter flussabwärts und hielten nur die Köpfe über Wasser. Sie nahmen den nächsten Seitenarm, der weiter ins Moor hinausführte, und hangelten sich unter der Plattform von Pfahl zu Pfahl, fort vom festen Felsengrund, auf dem der andere Teil Nebelbruchs errichtet war. Die Viertel der Handwerker und Bauern, Maurer und Soldaten, Händler und Bäcker, Metzger und Geldverleiher, Gastwirte, Schneider, Barbiere, Schmiede, Diener, Ärzte, Hebammen und wer immer sonst noch in den Gebäuden aus Stein leben mochte. Dort fand der wöchentliche Markt statt, dort standen die beiden Tempel, die meisten Schreine, die Kaserne der königlichen Soldaten und das weiße, wehrhafte Schloss mit den fünf schlanken Türmen, das die alte Burg derer zu Nebelbruch als Herrschaftssitz abgelöst hatte.
Milan und Pjer passierten ein Fischerboot, das an einem kurzen Steg angebunden war, und versteckten sich hinter drei dicken Pfählen, die nebeneinander in den Boden gerammt waren. Mehrere Minuten hielten sie sich dort reglos verborgen, dann zogen sie sich am Rand der Plattform hinauf und setzten sich mit baumelnden Beinen nebeneinander. Erschöpft lehnten sie sich an die Rückseite eines schmalen verwitterten Wohnhauses mit kleinen Fenstern, wie es in dem Viertel viele gab. Sie bibberten, und die Gelenke waren steif vom Wasser, Milan atmete schwer. Nass hing die Kleidung an ihnen.
»Ein Dolch«, keuchte Pjer, der sich noch immer nicht beruhigt hatte. »Ein verdammter Dolch! Dem Drecksack sollte ein Sumpfkriecher den Arm abreißen, nicht Fajenna. Der wollte uns das Gesicht zerschneiden! Das Gesicht! Das sag ich allen, und dann gibt es Rache, und wir reißen ihm den Arm aus und das Gesicht ab und … Scheiße! Und dich wollte er töten!« Er atmete durch und starrte Milan an. Mit einem Mal sah er aus, als wäre ihm schlecht. »Danke. Ohne dich hätte er mich erwischt, ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ich … Danke.«
Milan nickte. »Wir sind Freunde.«
»Ja, das sind wir.«
Damit war alles gesagt. In diesem Moment waren sie sicher, dass es eine Freundschaft für immer war. Sie würden sich ein Leben lang einer auf den anderen verlassen können.
Langsam trocknete die Kleidung in der untergehenden Sonne, und Pjer nieste.
»Was erzählst du zu Hause?«, fragte Milan, weil es spät war und sie nicht ewig hier sitzen konnten. »Dass wir geflohen sind?«
»Sie hatten einen Dolch! Was hätten wir tun sollen?«
»Ich hoffe, mein Vater sieht das auch so«, murmelte Milan, und zugleich zweifelte er daran. Vater hatte eine klare Vorstellung von Ehre, und davonzulaufen war kein ehrenhaftes Verhalten, auch nicht, wenn die anderen in der Überzahl waren. Was sollte ein einziger Dolch daran ändern?
»Ja, dein Vater.« Pjer schnaubte. »Dann sagen wir eben nur, dass du das Großmaul mit dem Messer niedergeschlagen hast, weil du schneller warst und dich nicht hast einschüchtern lassen. Und dass wir anschließend als Sieger aus dem Kampf fortgegangen sind – wir sagen gegangen, nicht geflohen.« Er lachte. »Und die anderen haben nur dumm geglotzt und sich nicht getraut, sich einzumischen.«
Milan nickte, dann grinste er. »Ja, das ist gut. Da kann er mich nicht mehr feige nennen.«
»Feige nennen? Feiern soll er dich dafür! Du hast mir das Leben gerettet, uns beiden, und das ist nicht gelogen.«
»Aber dieser Thomma darf damit nicht durchkommen. Niemand tötet beinahe einen von uns.«
Und so kehrten sie nicht sofort zurück, sondern schmiedeten gemeinsam Rachepläne, während die Kälte aus ihren Muskeln wich. Irgendwann halfen sie sich gegenseitig auf und machten sich auf den Heimweg.
2
Als Milan das Haus betrat, stand der Eintopf bereits auf dem Tisch. Er dampfte, und der Geruch des Kochfeuers hing noch in der Luft, seine Eltern und Elyn waren eben dabei, Platz zu nehmen. Neben den Krügen mit Wasser und Wein stand auch die Tonflasche mit Nachtbrannt.
»Du kommst spät«, raunzte der Vater ihn an, aber mehr kam nicht. Es folgten keine Fragen, wo er so lange gewesen sei und wie er aussähe, und auch sonst sagte niemand etwas.
Vater war ein durchschnittlich gebauter, stolzer Mann, der größer wirkte, als er war. Er war gesellig und bei vielen beliebt, und wenn er mit anderen trank und lachte, riss er sie mit. Doch auch seine Wut war laut und ansteckend, und so endeten seine Abende im Gasthof auch mal in Raufereien. Sein dunkles Haar war kurz, die Nase groß und mehrmals gebrochen. Er schwor beständig auf seine Ehre, und niemand zweifelte seine Schwüre an. Nicht mehr lange, und er würde zu einem der drei Grubensprecher seiner Gräberkompanie ernannt, nach dem Grubenmeister der zweithöchste Rang unter den Torfstechern, und auch seinen Kindern gegenüber war er oft mehr Anführer als Vater.
Hastig setzte sich Milan, und gemeinsam dankten sie den Göttern und dem Drachentöter für die Mahlzeit, bevor sie zum Löffel griffen. Milan hatte seinen selbst geschnitzt und den Griff mit Schuppen verziert, und weil Elyn den so gelobt hatte, hatte er auch ihr einen gemacht.
Sie aßen stumm. Vater stierte wütend vor sich hin und kaute, als wollte er die Suppe zermahlen. Seine Zähne knirschten, und niemand sah niemanden an. Streit lag in der Luft, aber Milan stellte keine Fragen. Der Streit hatte nichts mit ihm zu tun, das spürte er, wenngleich das nicht bedeutete, dass er sich nicht über ihm entladen konnte wie ein heftiges Gewitter. Er hoffte, die Wolken würden einfach weiterziehen, auch wenn sie das selten taten.
Schweigend löffelte er vor sich hin und behielt die zurechtgelegte Geschichte von dem Dolchangriff und seinem Sieg für sich.
Noch ehe der Teller geleert war, brach es – wie befürchtet – aus dem Vater heraus: »Wer ist es?«
»Niemand!«, giftete Elyn zurück. »Ich hab’s dir jetzt hundertmal gesagt!«
»Und ich hab dir nicht ein einziges Mal geglaubt!«
»Dann glaubst du, ich lüge?«
»Du bist zu hübsch, um keine Verehrer zu haben! Wenn wir also von niemandem wissen, triffst du dich heimlich.«
»Das ist Unsinn!«
»Was ist es dann?«, fragte Mutter nachdrücklich. Sie war eine schlaue Frau mit einem ebenmäßigen rundlichen Gesicht und beinahe so groß wie ihr Mann. Manche nannten sie schön, wenn der Vater es nicht hörte, doch wenn Milan gefragt wurde, wie sie war, dachte er immer zuerst an Kartenspiele. Über viele Sonntage hinweg hatte sie selbst ein Blatt angefertigt, hatte jede einzelne Karte mit zahlreichen Details und Schnörkeln bemalt. Als sie dann die erste Partie mit den Karten spielte, verlor sie, und daraufhin verschenkte sie das Blatt und sagte, es bringe ihr Pech. Noch am selben Abend begann sie, ein neues Blatt zu fertigen, mit ebenso vielen Details in jedem Bild. Und auch mit dem verlor sie das erste Spiel und verschenkte es ungerührt, und so ging es weiter und weiter bis zum fünften Blatt, das ebenso schön war, vielleicht sogar schöner als die Vorgänger und das ihr endlich den Auftaktsieg brachte. Dieses Blatt behielt sie, und wenn sie später mit ihm verlor, lächelte sie nur und sagte, letzten Endes werde es ihr Glück bringen, das wisse sie, und später ebenso ihren Kindern.
Milan war überzeugt davon, dass diese Geschichte etwas über seine Mutter aussagte, er war sich nur nicht sicher, was. Trotzdem war er davon beeindruckt und spielte so oft mit den Karten wie möglich, auch wenn er häufig verlor. Das tat er jedoch mit jedem Blatt.
Nun sah Mutter Elyn mit derselben Sicherheit an, mit der sie verkündet hatte, das Blatt werde ihr Glück bringen, und sagte: »Du verschweigst uns etwas.«
»Wer sagt das?«
»Ich sage das. Ich bin deine Mutter, ich kenne dich.«
Elyn warf den Löffel auf den Tisch. »Hält mich hier noch jemand für eine Lügnerin?« Sie starrte Milan an, und er konnte ihren Blick nicht lesen, Wut sah er darin, Trotz, eine stumme Herausforderung, aber auch Angst.
Schweigend schüttelte er den Kopf. Seit ein paar Tagen verhielt sich Elyn tatsächlich anders, sie war aufgekratzt, die Augen glänzten, sie lachte viel und wirkte im nächsten Moment wieder auf der Hut. Irgendetwas war mit ihr, aber er erfasste nicht, was. Auch er hatte schon an eine geheime Liebelei gedacht, weil ihr Verhalten ihn ans vergangene Jahr erinnerte, als sie sich heimlich mit dem jungen Bäckergesellen Lobran getroffen hatte. Das hatte er nur durch Zufall herausgefunden, und er hatte den Eltern nichts gesagt – und niemandem sonst. Auch jetzt würde er ihr nicht in den Rücken fallen, falls es einen Mann gab.
»Mach dich bloß nicht zum Gerede«, verlangte Vater. »Und uns keine Schande.«
»Es gibt niemanden«, wiederholte sie trotzig, das Kinn erhoben.
»Wenn ich dich erwische, dann …« Der Vater sprach nicht aus, was dann geschehen würde. Das tat er nie, denn so ließ er sich alle Möglichkeiten der Strafe offen, während er andernfalls als Mann von Ehre an seine Androhung gebunden wäre, selbst wenn er im Ärger eine zu harte Strafe ankündigte.
Anscheinend wollte Elyn ihn diesmal nicht damit durchkommen lassen. Zornig forderte sie ihn heraus. »Was ist dann? Was?«, spie sie ihm entgegen. »Ich bin siebzehn, es ist meine Entscheidung, ob ich jemanden treffe!«
Ihr Vater lief rot an, sprang auf und zeigte mit dem Finger auf sie. »Ich wusste es! Du … du …«
Während er wütend um Worte rang, erwiderte ihre Mutter scharf: »Deine Entscheidung oder nicht, solange du sie uns verheimlichst, ist es keine gute Entscheidung. Sonst könntest du es uns sagen.«
Elyn schnaubte. »Ich sagte: Wenn ich jemanden treffe. Wenn! Und zum hundertsten Mal: Ich tu es nicht!«
»Was verheimlichst du uns dann?«
»Wir Torfstecher sind Leute von Ehre!« Vater stand noch immer da, das Gesicht gerötet, und hielt den Finger auf sie gerichtet.
»Ehre! Was für eine Ehre denn?« Ihr Gesicht verzog sich vor Abscheu. »Das reden wir uns doch nur ein, weil wir sonst nichts haben! Ohne uns gäbe es keine Alchymie und keine Moordiamanten, der König wäre ein König unter vielen, sein legendärer Hof nur irgendein Hof. Und trotzdem hausen wir in Holzhütten über dem verfluchten Moor des Nachtwyrms und besitzen nichts, nicht einmal den Respekt der anderen!«
»Was gehen uns die anderen an? Wir haben uns und unsere Ehre!«
»Und was hilft uns die? Was ändert die an unserem Los, an unseren Toten im Moor?«
»Sie ändert alles! Und du bist immer noch zu jung, um das zu verstehen.« Er sprach nun ruhiger, doch nachdrücklich. »Wir haben Ehre und Stolz, und darum gehen wir aufrecht durchs Leben, nicht wie Knechte und Mägde. Also lass dein peinliches Jammern und Gerede von einem schlimmen Los. Es ändert nichts, du wirst immer eine Torfstecherin sein.«
»Nein, werde ich nicht!« Sie sprang auf, das Gesicht verzerrt wie vor Schmerz. Einen Augenblick lang stand sie mit zitternden Lippen einfach so da. Dann drehte sie sich um und lief aus dem Haus.
»Bleib hier!«, verlangte Vater, aber da schlug die Tür schon hinter ihr zu.
»Sie trifft also doch heimlich jemanden«, sagte Mutter. »Nur keinen Torfstecher. Irgendwer muss ihr diesen Unsinn in den Kopf setzen.«
»Auf, Junge, geh ihr nach!«, befahl Vater. »Behalt sie im Auge. Und erzähl mir von jedem Burschen, den sie trifft.«
Milan nickte und rannte los. Denn auch wenn er sie nicht verraten würde, offen würde er sich dem Vater nicht widersetzen. Während die Eltern wieder zu den Löffeln griffen, knurrte ihm der Magen, aber daran war jetzt nichts zu ändern.
Schon nach wenigen Schritten schien sich Elyn zu beruhigen, sie wurde langsamer und blieb schließlich ganz stehen, als dächte sie daran, umzukehren. Milan huschte hinter der nächsten Hausecke in Deckung, aber Elyn kehrte nicht um. Sie legte den Kopf in den Nacken und sah eine Weile in den dunkler werdenden Himmel hinauf, dann schritt sie wieder aus, weiter Richtung Stadtmitte. Milan folgte ihr mit Abstand und hoffte, sie würde sich nicht plötzlich umdrehen und ihn entdecken.
Sie verließ das verwinkelte Pfahlviertel und schlenderte durch Straßen aus Stein, bis sie den lang gezogenen Marktplatz erreichte. Vor den Gasthäusern saßen Erwachsene mit Wein oder Wasser beieinander, plauderten und lachten, würfelten oder spielten Karten. Andere kreuzten den Platz eilig auf dem Weg irgendwohin, wieder andere verfingen sich in zufälligen Begegnungen. Zwei streunende Hunde jagten bellend Vögel davon, Menschen blickten versonnen aus den umliegenden Fenstern, und Kinder spielten auf dem Boden mit Murmeln oder warfen einander einen Ball zu. Es war laut und friedlich zugleich.
Beherrscht wurde der Platz von der großen Bronzestatue König Cylhans XIII., die kurz vor Milans Geburt errichtet worden war. Mit erhobenem Degen saß der König auf einem Ross mit prächtiger Mähne und erinnerte alle daran, wer hier herrschte. Cylhan vereinte alle Macht Juwarens auf sich, und Nebelbruch, so abseits es auch lag, war Teil des Reichs, und sie alle hier waren Untertanen des Königs. Sein Wort galt unabdingbar, hier wie überall im Land.
So weit Milan zurückdenken konnte, hatte er sich vorgestellt, da hinaufzuklettern und sich zum König in den Sattel zu schwingen, aber letztlich hatte er sich nie getraut, es zu versuchen, und sich gesagt, die Statue sei sowieso zu hoch, um ohne Hilfe hinaufzugelangen.
Elyn hatte einmal spöttisch gefragt, ob der nächste Herrscher die ganze Statue austauschen würde, um sich selbst zu präsentieren, oder ob man nur den Namen ändern würde, schließlich wisse hier sowieso niemand, wie der König aussehe.
Als Elyn das Standbild nun passierte, hatte sie keinen Blick dafür übrig, nicht einmal einen abschätzigen. Ohne Zögern überquerte sie den Platz und trat auf der gegenüberliegenden Seite in eine Gasse, der sie ein Stück folgte. Der Lärm des Marktplatzes wurde leiser, Milan vorsichtiger.
Schließlich klopfte sie an die Tür einer Metzgerei, die so spät bereits geschlossen hatte. Trotzdem wurde Elyn eingelassen, und Milan fragte sich, ob er durch ein Fenster hineinspähen sollte. Bevor er eine Entscheidung gefällt hatte, kam Elyn jedoch wieder heraus und trug ein schmales Bündel im Arm. Anschließend suchte sie eine Bäckerei auf, aber nicht die von Lobrans Familie, und auch hier blieb sie nicht lange, und das Bündel in ihrem Arm wurde dicker. Nirgends traf sie sich mit einem Mann. Hier und dort wurde sie gegrüßt und grüßte zurück, blieb jedoch nie für ein Gespräch stehen.
Die Dämmerung zog herauf, und Milan war es leid, Elyn zu folgen. Er war müde und hungrig, sein Eintopf zu Hause wurde kalt. Seine Muskeln schmerzten, und er wollte endlich zurück, um sich über den Rest in seinem Teller herzumachen. Doch als er um die nächste Straßenecke bog, war Elyn plötzlich verschwunden. Er blickte in alle Richtungen, konnte sie aber nicht entdecken. Wie hatte er so ungeschickt sein können?
Und dann war sie mit einem Mal hinter ihm und fragte: »Hat Vater dich hinter mir hergeschickt?«
Überrumpelt wirbelte er herum und zuckte stumm mit den Schultern.
»Und, kleiner Spitzel, habe ich jemanden getroffen?«
»Nein.« Er schüttelte den Kopf. »Und ich bin kein Spitzel, ich würde dich nie verraten, und wenn du ein Dutzend Männer und Frauen triffst. Von Lobran habe ich ihm auch nie erzählt.«
Sie blinzelte überrascht. »Du weißt von Lobran?«
»Ich hab euch einmal gesehen.«
»Und du hast den Eltern nichts gesagt?«
»Ich werde dich nie verraten. Du hast mir Großvaters Schnitzmesser verschafft, als er gestorben ist, und du hast mit mir geschnitzt. Du hast dich vor mich gestellt, damals, als Vater so wütend und betrunken war, und … du bist immer da.« Er verstummte und zuckte erneut mit den Schultern. Er war es nicht gewohnt, solche Dinge auszusprechen, es war seltsam.
Sie lächelte, und dennoch wirkte sie traurig, fast als wollte sie losweinen, und das war ebenso seltsam. War sie etwa gerührt?
»Aber ich bin auch nicht blöd«, sagte er schnell, weil er sie nicht weinen sehen wollte, nicht einmal vor Rührung. »Irgendwas stimmt nicht, du bist komisch in letzter Zeit. Gut komisch, aber komisch. Und jetzt holst du irgendwelche Dinge ab und …« Er verstummte, sie hatte nichts mehr bei sich. »Wo ist das Bündel hin? Was ist los mit dir?«
Sie musterte ihn, noch immer sichtlich aufgewühlt, und setzte zweimal an, etwas zu sagen, tat es dann aber nicht. Stattdessen strich sie ihm übers Haar, wie sie es oft getan hatte, als er klein gewesen war. Mit zittriger Stimme sagte sie: »Kann ich nicht verraten, das wird eine Überraschung.«
»Für wen?«
»Für alle.« Sie lächelte vorsichtig, die Augen glänzten, aber sie hatte sich wieder im Griff. »Kannst du also Vater einfach sagen, dass ich niemanden getroffen habe? Und sag es ihm morgen und übermorgen erneut, weil er nicht aufhören wird zu denken, dass ich es doch tue, das weiß ich. Aber mir glaubt er nicht.«
»Schwörst du, dass du niemanden triffst? Bei deiner Ehre?«
Sie seufzte. »Bei meiner Ehre? Hast du mir vorhin zugehört?«
»Ja. Aber du weißt, dass mir die Ehre wichtig ist, und das reicht dann.«
Lächelnd schüttelte sie den Kopf. »Gut. Dann also bei der Ehre.« Dann umarmte sie ihn plötzlich und drückte ihn heftig an sich. »Ich hab dich lieb, Bruder. Ja?«
»Ich dich auch«, murmelte Milan. »Aber du bist in letzter Zeit wirklich komisch.«
»Ja, das kann sein. Es ist schließlich eine große Überraschung.«
Milan wollte noch weiter danach fragen, aber sie schnitt ihm das Wort ab und ließ ihn wieder los. »Komm, gehen wir zurück, es wird dunkel. Und vielleicht ist der Rest Eintopf noch nicht ganz kalt.«
Das erinnerte ihn an seinen Hunger, und er nickte. Gemeinsam schlenderten sie bis kurz vor die Tür, dann trennten sie sich. Sie trat zuerst ein und kurz darauf er, als wäre er ihr bis eben gefolgt.
Es war noch stockdunkel, als Milan aus dem Schlaf aufschreckte. Bodenbretter knarzten, irgendwer bewegte sich am Bett seiner Schwester; er konnte nur einen undeutlichen Schemen erahnen.
»Elyn?«, fragte er.
»Schlaf weiter, Kleiner.«
»Was tust du?« Plötzlich wurde Milan von Misstrauen gepackt. »Triffst du doch jemanden?«
»Unsinn. Ich hab es dir geschworen!«
»Was dann?«
»Ich hab nur schlecht geträumt und muss was trinken.«
Was trinken. Milan entspannte sich, die Müdigkeit griff wieder nach ihm.
Leise öffnete sich die Tür, dann erklang Elyns Stimme erneut. »Träum was Schönes, Bruder. Alles ist gut.«
Die Tür schloss sich wieder.
Alles ist gut.
Milan starrte in die Dunkelheit, fragte sich, was Elyn geträumt haben mochte, und dachte, dass es schlimm gewesen sein musste, wenn sie deswegen aufstand. Fast wollte er ihr folgen, um nach ihr zu sehen, aber was hätte das geändert? Sie brauchte nur ein wenig Wasser, und er war hundemüde, und seine Beine waren schwer, und so blieb er liegen. Dabei nahm er sich fest vor, bis zu ihrer Rückkehr wach zu bleiben. Trotzdem dämmerte er rasch wieder weg. Er schlief unruhig und träumte viel, woran er sich am Morgen nicht erinnern sollte.
3
Milan!« Grob rüttelte Mutter ihn aus allen Träumen. »Wo ist Elyn?«
»Elyn?«
»Sie ist weg!«
»Weg?«
»Ja, weg! Und du hast gesagt, sie trifft niemanden!«
Milan sprang auf, im Kopf noch verschlafen. »Sie wollte nur was trinken. Wegen der Albträume.«
»Was meinst du?«
Er wiederholte, was Elyn in der Nacht gesagt hatte, und Mutter schleifte ihn zum Vater, und da wiederholte er es erneut.
»Sie trifft jemanden«, war der sich sicher. »Wozu soll sie sich sonst nachts aus dem Haus schleichen?« Er bedachte Elyn mit einem Schwall Schimpfworte, und dann beschimpfte er Milan, weil der sie nicht aufgehalten hatte, und stieß ihn zur Seite. »Und nicht mal am Morgen ist sie zurück!« Zornig stapfte er im Zimmer auf und ab und murmelte verschiedene Namen und Verdächtigungen vor sich hin.
»Und wenn ihr etwas passiert ist?«, fragte Milan und folgte ihm. »Wollen wir nicht nach ihr suchen und herumfragen, wer sie …?«
»Damit alle von der Schande erfahren?«, spie sein Vater aus. »Nein. Sie wird bei ihrem Liebsten verschlafen haben und irgendwann auftauchen. Und dann …« Er sprach nicht weiter, aber seine Lippen bebten vor Zorn.
Doch bis alle zur Arbeit aufbrachen, war sie nicht aufgetaucht. Inzwischen war Milan auch wieder die Überraschung eingefallen, die Elyn am Vortag erwähnt hatte, aber er sagte nichts; das hatte er versprochen. Er hoffte, dass ihr Verschwinden damit zu tun hatte und geplant war, machte sich aber trotzdem Sorgen.
»Wenn du allein nach ihr herumfragst, dann …«, drohte Vater zum Abschied, und so verwarf Milan den Gedanken, der ihm tatsächlich gekommen war.
Bei der Arbeit erzählte Milan nichts von Elyns Verschwinden, während Pjer noch immer furchtbare Rache an Thomma plante, und Fajenna und alle anderen fluchten, als sie von dem Dolch und der Drohung erfuhren und jeden Rachegedanken lautstark befeuerten.
»Das müsst ihr ihm heimzahlen«, verlangten sie. »Niemand springt so mit einem Torfstecher um.«
»Das werden wir«, versicherte Pjer. »Das ist ausgemacht. Stimmt’s?«
»Natürlich«, versprach Milan, und Fajenna und die anderen nickten ihm zu, und der Respekt in ihrem Blick tat ihm trotz wachsender Sorgen um Elyn gut. Wo war sie nur? Hatte sie gelogen, als sie geschworen hatte, dass sie niemanden traf? Und war dann auch die große Überraschung eine Lüge?
Mittags wurde er von seiner Mutter abgeholt: Elyn war noch immer nicht aufgetaucht, allen war ihr Fehlen aufgefallen. Doch es wurde kein anderer Torfstecher vermisst, niemand in der Torfgrube wusste etwas, niemand hatte sie gesehen.
»Alle machen sich Sorgen, und sie haben uns gehen lassen. Dein Vater sucht sie bei den Felsenmenschen«, erklärte seine Mutter. So nannte sie all jene, die nicht bei ihnen im Pfahlviertel lebten, sondern auf festem Felsengrund. Sie, die sonst so beherrscht war, weinte beinahe, und da packte Milan die Angst, und er erzählte von Elyns geplanter Überraschung und den Besuchen bei Bäcker und Metzger.
»Du Schwachkopf!«, rief Mutter und brachte ihn zum Vater. »Los, erzähl’s auch ihm!«
Das tat er, und Vater versetzte ihm eine derart harte Maulschelle, dass er zurücktaumelte und vor Schmerz aufschrie. Seine Lippe war aufgeplatzt, und er schmeckte Blut. Nur mühsam konnte er die Tränen niederkämpfen, aber er protestierte nicht.
In der Bäckerei erfuhren sie, dass Elyn einen Laib haltbares Dunkelbrot gekauft hatte, beim Metzger hieß es, sie habe ein großes Stück Trockenfleisch genommen, das für eine mehrtägige Reise ausreiche. Von bösen Ahnungen erfüllt, eilten sie nach Hause, wo sie feststellten, dass mehr Kleidung von ihr fehlte, als sie am Leib trug. Die Ahnungen wurden Gewissheit: Elyn war fortgegangen. Nur wohin und für wie lange?
Vater verpasste Milan eine weitere Maulschelle, und er nahm sie stoisch hin; er hätte sich selbst ohrfeigen können. Sie erkundigten sich bei den Nacht- und Torwächtern, aber die hatten Elyn nicht gesehen. Doch es gab genug Wege, auf denen man aus der Stadt gelangte, ohne bemerkt zu werden, und vielleicht war sie mit einem fahrenden Händler fortgelaufen, versteckt in seinem Wagen, oder hatte in einem der umliegenden Dörfer bei einem Bauern Unterschlupf gefunden. Milans Vater verdächtigte jeden, der kein Kind oder Greis war. Dass sie allein gegangen sein könnte, zog er nicht in Betracht.
Bis tief in die Nacht hinein suchten sie vergebens. Längst hatten sich ihnen andere angeschlossen, und im ersten Morgenlicht ging die Suche weiter, hier und da und überall. Gefunden wurde ihre Leiche schließlich von Torfstechern auf dem Weg zur Arbeit. Drei von ihnen kamen mit der Nachricht zu Elyns Familie, die ganz woanders im Moor suchte.
Der Vater wankte und verlor alle Farbe aus dem Gesicht. Seine Schultern sackten nach vorn, und mit einem Mal wirkte er viel kleiner, als er war. »Wo?«
»Nicht weit von unserer Grube.«
»Wie? Warum?«
»Der Nachtwyrm«, sagte eine der Frauen, die sie gefunden hatten, mit gesenktem Blick. »Sie hatte … einen Moordiamanten bei sich.«
»Nein!«
»Es tut mir leid, Severin.«
»Oh, du elende Verräterin«, presste er hervor. Seine Kiefer mahlten vor Wut, und rote Flecken erschienen auf seinem Gesicht. Denn jeder Moordiamant gehörte per Geburtsrecht dem König und musste, sobald er gefunden wurde, bei der Freifrau abgegeben werden. Die schickte ihn dann unter schwerer Bewachung in die Hauptstadt. Einen solchen Stein einzubehalten, und sei es nur für eine Stunde, zog unweigerlich die Todesstrafe nach sich – auch wenn in Elyns Fall der Nachtwyrm einer Hinrichtung zuvorgekommen war.
Mutter, die sonst so beherrscht war, weinte laut und schrie ihre Klage hinaus, während Milan von einem Moment zum nächsten versteinerte, nur sein Herz schlug schnell und schmerzhaft. Dann rannte er plötzlich los, er musste sie sehen. Schneller als die Eltern stürmte er zu der Fundstelle, und dort machten sie ihm mit gesenkten Köpfen Platz.
Elyn lag, unweit der Torfgrube, verrenkt zwischen den knorrigen Wurzeln einer alten Sumpfzypresse; der ausgerissene rechte Arm schwamm in einer schlammigen Pfütze fünf Schritte entfernt, der linke Fuß fehlte ganz. Eine tiefe Bisswunde klaffte quer über den Brustkorb hinweg.
»Gestern war sie noch nicht hier«, flüsterte einer und erntete zustimmendes Gemurmel; die Gesichter aller waren bleich vor Schreck. Der Nachtwyrm hatte Elyns Überreste nachts da zurückgelassen, wo sie selbst tagsüber arbeiteten. Elyns Züge waren angstverzerrt, das Haar war weiß geworden und vollkommen verdreckt, und doch war sie eindeutig zu erkennen.
Irgendwer fragte, warum sie nicht aufgefressen worden sei, und einer schob es auf den makellosen Moordiamanten, der sich in ihrem Besitz befand, denn denen wurden alle möglichen Kräfte nachgesagt. Moordiamanten waren verstorbene und zu Stein gewordene Irrlichter, und sie glänzten so hell, als wäre das Mondlicht in ihnen gefangen.
Andere erinnerten daran, dass der Nachtwyrm seine Opfer sowieso nicht immer auffraß, während weitere in Richtung Milan nickten und zischten: »Pst.«
Einen ewigen Augenblick lang betrachtete Milan seine tote Schwester, sah, wie schrecklich sie zugerichtet war, sah ihr verzerrtes Gesicht und das knochenbleiche Haar.
Sah und wollte nicht sehen.
Sein Herz zerriss, und er verschloss die Augen, jedoch zu spät. Mit aller Gewalt presste er die Lider zu, so als könnte er damit das Gesehene ungesehen machen, vielleicht gar das Geschehene ungeschehen, aber natürlich war das nicht möglich, sie war tot. Als könnte er die Tränen damit in seinem Kopf einsperren, bis niemand mehr da war, sie zu bemerken. Unvermittelt erinnerte er sich an das ferne Fauchen des Nachtwyrms, das der Wind in manchen stillen Nächten aus dem Moor herübergetrieben hatte. Es war kaum zu vernehmen gewesen, und doch hatten sich ihm die Nackenhaare aufgestellt. Vor seinem geistigen Auge erschien eine gewaltige Kreatur, die Elyn ins zahnwuchernde Maul nahm und sie schüttelte wie eine Kinderpuppe, hin und her, bis die Knochen knackten und der Kopf baumelte. Rasch riss Milan die Augen wieder auf, um das Bild loszuwerden, aber auch dafür war es zu spät. Es hatte sich eingebrannt, und die Tränen liefen ungebremst über seine Wangen. Niemand legte ihm zum Trost die Hand auf die Schulter.
Still weinend schloss er sich dem Zug an, der seine tote Schwester zurück in die Stadt brachte.
Noch am selben Tag nahm sich die Freifrau von Nebelbruch der Sache im Namen des Königs an. Gleich am Morgen war ihr der Stein von einer Abordnung Torfstecher mit demütig gesenkten Häuptern übergeben worden, und am späten Nachmittag ließ sie alle, die in den Torfgruben arbeiteten, auf dem Marktplatz versammeln. Sie hatte die grauen Haare streng nach hinten geflochten und trug richterliches Schwarz. Umgeben war sie von einem Dutzend groß gewachsener Soldaten mit Degen und Dolchen. Zwei der Männer hatten außerdem lange Musketen über der Schulter hängen, und keiner von ihnen ähnelte Thomma, wie Milan beiläufig feststellte.
Milan begleitete seine Eltern, obwohl er noch kein Torfstecher war, aber er konnte nicht anders, er wusste nicht, was er allein im leeren Haus hätte tun sollen. Hier wusste er nun nicht, ob er zu den Angeklagten gehörte oder zu den Schaulustigen, die zahlreich gekommen waren, um zuzusehen, wie die Torfstecher bestraft wurden. Aus allen Fenstern der angrenzenden Häuser gafften Felsenmenschen. Verloren stand Milan da, unfähig, klar zu denken, das Bild seiner toten Schwester beherrschte seinen Kopf, alles war dumpf.
Laut scholl die Stimme der Freifrau über den Platz, als sie ihr Urteil für den ruchlosen Diebstahl des Moordiamanten verkündete. Jeder Torfstecher, alle aus allen Gruben, nicht nur jene aus Elyns, sollte fünf Schläge mit einem Galgenstrick auf den blanken Rücken erhalten, weil keiner von ihnen Elyn aufgehalten hatte. Darüber hinaus wurde allen für fünf Tage der Lohn gestrichen, den behielt die Freifrau im Namen der Krone ein. Statt der gemeinsamen Feier, die bei einem solchen Fund üblich war, gab es eine gemeinsame Bestrafung. Ohne Murren nahmen die Torfstecher das Urteil hin; das verlangte die Ehre, denn Elyns Tat war unleugbar und unverzeihlich. Doch Milan sah in vielen Augen Unmut; sah viele, die die Lippen aufeinanderpressten.
»Einer für alle, alle für einen«, verkündete die Freifrau mit schneidender Stimme das Motto, das die Torfstecher stets für sich reklamierten und das ebenso für ihre Bestrafung galt. Denn die Gemeinschaft war dafür verantwortlich, dass der Einzelne nicht mit einem derart groben Fehlverhalten ausscherte. Bestahl einer den König, tat er es im Bewusstsein, alle in das Vergehen hineinzuziehen.
Warum, Elyn?, dachte Milan wieder und wieder. Sie hatte über die Ehre gelacht, aber trotzdem verstand er nicht, wie sie so ehrlos hatte sein können. Du hast gesagt, du hast mich lieb, aber was ist mit den Eltern und allen anderen?
Früher waren Stockschläge auf die bloße Fußsohle die allgemein übliche Bestrafung gewesen, aber da man danach tage- oder wochenlang nicht auftreten konnte, vielleicht nie wieder, war die Methode bei solchen Massenbestrafungen längst abgeschafft, denn wer nicht laufen konnte, konnte nicht arbeiten. Und einen Ausfall aller Torfstecher konnte sich Nebelbruch nicht erlauben, der Abbau des Torfs durfte nicht zum Erliegen kommen, die Suche nach Moordiamanten nicht stocken.
Nacheinander und jeweils zu zweit sollten alle Torfstecher mit entblößtem Rücken an den großen Marmorblock des Königstandbilds treten. Die Hände gegen den Stein gestützt, mussten sie unter den erhobenen Hufen des Pferds die Schläge erwarten.
Milans Eltern waren die Ersten, da ihre Tochter den Diebstahl begangen hatte, und die beiden soldatischen Bestrafer schlugen mit voller Wucht zu. Schon beim ersten Hieb riss die Haut auf, und Vater und Mutter pressten die Zähne zusammen, um nicht zu brüllen. Milan zwang sich zuzusehen, denn sosehr ihn der Anblick auch schmerzte, er dachte, wenn er wegsähe, würde er sie im Stich lassen.
Ergeben ertrugen die beiden die Schläge, so wie sie die Vorwürfe und Blicke der anderen den ganzen Tag über ertragen hatten; stumm und mit gesenktem Kopf.
»Warum habt ihr auf eure Blage nicht aufgepasst?«
»Diebespack!«
»Wo hat sie ein solches Verhalten her, die Verräterin? Wo?«
Man hatte ihnen vor die Füße gespuckt und sie geschubst, ihre vormalige Beliebtheit hatte sich aufgelöst wie Nebel. Und Milans Eltern hatten sich nicht gewehrt, sondern alles hingenommen, und das hatte Milan kaum ertragen. Hatte sein Vater ihm nicht eingebläut, sich immer zu wehren? Kein Einknicken vor niemandem, kein Davonlaufen, keine Feigheit. Wo war dieser Stolz geblieben?
Jeder konnte sehen, dass die beiden sich schuldig fühlten und sich für ihre Tochter schämten, und Milan wollte sie schütteln und schreien: »Nein, hebt den Kopf!«
Auch wenn er – einmal abgesehen vom Stolz – nicht wusste, weshalb. Denn Elyn war schuldig, und so fragte er sie in Gedanken: Weshalb, Elyn?
Doch sie war tot und antwortete nicht, und seine Gedanken sprangen zurück und fragten: Seit wann reicht Stolz denn nicht aus?
Ein Brei aus Fragen wälzte durch seinen Kopf, es gab keine Antworten. Und er schrie die Eltern nicht an, und sie hoben auch nicht den Kopf, sondern erduldeten alles, die Vorwürfe wie die Schläge, die Blicke wie das Gaffen und Gieren der aufgewühlten Menge.
Anschließend warteten sie mit frisch verbundenem Rücken die Bestrafung aller ab, denn es war ihre Aufgabe, den Marmorblock danach von allen Spuren zu reinigen. Gründlich wischten sie das Blut ab, ohne zu klagen, auch wenn die Bewegungen langsam waren und sie wieder und wieder das Gesicht verzogen. Milan half ihnen, und niemand hinderte ihn daran.