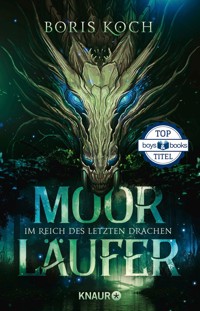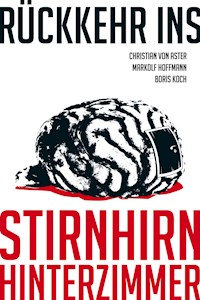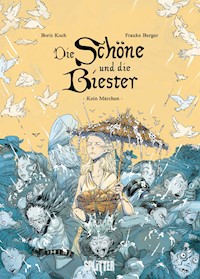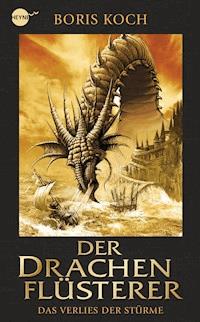12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Dornen von Ycena
- Sprache: Deutsch
Ein dornenüberwucherter Palast, eine schlafende Kaisertochter und eine Sage, die die Krone verspricht. Die düstere Neuinterpretation des Märchens »Dornröschen« geht weiter. Erfolgsautor Boris Koch entführt in diesem Fantasyroman in eine dunkle Welt, und der Kampf um Ycena hat begonnen … Der alte Palast in der Ruinenstadt Ycena ist seit Jahrhunderten von einer Dornenhecke überwuchert. Es heißt, in ihm schlafe die Kaisertochter und warte darauf, mit einem Kuss gerettet zu werden. Wer sie erweckt, soll Kaiser werden. Tausende haben versucht, an der Hecke vorbei in den Palast zu gelangen und sind gescheitert. Doch nun ist die Magie der Hecke geschwächt. Während der Narr Arlac am fernen Königshof des Tyrannen Tiban seine derben Scherze treibt, sucht Ukalion, Tibans Bastard, einen Weg in den verwunschenen Palast, um seinen grausamen Vater zu stürzen und seine große Liebe zu rächen. Doch auch die hartgesottenen Sucher Parikles und Levith streben nach dem Kuss der Kaisertochter und damit der Kaiserkrone. Die junge Perle, Trägerin der Klinge Ungehorsam, hingegen ist mit ihrem Bruder nur wegen der Schätze nach Ycena gekommen. Anders Anthia, die Schwester eines gehenkten Räubers: Sie glaubt nicht daran, dass nur Männer die Kaisertochter küssen dürfen, das hat ihr der gelehrte Schreiber Inrico aus der Schwebenden Bibliothek versichert. Sie alle treffen an der Hecke aufeinander – doch es kann nur einen Kaiser geben. Und dann taucht ein mächtiger Mitbewerber auf, mit dem niemand gerechnet hat ... Die Fortsetzung zu »Dornenthron« und der krönende Abschluss der dunklen Neuinterpretation von »Dornröschen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Boris Koch
Narrenkrone
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein dornenüberwucherter Palast, eine schlafende Kaisertochter und eine Sage, die die Krone verspricht.
Der alte Palast in der hexereiverseuchten Ruinenstadt Ycena ist seit Jahrhunderten von Dornen überwuchert. Doch nun ist die Magie der Hecke geschwächt, und es heißt, wer die im Palast schlafende Kaisertochter weckt, soll Kaiser werden.
Ukalion, Bastard des Tyrannen Tiban, sucht einen Weg hinein, um seinen Vater zu stürzen. Auch der ehemalige Gladiator Levith und die Räuberschwester Anthia wollen die Kaiserkrone unbedingt – und sie sind nicht allein. Ein verzweifelter Wettkampf beginnt, denn es kann nur einen Kaiser geben.
Die Fortsetzung zu »Dornenthron« und der krönende Abschluss der dunklen Neuinterpretation von »Dornröschen«.
Inhaltsübersicht
Widmung
Karte
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Hitze
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Vertrocknete Blätter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Die Spuren des Lindwurms
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Die Hecke und das Seil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Gegen die Zeit
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Wurzeln
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Sand und schwarzes Blut
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Der Herr der Hecke
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Der Tyrann und sein Sohn
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Der Henker von Ycena
1. Kapitel
2. Kapitel
Durch die Dornen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Der Kuss
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Hochzeits- vorbereitungen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Wolken und Gold
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Scherze, Trophäen und eine Hinrichtung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Die Krönung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Danksagung
Für Mario,
Blutsbruder in anderen Welten.
Und für Elli,
da der Anfang der Geschichte für dich war, gehört natürlich auch das Ende dir.
Prolog
Sieben Jahre zuvor
1
Burg Farnoh am Südrand des Wilden Walds war reich geschmückt, als der Tross des Königs eintraf, um das Einhorn sterben zu sehen. Die Mauern aus hellem rötlichem Stein erhoben sich auf einer schroffen Felsformation, fast schienen sie aus ihr herauszuwachsen. Die Felsformation war vielleicht zwanzig Schritt hoch und nicht viel breiter, zog sich aber weit über hundert Schritt in die Länge, und so war auch die Festung länglich angelegt. Vorn, hinten und in der Mitte, direkt über dem mächtigen Hauptgebäude, ragte jeweils ein hoher Turm mit quadratischem Grundriss, schmalen Fenstern und spitzem dunklem Dach in die Höhe.
Regen fiel in schweren Tropfen vom Himmel, die nassen Fahnen mit dem Königswappen flatterten klatschend im warmen Frühlingswind. Posaunen erklangen zur Begrüßung, während der Tross, ebenfalls vollkommen durchnässt, die steile Rampe zum Tor hinauftrottete. Die Zugbrücke, die einen mehrere Schritt breiten Spalt zwischen Rampe und Fels überspannte, war heruntergelassen. In ihre schweren Eisenketten waren Blumen geflochten.
Eine Bö trug den Schrei eines Gefangenen aus dem Schuldturm herüber, dem vierten Turm der Anlage. Errichtet aus schwarzem Basalt, erhob er sich massig auf einem steilen Felsen neben der Burg. Im Unterschied zu den anderen Türmen war er rund, und eine lange, schmale Brücke verband die Burg mit seinem einzigen Eingang; vom Boden aus war er nicht zu erreichen.
Angeführt wurde der Tross von König Tiban und Prinz Aurel. Nebeneinander ritten sie durch das offene Tor in den Hof, und die Männer, Frauen und Kinder der Burg jubelten ihnen zu. Jeweils zu zweit folgten die Höflinge ihrem Rang nach, dann die Diener zu Fuß, beladene Wagen und zuletzt, ganz allein, Arlac, der Narr, auf seinem hässlichen Pferd Trottel. Er lächelte, als er sah, wie zerzaust die Blumengirlanden von den Zinnen hingen und dass abgerissene Blüten auf dem Boden lagen, zertrampelt von zahlreichen Hufen, aber er verbiss sich jeden lauten Scherz. Zunächst wollte er nur ins Trockene, und er wollte das todgeweihte Einhorn sehen. Doch im Hof war kein Tier angebunden, nur Menschen, neugierig und frei, umringten den Platz, und Hunde liefen bellend und schwanzwedelnd umher.
Vogt Farnoh, ein drahtiger Mann mit silbernem Haar und einer schweren Goldkette um den Hals, Herr der Burg und König Tibans Stellvertreter im und um den Wilden Wald, begrüßte sie und führte die Adligen ins Haus, während die Diener sich um die Pferde und Wagen kümmerten. Arlac, der weder hier noch da dazugehörte, brachte Trottel selbst in den Stall, rieb ihn trocken und gab ihm zu fressen und zu saufen. Er tätschelte ihm den Hals, bevor er ihn einem sommersprossigen Stallknecht überließ.
»Steht das Einhorn auch hier?«, fragte Arlac.
»Nein«, erwiderte der Bursche, »das ist noch im Wald.«
»Im Wald?« Arlac sah ihn überrascht an. »Ist es ausgebrochen?«
»Wieso ausgebrochen?«
»Wir haben gehört, der Vogt hätte es längst gefangen.«
»Das hat er auch, schon vor Wochen. Aber Einhörner sind magische Wesen, und niemand holt sich freiwillig Magie ins Haus, oder?«
»Unsinn«, mischte sich eine ältere Stallmagd ein. »Nicht jeder hat solche Angst vor Magie wie du. Aber wenn ein Einhorn zu lange hinter Mauern aus Stein oder Holz gehalten wird, verliert es seine Magie, das Horn fällt ab, und irgendwann stirbt das Tier. Es braucht den Wald, um zu überleben, und es durfte ja auf keinen Fall sterben, bevor der Prinz eintrifft. Darum ist es draußen, eingesperrt in einem Käfig unter Bäumen.«
»Trotzdem mag ich nicht, wie es mich ansieht«, brummte der Knecht. »Und damit bin ich nicht allein.«
Arlac verbiss sich jede Bemerkung zur Ängstlichkeit des Jungen und ging hinüber ins Haupthaus, wo ihm ein Zimmer zugewiesen werden sollte. Wer fürchtete sich schon vor dem Blick eines gefangenen Tiers?
2
Am Abend saßen alle von Rang sowie Arlac bei einem Festmahl im großen Saal zusammen. Die hohen hellen Wände waren mit laubgrünen und gelben Ornamenten bemalt und mit den Fellen von allerlei Tieren geschmückt. Arlac sah sich nach den Häuten von Einhörnern, Lindwürmern und anderen Kreaturen um, die tief im Wilden Wald lebten, doch ausgerechnet sie fehlten. Durch die hohen Fenster fiel noch Tageslicht herein, die Sonne würde erst in einer oder zwei Stunden untergehen. Es regnete nicht mehr, und die Wolken waren weitergezogen.
Diener und Mägde brachten Silberteller voller Wild und gedünsteter Rüben und Schüsseln mit allerlei Beeren und füllten die schweren Becher mit kaum verdünntem Wein. Die Männer aßen und tranken und schwelgten schmatzend in Erinnerungen an die Jagd. Mit jeder Geschichte und jedem geleerten Becher wurden die erlegten Tiere größer und gefährlicher, bis schließlich die Sonne unterging und Diener die Fackeln entzündeten. In ihrem Schein wuchsen die Heldentaten weiter.
Lautstark prahlte Ritter Malleu, er habe ganz allein und mit einem einzigen Pfeil einen Keiler erlegt, größer als das größte Pferd im Stall des Königs. Er war Mitglied des Königsordens und litt unter der Schande, dass sein Vater sich vom Turm einer Baronesse gestürzt hatte, einem Turm, in dem er sich überhaupt nicht hätte aufhalten sollen, und schon gar nicht nachts. Malleus Augen glänzten vom Wein, und beim Erzählen stieß er seinen leeren Becher um, der scheppernd zu Boden ging.
Noch bevor irgendwer, wie üblich, nach einer Magd rufen und mit doppeldeutigen Bemerkungen auf die Knie befehlen konnte, kroch ein Diener unter den Tisch, um ihn aufzuheben.
»Eine solch gewaltige Trophäe heimzuschaffen muss eine Herausforderung gewesen sein«, bemerkte Vogt Farnoh derweil mit einem spöttischen Lächeln. »Aber liegen lassen kann man sie ja auch nicht bei der Größe, das wäre einfach zu schade, oder nicht?«
»In der Tat. Und Herausforderung ist weit untertrieben.« Malleu schüttelte den Kopf. »Einen vollen Tag habe ich gebraucht, um dem Vieh das Fell mitsamt Kopf abzuziehen, und anschließend musste ich einen langen Hebel einsetzen, um alles mit Müh und Not auf das Pferd zu heben. Dann bin ich, erschöpft und besudelt, selbst aufgestiegen und langsam losgeritten. Doch schon bald sind uns Wölfe gefolgt, ein ausgehungertes Rudel. Sie müssen das Eberblut gerochen haben, das noch an dem Fell und meiner Haut klebte. Ich trieb mein Pferd zur Flucht, und das brave Tier rannte wie noch nie, trotz der doppelten Last auf dem Rücken. Zu guter Letzt sprang es sogar über eine Spalte im Boden, und so haben wir die Wölfe abgeschüttelt. Doch für mein Pferd war es zu viel, es ist unter dem Gewicht zusammengebrochen, und wenige Atemzüge später war es tot. Ich musste zu Fuß weitergehen, und als ich zwei Tage später mit einem frischen Pferd und weiteren Männern zu der Stelle zurückkam, war das Fell verschwunden, und von dem gestürzten Pferd fanden wir nur noch ein abgenagtes Gerippe, über das die Ameisen krochen.«
»Das nennt man Pech«, sagte Vogt Farnoh, ohne eine Miene zu verziehen.
Andere lachten, und irgendwer rief: »Verschwunden, natürlich.«
Malleu fuhr zornig auf: »Nennst du mich einen Lügner?« Sein Blick huschte umher auf der Suche nach dem, der das gesagt hatte.
Alle anderen Gespräche verstummten. Jeder wusste, wie schnell Malleu gekränkt war, wie leicht er fürchtete, seine Ehre zu verlieren, und dass er sie verbissen verteidigte, mit Worten und Waffen, selbst wenn sie gar nicht angegriffen wurde. Er war groß und stark und geübt mit dem Schwert. Das brachte manche frühzeitig zum Schweigen, aber Arlac reizte es umso mehr zu Späßen.
»Lügner? Nein! Einen Helden muss man ihn nennen!« Arlac sprang auf, die Augen weit aufgerissen. Auch er sah in alle Richtungen. »Denn wer von euch hat schon eine vergleichbare Tat vollbracht? Mit einem einzigen Pfeil gleich zwei Tiere zur Strecke bringen, das ist wahrlich ein meisterhafter Schuss!« Er verbeugte sich tief in Richtung des Ritters.
Malleu war zu misstrauisch, um sich geschmeichelt zu fühlen. »Es war nur ein Tier. Hast du nicht zugehört, Narr?«
»Oh, das habe ich, sehr genau sogar. Aber bei großen Helden ist es eben so, dass eine Tat zur nächsten führt. Hättest du – sagen wir – nur einen Fuchs oder ein Kaninchen erlegt wie ein jedermann, wäre dein Pferd nicht zusammengebrochen und noch am Leben. Aber so hat dein einer Schuss …«
Weiter kam er nicht, denn weinseliges Gelächter brach los, und Fäuste wurden vor Vergnügen auf die schwere Tischplatte gehämmert.
Malleus Züge verzerrten sich, und er schrie Arlac an: »Was verstehst du hässlicher Witz von einem Mann schon von der Jagd? Hast du überhaupt jemals ein Tier erlegt, dass du jetzt so große Töne spuckst?«
»Nein«, gab Arlac zu, obwohl er damals in der Gosse zahlreiche Ratten erschlagen und gegessen hatte. Auch war er oft von anderen durch die Straßen gehetzt worden, Gejagter, nicht Jäger, und hatte dabei Dinge über die Jagd gelernt, die Malleu nicht wusste und wohl nie erfahren würde. Doch das alles sagte er nicht. Stattdessen warf er sich theatralisch in die Brust. »Aber beinahe! Einmal hätte ich beinahe einen Keiler erlegt, klein wie eine Maus – vielleicht sogar noch kleiner.« Er riss die Augen weit auf und zeigte mit Daumen und Zeigefinger, wie winzig der Keiler gewesen war.
Die Leute lachten, Prinz Aurel am lautesten, während König Tiban nur lächelte.
»Eine Maus?«, höhnte Malleu. »Und dann auch nur beinahe? Was für ein großer Jäger du bist!«
»Nun«, erwiderte Arlac, »ich habe nie behauptet, ein großer Jäger zu sein. Aber in meiner närrischen Ahnungslosigkeit finde ich es bedeutend schwieriger, eine Maus mit einem Pfeil zu treffen als ein Tier, größer als ein Pferd. Daran hätte ich wahrscheinlich nicht einmal mit verbundenen Augen vorbeigeschossen, selbst wenn ich gewollt hätte.«
Das Lachen schwoll an.
Malleu blinzelte verblüfft, der Mund stand ihm offen, und für einen Moment wusste er nichts zu erwidern. Die Männer neben ihm klopften ihm freundschaftlich auf die Schulter, und ganz langsam entspannten sich seine Züge. Er war bereit, den Scherz als Scherz zu begreifen, nicht als Beleidigung.
Doch Prinz Aurel wollte den Scherz noch nicht gehen lassen. Er war fünfzehn Jahre alt und damit sogar noch jünger, als Tiban es gewesen war, als der sein Einhorn getötet hatte, und der Stolz stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Die dichten dunklen Locken fielen ihm bis auf die breiten Schultern, die Augen waren gerötet, denn er hatte schneller getrunken als jeder sonst am Tisch. Er richtete den Finger auf Arlac und rief lachend: »Nun, wenn unser Narr gerne Mäuse jagt, so soll er die bekommen! Könnt ihr welche braten und auftragen lassen, Vogt?«
Ein paar Männer johlten.
»Vorrätig haben wir in der Küche keine«, beschied ihn Vogt Farnoh mit einer leichten Verbeugung. »Aber es sollten sich sicher welche finden und fangen lassen.« Und er scheuchte zwei junge Diener hinaus, die Mäuse zu besorgen.
»Zur Not tun es auch Ratten!«, rief Aurel ihnen hinterher und lachte laut.
Andere fielen in das Lachen ein, und irgendwer wiederholte brüllend: »Ratten!«
»Frösche!«, rief einer.
»Kröten!«, der Nächste.
Mit den meisten von ihnen hatte Arlac schon seine Scherze getrieben, es war nur zu verständlich, dass sie lachten.
Er öffnete den Mund, sah zu König Tiban, und der sah zu ihm, und Arlac schloss den Mund wieder.
»Auf dieser Fahrt wirst du keine Scherze über meinen Sohn machen«, hatte der König ihm vor dem Aufbruch unter vier Augen befohlen. »Es ist sein großer Tag, du wirst ihn nicht durch Spott kleiner machen. Verstanden?«
»Wozu benötigt Ihr dann einen Narren, wenn er kein Narr sein darf?«
»Für den Rest des Hofs. Über alle anderen kannst du lachen, wie du willst. Wir werden tagelang unterwegs sein, da brauchen wir Zerstreuung.« König Tiban hatte ihn einst von den Dächern geholt und zum Narren gemacht, er konnte ihm die Narrenfreiheit jederzeit auch wieder nehmen.
Arlac hatte nicht protestiert, sondern, wie gewünscht, unterwegs den Tross zum Lachen gebracht und den Prinzen verschont. Und auch wenn er die Einschränkung bedauerte, verspürte er Tiban gegenüber keinen Groll deswegen. Der König hatte ihm das Leben gerettet, hatte ihn zu dem gemacht, der er war, und so war Arlac ihm treu.
Er schluckte eine scharfe Entgegnung in Richtung des Prinzen hinunter und nahm noch einen Schluck Wein. Dann leckte er sich über die Lippen und sagte: »In Honig eingelegt mag ich Mäuse am liebsten.«
Sein Bauch war vom Festmahl dick und voll.
Eine Weile später brachte eine Küchenmagd einen großen Teller mit einem vollen Dutzend aufgespießter gehäuteter und gerösteter Tiere; es waren sechs Mäuse, vier Ratten und zwei Frösche oder Kröten.
Sie wurde mit Gejohle empfangen, irgendwer rief: »Sind sie in Honig eingelegt?«
»Nur die Mäuse«, sagte die Magd mit gesenktem Kopf. »So wie er es …«
»Los!«, fuhr Prinz Aurel dazwischen, und seine Stimme überschlug sich vor Begeisterung. »Lass es dir schmecken, Narr!«
»Aber ich kann doch nicht all die Köstlichkeiten allein beanspruchen«, jammerte Arlac in gespielter Bescheidenheit. »Mein Freund Malleu hat sicher …«
»… genug gegessen!«, fiel Aurel ihm ins Wort. »Alles für dich, Narr, alles für dich!«
Und Arlac aß gehorsam, ohne sich mit beißenden Scherzen zu wehren, ohne vorzuschlagen, dass, wenn er schon Mäuse aufgetischt bekäme, Malleu nach derselben Logik auch ein ganzes Pferd verzehren solle. Er aß, obwohl er schon viel zu viel gegessen hatte und sein Bauch rumorte. Die dünnen Knochen knackten unter seinem Griff, und es schmeckte verbrannt und klebrig süß und nach den Erniedrigungen, die er ertragen hatte, als er auf der Straße hatte Ratten essen müssen. Erinnerungen an die Zeit, als er durch die Gassen Freybrucks gehetzt worden war, kamen hoch, und dafür hasste er Aurel, der mit weinglänzenden Augen zu ihm stierte. Doch noch mehr hasste er den Prinzen dafür, dass er dessen Spott nicht mit Spott vergelten durfte. Der Prinz verhöhnte ihn mit einer Ausdauer und Boshaftigkeit, als wüsste er von seinem Vater, dass er für Arlac in diesen Tagen tabu war, und dafür, dass er das ausnutzte, verachtete Arlac ihn umso mehr.
Du hochmütiger Hosenkacker, dachte er, aber er sagte es nicht, sondern tönte schmatzend in alle Richtungen, wie lecker es sei, rieb sich den Bauch, verdrehte genießerisch die Augen und bat um etwas zusätzlichen Honig, um den auch auf die Ratten und Froschkröten zu schmieren. Rasch hatte die Magd einen Tiegel besorgt.
»Genauso knusprig, wie ich es mag«, verkündete er, obwohl er die halb verbrannten Dinger kaum runterbrachte. Er spielte so gut, dass den Höflingen in seiner Nähe das Wasser im Mund zusammenlief, doch sie nahmen sich nichts von seinem Teller, denn der Prinz hatte befohlen, dass alles für Arlac sei.
Arlac aß, bis ihm schlecht war, und dann aß er mit gespielter Fröhlichkeit weiter, weil er Prinz Aurel die Genugtuung, dass er darum bettelte, aufhören zu dürfen, nicht gönnte. Zumal es nichts bringen würde. Der Prinz war hergekommen, um das Einhorn zu töten und dadurch zu beweisen, dass er ein starker König sein würde, da konnte er am Abend davor nicht zulassen, dass irgendwer seinen Befehlen nicht Folge leistete, schon gar nicht der Narr.
Tier für Tier spülte Arlac mit Wein hinunter, und der stieg ihm rasch zu Kopf. Sein Bauch drückte, er konnte kaum noch schlucken, aber es war nicht mehr viel, eine einzige Ratte noch und die kleinere Froschkröte. Ihm war speiübel und längst schwindlig vom Alkohol, aber er kaute weiter, bis der Teller leer war. Er wollte brechen, aber er hielt es zurück und leckte mit letzter Willenskraft auch noch die Honigreste vom Teller, grinsend und stöhnend wie vor Lust.
Manche klatschten, König Tiban nickte, Prinz Aurel lächelte gequält.
Arlac erhob sich, deutete zur Tür und sagte: »Ich jage mir schnell noch einen Nachschlag. Die Mäuse waren schon arg klein.«
Unter Gelächter ging er hinaus, schloss die Tür hinter sich, lief um die nächste Ecke, hängte den Kopf zum Fenster hinaus und erbrach sich in die Dunkelheit. Kurz atmete er durch, dann übergab er sich noch einmal und schließlich ein drittes Mal. Er spuckte noch mehrmals aus, um den bitteren Geschmack loszuwerden, doch der wollte einfach nicht weichen.
Du hast es nicht verdient, deine Stärke zu beweisen, Prinzlein, dachte er wütend. Der König muss dich vor meinen Scherzen schützen, weil du das Lachen nicht erträgst. Was daran zeugt von Stärke? Und so beschloss er, noch leicht wankend und benebelt vom Wein, in den Wald zu gehen und das Einhorn zu töten. Ohne das Einhorn konnte die Zeremonie nicht stattfinden, ohne das Einhorn wäre der Prinz umsonst hergekommen, kein Verbot von Scherzen auf seine Kosten würde die Lacher darüber aufhalten.
Und mehr noch: Wenn es einfach tot im Käfig lag, hieß das, dass ein beliebiger Irgendwer, ein Räuber oder Vogelfreier aus dem Wilden Wald, das vollbracht hatte, was den Königen seit Tibans Urgroßvater als mystisches Zeichen von Stärke galt. Das mochte grob sein für einen Scherz, und Arlac glaubte auch nicht, dass viele lauthals darüber lachen würden, aber es würde bewirken, was er für seine eigentliche Aufgabe als Narr hielt: den Hochmut und die Selbstherrlichkeit der Mächtigen bloßzustellen und nicht, sie mit harmlosen Späßen zu unterhalten.
»Das kann jeder dahergelaufene Gaukler, ich dagegen bin ein Narr«, murmelte er. »Ein hochwohlgeborener Narr, denn ich wurde auf den Dächern geboren.«
Kichernd ging er in den Stall, tunkte den Kopf in einen Eimer Wasser, um den Alkohol zu verscheuchen, und sammelte verschiedene Stricke zusammen. Mit denen kehrte er in sein Zimmer zurück, das zur Außenwand der Burg hin lag, und band sie zu einem langen Seil zusammen. Er knotete das Seil an einem Balken fest und ließ sich aus dem Fenster hinab bis auf den Grund des Felsens. Alle Wolken hatten sich verzogen, der Mond und die Sterne leuchteten hell.
Erst als Arlac den Boden erreicht hatte, kam ihm der Gedanke, dass das wertvolle Tier vermutlich bewacht wurde.
Egal, dachte er, jetzt bin ich schon unten.
Und so lief er, einen langen Dolch am Gürtel, in Richtung des nahen Walds. Die ersten Bäume waren nicht weit, und das Einhorn würde nicht allzu tief im Innern des Waldes angebunden sein.
3
Es war nur der Rand des Wilden Walds, das sagenumwobene felsige Herz mit seinen Lindwürmern lag weit entfernt, und doch schienen die Bäume Arlac hier größer als in Freybruck und ihre Schatten dunkler. Stämme und Äste knarzten und ächzten, der Wind strich raschelnd durchs Laub, und im dichten Unterholz am Rand des schmalen Waldpfads huschte etwas davon.
Arlac nahm den Dolch in die Hand und folgte dem Pfad in den Wald. Das Laub verdeckte den Himmel vollständig, nicht ein einziger Stern lugte hindurch. Er sah in alle Richtungen und lauschte auf jedes Geräusch. Bereits nach gut hundert Schritt stieß er auf eine kleine Lichtung, die ganz in Mondlicht getaucht war. An ihrem Rand kauerte ein Käfig, doch Wächter waren keine zu sehen. Irgendwo rief eine Eule, das Laub raschelte lauter, Äste knackten.
Langsam näherte sich Arlac dem Käfig, in dem er den Schemen eines Tiers ausmachte.
König Tiban wird wissen, dass du es warst, dachte er, aber dem entgegnete er sofort: Nein, wird er nicht. Du musst nur gut alles Blut abwaschen, das auf dich spritzt, und mit zwei, drei toten Mäusen wieder im Saal auftauchen – und mit einer lustigen Geschichte, wie du sie gefangen hast. Wenn du dich darin selbst lächerlich machst, glaubt niemand, dass sie erfunden ist.
Leise ging er weiter. Er hatte noch nie ein Pferd getötet, aber er hoffte, er würde das Herz des ähnlichen Einhorns rasch finden, zur Not eben mit dem zweiten, dritten oder vierten Stich.
Und dann war er nahe genug, um das Tier deutlich zu erkennen, und ließ den Dolch sinken. Es hatte die Statur eines schlanken Pferdes, rotbraunes Fell mit weißen Flecken, eine lange schwarze Mähne und einen dichten schwarzen Schweif. Die Hufe waren zierlich, der Kopf schmal. Auf der Stirn wuchs ein gewundenes Horn, leuchtend weiß wie der Mond und lang wie ein Schwert. In den nachtblauen Augen glaubte Arlac das Spiegelbild aller Sterne zu erkennen, und als das Einhorn ihn abwartend ansah, murmelte er: »Du stirbst auf jeden Fall, spätestens morgen, aber wenn ich es jetzt schon tue, dann …« Er brach ab.
Nicht weil es ein Tier war und ihn nicht verstand, da war er sich nicht einmal sicher, sondern weil es Unsinn war. Egal, was er sich in seinem Kopf zurechtgelegt hatte, er wusste, dass er es nicht töten würde. Er konnte nicht, noch nie hatte er ein so schönes Wesen gesehen.
Es war nicht niedlich oder hübsch, es wirkte weder unschuldig, wie manche Geschichten behaupteten, noch wehrlos, es war eben einfach schön. Es war nicht ebenmäßig oder vollkommen, aber sein Anblick pflanzte Arlac eine Ahnung von Freiheit ein, die er nie gekannt hatte. Diese Schönheit ließ ihn verstummen und sein Herz aufgeregt schlagen. Eine Schönheit, die nicht einmal ihn, den groben Narren des Königs, zu Spott und Scherzen verleitete, sondern ganz still werden ließ. Sollte sie vergehen, würde etwas in ihm zerbrechen, das begriff Arlac, als ihn die Augen mit den tausend gespiegelten Sternen betrachteten. Er sehnte sich danach, es frei über die Lichtung springen zu sehen, staunend wie ein Kind, und hätte wer gesagt, es könne auf dem Wind laufen, bis zu den Wolken hinauf und weiter, so hätte er es geglaubt. Er wollte es berühren, doch zugleich erfasste ihn eine merkwürdige Scheu, und so tat er es nicht. Er stand einfach da, nur eine Armlänge von ihm entfernt, und begriff nicht, wie irgendwer ein solches Wesen töten konnte. Wie man das auch nur wollen konnte.
Wie hast du das damals übers Herz gebracht, Tiban?, dachte er und sah den König vor sich, wie er stolz lächelte.
Ich konnte es, weil ich stark bin.
Arlac schüttelte den Kopf. Stark? Nein. Wie soll das Stärke gewesen sein?
Nun, Schwäche war es bestimmt nicht, entgegnete der König in seinem Kopf, und das stimmte natürlich. Aber Arlac bezweifelte, dass es sich überhaupt um eine Frage von Stärke und Schwäche handelte, auch wenn der König gern alles und jeden danach beurteilte.
»Ich lass dich heraus«, sagte Arlac und steckte den Dolch weg, verwundert, dass er ihn überhaupt noch in der Hand hielt. Auch wenn das Einhorn einfach verschwunden war, konnte die Zeremonie morgen nicht stattfinden, es musste nicht tot im Käfig liegen.
Das Einhorn sah ihn unverwandt an und stieß ein leises Schnauben aus.
Doch die Gitter waren aus Eisen und viel zu dick, als dass er sie hätte verbiegen oder gar herausreißen können. Die einzige Tür war durch drei große verstärkte Schlösser und eine schwere Kette gesichert. Vergebens versuchte Arlac, die Schlösser zu knacken. Er stocherte mit dem Dolch in ihnen herum, bis die Klinge brach, und dann weiter mit dem Bruchstück, bis die Finger von blutigen Schnitten überzogen waren, aber er erreichte nichts.
»Verdammt!«
Verzweifelt rüttelte er an der Tür und trat gegen das Eisen. Es schepperte so laut, dass man es bei der Burg gehört haben musste, aber auch tief im Wald. Kreischend stoben rings um die Lichtung Vögel auf, flatternde Schatten vor dem klaren Nachthimmel. Irgendwo zwischen den dunklen Bäumen heulte ein Wolf, und andere Tiere antworteten ihm.
Das Einhorn schnaubte noch einmal und warf den Kopf herum.
Arlac fluchte und sah sich hektisch um.
Wieder heulte ein Wolf, näher diesmal, und wie ein Echo kam ein heiseres Brüllen, das von einem Bären stammen konnte oder etwas ganz anderem. Wer wusste schon, was der Wilde Wald noch alles beherbergte? Nur in einem war Arlac sicher: Was immer es war, es war groß.
Er ließ vom Käfig ab.
»Es tut mir leid«, sagte er und meinte es aufrichtig, aber er konnte nun einmal nichts tun und wollte sich nicht von wilden Tieren zerfleischen lassen. Aufgewühlt machte er sich auf den Weg zurück.
Kaum hatte er die Lichtung verlassen, hörte er vor sich Schritte auf dem Pfad und tauchte ins Gebüsch daneben. Ein halbes Dutzend Männer des Vogts eilte an ihm vorbei. Aus ihren Rufen schloss er, dass sie gekommen waren, um nach dem Einhorn zu sehen und es für den Rest der Nacht zu bewachen.
»Aber kommt ihm nicht zu nahe, damit ihr nicht unter seine Magie fallt«, warnte einer, und Arlac erkannte die Angst in seiner Stimme.
Ein anderer lachte, aber der Erste fügte hinzu: »Seht es nicht an, das ist ein Befehl des Vogts.«
Und dann waren sie vorbei.
Arlac wartete noch einen Moment, doch sie kamen nicht zurück. Er schlich noch einmal zum Rand der Lichtung und sah, dass die Männer den Käfig umstellt hatten, den Rücken dem Einhorn zugewandt, den Blick starr in die Ferne gerichtet. Leise zog Arlac sich zurück und machte sich auf den Weg zur Burg. Noch einmal heulte in der Ferne ein Wolf.
Bei der Burg angelangt, sah Arlac sich kurz um und hangelte sich am Seil hinauf in sein Zimmer. Er entknotete die Stricke und brachte sie wieder in den Stall. Auf dem Weg hinaus sah er bei Trottel vorbei und gab ihm einen Apfel aus der Tonne an der Tür.
»Du hättest es sehen sollen«, flüsterte er ihm ins Ohr. »Es ist wunderschön.« Anschließend machte er sich auf in den Keller, um Mäuse zu fangen und sie den Höflingen zu präsentieren, auch wenn das Einhorn noch am Leben und im Käfig war. So oder so sollte der Abend nicht mit seinem Rückzug enden, das gönnte er Aurel nicht. Er würde scherzen und saufen und lachen, bis er umfiel, und er hoffte, dass sein Schlaf ohne Träume blieb.
4
Am nächsten Mittag saß Arlac in der Laibung eines Fensters zum Burghof hin und ließ die Beine baumeln. Der einsame Platz passte zu ihm, dem Narren, der weder zu den Höflingen noch zum Volk gehörte. Sein Kopf schmerzte vom Wein, und die Sonne schien viel zu grell vom blauen Himmel herab. Er bewegte sich nur vorsichtig, weil er das Gebimmel der Glöckchen an seiner Narrenkappe so nah bei den Ohren nicht ertrug. Wenigstens hatte er nichts geträumt.
Auf der einen Seite des Hofs, direkt vor Arlac, dort, wo eine breite Treppe ins erste Geschoss des Hauptgebäudes führte, erhob sich ein großes steinernes Podest, das vom gesamten Hof aus gut eingesehen werden konnte, fast wie eine Bühne. Dort sollte Prinz Aurel vor aller Augen das Einhorn töten.
Arlac wusste, dass Tiban seines damals vor nur wenigen Zeugen niedergestochen hatte. Sein Vater hatte es so gewollt, ein intimes Ereignis im Kreis der Familie, Tiban hatte nur seinem Vater und sich selbst zeigen sollen, dass er würdig sei, und niemandem sonst.
»Anderen musst du nichts beweisen, wir sind die Königsfamilie«, hatte der Vater gesagt, aber es wurmte Tiban bis heute, dass seine große Tat nur so wenige Zeugen gehabt hatte. Für ihn gehörten Stärke und ihre Inszenierung zusammen, und so gönnte er seinem Sohn Aurel einen großen Auftritt. Zumal kein Schreiber oder Bibliothekar anwesend war, um das Geschehen für die Chronik festzuhalten.
»Warum das?«, hatte Aurel gefragt.
»Weil man über den Tod eines Einhorns nicht schreibt«, hatte Tiban erwidert. »Der Akt selbst beeindruckt die Anwesenden, niemand wird es je vergessen, doch niedergeschrieben wirkt es abstoßend und sinnlos. Kein Schreiber kann die Essenz eines Einhorns einfangen, kein Leser findet die Größe deiner Tat in den Sätzen wieder, egal, wie geschliffen sie aufs Pergament gebracht werden. Niedergeschrieben klingt es wie die aufgebauschte Schlachtung einer Kuh, und das ist nicht in deinem Sinn. Nur im Bericht der Augenzeugen, in ihrem Zögern, ihrem unsicheren Blick, ihrem Stammeln, in ihrer verzweifelten Unfähigkeit, die passenden Worte zu finden, wird sich ein Widerhall deiner Tat finden lassen, glaube mir.«
Ob der Prinz ihm glaubte, wusste Arlac nicht, nur dass er es hingenommen und nicht mehr nach einem Chronisten verlangt hatte.
Und nun war es so weit, die Augenzeugen waren versammelt. Für die Höflinge, sich selbst und seine Familie hatte Vogt Farnoh lange bunte Stoffbahnen über einen Teil des Innenhofs spannen lassen. Darunter herrschte einerseits Schatten, und andererseits boten die Stoffe im Sonnenlicht ein prächtiges Farbenspiel. Sanft bewegte sich das dünne Tuch im Wind, darunter standen die herausgeputzten Höflinge und warteten, sie tuschelten und lachten.
Weiter hinten im Hof, jenseits der Stoffbahnen, harrten die Männer, Frauen und Kinder der Burg in der prallen Sonne. Die hatte ihren Zenit erreicht, und nur ganz nah an der Mauer herrschte etwas Schatten.
Neugierig reckten die Pferde den Kopf aus dem Stall, Hunde streiften aufgeregt umher, und selbst in den kleinen Gitterfenstern des Schuldturms waren undeutlich Gesichter auszumachen.
Eine Posaune rief die Menge zur Ruhe, und König Tiban und Prinz Aurel betraten gemessenen Schritts das Podest. Tiban war festlich gekleidet, Aurel prunkvoll. Tiban trug seine Krone auf dem Kopf, Aurel in der Rechten ein kurzes Schwert, dessen Parierstange und Knauf mit leuchtenden Rubinen verziert waren.
»Heute ist ein Tag, der mich stolz macht als Vater«, sagte König Tiban, als die Posaune verstummte. Aufrecht stand er da, das schwarze Haar glänzte in der Sonne, der dichte Bart war ohne jedes graue Haar. Seine Stimme, tief und voll, trug weit, sodass sie auf dem gesamten Hof zu hören war. »Denn heute wird mein Sohn Aurel uns allen zeigen, dass er über die Stärke eines Königs verfügt. Diese Stärke ist nicht allein körperliche Kraft – auch wenn die natürlich nie schadet.« Er lächelte. »Nein, es ist eine innere Stärke, die einen befähigt, auch schwierige Entscheidungen ohne Zögern, ohne Skrupel und ohne Mitleid durchzusetzen. Stärke ist es, die einen zu einem guten Herrscher macht, nicht Mitleid. Natürlich kann ein starker Herrscher Erbarmen zeigen, wenn er es für angebracht hält, aber dieses Erbarmen muss seiner freien Entscheidung entspringen, es darf nicht darauf gründen, dass er weinerliches Mitleid für Besiegte, Kranke oder Schwache empfindet. Die Entscheidungen eines Königs müssen frei sein von solchen Empfindungen, und diese Freiheit kommt nur aus der Stärke.« Tiban streckte den rechten Arm in Aurels Richtung, die Hand geöffnet. »Mein Sohn, der mir eines Tages auf den Thron folgen wird, verfügt über diese königliche Stärke. Wie es Tradition ist in unserer Familie, wird der Tod eines Einhorns durch seine Hand sie unter Beweis stellen. Das Tier steht wie kein anderes für Unschuld und Schönheit, und doch wird Aurel sich davon so wenig einlullen lassen wie ich damals mit sechzehn Jahren. Wer ein Einhorn tötet, der spürt in sich etwas Göttliches, das ihn für immer verändert. Wer ein Einhorn tötet, ist fortan in der Lage, alles zu vollbringen. Nie wieder ist er ein Gefangener von falschen Skrupeln, denn er weiß, er kann alles überwinden. Wer ein Einhorn tötet, der ist wahrhaft frei in all seinen Entscheidungen und damit ein starker, ein wahrer König. Und ihr, die Vertreter des Hofs«, Tiban blickte in Richtung der Höflinge, »und die des einfachen Volks«, nun blickte er zu denen in der Sonne, »seid auserwählt, mit eigenen Augen zu sehen, dass euer zukünftiger König nicht zögert, wenn es darum geht, Stärke zu beweisen. Er ist ein Prinz, wie ihn sich jedes Land nur wünschen kann, und ein Sohn, der seinen Vater mit Stolz erfüllt!«
Der König verstummte, und Höflinge wie einfache Menschen jubelten. Arlac ließ weiter die Beine baumeln und schwieg. Nicht nur, weil der König ihm das Scherzen untersagt hatte, er verspürte auch nicht den geringsten Drang zu scherzen. Sein Blick wanderte über die Gesichter, auf denen sich Vorfreude zeigte. All die Wartenden hatten noch nicht begriffen, dass sie nicht nur dazu da waren, Aurels Tat zu bejubeln und ihm den würdigen Rahmen für seine große Tat zu liefern. Ihnen kam selbst eine wichtige Aufgabe zu, das hatte Arlac verstanden, als er in der vergangenen Nacht das Einhorn nicht aus dem Kopf bekommen hatte, egal, wie viel er soff.
Es war ähnlich wie bei Tibans Richtturm in Freybruck, der nicht nur für die Gehenkten gedacht war, sondern in erster Linie eine Zurschaustellung von Macht war und eine Warnung an die Zuschauer, sich ans Gesetz zu halten. Tiban dachte stets an die Inszenierung, das wusste Arlac, und so ging es nicht nur darum, dass der Prinz seine Stärke bewies, sondern auch darum, dass die Zeugen erlebten, wie der Prinz und künftige König das denkbar Schlimmste tat, und sie nicht eingriffen. Dass sie sich daran gewöhnten, den künftigen König bei einer Untat zu beobachten, jubelnd und bewundernd, und dass sie auf diese Weise lernten, ein König stünde über jeder Moral, solange er nur stark sei.
Aber natürlich wissen sie das längst, dachte Arlac, er immerhin wusste es. Nur war es erträglicher gewesen, als er darüber hatte lachen dürfen und als er noch nie ein Einhorn gesehen hatte.
Langsam verebbte der Jubel, wieder erklang die Posaune, laut und fröhlich. Vier Männer des Vogts führten das Einhorn von draußen herein. Sie hielten die Köpfe gesenkt, die Gesichter waren angespannt.
Lauf weg, dachte Arlac, aber das Einhorn zerrte nicht einmal an den Stricken. Ergeben ließ es sich führen, es wirkte kleiner als nachts im Wald. Arlac vermochte es kaum anzusehen, und so blickte er weg, beobachtete die Gesichter in der Menge. Sie alle hatten sich dem Geschöpf zugewandt, und Erstaunen zeigte sich auf ihnen, Ehrfurcht, Scheu, Mitleid und Ungläubigkeit angesichts der seltsamen Schönheit – so zumindest empfand es Arlac.
Und dann schaute er zu Prinz Aurel, sah auf dessen Gesicht das gleiche Erstaunen, die gleiche Überraschung und die gleiche Ehrfurcht, und begriff, dass auch der Prinz noch nie ein Einhorn gesehen hatte. Gestern hatte er nur gefeiert und sich feiern lassen, stolz und selbstverliebt, und auch am Morgen war er nicht in den Wald gegangen, um herauszufinden, was ihn erwartete. Er hatte einfach auf seine Stärke als künftiger König vertraut, und jetzt zitterte sein Arm mit dem Schwert.
Tiban, der das nicht mitbekam, weil er nur Augen für das Einhorn und die staunende Menge hatte, lächelte.
Einfache Menschen wie ranghohe Adlige wichen zurück und gaben den Weg frei, als das Einhorn über den Hof und auf das Podest geführt wurde. Dort wurde es an zwei massiven schwarzen Eisenringen festgebunden, die in der Wand verankert waren. Es schnaubte und scharrte mit den Hufen über den Stein, das Horn erschien Arlac matter als in der Nacht. Von den Stricken, die das Tier hielten, hatte er dagegen den Eindruck, sie würden schimmern wie Silber im Mondlicht. Solche Stricke hatte er noch nie gesehen.
Die Posaune verstummte, auch die Zuschauer waren vollkommen still, nicht einmal die kleinen Kinder gaben einen Laut von sich, auch nicht die Hunde oder Pferde, oder die Vögel hoch auf den Giebeln. Kein Lufthauch regte sich.
Die Männer, die das Tier angebunden hatten, verließen das Podest hastig, jeder Tritt auf der Treppe hallte laut in der Stille. König Tiban wich einen Schritt zur Wand zurück, um seinem Sohn den Raum zu überlassen. Dabei fiel sein Blick auf Aurel, und das Lächeln erlosch.
Arlac, der sowieso nah am Geschehen saß, beugte sich unwillkürlich noch weiter vor, um deutlicher zu sehen. Das Gesicht des Prinzen wirkte verbissen, und für einen winzigen Moment schienen seine Wangen im Sonnenlicht zu schimmern.
Tränen?, fragte sich Arlac verblüfft. Er blinzelte, das Schimmern war und blieb verschwunden. Wahrscheinlich hatte er es sich nur eingebildet, die Entfernung war ohnehin zu groß.
Doch wie zur Bestätigung huschte Verachtung über Tibans Gesicht, nur kurz, dann trug er wieder eine Maske aus Würde zur Schau.
»Tu es!«, sagte er schneidend.
Die Zuschauer hielten die Luft an, ein Mädchen lief jammernd davon, ein kleiner Junge begann zu heulen, und der Vater hielt ihm den Mund zu.
»Halt die Schnauze«, zischte er mit rotem Kopf, und das war weithin zu hören. Er drehte den Kopf des Kleinen in Richtung Podest. »Halt die Schnauze und schau hin.«
Unter den Erwachsenen sahen manche zu Boden, aber dann hoben die meisten den Blick wieder, als schämten sie sich ihrer Schwäche. Arlacs Herz krampfte sich zusammen, aber auch er konnte nicht wegschauen. Er merkte, dass er lautlos weinte, und wusste nicht, wie lange schon.
Aurel zögerte.
»Tu es jetzt!«, verlangte Tiban.
Aurel hob das Schwert ein Stück, in seinem Gesicht zuckte es, dem Ausdruck nach weinte er hemmungslos. Langsam ließ er das Schwert wieder sinken.
Die Höflinge starrten ihn an, doch keiner lachte. Viele rangen selbst um Fassung.
Das Einhorn stand reglos da, das Horn zeigte hoch in den Himmel. Arlac wünschte, die Stricke würden reißen und das Einhorn würde die Treppe weiter hinaufspringen, zur Burgmauer und darüber hinweg, es würde wiehernd zum Wald galoppieren oder durch die Luft stürmen, schön und frei, aber die schimmernden Seile hielten das Tier unerbittlich fest, und es stand einfach da wie gebannt und sah den Prinzen an.
Arlac erinnerte sich an die tausend gespiegelten Sterne in den nachtblauen Augen, an den Blick, der ihn bezwungen hatte, und fragte sich, was mit dem Einhorn geschehen würde, wenn Aurel es nicht tötete, aber da erklang ein Keuchen.
»Nein«, keuchte Aurel quäkend, die Nase von Rotz verstopft. »Du machst mich nicht zu einem Schwächling!«
Und damit riss er das Schwert in die Höhe. Weit über den Kopf hob er es.
»Stirb!«, schrie er, als könnte er so seine Stärke herbeirufen, und seine Stimme bebte vor Wut und Verzweiflung. Noch während er schrie, ließ er das Schwert auf das Einhorn niedergehen, anstatt es mit einem sauberen Stich ins Herz zu erlösen. Unwillkürlich wandte er selbst den Kopf ab.
Die Klinge traf auf das Horn, rutschte an ihm entlang und schlug dem Tier eine lange Wunde in die Stirn. Blut quoll heraus, Mähnenhaare segelten zu Boden, doch das Einhorn blieb stehen.
Die Zuschauer japsten, die Pferde im Stall wieherten schrill und schlugen die Hufe gegen die Tür. Ein Hund kläffte. Andere fielen ein, der Junge biss seinem Vater in die Hand und heulte lauter. Der Vater fluchte.
König Tibans Miene war starr.
Aurel riss das Schwert hoch und schlug erneut zu, und diesmal sah er auch hin. Das Einhorn wankte, und er schlug ein drittes Mal zu, und endlich ging das Tier zu Boden.
Aurel aber hörte nicht auf, er drosch die Klinge auf die Flanke des liegenden Tiers, schlug wieder zu, wieder und wieder, bis er irgendwann keuchend innehielt.
Die Hunde bellten wie im Wahn, die Pferde schrien, die Vögel auf den Dächern stoben davon.
Arlacs Brust krampfte sich zusammen, er wollte schreien, aber er tat es nicht, er ließ den Schmerz toben und suchte verzweifelt nach einem Scherz, mit dem er ihn würde betäuben können.
Vom Schuldturm drang ein Schrei herüber: »Und ihr da unten nennt mich einen Verbrecher!«
Ein Ritter ging auf die Knie, und Arlac dachte, er würde sich gleich übergeben, aber das war es nicht, er kniete vor dem Prinzen.
König Tiban nickte grimmig.
Krähen kreisten krächzend über der Burg.
Aurel atmete heftig, er war über und über mit Blut beschmiert. Das Einhorn zu seinen Füßen zuckte nicht mehr, und er sah es nicht an. Triumphierend reckte er das besudelte Schwert in den Himmel und sah in die Menge; die Klinge zitterte.
Weitere gingen auf die Knie, manche sahen ihn bewundernd an, andere voll Abscheu oder Angst, manche verwirrt, doch letztlich knieten sie alle. Alle bis auf Arlac, der in der Fensterlaibung saß und dort nicht knien konnte; der Platz war gut gewählt.
König Tiban sagte nichts.
Aurel rief: »Schwäche und Mitleid werden mich nicht überwinden. Ich kann und werde tun, was immer nötig ist, denn ich bin wahrhaft frei, ihr seid meine Zeugen!«
»Wir sind deine Zeugen«, antworteten die Knienden im Chor. Es klang dünn und verängstigt.
Arlac, der mit Haut und Haar Narr war, dachte: Ihr kniet vor einem Fleischer, noch dazu vor einem miserablen, aber er sagte es nicht. Auch bestellte er weder ein Stück Lende – gern noch etwas blutig – noch Gehacktes in Prinzentränensud, wie er es gern getan hätte, wenn er denn auch an diesem Tag Narr hätte sein dürfen. Und er wäre gern Narr gewesen, denn ein Lachen, und sei es noch so böse, schrill oder verzweifelt, hätte die Qual der Situation gemildert. Der Tod des Einhorns war das Schlimmste, was er je hatte mit ansehen müssen, und er hatte wahrlich schon vieles gesehen – nur im Krieg war er nicht gewesen.
Den heutigen Tag würde er Prinz Aurel nie verzeihen, und dafür würde er ihn bis an sein Lebensende verspotten, das schwor er sich.
Hitze
1
Seit über einem Monat lebte Ukalion nun im Schatten der Dornenhecke. Er schlief in einem großen leeren Haus in Sichtweite, trank und aß in den Zehn Kerzen, verbrachte jedoch die meiste Zeit grabend in einem Raum unterhalb der Dornenhecke.
Vor Jahrhunderten von dreizehn Hexen geschaffen, überwucherte sie bis heute den gewaltigen Kaiserpalast von Ycena samt Nebengebäuden, Ställen und Gärten vollständig. Ein Dickicht aus verschlungenen steinharten Ästen, die weder mit einem Werkzeug noch mit einer Waffe zu durchtrennen waren, die Ukalion aber überwinden wollte. Er musste es, um sich König Tiban entgegenzustellen, dem fernen Vater, der ihn, den Bastard, nicht akzeptierte und das Land tyrannisierte. Ebenso dem verhassten Halbbruder Aurel, der Ckarya hatte hinrichten und demütigen lassen, nur weil sie im königlichen Wilden Wald gewildert hatte.
Nur weil sie mein gewesen ist!, dachte Ukalion bitter. Bereits vier Schritt tief war der Schacht, in dem er stand, und wieder und wieder rammte er den Spaten in den Boden und schaufelte schwarze Erde heraus. Kleine Steine knirschten unter der schartigen Kante des Werkzeugs, Würmer wanden sich im Dreck, Käfer krabbelten davon. Ukalion schwitzte und stank, das Hemd hatte er längst ausgezogen.
Das Licht der Fackel, die oben am Schachtrand im Boden steckte, flackerte, obwohl die Luft hier unter der Erde stillstand. Eine zweite Fackel klemmte am Eingang des Raums zwischen Ziegeln in der Wand.
Zahlreiche Abenteurer hatten in der Hecke ihr Ende gefunden, festgehalten von langen Dornen. Ihre zerbrochenen Klingen, gesplitterten Knochen und Zähne, ihre Gürtelschnallen und Schmucknadeln hatten sich mit der Hecke verbunden und waren zu neuen Dornen geworden, spitz und scharfkantig. Unerbittliche Krallen der ineinander verschlungenen Ranken, die Blut und Tränen wie Wasser tranken und als undurchdringlich galten. Trotzdem hatten immer neue Abenteurer versucht, hindurchzugelangen, denn hinter den Dornen warteten unermessliche Reichtümer aus dem untergegangenen Kaiserreich – und die schlafende Tochter des letzten Kaisers. Glaubte man dem Märchen vom letzten Kaiser, so konnte man sie mit einem einzigen Kuss wieder erwecken; und ihrem Retter waren die Hochzeit mit ihr sowie der Titel des Kaisers versprochen.
Fast jeder in den dreizehn Königreichen kannte das Märchen, doch nur die wenigsten glaubten, dass die Kaisertochter dort tatsächlich schlief.
»Das Märchen ist ein Märchen«, sagten die meisten Sucher von Ycena lapidar und durchwühlten die Ruinen außerhalb der Dornenhecke nach Überresten, die sich zu Geld machen ließen – nach Schmuck und Statuen, nach Keramik, Münzen und allem anderen.
»Selbst wenn die Hexerei sie damals tatsächlich nur in den Schlaf geschickt hat, ist sie heute doch längst verhungert«, behaupteten sie. »Ganz abgesehen davon, dass niemand vierhundert Jahre alt wird.«
Das sagt ihr nur, weil ihr es nicht wagen wollt, die Hecke zu überwinden, dachte Ukalion jedes Mal, wenn er das hörte, aber er sprach es nicht aus. Ihm war ihre Überzeugung nur recht, denn er hatte den Traum, Kaiser zu werden, noch nicht aufgegeben. Er hatte gesehen, wie mächtig die alte Hexerei war, und traute ihr ohne Weiteres zu, eine junge Frau über Jahrhunderte im Schlaf und am Leben zu halten. Und doch war die Macht der Hecke vor vier Wochen, als sie den Hexer ohne Gesicht und Namen besiegt hatten, kurz ins Wanken geraten, und an diese Schwäche knüpfte er seine Hoffnung. Denn was einmal geschehen war, konnte immer auch wieder geschehen.
Zwei Tage lang hatte er die Hecke langsam umrundet und von früh bis spät vergebens nach einer Schwachstelle gesucht, hatte eine lange Stange aus Holz hineingestoßen, war aber nicht durchgedrungen. Am dritten Tag hatte er die Hoffnung auf eine Schwachstelle aufgegeben und war wieder in die einstige Kanalisation hinabgestiegen, in den Raum, dessen rückwärtige Wand von den Wurzeln der Hecke gebildet wurde. Den Raum, in dem die Hecke sich von Kinderträumen genährt hatte; dorthin, wo sie den Hexer besiegt hatten, der kein Mensch gewesen war; dorthin, wo die Wurzeln eine kleine Weile lang verwundbar gewesen waren. Das waren sie zwar nicht mehr, aber auch unverwundbar mussten sie irgendwo ein Ende haben.
Sie können nicht bis in die Unterwelt reichen, hatte Ukalion gedacht, doch für einen Moment hatte ihn die Vorstellung schaudern lassen. Dann hatte er den Kopf geschüttelt und den Spaten direkt bei den Wurzeln in den Boden gestoßen.
Nein, das können sie nicht.
Seitdem grub er an dem Loch, das ihn unter den Wurzeln hindurchführen sollte, so wie er es anfangs schon an der Oberfläche versucht hatte – damals jedoch ohne Geduld. Inzwischen wusste er, dass es dauern würde. Der Boden war hart, die Luft stickig, und er, Ukalion, war allein, und so kam er nur langsam voran.
Sicherheitshalber hatte er seinen Anspruch auf den Raum durch eine Fahne mit seinem Namen markiert, wie es unter den Suchern von Ycena üblich war, doch niemand verirrte sich hierher, niemand machte ihm den Platz streitig.
Trotz der Tiefe des Schachts war noch kein Ende des Wurzelwerks auszumachen. Wieder und wieder stieg Ukalion über eine selbst gebaute Leiter rauf und runter, hob einen Eimer Erde nach dem anderen aus und schaffte jeden einzeln hinauf. Die Erde schichtete er weiter vorn im Raum und draußen in der ehemaligen Kanalisation zu Haufen auf. Sein Rücken schmerzte, die Gelenke knirschten, Arme und Beine zitterten, und manchmal verschwamm hier unten im Dämmerlicht alles vor den Augen, aber er machte weiter.
Für Ckarya.
Er sprach nicht mehr so oft mit ihr wie direkt nach ihrem Tod, aber seit Tyra fort war und er den ganzen Tag allein hier unten arbeitete, dachte er viel an sie.
Und an Tiban.
An Aurel.
Wut und Hass gaben ihm die Kraft, immer weiter zu graben, obwohl die Wurzeln tiefer und tiefer reichten. Drei der Wände des Schachts stützte er mit Brettern ab, die er aus alten Möbeln in den Ruinen herausbrach, die vierte wurde von den verschlungenen Wurzeln allein gehalten – oder gar überwiegend gebildet.
Nur noch einen Eimer, sagte er sich erschöpft wie schon bei den letzten sieben, und dann hatte er sich doch weiter durchgebissen und war immer noch einmal hinabgeklettert. Er musste die Hecke überwinden, bevor die anderen mitbekamen, was er tat. Er musste in den Palast gelangen, solange sie noch in den anderen Ruinen suchten und den eigentlichen Schatz von Ycena aufgegeben hatten. Er musste Kaiser werden, um Tiban die Stirn zu bieten.
Für Ckarya.
Für seine Mutter.
Für seinen wahren Vater Gajus, der ihn nicht gezeugt, ihm aber schließlich doch seinen Namen gegeben hatte.
Für Ckaryas Großvater und alle anderen, die hatten sterben müssen.
Erschöpft schüttete er die Erde aus und stellte den leeren Eimer ab. Seine Zunge war geschwollen, der Mund ausgetrocknet. Durstig griff er nach dem Wasserschlauch, aber der war leer, schon lange.
Noch einen letzten Eimer, ermutigte er sich trotzdem und stieg die Leiter mit zitternden Beinen nach unten. Direkt bei den Wurzeln setzte er den Spaten an und hebelte Erde heraus, und dann sah er etwas blinken. Ächzend kniete er sich hin, um den Dreck um das Blinken herum mit den Händen wegzukratzen. Mit etwas Glück war das eine alte Münze. Schon nach wenigen Augenblicken erstarrte er, und für einen Moment setzte sein Herzschlag aus.
Es war keine Münze und dennoch Gold. Ein großer goldener Siegelring, durch den eine fingerdicke schwarze Wurzel gewachsen war.
Gold!
Das musste echtes Gold sein!
Ukalions Herz schlug wieder, und es schlug schneller. Das war der erste richtige Schatz, den er in Ycena gefunden hatte – oder überhaupt in seinem Leben. Hastig zog er sein Messer und hackte damit in die Wurzel, die mit anderen verflochten war. Unverletzt federte das Geflecht zurück, und das Messer traf knirschend auf die Erde, nur knapp neben seinem Knie.
Verdammt! Er musste den Ring freilegen. Keuchend grub er mit Händen und Klinge und schürfte sich alle Finger auf. Erneut hackte er auf die Wurzel ein, und erneut federte sie zurück. Es war wie überall an der verdammten Hecke: Er konnte ihr kaum einen Kratzer zufügen. Als schlüge ein kleines Kind mit einem Holzmesser auf eine Eisenstange ein.
»Komm schon!«, knurrte er verzweifelt. Mit dem Gold würde er sich gutes Werkzeug und Vorräte für eine halbe Ewigkeit leisten können, ohne die Sachen selbst zusammensuchen zu müssen. Bretter, Stützbalken und alles andere, was er benötigte, um sich unter der Hecke hindurchzugraben. Er hackte schräg und gerade auf die Wurzel ein, sägte mit der Klinge und versuchte, die Rinde Stück für Stück abzuschaben, doch nichts davon gelang, die Wurzel war zu hart.
»Verdammt!« Ukalion schleuderte das Messer fort. Sein Mund war voller Dreck, doch als er ausspucken wollte, fehlte ihm der Speichel. Müde hob er das Messer wieder auf und steckte es weg. Anschließend umwickelte er den Ring mit einem Stück grauer Schnur, sodass er nicht mehr zu sehen war. Falls ein anderer Sucher hier herunterkam, sollte der nicht unbedingt Gold entdecken; dann wäre es mit der Ruhe vorbei, dann müsste Ukalion um sein Vorrecht, hier zu graben, kämpfen.
Enttäuscht füllte er den Eimer nun wirklich zum letzten Mal für diesen Tag und brachte ihn und den Spaten hinauf. Er warf sich das Hemd über, löschte die Fackel am Schacht, nahm die zweite mit und schüttete die Erde draußen in die Kanalisation. Erschöpft machte er sich auf den Weg zurück an die Oberfläche.
2
Durch den schmalen Einstieg in die Kanalisation kletterte Ukalion hinaus. Es war so hell, dass er die Augen zusammenkneifen musste, und die Hitze traf ihn mit voller Wucht, und doch freute er sich den ganzen Tag auf diesen Moment. Mit ausgebreiteten Armen hieß er die Sonne willkommen, es war, als brenne sie die Dunkelheit aus ihm heraus. Nirgendwo waren die Nächte schwärzer als in Ycena, und die Tage verbrachte Ukalion im spärlichen Fackellicht unter der Erde. Seit Wochen bewegte er sich, abgesehen vom frühen Morgen und den Abenden, in einsamer Dunkelheit, und diese Dunkelheit schien ihm inzwischen unter die Haut zu kriechen, ihn zu füllen. Langsam atmete er ein und aus. Die Hitze blendete und brannte und stach, aber er brauchte sie.
Als sich seine Augen an das grelle Licht gewöhnt hatten, beschattete er sie und hob den Blick, um zu sehen, ob sich irgendwo eine Wolke zeigte. Auch wenn die Sonne seine innere Dunkelheit vertrieb, hoffte er natürlich auf Wolken, doch der Himmel war blau und klar. Selbst im Schatten herrschte Hitze. Die Trockenheit hatte Ycena seit Wochen im Griff, der breite Tivere führte jeden Tag weniger Wasser.
Langsam machte Ukalion sich auf den Weg zum Fluss, um sich den Dreck von der Haut zu waschen. Schwarze Nachtsalamander lagen auf den warmen Steinen am Wegrand, und schillernde Fliegen krabbelten über die hellen Hauswände. Brummend umkreisten sie Ukalion, angelockt vom getrockneten Schweiß, und bald kamen auch summend die Mücken. Hungrig setzten sie sich auf seine bloße Haut, und er schlug mit der freien Hand nach ihnen.
In einer Seitengasse lungerten drei Streuner herum, aber Wolf war nicht unter ihnen. Ihn hatte Ukalion seit der Nacht, als er davongelaufen war, nicht mehr gesehen. Telamon und Isa glaubten, er sei tot und die Nachtkreaturen hätten sich furchtbar an ihm gerächt, und wahrscheinlich hatten sie recht. Der Junge hätte nicht so kopflos davonstürzen sollen.
Warum hast du das nur getan? Du könntest noch leben.
Am Tivere schöpfte Ukalion mit den Händen Wasser und trank gierig, dann wusch er sich Dreck und Schweiß von der Haut. Nass schlüpfte er wieder in die schmutzige Kleidung und ging nach Hause. Er mied den Schatten, wo immer möglich, und hielt das Gesicht der Sonne entgegen. Noch unterwegs trocknete sie ihn. Er stellte Spaten und Eimer ab und machte sich auf, etwas zu essen und zu trinken. In lauter Gesellschaft gegen die Einsamkeit im Schacht.
Schallendes Gelächter drang aus den Zehn Kerzen, als Ukalion sich den ehemaligen Thermen näherte. Zwei Streuner standen am Fenster und sahen hinein, ein alter Sucher saß sabbernd auf den Resten einer Säule und summte kichernd vor sich hin; Estor, der sich eine Hand beim Graben verstümmelt hatte, Ycena aber nicht verlassen wollte.
»Ich weiß nicht, was ich dort draußen soll, dort wartet nichts und niemand auf mich«, sagte er immer, aber viele glaubten, dass er dort gesucht wurde – so wie einige von ihnen auch. In Ycena kam er zwar als Sucher nicht mehr weit, aber nüchtern war er als erfahrener Ratgeber geschätzt und gewann beim Spiel genug, um zu essen, hin und wieder das Bordell zu besuchen und vor allem zu saufen, und das reichte ihm. Neben ihm lag ein umgestürzter Krug auf dem Boden.
Ukalion nickte ihm zu und ging hinein. Fast alle Tische der riesigen Halle waren belegt, der Tresen dicht belagert. Überall wurde gerufen, getrunken und gelacht.
»Neuankömmlinge!«, rief Isa ihm vom ersten Tisch neben der Tür zu, kaum war er eingetreten, und winkte ihn herbei. Ihre Wangen waren gerötet, und sie trug die blonden Haare zu einem verschlungenen Knoten gebunden, den Tyra ihr gezeigt hatte. Bei ihr waren ihr Vater Telamon und Belizar, sie hatten große Krüge und leere Teller vor sich. »Eine Frau und ein Mann.«
»Neue Sucher?« Ukalion trat zu ihnen.
»Was sonst?« Isa lachte. »Sie waren auch schon an der Hecke!«
Ukalion durchfuhr es kalt. Was hatten die Neuen vor? Wollten sie in den Palast eindringen wie fast jeder, der neu hierherkam? Er erinnerte sich noch gut daran, wie er zum ersten Mal vor der Hecke gestanden hatte und wie überwältigend ihm ihre unbegreifliche Größe erschienen war. Wie er für einen Moment alle Hoffnung verloren hatte, sie je zu überwinden. Was, wenn die Neuen nicht so leicht die Hoffnung aufgaben? Was, wenn sie schneller einen Weg hinein fanden als er? Er versuchte, sich die Angst nicht anmerken zu lassen, und fragte möglichst unbeteiligt: »Und? Was haben sie gesagt?«
Isa zuckte mit den Schultern. »Was wohl? Jeder ist von der Hecke beeindruckt.«
»Weißt du, was sie wollen?«
»Nein. Aber die Frau ist schön.«
»Ach, ja?« Das erklärte natürlich, warum der Andrang diesen Abend so groß war, größer als damals bei ihm. Frauen waren selten in Ycena, und schöne besonders. Oder hatte der Andrang eine andere Ursache? Neugierig sah Ukalion sich um, doch er konnte die Neuen nicht entdecken. »Und was ist der Mann für einer?«
»Der ist komisch.«
»Komisch? Ein Gaukler und Spaßmacher?«
»Nein.« Nachdrücklich schüttelte sie den Kopf.
»Was meinst du dann?«
»Ich weiß nicht. Er ist nicht lustig, er stellt komische Fragen.«
Telamon wuschelte ihr durchs Haar und wandte sich Ukalion zu. »Er hat sich nach Inschriften auf Ruinen erkundigt und nach Wandmalereien und so was. Als Parikles ihm gesagt hat, dass das nichts einbringt, dass im Moment Statuen besonders gefragt sind, hat er erwidert, das sei ihm nur recht, dann würde ihm niemand die Inschriften streitig machen. Für Statuen interessiere er sich natürlich auch, aber in erster Linie eben für Bücher und Pergamentrollen und alte Briefe. Bücher! Kannst du dir das vorstellen?«
»Er ist ein Schreiber aus irgendeiner Bibliothek, sagt er«, ergänzte Belizar. Seine Wunden waren so weit verheilt, dass er vor einer Woche das Bett verlassen hatte. Noch konnte er weder schwer tragen noch sich anderweitig anstrengen, aber er hatte Glück gehabt, nichts hatte sich entzündet, er würde sich wieder völlig erholen.
Bücher, dachte Ukalion erleichtert. Die mussten sich doch außerhalb der Hecke finden lassen, wie auch Inschriften und Wandmalereien. Trotzdem fragte er: »Was macht ein Schreiber hier?«
»Was ein Müllergehilfe? Ein Seemann?«, hielt Belizar ihm entgegen und grinste.
»Auch wieder wahr.« Ukalion nickte. »Ich hol mir ein Bier und schau mir die beiden mal an.«
Langsam ging er an den Tresen, grüßte den Wirt Labuz und bestellte bei Maija ein Bier. Sie half manchmal aus, wenn sie gerade nicht im Bordell arbeitete.
Da, am anderen Ende des Tresens, umlagert von trinkenden Suchern, standen die Neuankömmlinge. Isa hatte recht, die Frau war schön, auch wenn sie nicht mehr jung war. Groß und schlank, das Haar lang und schwarz und das Gesicht ebenmäßig. Jeder wollte ihr etwas ausgeben, aber sie bezahlte selbst und trank langsam und überließ das Reden dem Mann. Sie wirkte müde, aber aufmerksam. Als Sylenos, ein trinkfreudiger Sucher mit roten Wangen, ihr vertraulich den Arm um die Schulter legte, löste sie sich mit einer schnellen Bewegung und stieß ihn fort. »Such dir eine Statue, wenn du dich anlehnen willst. Und wenn du was anderes willst, dann such dir auch eine Statue, denn die sind leichter zu erweichen als ich.«
Sylenos taumelte zurück, stürzte aber nicht. Andere lachten, und ein Grinsen zeigte sich auf Sylenos’ Zügen. Langsam wankte er wieder auf sie zu, die rechte Hand ausgestreckt, als würde er sich an ihr orientieren. Dazu nuschelte er: »Komm schon, Schöne.«
»Nein«, erwiderte sie und hob die Brauen.
»Nein? Wieso nein? Du kannst doch nicht einfach so … Ich hab von allen hier zuerst gefragt, ich bin der Erste …«
»Nein, hat sie gesagt«, mischte sich jetzt der Mann ein.
Sylenos blieb stehen und musterte ihn wankend. »Bist du ihr Mann?«
»Du bist es auf jeden Fall nicht, oder?«
Sylenos schien verblüfft. Er schüttelte er den Kopf. »Nein, bin ich nicht. Das bin ich wirklich nicht. Oder?« Er sah aus, als denke er ernsthaft darüber nach. Unablässig den Kopf schüttelnd, taumelte er an den Tresen, wo er von Maija einen weiteren Wein verlangte. Dann fragte er: »Arbeitest du heute gar nicht?«
»Doch.«
»Warum bist du denn dann hier?«
»Ich arbeite.«
»Du …? Ach, heute habe ich einfach kein Glück.« Er bezahlte den Wein und ging, ohne den Krug anzurühren. Vergessen stand der auf dem Tresen.
»He, Sylenos!«, rief Maija. »Dein Wein!«
»Lass ihn stehen«, brummte er. »Ich trink ihn morgen früh.«
»Bis dahin schwimmen hundert Fliegen drin«, johlte irgendwer.
»Dann trink ich die eben mit«, erwiderte Sylenos und trat unsicher auf die Straße.