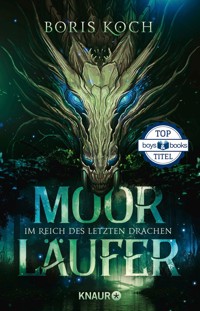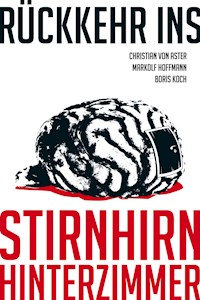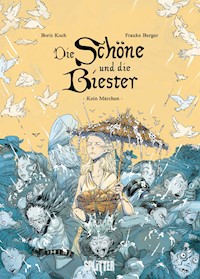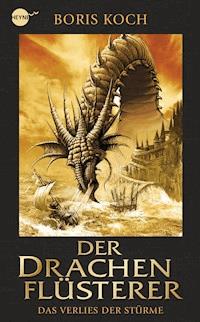9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Drachenflüsterer-Serie
- Sprache: Deutsch
Der junge Ben ist Drachenflüsterer und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die majestätischen Geschöpfe vor der Verfolgung durch die Drachenritter zu schützen. Eine Mission, mit der er sich im Großtirdischen Reich viele gefährliche Feinde verschafft hat. Als der am meisten gefürchtete Kopfgeldjäger des Landes auf Ben angesetzt wird, muss dieser fliehen, begleitet von seinem treuen Gefährten, dem Drachen Aiphyron. Es bleibt ihm nur eine Hoffnung: Im Ewigen Eis, bei den weißen Drachen, könnte es ein wirksames Mittel geben, um den Orden dauerhaft zu schlagen. Doch der Weg dorthin ist gefährlich – und die weißen Drachen gelten als besonders grausam. Andererseits: Wann hätte Ben sich jemals vor Drachen gefürchtet?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Ben hat es sich zur Aufgabe gemacht, die majestätischen Drachen vor der Verfolgung durch die Drachenritter zu schützen. Eine Mission, mit der er sich im Großtirdischen Reich viele Feinde verschafft hat und zum Geächteten wurde. Doch er ist nicht allein: Gemeinsam mit seiner Freundin Anula, dem treuen Drachen Aiphyron und einigen kampferprobten Gefährten hat sich Ben in einer entlegenen Festung versteckt. Als aber der Hohe Abt persönlich die Jagd auf Ben und seine Freunde eröffnet, muss der Drachenflüsterer handeln. Denn es gibt womöglich eine Waffe, mit der sich der Abt und die Ritter für immer zurückdrängen ließen. Eine Waffe, die allerdings an einem Ort verborgen liegt, den kein Mensch (und eigentlich auch kein Drache) freiwillig zu betreten wagt. Doch wann hätte Ben sich schon jemals von alten Legenden in die Flucht schlagen lassen?
Der Autor
Boris Koch, Jahrgang 1973, wuchs auf dem Land südlich von Augsburg auf und studierte Alte Geschichte und Neuere Deutsche Literatur in München. Nach 15 Jahren in Berlin lebt er heute als freier Autor in Leipzig. Zu seinen Buchveröffentlichungen gehören die erfolgreiche Drachenflüsterer-Saga, die humorvolle Abenteuergeschichte Die Mondschatzjäger und der mit dem Hansjörg-Martin-Preis ausgezeichnete Jugendkrimi Feuer im Blut. Sein Roman Vier Beutel Asche wurde von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur als Jugendbuch des Monats April 2013 ausgezeichnet.
BORISKOCH
DER DRACHENFLÜSTERER
Die Feuer von Arknon
Roman
Für Elli
PROLOG
E
GEFESSELT
Die wuchtigen Mauern und schlanken Türme des Klosters leuchteten rot in der Nachmittagssonne. Sie bestanden aus dem seltenen dunklen Blutgranit, der von schimmernden Kristalleinsprengseln durchzogen war. Der sanfte Wind wehte vom Meer herein, und Cathe lehnte sich zwischen zwei Zinnen und sah hinab. Von hier konnte man weder das Meer noch Rhaconia ausmachen, dafür musste man auf den höchsten Turm, doch der war der Äbtissin Pallhene vorbehalten.
Cathe achtete nicht auf die Stimmen vor dem Tor, sie wollte einfach nur ein paar Minuten für sich sein, bevor der Unterricht fortgesetzt wurde. Sie fragte sich, wie es ihren Eltern ging und wie sehr sie sie vermissten. Sie selbst vermisste sie weniger als gedacht, und das schmerzte. Sie fühlte sich wie eine Verräterin, dabei war es ihr Vater gewesen, der zuerst Tharas im Stich gelassen hatte.
Seit nunmehr sechs Wochen waren sie im Kloster Felsenrot, und doch konnte Cathe sich an dem herrlichen Bauwerk kaum satt sehen. Im kleinen Buchenbrunn gab es nichts annähernd Vergleichbares. Cathe und Sinje waren beide als Jungfrauenschülerinnen angenommen worden, und Cathe konnte kaum sagen, wie froh sie darüber war. Sie hatte nicht geahnt, wie viele ehrgeizige Eltern ihre Töchter hierher schleppten, teuer herausgeputzt und breit lächelnd in der Hoffnung, angenommen zu werden. Jede Jungfrau, die drei oder vier Jahre als lebender Köder ihren Dienst getan hatte, wurde vom Orden ehrenhalber entlassen und galt fortan als ausgezeichnete Partie. Jungfrauen des Ordens waren erwiesenermaßen Jungfrauen, sie waren schön, tapfer und äußerst duldsam.
»Wer wünscht sich nicht eine Frau, die sich freiwillig fesseln lässt?«, war ein tausendfach gehörter Scherz im Großtirdischen Reich, aber Cathe wollte nicht glauben, dass das alles war. Wer die drei oder vier Jahre als Lockvogel für wilde Drachen überlebte, hatte mehr erlebt, gesehen und erreicht als die meisten anderen. Hatte mehr für das Wohl aller getan als all die Spötter zusammen. Und was die vergaßen: Eine solche Jungfrau hatte in den Jahren meist mehreren wilden Drachen ins Auge gesehen, ohne davonzulaufen. Sie hatte gesehen, wie Samoths Fluch von ihnen wich. So jemandem konnte ein wenig Spott nichts anhaben.
Und er änderte auch nichts daran, dass viele Jungfrau werden wollten. Zahllos waren die Bewerberinnen, doch die meisten wurden nicht angenommen. Jene, die mit ihren Eltern gekommen waren, gingen auch wieder mit ihnen, geknickt oder gekränkt, enttäuscht oder auch mal mütterlich streng beschimpft: »Du hättest die Lippen roter schminken sollen! Hab ich das nicht gleich gesagt? Und dich gerader halten!«
Aber sie konnten wenigstens wieder nach Hause. Auf Ausreißerinnen, die allein ihr Glück versuchten, warteten dagegen herausgeputzte Männer und Frauen aus Rhaconia vor dem Tor, um ihnen irgendwelche Arbeit anzubieten. Und die Abgelehnten, die gerade ihren Stolz und ihre Träume verloren hatten und oft nicht viel besaßen, gingen mit ihnen, weil sie sonst meist niemanden hatten. Cathe wusste nichts über diese Arbeit, aber sie konnte sich nicht vorstellen, dass es eine schöne war. Ihr gefielen die schmierigen Männer und Frauen aus Rhaconia nicht, und sie verstand nicht, warum der Orden das zuließ. Konnte er diese Mädchen nicht einfach als Dienstmagd oder Küchenhilfe oder für die Feldarbeit einstellen? Immerhin waren sie bereit gewesen, als Jungfrau ihr Leben für den Orden zu riskieren.
Cathe vertrieb die trüben Gedanken an die abgelehnten Mädchen. Beinahe täglich hatte sie ihren Eltern schreiben wollen, dass sie jetzt eine angesehene Jungfrau war und am Leben, aber Sinje hatte sie abgehalten. »Die holen uns hier sofort raus. Mein Vater zumindest. Er denkt gern, dass ich sein Besitz bin.«
Also hatte Cathe nicht geschrieben. Wahrscheinlich wäre auch ihr Vater hier aufgetaucht und hätte einen Streit mit dem ganzen Orden vom Zaun gebrochen. Was glaubten ihre Eltern, was mit ihr geschehen war? Bestimmt waren sie überzeugt, dass die Drachen sie – die Jungfrau – geholt und gefressen hatten, so wie den kleinen Tharas.
Das gefiel ihr nicht, denn sie hatte ihnen keinen Kummer machen wollen. Sie wollte ihnen schreiben, damit sie stolz auf sie wären, aber vielleicht war es besser, nicht herauszufinden, ob sie nicht eher stinksauer waren.
Manchmal packte sie die verrückte Hoffnung, Tharas könnte noch leben, denn wenn Sinje und sie nicht von den Drachen geholt worden waren, obwohl das Dorf fest davon ausging, war es Tharas vielleicht auch nicht. Dann hätte Sinje ihren Racheschwur völlig ohne Grund geleistet.
Nein. Cathe schüttelte den Kopf. Das war Wunschdenken. Sie hatten ein Ziel gehabt und waren fast erwachsen, Tharas war zehn gewesen und allein. Wohin hätte er denn weglaufen sollen? Und warum? Nein, er war von den Drachen geholt worden. Niemand im Dorf hatte Spuren von wilden Tieren gefunden, es mussten also die geflügelten Bestien gewesen sein, die einfach in die Luft verschwinden konnten.
»Kommst du?«, rief Sinje plötzlich.
»Ja.« Langsam stieß sich Cathe von der Brüstung ab. Es war Zeit für den Unterricht.
Sinje wartete vor dem Brett für Aushänge, das sie jeden Tag mindestens dreimal besuchte. Jedes Mal starrte sie auf dasselbe Plakat und murmelte: »Ich kriege dich, Ben, ich kriege dich.«
»
LEBEND ODER TOT
Schaumgekrönte Wellen plätscherten gegen das steinige Ufer der kleinen Insel, die Luft schmeckte nach Salz. Der steckbrieflich gesuchte Drachenflüsterer Ben saß auf einem mannshohen Felsen am Wasser und hielt seelenruhig eine Angelrute in der Hand. Er hatte viel kürzere Haare als auf den meisten Steckbriefen beschrieben, und seine Hose bestand schon längst nicht mehr aus einer Ansammlung bunter Flicken. Ein Jahr war vergangen, seit der Orden das erste Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hatte. Seitdem hatte er sich verändert, auch wenn er noch immer drahtig war.
Neben ihm döste der acht Schritt lange, geflügelte Drache Jurbenmakk friedlich in der Nachmittagssonne. Er wurde von allen nur Juri gerufen, und wann immer er konnte, suchte er die Nähe von Wasser. Ben war ein guter Angler, doch heute wollte kein Fisch anbeißen.
Tiefblau strahlte der Himmel über ihnen, und die Luft war so klar, dass Ben das Land am Horizont erahnen konnte, ein dunkler Streifen im leuchtenden Blau, die Küste des mächtigen Großtirdischen Reichs. Ihre Insel war von dort jedoch nicht zu erkennen, das wusste er.
»He, du Fürchterlicher!«, drang plötzlich Akses Stimme laut aus der gewaltigen Festung in Bens Rücken. Sie war einst von riesigen Seetrollen aus großen dunklen Steinquadern errichtet worden und nahm mit fast tausend Schritt Länge die halbe Insel ein. Zahlreiche runde Türme erhoben sich siebzig oder achtzig Schritt hoch, und einer sogar über hundert. Wuchtige Pfeiler, die zahllosen Stürmen getrotzt hatten und an Regentagen bis zu den tief hängenden Wolken zu reichen schienen. »Wir sind fast fertig. Jetzt brauchen wir deine Hilfe!«
»Ich bin der Schreckliche, nicht der Fürchterliche!«, rief Ben und holte lachend die Angel ein. »Wenn schon angsteinflößend, dann richtig, alter Knappe und Besenschwinger!«
»Meinetwegen, Schreckhafter. Hauptsache, du kommst!«
»Ja, ich komme.« Ben sprang vom Felsen und schulterte die Angel.
Juri blinzelte und öffnete die Augen. »Vergiss den Fisch nicht.«
»Welchen Fisch?«
»Den für Sidhy.«
»Natürlich für Sidhy, aber welchen? Ich hab keinen gefangen.«
»Menschen«, schnaubte Juri abfällig und grinste sein lippenloses Drachengrinsen. Seine Schnauze war lang, die spitzen Zähne zahlreich. »Auf die ist einfach kein Verlass.«
»Ach?«
»Zumindest in den wesentlichen Dingen.« Kurz schüttelte sich Juri, dann sprang er aus dem Stand hoch in die Luft. Mit zwei, drei kräftigen Flügelschlägen schraubte er sich weitere zwanzig Schritt in die Höhe und ein Stück raus aufs offene Meer. Seine schilffarbenen Schuppen schimmerten in der Nachmittagssonne. Zwei Reihen gelbgrüner Zacken verliefen parallel über den breiten Rücken, bevor sie sich auf dem kurzen Schwanz vereinten.
Der Wind frischte auf, und Juri legte die Flügel ganz eng an den Körper. Kopfüber stürzte er hinab, die Klauen ausgestreckt, die Zähne gefletscht. Platschend tauchte er ins Meer, Wasser schlug hoch und spritzte fast bis zu Ben. Drei gescheckte Dämmermöwen kreisten kreischend über ihm, aufgeschreckt von dem plötzlichen Aufruhr. Irgendwo hinter ihm meckerten zwei Krummhornziegen miteinander, irgendwer hinter der Festungsmauer lachte laut.
Prustend tauchte Juri wieder auf und warf sich an Land. Tropfen perlten über seine Schuppen. Mit der rechten Klaue hielt er Ben einen bestimmt 30 Pfund schweren Regenbogenflosser entgegen. »Ich hoffe, Sidhy hat eine richtig große Pfanne.«
»Sollte er. Die halbe Küchenausstattung stammt noch von den Seetrollen.« Ben lehnte die Angel an den Felsen und warf sich stattdessen den langen Fisch über die Schulter. »Danke.« Juri reckte sich, schüttelte sich das Wasser aus Ohren und Nüstern und legte sich wieder ans Meer, ohne – wie meist sonst – eine seiner hunderttausend Erinnerungen zum Besten zu geben. Er wollte noch ein wenig ruhen, bevor die Nacht kam und er wieder in irgendeiner Mission ans Festland fliegen würde.
Die untersten Fenster der Festung lagen alle übermannshoch und waren vergittert, niemand konnte einfach hineinklettern. Rundum waren sieben Strickleitern verteilt, die ins zweite Geschoss hochführten, aber das schaffte Ben nicht mit dem schweren schlüpfrigen Fisch im Arm. Also stapfte er um die Ecke und die halbe Seitenlänge vor zum Tor.
Die riesige Festung hatte leer gestanden, seit der heldenhafte Beutelnäher Ailon die menschenfressenden Seetrolle vor Jahrhunderten vertrieben hatte. Ailon hatte das Gebäude mit seiner schützenden Magie belegt, sodass sich kein Schiff der Insel nähern konnte, ohne einen zerstörerischen Sturm heraufzubeschwören, der Masten und Planken bersten ließ und jedes Schiff mit Mann und Maus versenkte. Und so erging es der Sage nach auch jedem Schiff, das sich näherte, um das hier gesunkene Gold auf dem Meeresgrund zu bergen. Seitdem wurde die Festung nur noch das Verlies der Stürme genannt.
Ben und seine Freunde waren im Frühjahr nicht mit Schiffen gekommen, sondern auf Drachen. Das hatte die wilden Stürme nicht ausgelöst, und so hatten sie zufällig ein Versteck gefunden, das Sicherheit vor dem Orden der Drachenritter versprach. Denn der konnte nur mit Schiffen so weit aufs Meer; seine Drachen hatten keine Flügel. Und schon bald war aus dem Versteck ein richtiges Zuhause geworden. Die Festung war Ben längst mehr Heim, als es das kleine Haus gewesen war, das er jahrelang mit seiner trinkenden Mutter bewohnt hatte. Hier musste er nicht auf der Hut sein, hier war er frei und hatte die besten Freunde der Welt – Menschen und Drachen. Und Anula.
Ben erreichte das haushohe äußere Tor, das selbst fünfzehn Mann nicht aufstemmen konnten. Rost und Salzablagerungen aus den letzten Jahrhunderten hatten die Scharniere so verkrustet, dass sie sich nicht mehr bewegen ließen. Zum Glück hatten die Seetrolle dort eine kleinere Tür eingelassen, die sich öffnen ließ. Wobei kleiner bedeutete, dass sich die massive Klinke auf Höhe von Bens Gesicht befand und die Oberkante weit darüber. Diese Tür stand tagsüber immer offen, Feinde konnten die Insel ja nicht erreichen.
Trotzdem trieb sich hier oft der stachelbewehrte jagdhundgroße Wachdrache Quobemhonn herum, wenn er nicht gerade seine Patrouillenflüge um die wuchtigen Türme machte. Leidenschaftlich beschimpfte er tief fliegende Vögel abwechselnd als Eindringlinge oder Spione, weil sie nicht zu den Geächteten gehörten. Hundertfünfzig Jahre lang hatte er das Anwesen einer Händlerfamilie in Rhaconia bewachen müssen, bis Ben ihn befreit und ihm seine Flügel wiedergegeben hatte. Das Verhalten als Wachdrache hatte sich zu tief eingeprägt, um es in wenigen Monaten der Freiheit so einfach wieder ablegen zu können.
Auch jetzt stand er breitbeinig im Durchgang und musterte den herankommenden Ben.
»Drachenflüsterer«, grüßte er freundlich und nickte knapp. Dem toten Fisch warf er jedoch einen strengen, prüfenden Blick zu. Alles, was er nicht kannte, machte ihn misstrauisch, schließlich hatte er sich selbst die Verantwortung für die Sicherheit der ganzen Festung übertragen. »Wer ist das? Ein neuer Verbündeter?«
»Nein, ein Abendessen.«
»Aha«, knurrte Quobemhonn. »Vergiftet?«
»Nein. Aber schwer.«
»Bist du sicher?«
»Ja«, keuchte Ben und drängte sich vorbei in den Innenhof.
Quobemhonn knurrte ihm hinterher: »Sag Sidhy trotzdem, eine Ziege soll besser mal vorkosten. Am besten Zottel.«
»Mach ich«, behauptete Ben. Er sagte ihm nicht, dass Ziegen nur Pflanzen fraßen.
Schweißgebadet betrat er den gewaltigen Innenhof, dessen Bodenplatten vielfach schief oder gebrochen waren. Einige hatten sie ganz herausgelöst und dort Hochbeete angelegt. Die Umrandung bestand aus den Bruchstücken der Platten und Steinen von der Insel, die fruchtbare Erde hatten die großen Drachen nachts vom Festland geholt. Hier wuchsen süße Rundrüben, Kohl in allen Farben, faustgroße Erdbirnen und verschiedene Beeren. Zudem wucherte an der südlichen Innenhofmauer schnell wachsender Wein. Byasso zupfte gerade Unkraut, Ayna erntete einen Eimer frühreifer Erdbirnen, Celber und Thylos zimmerten eine Futterkrippe für den kommenden Winter.
Zweiundvierzig Blaukammhühner staksten gackernd zwischen den Beeten umher und pickten nach Würmern, Käfern, Körnern und Essensresten. Die Hühner hatten sie drei Bauern östlich von Rhaconia abgekauft. Die sieben struppigen und kletterfreudigen Krummhornziegen, die sich meist draußen auf dem Fels herumtrieben, hatten sie dem Orden gestohlen. Aus ihrer Milch machten sie Käse, die Hühner schenkten ihnen Eier, das Meer Muscheln, Fische und Algen. Ben hatte Zweifel, dass die Vorräte sie durch den ganzen Winter bringen würden, aber wenn nicht, würde ihnen schon etwas einfallen. Die Drachen konnten sich leicht selbst versorgen, und der schilfgeborene, wasserliebende Juri würde immer ausreichend Fische für alle aus dem Meer holen.
Alle, das waren inzwischen gut dreißig junge Männer und Frauen, Jungs und Mädchen, die an Bens Wahrheit über die Drachen glaubten. Daran, dass nur geflügelte Drachen frei waren, und flügellose gebrochene, willenlose Diener. Für diese Überzeugung hatten sie ihre Eltern, Geschwister und Freunde verlassen und sich gegen den übermächtigen Orden der Drachenritter gestellt. Jetzt waren sie vogelfrei wie Ben selbst, geächtet in ihrer Heimat. All das hatten sie für die Wahrheit geopfert, und das machte Ben zugleich froh und stolz, er fühlte eine tiefe Zuneigung zu ihnen allen. Doch manchmal fragte er sich, ob sie nicht besser dran wären ohne ihn. Denn ohne ihn hätten sie nicht alles aufgeben müssen, ohne ihn wäre ihr Leben nicht täglich in Gefahr.
»He, Schreckensbleicher, wo bleibst du?«, rief Akse von drinnen. »Das Ding ist echt schwer!«
Ben konnte ihn kaum verstehen, er war noch immer fünfzig Schritt von der Tür entfernt. Also brüllte er zurück: »Ja, das hier auch!«
Dann wechselte er den Fisch von der rechten auf die linke Schulter und legte den Kopf kurz zur Entspannung in den Nacken. Dabei fiel sein Blick auf Vilette, die flink über das Dach balancierte und die löchrigen Regenrinnen reparierte, die das Wasser in die große Zisterne leiteten. Das lange helle Haar hing ihr in einem Zopf über die Schulter. Noch war der Himmel meist blau, doch an manchen Abenden schmeckte der Wind bereits nach Herbst. In wenigen Wochen würde der Regen regelmäßig auf die vielen Dächer prasseln.
Ben lächelte. Als er Vilette kennengelernt hatte, war sie ständig ängstlich gewesen – sie hatte sich vor ihrem Vater gefürchtet, vor geflügelten Drachen, vor ihm selbst, vor der Meinung ihres Dorfs und natürlich vor der aufgebrachten Menge, die sie totschlagen wollte, weil sie angeblich Samoth anhing. Jetzt war sie schwindelfrei und wollte kommende Woche sogar die Rinnen der Türme ausbessern.
Ben betrat die Festung durch die offene Tür, ein neugieriges Huhn folgte ihm. Als er jedoch schnurgerade in Richtung Küche stapfte, kehrte es rasch wieder um.
»Mit besten Grüßen von Juri«, sagte Ben und klatschte den Fisch auf den Tisch wie einen Mehlsack. Strahlend saubere Messer, Schöpfkellen, Bratenspieße und Trollgabeln hingen an der Wand, die Töpfe und Pfannen stapelten sich der Größe nach im Regal neben dem Herd. Die Küche war eindeutig der aufgeräumteste Raum der Festung, hier sorgte Sidhy für Ordnung.
»Danke.« Sidhys Augen leuchteten, und er rieb sich die kräftigen Hände. Das helle dünne Haar fiel ihm tief in die Stirn. Er leckte sich über die Lippen. »Das wird ein Festmahl.«
Ben streckte sich. »Was willst du denn dazu …«
»He!«, tönte es aus dem Nebenraum. »Wo bleibst du, o schrecklich Langsamer?«
»Komme!« Ben lief auf den Gang und zum nächsten Zimmer. Was war denn so dringend? Er hatte gedacht, Akse und Nica wollten nur einen Vorratsschrank ausbessern.
Und genau das hatten sie gemacht. Sie hatten eine mannshohe Kommode der Seetrolle genommen und geschliffen, das Schloss ausgetauscht, neue Zwischenbretter als Ablage eingebaut und den durchgebrochenen Boden ersetzt. Der drei Schritt breite Schrank stand an der hinteren Wand der ersten Vorratskammer, Akse und Nica saßen auf der ausgebesserten Truhe daneben. Akse hatte die schlaksigen Beine untergeschlagen und trommelte mit den ewig unruhigen Händen auf den Knien, die dunklen Haare waren verstrubbelt. Nicas lange blonden Haare waren streng zusammengebunden, sie saß aufrecht und ruhig, doch ihr schönes schmales Gesicht und die Hände waren ebenso verdreckt wie Akses. Hinter ihnen öffnete sich ein Fenster nach draußen; dort lag Bens Angelfelsen.
»Was gibt’s?«, fragte er.
»Der Schrank«, sagte Akse.
»Sieht gut aus.«
»Ich weiß. Aber passt er da, wo der steht? Oder soll er eine Handbreit weiter nach rechts? Nica sagt rechts.«
Ben stutzte. Hatten sie ihn wirklich dafür gerufen? Einmal um die halbe Festung gehetzt wegen einer Handbreit, obwohl an der Wand noch Platz für zwei weitere Schränke war?
»Weiter rechts ist schöner«, sagte Nica. »Findest du nicht?«
»Könnt ihr das nicht selbst …?«
»Nein«, unterbrach ihn Akse. Um seine Mundwinkel zuckte es verräterisch. »Du bist der furchtbare Ben, wir sind nur die Bande. Du entscheidest.«
»Was?«
»Rechts ist schöner, oder?« Nica klimperte mit den Wimpern.
»Na gut«, sagte Ben. Sie wollten ihn veralbern? Das konnten sie gern versuchen, wenn sie seine Antwort vertrugen. »Zeigt mal. Rückt ihn rüber.«
Akse stöhnte demonstrativ, packte aber mit Nica an. Sie wuchteten den Schrank in die Höhe und hoben ihn ein Stück nach rechts.
»So gut?«, keuchte Akse. Schweiß rann ihm über die Stirn, Nicas Gesicht war rot vor Anstrengung.
»Mhm«, machte Ben gedehnt. »Besser noch ein Stück weiter.«
Akse stöhnte und zerrte fluchend am Schrank. »So?«
»Zu weit, zu weit! Doch lieber zurück.«
Murrend und knurrend tippelten Akse und Nica ein winziges Stück zurück. Erste Schweißtropfen fielen zu Boden, die Adern an den Hälsen traten hervor.
»Nein, nein, das geht so gar nicht, tut mir leid. Besser wieder vor. Zwei Fingerbreit höchstens.« Ben grinste. Bande, pah.
»Was?«, platzte Akse heraus.
»Oder nein, vielleicht eher doch eine ausgewachsene Seetrollhandbreite weiter. Dann passt die Maserung der linken Tür perfekt zu den Linien im Steinfußboden.«
»Was?«, schnaubte Akse noch mal, die Hände noch immer unter dem Schrank. »Ich geb dir gleich Maserung, du fauläugiger Bodengucker.«
Nica ließ ihr Ende einfach fallen. »Ach, trag ihn doch einfach selbst.«
»He!«, protestierte Akse und balancierte mühsam den schwankenden Schrank aus. Schwer atmend setzte er ihn ab.
»Ja, ich denke, das passt.« Noch immer grinsend wandte sich Ben an Nica. »Oder?«
Sie stellte sich neben ihn, grinste inzwischen ebenfalls und nickte. »Ist genau da, wo ich ihn wollte: ein Stück weiter rechts als vorhin.«
Akse starrte die beiden noch immer keuchend an und sagte nichts. Schweigend klopfte er zur Abwehr von Schimmelgeistern dreimal gegen die hölzerne Seitenwand. Dann spuckte er einmal beiläufig über die linke Schulter, wie man es tat, um eine solche Tischlerarbeit glücklich zu Ende zu bringen.
»Nicht über die rechte?«, fragte Nica.
»Nein, links«, sagte Akse.
Ben nickte, und Nica spuckte. Ben nicht, er hatte nicht mitgearbeitet.
Als sie in den großen Speisesaal hinübergingen, lächelte Akse schon wieder und raunte Ben zu: »Warte nur, Schreckloser, das zahl ich dir noch heim.«
Der Saal wurde von einer gewaltigen groben Tafel dominiert, die ihnen allen Platz bot und noch von den Seetrollen stammte. Sie hatten nur die Beine gekürzt, um sich beim Essen nicht wie Zwerge oder Kleinkinder vorzukommen.
Die einst grauen Wände waren mit zahlreichen eingerissenen und verknitterten Steckbriefen aus allen Regionen des Großtirdischen Reichs gepflastert. Sie hatten sie von Anschlagsbrettern, Zäunen, Bäumen und Mauern gerissen.
Die meisten zeigten den Drachenflüsterer Ben, andere versprachen ebenfalls hohe Summen für die Ergreifung von Yanko, Nica und Anula, seine frühesten Gefährten. Manchmal waren die Namen falsch geschrieben, die Beschreibungen voller Fehler und die Porträtzeichnungen ein solch furchtbares Gekritzel, dass man selbst Ben und Nica kaum unterscheiden konnte.
Doch auch die anderen von ihnen wurden dringend gesucht, der ehemalige Knappe Akse ebenso wie der Ketzersohn und Nicas Bruder Sidhy, die Fischertochter Vilette, der Bürgermeistersohn Byasso, die fahrende Sängerin Ayna, der Flößergehilfe Thylos, Celber, der junge Gibor und alle anderen. Fast jeder von ihnen hatte einen eigenen Steckbrief, inzwischen sogar auch die Drachen.
Fünf von ihnen galten als gestohlen, nur Aiphyron hatte offiziell nie jemandem gehört. Nur einmal hatte ihm ein Verräter ohne Wissen des Ordens beide Flügel abgeschlagen und ihn so unterworfen, doch die Freunde hatten ihn befreit, bevor er auf dem Schwarzmarkt verkauft worden war, und Ben hatte ihn mit seiner Gabe als Drachenflüsterer geheilt. Ihr beider Blut hatte sich schon früher miteinander vermischt, sie waren wie Brüder, obwohl einer ein Mensch und der andere ein Drache war.
Ben kämpfte dafür, dass möglichst viele Menschen die Wahrheit über geflügelte Drachen erfuhren, doch der Orden wollte davon nichts wissen. Er verdankte seine ganze Macht der alten Legende von Samoths Fluch und den zahllosen angeblich befreiten Drachen in seinen Ställen, die tatsächlich nur gefügig gemacht worden waren. Auf diese Macht wollte der Orden auf keinen Fall verzichten, auch wenn sie auf einer Lüge fußte. Bens Wahrheit war eine Bedrohung für diese Macht, deshalb wurde er mit aller Härte gejagt. Er und seine geächteten Freunde.
Die meisten Menschen glaubten an die Legende und den Anspruch des Ordens, weil sie von klein auf daran glaubten, so wie es auch ihre Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und viele Generationen davor geglaubt hatten. Sie schafften es nicht, das alles von heute auf morgen infrage zu stellen, und Zweifel waren ketzerisch, predigte der Orden. Für sie war Samoth der Gott der Lüge, wie also konnte sein Anhänger Ben oder gar ein geflügelter Drache die Wahrheit sagen?
Es war ein verrückter Kreis, dem Ben kaum entkommen konnte. Nur sehr wenige hatten das Irrsinnige daran erkannt, hatten nicht sofort »Lüge!« geschrien, sondern zugehört und nachgedacht. Und dafür war auf ihre Köpfe jetzt auch eine Belohnung ausgesetzt. Nur nicht auf Nesto, der noch immer unentdeckt für sie in Rhaconia spionierte, und nicht auf die Brüder Knechter, die als scheinbar harmlose Handlanger des Ordens überall die Ohren offen hielten.
Um sich die Belohnung für Ben, Akse, Nica und die anderen Menschen zu verdienen, musste man sie fangen. Das Geld für die Drachen bekam man, wenn man sie nach Ordensvorstellung befreite: Wenn man ihnen die Flügel abschlug und sie derart verstümmelt beim Orden ablieferte.
Kaum hatten Ben, Nica und Akse den Saal betreten, drang von draußen das Rauschen von Drachenflügeln und der Aufprall großer Pranken herein. Aufgescheuchte Hühner flatterten und gackerten, Ziegen meckerten, manche Jungs und Mädchen riefen Grußworte. Quobemhonn meldete bellend: »Yanko und Feuerschuppe sind zurück!«
Und schon stürmte Yanko grinsend herein, das schulterlange Haar zusammengebunden, die schalkhaften dunklen Augen strahlten. Er wedelte mit einem gerollten Pergament herum und rief: »8000! Ich hab Anula wieder überholt! 8000!«
»Was hast du?«, rief seine Freundin Nica, ohne ihn zu begrüßen.
»8000! Ich bin wieder Zweiter!« Lachend entrollte er das Pergament, das ihn zwar fälschlich Janko schrieb und mit kurzen Stoppelhaaren zeigte, aber 8000 Gulden für seinen Kopf versprach.
»Da steht lebend oder tot.« Nica sah ihn fassungslos an. »Tot! Und du jubelst?«
Er zog sie an sich und wollte sie küssen, doch sie stieß ihn wütend von sich. »Komm schon, Nica. Das ändert doch nichts. Sie wollten uns doch immer nur lebend, damit sie uns öffentlich hinrichten können. Das macht keinen großen Unterschied, denn wer hingerichtet wird, ist meistens auch tot.«
»Aber das heißt, sie sind stinksauer! Sie nehmen das richtig ernst!«
»Gut!«, rief Yanko. »Ich will ernst genommen werden!«
»Der verdammte neue Abt«, murmelte Akse. Der Vorgängerabt Khelchos hatte ihn und Ben hinrichten lassen wollen, und sie hatten gefeiert, als er abgesetzt worden war. Aber dann war der reiche und selbstherrliche Morghon zum Hohen Abt von Kloster Sonnenflut ernannt worden. Er galt als unbestechlich, unbesiegbar und unnachgiebig. Letzteres hatte er sogar in den Sockel seiner vergoldeten Statue meißeln lassen, die er bei Amtsantritt errichten hatte lassen. Überhaupt ließ er ständig irgendwen irgendetwas für sein Geld tun. Von seinen Anhängern wurde er als geradlinig und konsequent gefeiert, und das bedeutete, er war einfach nur rücksichtslos und ohne Mitleid.
»Versteht ihr nicht?« Yanko strahlte. »Je höher unser Kopfgeld, desto größer ist der Ärger, den wir dem Orden bereiten. Das ist der Beweis, dass wir Erfolg haben! Dass sie uns fürchten. Und für uns ändert sich nichts, der Orden ist sowieso hinter uns her.« Übermütig schlug Yanko den Steckbrief an einen der letzten freien Flecken der Wand.
In dem Moment kamen Byasso und Ayna herein. Byasso rief: »He, Yanko, willkommen zurück! Was …?«
»8000! Acht!«, unterbrach ihn Yanko. »Schreib das auf. Sofort!«
»Respekt.« Byasso ließ sich den Steckbrief zeigen, schlug Yanko anerkennend auf die Schulter und korrigierte das Ergebnis der Bestenliste, die er als selbsternannter Chronist der Geächteten penibel führte. Ben stand als großes Feindbild des Ordens und angeblicher Kopf und Rädelsführer mit weitem Abstand auf Platz eins, Yanko nun wieder auf Platz zwei. Acht von ihnen hatten es inzwischen auf über 1000 Gulden Belohnung gebracht. Dafür mussten echte Verbrecher mindestens zwei Morde begehen, ein Dutzend Kaufleute ausrauben oder einen Drachen stehlen. Byasso hängte die neue Liste an ihren Platz neben der Tür, wo sie jeder sehen konnte.
Der Lärm hatte noch weitere Jungen und Mädchen angelockt, auch Sidhy war aus der Küche herübergekommen. Die meisten Geächteten waren ungefähr in Bens Alter, manche jünger, ein paar wenige drei oder vier Jahre älter. Er selbst würde bald siebzehn werden, erwachsen.
»Gibt’s schon Essen?«, riefen einige.
»Geduld!«, verlangte Küchenchef Sidhy. »Wir sind ja dabei.« Er winkte Ayna und scheuchte sie mit einem Handwedeln in die Küche. Vilette half nur noch selten, seit sie auf den Dächern arbeitete, aber der penible Sidhy war mit ihrer Hilfe ein guter Koch geworden. »Schäl schon mal die Erdbirnen, ich komme gleich nach.«
»8000!«, rief Yanko noch einmal stolz und sah sich triumphierend um. Manche jubelten, andere pfiffen anerkennend, doch die verdrängte Anula war nicht zu sehen. Vermutlich brachte sie die Feuerstellen im letzten Winkel der Festung für den Winter in Schuss und hatte die ganze Aufregung gar nicht mitbekommen.
Der erst dreizehnjährige Gibor kratzte sich im roten Haar und fragte vorsichtig: »Hast du keine Angst vor Herrn Prahler?«
»Vor wem?«, fragte Yanko.
Gibor sah ihn verblüfft an, auch Nica und ein paar andere wirkten irritiert.
»Herr Prahler«, wiederholte Gibor. »Der größte Kopfgeldjäger des Großtirdischen Reichs, die Geißel der Gesuchten. Der Mann, der den grausamen Schinderbert erwischt und die listenreiche Vilmine aus dreihundert Schritt Entfernung mit dem letzten Pfeil von einem fliehenden Pferd geschossen hat. In der Dämmerung bei dicht wallendem Nebel und mit schlammverkrusteten Augen.«
»Das denkst du dir doch aus!«
Gibor schüttelte den Kopf.
»Tut er nicht.« Sidhy nickte gewichtig. »Nur den Namen hat er durcheinandergebracht. Er heißt Fahler, Herr Fahler, weil er so fahl ist wie ein ausgebleichter Totenschädel.«
»Oder doch eher Herr Kahler?«, fragte Yanko spöttisch. »Weil er so kahl ist wie einer?«
»Du hast echt nie von ihm gehört?«, fragte Nica.
Yanko schüttelte den Kopf. Er blinzelte und wirkte einen winzigen Moment lang verunsichert.
»Wenn bei uns ein Kind Mist gebaut hat, haben die meisten Eltern gedroht: Noch einmal, und ich setz fünf Gulden auf dich aus, dann holt dich Herr Fahler.«
Yanko blinzelte längst nicht mehr, sondern lachte laut auf.
»Nein, wirklich!«, beharrte Nica.
»Bei uns wurden immer dreizehn Gulden ausgesetzt«, sagte der schmächtige Khomah, dem der kleine Finger an der linken Hand fehlte und der nie sagen wollte, warum. »Aber ich dachte, er heißt Herr Stahler.«
Wieder lachte Yanko und schüttelte den Kopf, auf zwei, drei Gesichtern zeigte sich ein vorsichtiges Lächeln. Kurz sahen sie auch zu Ben, als wollten sie seine Reaktion prüfen. Ben grinste, er hatte noch von keinem der vielen Kopfgeldjäger gehört.
Akse zuckte mit den Schultern und brummte: »Meine Eltern hatten einen Diener, der mich ohne Sonderzahlungen bestraft hat, und das mit größtem Vergnügen. Das Verrückte daran war, dass der sich immer vorgestellt hat, ich wäre mein Vater, weil der ihn ordentlich schuften ließ. Deshalb hat er auch ordentlich zugeschlagen. In seinem Kopf hat mein Vater also sich selbst Prügel eingebrockt. In Wirklichkeit leider mir, und ich hab die Wut von beiden abbekommen. Egal, auf jeden Fall haben sie mir nie mit einem Fremden gedroht. Lange Rede: Erst als Knappe habe ich dann von einem Kopfgeldjäger gehört, aber der hieß Thaler, glaube ich.«
»Thaler, Fahler, Kahler, Stahler. Wenn die sich mal alle treffen, können die zusammen ein Gedicht aufmachen, oder eine Reimschule.« Yanko schnaubte vergnügt. »Nein, die sind nicht echt. Das klingt alles nach einem erfundenen Buhmann, um Kindern Angst zu machen. Aber ich bin kein Kind mehr.«
»Nein, den gibt’s wirklich!«, rief Gibor. »Die Schwester des Nachbarn meines Onkels hat schon mal von ihm geträumt, und die träumt dauernd wahre Sachen!«
Einen Moment lang sah Yanko ihn verblüfft an, dann prustete er los: »Ein Jäger im Traum also. Damit kann ich leben. Und das meine ich wortwörtlich.« Er grinste breit, Akse und einige andere lachten, auch Ben.
»Aber …«
»Niemand trifft halbblind auf dreihundert Schritt Entfernung, oder? Bei dichtem Nebel und Dämmerung zusammen. Oder hat ihn schon jemand mal wirklich gesehen, nicht nur im Traum?« Yanko sah sich auffordernd um.
Keiner meldete sich, die meisten wirkten erleichtert.
»Na also, der ist eine so falsche Legende wie die von Samoths Fluch. Eine Angstmachergeschichte. Die soll nur verhindern, dass kleine Jungs Verbrecher werden, oder Geächtete wie wir. Vor dem brauchen wir uns nicht zu fürchten.«
Yanko hatte sich schon immer über seine Ängste hinweggesetzt. In Trollfurt hatte er regelmäßig die Prügel von seinem Vater ausgehalten, um mit Ben befreundet zu bleiben. Er hatte die Prügel aller ausgehalten und weiter zu Ben gehalten, als alle Ben für einen Mörder hielten. Und jetzt stand er lachend da, den Steckbrief locker in der Hand, als ginge es nur um eine weitere Abreibung, als sei ein Kopfgeldjäger nichts Schlimmeres, schon gar nicht, wenn man sich nicht auf seinen Namen einigen konnte.
Yanko war der beste Freund, den man sich wünschen konnte, und Ben war froh über seinen Mut, der schon fast an Gleichgültigkeit grenzte. Sollten sich die Neulinge von Yankos sorglosem Lachen ruhig anstecken lassen, wenn sie darüber vergaßen, dass der Name der Kopfgeldjäger keine Rolle spielte. Auch wenn es diesen schrecklichen Prahler nicht gab, so gab es doch zahllose andere. Vielleicht waren sie nicht so furchterregend oder fähig, aber sie existierten tatsächlich und wurden angelockt von den steigenden Kopfgeldern.
Sidhy zögerte einen Moment. Er schien etwas einwerfen zu wollen, doch dann zuckte er mit den Schultern und verschwand stumm in der Küche. Nica lächelte Yanko an und umarmte ihn endlich.
Ben war erleichtert, dass die meisten das kleine Wort tot auf dem Steckbrief über diese gereimten Kopfgeldjäger schon wieder vergessen zu haben schienen.
Lange nach dem Essen lagen Ben und Anula in ihrem Zimmer hoch im Turm über dem Speisesaal. Den Turm mit dem großen Krakenthronsaal hatten sie Yanko, Nica, Sidhy, Byasso und Vilette überlassen. Ben wollte kein Anzeichen von Herrschaft in seiner Nähe haben, es war genug, dass er über eine seltene Gabe verfügte und dass der Orden der Drachenritter ihn auf den Steckbriefen zum Anführer der Samothanbeter machte. Er wollte kein Herrscher sein, er wollte, dass die Geächteten Freunde waren. Zu lange hatte er außer Yanko– und vielleicht Byasso– keine gehabt.
Ihre Bäuche waren voll und schwer, und das Mondlicht fiel durch die hohen Fenster auf Anulas helle Haut, die schimmerte wie ein gefrorener Bergsee in klaren Winternächten. Das war ihr vom eisigen Atem des weißen Drachen geblieben, der sie im Namen des Ordens gefoltert hatte. Auch wenn dessen lähmende Kälte eigentlich längst aus ihrem Körper verschwunden war, steckte der Eishauch noch immer tief in ihren Gedanken und Träumen. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute verlangte es Anula nach Sonne und menschlicher Wärme, und sie sog sie auf wie ein trockener Schwamm einen winzigen Wassertropfen. Egal, wie stark die Sonne schien, egal, wie fest Ben sie umarmte, den letzten Rest Kälte konnten sie nicht aus Anula vertreiben. Doch so lange andere Menschen außer Ben da waren, war sie zu stolz, sich das anmerken zu lassen. Sie hielt ihre innere Kälte für Schwäche, obwohl niemand dem Hauch eines weißen Drachen trotzen konnte. Und die unnatürlich glitzernde Haut hielt sie für einen Makel, doch für Ben war sie ein Zeichen von Anulas Tapferkeit und Anula einfach schön.
Dicht aneinander geschmiegt lagen sie auf dem großen Bett. Draußen frischte der Wind auf, man konnte den kommenden Herbst schon in ihm ahnen. Eine Dämmermöwe schrie klagend vor dem offenen Fenster, und Ben fragte leise: »Hast du Angst vor dem Winter?«
»Ja«, gab sie zu, weil sie wusste, dass er es nicht weitererzählte. »Aber nur ein wenig. Ich habe alle Kamine repariert, wir brauchen nur noch mehr Feuerholz. Aiphyron und Marmaran haben mir versprochen, morgen ein paar Bäume vom Festland zu holen. Und Thylos sägt aus alten Brettern Fensterläden zurecht, dann können wir die Wärme drin halten.«
»Wirst du nicht trotzdem frieren?«
»Wir alle werden frieren.«
»Du weißt, was ich meine.«
»Ja.« Sie wandte ihm das Gesicht zu, ihre Nasen berührten sich. »Aber wir können nicht in den Süden, nicht dieses Jahr. Wir können nicht zu viert mit den Drachen abhauen und die anderen im Stich lassen.«
Ben küsste sie, und sie erwiderte den Kuss. Ihre Lippen waren nie kalt. »Ich könnte dir echtes Glas aus Venzara holen. Dann sind die Fenster auch dicht, aber nicht dunkel wie bei Brettern. Dann siehst du tagsüber die Sonne.«
»Das wäre schön.« Anula lächelte. »Aber …«
»Kein Aber. Ich hol dir die Glasfenster. Gleich morgen.« Für dieses Lächeln würde er ihr alles holen. Eigentlich würde er das auch, wenn sie nicht lächelte, nur einfach, weil sie sie war. Das hätte er sich nie träumen lassen, als er sie bei ihrem ersten Treffen noch für eine unverbesserliche Rinnsteinschnepfe gehalten hatte. »Die Wahrheit kann auch mal eine Nacht pausieren.«
Den ganzen Sommer lang hatten sie mit Leuten in abgelegenen Dörfern geredet und Hunderte von Flugschriften verteilt, vielleicht gar Tausende. Jeden Tag hatte Ben dem mühsamen Kampf für die Freiheit der Drachen gewidmet. Sie alle hatten sich den Hals heiser geredet und die Finger blutig geschrieben, sie hatten Hornhaut auf dem Hintern vom Reiten auf Drachenrücken. Doch viel hatte es nicht genutzt, kaum einer glaubte die Wahrheit, und der von Morghon aufgestachelte Orden predigte mit Ausdauer seine Lügen. Es wurde Zeit, dass Ben etwas für Anula tat. Er liebte sie, und sie konnte nicht selbst nach Venzara. Mit der schimmernden Haut war sie die Geächtete, die am schnellsten und sichersten erkannt wurde. Sie saß hier fest, ob sie wollte oder nicht. Wenn die Kälte in ihr groß war, fragte sie sich, ob die anderen sie deshalb für feige hielten.
»Aber …«, fing sie noch einmal an.
»Ich sagte, die Wahrheit kann eine Nacht warten. Außerdem friert keiner von uns gern, auch die anderen haben nichts gegen Glas. Und ich kann Flugschriften nach Venzara mitnehmen.«
»Das weiß ich.« Sie lächelte. »Ich mache mir keine Sorgen, dass du die Wahrheit vernachlässigst. Im Moment mache ich mir mehr Sorgen um die Kopfgeldjäger.«
Überrascht zwinkerte Ben. »Glaubst du an diesen Herrn Fahler-Thaler-Prahler-sonst-was?«
»Ich weiß es nicht. Niemand trifft auf dreihundert Schritt Entfernung. Aber wenn sie uns jetzt auch tot wollen, dann wird es einer versuchen. Oder aus zweihundert, aus hundert oder aus fünfzig Schritt Entfernung, und da könnte er treffen. Lebendig waren wir mit einem Bogen nicht zu fangen, aber tot? Wenn sie keine Rücksicht auf unser Leben nehmen müssen, haben sie es viel leichter.«
»Du glaubst, bisher waren sie rücksichtsvoll zu uns?«, neckte Ben sie, obwohl ihm ihr Gedanke selbst Angst machte. Aber er würde die Angst nicht zulassen.
Anula lächelte nicht mehr. »Nein, das nicht, aber… Ich glaube, jetzt machen sie richtig Ernst.« Sie flüsterte, und Ben konnte einen Schimmer ihrer inneren Kälte in ihrem Auge sehen. Und mit der Kälte kam die Angst. So sehr sie die auch unterdrückte und bekämpfte, sie steckte in ihr.
»Ich weiß«, sagte Ben.
»Warum hast du das dann nicht zu allen gesagt?«
»Ich wollte niemandem Angst machen. Gibor ist erst dreizehn, die meisten wissen noch gar nicht, auf was sie sich eingelassen haben. Aber hier in der Festung sind sie sicher. Warum soll ich sie also beunruhigen, bevor wir wissen, ob wirklich wer hinter uns her ist?«
Sie sah ihn zärtlich an. »Du bist ein guter Anführer.«
»Nein, ich bin gar kein Anführer!«, widersprach er sofort. »Der Orden hat Anführer! Äbte und Hohe Äbte und Ritter und so. Er verlangt Gehorsam und all das. Wir dagegen sind alle frei und gleich.«
»Darum geht es nicht. Bemerkst du nicht, wie sie dich ansehen und um Rat fragen?«
»Pfff«, machte Ben. »Die sollen ihre Schränke allein aufstellen.«
»Äh, was?«, fragte Anula.
»Nichts. Verstehst du nicht? Wir sind nicht Bens Bande! Den Begriff hat der Orden erfunden. Es geht darum, die Dinge selbst herauszufinden, so wie ich das mit den Drachenflügeln. Das hat mir kein Anführer gesagt, ganz im Gegenteil.«
»Ja, aber du hattest dafür deine Gabe. Aiphyron hat es dir gesagt, weil du ihn geheilt hast. Yanko, Nica und ich wissen es von dir. Wir haben dir geglaubt und es nicht selbst herausgefunden.«
»Von einem Freund habt ihr es, keinem Anführer!«, stieß er hervor. Auf keinen Fall wollte er so werden wie die Anführer, die er überall getroffen hatte, die Hohen Äbte, Bürgermeister und Kaufleute, die nach Lust und Laune über ihre Diener herrschten. Konnte sie das nicht verstehen? Immerhin war sie die Dienerin eines Händlers und Drachenreiters gewesen, als sie dem Orden in die Hände gefallen war. Anula hatte sich nicht selbst für den Kampf entschieden, das hatte der Orden ihr abgenommen. Er hatte sie einfach den Geächteten zugerechnet und sie gefangen gesetzt. Sie hatte keine Wahl gehabt, und Ben fragte sich für einen Moment, ob sie sich ihnen auch als Freie angeschlossen hätte.
Idiot, dachte er, sie hat damals beschlossen, dich nicht zu verraten, obwohl sie dich nicht kannte. Es war ihre Entscheidung gewesen, und die war härter als die von Yanko und Nica.
Ben strich ihr durchs Haar. »Ich will keinen Gehorsam, verstehst du das nicht? Ich will keinen Herrscher haben, und ich will auch kein Herrscher sein.«
»Gehorsam?« Anula gluckste vergnügt. »Den bekommst du von mir ganz sicher nicht, das verspreche ich dir.«
Ben sah sie verwirrt an.
Anula wendete ihm den Kopf zu und lächelte. »Das gilt wohl für die meisten hier. Schau dich doch um, wer hier ist. Jungen und Mädchen, die daheim geprügelt wurden wie Yanko, unterdrückt wie Vilette, zum Gehorsam lernen abgeschoben wie Akse. Und alle hier haben sich dem widersetzt, wir sind nicht gehorsam. Aber du bist der, der über die Gabe verfügt, die uns zusammengebracht hat. Der, dem die Drachen vertrauen, dem wir vertrauen.«
»Die Gabe macht mich doch nicht zu einem besseren Menschen!«
»Von besser war nie die Rede!« Wütend funkelte Anula ihn an. »Hörst du mir überhaupt zu? Verstehst du, was ich sage? Leute wie Gibor schauen zu dir auf, daran kannst du nichts ändern. Und du weißt das, du hast selbst gesagt, dass du deshalb vorhin geschwiegen hast!«
»Als Freund!«, beharrte Ben trotzig. »Nur als Freund.«
»Wenn du meinst …«, sagte Anula.
Ben zog sie an sich, um ihr nicht in die Augen sehen zu müssen. Er wollte nicht weich werden und nachgeben. Er wollte nicht nur keinen Gehorsam, sondern auch die Verantwortung für Gibor und die anderen nicht. Er war bereit, sein Leben zu riskieren, um Drachen zu retten, obwohl ihm das manchmal eine gewaltige Angst einjagte. Aber er konnte nicht das Leben von anderen riskieren. Er war kein Anführer, warum wollte sie das nicht verstehen? Er wollte Freunde, keine Untergebenen.
Plötzlich ging ihm etwas anderes durch den Kopf, das Anula gerade gesagt hatte. Er hatte es sich noch nie selbst bewusst gemacht, aber es stimmte. »Weißt du, warum so viele hier sind, die geschlagen, verraten oder abgeschoben wurden? Wieso glauben gerade sie die Wahrheit?«
»Auch andere glauben uns. Aber wer so mies behandelt wird, läuft eben leichter weg, um sich einem Fremden anzuschließen.«
Ben nickte, und sie lagen wieder schweigend beieinander.
»Meinst du, bunt wäre möglich?«, fragte Anula nach einer Weile leise.
»Was?«
»Mein versprochenes Fenster. Könnte ich buntes Glas haben?«
Ben lächelte. »Ich tu mein Bestes.«
IM ANGESICHT DES DRACHEN
Cathe schrie so laut, dass sich ihre Stimme überschlug. Dann war der Drache da. Er prallte vor ihr auf den Boden, Äste barsten, und die Erde knirschte. Die Bestie war so viel Furcht einflößender als die Drachen des Ordens, die im Unterricht zum Einsatz kamen. Seine riesigen schwarzen Schwingen waren von feuerroten Adern durchzogen. Ausgebreitet schluckten sie das letzte Tageslicht, die steingrauen Schuppen erinnerten an grobkörnigen Granit. Er fauchte, und seine Zunge leuchtete wie glühende Lava. Sein heißer Atem rollte über Cathe hinweg wie eine Lawine aus brennendem Fels. »War das schon wieder der dreckige Blechkopf?«
Cathe schrie. Sie verstand nicht, wieso der Drache reden konnte, und auch nicht, was er fragte. Nichts ergab einen Sinn. Panisch dachte sie nur: Wo bleibt Herr Lanzifal?
Langsam streckte der geflügelte Drache die Klauen nach ihr aus, Krallen so lang und spitz wie frisch geschmiedete Krummdolche. Wutschnaubend griff er nur haarscharf an ihr vorbei, packte den Pfahl und brach ihn mühelos entzwei, sodass ihre Fesseln zu Boden fielen. Das Holz splitterte knirschend und riss ihr die Haut an den Armen auf.
Wo blieb nur der vermaledeite Ritter? Auf was wartete er noch?
»Lauf, Mädchen, lauf«, knurrte die Bestie. Ihre Augen glommen hell und rot wie Feuer. Cathe erkannte wilden Zorn in ihnen, aber sie fühlte plötzlich keine Angst mehr. Gegen alles Wissen war sie überzeugt, der Zorn richte sich nicht auf sie. Trotzdem zitterten ihre Knie und Muskeln, alle Gelenke waren noch immer steif. Sie konnte gar nicht rennen. Ohne nachzudenken, fragte sie: »Wieso kannst du reden?«
Der Drache stutzte. Sie sah ihm weiter in die Augen, die lebendiger strahlten als alle Drachenaugen, die sie im Kloster gesehen hatte. So wach und klar, fast wissend. Für einen Moment blitzte sogar Schalk in ihnen auf, und Cathe konnte sich nicht abwenden. Hatte die Bestie sie mit einem Bann belegt?
»Lauf«, knurrte er noch einmal, und es kam ihr fast freundlich vor, aber sie konnte noch immer nicht rennen. Der Drache hob die Lefzen zu einem seltsamen Grinsen und entblößte die gewaltigen spitzen Zähne. Und mit einem Mal packte sie die Angst.
»Hilfe«, keuchte sie und taumelte langsam zurück. Die Brust war ihr zugeschnürt, sie konnte nicht mehr schreien.
Und dann – endlich – brach Herr Lanzifal mit erhobenem Schwert aus dem Gebüsch. Hell glänzte die Blausilberklinge in der untergehenden Sonne. Herr Lanzifal sprang den überraschten Drachen von hinten an. Dabei schrie er Cathe zu: »Tut mir leid, mir war der Helm verrutscht! Ich konnte nichts sehen!«
Dann schlug er zu. Tief drang die scharfe Klinge in das Gelenk, das den Flügel mit dem Körper verband. Blut quoll heraus, und der Schwanz des herumwirbelnden Drachen traf Cathe gegen den Arm.
Sie stürzte und fiel hart zu Boden. Rasch rappelte sie sich auf und kroch in den Schatten eines Buschs, duckte sich tief in ihr Versteck, versuchte zu verschwinden. Helfen konnte sie nicht.
Hinter dem Ritter stürmte Donnerkugel aus dem Gebüsch und warf sich fauchend auf den geflügelten Drachen. Sie krallten sich ineinander und rollten über den Boden. Dicke Äste brachen unter ihrem Gewicht, Büsche wurden aus dem Boden gerissen, aufgewühlte Erde spritzte umher. Herr Lanzifal tauchte immer wieder zwischen die gewaltigen Leiber und schlug mit flinker Klinge nach den verfluchten Schwingen, kaltes Blau blitzte hell. Gewaltige Zähne schnappten nach ihm und zerfetzten doch nur Luft. Klauen schlugen dumpf auf Schuppen, die Luft war erfüllt vom wütenden Fauchen beider Drachen. Fast wurde Herr Lanzifal zerquetscht, doch dann schlug er blitzschnell zu. Die Klinge fuhr tief ins Flügelgelenk, und der Drache brüllte vor Schmerz. Cathe kniff die Augen zusammen, als Herr Lanzifal erneut zuschlug und den Flügel endgültig abtrennte. Der Drache taumelte und versuchte, sein Gleichgewicht wiederzufinden. Den Moment nutzte der Ritter geschickt und hackte ihm auch den zweiten Flügel ab.
»Sei ruhig!«, schrie er den Drachen an. »Du bist frei.«
Und der Drache verstummte und rührte sich nicht mehr.
In der plötzlichen Stille schlug Cathes Herz viel zu laut. Ein rostroter Wurm streckte den Kopf vor ihrer Nase aus der Erde, als wollte er prüfen, ob alles vorbei war. Das war es. Vorsichtig kroch Cathe aus dem Gebüsch hervor und sah zu dem befreiten Drachen hinüber. Sie erwartete, dass seine Augen vor Dankbarkeit leuchten würden, doch das Gegenteil war der Fall. Matt und stumpf lagen sie in den Höhlen, Cathe konnte in ihnen nichts anderes erkennen als Schmerz.
Doch nur für einen Augenblick, dann war der Ritter schon bei ihr, umarmte sie und wirbelte sie ausgelassen herum. »Wir haben es geschafft!« Blutspritzer prangten überall auf seinem Gesicht und seiner Rüstung, aber er lachte. »Du warst großartig!«
Und sie ließ sich von seiner Freude anstecken und lachte ebenfalls. »Wirklich?«
»Besser als meine letzte Jungfrau, und die war fertig ausgebildet!«
Das war das größte Kompliment, das ihr je jemand gemacht hatte. Verlegen sah sie zur Seite und dann wieder zu dem frisch befreiten Drachen, der noch immer auf dem Boden kauerte. Er atmete heftig, aber er wirkte nicht mehr gefährlich und ohne Flügel plötzlich viel kleiner. Er war keine zehn Schritt lang, vielleicht sieben oder acht. Die Augen hatte er geschlossen, und Cathe spürte keine Angst mehr.
»Du hast ihn wunderbar abgelenkt, als ich nicht sofort gekommen bin.« Herr Lanzifal wirkte nun etwas verlegen. »Würdest du bitte niemanden von dem kleinen Malheur mit dem Helm erzählen? Das ist mir wirklich peinlich.«
»Natürlich«, versprach Cathe.
»Danke. Vielen Dank.« Langsam ließ er sie los. »Das ist mir noch nie passiert. Noch nie.«
Gemeinsam schichteten sie zerbrochene Äste, kleine Zweige vom Boden und trockenes Laub übereinander. Herr Lanzifal zeigte ihr geduldig, wie. Als sie fertig waren, war die Nacht längst hereingebrochen, und die Sterne funkelten hell.
Mit Donnerkugels Hilfe wuchteten sie die zwei abgetrennten Flügel auf den Scheiterhaufen. Aufrecht stehend sprachen sie ein lautes Gebet des Danks an Hellwah und kündigten ihm das Flügelopfer an. Herr Lanzifal entzündete den Scheiterhaufen, und sie standen am Feuer, bis die riesigen Flügel vollständig verbrannt waren. Schweiß trat Cathe auf die Stirn, doch sie wich vor der Hitze nicht zurück. Sie wollte Hellwah in ihr spüren, den Gott der brennenden Sonne. Hell spiegelten sich die Flammen in den dumpfen Augen des befreiten Drachen. Es schien, als könnte er den Blick nicht abwenden.
So mächtig ist Samoths Fluch, dachte Cathe und fragte sich, ob der Drache je wieder wirklich frei sein würde. Wenn er es gewesen wäre, der Tharas unter dem Fluch gerissen hätte, könnte sie ihm die Tat wirklich verzeihen? Ihr Verstand würde wissen, dass nicht der befreite Drache schuld war, und doch … Wie war das für den Drachen? Hatte er seine Untaten vergessen, oder erinnerte er sich an alles und wurde von Schuldgefühlen geplagt? Hatte er wortwörtlich Blut geleckt und sehnte sich auch befreit nach dem Geschmack von schreienden Jungfrauen?
»Als sein Befreier darf ich ihm seinen Namen geben«, unterbrach Herr Lanzifal ihre Gedanken und reckte stolz die Brust so weit raus, wie es das schwere Kettenhemd zuließ. »Aber weil du so tapfer warst, will ich dich auch dazu hören. Was hältst du von Glutauge?«
Cathe zögerte. Ritter waren den Jungfrauen übergeordnet, besonders denen in Ausbildung, die noch nicht erwachsen waren. Doch Herr Lanzifal schien freundlich, und weil sie keine Glut mehr im Drachenauge erkennen konnte, wagte sie es, einen eigenen Vorschlag zu machen: »Oder vielleicht Flammenzunge?«
»Flammenzunge?« Herr Lanzifal wirkte überrascht. »Ähm, ja, ein Gegenvorschlag, interessant. Gut, gut, ja, das würde auch passen.«
Cathe lächelte.
»Aber ich glaube, ich bleibe doch bei Glutauge.« Herr Lanzifal lächelte nicht. Er nickte nachdrücklich. »Ist wirklich besser, oder?«
Und Cathe nickte auch. Sie hatte gelernt, dass man als Jungfrau gehorchen musste, ganz unabhängig von der Freundlichkeit des Ritters.
Also sagte Herr Lanzifal die rituellen Worte der Namensgebung zu Glutauge, sprach ihn von Samoths Einfluss frei und machte ihn vorläufig zu seinem Drachen. Im nächsten Kloster würde er ihn dann an den dortigen Abt übergeben. Der durfte dann entscheiden, ob er ganz in den Besitz des Ordens überging oder an einen herausragenden Händler oder Adligen verliehen wurde, der sich eine solche Auszeichnung durch Taten und Spenden verdient hatte.
Cathe wusste, dass sie sich für den befreiten Drachen freuen sollte, aber sie konnte nicht. Der kurze Moment der Angst steckte ihr noch immer in den Knochen, die Haut war aufgeschürft vom Sturz, und sie erinnerte sich noch genau an seinen Zorn, an den Befehl, sie solle laufen. Doch warum und wohin? Warum hatte er sie nicht sofort gefressen? Das begriff sie noch immer nicht, es passte nicht zu ihrem Wissen über verfluchte Drachen.
Herr Lanzifal setzte sich auf einen Stein und reinigte pfeifend sein Schwert. Fast zärtlich glitt er mit einem Tuch über die Klinge, der er einen großen Teil seiner Macht verdankte. Vorsichtig spuckte er auf sie und polierte jeden Blutspritzer fort, auch wenn Schmutz Blausilber eigentlich nichts anhaben konnte.
Gedankenversunken sah Cathe ihm einen Moment lang zu, dann starrte sie in das schrumpfende Feuer. Am Rand seines Scheins entdeckte sie eine kleine unversehrte Spitze des Flügels. Bedächtig hob sie sie auf, die Spitze war noch immer warm. Für einen winzigen Moment wollte Cathe sie einfach einstecken, dann warf sie sie hastig in die Flammen und wischte sich die Hand am Kleid ab, als hätte sie etwas Schmutziges angefasst. Es zischte, die Spitze verschrumpelte in wenigen Augenblicken, und Cathe atmete durch. Was hatte sie da nur geritten, das Stück Flügel behalten zu wollen? War das ein letztes Aufbäumen von Samoths Fluch gewesen?
Schnell sah sie sich um, aber sie konnte keine weiteren Überreste der Schwingen entdecken. Samoths Fluch war vollständig vernichtet.
»Morgen suchen wir Jungfrau Aphrodena. Jetzt ist es zu dunkel«, bestimmte Herr Lanzifal und ließ Cathe mit den zwei Decken ein einfaches Nachtlager bereiten.
»Herr Lanzifal?«, fragte Cathe höflich, bevor sie sich zur Ruhe legten. Bei allem, was in den letzten Stunden passiert war, ging ihr vor allem eines nicht aus dem Kopf.
»Ja?«
»Warum hat Glutauge mich befreit und mir dann zugerufen, ich soll laufen. Und …« Sie zögerte. »Warum kann er überhaupt sprechen? Kann Donnerkugel das auch? Und warum sagt Glutauge nichts mehr, seit er frei ist?«
Herr Lanzifal musterte sie einen Moment lang abschätzend. Dann sagte er ernst: »Er hat dich nicht befreit, nicht im eigentlichen Sinn. Du solltest laufen, damit er dich hetzen kann. Unter dem Fluch war er eine räuberische Bestie, die dich jagen wollte. Er hätte es genossen, dir für einen winzigen Moment das Gefühl zu geben, frei zu sein, zu entkommen, und dann hätte er zugeschlagen. Er wollte dich im Lauf reißen. Deine Freiheit wäre nur eine Lüge gewesen, derart ist die Grausamkeit Samoths.«
Cathe schluckte. Das hatte sie nicht erwartet.
»Und was das Sprechen anbelangt«, fuhr der Ritter fort, »so tun es die Drachen im Allgemeinen nicht, zumindest nicht in unserer Sprache. Natürlich können sie sich verständigen, und sie verstehen uns bestens, weit besser als jedes Tier. Doch da Samoth der Gott der Lüge ist, ist sein Fluch auch an die Fähigkeit zu sprechen geknüpft. Denn wie sonst sollen die Bestien Zweifel säen und Unwahrheiten verbreiten, wenn sie nicht reden könnten?«
Cathe konnte sich nicht mehr erinnern, was der Drache noch zu ihr gesagt hatte außer: »Lauf!« Irgendetwas war da gewesen, etwas Seltsames. Aber wenn das alles nur Samoths Lügen waren, war es nicht wichtig.
Dass Lügen mit Sprache weitergegeben wurden, hatte sie sich nie bewusst gemacht. Sprache war ihr immer selbstverständlich vorgekommen, sie hatte nicht groß darüber nachgedacht. Aber es stimmte! Ein Baby, das noch keine Worte kannte, nur Schreie, war schwer zu verstehen, doch es log auch nicht. Aber war es wirklich immer so, dass keine Sprache keine Lügen bedeutete? Und wie passte das zu dem anderen, was Herr Lanzifal ihr über Wahrheit und Sprache beigebracht hatte: Die Wahrheit konnte laut ausgesprochen werden, doch der, der flüstert, lügt. Waren das nicht seine Worte gewesen? Cathe wollte erst selbst darüber nachdenken, bevor sie seine Geduld mit weiteren Fragen strapazierte.
Das Feuer war inzwischen heruntergebrannt, die letzte Glut glomm in der Asche vor sich hin. In der Senke war es dunkel, nur der schmale Mond und die Sterne spendeten ein wenig Licht. Manchmal raschelte etwas im Gebüsch, es plätscherte im Teich, und Frösche quakten. Trotzdem schlief Herr Lanzifal beinahe sofort ein.
Cathe nicht. Sie sah immer wieder zu Glutauge hinüber, konnte jedoch nicht viel erkennen. Der Drache lag auf dem Bauch und atmete regelmäßig. Von Donnerkugel sah sie nur einen Schemen im Schatten des Gesträuchs.
Cathe konnte nicht schlafen. Zu viel ging ihr durch den Kopf, zu viel war passiert. Die Schürfwunden juckten und da, wo Glutauge sie getroffen hatte, schmerzte ihr Arm. Würde so ihr ganzes Leben als Jungfrau aussehen?
Herr Lanzifal stieß einen Grunzlaut aus, dann schnarchte er laut und hingebungsvoll.
Auch das noch! Cathe verdrehte die Augen.
Donnerkugel seufzte.
Cathe schmunzelte.
Die Frösche quakten.
Dann hörte sie ein leises Knacken im Gesträuch. Hinter sich, nicht da, wo Donnerkugel lag. Ein Knacken, das sie von zahlreichen Spielen mit Tharas kannte, wenn er versucht hatte, sich anzuschleichen. Aber das hier war weder Tharas noch ein Spiel. Lautlos griff sie nach ihrem Dolch. Glutauge hob ein Lid. Donnerkugel rührte sich nicht, aber Cathe glaubte, ein Wittern zu hören.
Herr Lanzifal brummte.
Wieder knackte es, lauter diesmal.
»Herr Lanzifal«, raunte Cathe.
Herr Lanzifal drehte sich auf die Seite und schnarchte weiter.
Eine Gestalt löste sich aus den Büschen, und Cathe umklammerte den Dolch fester. Sie war bereit, jederzeit aufzuspringen.
Die Gestalt trat ganz ins Mondlicht. Inzwischen war sie so nah, dass Cathe eine schöne junge Frau mit zerzausten Haaren erkennen konnte. Sie hatte mehrere Striemen im Gesicht und auf den Armen, die Kleidung war verdreckt und eingerissen.
»Ihr seid es wirklich!«, stieß die Fremde hervor. Ihre Stimme war tief und kräftig.
Donnerkugel brummte zufrieden, es klang fast wie das Schnurren einer Katze.
»Was?«, schnappte Herr Lanzifal und rappelte sich mühsam auf. Seine Rechte schnappte nach seinem Schwert, erwischte jedoch nur den kümmerlichen Überrest eines Asts, mit dem er einen Augenblick herumfuchtelte. Dann ließ er ihn wieder fallen und tastete wild nach seiner Waffe.
»Jungfrau Aphrodena?«, vermutete Cathe und erhob sich. Den Dolch hatte sie wieder eingesteckt.
Die Angesprochene nickte, Donnerkugel tapste herbei und nickte ebenfalls.
»Was?«, rief Herr Lanzifal noch einmal, dann gab er die Suche nach dem Schwert auf. Erfreut tönte er: »Beste Aphrodena! Wir wollten morgen deine Spur aufnehmen!«
»Ich hatte mich ganz am anderen Ende der Senke versteckt. Tief im Gesträuch, damit die Bestie mich nicht erwischt. Dann habe ich den Kampflärm gehört und bin in Deckung geblieben. Irgendwann bin ich dann herübergeschlichen, in der Hoffnung, dass Ihr zurückgekehrt seid.«
»Bist du verletzt?«, fragte der Ritter, und in seiner Stimme schwang echte Sorge mit.
»Nein.« Die Schrammen waren ihr keine Erwähnung wert, sie schien nicht viel zu jammern. Sie hatte dunkle Augenringe und musste hundemüde sein.
»Wie bist du entkommen?«
»Ich … ich weiß es nicht mehr.«
Cathe stutzte, es klang wie ein Ausweichen. Verbarg sie etwas? Oder hatte Samoth sie mit Lügen verwirrt? Was hatte sie hier allein erlebt? Stundenlang musste sie in ständiger Angst vor dem Drachen in ihrem Versteck ausgeharrt haben. Würde es Cathe auch einmal so ergehen?
Auch über Herrn Lanzifals Gesicht huschte eine Schatten von Misstrauen, aber gleich darauf lächelte er wieder. »Das soll uns jetzt egal sein, Hauptsache, du bist entkommen und unversehrt. Was für ein Glück! Alles andere bereden wir morgen. Leg dich hin.« Und er bot ihr seinen Lagerplatz an.
»Sollte nicht eher ich …?«, fing Cathe an, aber er fuhr ihr über den Mund. »Nichts da. Ich bin ein Ritter, ich kann auch ohne Decke schlafen.«
Und das konnte er. Nach fünf Minuten erklang sein vertrautes Schnarchen.
Aphrodena schnarchte auch.
Donnerkugel seufzte laut.
Cathe schmunzelte, und darüber schlief sie trotz allem endlich ein.
Die Rückkehr nach Kloster Felsenrot war ein einziger Triumph. Sie kehrten unversehrt heim, hatten die geraubte Jungfrau gerettet und einen verfluchten Drachen befreit, der von der Schnauze bis zur Schwanzspitze ordentliche acht Schritt maß. Herr Lanzifal winkte den jubelnden Jungfrauen und Schülerinnen huldvoll zu, Cathe hob die Hand nur schüchtern. Doch die meisten ihrer Mitschülerinnen sahen auch bewundernd zu ihr, und Sinje jubelte lauthals und schrie: »Cathe!«
Cathe winkte ab, und als Herr Lanzifal Cathe ausufernd für ihre Unerschrockenheit, ihre Geistesgegenwart und ihren Mut lobte, da lief sie sogar rot an. Ihre Lehrerinnen strahlten, und nun applaudierten ihr alle angehenden Jungfrauen, Kanja und Celi allerdings mit einem gezwungenen Lächeln.
Das anschließende Mittagessen wurde zu einer ausgelassenen Feier, und die ersten Unterrichtsstunden des Nachmittags fielen deswegen aus. Jetzt lächelten auch Kanja und Celi aufrichtig.
Als Cathe mit Sinje nach dem Essen im Innenhof in der Sonne stand, um ihr all das zu erzählen, was sie vor der ganzen Gruppe ausgespart hatte, kam die Glasmeistertochter Kanja sogar herüber und gratulierte strahlend. Dann fragte sie im vertraulichsten Ton: »Was hast du nur getan, um den Ritter so zu beeindrucken? Der ist ja ganz begeistert von dir.«
»Ach, nichts Besonderes. Ich habe nur den Drachen abgelenkt«, sagte Cathe leichthin. Von dem Malheur mit dem Helm durfte sie ja nicht erzählen. Weil das aber irgendwie angeberisch klang und Kanja extra zu ihr herübergekommen war, wollte sie unbedingt noch etwas Nettes sagen. »Das hättest du bestimmt mindestens genauso geschafft.«