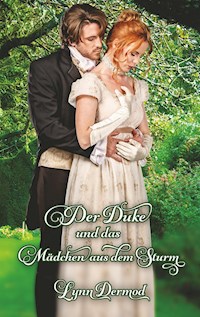
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem Gewittersturm kreuzen sich die Wege von Catherine O' Reiley und Robert Leighton, dem neuen Duke of Harrisford. Sie retten sich in ein Cottage und Robert beschließt aus einem Impuls heraus, ihr seinen Titel zu verschweigen und die letzten unbeschwerten Stunden zu genießen, bevor er sich seinem neuen Leben in London stellen muss. Als Robert schließlich aufbricht, deutet nichts darauf hin, dass sie sich je wiedersehen werden. Doch das Schicksal führt die beiden in London wieder zusammen, aber als Catherine erfährt, dass Robert den Titel eines Dukes führt, wendet sie sich enttäuscht von ihm ab, obwohl Robert sie bittet, ihn zu heiraten. Aber Catherines Vergangenheit lässt nicht zu, dass sie einem Adeligen vertraut. Als Catherine nach einem Verbrechen an ihrem Onkel entführt wird, muss sie sich ihrer Vergangenheit stellen und kann endlich ihre Liebe zu Robert zulassen. Ihr gelingt die Flucht, aber zurück in London erfährt sie, dass Robert inzwischen gezwungen wurde, in wenigen Tagen ihre Cousine Georgina zu heiraten. Catherine weiß, dass sie diese Hochzeit verhindern muss, wollen sie und Robert jemals glücklich werden. Hilfe findet sie bei Lady Annabel, Roberts Schwester, die diese Hochzeit ebenfalls zu verhindern versucht. Als beide endlich einen Weg gefunden haben, steht Robert bereits vor dem Altar ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Stamford Hall, acht Jahre später
Stadthaus der Duchess und des Dukes of Harrisford, vier Monate später
Catherine öffnete leise die Tür zu den Stallungen, in denen ihr Onkel seine Pferde untergebracht hatte. Der Boden war blitzblank, die Heuraufen gut gefüllt und nur das zufriedene Schnauben der Pferde und das beruhigende Mahlen ihrer Kiefer war zu hören.
Catherine liebte diesen Ort, der ihr mehr Zuhause war als die prachtvoll ausgestatteten Räume von Stamford Hall, dem Landsitz ihres Onkels. Sie zog eine verschrumpelte Karotte aus ihrer Rocktasche und hielt sie einem feingliedrigen Schimmel hin.
„Na, Cloud, wie geht es dir heute?“ Vorsichtig schnupperte das Tier an der Leckerei und nahm sie dann behutsam mit seinem samtenen Maul aus ihrer Hand. Während der mächtige Hengst genüsslich kaute, kraulte Catherine ihm die Mähne. „Leider ist hier heute eine Menge los. Wir können erst wieder ausreiten, wenn der Viscount und Lady Maude nicht mehr hier sind.“ Seufzend öffnete sie die Boxentür und schlüpfte zu ihrem Liebling in den Verschlag. Ihr Onkel und seine Gattin gaben heute das große alljährliche Gartenfest auf Stamford Hall und die sogenannte „bessere Gesellschaft“ ließ es sich nicht nehmen, der Einladung des Viscounts aufs Land zu folgen.
Catherine war erst seit einigen Monaten hier auf Stamford Hall, ihr Onkel hatte sie nach dem Tod ihrer Mutter zu sich genommen, und es war ihr erstes Gartenfest, das sie hier erlebte. Wobei sich das Erlebnis darauf beschränkte, die vornehmen Gäste in ihren Kutschen und mit ihren prachtvollen Kleidern nur aus der Ferne ansehen zu dürfen! Ihr Onkel hatte ihr eingeschärft, dass sie unsichtbar zu sein hatte, wenn die illusteren Gäste kamen. Zu sehr würde ihre Anwesenheit die Herrschaften des Tons belästigen.
Schließlich hatte ihre Mutter, die Tochter eines Viscounts!, die Familie entehrt, indem sie einen irischen Einwandere geheiratet hatte, der sich noch dazu als unverbesserlicher Spieler und eifriger Bordellbesucher entpuppt hatte. Und der wegen dieser Laster sein Hab und Gut verloren und das Ansehen der Familie noch tiefer in den Schmutz gezogen hatte. So jedenfalls hatte ihr Onkel es dargestellt, und als Catherine einmal gewagt hatte, ihm zu widersprechen und ihren Vater vor diesen Anschuldigungen zu verteidigen, hatte der Viscount sie grün und blau geschlagen.
Mit ihren dreizehn Jahren hatte Catherine schmerzhaft gelernt, dass niemand an der Wahrheit interessiert war, schon gar nicht der Mann, der ihr zwar ein Dach über dem Kopf gab, sie aber darüber hinaus im besten Fall ignorierte. Jedenfalls solange sie das tat, was er vorgab: unsichtbar zu sein und den zu Mund halten.
Sie strich sich eine verirrte Strähne hinter das Ohr und legte den Kopf an Clouds warme Schulter. Ganz hinten im Stall hörte sie jetzt die Stallburschen hereinkommen, lachend und feixend. Schnell schlüpfte sie aus der Box und ging zur Tür. Sie wollte die Männer nicht in Verlegenheit bringen, denn natürlich durfte sie nicht hier sein, jedenfalls nicht, wenn ihr Onkel anwesend war. Und ganz sicher würde er die Männer bestrafen, wenn sie Catherine erlaubten, bei den Pferden zu sein.
Einen kurzen Augenblick blendete die gleißende Sonne sie als sie hinaustrat, und so sah sie das Unheil nicht gleich kommen. Noch während sie blinzelte hörte sie ihren Onkel sagen: „Aber natürlich, Lady Manderly, dürfen Sie meine Pferde sehen! Ich versichere Ihnen, es gibt in ganz England keine vergleichbaren Vollblüter!“
Catherines Nackenhaare stellten sich auf als sie bemerkte, dass ihr Onkel und diese fremde Frau zusammen mit noch einigen anderen Gästen auf sie zukam.
Sie presste sich an die Stalltür, in der vergeblichen Hoffnung, unsichtbar zu werden.
„Lord Alverstone, ich wusste ja gar nicht, dass Sie auch Mädchen in Ihren Ställen beschäftigen! Kann sie denn so gut mit Ihren Hengsten umgehen?“, rief ein gesetzter Herr mittleren Alters, vornehm in einen maßgeschneiderten Anzug gehüllt, als er sie entdeckte.
Anzügliches Kichern und Hüsteln folgte dieser zweideutigen Bemerkung und während Catherine bis über beide Ohren rot wurde, musterten die anwesenden Herren sie neugierig.
„Wer bist du denn, mein Mädchen?“, flötete in diesem Augenblick auch schon eine ältere Dame in einem üppig mit Rüschen verzierten, leichten Tageskleid aus himmelblauer Seide.
Catherine versuchte sich zu konzentrieren, konnte aber angesichts des wutverzerrten Gesichts ihres Onkels keinen klaren Gedanken fassen. Himmel! Er würde sie für diese Unachtsamkeit bestrafen! Nie hätte sie gedacht, dass er mit seinen Gästen den auf der Vorderseite des Anwesens gelegenen Garten, der für das Fest wunderschön mit Laternen, bunten Bändern in Büschen und Bäumen, und langen Tafeln mit weißen Tischtüchern geschmückt war, verlassen und zu den Stallungen kommen würde!
„Nun?“ Die Frau sah sie auffordernd an.
Was hatte sie noch gefragt? Ach ja, ihr Name.
„Ich bin...ich heiße Catherine. Catherine O' Reiley.“, stammelte sie, aber ein Blick in das aschfahle Gesicht ihres Onkels ließ sie erstarren. Ein Fehler! Ein fataler Fehler war ihr unterlaufen, das bemerkte sie in dem Augenblick, als sie ihren Namen genannt hatte. Ihren richtigen Namen! Lord Alverstone hatte sie angewiesen, nie - niemals! - ihren Namen zu nennen, wenn sie gefragt würde. Zu sehr klebte der Ruf ihres Vaters daran, der Ruf eines betrügerischen Selbstmörders, der jeden in Verruf brachte, der mit ihm bekannt war! Und er wollte nicht, dass sich jemand an den Skandal erinnerte, der damals mit dem Tod ihres Vaters einhergegangen war. Tagelang hatte die Presse alles breit getreten, die unstandesgemäße Heirat ihrer Mutter mit einem Niemand! Und dann der Bankrott ihres Vaters, hervorgerufen durch dessen Spielsucht und seine kostspieligen Besuche in den teuersten Bordellen der Stadt. Um das alles zu finanzieren hatte er das Geld einiger Investoren veruntreut. So jedenfalls war die einhellige Ansicht des Tons, des Adels, der niemanden wie ihren Vater in seinen Reihen duldete!
Am Ende blieb von dem ehemals ehrbaren Namen O'Reiley nichts als Schande! Miss Miller wäre richtig gewesen, so sollte sie sich vorstellen, falls wirklich einmal jemand die Freundlichkeit besitzen würde, sie zu bemerken!
„Und du bist...?“
„Unwichtig, Lady Manderly.“, fiel ihr Onkel der neugierigen Countess ins Wort. Dann wandte er sich den Wartenden zu und rief: „Liebe Freunde! Bitte, ich habe ein neues Pferd von dem ich hoffe, es wird demnächst in Ascot laufen und ein echter Champion werden. Sehen wir uns das Tier doch an.“ Er öffnete die Stalltür und hielt sie für die neugierig Heranströmenden auf. Catherine wollte sich schon in der Hoffnung davonstehlen, noch einmal davon gekommen zu sein, aber der Viscount hielt sie am Arm fest. „Du wartest hier, hast du mich verstanden?“, presste er wutentbrannt heraus und Catherine bekam angesichts des unverhohlenen Hasses in seiner Stimme eine Gänsehaut. Zitternd wartete sie, bis sich die Menge wieder plaudernd und lachend entfernte, denn Flucht wäre keine Option gewesen. Er hätte sie ohnehin gefunden und dann wäre seine Strafe noch viel härter ausgefallen.
Als niemand mehr in Sichtweite war, zerrte Lord Alverstone sie in den Stall, riss ihr Kleid am Rücken auf und griff zu einer an der Wand hängenden Reitgerte.
„Nie... hörst du... nie wieder wirst du vergessen, wie dein Name ist, so lange du hier unter meinem Dach lebst!“, schrie er, außer sich vor Wut.
Ich werde das Kleid nähen müssen, er hat es ruiniert! Dabei habe ich doch nur zwei!, dachte Catherine noch, dann traf sie der erste Hieb.
Stamford Hall, acht Jahre später
Catherine öffnete die marode Tür des Pächterhauses und trat hinaus in den auffrischenden Wind. Sie stellte mit einigem Unbehagen fest, dass die Sonne, die ihren Hinweg noch mit den letzten wärmenden Strahlen des Herbstes begleitet hatte, inzwischen hinter einer dicken Wolkendecke verschwunden war. Sie strich sich eine widerspenstige rotblonde Locke hinters Ohr und atmete tief die frische Luft ein. Der Geruch nach feuchter Erde vertrieb den rauchigen, modrigen Hauch aus ihren Lungen, dem sie in dem zugigen Haus ausgesetzt gewesen war. Es war eine Schande, wie wenig sich ihr Onkel um seine Pächter kümmerte. Das Haus der beiden Alten, die jahrelang unermüdlich die Felder des Landgutes bestellt hatten, bestand aus zwei kleinen Räumen, in denen der Wind durch die kaputten Fenster pfiff und der Putz von den feuchten Wänden blätterte.
Der Rauchabzug war verstopft und das Dach müsste dringend gedeckt werden, aber Edward Sutton, 8.Viscount Alverstone, gab sein Geld lieber für Rennpferde, Glücksspiel und - gezwungenermaßen, um seine Ruhe zu haben - für sündhaft teuren Schmuck und Garderobe für seine Gemahlin aus. Wütend streckte Catherine den Rücken durch und machte sich auf den Heimweg. Sie hatte fast den gesamten Tag damit zugebracht, sich die Sorgen und Nöte der vielen Pächter anzuhören und versucht, die schlimmste Not zu lindern, indem sie Lebensmittel und Holz verteilte, das sie der Köchin abgeschwatzt hatte. Catherine begann zu frösteln und zog den fadenscheinigen Umhang fester um sich. Wie alles, was sie trug, war er ein abgelegtes Stück ihrer inzwischen verheirateten Cousine und da diese bereits seit vier Jahren mit ihrem Gemahl im mondänen London residierte und nur im heißen Sommer zu ihnen aufs Land kam, hatte das Kleidungsstück bereits seine besten Zeiten sowohl modisch als auch qualitativ hinter sich. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte auch Catherine von einem Debüt auf den glamourösen Bällen in London geträumt, mit wunderschönen Kleidern aus Seide und glitzerndem Schmuck. Hatte davon geträumt, strahlender Mittelpunkt der feinen Gesellschaft zu sein, umschwärmt und begehrt von den jungen Männern, die um ihre Hand buhlten. Und aus deren Schar sie sich den Einen erwählen würde, mit dem sie ihr restliches Leben verbringen und an dessen Seite sie glücklich und zufrieden sein würde. Aber das Leben hatte ganz offensichtlich andere Pläne mit ihr gehabt.
Den ersten Schritt in Richtung Realität hatte sie mit dreizehn Jahren machen müssen, als sie ihre Mutter mit verquollenen Augen und heftig schluchzend am Küchentisch ihres kleinen, gemütlichen Häuschens in einem einfachen Wohnviertel in London in Hafennähe vorfand. Hier residierten überwiegend Kaufleute, denn die Nähe zum Hafen und den Handelskontoren war praktisch und man konnte so bis spät in die Nacht hinein arbeiten ohne weitere Wege in Kauf nehmen zu müssen. Denn obwohl es in den vornehmen Wohngegenden des Adels bereits neumodische Gaslaternen gab, die die nächtlichen Straßen erleuchteten, hatte sich diese Neuerung natürlich noch nicht bis in die ärmeren Gegenden dieses geschäftigen Molochs verbreitet. Daher war es nach Einbruch der Dunkelheit nicht ungefährlich, sich ohne Begleitschutz hinauszuwagen. Catherines erster Gedanke war deshalb, dass ihr Vater vielleicht überfallen und beraubt worden war, aber die Realität war ungleich grausamer.
Man hatte ihren Vater an seinem Schreibtisch im Handelskontor seiner Firma vorgefunden, mit der Waffe noch in der Hand, nachdem er sich seinem Leben allem Anschein nach ein Ende gesetzt hatte. Catherine und ihre Mutter hatten keinen einzigen Augenblick an diese Version der offiziellen Untersuchung geglaubt, aber die Umstände ließen in den Augen der Justiz keinen anderen Schluss zu. Man schenkte der Tatsache, dass ihr Vater Linkshänder gewesen war, die Waffe aber in der rechten Hand gehalten hatte, keine Bedeutung, zumal das Büro ihres Vaters augenscheinlich nicht durchwühlt worden war und somit ein Raubüberfall ausgeschlossen schien. Allerdings hatte Catherines Mutter im Nachhinein, als die Räume endlich freigegeben waren, festgestellt, dass es durchaus eine gewisse Unordnung in den ansonsten penibel geführten Papieren ihres Gatten gegeben hatte, auch wenn sie nicht sagen konnte, ob etwas fehlte. Der Tod, noch dazu offiziell der Selbstmord ihres Vaters, hatte nicht nur ihre soziale Ächtung zur Folge, sondern auch, dass ihre Mutter und sie ihr Zuhause und ihr Auskommen verloren. Nach Durchsicht der Unterlagen überstiegen die Verbindlichkeiten die Sachwerte des mit Stahl und Eisenwaren angefüllten Kontors und den Gegenwert gesamten Geschäftes und nach Abwicklung der eingetretenen Insolvenz blieben ihnen gerade einmal hundert Pfund, auf die ein Gläubiger dankenswerter Weise in Kenntnis ihrer Lage verzichtet hatte. Darüber hinaus hatte man offensichtlich Wettscheine und Rechnungen eines stadtbekannten Bordells in beträchtlicher Höhe gefunden, so dass man davon ausging, Catherines Vater habe die Anleger um ihr Geld geprellt, um sich seine lasterhaften Vergnügungen zu finanzieren. Natürlich hatte Leonora O'Reiley keine Erklärung für diese Belege gehabt, die man im Kontor ihres Ehemannes gefunden hatte, aber sie hatte auch nicht einen Augenblick geglaubt, dass ihr Gemahl wettete oder ein Bordell aufsuchte, aber beweisen können hatte sie es natürlich nicht. Das hatte nur noch mehr dazu beigetragen, dass die Gesellschaft sie mied und schlecht über sie redete.
Der Himmel hatte sich weiter verdunkelt und Catherine quittierte die ersten Tropfen mit einem verärgerten Schnauben. Bis sie im Herrenhaus ankäme, wäre sie wahrscheinlich vollkommen durchnässt. Gott sei Dank war ihre Tante mit ihrer Cousine Georgina bereits zur Saison in London, wo ihr Onkel einen Sitz im Parlament hatte und seine Anwesenheit erforderlich war. Darüber hinaus debütierte Georgina, die jüngste Tochter des Viscounts, in diesem Jahr und Tante Maude nutzte die anstehenden Bälle, Soireen und Veranstaltungen bei Almack's um zu klatschen und zu tratschen und ihre neuesten Kleider und Juwelen ihren neidischen Freundinnen zu präsentieren. Und obwohl es eine Zeit gegeben hatte, wo auch Catherine sich ihr Debüt in diesem Kreis gewünscht hätte, war sie doch inzwischen so angewidert von dem ganzen Gehabe, dass sie froh war, nicht daran teilnehmen zu müssen.
Darüber hinaus war die Zeit auf Stamford Hall, dem Landgut des ihres Onkels, ohne die Anwesenheit der Familie eine Zeit der Ruhe und des Friedens und Catherine genoss diese Tage und Wochen viel zu sehr, um sich nach dem geschäftigen Treiben Londons zu sehnen.
London! Sie war dort aufgewachsen, behütet und geliebt von ihren Eltern, und bis zum Tod ihres Vaters war die stets geschäftige, quirlige Metropole ihre Heimat gewesen. Aber mit seinem Tod hatte sich alles verändert.
Leonora O'Reiley hatte die 100 Pfund genommen und war mit ihr auf' s Land nach Watford gezogen, in eine kleine Kate mit einem großen Garten, in dem Obstbäume und duftende Blumen wuchsen, etwa 21 Meilen nordwestlich von London. Sie hatten zurückgezogen gelebt, bis zu dem Tag, der den letzten Rest Unbeschwertheit aus Catherines Persönlichkeit vertrieben hatte, dem Tag, an dem mit ihrer Mutter auch die Hoffnung auf eine behütete Jugend starb.
Catherine nahm nur am Rande wahr, dass sich der Regen inzwischen zu einem regelrechten Unwetter ausgeweitet hatte, mit Blitz und Donner und einem immer heftiger werdenden Sturm, so sehr war sie in den Gedanken an diesen Tag gefangen, den sie nie im Leben vergessen würde.
Ihre Mutter war schon seit einigen Tagen anders gewesen als sonst. Normalerweise war sie eine ausgeglichene, ruhige Frau, die versuchte, sich vor Catherine nicht anmerken zu lassen, wie sehr sie unter dem Tod ihres geliebten Gatten litt. Aber seit einigen Tagen meinte Catherine, eine unterschwellige Aufgeregtheit zu spüren, fast erschien es ihr, als sei ihre Mutter euphorisch. Ihre Mutter war in der Vergangenheit einige Male nach London gefahren und hatte Catherine in der Obhut des alten Pfarrehepaares zurückgelassen, von denen sie nicht nur das Haus gemietet, sondern auch mit der Zeit so etwas wie eine Freundschaft aufgebaut hatte. Zunächst hatte Catherine geargwöhnt, ihre Mutter hätte vielleicht wieder einen Mann kennengelernt, aber das erschien ihr nur knapp ein Jahr nach dem Tod ihres Vater und angesichts der immer noch tiefen Traurigkeit ihrer Mutter dann doch zu abwegig. Sie hatte ihre Mutter einmal nach dem Grund für diese Besuche in London gefragt, aber Leonora hatte ihr nur geantwortet, es sei noch nicht die Zeit, darüber zu reden. Dann, einen Tag vor dem Tod ihrer Mutter, hatte sie einen fremden Mann aus der Tür ihres Zuhauses treten sehen, der sich verstohlen umsah, bevor er, den Hut tief in die Stirn ziehend, in eine bereitstehende Droschke gestiegen war und die staubige Straße Richtung London eingeschlagen hatte.
Ihre Mutter war an diesem Abend ganz aufgeregt gewesen und hatte einen triumphierenden Glanz in ihren blauen Augen gehabt. „Cat, ich fahre morgen nach London. Ich kann jetzt beweisen, dass dein Vater sich nicht umgebracht hat sondern ermordet wurde!“
Dann hatten sie sich in die Arme genommen und so fest gehalten, als wenn sie sich nie wieder loslassen wollten. Catherine hatte versucht, mehr darüber zu erfahren, welche Beweise ihre Mutter hatte und wer ihren Vater getötet hatte, aber dazu schwieg Leonora O'Reiley standhaft. „Ich erzähle dir alles, wenn die Person zur Rechenschaft gezogen wurde. Je weniger du bis dahin weißt, desto sicherer ist es für dich.“
Schließlich hatte Catherine nicht weiter gefragt, wichtig war nur, dass sie und ihre Mutter immer Recht behalten hatten: Der Tod des Vaters war kein Selbstmord! Und auch wenn es an ihrer schwierigen finanziellen und gesellschaftlichen Position nichts ändern würde, so waren sie es doch dem Gatten und Vater schuldig, ihn von dem Makel der Selbsttötung reinzuwaschen!
Catherine hatte sich schließlich gewaschen und bettfertig gemacht, war aber, um ihrer Mutter eine gute Nacht zu wünschen, noch einmal in die Küche gekommen, wo ihre Mutter an dem sauber geputzten Holztisch saß und in das erlöschende Feuer des Herdes starrte. Sie hatte mit dem Rücken zur Tür gesessen, und ihre zuckenden Schultern hatten verraten, dass sie weinte. Noch bevor Catherine sich bemerkbar machen konnte, war die Mutter aufgestanden, hatte mit der Faust auf den Tisch geschlagen und mit einer Stimme, die Catherine das Blut in den Adern gefrieren ließ, gezischt:
„Das wirst du mir büßen. Alles, alles was du uns angetan hast, werde ich dir heimzahlen!“
Es verwunderte Catherine noch heute, wie genau sie sich an diese letzten Stunden mit ihrer Mutter erinnern konnte, wie sich ihr jedes Detail eingeprägt hatte: der vergessene Topf mit dem sämigen Eintopf aus Karotten und Kartoffeln auf dem Herd, dessen Inhalt angesetzt hatte und nun einen verbrannten Geruch durch die Küche schickte, das Geschirr vom Abendessen, das in einer Schüssel darauf wartete, abgewaschen zu werden, die eine widerspenstige Locke, die sich aus den ansonsten immer perfekt aufgesteckten Haaren ihrer Mutter gelöst hatte und ihr nun unbeachtet und störend ins Gesicht fiel. Aber am einprägsamsten war der Blick ihrer Mutter gewesen, als sie Catherine in der Tür entdeckt hatte. Für einen kurzen Augenblick hatte Catherine Hass und Triumph, Zufriedenheit und Unglauben in den blauen Tiefen erkennen können, bevor ihre Mutter die Augen geschlossen und den Kopf geschüttelt hatte, so, als wolle sie die Gespenster dieser aufwühlenden Entdeckung vertreiben. Als sie Catherine kurz darauf erneut in die Arme genommen hatte, stand nichts anderes als Liebe und Zuneigung in ihrem Blick und Catherine hatte den Schauer, den sie bei dem Anblick ihrer aufgelösten Mutter empfunden hatte, schnell abgeschüttelt. Allerdings nur bis zum Mittag des nächsten Tages, als ein Constabler an die Tür geklopft und der entsetzen Misses Brown, bei der Catherine die Zeit bis zur Rückkehr der Mutter verbringen sollte, erklärt hatte, dass die Kutsche, mit der Leonora O'Reiley unterwegs gewesen war, einen Unfall gehabt und ihre Mutter diesen leider nicht überlebt hatte.
Kälte. Und Schwärze. Schmerzlich erinnerte sich Catherine an diese beiden Gefühle, die sie in diesem Augenblick, der ihr Leben ein weiteres Mal nachhaltig verändern sollte, erfasst hatten. Und Wut. Und Trauer.
Ihre warmherzige, sie vor allem Bösen beschützende und immer tröstende Mutter war tot. Sinnlos, grausam hatte das Schicksal ein weiteres Mal in Catherines Leben eingegriffen. Die folgenden Tage und Wochen - oder waren es Monate gewesen? - hatte Catherine wie durch einen nebligen Schleier erlebt. Die Beerdigung ihrer Mutter auf dem Dorffriedhof, am frischen Grab nur sie und die beiden alten Pfarrersleute. Niemand trauerte um die schöne, einstmals begehrte Tochter eines angesehenen Viscounts, die sich durch ihre unstandesgemäße Heirat mit einem irischen Einwanderer und Glücksritter selbst aus den anerkannten Adelskreisen ausgeschlossen hatte. Der versnobte Adel hatte es ihrer Mutter nie verziehen, dass sie sich derart erniedrigt hatte und sie und ihren Gatten nicht nur geschnitten, sondern auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit verunglimpft.
Irgendwann hatte dann ihr Onkel vor der Tür gestanden, ein herrisch aussehender Mann in den Vierzigern, mit leichtem Bauchansatz und bereits schütterem Haar und hatte sie mitgenommen. Und seit dieser Zeit vor ziemlich genau acht Jahren lebte sie im Haus ihres Onkels, des Viscounts Alverstone, aber statt eines Zuhauses bot man ihr dort nur einen Schlafplatz und Essen. Niemals war sich Catherine so ungeliebt und unerwünscht vorgekommen wie seit der Zeit, da man sie nach Stamford Hall gebracht hatte. Sie hatte keine Erklärung, warum ihr Onkel sie zu sich geholt hatte, wenn er sie doch als unzumutbare Belastung empfand, was er ihr bei jeder sich bietenden Gelegenheit vorhielt. Catherine hatte ihren Onkel als einen Mann kennengelernt, der nichts ohne Berechnung tat, aber im Hinblick auf ihre Person gaben ihr seine Beweggründe Rätsel auf.
Sie war nun einundzwanzig, in knapp zwei Monaten würde sie zweiundzwanzig, und lebte zwischen den Welten. Für ihren Onkel und seine Familie war sie Abschaum, das sichtbare Ergebnis einer Mesalliance ihrer Mutter. Für das Gesinde aber, von denen die meisten ihre Mutter noch gekannt hatten, gehörte sie unumstößlich zur Herrschaft. Sie behandelten sie stets höflich und mit Respekt. Erst recht seit sie begonnen hatte, sich heimlich um die Belange der Angestellten und Pächter zu kümmern, eine Aufgabe, die ihr Onkel sträflich vernachlässigte, obwohl gerade diese Menschen dafür sorgten, dass er seinem ausschweifenden Lebensstil ungestört frönen konnte.
Natürlich durfte ihr Onkel nicht erfahren, dass sie sich derart in seine Belange einmischte, sonst würde er sie spüren lassen, dass er allein das Sagen hatte.
Bei diesen Erinnerungen begann Catherines vernarbte rechte Hand zu schmerzen. Die Brandnarben vertrugen die Feuchte des Regens nicht und sie hatte vergessen, die Lederhandschuhe überzustreifen, die sie sonst immer als Schutz trug. Das Unwetter war nun so schlimm, dass Catherine kaum noch den Weg vor sich erkennen konnte. Der Regen peitschte ihr ins Gesicht und ließ die Konturen der Landschaf vor ihren Augen verschwimmen. So bemerkte sie die Unebenheit im Boden nicht und der Schmerz, der ihren Knöchel durchzuckte, als sie in dem Hasenbau umknickte, ließ es kurz schwarz vor ihren Augen werden. Das verminderte die Reaktionszeit, die sie gebraucht hätte, um sich vor der Gefahr des herabstürzenden Baumes zu retten, der genau in diesem Augenblick der Gewalt des Sturmes nachgab und mit einem bedrohlichen Knacken und Rauschen auf sie herabstürzte.
Robert Leighton, 10. Duke of Harrisford, sah ein, dass er den Naturgewalten nicht länger trotzen konnte, wollte er nicht riskieren, dass sich sein Pferd in einem Hasenbau den Fuß vertrat oder sogar die Fessel brach.
Er hatte die Warnungen seines Verwalters nicht ernst genommen, als dieser ihm riet, noch eine weitere Nacht auf seinem Landgut Oakwood Manor zu verbringen, weil die ersten Anzeichen eines Unwetters heranzogen.
Offensichtlich hatte er während seiner beinahe achtjährigen Abwesenheit aus England verlernt, das wechselhafte Wetter in diesem Land richtig einzuschätzen. Das Wetter auf Barbados, wo er die letzten Jahre gelebt und sich einen florierenden Zuckerrohrhandel aufgebaut hatte, war weniger sprunghaft. Abgesehen von der Regenzeit und einigen Stürmen hin und wieder war es ganzjährig warm und trocken. Was man von England nicht behaupten konnte!
Ein lautes Krachen ließ ihn zusammenfahren und er hatte alle Mühe, sein erschrockenes Pferd zu zügeln.
Nein, so konnte er nicht weiter reiten!
Wütend auf sich selber, weil er den gut gemeinten Rat seines Verwalters in den Wind geschlagen hatte und nun völlig durchnässt einen Unterstand für sich und sein Pferd suchen musste, zügelte er den Braunen und versuchte, in dem tobenden Sturm etwas zu erkennen.
Ein Baum war umgestürzt und versperrte ihm den weiteren Weg, so dass er den Braunen darum herum lenken musste. Im Vorbeireiten erregte eine Bewegung seine Aufmerksamkeit und als er näher kam, erkannte er, dass unter der Krone des Baumes ein Mensch eingeklemmt war und sich zu befreien versuchte.
Bevor er noch absteigen und nachsehen konnte, was es war, kämpfte sich schon unter lästerlichem Fluchen und Schimpfen eine Frau unter dem Blätterwerk hervor. Ihr langes, bernsteinfarbenes Haar hatte sich in dem Geäst verfangen und als sie es endlich befreit hatte, hing es ihr zerzaust und wirr um das Gesicht. Wie er selbst war sie vollkommen durchnässt und ihr Anblick erinnerte ihn augenblicklich an eine Katze, die man in einen Teich geworfen hatte und die nun, fauchend und katzbuckelnd versuchte, diesem zu entkommen.
Offensichtlich nahm man in diesem Teil Englands, im Gegensatz zu dem allzeit steifen und von kühler Zurückhaltung geprägten London, kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, seinem Ärger Luft zu machen! Während er abstieg, um der jungen Frau zu helfen, kam er nicht umhin, ihr Repertoire an Kraftausdrücken zu bewundern und beschloss, sich einige davon zu merken, jedenfalls die, die er über den brausenden Sturm verstehen konnte. Nicht, dass er als Duke, nur einen Rang unter dem Königshaus stehend, Gelegenheit gehabt hätte, sie jemals zu benutzen.
Zumindest nicht, wenn er sich nicht den Unmut des Tons in London zuziehen wollte, der untadeliges Benehmen und korrekte Umgangsformen über alles stellte. Allerdings, wenn er es genau betrachtete, war es ihm vollkommen egal, was die sogenannte „gute Gesellschaft“ von ihm dachte. Spätestens wenn bekannt würde, dass er eines der größten Handelsgeschäfte mit Zuckerrohr aufgezogen hatte, wäre er für den Tonohnehin erledigt. Zwar würde ihn der Titel eines Dukes vor öffentlichen Anfeindungen bewahren - mit einem Duke verscherzte man es sich nicht! - aber hinter vorgehaltener Hand würde man kein gutes Haar an ihm lassen. Dass er als drittgeborener Sohn seines Vaters niemals damit gerechnet hatte, jemals diesen Titel zu tragen und auch nicht dafür erzogen worden war, würde man nicht als Rechtfertigung gelten lassen. Und dennoch: Die bigotten Adeligen würden ihm, wenn erst bekannt würde, dass er wieder im Land war, ihre debütierenden Töchter anpreisen, Mütter würden ihn zu Soireen einladen, um ihn für ihre Töchter einzufangen und die Mätressen würden Schlange stehen, um von ihm ausgewählt zu werden. Der Titel eines Dukes öffnete ihm die Türen zur Gesellschaft, die ihm als Robert Leighton verschlossen gewesen wären. Dass er keinen Wert auf eine Ehefrau legte, um den Bestand der Familie zu sichern und den Titel zu vererben, und schon gar nicht vor hatte, sich an eine kichernde, nur an Mode und Klatsch interessierte Debütantin zu binden, würde schon noch früh genug die Runde machen.
Einzig das Interesse der geneigten Damen, die bereit wären, seine Mätresse zu werden, würde er nicht ausschlagen!
Der Sturm peitschte ihm die Äste ins Gesicht, bevor er sie zurückbiegen und der jungen Frau so den Weg aus dem Gestrüpp erleichtern konnte, aber er kämpfte sich tapfer vor, bis sie schließlich keuchend vor ihm stand.
Der Wind zerrte an ihren Haaren und sie sah aus, wie die Gallionsfigur des Schiffes, das ihn hergebracht hatte, nachdem er vom Unfall seines zweitältesten Bruders erfahren hatte. Der Unfall, der seinem Bruder den Tod und ihm diesen verhassten Titel eingebracht hatte. Und nun stand diese Frau vor ihm, durchnässt und zitternd, und in ihrer Natürlichkeit schöner als die meisten Frauen, die er jemals in den Salons der Gesellschaft gesehen hatte. Ihre leuchtend blauen Augen erinnerten ihn an das tiefblaue Wasser der Karibik. Im Gegensatz zu der Blässe ihres Gesichtes leuchteten ihre Lippen in einem verführerischen Rot, das durch die herabperlende Nässe des Regens, der sie benetzte, seinen Blick magisch anzog. Hohe Wangenknochen und eine gerade, zierliche Nase ließen ihr Gesicht fast so perfekt erscheinen wie eine dieser römischen Büsten, die im Garten seines Anwesens standen, nur ein paar Sommersprossen auf ihrer Nase störten diesen Eindruck der Perfektion ein klein wenig, was sie in seinen Augen allerdings nur noch anziehender machte. Er musste sich räuspern, als er sich ihres erschrockenen Blickes bewusst wurde, denn selbst in dem tosenden Unwetter hatte er kurzfristig alles um sich herum vergessen, so fixiert war er auf die fluchende und zerzauste Schönheit gewesen.
„Geht es Ihnen gut? Sind Sie verletzt?“, fragte er gegen den Sturm an, aber der Wind riss ihm die Worte von den Lippen. Auch ihre Antwort, falls es denn eine gewesen war, konnte er nicht verstehen, aber als sie sich zum Gehen wandte, bemerkte er, wie sie zusammenzuckte und innehielt. Sofort war er bei ihr und hielt sie am Arm fest, aber sie entwand sich ihm und machte einen weiteren vorsichtigen Schritt. Aber auch dieser Versuch, ihren Weg fortzusetzen, scheiterte an den offensichtlichen Schmerzen, die sie hatte. Das wechselnde Mienenspiel auf ihrem Gesicht offenbarte den inneren Kampf, den sie mit sich ausfocht, aber dann legte sie die Hände an den Mund und rief ihm zu:
„Also gut, helfen Sie mir. Ich bin umgeknickt und kann wohl keinen Schritt gehen. Ich kenne ein verlassenes Haus gleich hinter der Wegbiegung dort, da finden wir Schutz vor dem Regen.“ Verdutzt stellte er fest, dass sie ihn auffordernd anblinzelte und offenbar darauf wartete, dass er sie trug oder auf sein Pferd setzte. Ihre Entschlossenheit gefiel ihm, wenngleich es ihm auch zeigte, dass sie völlig naiv war und die Gefahr, die von einem Fremden wie ihm ausgehen konnte, gänzlich falsch einschätzte.
Oder vielleicht doch - ganz im Gegenteil - ihre Situation ausnutzen wollte, um ihm näher zu kommen?
Schließlich hatte kaum eine Frau, die er bislang kennengelernt hatte, hatte ihn zurückgewiesen, sobald er sein Interesse bekundet hatte, sie in sein Bett zu bekommen. Ärgerlich schüttelte er den Kopf, denn offensichtlich hatte die Vorsicht, zu der er sich in London im Umgang mit Frauen genötigt sehen würde, seinen Geist völlig vernebelt. Dies hier war das platte Land, die Frau vor ihm keine Adelige, wie er an ihren fadenscheinigen Kleidern auf den ersten Blick erkannt hatte. Und selbst wenn er mit ihr gesehen werden würde, müsste er sie nicht gleich heiraten, so wie es der Ton in London verlangen würde, wenn er sich in eine ähnliche Situation mit einer unbescholtenen Debütantin begeben würde.
„Was jetzt? Warten wir den nächsten Baum ab, den der Blitz fällt, oder könnten Sie sich herablassen, mir zu helfen?“, fauchte sie gegen den Sturm. „Nicht, dass ich nicht noch nasser werden könnte, als ich schon bin, aber das Gewitter und der Sturm sind nicht ungefährlich und ich würde es vorziehen, das Ende des Unwetters in sicheren vier Wänden abzuwarten!“
Himmel! Ihre Augen sprühten Funken und er kam sich vor wie ein kleiner Junge unter der Strafpredigt seiner Mutter. Aber dann riss er sich von ihrem entzückenden Anblick los, griff sie um die Taille und hob sie auf sein Pferd. Wie redete diese Frau bloß mit ihm?! Er war ein Duke und sie offensichtlich nichts weiter als eine Bedienstete, wenn er ihre Aufmachung bedachte.
Vielleicht eine Gesellschafterin oder Gouvernante? Ein Grinsen stahl sich auf sein Gesicht als er sich vorstellte, was die hochwohlgeborenen Töchter der Gesellschaft alles bei ihr lernen könnten! Und im Stillen genoss er ihre unverblümte Art, ihm die Meinung zu sagen. Wenn er erst in London wäre, wäre ihm diese Offenheit nicht mehr vergönnt. Dann müsste er sich mit speichelleckenden Emporkömmlingen abgeben, die die Bekanntschaft mit ihm als Duke of Harrisford als Sprungbrett für ihre eigene Karriere benutzen wollten.
Er würde sich falschen Komplimenten gegenüber sehen, die weniger ihm als seinem Titel galten und er würde sich der geifernden Mütter und Debütantinnen erwehren müssen, die ihm Honig um den nicht vorhandenen Bart schmieren würden, um ihn zur Heirat zu bewegen. Ebenfalls nicht wegen seiner Person oder seines Charakters, sondern wiederum nur wegen seines Titels. In diesem Augenblick beschloss er, dass er für heute nur Robert Leighton sein würde, nicht der Duke of Harrisford, und dass er die letzten unbeschwerten Stunden seines Lebens ohne den Druck, dem ehrwürdigen Titel gerecht zu werden, genießen würde!
Lord Edward Alverstone saß in einem gepolsterten Sessel am Schreibtisch seines in die Jahre gekommenen Stadthauses in Mayfair und beobachtete die Regentropfen, die unaufhörlich am Fenster seines Schreibzimmers hinabrannen. In der Hand hielt er ein halbleeres Glas Brandy , das er verdrossen hin und her drehte. Wie hatte ihm das nur passieren können? Er war sich so sicher gewesen, dass der größere Regentropfen schneller das Fensterbrett erreichen würde als der kleinere! 3000 Pfund hatte er in seinem elitären Club „White's“ darauf gesetzt. Und verloren. Entgegen aller Gesetze der Physik hatte der kleinere Tropfen das Rennen gemacht und er war nun um diese horrende Summer ärmer. Es wurde Zeit, dass er zu Geld kam.
Seine Gattin gab gerade in diesem Augenblick wahrscheinlich eine Summe im Gegenwert eines guten Rennpferdes in dem Salon einer angesagten Modistin für die neuesten Kreationen aus Frankreich aus und so langsam gingen ihm die Geldmittel aus! Sein Landgut Stamford Hall warf schon lange keine großen Erträge mehr ab, aber anstatt die Pächter zu mehr Einsatz aufzufordern, faselte sein Verwalter immer nur etwas von Investitionen. Investitionen! Pah! Er war niemand, der investierte. Geld hatte da zu sein, wenn er es brauchte, egal, woher es kam. Und Investitionen kosteten Geld. Geld, das er hier in London dringender brauchte als das verlotterte, faule Geschmeiß auf seinem Landgut. Dann sollten sie eben in verwahrlosten Hütten hausen, wenn sie zu faul waren, ihre Ärsche auf die Felder zu hieven und für ihre Unterkunft und ihr Essen zu arbeiten!
Es wurde Zeit, dass Catherine Geburtstag hatte, ihren zweiundzwanzigsten. Dann endlich würde er in Geld schwimmen, konnte endlich so leben, wie es ihm zustand. Diese dumme, nichtsnutzige Tochter seiner Schwester würde mit ihrem Geburtstag eine reiche - sehr reiche! - Frau sein, jedenfalls, wenn sie nicht vorher heiratete. Aber das mit dem Heiraten hatte er gut unter Kontrolle, er hielt sie völlig abgeschottet auf Stamford Hall. Und der Passus im Testament irgendeiner weit entfernten, verschrobenen Tante sicherte ihr ihr Auskommen unter seinem Dach, jedenfalls bis sie das Erbe angetreten und ihn als Verwalter des Vermögens eingesetzt hatte. Und dann würde er endlich in der obersten Liga des Ton mitspielen können!
Selbstverständlich wusste Catherine nichts von diesem Geldsegen, der sie erwartete, immerhin öffnete er als ihr Vormund ihre Post und kontrollierte ihr Leben. Dass diese weltfremde, verschrobene alte Jungfer von Tante in ihrem Testament verfügt hatte, die Tochter ihrer Lieblingsnichte Leonora sollte an ihrem zweiundzwanzigsten Geburtstag diese ungeheure Summer erben, hatte er als Schlag in sein adeliges Gesicht empfunden. Er war der alleinig Erbberechtigte, seine hurende Schwester hatte in dem Augenblick, als sie mit diesem irischen Hasardeur nach Gretna Green durchgebrannt war und ihn heimlich geheiratet hatte, alle Ansprüche auf irgendein Familienerbe verwirkt!
Noch immer stieß es ihm sauer auf, dass sein seniler Vater ihr nach einiger Zeit vergeben hatte und ihr ein Teil des Familienschmucks hatte zukommen lassen.
Freilich ohne sein Wissen und ohne dass er etwas dagegen hätte unternehmen können. Solange der Alte noch lebte, hatte er gekuscht, aber nun war der Alte tot und verrottete in seinem dunklen Grab während er als Viscount Alverstone seinen Platz in der Gesellschaft eingenommen hatte.
Die schrullige Alte hatte als Zusatz angefügt, dass die gesamte Summe für den Fall, dass Catherine vor ihrem zweiundzwanzigsten Geburtstag versterben würde, einer Wohltätigkeitsorganisation zugute kommen sollte, die sich der Bildung von Frauen aus der Unterschicht verschrieben hatte. Selten hatte er etwas Lächerlicheres gehört, als Geld für Frauenbildung auszugeben. Frauen waren von Natur aus nicht mit dem gleichen Intellekt ausgestattet wie Männer. Ihr Wissen und Können sollte sich auf sticken, nähen und darauf konzentrieren, ihrem Gatten eine gefügige Bettgenossin zu sein und seine Kinder zu gebären. Das war mehr als genug für die hübschen Köpfe der Damen!
Nur noch zwei Monate, dann würde Catherine endlich ihr Erbe antreten. Und sein Plan, an dieses Geld zu kommen, das von Natur aus ihm als Familienoberhaupt zustand, war wirklich gut! Catherine würde ihn als ihren Vermögensverwalter einsetzen, so dass er frei und ohne Einmischung über die Summe verfügen konnte.
Für den Fall, dass sie sich diesem Vorhaben widersetzen würde, hatte er schon einen subtilen Hinweis parat, der sie überzeugen würde. Jedenfalls, wenn sie an ihrem Leben hing. Denn er als ihr einziger Verwandter würde er in dem bedauerlichen Fall ihres Ablebens nach Erbantritt ihr Nachfolger sein! Nicht, dass er gedachte, sich seine adeligen Hände selber schmutzig zu machen, aber er hatte seine Leute, die das für ihn erledigen würden. Um weiter in der Gesellschaft aufzusteigen durfte man keine Skrupel haben. Man musste zu jeder Zeit und mit jedem Mittel die Gelegenheiten ergreifen, wenn sie sich einem boten!
Der Tag hatte angesichts dieser erhebenden Gedanken doch noch etwas Gutes, wenn er auch die Tropfen ans einem Fenster zu hassen begonnen hatte.
Catherine versuchte ihre Gedanken zu ordnen. Wenn nicht ihr Knöchel sie dermaßen im Stich gelassen hätte, hätte sie sich alleine zu dem verfallenen Cottage durchgeschlagen. So aber sah es so aus, als wenn sie diesen Fremden um Hilfe bitten musste, wenn sie nicht in diesem Unwetter noch größeren Schaden als ohnehin schon erleiden wollte. Natürlich war sie sich der Gefahr bewusst, wenn sie sich quasi in die Hände dieses Mannes begab, den sie nicht kannte und der auf eine verwirrende Art gefährlich aussah. Aber sie hatte ohnehin keine Wahl. Wenn er unlautere Absichten hatte, dann würde er sie ohne große Gegenwehr überwältigen können, denn ihr verstauchter Knöchel würde einen Fluchtversuch im Keim ersticken.
Er war groß und soviel sie im diffusen Licht des sich austobenden Unwetters erkennen konnte, auch muskulös. Seine dunklen Haare hingen ihm wirr ins Gesicht, was ihm ein verwegenes Aussehen verlieh.
Sein Gesicht war mit Abstand das attraktivste, das sie je gesehen hatte, wenn sie auch nicht genau wusste, ob das ein Kompliment war, denn sie kannte außerhalb der Bediensteten des Gutes nur wenige Menschen. Der kräftige Griff um ihre Taille als er sie auf sein Pferd hob, verriet ihr, dass er körperliche Arbeit gewohnt war.
Also ergab sich Catherine in ihr Schicksal. In dem Cottage hatte sie wenigstens eine alte Duellpistole, die sie einem Pächter abgeschwatzt hatte, quasi als Gegenleistung für ein Brot und etwas Fleisch. Nicht mehr als Fett und Sehnen hatte sie aus der Küche entwenden können, aber das wurde immerhin nicht vermisst und für die Pächterfamilie war es ein





























